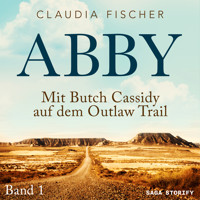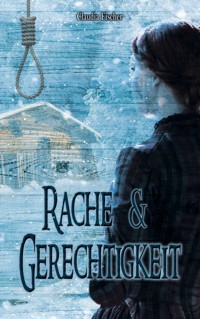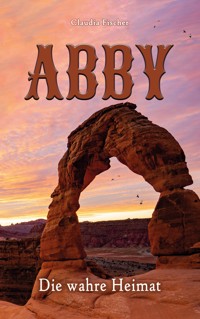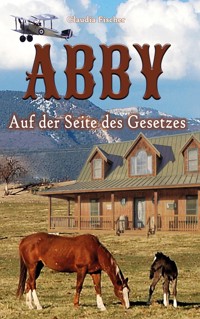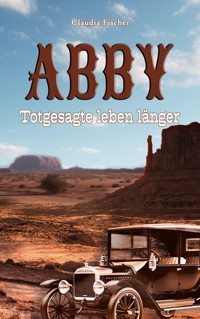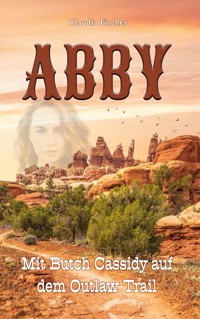Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Das amerikanische Kind
- Sprache: Deutsch
Du hast eine Kette, sie wird dich beschützen. Du musst sie tragen. Immer. Bis der Kreis sich schließt. 1863 überlebt die achtjährige Jacqueline Bianchet als einziges Mitglied ihrer Familie einen brutalen Überfall. Die Mörder prägen sich in ihr Gedächtnis ein und quälen sie fortan in unzähligen Albträumen. Nur Manyeyes, ein Krieger der Cheyenne, kennt Jacquelines Bestimmung und führt sie behutsam an ihre gefährliche Aufgabe heran: die Täter zur Strecke zu bringen. So macht sich die junge Frau nach zehn Jahren auf, ihre Familie zu rächen. Sie weiß, sie ist nur deshalb noch am Leben und muss den Kreis schließen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchbeschreibung:
Als Kind bekommt Jacqueline Bianchet von einem Apachen eine blaue Kette geschenkt. Sie ahnt nicht, welche Bedeutung diese Kette für ihr Leben haben wird, denn sie wird zur einzigen Verbindung mit ihrer Familie, die bei einem Überfall getötet wurde.
Auf der Suche nach den Mördern erfährt sie, dass einem im Leben manche Dinge begegnen, die man nicht erwartet hatte und die sich dann doch als gut erweisen, und so kann sie sich allen Gefahren stellen.
Über die Autorin:
Schon als Kind war Claudia Fischer von Karl Mays Geschichten fasziniert, konnte gut nachvollziehen, wie er nur mit Hilfe der Landkarte durch die weiten Prairien zog und Abenteuer erlebte.
Genau so schrieb sie auch ihre ersten Romane, damals gab es noch kein google maps, nein, allein Bücher, Atlanten und historische Karten beflügelten ihre Fantasie.
Inzwischen ist dank Internet alles leichter geworden und beim amerikanischen Kind wurde Claudia Fischer die genaue historische Recherche zur Pflicht. Natürlich gab es Jacky Hart niemals und auch beinahe alle anderen Personen sind frei erfunden, ebenso die Gouverneurswahl, es fand im beschriebenen Zeitraum keine statt.
Aber die Gesetzeslage, die Eisenbahnstrecken, die Siedlertrecks ... all das erforderte oft langwierige Suchen, die jedoch auch viel Spaß machten.
Als die Autorin das Buch schrieb, war sie noch voll im Berufsleben als Lehrerin tätig. Inzwischen ist sie wegen einer Krankheit frühpensioniert und nun als Lektorin und Organisatorin der Buchmesse LibeRatisbona in Regensburg mit erfüllenden Aufgaben beschäftigt.
Inhaltsverzeichnis
Cheyenne, Wyoming November 1873
Der Treck
Der Überfall
Der Ruf des Adlers
„Frage deine Füße“
Aufbruch nach Leadville
Auf der Suche nach Gold
Die Wahrheit
Die Entscheidung
Wieder in Denver
Die Suche beginnt
Spuren der Vergangenheit
Im Fort Sedgwick
Rubeus Porter
Das Geständnis des Richters
Zurück in Cheyenne
Ritt nach Denver
Tom Boulder
„Er ist Taylor!“
Die Zeugen
Die Gegenüberstellung
Der Gerichtstermin
„Sie sind nicht allein!“
Das Urteil
Der Kreis wird geschlossen
Danksagung
Was dich erwartet, bestimmst du selbst.Manches sucht dich, manches meidet dich,daher wirst du Dingen begegnen,die du nicht willst,die sich dann als gut oder schlecht erweisen.Aber du wirst auch nicht immer finden,was du willst, und das ist vielleicht gut so.Tu was du tun musst,wann immer es an der Zeit ist.
Cheyenne, Wyoming November 1873
Jacky schlich vorsichtig ins obere Stockwerk des Hauses. Ihr Gewehr hatte sie fest in der Hand. Kein Laut ertönte, alles blieb still, totenstill. Sie öffnete eine Tür, sah sich um, niemand war zu sehen, sie war ganz allein.
Die Kälte ließ sie frösteln, aber sie war fest entschlossen, ihre Aufgabe zu erfüllen.
Langsam ging sie zum Fenster und öffnete es einen Spalt. Nun hatte sie einen guten Überblick auf den Eingang des Gebäudes gegenüber. Sie suchte sich einen Stuhl und setzte sich ans Fenster. Eiskalte Luft wehte von draußen herein und sie erschauerte. Ihr Blick fiel auf eine Decke, sie holte sie und hüllte sich darin ein, nun war es besser. Aber ihr Zittern stammte nicht nur von der Kälte.
Langsam hob sie die Waffe und entsicherte sie.
Ja, von hier hatte sie freie Schussbahn und sie würden keine Chance haben. Bald würden sie heraustreten und dann konnte Jacky ihre letzte Möglichkeit nutzen.
Sie musste es tun, es war nun so gekommen und sie wollte nicht länger die Verantwortung auf andere Schultern schieben. Es war ihre Aufgabe und nur sie allein konnte sie erfüllen.
Mit Wehmut dachte sie an ihre Familie, an Suzanne, an ihre Mutter, an ihren Vater, sie dachte an Ben. Es wäre so schön gewesen, mit ihm eine eigene Familie zu haben, es war zu spät. Sie trauerte um alles, was sie in ihrem Leben verloren hatte und nun endgültig verlieren würde.
Bald würde sie mit ihren Lieben vereint sein, dieser Kreis würde sich schließen, es war alles in Ordnung so.
Sie war ganz ruhig.
Gegenüber öffnete sich die Tür. Jacky saß angespannt da und wartete. Leute strömten heraus, sie eilten schnell davon, es war zu kalt, um lange herumzustehen.
Dann kamen sie!
Triumphierend standen sie da, ihren Sieg auskostend.
Plötzlich war Jacky nicht mehr allein.
Hinter ihr befanden sich Suzanne, ihre Eltern und ihre anderen Geschwister.
Jacky war, als hörte sie sie eindringlich flüstern. ‚Tu es!‘
Sie hob das Gewehr, sie hatte sechs Kugeln.
Der erste Schuss löste sich, unten ertönten Schreie und Rufe, der zweite Schuss, der dritte Schuss …
Neben ihr zersplitterte das Fenster. Etwas pfiff ganz nah an ihr vorbei.
Der vierte Schuss …
Sie spürte einen heftigen Schlag an der Schulter und es riss sie nach hinten. Der Schmerz war übermächtig.
Mit aller Macht dachte sie an ihre Familie, doch ihr letzter sehnsüchtiger Gedanke galt Ben, bevor sich die Dunkelheit um sie senkte.
Der Treck
New York 1863
Jacqueline Bianchet war ein echtes Kind Amerikas. Sie war das einzige Mitglied ihrer achtköpfigen Familie, das in der Neuen Welt geboren wurde. Diese Tatsache machte sie von Anfang an zu etwas Besonderem und grenzte sie ab vom Rest ihrer Familie, die nie anders von ihr sprach als vom ‚amerikanischen Kind‘.
Und wie war sie stolz darauf!
Die Bianchets waren 1855 in New York angekommen, ausgewandert aus Frankreich, nachdem etliche Generationen vor ihnen in Armut und Not gelebt hatten.
Jacqueline wurde im selben Jahr in New York geboren und somit zum jüngsten und letzten Kind ihrer großen Familie. Beinahe alle hatten Arbeit während ihrer Zeit in der riesigen Stadt, es war vollkommen normal, dass auch kleinere Kinder Geld verdienten.
Nur die acht Jahre ältere Schwester Suzanne hielt sich zuhause auf, versorgte Jacqueline und kümmerte sich um den Haushalt, daher blieb ihr Suzanne am lebhaftesten im Gedächtnis.
Schmal, hellhäutig und mit langen dunklen Haaren war sie für das kleine Kind der Inbegriff von Schönheit. Suzanne hatte von Anfang an die Mutterrolle bei ihrer jüngeren Schwester übernommen, sie fütterte sie, tröstete sie, wenn sie weinte, und brachte ihr Spiele und sogar das Lesen und Rechnen bei.
Die Mutter selbst hatte so viele andere Aufgaben und sie arbeitete stundenweise in einer Näherei, daher blieb ihr kaum Zeit, sich um ihre Jüngste zu kümmern. Nur in der Nacht durfte Jacqueline in den Armen ihrer Mutter schlafen und genoss Wärme und Geborgenheit.
Wenn Jacqueline nach vielen Jahren die Augen schloss, sah sie manchmal noch die schäbige Zweizimmerwohnung in einem düsteren, schmutzigen Viertel. Sie erinnerte sich an den unebenen, kalten Steinboden, den kleinen Kohleofen als großen Luxus und die Betten, besser gesagt die Matratzen am Boden, auf denen die Familie abwechselnd schlief. Es war ein hartes Leben aber nicht für Jacqueline, die viel zu klein gewesen war, um den Ernst des Lebens zu begreifen.
Die Eltern erzählten Geschichten aus der alten Heimat Frankreich, erzählten von ihren Träumen, die sie sich im Gelobten Land erfüllen wollten, und steckten ihre Kinder an mit ihren Sehnsüchten nach einem großen Haus inmitten von Natur, das ihnen alleine gehören würde, von fruchtbarer Erde und von Vieh. Die ganze Zeit über sparten sie ihr Geld für das gewaltige Abenteuer und schließlich, als Jacqueline acht Jahre alt war, machten sie sich auf in den Westen, in das goldene Kalifornien, das ihnen allen vage als Paradies auf Erden vorschwebte.
Endlich, endlich durfte Jacqueline auch auf die Reise gehen, jedes ihrer Geschwister war schon unterwegs gewesen, alle waren auf einem großen Schiff über den Ozean gefahren. Nur Jacqueline nicht, das amerikanische Kind. Nun wurde auch sie zu einem vollständigen Mitglied ihrer Familie und sie freute sich sehr darüber. Sie konnte es kaum erwarten, dass es endlich losging.
So begaben sich die Bianchets im Frühjahr 1863 nach Westport, dem Tor zum Westen, das heute Kansas City heißt. Dort herrschte ein reges Treiben, Siedler, Pferde, Ochsen, Planwagen so weit das Auge reichte.
Obwohl Jacqueline erst acht Jahre alt war, sollte sie diese Eindrücke ihr Leben lang nicht vergessen. Aufgeregt und neugierig lief sie zwischen all den Gesellschaften herum, schloss Freundschaften, und ein Trapper ließ sie sogar auf seinem Pferd reiten, nachdem sie ihn mit großen dunklen Augen flehend angebettelt hatte. Glückselig saß sie auf dem Rücken des Tieres und Suzanne schlug die Hände über dem Kopf zusammen, als sie ihre kleine Schwester entdeckte. Das gab ein Donnerwetter, wie konnte Jacqueline sich nur so in Gefahr begeben!
Zum Glück verriet Suzanne den Eltern nichts von diesem Abenteuer, der Vater konnte sehr streng sein und auch Suzanne fürchtete sich vor Bestrafung, weil sie nicht genug auf ihre Schwester aufgepasst hatte.
Vor den Männern der indigenen Stämme, die sich unter die weißen Siedler gemischt hatten und Handel trieben, hatte das kleine Mädchen zuerst eine Heidenangst. Sie sprachen nicht viel, ihr Geruch war so fremd und meistens hatten sie ihre Gesichter mit roten und schwarzen Farben bemalt, trugen Hüte und Schmuck. Die Frauen und Mädchen arbeiteten schwer in ihren Zelten, die rund um Westport standen, von ihnen sah Jacqueline nicht viel, aber die Männer und Jungen lungerten herum.
Manche waren völlig dem Alkohol verfallen, sie bettelten oder lagen einfach auf den Wegen, aber andere versuchten, ihre Felle und Fleisch zu verkaufen, und konnten ein wenig Englisch um sich zu verständigen.
Es waren Vertriebene aus mehreren Stämmen, Iowas, Apachen und Comanchen, die man alle ihrer Heimat beraubt hatte und die nun versuchten, mit den Weißen in Frieden zu leben. Ganz im Gegensatz zu den wilden Stämmen, die noch immer die Prärien bewohnten und bei den Weißen Angst und Schrecken verbreiteten.
Die ungebärdige Jacqueline verlor natürlich bald ihre Scheu. Immer wieder entwischte sie der großen Schwester und plauderte mit den Männern, schnappte hie und da ein paar Brocken ihrer Sprache auf und brachte sie zum Lachen, wenn sie sich an diesen ungewohnten Lauten versuchte.
Von einem Apachen bekam sie eine schöne Kette mit blau bemalten Holzperlen, Federn und einem roten Stein in der Mitte eines Netzes aus blauen Fäden.
„Für deine Träume“, erklärte der Apache.
Mit schwarzen Augen musterte er das Kind, reichte ihm die Hände und sagte ein paar Worte in seiner Sprache, die wie ein Segen klangen, wie ihn die überall anwesenden Prediger freigebig erteilten.
„Wird dich schützen, trage Kette immer“, riet er ihr noch. Aber dann ließ er ihre Hände los und zeigte unmissverständlich, dass er etwas dafür haben wollte.
Sie holte schnell eine Dose mit Fleisch aus den Vorräten ihrer Eltern. Eine Dose mehr oder weniger, so vermutete sie, würde nicht auffallen und tatsächlich wurde der Diebstahl nicht entdeckt.
Jacqueline versteckte die Kette zunächst, wenn sie einmal unterwegs waren, würde ihr sie niemand mehr abnehmen oder verlangen, dass sie sie zurückbrachte. Das waren so ihre kleinen Geheimnisse und das schlechte Gewissen wegen der gestohlenen Dose währte nicht lange. Dafür gab es viel zu viel zu tun und zu entdecken.
Jedenfalls war Jacqueline glücklich, jeden Tag erlebte sie etwas Neues. Die Gefahren, die vor ihr lagen, all die Mühseligkeiten der langen Reise fürchtete sie nicht. Zwar hörte sie die Mutter ängstlich seufzen, vernahm die Sorgen des Vaters, der sich sogar ein Gewehr zugelegt hatte, aber all das konnte ihre freudige Erwartung nicht trüben.
Vor ihr lag ein ungeheures Abenteuer, sie würde einen ganzen Kontinent überqueren, fremde Gegenden sehen, wilde Tiere und feindliche Ureinwohner.
Suzanne hatte tatsächlich eine schwierige Aufgabe damit, das lebhafte Kind im Auge zu behalten.
Immer wieder büxte die Kleine aus und verschwand spurlos, egal, wie sehr die Schwester schimpfte und klagte. Jacqueline nutzte ihre Freiheit weidlich aus und schließlich gab Suzanne auf, ließ das Kind einfach gewähren und schloss eigene Freundschaften.
Zum ersten Mal erkannte das junge Mädchen, dass es nicht immer nur um die kleine Schwester gehen musste, die problemlos allein zurechtkam. Ab und zu sah man Suzanne daher nun mit einem jungen Mann, mit dem sie sehr vertraut schien. Sie lachten oft und gingen Hand in Hand, natürlich ohne dass die Eltern davon wussten.
Doch er würde nicht mit ihrem Treck reisen, so viel stand fest, er begleitete einen anderen. Jacqueline lernte den jungen Mann ebenfalls flüchtig kennen, sie mochte ihn, denn durch ihn war ihre Aufpasserin abgelenkt und sie konnte weiterhin tun und lassen, was sie wollte.
Jedenfalls genossen die beiden Schwestern ihren Aufenthalt in Westport, jede auf ihre Weise.
Dennoch sehnten sie den Aufbruch herbei.
Endlich ging es los! Die Bianchets gehörten zu einem Treck von zehn Wagen, der von zwei erfahrenen Trappern geleitet wurde, und anfangs kamen sie gut voran.
Das Wetter war die ersten Wochen schön, nicht zu heiß. Ächzend rollten die Wagen am Ufer des Platte River entlang, der für Jacqueline eine Art Heimat wurde.
Tag und Nacht hörte sie das eintönige Rauschen des träge dahin fließenden Flusses, sie badete darin, kühlte ihre Beine nach langen Fußmärschen und manchmal fing sie sogar ein paar Fische, die erfreut in Empfang genommen und verspeist wurden.
Da war sie natürlich sehr stolz.
Der Treck erreichte in der vorgesehenen Zeit die großen Prärien. Ebenmäßig und flach war die Landschaft, weit in der Ferne konnte man die hohen Berge der Rocky Mountains erahnen, die einfach nicht näherzukommen schienen. Geplagt von unzähligen Mücken, von der heißen Sonne und dem Staub, der vom Wind und den Wagenrädern aufgewirbelt wurde, quälten sich die Siedler vorwärts. Jacqueline hasste diese Mücken und weinte oft, weil sie so zerstochen wurde. Suzanne kühlte die Stiche mit feuchten Tüchern und tröstete ihre kleine Schwester. Von einer Mitreisenden bekamen sie eine übelriechende Salbe, die die Mücken ein wenig fernhielt.
Meile um Meile näherte sich der Treck den Bergen.
Viele wurden krank, Mückenstiche infizierten sich und ein kleiner Junge starb am Fieber und wurde am Wegesrand begraben.
Die Bianchets blieben von Krankheiten weitgehend verschont, alles in allem schien für sie die Reise unter einem guten Stern zu stehen.
Doch dann kam jener schicksalhafte 25. Mai, der Tag, der das Leben der kleinen Jacqueline auf den Kopf stellte und alles änderte und zerstörte.
Der Überfall
Der Tag begann wie alle anderen. Bei Sonnenaufgang wurden die Wagen angespannt, die Feuer gelöscht und die Siedler brachen gemeinsam auf. Zurück blieb der übliche Müll, leere Dosen, unbrauchbare Kleidungsstücke, überflüssiger Ballast, verdorbene Nahrungsreste.
Langsam schoben sich die Wagen vorwärts. Man wusste, in Kürze würde man Fort Sedgwick erreichen, eine kleine Atempause vor den gefürchteten Anstiegen auf die Pässe der Rocky Mountains. Die Sonne schien bereits in den frühen Morgenstunden unbarmherzig herab, es würde wieder sehr heiß werden. Schon waren die Wagen von Schwärmen von Mücken eingehüllt, das Summen begleitete die Siedler mit grausamer Beständigkeit.
Jacqueline hatte sich im Wagen unter den Decken verkrochen. Sie war müde und weinte wegen der Mücken. Suzanne blieb bei ihr, doch die Hitze wurde bald unerträglich, daher schlug Suzanne vor, zum Fluss zu gehen und die Beine im Wasser zu kühlen.
„Ich habe keine Lust!“, wehrte Jacqueline ab.
„Komm“, lockte Suzanne, „am Fluss ist es nicht so heiß und du kannst baden. Die Mücken sind dort auch nicht so schlimm!“
Die Schwester war schließlich einverstanden.
Die beiden Mädchen kletterten aus dem Wagen, sagten dem Vater Bescheid und liefen zum Ufer. Jacqueline schleuderte Steine in die Fluten, planschte herum und beobachtete entzückt ein paar Fische, von denen sich leider keiner fangen ließ. Auch Suzanne kühlte sich im Wasser ab und genoss es. Wie immer verging die Zeit viel zu schnell.
„Nun ist Schluss, Jacqueline, wir müssen zurück“, forderte Suzanne sie schließlich auf, denn die Wagen waren schon weit voraus. Sie fuhren gerade in eine kleine Schlucht ein und würden bald aus dem Blickfeld der Mädchen verschwunden sein.
Doch Jacqueline war eigensinnig und gehorchte nicht. Es war so schön am Wasser, sie hatte keine Lust, mit den langweiligen Wagen mitzulaufen. Endlich verlor Suzanne die Geduld und zog die widerstrebende Jacqueline mit sich, den ausgefahrenen Wagenspuren folgend.
Sie waren noch nicht weit gekommen, da ertönte ein ungewöhnlicher Knall und erschreckte die beiden Mädchen zutiefst.
„Was war das?“, fragte Jacqueline entsetzt und klammerte sich an Suzannes Hand.
„Je ne sais pas“, antwortete Suzanne, automatisch in ihre Muttersprache verfallend. „Ich weiß nicht!“
Es knallte wieder und immer wieder, man hörte Schreie und plötzlich erhob sich schwerer, schwarzer Rauch über der Schlucht. Die Mädchen blickten sich an.
„Das sind Schüsse, los Jacqueline, vite!“
Sie rannten, so schnell sie konnten, liefen in die Schlucht, doch was sie dort entdecken mussten, ließ sie innehalten. Suzanne zog Jacqueline zu sich hinter einen Felsen, der sie nur notdürftig verbarg.
Von dort beobachteten sie atemlos, was geschah.
Eine Horde weißer Banditen hatte den Treck überfallen und die Wagen in Brand gesteckt. Die Siedler schrien, liefen durcheinander, keine Gegenwehr erfolgte und so wurden sie einer nach dem anderen von Kugeln niedergestreckt oder mit Messern erstochen.
All die vertrauten Reisegefährten lagen blutüberströmt auf dem staubigen Boden, Kinder, Männer, Frauen und das Vieh. Jacqueline wollte losrennen, hin zu ihrer Mutter, ihrem Vater, aber Suzanne, starr vor Entsetzen, hielt sie fest umklammert, verschloss ihr den Mund.
Wie oft in späteren Jahren dachte Jacqueline an diesen Moment, als Suzanne sie hätte gehen lassen sollen, sie wäre jetzt auch tot, wäre vereint mit ihren Lieben, hätte nie diese Last tragen müssen, die Last der Überlebenden, die das Grauen mit ansahen und nicht verhindern konnten. Das schlechte Gewissen, dass man eigentlich dazugehört hätte, aber davongekommen war.
Nie hätte sie die Albträume durchleben müssen, die Einsamkeit und das Entsetzen. Wie verführerisch hatte doch der Tod gewunken, wie schnell wäre er gekommen.
Aber er verschonte Jacqueline und lange Zeit war sie sich nicht im Klaren, ob es Glück oder Unglück bedeutet hatte, zu überleben.
Der Moment war vorbei, Jacqueline wurde von nackter Angst beherrscht. Zitternd klammerte sie sich an Suzanne, von Panik überwältigt schloss sie zunächst die Augen, betete, das Unheil möge an ihr vorübergehen.
Sie wollte es nicht mit ansehen, wollte die Schreie nicht hören, aber etwas zwang sie, alles zu beobachten, also öffnete sie die Augen und sah grausame Bilder, die sich dem achtjährigen Mädchen einprägten und sich für ihr ganzes Leben in ihrem Gedächtnis verankerten.
Ohne dass es ihr bewusst wurde, merkte sie sich die Gesichter der Räuber, überall und zu jeder Zeit würde sie sie in Zukunft wiedererkennen, zunächst sollten sie nur in ihren Albträumen auftauchen, doch später würde sie das Grauen und die Angst überwinden, später, wenn die Rache zu Jacquelines Lebensmotto werden würde, dann konnte sie sich ihre Erinnerungen zunutze machen.
Suzanne hatte ebenfalls alles mit großen Augen beobachtet, die Angst hüllte sie vollkommen ein, sie wollte weglaufen und konnte es doch nicht. Zitternd hielt sie die kleine Schwester im Arm, was würde mit ihnen geschehen?
Eine beängstigende Stille breitete sich nun aus.
Das Feuer in den Wagen hatte gierig Nahrung gefunden, schwarzer Rauch und Hitze stiegen in den Himmel empor. Die Räuber waren in die brennenden Wagen gestiegen und hatten die Habseligkeiten herausgeworfen, durchsuchten sie, nahmen mit, was ihnen wertvoll erschien, warfen den Rest zurück ins Feuer.
Dann ritten sie aus der Schlucht, an dem Ort vorbei, an dem die Mädchen sich angstvoll versteckten.
Doch der Felsen war nicht groß genug, um beide zu verbergen, einer der Räuber bemerkte, dass sich dort jemand befand, und ritt auf sie zu.
Suzanne stieß einen verzweifelten kleinen Schrei aus und drückte Jacqueline mit aller Kraft nach unten.
„Reste calme, bleib ruhig!“, flüsterte sie ihr noch einmal zu, dann sprang sie auf und rannte davon.
Ihr rasch gefasster Plan ging auf, der Räuber verfolgte Suzanne, hob das sich wehrende Mädchen auf sein Pferd und ritt mit ihr weg, seinen Kameraden folgend.
Jacqueline blieb zurück, starr vor Angst und Entsetzen, sie hatte noch versucht, die Hand der Schwester zu greifen, doch sie war ihr entglitten. Das Letzte, was sie von Suzanne sah, war das wehende schwarze Haar.
Lange blieb es still - totenstill.
Die Feuer in den Wagen erloschen allmählich, fanden keine Nahrung mehr. Jacqueline kauerte in ihrem Versteck, wartete nur darauf, dass einer der Räuber zurückkehren und sie herausziehen würde. Sie wagte nicht, sich zu bewegen, kein Laut drang über ihre Lippen.
Wie lange sie so saß, kann nur vermutet werden. Die Sonne sank, die Stätte des Todes lag nun im rötlichen Abendsonnenschein. Fliegen summten über den Leichen.
Plötzlich waren Pferdehufe zu hören.
Jacqueline wurde erneut von Entsetzen gepackt, nun waren sie zurückgekommen, um sie zu holen. Angstvoll drückte sie ihr Gesicht auf den Boden. Sie hörte Pferde, Männerstimmen, Rufe, doch sie rührte sich nicht.
Da fiel ein Schatten über sie, sie wurde gepackt und hochgezogen und als sie die Augen öffnete, glaubte sie, geradewegs in die Hölle gekommen zu sein, denn ihr stand der leibhaftige Teufel gegenüber. Er hatte gebräunte, wettergegerbte Haut, dunkle Augen, schwarze lange Haare und rote Striche im Gesicht, quer über die Wangen. Auf dem Kopf trug er einen alten Hut, der mit einer Feder geschmückt war. Der vermeintliche Teufel nahm das schreckensstarre Kind auf und strich ihm über den Kopf, berührte es aber nicht.
Sofort fühlte Jacqueline sich geborgen, ohne es erklären zu können, ahnte sie, dass sie letztendlich überleben würde und es für sie Rettung gab.
Sie begriff, dass sie keinen Teufel, sondern einen Indianer vor sich hatte. Er war, wie sie später erfahren sollte, ein Krieger der Cheyenne, der sich hin und wieder in den Dienst der amerikanischen Armee stellte und als Kundschafter oder Übersetzer aushalf.
Vorsichtig sah sich Jacqueline um, Soldaten waren überall, die fassungslos die Todesstätte untersuchten. Der Cheyenne brachte Jacqueline zu den Soldaten und voller Mitleid und in hilflosem Zorn erkannten die Männer, dass das Mädchen die einzige Überlebende war.
„Wer war das, was ist passiert?“, fragten sie.
„Männer …“, war alles, was Jacqueline hervorbrachte. Stumm blickte sie sich um, suchte nach den bekannten Gesichtern unter den Toten, die nun ordentlich aufgereiht wurden.
Als sie ihre Mutter entdeckte, lief Jacqueline zu ihr. Die Mutter war von mehreren Schüssen niedergestreckt worden, aber ihr Gesicht war wunderbarerweise verschont geblieben. Ein weiches Gesicht, gezeichnet von einem arbeitsreichen, schweren Leben. Die Augen blickten seltsam leer.
Das Kind betrachtete seine Mutter und begriff mit einer erstaunlichen Klarheit, dass sie tot war.
Ebenso der Vater, die Brüder, die Schwestern und dass sie nun völlig allein war.
Dass sie nun nicht nach Kalifornien kommen würde und die Reise zu Ende war.
Das Mädchen zitterte am ganzen Körper und nahm stumm Abschied, ohne Tränen betrachtete sie zum letzten Mal das vertraute, liebe Gesicht der Mutter.
„Maman“, flüsterte sie.
Der Verlust Suzannes wog jedoch ungleich schwerer. Jacqueline erschrak über sich selbst. Suzanne!
Wie hatte sie Suzanne vergessen können, sie musste den Soldaten von Suzanne erzählen, sie mussten sie retten! Das Mädchen lief auf den Cheyenne zu, er hatte sie gefunden, er würde auch Suzanne finden.
„Suzanne!“, begann sie und redete in abgehackten Sätzen weiter. „Suzanne, meine Schwester, ... finde Suzanne, die Männer, ... mitgenommen!“
Der Mann verstand das Kind nicht und brachte es zu einem der Soldaten. Jacqueline wiederholte ungeduldig ihr Anliegen und endlich begriff der Kavallerist und wandte sich an einen Vorgesetzten.
„Sir, es scheint, als hätte die Horde die Schwester des Mädchens mitgenommen, könnte es sein …?“ Der Soldat stockte.
Jacqueline rief weiter, französische und englische Wörter mischten sich wild durcheinander.
Warum verstand sie keiner?
„Meine Schwester, ma soeur, bitte!“
Der Oberst beugte sich zu ihr hinunter.
„Deine Schwester sagst du? Wie alt ist sie?“
„Elle a 16 ans, sie ist 16!“
Der Oberst nickte dem Soldaten zu.
Jacqueline konnte ihre Blicke nicht deuten.
„Vite! Schnell!“, beharrte sie.
So viel Zeit war doch schon vergangen.
Der Soldat nahm das Kind und führte es zu einem Pferd, das eine Last trug, die in eine Decke eingewickelt war. Er hob die Decke an und ließ Jacqueline schauen.
Sie hatten Suzanne gefunden, ein paar Meilen entfernt, es war ihre Leiche gewesen, die die Soldaten zu der Stätte des Überfalls geführt hatte.
Mit blankem Entsetzen blickte Jacqueline auf ihre leblose Schwester, die ihr Freundin und Mutter zugleich gewesen war. Suzannes Augen waren geschlossen, daher begriff Jacqueline nicht sofort, wollte Suzanne aufwecken, ihre tröstende Hand nehmen.
Doch der Soldat deckte die Leiche wieder zu und brachte das widerstrebende Kind weg. Da sah Jacqueline den Cheyenne, der sie gefunden hatte. Er hatte sie zuerst getröstet, er würde ihr vielleicht etwas von dem unerträglichen Schmerz nehmen, den sie empfand. Sie riss sich von den Soldaten los und rannte zu ihm.
Der Mann blickte das Kind an. Er betrachtete das von dichten schwarzen Haaren umrahmte blasse Gesichtchen mit den vor Schreck weit geöffneten dunklen Augen, die ihn anflehten. Aufmerksam musterte er die blaue Kette, die Jacqueline von dem Apachen in Westport bekommen und die letzten Wochen ständig getragen hatte, und fühlte ihre spirituelle Bedeutung.
Er gebrauchte keine Worte, Worte würden nicht helfen, nichts würde helfen. Denn er erinnerte sich an seine eigenen Verluste, an einen toten Sohn, seinen im Kampf gefallenen Vater. Da waren Trauer und Tod, er fühlte fast körperlich den Schmerz des Mädchens, konnte sehen, wie sich dunkle Geister um ihren kleinen Körper wanden.
Er ahnte, was Jacqueline bald genug erfahren würde, dass diese Geister von ihr Besitz ergreifen und sie heimsuchen und quälen würden. Vorerst würde es keine Hilfe geben. Tröstend nahm er die kalten Hände des Kindes, barg sie in den seinen und schloss die Augen. Alle Kraft, die er ihr übertragen konnte, floss in das Mädchen, aber es war klar, es war nicht genug.
Jacqueline fühlte die Wärme, die von dem Cheyenne ausging, am liebsten hätte sie diese Hände nie mehr losgelassen, doch die Soldaten drängten zum Aufbruch und einer setzte das Kind vor sich auf sein Pferd.
Schnell ritten sie davon in das nur ein paar Meilen entfernte Fort Sedgwick.
Der Cheyenne war verschwunden, aber seine Saat war gelegt, Jacqueline fand Trost, sobald sie an ihn dachte, und das gab ihr die Kraft weiterzuleben.
Doch sie verstummte für lange Zeit.
Die Toten wurden kurze Zeit später von den Soldaten bestattet, ein Priester des Forts segnete die Gräber und immer war Jacqueline anwesend, ein bleicher, schweigender kleiner Geist, selbst mehr tot als lebendig.
Sie verbrachte ein paar Wochen in dem Fort, wurde von den wenigen mitleidigen Soldatenfrauen verwöhnt, man versuchte, sie zum Sprechen zu bringen, und wusste doch, man musste ihr Zeit lassen, Zeit zu vergessen.
Sogar Suzannes Freund aus Westport war aufgetaucht, er schien sich sehr zu grämen, wollte mit Jacqueline reden, sich um sie kümmern, aber es war sinnlos, sie reagierte nicht. Er verschwand unvermittelt und das Mädchen blieb einsam zurück in den Baracken des Forts.
Die Soldaten machten sich schließlich auf eine ziemlich hoffnungslose Suche nach der Mörderbande und lange bevor sie zurückkehrten, schickte man das Kind nach Denver, wo man von Jacquelines Schicksal gehört hatte und nur zu gern bereit war, der armen Waise zu helfen. Nach einigem Hin und Her kam sie in einer Händlerfamilie unter, die schon länger in Denver lebte und ein gut gehendes Warengeschäft besaß.
Die Familie hieß Warner und hatte bereits zwei Söhne, die etwa in Jacquelines Alter waren. Dort, so hoffte man, würde das Kind sich erholen, alles Schreckliche überwinden und zu einem neuen Leben finden.
Kinder vergessen doch so schnell und wer wusste schon, was das Mädchen genau gesehen hatte. Sie sprach nie darüber und niemand war wirklich daran interessiert, das herauszufinden. Wahrscheinlich hatte sie überhaupt nichts mitbekommen, sie war ja nicht direkt dabei gewesen.
Der Ruf des Adlers
Und tatsächlich schien es, als würde sich alles normalisieren. Mrs. Warner, von Jacqueline Tante Allie genannt, war eine mütterliche doch gleichzeitig sehr energische Frau, die es nicht zuließ, dass Jacqueline sich in ihr Schneckenhaus zurückzog.
Mit großer Ausdauer widmete sie sich der Aufgabe, aus dem Mädchen eine amerikanische Tochter zu machen, die sowohl im Haushalt als auch im Geschäft nützlich war. Es gab viel zu tun und so ließ sie Jacqueline arbeiten und hielt sie tagsüber ständig auf Trab.
Am meisten aber halfen die zwei Jungs, Mike und Fred, die zwar anfangs Mitgefühl gezeigt, jedoch rasch das Interesse an dem schrecklichen Geschehnis verloren hatten, und Jacqueline nur noch als ihre Schwester betrachteten, die man wunderbar ärgern konnte.
Zuallererst änderten sie ihren Namen in „Jacky“, da das französische Jacqueline viel zu lange und umständlich war. Dann spielten sie ihr Streiche, legten ihr tote Mäuse ins Bett oder banden dem Hund klappernde Dosen an den Schwanz, so dass er panisch durch die Küche lief, bis Jacky ihn einfangen und befreien konnte.
Das Mädchen musste lernen, sich zu wehren. Anfangs tat sie es stumm, da sie immer noch nicht geredet hatte, aber als Mike ihr den langen Zopf abschneiden wollte, um sie endgültig zu einem ‚Bruder‘ zu machen, sprang sie plötzlich auf ihn zu und ein Wortschwall ergoss sich über den verblüfften Jungen. Zornige Worte, halb englisch, halb französisch. Wütend entriss sie ihm die Schere und versuchte ihrerseits, seine Haare zu schneiden.
Es entstand eine wilde Balgerei, die von Mrs. Warner abrupt beendet wurde, indem sie die Kampfhähne an den Ohren packte und auseinanderzog.
Beide bekamen eine Tracht Prügel, die zumindest ein paar Tage dafür sorgte, dass Mike Jacky in Ruhe ließ, aber die zwei brauchten auch in Zukunft nicht viel, um handgreiflich zu streiten.
Auf diese Weise begann nun Jacky wieder zu reden und allmählich vergaß sie ihre Muttersprache. Und weil sie schon immer lebhaft gewesen war, passte sie sich dem arbeitsreichen Leben rasch an und wurde eine rührige, flinke Tochter, ganz nach Mrs. Warners Geschmack.
Schon nach kurzer Zeit bediente sie mit im Laden, konnte Waren abwiegen und Preise ausrechnen, schneller, als die beiden Jungs das jemals lernen würden. Auch fiel Jacky weder das Lesen noch das Schreiben schwer und unter Tante Allies strenger Aufsicht gewöhnte sie sich eine ordentliche Handschrift an und durfte bald Einträge im Warenbuch machen, was eine besondere Ehre darstellte und von ihr auch so empfunden wurde.
Eifrig und gewissenhaft erfüllte sie ihre Aufgaben und wenn Tante Allie sie lobte - was allerdings selten vorkam, denn Mrs. Warner stellte hohe Ansprüche an sich und andere - war sie sehr stolz und glücklich.
Zur Schule ging sie sehr gern und hatte bald eine Schar von Freundinnen, mit denen sie in ihrer spärlichen Freizeit spielte. Sie war beliebt und wurde wegen ihrer hervorragenden Zensuren geachtet, auch vom Lehrer, der sich über seine begabte Schülerin freute.
Ihren Pflegevater Sam sah Jacky nur selten, denn er befand sich häufig auf Reisen. Manchmal nahm er eines der Kinder mit, gab aber dabei meist seinen Söhnen den Vorzug.
Sam Warner war ebenfalls ein harter Geschäftsmann, der wusste, was er wollte, doch im Privatleben ließ er es eher gemütlich angehen und er liebte gutes Essen, was sich auch immer mehr in seiner füllig werdenden Figur abzeichnete.
Jacky mochte ihren Onkel Sam gern und freute sich über seine zahlreichen Späße. Er war den Kindern gegenüber viel gutmütiger und nachsichtiger als seine strenge Frau und drückte öfter mal die Augen zu, wenn sie etwas angestellt hatten. Oft half er tatkräftig mit, irgendwelche Folgen zu beseitigen, bevor Mrs. Warner sie entdeckte. War es ein Wunder, dass alle drei Kinder an ihm hingen?
Wer Jacky tagsüber erlebte, hätte niemals geglaubt, welche Qualen das Kind in unzähligen Nächten litt.
Alle dachten, sie hätte den Überfall vergessen, sie sprach ja auch nie darüber, nie kam ein Wort über ihre Lippen über ihre leibliche Familie und schon gar nicht über Suzanne. Das war ihr Geheimnis, ihre andere, eigentliche Familie, die mit den Warners nichts zu tun hatte und vor ihnen verborgen werden musste.
Tante Allie würde nie im Leben akzeptieren, dass Jacky nicht voll und ganz zu ihnen gehörte.
Doch das Kind vergaß ihre Lieben nicht, so oft erschienen sie alle im Traum, dann sprachen der Vater und die Mutter mit ihr, sie redeten französisch und nannten sie Jacqueline. Im Traum war sie wieder das besondere Kind einer französischen Familie, eine andere Person, das kleine Mädchen, die kleine, geliebte Schwester. Sie vermisste sie alle so sehr, vor allem Suzanne.
Suzanne war es auch, die Jacqueline beschwor, das Verbrechen zu sühnen.
„Du bist allein übriggeblieben! Ich habe mich für dich geopfert, damit du überlebtest! Du musst uns rächen, deswegen lebst du! Nur deshalb, denk daran, Jacqueline!“
Und dann tauchten sie auf, die Männer, die ihre Lieben getötet hatten, in diesen Nächten kamen sie, einer nach dem anderen ritten sie an ihr vorbei, sie sah ihre Gesichter, sie hörte ihr höhnisches Lachen, sie sah Feuer, das in ihrem Traum zum Höllenfeuer wurde. Sie sah die blutüberströmten Opfer, die stöhnend und sterbend am Boden lagen, hörte das qualvolle Gebrüll der Ochsen und sie konnte weder ihre Ohren noch ihre Augen verschließen.
Diese Albträume suchten das Kind mindestens einmal in der Woche heim, sie war wehrlos dagegen. Oft hatte sie Angst einzuschlafen, aber die viele Arbeit tagsüber machte sie so müde, dass der Schlaf sie einfach überwältigte.
Und allmählich akzeptierte sie es, dass die Träume zu ihrem Leben gehörten.
Etwa zwei Jahre nach dem Überfall betrat der Cheyenne, der Jacky damals gefunden hatte, das Geschäft. Jacky erkannte ihn sofort wieder und starrte ihn verblüfft an.
Sie war gerade allein im Laden, Tante Allie war kurz hinausgegangen.
„Komm, Mädchen“, sagte der Mann und wandte sich zum Gehen.
Jacky konnte gar nicht anders, sie folgte ihm. Er führte sie aus der Stadt, einen langen Weg durch belebte Straßen und Jacky lief einfach hinterher, wohl wissend, dass sie Probleme mit ihrer Pflegemutter bekommen würde.
Schließlich erklommen die beiden einen steilen Hügel. Es war um die Mittagszeit, die Sonne schien heiß herab und der Aufstieg war mühsam. Oben angelangt setzte sich der Mann nieder, mit dem Gesicht nach Westen, zu den hohen Bergen gewandt, weg von der lärmenden Stadt.
Jacky war stehengeblieben, unsicher, was von ihr erwartet wurde.
„Ich gehe dann wieder“, sprach sie zögernd.
Er hob die Hand und wies ihr einen Platz neben sich.
„Höre!“, befahl er ihr.
Verwundert sank das Mädchen vorsichtig ins Gras und bemühte sich, zu hören.
Zunächst vernahm sie nur die gewohnten Geräusche der Stadt, das Hämmern aus der Schmiede, die Eisenbahn, die ratternden Fuhrwerke, doch je mehr sie nach Westen blickte, desto mehr kam es ihr vor, als würde alles verstummen.
Sie hörte den Wind in den Bäumen, das Rascheln der Blätter, den Gesang eines Vogels, das Murmeln eines Baches, das leise Rasseln einer Klapperschlange in den Felsen, es war, als schärften sich ihre Ohren.
„Was hörst du?“, fragte der Cheyenne.
„Ich höre die Stadt, ich höre den Vogel, ich höre die Blätter, ich höre den Bach, ich höre die Schlange …“
Der Mann nickte zufrieden und begann zu singen, einen monotonen Gesang, der so viel Ruhe ausstrahlte, dass Jacky ganz still dasaß und ihre Augen schloss.
Und nun vernahm sie noch viel mehr, sie vermeinte, einen Hasen zu erkennen, der hinter ihnen vorbeihoppelte, und die Stimmen der Vögel wurden so laut, dass es fast unangenehm wurde.
Als plötzlich ein einzelner heiserer Vogelschrei ertönte, brach der Cheyenne seinen Gesang ab und blickte in die Richtung, aus der der Ruf gekommen war.
„Der Adler hat gerufen!“, verkündete er.
„Ja, und?“ Jacky verstand gar nichts mehr.
„Wenn der Adler ruft, muss man auf ihn hören. Der Adler beherrscht die Lüfte, er sieht, was die Menschenwesen nicht sehen.“
„Ja, aber was hat er denn gerufen?“
Der Cheyenne sah das Mädchen eine Weile nur an. Sie war eine Weiße, aber noch sehr jung und konnte lernen.
„Eines Tages wirst du den Adler verstehen. Wenn du ein Menschenwesen geworden bist. Du redest zu viel, du verschließt deine Ohren. Wer redet, hört nicht.“
Er stand auf und schritt im Kreis um sie herum.
„Du trägst die Kette nicht mehr!“, stellte er unvermittelt fest und blieb vor ihr stehen.
„Welche Kette?“
„Du hattest eine Kette, sie wird dich beschützen. Du musst sie tragen. Immer. Bis der Kreis sich schließt.“
Aus irgendeinem Grund wurde Jacqueline bewusst, dass er die Kette des Apachen aus Westport meinte, die Kette mit blauen Holzperlen und Federn.
Tante Allie wollte nicht, dass Jacqueline sie trug, und so hatte das Mädchen sie versteckt, denn diese Kette verband sie mit den glücklichen Erinnerungen an die Zeit vor dem unseligen Treck.
Wieder machte der Cheyenne einen Kreis um sie, hielt vor ihr und wies mit seinen Armen auf die Sonne. Dann deutete er auf die Erde.
„Alles hat einen Anfang und ein Ende, und im Ende liegt ein neuer Anfang. So ist alles ein ewiger Kreis. Bleibe in der Mitte des Kreises, zieh den Kreis um dich, der Kreis hat Macht, das Böse kann nicht hinein. Lass keine Lücke, kein böser Geist kann zu dir außer denen, die du in dir trägst. Ich werde dich wiedersehen, der Adler wird dich rufen. Und trage die Kette, sie wird dir helfen!“
Der Cheyenne wandte sich zum Gehen.
„Halt, warte“, rief Jacqueline. „Wie werde ich wissen, …“
Er legte seine Finger auf den Mund und deutete dann auf seine Ohren. Sie sollte hören, nicht reden.
„Nur noch eine Frage!“ Das Mädchen gab nicht klein bei. „Wie heißt du?“
„Ein Menschenwesen sagt seinen Namen nicht, wer einen Namen weiß, hat Macht über diesen Menschen. Die Weißen haben mir einen Namen gegeben, den kannst du benutzen, sie nennen mich ‚Der mit vielen Augen sieht‘ oder ‚Manyeyes‘. Und nun gehe ich!“
Er wandte sich endgültig um und stapfte langsam in die Wildnis der Berge.
Jacqueline sah ihm nach, unschlüssig, was sie tun sollte, aber dann erinnerte sie sich wieder an ihre Pflichten und stellte sich eine wütende Tante Allie vor.
„Du lieber Himmel, was mache ich hier?“, rief sie laut, erhob sich rasch und rannte den Berg hinunter, Richtung Stadt.
Die Worte von Manyeyes hallten in ihrem Kopf nach. Erzählungen von Geistern und Magie waren ihr nicht fremd, Suzanne hatte ihr viele Gutenachtgeschichten erzählt. Und auch Tante Allie hatte das Ihre getan, indem sie Jacky zur Kirche gebracht hatte und sie stets vor bösen Mächten und dem Satan warnte, so wie die Prediger, die nach Denver kamen und die Menschen mit feurigen Reden in ihren Bann zogen.
Nun hatte ihr Manyeyes einen Weg gezeigt, wie sie sich in Zukunft schützen konnte, wenn sie des Nachts die Dunkelheit und die Schatten umgaben, und sie fand keinen Grund, warum sie Manyeyes nicht vertrauen sollte. Er hatte sie schon einmal gerettet!
Zuhause schlich sie sich in ihr Zimmer und holte die alte Kette unter der Matratze hervor. Sie war ein wenig beschädigt, aber das konnte repariert werden.
Lange überlegte Jacky, wie sie den Schmuck tragen konnte, ohne dass man ihn sah, es war nicht möglich. Daher legte sie die Kette vorsichtig in den Beutel, in dem sie ihr Geld aufbewahrte und den sie immer an ihrem Kleid am Gürtel befestigte. Das musste reichen.
Schwieriger war es, Tante Allie Rede und Antwort zu stehen, warum sie den Laden verlassen hatte. Aber Tante Allie hatte zum Glück selbst eine Theorie gefunden und nichts in der Welt hätte sie davon abgebracht, am wenigsten die Wahrheit.
„Du bist wieder mit den Jungen gerannt, nicht wahr?“, schalt sie. „Hast dich herumgetrieben, anstatt zu arbeiten! Du bist aber kein Junge, du bist ein Mädchen und bleibst im Haus. Frauen hüten das Haus, um den Männern ein schönes Zuhause zu bieten, das ist die Pflicht und Aufgabe einer Frau und es wird Zeit, dass du das lernst und begreifst!“
Jacky nickte ergeben und umklammerte trostsuchend die Kette in ihrer Tasche. Ihr schien es, als würde sie ihr Kraft geben, sie symbolisierte ihr altes Leben und die Aufgabe, die daraus erwachsen war.
Von dieser Nacht an zog sie auch einen Kreis um ihr Bett und tatsächlich wurden die Albträume weniger. Je sorgfältiger sie den Kreis zog, desto besser und ruhiger konnte sie schlafen.
Nur Suzanne war bei ihr, beinahe jede Nacht, und beschwor sie zur Rache.
Du machst dir Sorgen und Gedanken, warum?Du bist frei zu entscheiden,welchen Weg du gehen willstund was du ertragen willst.Du bist hier, es gibt nichts,was du nicht schaffen kannst.
„Frage deine Füße“
Die Jahre vergingen. Jacky wurde äußerlich so, wie Mrs. Warner sich gewünscht hatte: ein rühriges, hübsches junges Mädchen mit scharfem Verstand und der Fähigkeit zu kühler Kalkulation.
Die Schule hatte sie als Beste abgeschlossen und war geehrt worden, bei den jungen Männern war sie sehr beliebt und wurde oft von ihnen eingeladen. Auf den Bällen, die regelmäßig stattfanden, war sie eine begehrte Tanzpartnerin und es mangelte nicht an Verehrern und Anträgen, doch sie hielt alle auf Abstand.
Selbst wenn sie gewollt hätte, sie konnte nicht hierbleiben und eine Familie gründen. Diese Tatsache machte sie oft traurig, sie fühlte sich ausgeschlossen und unverstanden.
Aber das half alles nichts. Vielleicht, wenn die große Aufgabe erledigt war, dann konnte sie zurückkehren.
Denver war in wenigen Jahren zu einer großen Stadt geworden, Ausgangspunkt für Trecks nach Santa Fe und vor allem Versorgungspunkt für alle jene, die immer noch nach Gold suchten. Zwar war die Zeit des großen Goldrausches in den Rocky Mountains vorbei, doch es gab genug Abenteuerlustige, die nicht aufgeben wollten, und kleine Ansiedlungen gründeten sich überall in der einsamen Wildnis der Berge.
Das Geschäft der Warners blühte, sie hatten inzwischen ein großes Haus über einem neuen Laden gebaut und lebten in Reichtum aber nicht in Luxus, denn man bevorzugte nach wie vor Sparsamkeit.
Angestellte erledigten allerdings die schwereren Arbeiten und Mrs. Warner träumte davon, Jacky mit dem Sohn des einzigen Konkurrenten zu verheiraten, damit man die Geschäfte zusammenlegen und die Preise bestimmen konnte. Sie ahnte nicht im Geringsten, was in Jacky vorging und dass das Mädchen heimlich zu einem Menschenwesen geworden war, wie der Cheyenne Manyeyes sich ausdrückte.
Jedes Mal wenn der Adler gerufen hatte, war Jacky in die Berge gerannt, um Manyeyes zu sehen.
Genaugenommen hatte sie den Adler nie wirklich gehört, dazu war sein Schrei viel zu leise und weit entfernt, dennoch hatte sie immer gewusst, wann er ertönte. Eine innere Unruhe und Sehnsucht nach dem Gipfel des kleinen Hügels hatte sich ihrer bemächtigt und sie zu den Treffen mit dem Cheyenne gedrängt.
Begierig hatte sie seinen Lehren gelauscht, nicht, dass es viele gewesen waren, aber die wenigen hatte sie zu ihren eigenen gemacht. Sie hatte gelernt zu hören, ihr Gehör war geschärft, hatte gelernt, die Erde als ihre Mutter zu sehen, und sie hatte die Bedeutung des Kreises erkannt.
Anfang und Ende sind eines, das Leben ist ein einziger Kreis. Im Tod ist das Leben, denn wenn man stirbt, wird man zu Erde, auf der das Gras wächst, das der Büffel frisst, der wiederum den Menschenwesen Nahrung gibt.
So hatte es ihr Manyeyes erklärt und Jacky hatte verstanden, dass ihre tote Familie zwar in den Kreislauf des Lebens aufgenommen worden war, aber ihre Geister keine Ruhe fanden, bis sie nicht gerächt worden waren. Manyeyes konnte die Geister sehen, sie waren in das Netz der Kette gezogen, die Jacqueline am Tag des Überfalls getragen hatte.
Daher durfte Jacqueline die Kette nicht weggeben, sie war die Verbindung zu ihrer Familie.
Jacky wollte das nur zu gern glauben.
So gut es ihr bei den Warners ging, Tante Allie war nicht die Mutter und die beiden Brüder konnten Suzanne, die geliebte Schwester, niemals ersetzen.
Und dann trat Ben Hart in ihr Leben.
Es war ein herrlicher Frühsommermorgen im Jahre 1872, Jacky war gerade 17 Jahre alt geworden.
Wie immer stand sie im Laden und bediente die Kunden freundlich. Man konnte sich auf sie verlassen, nie verrechnete sie sich oder nannte zu hohe Preise, das hatte sich herumgesprochen und daher kamen die Leute gerne zu ihr, auch wenn in Warners Warehouse die Preise etwas höher waren als bei der Konkurrenz. Die Qualität der Waren war in Ordnung und man wurde nie betrogen.
Gerade als es ein wenig ruhiger wurde, betrat ein junger fremder Mann den Laden.
Er war etwas über 20 Jahre alt, trug eine hellbraune Lederjacke und eine feste Hose aus Baumwolle, hatte kurze dunkelblonde Haare und warme braune Augen. Er sah gepflegt aus, sein ebenmäßiges Gesicht war schmal geschnitten und er wirkte männlich und sehr kräftig.
Mit lebhafter Stimme bestellte er bei Jacky eine Menge Waren, haltbare Lebensmittel und Konserven, er schien sich auf eine längere Reise vorzubereiten.
Jacky stapelte die Sachen auf den Tresen und fragte dann: „Wohin sollen die Einkäufe geliefert werden?“
„Ich nehme sie gleich mit“, antwortete der Mann. „Ich will heute noch weg, meine Kutsche steht draußen.“
Er begann, alles aus dem Laden zu tragen, und Jacky winkte einem der Lehrjungen, damit er helfen sollte.
„Das muss ja eine weite Reise sein“, hielt Jacky mechanisch das Gespräch am Laufen.
Er blickte sie freundlich an.
„Nicht allzu weit, aber lange!“
„Sie gehen in die Berge zum Jagen?“
„Zum Jagen weniger, eher zum Jagen nach Glück!“
„Ach so!“ Jacky verstand.
Es gab immer noch Goldsucher, die an die sagenhaften Reichtümer der Rocky Mountains glaubten. Tante Allie hielt absolut nichts von diesen Glücksrittern und sparte nicht mit verächtlichen Bemerkungen über sie.
„Wo liegt denn ihr El Dorado?“, fragte sie lächelnd.
„Sie glauben doch nicht, dass ich Ihnen das verrate! Sie würden mir ja alles vor der Nase weggraben, so geschäftstüchtig, wie Sie sind“, scherzte er.
Sie ging auf seinen Ton ein und grinste.
„Natürlich würde ich das, aber leider bekomme ich zunächst wirklich Geld von Ihnen.“ Jacky hatte inzwischen zusammengerechnet und nannte die Summe.
Der Mann zog ein langes Gesicht. „So viel? Also wo ich herkomme …“
Jacky kannte dieses Gerede zur Genüge und schnitt ihm das Wort ab. „Dann hätten Sie eben einkaufen müssen, wo Sie herkommen! In Denver haben wir unsere Preise. Wenn Sie nicht zahlen können …“ Sie brach ab.
Sie hörte sich bereits an wie ihre Tante Allie, eine erschreckende Erkenntnis, die zum ersten Mal in ihr Bewusstsein drang. Wollte sie das denn überhaupt? Wollte sie so hart und unnachgiebig werden?
Sie wusste, dieser freundliche junge Mann würde in ganz Denver keine besseren und günstigeren Waren bekommen und er würde bezahlen müssen, was sie verlangte, sich damit gleichzeitig ruinieren oder auf überlebenswichtige Dinge verzichten.
Der Mann bemerkte ihr Zögern.
„Hören Sie“, begann er und ganz gegen ihre Gewohnheit ließ Jacky ihn ausreden. „Wenn ich nun einen Teil bezahle und den Rest begleiche, wenn ich in ein paar Monaten zurückkomme? ... Ich nehme nicht an, dass Sie meinem Wort glauben, Sie kennen mich nicht. Was kann ich tun, dass Sie mir vertrauen?“
Er sah ihr offen ins Gesicht.
Sie konnte nicht antworten, noch nie hatte sie so eine Situation erlebt. Sie war mit allen fertig geworden, mit Bettlern, mit Menschen, die sie bedrohten, mit Menschen, die Forderungen stellten, nie hatte sie gezögert das zu tun, was zu tun war. Niemand bekam etwas geschenkt, niemand bekam etwas, ohne zu bezahlen.
Doch dieser Mann rührte ihr Herz.
Gab es eine Möglichkeit, ihm zu helfen?
Er nestelte an seinem Hals und zog eine Kette über den Kopf, an der ein goldenes Medaillon hing.
„Nehmen Sie das“, bat er. „Nehmen Sie das als Sicherheit. Es ist bestimmt mehr wert, als der ganze Krempel hier zusammen, aber ich will es nicht verkaufen. Ich möchte es wiederhaben. Ich werde es holen, wenn ich den Rest des Geldes bringe und meine Schulden bezahle.“
Jacky nahm das Schmuckstück in ihre Hand. Es war noch warm, der Mann hatte es an seinem Körper getragen. Die Wärme schien auf sie überzugehen.
Schließlich nickte sie. „In Ordnung, ich vertraue Ihnen!“
„Und ich Ihnen. Bewahren Sie das Medaillon gut auf, ich werde es holen, ich werde wiederkommen. Und vielen Dank!“ Der Mann lächelte sie an und verschwand mit den restlichen Sachen.
Jacky trat ans Fenster und sah zu, wie er seine einfache Kutsche fertig belud und bald darauf abfuhr. Sie hätte gerne seinen Namen gewusst, aber es war keine Zeit gewesen, ihn zu fragen. Nachdenklich wog sie das Medaillon in ihrer Hand und hängte es sich schließlich um den Hals, unter ihrem Kleid verborgen.