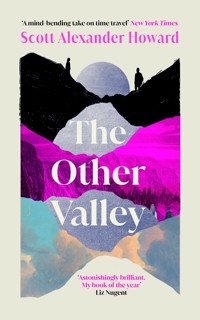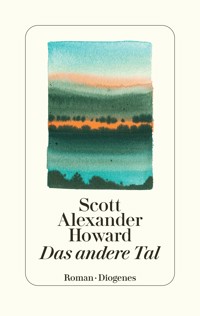
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Tal ist ein besonderer Ort. Geht man nach Osten oder Westen, stößt man auf die gleichen Häuser, Hügel, Straßen – doch alles ist zwanzig Jahre zeitversetzt. Nur in Trauerfällen dürfen die Grenzen passiert werden. Als die junge Odile in Besuchern aus der Zukunft die Eltern ihres Freundes Edme erkennt, weiß sie, dass er bald sterben wird. Was wäre, wenn Odile das ihr auferlegte Schweigen bricht? Ein bewegendes und außergewöhnliches Debüt über Freiheit und die Macht des Schicksals.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Scott Alexander Howard
Das andere Tal
roman
Aus dem kanadischen Englisch von Anke Caroline Burger
Diogenes
TEIL I
Ich stand allein draußen vor dem Garderobenraum. Morgens vor dem Unterricht und mittags, wenn es zur großen Pause läutete und die anderen hinausrannten auf den Hof. Ich ging immer zur selben Stelle neben der Tür und lehnte den Kopf an den rauen Putz. Ein schmaler Schattenstreifen schützte die Wand vor der Spätsommerhitze. Mit gefalteten Händen stand ich im Schatten, den Blick unverwandt auf den Wald hinter der Schule gerichtet, und wartete, dass der Tag vorüberging.
Diesen Posten an der Rückseite der Schule nahm ich ein, als Clare mit ihren Eltern in die Innenstadt zog und ich keine Freundin mehr in der Gegend hatte. Manchmal sah ich Clare im Laden oder auf der Straße, aber wir blieben wortkarg, während unsere Mütter sich unterhielten – es schien, als hätten wir außer den angrenzenden Grundstücken nur wenig Gemeinsamkeiten gehabt. Unsere neuen Nachbarn waren alt und liefen den ganzen Tag im Bademantel herum. Und so wurde ich in der Schule zum Mädchen neben der Tür: Odile, die allein dasteht. Die nicht angesprochen und nur selten erwähnt wird. Die mit Augen wie aus geschnitztem Holz ins Nichts starrt, reglos wie eine Statue.
Eine Minute bevor die Schulglocke alle wieder hineinrief, schlich ich mich meist zurück ins Klassenzimmer. Sechs leere Bankreihen standen vor einer blitzsauberen Tafel. Es roch nach Kreidestaub und einem stark riechenden Öl. Unser Lehrer, Monsieur Pichegru, wischte seinen Tisch regelmäßig mit einem feuchten schwarzen Tuch ab. Als ich jünger war, hatte mir der Ölgeruch unangenehm in der Nase gebrannt.
Dann klingelte es, die Tür zum Garderobenraum hinter mir wurde aufgerissen, und das Klassenzimmer füllte sich mit Stimmen. Im anstürmenden Gelächter blieb ich allein. Sobald Pichegru mit seinen Büchern und seinem Rohrstock hereinkam, waren alle still. Wir standen in unseren Schuluniformen neben dem Platz, bis er uns das Zeichen zum Hinsetzen gab, und in den folgenden Unterrichtsstunden war ich froh, Gesellschaft beim Schweigen zu haben.
In diesem Herbst wurde ich sechzehn, und der weitere Verlauf meines Lebens würde sich entscheiden. Meine Klasse hatte jetzt das Lehrjahr erreicht, und die meisten freuten sich auf den kurz bevorstehenden Übergang von der Schule zu etwas Neuem. Ende September mussten wir unsere Bewerbungen einreichen und abwarten, wer uns einstellen würde; später, sobald die Entscheidungen gefallen waren, würden wir uns die Zeit zwischen Pichegrus Unterricht und der praktischen Lehre in der Stadt teilen. Manche wussten, welchen Beruf sie ergreifen wollten, und andere versuchten es verzweifelt herauszufinden. Den ganzen Monat über standen Besuche von Handwerkern und Angestellten auf dem Programm, die ihre Tätigkeiten erläuterten, außerdem Ausflüge zu Bauernhöfen, Obstbaumplantagen, der Sägemühle und an die Grenze.
Das war der normale Gang der Dinge. Meine Mutter war allerdings fest davon überzeugt, ich sei für das Conseil vorherbestimmt. Das hatte sie immer geglaubt oder zumindest glauben wollen.
Die Bewerbung beim Conseil verlief anders als bei den übrigen Ausbildungsgängen. Ich konnte mich nicht einfach bis Monatsende bewerben und hoffen, dass ich genommen wurde. Es gab ein spezielles Auswahlverfahren, und in das Programm zu kommen war schwierig. Pichegru musste mich vorschlagen, und er konnte nur zwei Schüler oder Schülerinnen ins Programm entsenden, während die Schule in der Innenstadt mehr Leute nominieren durfte. Wenn man es schaffte, ins Auswahlverfahren zu kommen, musste man die nächste Hürde nehmen und bis September im Rennen bleiben, ohne herausgesiebt zu werden. Die Erfolgreichen erhielten dann einen Ausbildungsplatz im Hôtel de Ville. Jedes Jahr schafften es nur wenige, in manchen Jahren niemand.
Meine Mutter arbeitete auch im Hôtel de Ville, aber im Archiv, im Keller. Ich sehe doch, welche Auszubildenden zu uns kommen, sagte sie. Sie mögen schlau sein, aber du bist schlauer. Als sie in meinem Alter war, hatte sie auch versucht, ins Conseil zu kommen, war aber am Ende der zweiten Woche ausgesondert worden. Als ich einwandte, dass ich womöglich zu schüchtern für eine politische Karriere sei, lachte sie mich aus.
Sie wusste nicht, wie unsichtbar ich mich in der Schule machte. Die Vorstellung von mir im Conseil war lächerlich. Ich träumte nicht davon, Conseillère zu werden, und machte mir keinerlei Illusionen. Die Vorstellung, mich gegen andere durchsetzen zu müssen, fand ich grässlich, und die Idee, zu gewinnen und ein solch öffentliches Amt einzunehmen, erst recht. Aber die Tätigkeit meiner Mutter schien mir gar nicht so übel, auch wenn sie sich selbst oft darüber beschwerte: In irgendeinem unterirdischen Raum Petitionen abzulegen oder Akten mit geschwärzten Namen und Altersangaben zusammenzutragen. Ich konnte mir vorstellen, mein Leben unter dem Hôtel de Ville zu verbringen. Dass diese Stellen alle mit Teilnehmenden am Conseil-Auswahlverfahren besetzt wurden, half mir, meine Scham zu überwinden und Pichegru schon am ersten Schultag zu fragen, ob er mich vielleicht vorschlagen könne. Meine Mutter hatte mich am Morgen zur Schule gefahren und mir siegesgewiss Glück gewünscht.
Das Schuljahr begann am letzten Freitag im August – ein Einschnitt in den Sommer, der uns jedes Jahr wieder grausam erschien. Die jüngeren Kinder brauchten nur einen halben Tag in die Schule zu kommen, aber Pichegru tat so, als sei es ein ganz normaler Schultag, und ließ uns die neuen Unterrichtsmaterialien aufschlagen, ohne uns auch nur willkommen zu heißen. Ich sah, dass einige Mädchen im Klassenzimmer einen neuen Haarschnitt hatten. Außerdem gab es offensichtliche Veränderungen in der sozialen Landschaft – Leute, die die Plätze getauscht hatten, damit sie näher beisammensitzen konnten. Flirts und Freundschaften, von denen ich mir vorstellte, dass sie an langen Strandnachmittagen entstanden waren.
Ich bemühte mich, während des Unterrichts interessiert zu wirken, und als der Schultag vorbei war, wagte ich mich vor zu Pichegrus Lehrertisch. Er wischte gerade die Tafel. Er war kaum größer als ich, aber muskulös und schnell auf den Füßen; er vernichtete die Kreidebuchstaben mit kräftigen Schwüngen. Das Deckenlicht glänzte auf seinem kahlen Schädel. Ich stammelte, ich sei interessiert an einer Conseil-Ausbildung.
Er wischte erst die ganze Tafel zu Ende, bevor er mir eine Antwort gab. Zum Fenster drang gedämpfter Spielplatzlärm herein. Pichegru warf den Lappen auf die Kreideablage und drehte sich zu mir um.
Ich bin erstaunt, Odile. Du weißt schon, dass du im Auswahlverfahren den Mund aufmachen musst.
Ich lief knallrot an, aber dann sprach er sachlicher weiter.
Schreib mir übers Wochenende einen Aufsatz und gib ihn mir am Montag. Nächste Woche reiche ich die Namen ein.
Er erklärte mir, dass sich seine Empfehlungen auf einen persönlichen Essay stützten – je kürzer, desto besser, aber wohldurchdacht müsse er sein. In der Innenstadtschule herrsche Nepotismus, aber bei seiner Methode bewerte er nur die Leistung. Wenn ich einen Aufsatz zustande brächte, der angemessenen Verstand und, noch wichtiger, ein für das Conseil geeignetes Temperament demonstriere, sei er gern bereit, meinen Namen weiterzugeben.
Ich fragte, worüber ich schreiben solle. Pichegru antwortete, er stelle jedes Jahr die gleiche Frage: Wenn du die Erlaubnis hättest, das Tal zu verlassen, in welche Richtung würdest du gehen?
Ich lief an der einzigen befestigten Straße unserer Gegend nach Hause. Sie schlängelte sich am Fuß des Bergs entlang. Auf der Bergseite führten steile Einfahrten vom Chemin des Pins hinauf zu einzeln stehenden Häusern. Auf der anderen Straßenseite fiel der Hang ebenfalls steil ab, zwischen Bäumen wuchsen Balsamwurzel und Wildkräuter. Über die grau verblichenen Dächer der niedriger gelegenen Häuser hinweg konnte man das gesamte Tal überblicken: den ruhigen See und die staubig verbrannten Berge, die sich am gegenüberliegenden Ufer erhoben.
Unser Haus war klein und lag unterhalb vom Chemin des Pins. Ich ging die Einfahrt hinunter und schloss mir selbst auf. Meine Mutter war noch bei der Arbeit. Sie hatte am Vortag die Neuordnung der Bücher im Wohnzimmer in Angriff genommen, und auf dem Fußboden erhoben sich überall wacklige Buchstapel. Ich setzte mich im Schneidersitz hin und nahm einen in Pergamentpapier eingeschlagenen Band in die Hand.
Es war das einzige Kunstbuch, das meine Mutter besaß. Es war mit rot gedruckten Holzschnitten illustriert, kompakte Bilder, auf denen das Tal wie eine Märchenlandschaft aussah. Jede Illustration war durch eine Pergaminseite geschützt, die man sehr vorsichtig umblättern musste. Ich schlug eine Seite auf, die eine Apfelwiese am Hang zeigte, eine Wolke von Bäumen. Auf der nächsten Seite war der Park in der Innenstadt abgebildet. Man blickte vom See auf den Park, vielleicht von der sommerlichen Schwimminsel aus. Am Strand standen kleine Badegäste. Haarfeine Wellenlinien durchzogen das blutrote Wasser im Vordergrund.
Das interessanteste Bild befand sich am Ende des Buchs. Das Tal war von oben aus der Vogelperspektive abgebildet. Unsere kleine Stadt in der Mitte schmiegte sich ans Ufer des Sees, der sich wie ein Finger nach oben und unten erstreckte. Die uns umgebenden Berge waren hoch und menschenleer.
Zur Linken der Berge war eine identische kleine Stadt, am Ufer eines identischen Sees. Und nach rechts sah es genauso aus: wieder die Berge, der See, die Stadt. Nach jedem Tal kam das nächste. Die Städte wiederholten sich in beide Richtungen, Ost und West. Dunkle Seen schritten im Gleichtakt über die Seite.
Mit dem Finger fuhr ich die Berge nach, während ich mir Pichegrus Fantasieaufgabe durch den Kopf gehen ließ. Zusätzlich zu den natürlichen Begrenzungen der Täler waren die Städte von einem Zaun umgeben – der war auf diesem Holzschnitt zwar nicht abgebildet, aber jeder wusste, dass er da war. Der Zaun zog sich am Kamm oberhalb meiner Schule entlang, hoch oben in den Wäldern, größtenteils unsichtbar. Wo der Zaun aus den Bergen nach unten führte, durchquerte er die weite, gelbe Steppe außerhalb des östlichen Stadtrands. Er beschrieb eine Kurve hin zum See, ging dann im Wasser weiter und fasste die schmale Landzunge ein, die von den westlichen Wachen bewohnt wurde.
Ich hatte die Grenze noch nie aus der Nähe gesehen. Ich saß auf dem Boden und versuchte mir vorzustellen, wie das sein mochte, sie zu überqueren.
Als ich meiner Mutter von der Unterhaltung mit Pichegru erzählte, fragte sie nicht, ob ich lieber den Osten oder den Westen besuchen würde. Sie sagte, ich solle mich auf das konzentrieren, was das Conseil hören wollte.
Es ist eine Fangfrage, Odile. Denk drüber nach, wofür du dich da bewirbst. Sie wollen keine Auszubildenden, die neugierig sind, wie es da drüben wohl aussehen mag. Hauptaufgabe eines Conseillers ist es, den Menschen mitzuteilen, dass sie dort nicht hindürfen.
Wir saßen auf unserer Terrasse hinter dem Haus auf nicht zusammenpassenden Metallstühlen und schlürften kalte Suppe zum Abendessen. Die Suppe war rot und pikant. Es war zwar noch nicht ganz dunkel, aber ein paar erste Sterne funkelten schon. Unser Garten lag im Schatten von Bäumen, die uns den Blick auf den See versperrten. Ich fragte, was ich denn ihrer Meinung nach schreiben solle, wenn Pichegrus Frage eine Falle war.
Sei ehrlich und schreib, dass du diese Orte nicht sehen willst. Schreib, dass du zufrieden mit dem bist, was du hier hast.
Ich setzte mich an den alten Schreibtisch meines Vaters, der in meinem Zimmer stand. Der Tisch war an den Beinen so eng, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie ein erwachsener Mann daran hatte sitzen können, aber er brachte mich auf eine Idee, wie ich meinen Aufsatz persönlicher gestalten konnte. Irgendwas musste ich ja schreiben. So war es mir weniger unangenehm, dass ich die Frage streng genommen nicht beantworten wollte. Ich nahm einen Bleistift zur Hand.
Wenn ich Gelegenheit hätte, ein anderes Tal zu besuchen, würde ich sie nicht wahrnehmen.
Den letzten Teil strich ich durch und ersetzte ihn:
würde ich höflich ablehnen.
Der einzig legitime Grund für einen Besuch war, Trost zu finden, hatten wir gelernt. Um einen Blick auf eine Person werfen zu können, die wir zu Hause nie kennenlernen oder nie wiedersehen würden. Und für mich gab es eine solche Person. Als ich vier Jahre alt war, starb mein Vater in der alten Garage neben der Obstplantage meiner Großeltern. Würde ich nach Westen reisen, könnte ich ihn finden und ein wenig beobachten. Hinter den Bergen wäre er Anfang zwanzig und hätte meine Mutter gerade erst auf dem Place du Bâtisseur kennengelernt. Ich kannte die Anekdote: Mutter hatte eine Münze geworfen, sich etwas gewünscht und ihm, einem wissbegierigen Fremden, nicht verraten wollen, was. Er hatte selbst eine Münze geworfen und sich gewünscht, dass er sie zu einem Getränk einladen dürfe. Sie erwiderte, sein Wunsch gelte nicht mehr, weil er ihn verraten habe, aber sie ging trotzdem mit ihm aus. Es war verlockend, dorthin zu reisen und sich das anzusehen. Das Gefühl zu haben, meinen Vater besser oder überhaupt kennenzulernen.
Aber ihn zu sehen würde mich nicht trösten, schrieb ich. Vielleicht würde ich ihn noch nicht einmal erkennen. Was sollte mir das nützen, wenn mir von Weitem gezeigt würde: Da, das ist dein Vater? In Wirklichkeit trauerte ich nicht, weil er in meinem Leben fehlte; er war eher eine abstrakte Abwesenheit, die Erklärung dafür, warum es in unserem Haus ruhiger zuging als bei Clare. Meine Mutter war es, die den Verlust bewusst erlebt hatte, und sie schwor immer hoch und heilig, dass sie nie einen Besuch erbitten würde. Sie sagte, sie erinnere sich an genug: Wie mein Vater anfangs den ganzen Tag über schlief, wie er immer stärker den Eindruck machte zu schlafen, auch wenn er eigentlich wach war. Meine Mutter sagte, ihre Erinnerungen halfen ihr, ihn nicht zu vermissen.
Ich schloss meinen Aufsatz mit dem Schwur, dass ich als zukünftige Conseillère Antragstellern raten würde, hier im eigenen Tal ihren Frieden zu finden, im sicheren Gefilde normaler Trauer. Wenn das meiner Mutter reichte, dann reichte es auch mir, und so sollten es auch alle anderen halten. Als ich mir meinen eigenen Text im Flüsterton vorlas, fand ich meine Antwort gar nicht so schlecht. Außerdem vermutete ich, dass ich in der Art geschrieben hatte, die Pichegru am stärksten zu beeindrucken schien. Die einzigen lobenden Häkchen, die er, unabhängig vom Thema, je neben meine Hausaufgaben kritzelte, fanden sich neben meinen unbarmherzigsten Sätzen. Vielleicht würde er den Text als weiteres Beispiel meiner Strenge gutheißen.
Es war schon spät, als ich die Reinfassung abschrieb. Meine Mutter lag lesend im Bett. Sie nahm meinen Aufsatz und drehte ihn zur Lampe hin. Mit im Schatten verborgenen Augen überflog sie die Seite. Ich war nervös, wandte den Blick ab und sah mein verzerrtes Ebenbild in ihrem Schminkspiegel: meine wilden Locken, mein überlanges Gesicht. Das Papier zitterte, als sie es an mich zurückreichte.
Sehr raffiniert, sagte sie.
Wir hatten seit langer Zeit nicht mehr über ihn gesprochen. Vater hatte in dem kleinen Kaufladen an der Rue de Laiche gearbeitet. Dort war er für alles zuständig gewesen, aber vor allem fürs Obst, was bei seinem Elternhaus kein Wunder war. Meine Großeltern hatten es ihm krummgenommen, dass er die Obstplantage nach ihrem Ruhestand nicht übernehmen wollte. Sie mussten das Grundstück stattdessen an die Nachbarn verkaufen, und die beiden Plantagen wurden zusammengelegt. Aber die Nancys waren immer nett zu mir, und wenn wir meine Großeltern besuchten, durfte ich zwischen den Kirschbäumen spielen, die früher uns gehört hatten.
Eine der wenigen Erinnerungen, die ich an meinen Vater habe, stammt aus dieser Obstplantage. Sommer. Die Sonne war sengend heiß, aber unter dem Blätterdach fühlte sich die Luft satt und träge an. Barfuß gingen wir durch die Baumreihen, mein Vater hielt mich an der Hand. Ich machte große Schritte durch das hohe Gras. Zwischen meinen Zehen platzten faulige Kirschen, und ich fühlte mich wie eine Riesin in einem friedlichen, grünen Land. Als wir ans Ende der Baumreihe kamen, hob mein Vater mich hoch auf die Steinmauer, die das Grundstück einfasste. Ein trostloser Anblick lag vor mir, ein mit wildem Senf bewachsenes Brachland, das langsam zu den runden Hügeln des Vorgebirges anstieg. Die Sonne sah weiß aus hinter den Wolken. Ich verspürte eine aufregende Traurigkeit, etwas, das ich seitdem jedes Mal empfinde, wenn ich über trostlose, freie Flächen und einsame Begrenzungen hinwegblicke: ein Gefühl, als sei man am Rand der bekannten Welt angelangt.
Diese Erinnerung ist mir lieb und wichtig, aber der nächste Teil enthält zu viel spätere Einsicht, um eine echte Erinnerung zu sein. Immer noch an der Hand meines Vaters schaue ich zwischen den Bäumen hindurch zurück. Alle Bäume haben genau dieselbe Höhe, und durch die Äste hindurch sehe ich die geduckte Garage mit den weißen Wänden. Ein Gefühl der Vorahnung liegt über diesem Augenblick: Du wirst keinen Vater mehr haben, nur diesen verwunschenen Ort. Doch abgesehen davon, dass ich die Garage meide, wo er es getan hat, denke ich im Grunde nicht oft an ihn. Als er uns verließ, war ich zu klein, um das Ganze zu verstehen. Das Nein in meinem Aufsatz fiel mir leicht.
Am Montagmorgen legte ich meinen Aufsatz auf Pichegrus Lehrertisch und huschte schnell an meinen Platz, bevor er hereinkam. Andere Schüler gingen nach vorn und taten das Gleiche. Ich bereute, dass ich mein Blatt mit der Schrift nach oben auf den Tisch gelegt hatte, weil ich bemerkte, dass Henri Swain und Jo Verdier stehen blieben und es überflogen, bevor sie ihren Aufsatz darauflegten. Auf dem Weg zu seinem Platz warf Henri mir ein höhnisches Grinsen zu. Als Pichegru hereinkam, verstaute er die Aufsätze in seiner Schublade.
Zusätzlich zu unserem normalen Unterricht gab es an diesem Morgen einen kurzen Besuch von der Gehilfin des Apothekers, die Fragen zur Apothekerlehre beantworten sollte. Einige Klassenkameraden hoben eifrig die Hand. Am Verkaufstresen zu arbeiten und Tinkturen abzufüllen kam mir gar nicht so übel vor, aber der Apotheker war Luciens Vater, und er würde sicher eine der Lehrstellen erhalten. Ich blendete die Gehilfin aus. Das bevorstehende Auswahlverfahren sagte mir zwar überhaupt nicht zu, aber wenn Pichegru mich ablehnte, hatte ich keinen Schimmer, was ich sonst werden sollte. Meine Mutter hatte so auf dem Conseil beharrt, dass ich mir keine Alternativen zurechtgelegt hatte. Ich wusste, dass ich ihre Zukunftspläne mit erfüllen sollte. Mit jedem anderen Beruf würde ich die Erwartungen nicht erfüllen, die sie an ihr eigenes Leben gehabt hatte.
Ich lehnte draußen an der Wand und aß mein Schulbrot, als es neben meinem Kopf laut krachte. Kleine Putzbrocken flogen auf meinen Kragen. Ich zuckte zusammen und sah mich um.
Draußen auf dem Rasen standen Henri und Tom und unterdrückten ihr Gelächter. Ein mit weißem Staub bedeckter Gummiball landete im Gras.
Ach, sorry, Odile – hab nicht getroffen. Henri zuckte demonstrativ mit den Achseln.
Ich wurde rot und trat einen Schritt weg von der Stelle, an der der Ball die Wand getroffen hatte. Mein dunkelblauer Blazer war an der Schulter staubbedeckt. Ich bürstete mich ab und zog mir einen Putzbrocken aus den Haaren. Auf dem Boden lag ein Brot, und mir wurde klar, dass es sich um mein Mittagessen handelte. Ich überlegte gerade, ob ich es wohl retten konnte, als der Ball zum zweiten Mal einschlug.
Du hast wieder nicht getroffen, trompetete Tom und lachte sich halb tot.
Dieses Mal war ich nicht ganz so schlimm zusammengezuckt. Ich blieb mit dem Rücken an der Wand stehen und machte einen weiteren kleinen Schritt nach links, merkte aber sofort, dass ich einen Fehler beging. Ich bewegte mich zu automatisch, zu sehr wie eine Aufziehfigur. Henris Lachen erstarb, und er beäugte mich seltsam. Er nahm den Ball in die Hand.
Ich kniff die Augen zu, als der nächste Wurf kam, zog die Schultern hoch und machte einen weiteren Schritt zur Seite.
Das ist witzig, verkündete Henri.
Die anderen Schüler merkten, dass etwas los war, und beobachteten uns gespannt. Jedes Mal, wenn Henri den Ball warf, wich ich mit dem Oberkörper aus und bewegte mich einen Schritt weiter an der Wand entlang. Das Gelächter rund um den Rasen wurde lauter. Einige der Gaffer waren jünger, aber aus meiner Klasse waren auch welche dabei. Ich sah, dass Justine Cefai ein angewidertes Gesicht machte; Jo neben ihr grinste ungläubig. Edme Pira und Alain Rosso saßen unter einem Baum weit hinten auf dem Rasen und sahen ebenfalls her. Eine Lehrerin auf dem Spielfeld drehte mir den Kopf zu, kam aber nicht näher.
Warum ich immer weitere Seitschritte an der Wand entlang machte, wenn das Problem genau darin zu bestehen schien, weiß ich nicht. Ich hätte ja in den Wald hinter der Schule sprinten können. Ich sehnte mich danach, mich zwischen den Bäumen zu verstecken, aber wegrennen kam mir wie eine noch größere Demütigung vor. Ich setzte ein reserviertes Lächeln auf, während über mich gejohlt wurde, als fände ich das Ganze ebenfalls witzig.
Dann stieß Henri einen Fluch aus. Ich blickte auf und sah, dass Edme und Alain über den Rasen hinweg auf ihn zugestiefelt kamen. Sie hatten ihre Hemden vorn aus der Hose gezogen und in dem so entstandenen Beutel Äste gesammelt.
Hey, Henri!, rief Edme fröhlich. Er schleuderte einen Ast übers Gras und traf Henri damit am Schienbein. Alain warf ihm ein Stück Holz an die Schulter. Fluchend hielt Henri sich die Arme über den Kopf und verdrückte sich, Tom im Schlepptau. Edme und Alain schleuderten ihnen noch ihre restlichen Stöcke hinterher, ein Bombardement, das aber nicht mehr traf. Dann wischten sie sich die Hände ab und schlenderten zurück zu ihrem Baum.
Auf der Mädchentoilette reinigte ich meine Uniform und verbrachte den Rest der großen Pause drinnen. Blazer und Trägerkleid meiner Schuluniform waren feucht vom Waschbecken, und der Kopf tat mir weh, nicht vom Ball, der mich gar nicht getroffen hatte, sondern vom Zähnezusammenbeißen, den Nachwehen der Scham.
Es war natürlich nicht das erste Mal, dass ich gepiesackt worden war. Am schlimmsten war es meist zu Beginn des Schuljahrs, bevor es Henri und Konsorten langweilig wurde und sie sich eine andere Unterhaltung suchten. Aber an meiner Niedergeschlagenheit merkte ich, wie sehr ich gehofft hatte, es hätte sich endlich etwas verändert. Aber offensichtlich taugte ich immer noch nur als Opfer.
Edme saß eine Reihe seitlich vor mir. An diesem Nachmittag nahm Pichegru Geologie durch. Phyllit, Glimmerschiefer, Gneis. Neben Edmes Füßen stand ein lederner Kasten. Er spielte Geige in unserem kleinen Schulorchester. Sein Nacken hatte die Farbe von Sand im Schatten, und sein Haar war schwärzer als Schiefer.
Edme und Alain redeten nicht mit mir, aber sie ärgerten mich auch nicht. Die beiden waren unzertrennlich, Freunde noch aus der Kindergartenzeit. Alain wohnte bergab von unserem Haus. Er war ein Großmaul mit einem etwas groben Gesicht und rothaarig, genau wie ich, allerdings heller orangerot als meine dunkelroten Locken. Jahre zuvor, bevor ich so still wurde, hatten Clare und ich manchmal in unserer Nachbarschaft mit ihm gespielt. Alain hatte gern den Autos Äpfel hinterhergeworfen, und ich hatte zu viel Angst gehabt mitzumachen. Heutzutage war er im Grunde unverändert: aufgedreht, unberechenbar und frech. Als Klassenclown bekam er Pichegrus Rohrstock häufiger zu spüren als alle anderen. Zum Teil war er auch deswegen allgemein beliebt.
Edme wohnte noch weiter weg von der Schule. Seine Eltern arbeiteten im Abpackbetrieb und packten im Sommer Äpfel und Pfirsiche in Kisten. Im Winter sah man sie in der Innenstadt, immer zusammen, wo sie Schnee schippten und Salz auf die Bürgersteige streuten. Die Leute sprachen nie einzeln von ihnen, von Monsieur Pira oder Madame Pira, sondern immer nur von den allseits beliebten Piras. Manchmal kamen meine Mutter und ich an den beiden vorbei, wenn sie ihre Saisonarbeiten verrichteten, und sie grüßten uns immer lächelnd.
Ihr Sohn hatte eine leise Stimme und ein hageres Gesicht, die Haare hingen ihm lang ins Gesicht. Edme sah man nur selten bei uns in der Nachbarschaft, außer wenn er mit Alain unterwegs war. Dass sie so gut befreundet waren, schien vielleicht verwunderlich, aber sie waren einfach immer schon Freunde. Alain war laut, Edme nachdenklich, aber seine schmalen Augen tanzten. Er war nicht wirklich schüchtern: Wenn Alain irgendeinen irren Streich ausheckte, machte Edme mit geistesabwesendem Lächeln mit, als sei alles andere undenkbar. An einem Morgen unseres zweiten Schuljahrs, als wir acht oder neun waren, kletterte Alain vor der Schule auf eine Birke. Der Baum eignete sich nicht zum Klettern und schwankte unter Alains Gewicht. Aber er schaffte es fast bis zur Krone, zog seine Flöte heraus und blies schrill eine der Hymnen, die wir im Musikunterricht lernen mussten. Edme stellte sich unter den Baum und hob seine Geige ans Kinn. Mit geschlossenen Augen fiel er schräg und quietschend ein, was Absicht sein musste, da alle wussten, wie gut er spielen konnte. Ich versteckte mein Lächeln, ging zu meiner Wand, hörte aber immer noch das kreischende Echo und einen Lehrer, der die beiden schließlich anbrüllte, sie sollten aufhören. Dafür wurden sie geschlagen, aber nicht sehr schlimm, weil Pichegru nicht recht wusste, was er von der Sache halten sollte.
Nach der Schule trödelte ich, damit ich nicht zur gleichen Zeit wie Henri und Tom nach Hause zu laufen brauchte. Ich blieb so lange an meinem Platz sitzen, dass es Pichegru auffiel. Er sprach mich von vorne aus an.
Ich habe deinen Aufsatz gelesen. Ich werde dich nicht nominieren.
Mein Lehrer schob Bücher in seine lederne Aktentasche. Mehr schien er nicht sagen zu wollen.
Warum nicht?
Nachzufragen war ein Affront. Pichegru hatte mich so schnell abgekanzelt, dass ich seine Autorität als Lehrer vergessen hatte. Er wirkte irritiert, als brauche er das nicht zu erklären.
Ich habe dir eine Frage gestellt – Ost oder West – und du hast sie nicht beantwortet. Du hast nur ein bisschen Mitleid drüber gegossen.
Auf dem Weg nach draußen schaltete er die Deckenbeleuchtung aus, sodass ich im fahlen Nachmittagslicht sitzen blieb. Ich blinzelte in Richtung Spielplatz, Wiese und Teich, alles verschwamm und drohte überzulaufen, aber ich biss die Zähne zusammen und erlaubte mir nicht zu weinen.
Ich riss meinen Rucksack vom Haken in der Garderobe und rannte nach draußen. Das Schulgelände war menschenleer. Bei mir zu Hause wartete nichts auf mich als Stunden der Angst, bis meine Mutter nach Hause kam und mich fragte, wie es mit Pichegru gelaufen sei. Jenseits des sonnigen Rasens war der Wald, in den ich mich schon in der Mittagspause am liebsten geflüchtet hätte. Ich setzte den Rucksack auf, überquerte die Grünfläche, ließ die Schule hinter mir und wurde von den Kiefern verschluckt.
Der Wald hinter der Schule roch nach warmer Erde und Harz. Rötliche Ameisenhügel, abgefallene Kiefernnadeln und langsam zu Humus werdende Baumstümpfe wechselten sich ab. Unter meinen Füßen federte der Boden. Knarrende Äste antworteten auf den Klang meines Atems, der allmählich ruhiger ging.
Ich war schon eine ganze Weile nicht mehr im Wald gewesen. Den Weg hatte ich fast vergessen. Wenn ich weit genug ging, würde ich auf den Grenzzaun stoßen, das wusste ich, aber der war noch mindestens eine Meile weiter bergan. Hier unten war der Baumbewuchs noch dicht und die Steigung sanft. Ich folgte dem Pfad über die Kiefernnadeln. Der Boden war vom gleichen zarten Grau wie der Bauch einer Katze.
Als ich ein paar Minuten gelaufen war, lichtete sich der Bewuchs oberhalb des Wegs, dicke Grasbüschel und einzeln stehende Felsen tauchten auf. Ein Stück weiter oben zeigte sich ein steiniger Grat, an dessen Kante ich eine dünne Mauer aus Gebüsch sah. Etwas daran unterschied sich zu sehr von der Landschaft, um Zufall sein zu können; ich verließ den Pfad, um mir die Sache genauer anzusehen. Der Berghang war mit flachen, korallenroten Flechten bewachsen, die unter meinen Füßen knackten, als ich bergan kletterte. Ohne Bäume, die das Sonnenlicht filterten, musste ich mir die Hand schützend über die Augen halten. Ich ging über den Kamm auf etwas zu, das wie eine kleine Festung aussah.
Kinder hatten den Unterschlupf gebaut und entweder nur halb fertiggestellt, oder er war schon wieder verfallen. Ein dicker Baumstamm bildete die Basis der einzigen Wand, darauf war ein zusammengesackter Haufen Zweige wie ein Damm oder ein Vogelnest aufgetürmt. Aus diesem Haufen ragte aufrecht etwas heraus, das mir von unten aufgefallen war: totes, kupferbraunes Gebüsch, an dem die runden Blätter in der Brise flatterten und raschelten.
In dem verlassenen Unterschlupf war es friedlich. Auf dem festgetretenen Erdreich gab es etwas trockenes Moos und kleine Glimmersteine. Dankbar für Schatten und Schutz vor Blicken vom Weg weiter unten setzte ich mich hinein. Es wäre gar nicht so schwierig, hier ein wenig Ordnung zu schaffen, dachte ich. Man müsste nur frisches Laub auf dem Boden ausbreiten und die Wand aus Zweigen etwas verstärken. Von dem toten Baum war die Rinde abgefallen, und in den Stamm darunter waren flache Linien gezeichnet, von Holzwürmern, die sich in seltsamen Winkeln hindurchgefressen hatten. Als ich mich an den Baumstamm lehnte, kostete es mich immer mehr Mühe, die Augen offen zu halten. Ich bettete den Kopf auf meinen Rucksack und lauschte dem schwachen Wind, der durch die Wand pfiff.
Beim Klang von Schritten öffneten sich meine Augen. Jemand ging auf dem Pfad vorbei.
Ich hörte Stimmen, aber sie verflüchtigten sich gleich wieder und verrieten mir nichts, als dass ganz sicher andere Menschen in der Nähe waren. Bald waren sie verschwunden. Es hatte nach Erwachsenen geklungen, was für den Wald hinter der Schule ungewöhnlich war.
Ich hatte zwar eine Stunde geschlafen, aber die Erinnerungen an die Ereignisse des Tages hatten sich verhärtet, wie brennende Muskeln, die beim Aufwachen nur noch schlimmer schmerzten. Ich versuchte, nicht an Henris höhnisches Grinsen oder Pichegrus abfällige Bemerkung zu denken. Ich richtete mich auf und bürstete meine Schuluniform ab. Schräg fielen die Sonnenstrahlen durch die Wand des kleinen Forts. Die Sonne stand schon tief im Westen, und das Tal schien einen Seufzer der Erleichterung auszustoßen, als die Hitze endlich nachließ. Ich kraxelte den Abhang hinunter, bis ich wieder auf dem Weg ankam.
Die zur Schule gehörige Spielwiese war frisch gemäht. Der Hausmeister schloss gerade den Werkzeugraum ab. Es war fast halb fünf, meine Mutter würde bald heimkommen. Ich trödelte weiter am Rand des Spielplatzes herum und sah den Hausmeister, der seinen Wagen anließ und wegfuhr. Von der anderen Seite der Schule war Musik zu hören, die leicht schrägen Klänge einer Orchesterprobe.
Ich betrachtete die Schaukeln. Normalerweise waren sie für die kleinen Kinder reserviert, aber manchmal stellten sich auch meine Klassenkameraden aufs Brett und schaukelten, bis sie auf einer Höhe mit der Querstange waren, dann katapultierten sie sich hinunter in den Rindenmulch wie Klippenspringer.
Ich wischte einen Fußabdruck von dem schwarzen Schaukelbrett. Die Ketten quietschten, als ich mich setzte. Erst schaukelte ich lustlos, aber als ich anfing, die Fliehkraft zu spüren, hob ich die Hacken höher. Ein paarmal schnell pumpen, und schon flog ich mühelos hoch in die Luft. Ich fand es erstaunlich, wie viel Kraft die kleinsten Bewegungen freisetzen konnten. Trotz der Sorgen des Tages streckte ich die Fußspitzen.
Bald war ich fast an der Querstange, und der Wind sauste mir in den Ohren. Mit tränenden Augen blickte ich über die Wiese hinweg in die Ferne. Der Teich tauchte auf und wurde Himmel. Ich sehnte mich nach dem kurzen Moment des Stillstands am äußeren Rand der Schwerkraft, wenn ich den höchsten Punkt der Schaukel erreichte. Die Schaukel fiel wieder nach unten, und der Teich verschwand. Aber als ich wieder bis ganz nach oben kam, war ich verdutzt von dem, was ich hinter den Rohrkolben erblickte.
Drei Personen standen auf dem Teichwasser, so sah es zumindest aus. Alle hatten schwarze Masken vor den Gesichtern. Es waren zwei Männer und eine Frau – ihrer Haltung zufolge nicht mehr jung. Einer der Männer trug die grüne Uniform der Gendarmerie, die anderen formlose Besucherkutten. Ich beobachtete, wie der Mann in Grün sich zu der Frau hinbeugte. Sie schob die Maske nach oben, um zu antworten, aber der Gendarm zog ihr die Maske so heftig wieder nach unten, dass die Frau stolperte. Jetzt sah ich auch, dass sie auf einem wackligen Steg aus vertrocknetem Schilfrohr balancierten, der vom Ufer in den Teich ragte. Der Mann in dem Sackumhang hielt die Frau am Arm fest, damit sie nicht ins Wasser fiel. Und in diesem Augenblick, in dem sie sich aneinander festklammerten, starrten mich die beiden Besucher direkt an.
Entsetzen durchfloss meinen Körper. Als ich unten war, bohrte ich die Hacken gewaltsam in den Mulch. Ich sprang zu schnell von der Schaukel und taumelte zur Ecke des Schulgebäudes. Von dort blickte ich zurück. Ich sah die drei Gestalten immer noch jenseits der Spielwiese.
Ich hatte schon einmal Masken gesehen, aber nie, wenn ich weit und breit der einzige Mensch war. Heftig atmend versuchte ich einen klaren Gedanken zu fassen. Das mussten dieselben Leute sein, die ich im Wald auf dem Pfad gehört hatte, sie kamen also vom östlichen Zaun. Sie warteten in der Nähe der Schule, waren also wahrscheinlich die Eltern von jemandem – aber es waren zwei Personen, meine Eltern konnten es also nicht sein. Als ich an den leeren Fenstern der Klassenzimmer vorbeihastete, klammerte ich mich an diesem Gedanken fest: Sie waren nicht meinetwegen hier. Aber wie sie mich angestarrt hatten, das sah nicht nach Fremden aus. Ich rannte gerade an der Tür zu unserer Garderobe vorbei, als Edme um die Ecke kam, den Geigenkoffer in der Hand.
Ich wusste es augenblicklich.
Die Lippen, als sie die Maske angehoben hatte – es war Madame Pira. Es waren Monsieur Piras hektisch besorgte Bewegungen, als er sie festhielt. Mir fiel ein Stein vom Herz. Die Besucher waren die Piras; es waren die Piras, es hatte nichts mit mir zu tun.
Ihr Sohn hob vor mir die Hand zu einem beiläufigen Gruß.
Hi, Odile.
Ich war sprachlos. Ich blieb ein paar Schritte entfernt stehen und hielt mir den Bauch. Wir standen direkt voreinander. Ich war das Einzige zwischen ihm und dem Teich.
Fragend zog Edme die Augenbrauen hoch und musterte mich. Alles in Ordnung?
Ja, ja – mir geht’s gut.
Mein Körper blieb mit einer Entschlossenheit an Ort und Stelle stehen, die ich nicht verstand. Edme bemerkte es offensichtlich auch – den Augenblick, in dem wir aneinander hätten vorbeigehen müssen, es aber nicht taten – und schmunzelte.
Gut ist gut, sagte er. Die Peinlichkeit der Situation schien ihm nichts auszumachen. Irgendwie schaffte ich zur Antwort ein leichtes, luftiges Lachen, das wie ein Wimpel in der Sonne flatterte.
Was machst du?, fragte er.
Nichts. Nach Hause gehen.
Sonst sieht man dich hier nicht nach der Schule.
Ich habe mich ein bisschen oben im Wald rumgetrieben.
Ach, schön. Mir gefällt es da oben.
Ich sah hoch zu den Bäumen und nickte zustimmend. Aus dem Augenwinkel meinte ich zu bemerken, dass er das Gewicht verlagerte.
Ach übrigens, setzte ich schnell nach. Ich hab was gefunden. So eine Art kleines Fort.
Echt?
Ja, haben wahrscheinlich irgendwelche Kinder gebaut. Nichts Tolles, nur eine Wand. Ein bisschen ab vom Weg.
Ich lief rot an: Über so was zu reden war sicher total kindisch. Aber Edme erwiderte, dass er sich das gern mal angucken würde. Ob er damit meinte, mit mir zusammen, wusste ich nicht, also gab ich keine Antwort, und er führte es nicht weiter aus. Er nahm den Geigenkoffer in die andere Hand und lächelte wieder.
Wenn du auf dem Heimweg bist … einverstanden, wenn wir zusammen laufen? Die Probe hat heute früher aufgehört, ich glaube, ich gehe noch ein bisschen zu Alain.
Ich muss Ja gesagt haben, weil er sich umdrehte und wartete, dass ich ihm folgte. Ich muss neben ihm gegangen sein, weil wir das Schulgelände zusammen verließen, ohne am Spielplatz oder dem Teich vorbeizukommen.
Er lief auf dem Schotterstreifen neben der Straße, sein Gesicht nur ein Umriss vor der Sonne. Auf dem See hinter ihm glitzerte das Licht.
Mein Elternhaus lag nur zehn Minuten entfernt. Ich konnte das, was ich gesehen hatte, sicherlich zehn Minuten lang unterdrücken. Mit Edme an meiner Seite erschien es mir falsch, sogar unanständig, an etwas wie mein Erlebnis auch nur zu denken, und ich versuchte so zu tun, als sei nichts passiert.
Edme sagte gerade, er fände es schwer zu glauben, dass dieses Schuljahr schon unser Lehrjahr war. Er fragte, wofür ich mich bewerben wolle.
Ich musste seine Frage beantworten. Ich sagte etwas über das Conseil, aber bevor ich dazusagen konnte, dass ich es in den Sand gesetzt hatte, pfiff er.
Das Conseil, ja, das passt. Wir haben immer vermutet, dass du, na ja – weise bist.
Das war mir peinlich, aber ich freute mich auch sehr. Wer wir?
Nur ich und Alain. Aber die andern auch, garantiert. Du bist so ernst. ’tschuldigung, ich hoffe, das stört dich nicht, wenn ich so was sage?
Ich schaffte es, meine Füße anzulächeln und den Kopf zu schütteln. Ich sehnte mich nach einem Themawechsel. Wie sieht’s mit deiner Lehrstelle aus?
Tja, na ja, da gibt’s einen ziemlichen Streit deswegen. Ich will versuchen, aufs Konservatorium zu kommen. Da wird ein neuer Studiengang angeboten: Komposition und Violine, beides in einem. Aber meine Eltern wollen, dass ich was Nützliches mache, in der Metzgerei zum Beispiel. Edme hob den Geigenkasten hoch und zuckte die Achseln.
So schlimm wäre das auch wieder nicht, sagte ich tröstend. Mein Vater war Lebensmittelverkäufer.
Ja, das habe ich gehört.
Es war nichts Großes, dieser Satz, aber mir kam es sehr intim vor. Edme knirschte in freundlichem Schweigen über den Schotter. Die untergehende Sonne berührte die Bergkette am gegenüberliegenden Ufer.
Und was hast du vor?, fragte ich.
Er hüpfte vor mir und ließ dabei seinen Geigenkoffer schwingen. Seine Bewegungen waren schnell, fast kindlich. Keine Ahnung. Abwarten. Wäre schön, da drüben hinzugehen und es rauszufinden. Er machte eine Kopfbewegung in Richtung Berge.
Mein Magen verkrampfte sich, aber er redete weiter. Meine Eltern erlauben wenigstens, dass ich an der Aufnahmeprüfung teilnehme. Ich glaube, wenn ich es aufs Konservatorium schaffe, dann vergessen sie das ganze Metzgerding. Das heißt, ich habe noch ein paar Wochen Zeit, dann müssen meine Stücke perfekt sein.
Darauf wollte ich erwidern, dass er ja offensichtlich schon gut war. Aber ich befürchtete, das Kompliment würde geheuchelt klingen, obwohl es stimmte, deswegen sagte ich nichts. Wir kamen an die Einfahrt zu meinem Haus.
Schön, dass wir zusammen gelaufen sind, sagte Edme.
Ja, sagte ich.
Seine dunklen Augen funkelten. Bis morgen! Er tippte einen kleinen Trommelwirbel auf seinem Koffer und ging weiter bergab.
Sie fragte mich sofort, ob ich meinen Aufsatz abgegeben habe. Ich murmelte irgendetwas Zustimmendes. Meine Mutter muss angenommen haben, Pichegru würde länger für seine Entscheidung brauchen, weil sie sich nicht erkundigte, wie es ausgegangen war. Stattdessen lobte sie mich wieder für meine raffinierte Strategie: Mein Aufsatz demonstriere meinen ganz persönlichen Standpunkt – Klarheit und Gelassenheit angesichts meiner familiären Tragödie. Mit einem aufmunternden Blick wandte sie sich wieder dem Zwiebelschneiden zu. Bald duftete es im ganzen Haus, und ich merkte, wie hungrig ich war. Ich hatte nichts mehr gegessen, seit mein Brot in der Mittagspause heruntergefallen war. Bei Tisch konzentrierte ich mich aufs Essen und vermied jedes Gespräch über das Auswahlverfahren. Meine Mutter redete über eine Kollegin im Archiv, die schon seit einer Woche krank war. Deswegen musste sie jetzt zu Hause deren Arbeit nachholen. Ansonsten wurde kein weiteres Wort über das Conseil verloren, aber ich befürchtete trotzdem, Mutter könne auf das Thema zurückkommen, während ich abwusch. Ich spülte und trocknete das Geschirr in einem derartigen Tempo, dass ich beinahe einen Teller fallen ließ. So schnell ich konnte, ging ich auf mein Zimmer und machte die Tür hinter mir zu.
Ich wusste, was es zu bedeuten hatte, dass seine Eltern gekommen waren. In Wirklichkeit – anders als bei der hypothetischen Frage in dem Aufsatz – wurde die Erlaubnis, ein Tal zu verlassen und ein anderes zu betreten, nur bei Todesfällen gewährt. Auf ihrer Seite der Berge, zwanzig Jahre von hier, musste Edme nicht mehr da sein.
Erst war ich erleichtert gewesen, als mir klar wurde, dass es sich um die Piras handelte. Jetzt hatte ich Schuldgefühle deswegen. Ich hatte mich nicht mal bei Edme bedankt, dass er mich gegen Henri und Tom verteidigt hatte. Sollte er je wieder mit mir reden, musste ich das unbedingt nachholen.
Die schwarzen Masken waren größer als normale Gesichter, wodurch sie aus der Ferne sehr unheimlich, ja, bedrohlich wirkten. Dabei sollten sie nur ein Wiedererkennen verhindern. Viel hatte uns Pichegru darüber im Erdkundeunterricht nicht beigebracht, als wir noch klein und schreckhaft waren, nur: Nichts an den Masken war gruselig. Dahinter verbargen sich ganz normale Menschen. Trotzdem wirkten sie Furcht einflößend.
Es gab bestimmte Stellen im Ort, die den Besuchern als inoffizielle Aussichtspunkte dienten. Gendarmen aus den Nachbartälern begleiteten sie dorthin. Diese Stellen lagen meist ein wenig abseits, in der Nähe, aber nicht zu nah. Manchmal standen die Besucher hinter zwei großen Pappeln ganz am Ende des Parks. Von dort hatte man einen Blick auf den Pavillon und die große Rasenfläche, auf der gepicknickt oder Fußball oder Boule gespielt wurde. Einmal bemerkte ich eine Maske hinter einem Fenster des Zunfthauses, die darauf wartete, dass jemand Bestimmtes vorbeiging. Ich sah heimlich hin, obwohl man das eigentlich nicht sollte. Andere, die Besucher bemerkten, blickten weg. Die Anwesenheit der Fremden war verstörend: Der normale Fluss des Alltags wurde von ausdruckslosen, drohend wirkenden Gesichtern unterbrochen. Unwillkürlich fragte sich jeder, ob sie für einen selbst Unglück bedeuteten.
Krank wirkte Edme nicht. Ich dachte an die beiläufige Art, wie er den Streit mit seinen Eltern über das Musikstudium erwähnt hatte – nicht in der Art von jemandem, der etwas Dramatisches plante.
Im Vorjahr war ein Mädchen von der Innenstadtschule gestorben, Yvette Cressy. Sie hatte an einer schrecklichen Krankheit gelitten, sodass es keine Überraschung war, als es geschah. Ein- oder zweimal hatte ich sie, schwach am Arm ihrer Mutter, gesehen, so abgemagert, dass sie über dem Boden zu schweben schien.
Damals waren auch Masken zu Besuch gekommen. Ich selbst sah sie nicht, aber ich hörte Marie Valenti darüber reden: zwei ältere Leute und ein Gendarm, im Park, bei den Pappeln. Das Gerücht machte schnell die Runde. Wenn Yvette bemerkte, dass sie beobachtet wurde, muss sie ebenfalls eins und eins zusammengezählt haben. Dabei durfte eigentlich niemand wissen, wer die Besucher waren oder für wen sie kamen. Wenn sie sich irgendwo aufhielten, wo sie gesehen werden konnten, herrschte dort meist so viel Trubel, dass man nicht wissen konnte, nach wem sie Ausschau hielten. Und da alle gleich gekleidet waren, wusste man auch nicht, ob die Besucher aus dem Osten oder dem Westen kamen – außer, man hörte sie im Wald, nahe der Ostgrenze. Dann wusste man, dass sie wegen eines Trauerfalls da waren.
Ich lag in meiner Schuluniform auf dem Bett und rollte mich auf die Seite, um den Vorhang zuzuziehen. Eine kleine Motte, die Flügel zusammengefaltet wie ein Pfeil, hatte sich in die Falten der Patchworkgardine verirrt.
Marie Valenti hatte die Masken im Spätherbst gesehen; Yvette war erst im Frühjahr verstorben. Gleichgültig, was Edme zustoßen mochte – ihm blieb noch Zeit. Trotzdem bildete sich ein Knoten in meinem Magen. Ich hob die Bluse, um mir den Bauch zu reiben, aber das Gefühl von Fingern auf Haut verstärkte mein Unwohlsein nur noch. Es juckte mich am ganzen Körper. Ich war schrecklich aufgewühlt, wusste aber nicht genau, warum. Einfaches Mitleid war es jedenfalls nicht.
Ich versuchte, mich mit den Hausaufgaben abzulenken. Es war zwar erst der zweite Tag im Schuljahr, aber Pichegru hatte uns in Mathe schon Logikrätsel aufgegeben. Ich quälte mich durch die Beweise, strich meine falschen Entscheidungen durch, dann malte ich das Durchgestrichene geistesabwesend mit dem Bleistift aus, statt die Fehler zu korrigieren. Mir fiel auf, dass ich alle paar Minuten an die Decke starrte. Schließlich nahm ich meine Sachen, um in der Küche weiterzuarbeiten.
Einundzwanzig Uhr war schon vorbei. Meine Mutter saß immer noch über eine Kiste Akten gebeugt da. Ich schob mein Platzset beiseite und ließ meine Hausaufgaben ihr gegenüber auf den Tisch fallen. Sie blickte auf und lehnte sich zurück.
Ach, wir Armen, seufzte sie. Ich brauche noch ein Glas Wein.
Sie öffnete eine weitere Flasche und schenkte sich ein Glas ein, dann stellte sie auch mir ein Glas Wein neben die Hausaufgaben, was sie manchmal tat. An diesem Abend runzelte ich die Stirn und brummte, ich müsse klar denken können.
Meine Mutter wirkte überrascht. Du hast recht.
Ich löste meine Logikaufgabe langsam und merkte, wie Mutter mich über den Rand ihres Weinglases hinweg betrachtete.
Das wird schon alles, keine Sorge, murmelte sie.
Ich zögerte eine Sekunde, bevor ich aufblickte. Mutters Augen waren müde, und ihr Weinglas hatte unten einen roten Fleck. Du wirst schon sehen, Odile. Sobald du den Conseillers zeigst, was in dir steckt, werden sie hin und weg von dir sein. Aber ich merkte, dass ihr Blick nicht auf mich, sondern auf ihren Aktenordner gerichtet war.
In diesem Augenblick hätte ich ihr von Pichegrus Verdikt erzählen können, aber sie war nur selten so liebevoll zu mir. Ich fasste nach meinem Weinglas und prostete ihr zu.
Kurz danach ging meine Mutter zu Bett, nahm ihre Akten mit, ließ aber die halb volle Weinflasche stehen. Ich schleppte mich weiter bis zum Ende des Mathebeweises. Als ich die Aufgabe fertig hatte, riss ich die Seiten vorsichtig heraus, die ich morgen abgeben musste, und signierte sie. Als Zeichen von Bescheidenheit schrieb ich meinen Namen immer ganz klein: Odile Ozanne, die Buchstaben so eng beieinander, als wollten sie sich verstecken. Wenn Edme es sagte, klang es schöner: Hallo, Odile.
Ich leerte das Glas Wein und beschloss, mir noch eins einzuschenken. Ein schöner Name: Edme Pira. Wenn man ihn laut sagte, endete jedes Wort mit offenen Lippen, wie ein Versprechen auf mehr. Ich unterdrückte die seltsame Versuchung, den Namen einfach nur für mich in mein Notizbuch zu schreiben. Er war der erste Mensch seit Jahren, der nett zu mir gewesen war – wenn man die Kindheit ausklammerte, der erste. Aber ihm würde etwas zustoßen, und nur ich wusste darüber Bescheid. Niedergeschlagen fragte ich mich, wie ich mich jetzt ihm gegenüber verhalten sollte. Was, wenn er es mir ansah?
Mein Aufsatz hatte vor dem Besuch der anderen Täler gewarnt. Pichegru hatte behauptet, ich habe ihm keine richtige Antwort gegeben. Aber jetzt war mir klar, dass ich richtiger gelegen hatte als geahnt. Besuche sollten unbedingt vermieden werden – nicht nur, weil die Besucher selbst sie nicht als tröstlich empfinden würden, wie ich argumentiert hatte, sondern auch, weil die Besuche eine schreckliche Belastung für Unbeteiligte in der Nähe darstellen konnten. Wie leicht konnte es passieren, dass man einen Blick in die falsche Richtung warf und sah, wie sich eine Maske einen Augenblick hob, oder jemand eine vertraute Körperhaltung wahrnahm. Mehr brauchte es nicht, und schon kannte man ein schreckliches Geheimnis über seinen Nachbarn – etwas, das einem so lange durch den Kopf geisterte, bis jeder Gedanke davon eingefärbt war. Es war scheußlich, mit so etwas leben zu müssen, und nicht jeder würde genug Vernunft oder Selbstdisziplin besitzen, um es für sich zu behalten.
Die Hängelampe über dem Tisch flackerte. Ich goss mir den restlichen Wein ins Glas. Das Gefühl, das mich überkam, das mir wie ein Buschfeuer auf der Kopfhaut brannte, war schlimmer als jede Empörung: Es war Verachtung für Pichegru, für sein achtlos hingeworfenes Nein, für die Behauptung, ich hätte seine Frage nicht beantwortet, dabei hatte ich sie sehr wohl beantwortet, und zwar richtig. Ich nahm den Bleistift zur Hand und schrieb auf einer freien Seite in meinem Notizbuch, wie falsch es war, dass er mich abgelehnt hatte, und dass ich jetzt erst recht gegen das Verlassen unseres Tals argumentieren würde. Ich sah es nicht ein, dass ich mich für meinen Standpunkt entschuldigen sollte oder dass ich ungewollt ins Blickfeld der Piras geraten war – sie zu sehen und zu erkennen hatte ich mir nicht ausgesucht. Voller Verachtung malte ich dicke Kringel um die Worte »Risiko«, »Gefahr« und »Vorwissen«. Und dann schrieb ich Edmes Namen hin.
Ich träumte vom Schulspielpatz. Es war, als sei ich mitten in der Nacht zum Schaukeln dorthin zurückgekehrt. Die Masken sah ich nicht, aber ich wusste, dass sie in der Nähe waren. Die Wolken waren zu hell, fast gelb, und zischten wie Öl in der Pfanne.
Am Morgen war mein Bettlaken verknotet, meine Bettwäsche verschwitzt. Mein Mund war vom Wein wie ausgetrocknet, meine Zunge ein dürrer Lappen. Als ich mich zum Aufstehen zwang, pochte es schmerzhaft hinter meinen Augen. Undeutlich erinnerte ich mich, die Flasche ausgetrunken zu haben. Auf dem Schulweg kniff ich die Augen zusammen gegen das grausam stechende Sonnenlicht, ließ mich dann draußen gegen die Wand sinken und schloss die Augen, bis es klingelte.
Alain hing bei Edmes Tisch herum und streckte seinen Hintern in den Gang. Edme hatte mich nach unserem gemeinsamen Gang gestern noch nicht gegrüßt, aber ich war wegen der Kopfschmerzen froh, mich vor Beginn des Unterrichts tot stellen zu können. Erst als Lucien sich mit einem Blatt Papier in der Hand an mir vorbeidrängte, fielen mir meine Hausaufgaben wieder ein.
An Pichegrus Lehrertisch öffnete ich mein Notizbuch. Ich wollte die Matheaufgabe gerade auf den Stapel legen, als ich mein betrunkenes Geschreibsel auf der nächsten Seite bemerkte. Es war mein gerechter Zorn auf Pichegru, verziert mit einem kreisrunden weinroten Fleck. Ich hatte die Seite ausgerissen, aber nicht weggeworfen. Schnell legte ich meine Logikaufgabe darüber. Jemand pikte mich in die Schulter.
Und, was hast du für ein Gefühl? Auf einer Skala von eins bis zehn?
Alain sah mir fragend ins Gesicht. Ich brauchte einen Augenblick, bis mir klar war, dass er von der Aufgabe redete.
Skala, wiederholte ich. Ähm. Sagen wir sechseinhalb.
Sechseinhalb, überlegte Alain. Das ist ja halbwegs respektabel. Macht’s dir was aus, wenn ich abschreibe? Wer mit Pira befreundet ist, ist auch mein Freund. Nur ein bisschen freundliches Abschreiben …
Ich reagierte nicht schnell genug, und im nächsten Moment hatte Alain mir die Hausaufgaben aus der Hand gerissen. Er spritzte um mich herum und fing an auf dem großen Eichentisch meinen Beweis abzuschreiben. Hilflos stand ich da, während ich Pichegru den Gang entlangkommen hörte.
Ach, Scheiße, seufzte Alain und warf einen Blick zur Tür. Er schob die Seiten in den Hausaufgabenstapel und klopfte ihn gerade, als Pichegru hereinkam. Wir senkten beide den Blick und gingen an unsere Plätze. Edme lachte lautlos in sich hinein, als ich an ihm vorbeiging.
An der Stelle, an der die Spielwiese in einem sumpfigen Gelände endete, bog ich auf den Pfad ein, der um den Teich herumführte. Tote Zweige hingen wie Klauen über den Uferweg. Das Kindergekreisch der Mittagspause schien aus weiter Entfernung zu kommen.
Es dauerte nicht lang, bis ich die Stelle fand, an der die Besucher gestanden hatten. Ich brauchte bloß ein paar Schritte das Ufer hinunterzugehen, dort war eine Reihe Schilfrohr seitlich abgeknickt und bildete einen schwimmenden Steg auf dem Wasser. Erst trat ich nur mit den Zehen auf, dann stellte ich mich mit dem ganzen Körpergewicht auf das Schilfrohr. Zwischen dem Schilf suppte der Schlamm hoch. Es gab keine Fußabdrücke, keine Zigarettenkippen, kein Anzeichen, dass jemand hier gewesen war. Im flachen Wasser schwammen dicke orangefarbene Kaulquappen.
Als ich vom Teich zurückkam, begegnete ich Edme und Alain am Rand der großen Wiese. Alain hatte einen Lederball vor den Füßen.
Ach, da ist ja unsere Mademoiselle Ozanne, die mir heute so gnädig mit den Hausaufgaben geholfen hat, sagte er. Alain redete oft so, dass man nicht wusste, ob es sarkastisch gemeint war oder nicht.
Edme verdrehte die Augen. Hilf dem bloß nicht, sagte er zu mir. Wenn du’s einmal tust, ist es vorbei. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er überhaupt lesen und schreiben kann. Vielleicht kopiert er einfach nur die Krakel, die ich mache.
Das ließe sich ja gut ausnutzen, erwiderte ich.
Du kannst mich mal und du auch, sagte Alain friedfertig und zeigte nacheinander auf uns. Er hob den Ball mit der Fußspitze hoch und kickte ihn in die Luft.
Edme beachtete ihn gar nicht. Wir haben uns gefragt: Das Fort, das du gefunden hast, weißt du? Würdest du uns das vielleicht zeigen?
Na klar. Ich errötete. Ich meine, es ist nichts Tolles.
Die Schulglocke war über die Wiese hinweg zu hören. Alain trat den Ball ins Unkraut.
Wie wär’s nach der Schule?, fragte Edme.
Heute? Gut, einverstanden.
Zurück im Klassenzimmer schlug ich eine freie Seite in meinem Notizbuch auf. Ich hatte gerade das Datum oben draufgeschrieben, da merkte ich, dass die Seite mit dem Weinfleck nicht mehr da war. Ich sah noch vor mir, wie Alain sich meine Hausaufgaben geschnappt und dann in den Papierstapel auf Pichegrus Lehrertisch geschoben hatte.
Ich sah nach vorn. Die Aufgaben waren verschwunden.
Ich durchsuchte mein Notizbuch, das Fach unter meinem Tisch, wieder das Notizbuch. An alles, was ich geschrieben hatte, erinnerte ich mich nicht mehr, aber einzelne Sätze standen mir mit übelkeiterregender Deutlichkeit vor Augen. Aus jedem meiner Sätze hatte dunkler Zorn gesprochen. Ich hatte klargemacht, dass mein Urteil dem von Pichegru überlegen war. Und noch schlimmer: Ich hatte die Piras beim Namen genannt – Pichegru würde mir natürlich vorwerfen, dass ich ihm etwas verraten hatte, das weder er noch ich wissen sollten. Ich würde zweifellos bestraft werden. Wie Ungehorsamkeit eines solchen Ausmaßes geahndet wurde, wusste ich nicht. Meist benutzte Pichegru den Rohrstock, um uns zu disziplinieren. Seine Reaktion auf einen derart schweren Verstoß hatte ich noch nicht erlebt.
Den restlichen Tag über hielt ich den Blick gesenkt und starrte auf den Tisch. Nur einmal, als ich bei einem Test vorzeitig fertig wurde, wagte ich es aufzublicken. Edme schrieb, die Wange fast auf dem Blatt. Aus dem Augenwinkel schien es, als beobachte Pichegru ihn möglicherweise, aber ich wagte nicht nachzusehen. Ich machte den Fehler, einen Blick in Henris Richtung zu werfen, der seinen Gummiball unter dem Handteller rollen ließ. Gelangweilt betrachtete er mich mit hochgezogenen Augenbrauen.
Der ständige Blick auf die Wanduhr ließ den Tag endlos erscheinen: halb zwei, halb drei. Ich dachte, ich hätte den Kater endlich ausgestanden, aber er verlagerte sich nur vom Kopf in meine Eingeweide, wo er zusammen mit der Angst einen kalten Klumpen bildete. Ich fühlte mich elend und rutschte auf meinem Platz hin und her.
Endlich klingelte es. Ich versuchte, schnell mit allen andern rauszugehen, aber Pichegru brüllte meinen Namen.
Es gab kein Entkommen. Gegen den Strom der Klassenkameraden bahnte ich mir einen Weg nach vorn. Pichegru stützte sich mit beiden Händen auf den Lehrertisch, als wolle er mich anspringen. Aber stattdessen brüllte er an mir vorbei: Verdier!
Verwirrt drehte ich mich um. Ich sah, wie Jo Justine begeistert anschaute. Sie eilte nach vorn, strich sich die glänzenden schwarzen Haare glatt und warf mir einen nervösen Blick zu. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen, was vor sich ging.
Ihr interessiert euch beide für eine Laufbahn beim Conseil, sagte Pichegru. Das Auswahlverfahren beginnt morgen.
Er händigte Jo einen Zettel aus und hielt auch mir einen hin.
Sie haben uns nominiert?, fragte Jo aufgeregt.
Ja.
Draußen vor der Garderobentür warteten Edme und Alain auf mich, und Justine wartete auf Jo, deswegen standen sie zusammen. Als ich rauskam, unterhielt Alain sich gerade mit Justine. Sie hatte goldbraune Haare und sommersprossenübersäte, gebräunte Haut. Wenn sie kicherte, schob sie sich die Haare hinter die Ohren, die oft rot anliefen. Diese Minischamröte sah liebenswert aus, das Gegenteil von peinlich. Jo rannte an mir vorbei und warf sich Justine in die Arme.
Ich bin drin!, jubelte sie. Beide sprangen im Kreis herum.
Meinst du im Conseil?, fragte Edme belustigt.
Genau! Ich – und Odile. Jo unterbrach ihr Jubelgeschrei, um mich zu mustern. Ich wusste gar nicht, dass du so ehrgeizig bist.
Ich bekam ein Achselzucken hin.
Das ist ja super für euch, freute sich Edme. Glückwunsch.
Und Odile hat’s auch ohne reichen Daddy geschafft, witzelte Alain.
Jo zog eine Schnute. Hey, pass auf, was du sagst. Du weißt, was mit ihrem Dad …
Ja, Mist. Tut mir leid.
Alle sahen mich an. Macht doch nichts, sagte ich leise. Dann fügte ich trocken hinzu: Aber du kannst mich mal, Alain.
Einen kurzen Augenblick befürchtete ich, mich vertan zu haben, aber sie waren nur verblüfft: Alain, Edme und Justine lachten laut los, und Jo warf mir ein anerkennendes Grinsen zu. Es schien, als ließe sich damit spielen, dass mich alle für stocksteif hielten. Alain verbeugte sich vor mir, und als er wieder hochkam, ließ er vor den anderen seinen hochgereckten Mittelfinger wackeln. Diese kleinen, geschmackvollen Gesten von dir, die muss man einfach gernhaben, bemerkte Edme.
Es war nur natürlich, dass wir Jo und Justine auch mit zum Fort einluden, auch wenn ich darauf beharrte, so interessant sei es nun wirklich nicht. Zu fünft betraten wir den Waldweg. Im Wald summte es vor Insekten.
Ich zeigte den Hang hinauf, wo nur noch vereinzelte Bäume standen und die Sonne vom Himmel knallte. Die Jungs zogen ihre Blazer aus. Die weißen Hemden blendeten. Jo und Justine lockerten ihre Krawatten und knöpften den Kragen auf, also tat ich es ihnen nach. Als ich ihnen bergauf folgte, wischte ich mir den Schweiß von der Stirn und verschmierte dabei eine kleine Fliege mit dem Daumen.
Das soll es sein?, fragte Jo und begutachtete die aus Ästen gebaute Wand, eine Hand in die Hüfte gestützt.
Ich weiß, sagte ich entschuldigend. Wie ich sagte: Es ist echt nichts Besonderes.
Nichts Besonderes?, rief Alain. Das ist jetzt nicht dein Ernst! Die Stelle ist perfekt. Er stieg auf den Baumstamm und von da auf den Zweighaufen. Es gibt jede Menge Baumaterial. Man hat eine tolle Aussicht. Und den taktischen Vorteil, dass man hier ganz weit oben ist.
Willst du in die Schlacht ziehen oder was?, fragte Justine.
Nein, ich finde es bloß gut, irgendwo abhängen zu können, antwortete Alain. Aber falls es hier oben zu einer Schlacht kommen sollte …
Er ließ einen Stock wie einen Speer bergab fliegen. Als der Stock auf den Weg traf, wirbelte Staub auf.
Wo wir über Schlachten reden, sagte Jo. Henri ist total sauer auf euch, dass ihr ihn gestern attackiert habt.
Edme lachte. Henri ist ein echtes Stück Scheiße. Tom auch.
Tom ist ein etwas kleineres Stück Scheiße, sagte Alain. Etwas, das man vielleicht als Kackhaufen bezeichnen könnte.
Ja, die zwei sind manchmal echt beschissen drauf, pflichtete Jo ihm bei. Sie und Henri waren Kindheitsfreunde: Die Verdiers und die Swains waren im Norden die einzigen wohlhabenden Familien mit Verbindungen zur Reiche-Leute-Gegend in der Innenstadt.
Ich spielte an den Falten meines Trägerkleids herum. Ich hätte mich gern bei Edme und Alain dafür bedankt, dass sie Henri und Tom vertrieben hatten, mochte es aber nicht vor Jo tun. Ich hatte sie lachen gesehen. Besser abwarten, dass das Gespräch sich einem anderen Thema zuwandte, was es auch kurz darauf tat. Alain ging um den Wall herum und hob herabgefallene Zweige auf. Edme folgte, und dann stieg auch ich vorsichtig auf dem steilsten Abschnitt des Hangs nach unten. Jo und Justine blieben oben. Ich befürchtete immer noch, dass sie mein Fort kindisch fanden, aber sie nahmen willig die Steine und Zweige entgegen, die ich ihnen hochreichte, und bauten sie in die Festung ein.
Noch viele Nächte später kehrte ich zu dieser Erinnerung zurück, obwohl gar nichts Besonderes passiert war. Alain und Edme stehen unterhalb von mir und reichen Sachen an mich weiter. Ich balanciere auf losen Schieferstückchen, bleibe leicht in den Füßen, damit ich keine Lawine lostrete. Edme gibt mir einen dicken, grauen Stein voller Luftlöcher, der unten feucht ist. Er wartet, bis ich den Stein fest in der Hand halte, bevor er ihn loslässt. Ich reiche ihn weiter an Justine, die die sommersprossige Nase über das feuchte Gefühl rümpft. Es kommt mir vor wie ein Wunder, hier zu sein, in der Mitte dieser Menschenkette.
Als wir genug Material bewegt hatten, setzten wir uns auf die Flechten oberhalb der Festung und bewunderten unser Werk.
Justine fragte mich, was ich in meiner Bewerbung fürs Conseil geschrieben habe. Sie hatte auch einen Aufsatz geschrieben, war aber nicht ausgewählt worden.
Odile hat sich einfach um Pichegrus Frage rumgemogelt, antwortete Jo an meiner Stelle. Tut mir leid, ich hab reingelesen.
Wie meinst du das?, fragte Justine.
Jo sah mich ironisch bewundernd an.
Sie hat einfach geschrieben: »Ich würde nirgendwohin gehen – weder dahin noch dorthin.« Ich fand das ziemlich genial. Na ja, wenn ich ganz ehrlich sein soll, hab ich’s eigentlich für verrückt gehalten, aber es hat ja funktioniert! Ich meine, du hast es gut begründet, glaube ich. Aber auf den Gedanken wäre ich echt nie gekommen.
Edme riss beeindruckt die Augen auf. Und wie lautete das Thema?
Pichegru hat verlangt, dass wir sagen, in welche Richtung wir gehen würden, erklärte Jo. Wenn das Conseil einem erlauben würde, ein anderes Tal zu besuchen.
Und was hast du geschrieben?, fragte ich.
Jo reckte die Hand in die Luft, drehte das Handgelenk und zeigte auf die Berge hinter uns. Angeblich ist es gefahrloser für die Leute hier, wenn man nach Osten geht, deswegen habe ich das genommen. Meine Eltern wollen unbedingt, dass ich reinkomme.
Ach, das klappt bestimmt, sagte Justine. Ich meine, ihr schafft das beide.
Na ja, da herrscht schon ein enormer Konkurrenzdruck, sagte Jo. Ich wette, auf lange Sicht wirst du glücklicher mit deiner zweiten Wahl, Justine. Beim Tierarzt, erklärte sie uns anderen.
Schön, sagte Alain. Wie ich höre, bewirbt sich Émilie auch dafür.
Justine stöhnte. Wäre es irgendwie in Ordnung, wenn ich sie bitte, das nicht zu tun?
Komm doch einfach mit ins Sägewerk, dann können wir da zusammenarbeiten, sagte Alain.