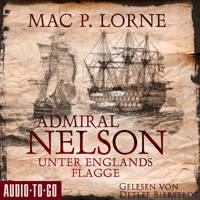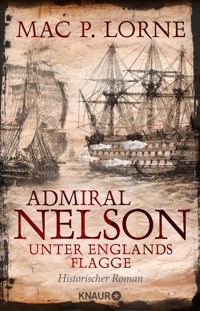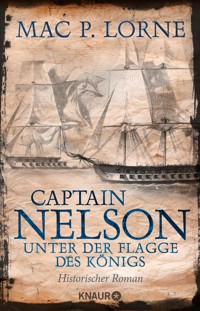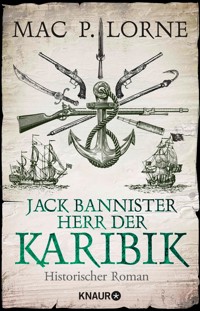9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Robin Hood-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der vierte Band der beliebten Robin-Hood-Serie vom erfolgreichsten Experten für historische Abenteuer Dem ehemaligen König der Diebe ist auch im Jahre 1218 kein beschauliches Leben vergönnt: Kaum aus England zurückgekehrt auf sein Landgut in der Gascogne, wird Robin Hood Zeuge, wie die Schergen Simon de Montforts ein Dorf niederbrennen. Im Auftrag des Papstes befehligt de Montfort den Kreuzzug gegen die Katharer, der mit äußerster Brutalität geführt wird – und mehr als ein politisches Ziel verfolgt. Gemeinsam mit seiner Frau Marian, seinem Freund Charles d'Artagnan und den alten Gefährten aus dem Sherwood Forest stellt Robin Hood sich erneut auf die Seite der Verfolgten. Nach "Das Herz des Löwen", "Das Blut des Löwen" und "Die Pranken des Löwen" der vierte Band in der erfolgreichen historischen Serie um den König der Diebe Robin Hood.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 693
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mac P. Lorne
Das Banner des Löwen
Die Robin-Hood-Reihe
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der vierte Band der beliebten Robin-Hood-Serie vom erfolgreichsten Experten für historische Abenteuer.
Dem ehemaligen König der Diebe ist auch im Jahre 1218 kein beschauliches Leben vergönnt: Kaum aus England auf sein Landgut in der Gascogne zurückgekehrt, wird Robin Hood Zeuge, wie die Schergen Simon de Montforts ein Dorf niederbrennen. Im Auftrag des Papstes befehligt de Montfort den Kreuzzug gegen die Katharer, der mit äußerster Brutalität geführt wird – und mehr als ein politisches Ziel verfolgt. Gemeinsam mit seiner Frau Marian, seinem Freund Charles d’Artagnan und den alten Gefährten aus dem Sherwood Forest stellt Robin Hood sich erneut auf die Seite der Verfolgten.
Nach »Das Herz des Löwen«, »Das Blut des Löwen« und »Die Pranken des Löwen« der vierte Band in der erfolgreichen historischen Serie um den König der Diebe Robin Hood.
Inhaltsübersicht
Widmung
Karte 1
Karte 2
Wappen
Personenregister
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Epilog
Historische Anmerkungen des Autors
Zeittafel
Glossar
Bibliografie
Für Gerlind und Arnulf, die mir das für mich Wichtigste geschenkt haben.
Westfrankreich um 1220
Okzitanien um 1225
Personenregister
(historische Personen sind mit einem * gekennzeichnet)
Robert Fitzooth, auch Robert von Loxley, später Robin Hood – geb. 1160 in Loxley, gest. 1247 in Kirklees Priory, seit Oktober 1190 Sir Robert von Loxley, seit August 1192 Earl von Huntingdon
Marian Leaford – seine Frau, geb. 1165 in Fenwick, gest. 1243 in der Gascogne
Fulke* – Sohn von Richard Löwenherz und Joan de Saint-Pol (Existenz spekulativ), Ziehsohn von Robin Hood und Marian Leaford
Blanche, seine Gemahlin, Nichte von William Marshal
Little John, Will Scarlet, Much Millerson, Alan a Dale, Bruder Tuck – Gefährten von Robin Hood
Richard Plantagenet*, Bruder von Henry III., später römisch-deutscher König – geb. 05.01.1209, gest. 02.04.1272
William Plantagenet*, genannt »Longsword« – Halbbruder von Richard und John, geb. um 1170, gest. 07.03.1226
Walter Marshal* – Sohn von William Marshal, 5. Earl von Pembroke, geb. 1196, gest. 24.11.1245
Berengaria von Navarra* – Witwe von Richard Löwenherz, geb. um 1167, gest. 1230 in Le Mans
Philipp II.* – seit 1188 König von Frankreich, ehemaliger Freund, später Feind Richards I., geb. 1165, gest. 1223
Prinz Louis* – sein Sohn, ab 1223 König von Frankreich, geb. 05.09.1187, gest. 08.11.1226
Blanka von Kastilien* – seine Frau, geb. 1188, gest. 27.11.1252
Romano Bonaventura* – vermutlich ihr Liebhaber, Kardinal und päpstlicher Legat für Frankreich, gest. 20.02.1243
Raimund VI.* – Graf von Toulouse, Schutzherr der Katharer, geb. 1156, gest. 1222
Raimund VII.* – sein Sohn, letzter Graf von Toulouse aus dem Geschlecht der Raimundiner, geb. 1197, gest. 1249
Simon de Montfort* – Anführer des von Papst Innozenz III. initiierten Kreuzzuges gegen die Katharer, der die Eroberung des Languedoc zum Ziele hatte, geb. um 1160, gest. 25.06.1218
Amaury de Montfort* – sein Sohn und Erbe, geb. 1195, gest. 1241
Guido de Montfort* – sein Bruder und Stellvertreter, geb. vor 1170, gest. 31.01.1228
Folquet de Marselha* – geb. um 1150, zuerst Troubadour, von 1206 bis zu seinem Tod 1231 Bischof von Toulouse und Verfolger der Katharer
Dominikus – Gründer des später nach ihm benannten Predigerordens, der zuerst durch das Wort, später über Jahrhunderte durch Feuer und Schwert versuchte, jede Art von Häresie oder das, was die Inquisition und der Klerus dafür hielten, auszurotten, geb. um 1170, gest. 06.08.1221
Peter Mauclerc* – Herzog der Bretagne und Earl von Richmond, geb. 1191, gest. 06.07.1250
Graf Theobald von Champagne* – später König von Navarra, geb. 30.05.1201, gest. 08.07.1253
Graf Hugo von Lusignan* – Stiefvater von Prinz Richard, geb. um 1200, gest. 05.06.1249
Isabella von Angoulême* – seine Gemahlin, Mutter von König Henry III. und Prinz Richard, geb. um 1188, gest. 04.06.1246
Charles d’Artagnan – Herr auf Castelmore, Freund von Robin und Marian
Jean und Francois d’Artagnan – seine Söhne, Letzterer Steward auf Château de Lisse
Prolog
Paris, April 1216
König Philipp II. von Frankreich, der seit seinem Sieg bei Bouvines über das Heer des deutschen Kaisers Otto IV. und der Niederlage des englischen Königs John, neuerdings nicht mehr Johann Ohneland, sondern immer öfter König Weichschwert genannt, den Beinamen Augustus führte, blickte auf den vor ihm knienden Mann herab. Sollte durch diesen sein größter Traum womöglich tatsächlich wahr werden?
Simon de Montfort führte seit sieben Jahren den Kreuzzug gegen die ketzerischen Katharer, nach ihrem Stammsitz, der Stadt Albi, auch Albigenser genannt, im Süden des Landes an. Nun war er gekommen, um das Herzogtum Narbonne, die Grafschaft Toulouse sowie die Vizegrafschaften Béziers und Carcassonne, die seit Menschengedenken weitgehend unabhängig von der Krone gewesen waren, dem König von Frankreich zu Füßen zu legen. Dafür erhoffte er sich seine Legitimierung als Graf von Toulouse und die Rückgabe der eroberten Gebiete an ihn als Kronlehen. Wahrlich nicht viel, bedachte man, dass Philipp, außer seiner Ritterschaft zu gestatten, sich am Kreuzzug zu beteiligen, keinen Finger gerührt hatte, um ihn dabei zu unterstützen, diese Häretiker und vor allem den sie unterstützenden Adel in Okzitanien, der Provence und dem Languedoc zu unterwerfen. Doch nun war es nahezu vollständig gelungen, die Katharer zu vernichten und die alten Herren zu vertreiben oder gefangen zu nehmen. Graf Raimund VI., der über dieses reiche Land geherrscht hatte, und sein Sohn waren nach England geflohen. Mit den letzten Widerstandsnestern, da war sich der von seiner heiligen Mission überzeugte Kreuzritter sicher, würde man auch bald fertigwerden. Da konnte er doch wohl davon ausgehen, dass ihm dieses große Fürstentum, welches im Süden an Aragon, im Osten an das Deutsche Reich und im Westen an Aquitanien grenzte und das er in zähem Ringen über Jahre erobert hatte, als erbliches Lehen zugesprochen wurde. Noch dazu, wo er sich als Vasall des französischen Königs sah und die Lehnspflicht im Gegensatz zu den Raimundinern durchaus ernst nahm.
Philipp war sich da allerdings nicht so sicher. Machte er womöglich den Bock zum Gärtner, entsprach er dem Verlangen de Montforts? Bisher hatten sich die Grafen von Toulouse jedenfalls immer dem Herrschaftsanspruch der Krone widersetzt. So war Frankreich in der Vergangenheit der direkte Zugang zum Mittelmeer verwehrt und es dadurch vom einträglichen Handel mit den Seerepubliken Venedig, Genua und Pisa nahezu ausgeschlossen gewesen. Selbst für Kreuzzüge ins Heilige Land mussten die Truppen eine Durchmarscherlaubnis entweder des deutschen Kaisers oder der Raimundiner einholen, die einzig von deren gutem Willen abhing. Das würde sich natürlich alles ändern, wäre die Grafschaft Toulouse ein Kronlehen und erstreckte sich das Herrschaftsgebiet des französischen Königs zukünftig von der ehemals kleinen Île-de-France bis an die Gestade von Atlantik und Mare Nostrum.
Philipp selbst hatte nach dem Tod von Richard Löwenherz dessen Bruder John weite Teile des ehemaligen, großen Angevinischen Reiches abgenommen. Nur ganz im Süden Frankreichs gehörten noch Teile Aquitaniens und die Gascogne zu den Ländereien des englischen Königs. Die Grafschaft Toulouse würde seinen Besitz natürlich wunderbar abrunden und ein Einfallstor in die den Plantagenets verbliebene Provinz abgeben. Obwohl – vielleicht bekam man sie ja ohne Kampf übereignet, denn sein Sohn Louis war gerade dabei, ein Heer für eine Invasion Englands an der Küste zu versammeln. Einige abtrünnige Barone auf der Insel hatten ihn gerufen und ihm Johns Krone angeboten. Er, Philipp, hielt das Unternehmen zwar für wenig aussichtsreich, und außerdem hatte der Papst es verboten, doch letztlich konnte man nie wissen, wie ein solches Abenteuer ausging und ob nicht womöglich bald Frankreich und England unter einem Herrscher vereint waren. Die nächste Zeit würde jedenfalls recht kurzweilig werden, und der französische König war auf Gottes weisen Ratschluss wirklich gespannt.
»Seid Ihr bereit, Simon, Herr über Montfort und Earl von Leicester, die durch Euch und Eure Mannen von den abtrünnigen Häretikern, die sich von unserer heiligen Mutter Kirche abgewandt haben und Irrlehren folgen, eroberten Gebiete der Krone Frankreichs zu übereignen?«
Philipp war sich durchaus bewusst, dass Teile der besetzten Gebiete, wie etwa Carcassonne und Béziers, zur Krone Aragon gehörten und weder er noch Montfort Rechte darauf besaßen. Doch wenn einem diese reichen Ländereien mit ihren wehrhaften Städten auf einem Silbertablett dargereicht wurden, wer konnte da schon widerstehen?
»Das bin ich, mein König. Bereits jetzt gilt in den unterworfenen Provinzen das Recht der Île-de-France. In den Statuten von Pamiers habe ich verfügt, dass nur noch Eure königlichen Erlasse anzuwenden sind, und okzitanisches Gesetze für ungültig erklärt. Auf zwanzig Jahre darf kein toulousianischer Ritter Waffen tragen und keine Frau, kein Mädchen von Adel einen Einheimischen heiraten. Ausschließlich Vermählungen mit französischen Edelleuten sind ihnen erlaubt. Das neue Erbrecht wird dafür sorgen, dass bald nur noch Euch lehnspflichtige Adelige über die südlichen Ländereien gebieten und dem Ketzertum dort ein für alle Mal die Grundlage entzogen wird. Die okzitanische Sprache ist verboten worden, und es darf in den Kirchen, vor Gericht, bei Amtshandlungen und in Dokumenten nur noch die französische verwendet werden. In Eure Hände lege ich das Schicksal des Landes und seiner Menschen. Wir, die wir vom Heiligen Vater beauftragt wurden, die Ketzer zum einzig wahren Glauben zurückzuführen, werden nicht ruhen, bis auch der Letzte von ihnen bekehrt oder im läuternden Feuer verbrannt ist. Das Land überantworten wir Eurer Gnade und Weisheit und schwören Euch als Eure Vasallen ewige Treue.«
Die Augen des fanatischen Kreuzritters funkelten wie im Fieber. Immer wieder packte ihn nach erfolgreicher Einnahme einer Stadt oder eines festen Platzes der Blutrausch, und Tausende und Abertausende waren bereits seinem religiösen Wahn zum Opfer gefallen. Dafür lebte er, das war sein ganzes Streben, und als bestätigter Graf von Toulouse würde er nach der kirchlichen bald auch noch über die weltliche Autorität verfügen, die ihm bisher gefehlt hatte.
Philipp hatte nun keine Zweifel mehr. Wenn ihm die wohlhabenden Provinzen im Süden wie ein reifer Apfel in den Schoß fielen, konnte er seine ganzen Kräfte darauf verwenden, die letzten Ländereien der Plantagenets seinem Reich einzuverleiben, das dann von den Pyrenäen bis zur britischen See, vom Mittelmeer bis nach Flandern reichen würde.
Er selbst hatte die Aufforderung des Heiligen Vaters, den Kreuzzug gegen die Katharer anzuführen, mit der Begründung abgelehnt, dass er zwei mächtige Löwen an seinen Flanken hatte, die nur darauf warteten, Frankreich zu zerreißen. Er meinte damit damals den deutschen Kaiser Otto und den englischen König Richard. Doch den Ersten hatte er vernichtend geschlagen, und Letzterer war zu seiner großen Freude bei einer völlig unsinnigen Belagerung von einem Armbrustbolzen verwundet worden und kurz darauf verstorben. Mit dessen Bruder John hatte er wesentlich weniger Probleme. Es sprach also aus Philipps Sicht eigentlich nichts dagegen, sich nun selbst an dem Kreuzzug zu beteiligen. Aber warum sollte er das tun, wenn er doch die Früchte auch so und ohne Anstrengung ernten konnte?
»Dann legt Eure Hände in die meinen, Simon de Montfort, und nehmt aus ihnen die Grafschaft Toulouse sowie die Vizegrafschaften Béziers und Carcassonne als erbliche Lehen der Krone Frankreichs entgegen«, sagte der französische König zu dem vor ihm Knienden und verschenkte damit Territorien, die ihm gar nicht gehörten. »Des Weiteren gestatten wir Euch, den Titel eines Herzogs von Narbonne zu führen, auch wenn die Stadt weiterhin dem Erzbischof unterstehen soll. In Eurem Kampf gegen die Katharer und andere Feinde werden wir Euch als Euer Lehnsherr von nun an unterstützen, soweit es in unserer Macht steht. Erhebt Euch und gebt mir den Bruderkuss, Graf von Toulouse.«
Unter dem Jubel des versammelten Hofes richtete sich der hagere, asketische Kreuzfahrer auf und küsste den König, wie es der Brauch war, auf den Mund. In dem Moment war er am Ziel seines lebenslangen Hoffens und Sehnens angekommen. Endlich konnte er sich nach allen geltenden Gesetzen als rechtmäßiger Eigentümer der eroberten Gebiete betrachten! Unzählige Menschen hatten er und seine Glaubensbrüder im Namen des Herrn abgeschlachtet, verbrennen lassen, aus ihrer Heimat vertrieben, um es zu erreichen! Der Aufruf von Papst Innozenz zum Kreuzzug gegen die Katharer, die die Autorität des Heiligen Vaters und damit der allein selig machenden heiligen Mutter Kirche infrage stellten, sonst aber niemandem ein Leid taten, war ein Geschenk Gottes für den verarmten und in England enteigneten Baron gewesen. Wie bei allen Kreuzzügen lockten Beute und Ländereien neben dem versprochenen Sündenablass. Und als er dann noch nach dem Rückzug der ranghöheren Adeligen, die vom Morden und Töten genug hatten, zum Anführer der päpstlich sanktionierten Eroberung Südostfrankreichs gewählt wurde, konnte er sein Glück kaum fassen.
Das Geschlecht der Raimundiner, das dieses Land seit mehr als dreihundertfünfzig Jahren beherrscht hatte, war verjagt, exkommuniziert und enteignet worden, die überlebenden Ketzer zu ihren Glaubensbrüdern und -schwestern nach Aragon und Aquitanien geflohen. War das nicht ein willkommener Anlass, auch dort einzufallen und diesen letzten verbliebenen Rest des einstmals so mächtigen Angevinischen Reiches auf dem Boden Frankreichs zu unterwerfen? Ein solches Unternehmen stand schon seit Längerem auf der Agenda Simon de Montforts, und einen Teil davon, das Agenais und das Quercy, hatte er seiner Grafschaft bereits einverleibt. Beide Regionen waren Joan von England von ihrem Bruder Richard Löwenherz als Mitgift zugesprochen worden, als sie Raimund VI. von Toulouse ehelichte, und nach ihrem frühen Tod auf ihren gemeinsamen Sohn übergegangen. Aber was scherte das Simon de Montfort? Den Rest der englischen Besitzungen auf dem Kontinent zu erobern konnte auch nicht weiter schwierig sein, und König Philipp war sicherlich nicht abgeneigt, wenn man ihm die Arbeit abnahm.
Er, der neue Graf von Toulouse, würde beim abendlichen Festmahl gleich einmal mit seinem Lehnsherrn darüber sprechen. In einem, höchstens zwei Jahren, so dachte er, gehörten auch die Ländereien, auf die er jetzt sein Augenmerk richtete, ihm.
Simon de Montfort ahnte nicht, wie sehr er sich täuschen sollte.
1. Kapitel
Gascogne, Winter 1217/1218
Zwei Männer ritten neben einem von schweren Percherons gezogenen Fuhrwerk her. Der Wagen war mit Fässern voll beladen, und selbst die starken, von erfahrenen Fuhrknechten gelenkten Pferde hatten es nicht leicht, ihn durch die tiefen Furchen der winterlich aufgeweichten Straße zu ziehen, die von Saint-Émilion nach Süden zur Garonne führte. In der alten Stadt am Jakobsweg hatten Robin und sein alter Freund Charles d’Artagnan bei guten Bekannten wie dem Winzerpaar Vauthier Wein für das Weihnachtsfest und die leeren Keller von Château de Lisse und Castelmore gekauft. Jetzt waren sie auf dem Rückweg, der Wagen erwartungsgemäß voller als geplant, und in die Diskussion über die Auseinandersetzung zwischen den Katharern und der katholischen Kirche vertieft, die das Land, ja selbst Familien spaltete und so gut wie jeden betraf, der hier im Süden lebte.
»Charles, ich sage dir, wir werden uns nicht ewig heraushalten können. Ich habe in zwei Kreuzzügen gekämpft, aber keiner wurde derart gnadenlos geführt. Was Simon de Montfort seinen eigenen Landsleuten, noch dazu Christen, antut, ist einfach unvorstellbar! Das geht nun schon seit Jahren so. Was haben die Katharer ihm denn getan, und warum verfolgt die Kirche sie so unerbittlich? Ich bin wahrlich kein Theologe, aber so viel weiß ich aus meinen Gesprächen mit ihnen: Sie glauben an Gott, beten das Paternoster und hoffen auf Erlösung im Paradies. Das ist mehr, als ich von mir behaupten möchte. Kannst du mir erklären, was den Unterschied zur Lehre der angeblich allein selig machenden Kirche ausmacht und sie berechtigt, diese friedfertigen, arbeitsamen und fleißigen Menschen zu Tausenden abzuschlachten? Dass sie in ihrer Muttersprache predigen und bei ihnen Frauen Priester, wenn auch keine Bischöfe, sein dürfen, kann es ja wohl nicht sein, oder?«
»Robin, ich bin mit Sicherheit der Falsche, den du dazu befragst. Selbst unser Bischof findet nur fadenscheinige Ausreden, wenn ich von ihm wissen will, warum unsere Nachbarn, mit denen wir viele Jahre friedlich Tür an Tür zusammengelebt haben, plötzlich als Ketzer verteufelt und verbrannt werden. Es heißt, sie lehnen das Alte Testament ab und erkennen den Papst nicht als Stellvertreter Gottes auf Erden an. Außerdem, so sagte der Prälat, würden sie bei ihren Gottesdiensten das Hinterteil einer Katze küssen, in deren Gestalt ihnen Luzifer erscheint. Aber das halte ich für groben Unfug. In Wahrheit ist es wohl eher so, dass sie keinen Kirchenzehnten abführen und ihre reichen Gemeinden die Begehrlichkeiten ihrer Feinde wecken. Es ist eine Schande, was man mit diesen armen Menschen in der Grafschaft Toulouse anstellt, seit Graf Raimund vertrieben worden ist. Wie man hört, sammelt er allerdings ein Heer und plant die Rückeroberung seines Landes. Unter ihm hatten die Katharer nichts auszustehen, denn uninteressierter an Glaubensfragen als er kann wohl kein Fürst sein. Ihm wäre es wahrscheinlich sogar gleich, wenn sie tatsächlich den Teufel anbeten würden. Hauptsache, sie beanstanden nicht seinen – nun, formulieren wir es einmal sehr höflich – lockeren Lebenswandel und spülen durch ihre Arbeit Geld in seine Kassen. Die meisten von ihnen sind ja Weber oder üben andere einträgliche Handwerke aus und haben damit der einst armen Grafschaft zu ungeahnter Blüte verholfen.«
»Unlängst hörte ich, sie sollen den Heiligen Gral auf ihrer festen Burg Montségur verstecken. König Richard hat im Heiligen Land danach suchen lassen, ihn aber nicht gefunden. Angeblich ist es der Kelch des Abendmahles, in dem dann das Blut Christi aufgefangen wurde, als er am Kreuz hing und der Römer ihm die Lanze in die Seite stieß.«
Der Gascogner winkte nur ab.
»Nichts als Ammenmärchen, um die Kreuzritter noch zusätzlich anzustacheln. Ein Goldpokal, besetzt mit riesigen Edelsteinen, soll das sein, und überall suchen sie danach. Du warst doch mit Löwenherz in Palästina. Hast du dort solche Gefäße im Besitz der einfachen Menschen gesehen?«
»Mit Sicherheit nicht! Vielleicht im Zelt Sultan Saladins, das mag sein, aber da habe ich auf andere Dinge achten müssen. Wenn Jesus, von Beruf Zimmermann und Sohn eines Zimmermanns, einen Becher hatte, dann war der sicherlich aus Holz. Aus einem Ölbaum geschnitzt oder gedrechselt, nehme ich bei der Gegend einmal an.«
»Schon allein für den Satz kannst du auf dem Scheiterhaufen landen. Es ist nämlich das Gleiche, was die Katharer behaupten. Sie sehen in Jesus Christus nicht Gottes Sohn, sondern einen Propheten, der sogar verheiratet war.«
»Mit Maria Magdalene, ich weiß. Das ist nun nicht wirklich neu, das hat mir schon als Kind meine Großmutter erzählt. Ich stand sogar vor dem angeblichen Grab Marias in der Kathedrale von Vezelay. Nur frage ich mich, wie auch beim Apostel Jacobus, der ja, wie die Kirche behauptet, in Santiago de Compostela begraben liegt – wie sind die beiden aus dem Heiligen Land zu ihren so weit entfernten letzten Ruhestätten gelangt?«
»Durch Wunder, wie sonst? Hinterfrage das bloß nicht! Habt ihr eigentlich auf Lisse auch Katharer aufgenommen? Meine Bauern verstecken mit Sicherheit etliche, denn sie sind ja miteinander versippt und verschwägert. Aber so genau will ich das gar nicht wissen.«
»Bei uns sind derart viele Flüchtlinge vorstellig geworden, dass Marian nicht mehr weiß, wohin mit ihnen. Einige ziehen ja nach einiger Zeit weiter zu Verwandten, aber andere haben wirklich alles verloren und konnten nichts als ihre bloße Haut retten. Familien werden getrennt, Müttern die Kinder aus den Armen gerissen, jeder, der Widerstand leistet oder dem man den uneingeschränkten Übertritt zum vermeintlich einzig wahren Glauben nicht abnimmt, umgebracht. Noch wagt sich Montfort mit seiner Mörderbande nicht auf angevinisches Gebiet. Doch ich frage mich, wie lange noch.«
»Die englische Garnison in Bordeaux ist jedenfalls viel zu schwach, um das zu verhindern. Meinst du, dass dein Sohn bei William Marshal etwas erreicht und der Regent im Namen des jungen Königs interveniert?«
»Fulke ist zum Weihnachtshof nach Westminster zurückgekehrt und wird das, was hier vor sich geht, natürlich zur Sprache bringen. Aber Marshal hat so kurz nach Beendigung des Bürgerkrieges bestimmt andere Probleme, als sich um die weit entfernte Gascogne zu kümmern. Außerdem wird er mit zunehmendem Alter immer frommer und sprach sogar davon, auf seine alten Tage noch dem Templerorden beizutreten. Fällt Montfort bei uns ein, sind wir sicherlich auf uns selbst gestellt. Eher könnte man vielleicht König Sancho von Navarra zum Eingreifen bewegen. Schließlich hat Montfort seinen Kampfgenossen aus der Schlacht von Tolosa, König Peter von Aragon, vor Muret umgebracht. Sancho und Peter waren immerhin gute Freunde und über viele Jahre verbündet.«
»Meinen Lehnsherrn, Graf Géraud von Armagnac, habe ich sagen hören, dass er sich unterwerfen würde und bereit wäre, die Katharer zu verfolgen und auszuliefern, würden Montfort und der päpstliche Legat es von ihm verlangen. Ich wüsste wahrlich nicht, was ich dann tun sollte.«
»Deinem Gewissen folgen, Charles!«
»Du hast gut reden. Lisse ist ein Allod. Du bist niemandem untertan als dem englischen König und dein Sohn noch dazu dessen Erzieher. Aber ich würde alles verlieren, widersetzte ich mich meinem Lehnsherrn.«
»Wie man hört, hat Montfort alle Allods in der Grafschaft Toulouse eingezogen und die Besitzer enteignet oder günstigstenfalls zu Lehnsnehmern nach französischem Recht gemacht. Das wäre es dann mit meiner Unabhängigkeit, rückt er hier ein. Nein, nein, wir müssen das unter allen Umständen zu verhindern suchen. Er darf nie einen Fuß über die Garonne setzen, sonst sind wir verloren. Marian könnte es nie verwinden, nach Fenwick auch noch Lisse zu verlieren. So gern ich selbst nach England zurückkehren würde, für sie ist die Gascogne ihre Heimat geworden.«
»Ich werde nie verstehen, was du an dieser kalten, nebligen Insel findest, wo du doch hier ein so sorgenfreies Leben führen kannst.«
Charles d’Artagnan schmunzelte in sich hinein, denn er wusste genau, was er jetzt zu hören bekam. Mit dieser Aussage konnte man Robert von Loxley schließlich immer aus der Reserve locken.
»Du kennst eben die Wälder in den Midlands nicht! Die der Gascogne sind auch wunderschön, ohne Frage. Aber nichts auf der Welt übertrifft den Sherwood im Mai! Wenn aus den Eichen und Buchen das erste Grün hervorbricht, sich die Wiesen in bunte Blumenteppiche verwandeln, die Luft so rein und klar ist wie die Waldbäche – das ist mit nichts zu vergleichen. Irgendwann will ich alles noch einmal wiedersehen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in diesem Leben erblicke.«
»Du bist doch erst ein paar Monate aus England zurück und hast schon Heimweh? Wie soll das erst in einigen Jahren werden? Ich habe nicht den Eindruck, dass deine Frau hier noch einmal weggehen will.«
Robin seufzte vernehmlich.
»Ja, da hast du sicherlich recht. Als sie mich vor einem reichlichen Jahr in Loxley verließ, hatte ich Sorge, sie überhaupt noch einmal wiederzusehen. Nicht sie ist als braves Eheweib bei mir geblieben, sondern ich habe hierher zu ihr kommen müssen. Du siehst, Charles, bei uns ist halt alles etwas anders als bei normalen Leuten. Aber was rede ich, du kennst sie ja.«
Robin grinste etwas schief, wie sein Freund sah, der ihn schmunzelnd von der Seite betrachtete.
»Stimmt es eigentlich, was man sich erzählt? Sie sagen, du hättest König John umgebracht und ihn ohne Absolution zur Hölle fahren lassen. Ich erfahre ja von dir nichts und stehe jedes Mal als unwissender Trottel da, wenn man es sich am Hofe Gérauds zuraunt.«
»Es ist auch nichts, worüber ich gern spreche. Aber ich will dich nicht dumm sterben lassen. Ja, ich habe mit meinen Gefährten John in den Wash gejagt. Die Brühe, die er da schlucken musste, ist ihm wohl nicht bekommen. Eine Woche später hat ihn die Ruhr dahingerafft. Und es ist auch richtig, ich habe verhindert, dass er die Sterbesakramente empfangen konnte. Denn sollte ich, woran ich allerdings zweifle, einmal in den Himmel kommen, will ich diesem Scheusal dort nicht begegnen.«
Und vor allem Marian nicht, dachte Robin. Aber was John mit ihr angestellt hatte, ging nun wahrlich keinen anderen Mann etwas an.
Charles d’Artagnan merkte, dass er seinem Freund nicht mehr würde entlocken können, obwohl ihn natürlich gerade die Details brennend interessierten. Doch für Robin, das sah er ihm an, war das Thema zumindest für heute beendet.
Bei Tonneins, noch auf angevinischem Gebiet, wollten sie die Garonne mittels einer Furt durchqueren. Der Fluss bildete die Grenze zwischen den Herzogtümern Aquitanien und der Gascogne, die beide einmal Königin Eleonore gehört hatten. Sie waren von ihr in ihre beiden Ehen – zuerst mit dem französischen König Louis, und, nachdem beide sich hatten scheiden lassen, in die mit dem späteren englischen König Henry – eingebracht worden. In direkter Erbfolge war jetzt ihr Enkel, König Henry III., ein zehnjähriger Knabe, der Herr über diese reichen, heiß begehrten und deshalb auch ständig umkämpften Gebiete. Ein Stück weiter, in Agen, gab es zwar eine Brücke über den Fluss, aber seit sich Simon de Montfort auch die Stadt unter den Nagel gerissen hatte, verlangte man dort abartige Wegezölle und schikanierte jeden, der nach Süden wollte. Kam jemand gar in den Verdacht, mit den Katharern zu sympathisieren oder womöglich selbst dazuzugehören, konnte man neuerdings ganz schnell in den Kerkern des bischöflichen Palastes landen und darauf warten, dass es bald sehr warm unter einem wurde.
Das Agenais gehörte wie das Quercy ursprünglich auch zum Angevinischen Reich. Beide Regionen waren aber von Richard Löwenherz seiner Schwester Joan als Mitgift übereignet worden, als diese nach ihrer Rückkehr aus dem Heiligen Land den Grafen Raimund von Toulouse heiratete, um die alte Feindschaft zwischen den Aquitaniern und den Toulousianern ein für alle Mal zu beenden.
Robin hatte Joan, die jüngste Tochter der legendären Eleonore von Aquitanien und ihr von all ihren zehn Kindern am ähnlichsten, auf Sizilien kennengelernt, wo sie bis zum Tod ihres ersten Gemahls Königin gewesen war. Später rettete er ihr und Richards zukünftiger Gemahlin, Berengaria von Navarra, vor Zypern das Leben und war dabei, als Richard die junge Witwe in Jaffa mit Saladins Bruder al-Adil verheiraten wollte. Aber das hatte sich die temperamentvolle Joan erfolgreich verbeten und die Friedenspläne ihres Bruders damit zunichtegemacht. Ihre später geschlossene Ehe mit dem polygam wie ein orientalischer Fürst lebenden Grafen Raimund konnte nicht gerade als glücklich bezeichnet werden. Immerhin schenkte Joan ihrem zweiten Gemahl aber einen Sohn und Erben, bevor sie ihn, obwohl sie wieder schwanger war, im Zorn über seine vielen Affären verließ. Joan kehrte zu ihrer Mutter nach Fontevrault zurück und verstarb dort im Kindbett kurz nach ihrem Bruder Richard, der bei der Belagerung der Burg von Chalus tödlich verwundet worden war.
Ihr Sohn, Raimund der Jüngere, war der Erbe ihrer angevinischen Ländereien, doch darum scherte sich de Montfort einen Dreck, überrannte beide Regionen und gliederte sie seiner Grafschaft an. Der damals noch lebende König John, Richards Bruder, war zu schwach, um ihn daran zu hindern.
Robin hatte sich den Enkeln Eleonores immer verbunden gefühlt, aber es stand nicht in seiner Macht, an den jetzigen Gegebenheiten etwas zu ändern. Die beiden Raimunds, Vater und Sohn, hatten fliehen müssen, und Robin hatte munkeln hören, dass sie eine Armee aufstellten, um ihr Land zurückzuerobern und den Gräueltaten der Kreuzritter ein Ende zu bereiten. So richtig daran glauben konnte er allerdings nicht, saß doch de Montfort fester denn je im Sattel, seit er nicht nur die Unterstützung des Papstes und dessen Legaten, sondern auch noch die Legitimation des französischen Königs besaß. Mit dem war er selbst gleich mehrmals zusammengeraten und hatte wahrlich keine guten Erinnerungen an Philipp.
Als sich die kleine Kolonne der Ortschaft am nördlichen Ufer der Garonne näherte, lag auf einmal ein unangenehmer, süßlicher Brandgeruch in der Luft. Gleichzeitig sahen die Männer Rauch aufsteigen, der unmöglich von Koch- oder Fischräucherfeuern stammen konnte. Robin gab seinem Hengst Ares die Sporen und preschte gefolgt von seinem Freund auf einen Hügel, von dem aus sie einen Rundblick auf die Ansiedlung und den Fluss hatten.
Tonneins hatte zwar kein Stadt-, aber immerhin Marktrecht, und wenn die Ortschaft auch keine Mauern schützten, so war sie doch dank der Flussfischer und zahlreichen Handwerker, die sich aus dem Toulousian auch hierher geflüchtet hatten, im Aufstreben gewesen. Nun schien dem kleinen Städtchen das zum Verhängnis geworden zu sein. Die Stroh- und Schilfdächer der größeren Steinhäuser brannten lichterloh, und die aus Holz errichteten Hütten standen zur Gänze in Flammen. In Richtung Osten entfernte sich gerade ein Trupp Reiter, über dem die Fahnen der Kreuzritter wehten. Zu Robins Verwunderung aber auch die des Bischofs von Bordeaux, der eigentlich gemeinsam mit dem Stadtkommandanten die Aufgabe hatte, angevinisches Gebiet zu schützen.
Jetzt sind Montforts Mörderbanden also schon bis hierher vorgedrungen, durchfuhr es Robin. Er brachte kein Wort heraus, denn auf einmal wusste er, was so widerwärtig süßlich stank. Es war der Geruch von Menschen, die man verbrannt hatte.
Robin gab seinem Hengst den Kopf frei und jagte den Hügel hinunter. Vielleicht war ja noch jemand zu retten, konnte Überlebenden geholfen werden. Doch schon am Eingang der Ortschaft sah er, dass sie zu spät kamen. Ein Diakon der Katharer, der den Angreifern ganz offensichtlich mit dem Johannesevangelium und damit der Friedensbotschaft Jesu, das er noch immer in seinen Händen hielt, entgegengetreten war, lag mit zerschmettertem Schädel in einer Blutlache am Boden. Den Weg zur Mitte des Örtchens säumten weitere tote Männer, Frauen und Kinder. Und doch hatten diese wohl noch Glück gehabt, denn sie waren unter den Schwertern, Streitäxten und Morgensternen der Ritter schnell gestorben. Diejenigen, die man gefangen genommen und auf dem Marktplatz zusammengetrieben hatte, dagegen nicht.
Die kleine Kirche des Ortes war niedergerissen und alles Brennbare aus ihren Trümmern herausgeschafft und aufgestapelt worden. Dann hatte man offenbar die Gefangenen, gleich, welchen Alters, Geschlechts und Glaubens, auf den Haufen getrieben, sie zusammengebunden, mit Öl, Tran und Pech übergossen und angezündet. Obwohl es bis auf das Prasseln des die Häuser zerstörenden Feuers völlig lautlos in Tonneins war, hörte Robin förmlich die Schreie der gemarterten Menschen im Todeskampf. Jetzt lagen sie über- und durcheinander auf den noch schwelenden Balken des ehemaligen Gotteshauses, im Sterben vereint. Die Gliedmaßen waren entsetzlich verrenkt, viele Leichen hatten die Hände gefaltet und noch im Tod nach oben, zum Himmel, gereckt. Doch von dort war keine Hilfe gekommen.
Robin knirschte so laut mit den Zähnen, dass es Charles d’Artagnan neben ihm hörte.
»Das hier«, stieß Robin hervor, »ist Aquitanien. Ein Land, in dem seit Menschengedenken Frieden und Toleranz herrschten. Dafür haben Königin Eleonore und ihre Vorfahren über viele Jahre hinweg gesorgt. Es ist furchtbar genug, was Montfort im Toulousian anrichtet. Doch hier hat er kein Recht, keinerlei Befugnisse. Das dürfen wir ihm einfach nicht durchgehen lassen! Dafür muss er bezahlen, dieser elende, verfluchte Mordbrenner!«
»Was willst du tun? Es wird nicht Montfort selbst gewesen sein, der hier gewütet hat. Er ist, wie man hört, in der Provence. Aber seine Trupps streifen durch das ganze Land und bringen im göttlichen Eifer alle um, die sie für Katharer oder auch nur für deren Sympathisanten halten. Du weißt doch, was der päpstliche Nuntius nach der Einnahme von Béziers gesagt hat, als die Kreuzritter ihn fragten, wie sie Katharer von Katholiken unterscheiden sollen. Tötet sie alle, der Herr wird die Seinen schon erkennen, soll er ihnen zugerufen haben. Zwanzigtausend Männer, Frauen und Kinder fanden daraufhin den Tod, erzählt man sich. Du allein wirst diese Fanatiker nicht aufhalten können. Glaubst du, sie halten sich an Grenzen?«
In dem Moment hörten die beiden Männer das Wimmern einer Frau. Als sie sich umwandten, sahen sie eine Gestalt, die in einer Toreinfahrt zusammengesunken war. In ihren völlig verbrannten Händen hielt sie den verkohlten Leichnam eines kleinen Kindes. Offenbar hatte sie sich verstecken können und nach dem Abzug der Kreuzritter ihren Säugling aus den noch lodernden Flammen gezogen. Niemand außer der Mutter konnte mehr sagen, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen gehandelt hatte.
Robin beugte sich zu der jungen Frau herab, der die Tränen wie Sturzbäche über die Wangen rannen. Mit einer Stimme, so sanft, wie Charles d’Artagnan sie noch nie bei seinem Freund gehört hatte, sprach er zu ihr.
»Dein Kind ist tot, seine Seele jetzt im Himmel. Gott hat sie schon aufgenommen, da bin ich mir ganz sicher. Deshalb sollten wir es begraben, damit du seine letzte Ruhestätte immer besuchen kannst. Wenn du willst, können wir das dort tun, wo ich zu Hause bin. Dort wird sich meine Frau auch um deine Verletzungen kümmern. Sie ist in der Heilkunde bewandert und kann dir sicher helfen.«
»Woher kommt Ihr, Monsieur? Ihr sprecht so gütig«, schluchzte die junge Mutter und presste das Kind so fest an sich, als wolle sie es bis zu ihrem eigenen Tod nie mehr loslassen.
»Von der anderen Seite der Garonne. Ich habe ein kleines Gut südlich von Nerac. Willst du mit uns kommen? Hier jedenfalls kannst du nicht bleiben.«
Die Frau nickte unter Tränen und erhob sich langsam, ohne das Kind loszulassen. Robin wollte es ihr auch nicht nehmen. Nicht nur den seelischen, sondern auch den körperlichen Schmerz der Brandwunden hätte sie sonst wohl nicht ertragen können. Weitere Überlebende zeigten sich keine, und so geleiteten die beiden Männer das Mädchen vor die Stadt, wo das Fuhrwerk mittlerweile angekommen war. Robin half ihr auf den Wagen und instruierte die Pferdeknechte, es ihr darauf so bequem wie nur möglich zu machen. Er selbst zog ein etwa zwei Yard langes Lederfutteral von der Ladefläche und begann, die Verschnürung an einem Ende aufzunesteln.
»Was hast du vor?«, wollte Charles d’Artagnan von seinem Freund wissen. »Sollten wir nicht zusehen, so schnell wie möglich von hier zu verschwinden? Vielleicht kommen sie zurück, und dann haben wir sicher nichts zu lachen.«
»Den Gefallen werden sie mir wohl leider nicht tun«, knurrte Robin, und sein Freund hatte auf einmal das Gefühl, neben einem zum Angriff bereiten Pyrenäenbären zu stehen. »Charles, tu mir einen Gefallen und begleite das Fuhrwerk nach Lisse. Sag Marian, was passiert ist und dass ich so bald als möglich nachkomme. Sie wird verstehen, was ich jetzt tun muss.«
Robin zog einen etwa zwei Yard langen, sich an den Enden verjüngenden Stab aus walisischer Bergeibe aus dem Futteral. Auf der einen Seite hatte das Holz eine helle, auf der anderen dagegen eine dunkle Farbe. Das Splintholz außen war besonders dehnbar und gab dem Zug nach, während das harte Kernholz innen, etwa doppelt so dick wie das helle Außenholz, dem Druck standhalten musste. An den Enden war der in der Mitte nahezu runde Stab abgeflacht und eingekerbt. Robin nahm eine Hanfschnur aus seiner Gürteltasche, ließ eine Schlinge in die untere Einkerbung rutschen, stützte den Stab auf einem Stein ab, bog ihn mit aller Kraft durch und hängte das andere Ende der Sehne in die obere Vertiefung ein. Nun hielt er die gefährlichste Waffe seiner Zeit in den Händen, den englischen Langbogen, mit dem sich Gegner selbst in Rüstungen noch auf dreihundert Schritt durch geübte Schützen bekämpfen ließen und der ihn zur Legende gemacht hatte. Denn niemand diesseits und jenseits des englischen Kanals handhabte diese tödliche Kriegs- und Jagdwaffe besser als der Mann, dessen Namen auf alle Zeit mit ihr verbunden sein würde – Robin Hood.
»Bei allem Respekt vor deinen Schießkünsten, Robin, aber willst du Simon de Montfort jetzt den Krieg erklären? Du allein gegen ein ganzes Kreuzritterheer, dem die mächtigen Grafen von Toulouse nicht standhalten konnten? Du solltest mittlerweile alt und erfahren genug sein, um zu wissen, dass das reiner Selbstmord ist.«
Charles d’Artagnan kannte natürlich den legendären Langbogen seines Freundes und hatte schon oft dessen mittlerweile mythische Treffsicherheit bewundert. Aber was sein Begleiter hier offenbar vorhatte, war einfach nur Wahnsinn.
Doch dieser ließ sich nicht beirren und griff sich den Köcher mit den yardlangen Pfeilen, der neben dem Bogen gelegen hatte.
»Einer muss ein Zeichen setzen, Charles. Ich weiß, dass ich nicht alle töten kann, aber ich werde sie das Fürchten lehren. Sie sollen es sich in Zukunft dreimal überlegen, auf angevinisches Gebiet vorzudringen. Glaub mir, ich weiß, was ich tue. Es ist nicht das erste Mal.«
»Robin, du trägst nicht einmal eine Rüstung, hast keine weiteren Waffen als zwei Dutzend Pfeile, dein leichtes Schwert und einen Dolch. Du bekommst es mit einem ganzen Fähnlein Kreuzritter zu tun, wenn du sie angreifst. Und dass die kämpfen können, haben sie in unzähligen Schlachten bewiesen. Das sind keine Kriegsknechte und Söldner, die nur stark sind, wenn sie auf wehrlose Bauern treffen, sondern Fanatiker im Glauben, die auch vor dem Tod nicht zurückschrecken. Sei doch vernünftig! Es ist schließlich niemandem geholfen, wenn du dich umbringen lässt! Deine Frau hat mir selbst gesagt, wie froh sie ist, dich aus diesen englischen Kriegen gegen John und die Franzosen heil und gesund zurückbekommen zu haben. Und du stürzt dich ohne zu zögern in den nächsten!«
»Begreifst du das denn nicht, Charles? Was glaubst du, wie lange es dauert, bis sie vor Castelmore und Lisse stehen, wenn wir sie gewähren lassen? Dass sie vor keiner Grenze haltmachen, siehst du ja selbst. Nein, solange sie nicht hinter sicheren Mauern sind, kann ich sie mir greifen. Natürlich werde ich sie nicht alle umbringen können, dafür habe ich nicht genügend Pfeile dabei. Aber sie sollen zumindest wissen, was auf sie zukommt, überschreiten sie die Garonne.«
»Du bist verrückt, weißt du das? Erwarte bitte nicht, dass ich mich an diesem Irrsinn beteilige.«
»Um Himmels willen, bloß das nicht! Sei so gut und tu, worum ich dich gebeten habe. Ich werde mich auf keinen Nahkampf einlassen, und du kannst nicht mit einem Langbogen umgehen. Ich hätte ständig nur ein Auge auf dich, und das könnte uns beide das Leben kosten.«
»Und es gibt nichts, was dich veranlassen könnte, diesen Wahnsinn zu unterlassen?«
»Nein, Charles. Spar dir deine Worte.« Robin schwang sich, ohne die Bügel zu benutzen, in den Sattel. »Wünsch mir Glück. Wenn alles gut geht, sehen wir uns heute Abend in Lisse.«
Die Tatsache, dass er keine Rüstung trug, sah Robin als eindeutigen Vorteil an. Außerdem hatte er mit Ares ein Pferd unter sich, dem keines der Kreuzritter an Schnelligkeit und Wendigkeit gleichkam. Der Hengst stammte aus der eigenen, von Marian liebevoll gehegten Zucht und vereinte arabische Blutlinien aus dem Marstall Sultan Saladins mit denen der berühmten englischen Fenwick-Pferde. Der Hengst hatte Robin schon in die Schlacht gegen die Mauren von Las Navas de Tolosa und gegen König John in England getragen, und immer und zu jeder Zeit war absoluter Verlass auf ihn gewesen. Auch heute, das wusste Robin, würde er ihn nicht im Stich lassen.
Die Kreuzritter hatten ihre Beute auf Wagen geladen und kamen dadurch nur langsam voran. Wenn sie nach Agen wollten, und davon ging Robin aus, mussten sie ein Stück östlich die Le Lot überqueren, die später in die Garonne mündete, die hier einen Bogen machte. Auf der anderen Uferseite des Flüsschens wollte er sie erwarten. Robin ließ Ares ausgreifen und fegte wie der Sturmwind über die abgeernteten Felder und Brachflächen. Das Wasser spritzte hoch auf, als er die Le Lot mittels einer Furt passierte und auf einem Hügel unmittelbar hinter dem Wasserlauf seinen Hengst durchparierte. Unter ihm befand sich die Stelle, die auch die Kreuzritter passieren mussten, wollten sie keinen großen Umweg machen. Einen besseren Ort würde er kaum finden.
Robin saß ab, brachte Ares auf die andere Seite des Hügels, sodass das Pferd nicht gleich entdeckt wurde, und kehrte dann auf den Kamm zurück. Etwa dreißig Jahre zuvor – ihn schauderte, wenn er daran dachte, was sich seither alles ereignet hatte – war er in einer ähnlichen Situation gewesen. Damals hatte Guy von Gisbourne Loxley niedergebrannt, seinen Vater ermordet und Robin seinen ersten Kampf mit dem Langbogen bestritten.
Vor sich steckte er die Pfeile in den Boden, um sie später schnell greifen zu können. Leider hatte er nur zwei Dutzend dabei, und auch nur die Hälfte davon war mit Bodkinspitzen besetzt, die Rüstungen durchschlagen konnten. Aber wer hätte auch ahnen können, dass er in der bis vor Kurzem so friedlichen Gegend würde kämpfen müssen?
Der Zisterziensermönch Bernard la Ferte hatte die in Agen eigentlich nur zum Schutz des Bischofs und der Stadt stationierten Kreuzritter dazu aufgestachelt, das Ketzernest Tonneins auszulöschen. Wie sein großes Vorbild Arnaud Amaury, Ordensbruder und päpstlicher Legat, sah er es als seine Verpflichtung an, die Katharer und ihre gotteslästerliche Lehre mit Stumpf und Stiel auszurotten. Wie sie geschrien und um Gnade gewinselt hatten, diese Verfemten, als das Feuer ihre Seelen läuterte! Es war Gottes Werk, das sie taten, davon war la Ferte zutiefst überzeugt. Hieß nicht der alte Schlachtruf der Kreuzritter seit allen Zeiten: Gott will es? Was scherten ihn da Grenzen? Außerdem sollten die Angevinen mit ihrem Kindkönig lieber froh sein, dass man ihnen die Arbeit abnahm. Der englische Regent William Marshal, ein gottesfürchtiger Mann, wie man hörte, hatte bestimmt nichts dagegen, wenn man dem Ketzertum auch in Aquitanien und der Gascogne die Grundlage entzog.
Robin hingegen, der mit William Marshal oft Seite an Seite gekämpft hatte, sah das ganz anders. Und so schickte er als Erstes den Mönch, der an der Spitze der Kolonne auf einem Maultier ritt, ein den Herrn lobpreisendes Lied auf den Lippen, durch einen breiten Jagdpfeil, der ihm durch den weit geöffneten Mund in den Rachen fuhr und die dahinter liegenden Wirbel durchschlug, direkt vor den Thron des allmächtigen Richters.
Im ersten Moment verstand keiner der dem Mönch nachfolgenden Kreuzritter, die sich gerade daranmachten, die Uferböschung zur Le Lot herabzuklettern, was geschehen war. Erst als zwei weitere von ihnen fielen, yardlange Pfeile in der Brust, entdeckten sie den Mann auf dem Hügel, der Tod und Verderben über sie brachte.
Robin stand vor ihnen wie der Erzengel Michael, nur dass er statt des Flammenschwertes einen englischen Langbogen in den Händen hielt. Ein guter Bogenschütze schoss mindestens zwölf Pfeile in der Minute in ein zweihundert Yard entfernt stehendes Ziel. Aber der Mann auf dem Hügel war kein guter Bogenschütze, er war der beste. Und das bekamen die dreißig Kreuzritter, die sich, nachdem sie die Gefahr erkannt hatten, mit ihren Schilden zu schützen versuchten, schmerzlich zu spüren. Zwei von ihnen brachten Armbrüste in Anschlag, doch der eine Schütze starb, bevor er den Bolzen lösen konnte, und das zweite Geschoss ging meilenweit an Robin vorbei.
Einige Reiter wendeten die Pferde, um aus dem tödlichen Schussfeld herauszukommen. Drei andere, mutigere, hingegen gaben ihren Rössern die Sporen und versuchten den teuflischen Widersacher direkt anzugreifen. Hinter ihre Schilde geduckt, trieben sie die Pferde in das Flüsschen. Der Erste starb noch am gegenüberliegenden Ufer, ein weiterer in der Mitte der Le Lot, der Dritte, bevor sein Pferd den Hügel erklimmen konnte.
Jetzt versuchte keiner mehr, zu Robin vorzudringen. Die Kreuzritter suchten hinter den Wagen und dem Ufergestrüpp Deckung und wollten sich gerade beratschlagen, wie sie aus der tödlichen Falle herauskamen, als eine befehlsgewohnte Stimme zu ihnen herüberdrang.
»Ihr wollt Streiter Gottes sein? Mördergesindel und Brandschatzer seid Ihr, nichtswürdiges Pack, für das die Hölle zu schade ist! Zu feige, gegen die Mauren oder Sarazenen zu kämpfen, sucht Ihr Euch nahezu wehrlose Gegner. Glaubt Ihr wirklich, dass Gott Euch Eure Untaten jemals verzeihen wird?«
»Und was seid Ihr? Ein Mann, der einen unbewaffneten Mönch tötet, einen Mann Gottes? Und uns auf eine Entfernung umbringt, in der wir uns nicht zur Wehr setzen können! Nennt Ihr das heldenhaft?«, schallte es von der anderen Seite zurück. »Stellt Euch mir mit dem Schwert in der Hand, dann werden wir ja sehen, wer hier der Feigling ist!«
Robin hatte gar nicht mit einer Erwiderung gerechnet, umso mehr verwunderte ihn jetzt die Antwort. Jederzeit hätte er sich dem Herausforderer zu einem fairen Zweikampf gestellt, ganz gleich, mit welcher Waffe. Aber er war allein, hatte nur noch vier Pfeile und konnte sich nicht darauf verlassen, dass man ihn nicht auf der Stelle in Stücke hackte, kamen die noch lebenden Kreuzritter nahe genug an ihn heran. Ihm blieb gar nichts anderes übrig, er musste langsam an Rückzug denken.
»Ich habe in Palästina und in Spanien gekämpft, wo sich keiner von Euch hingewagt hat. Und nennt diese Höllenbrut in Kutten, die Euch anführt, nicht Männer Gottes. Kein Teufel kann schlimmer sein als Amaury und sein Geschmeiß. Geht und berichtet, was Euch widerfahren ist. Jeder von Euch, der zukünftig die Grenze des Angevinischen Reiches überschreitet, ist des Todes. Richtet es Simon de Montfort aus, sonst komme ich selbst und überbringe ihm die Botschaft. Nur, dass das dann das Letzte auf der Welt sein wird, was seine Ohren zu hören bekommen, bevor er zur Hölle fährt.«
»Sagt wer?«
Der Sprecher auf der anderen Seite erhob sich und zeigte damit, dass er wahrlich kein Feigling war, denn Robin hatte einen Pfeil auf der Sehne und den Bogen gespannt.
»Robert von Loxley, Earl von Huntingdon«, gab Robin sich zu erkennen. Den Baron de Lisse verschwieg er geflissentlich. Er musste Montforts Männer ja nicht zwingend notwendig mit der Nase darauf stoßen, wo er jetzt zu Hause war.
»Ich dachte es mir bereits, denn ich habe Eure Stimme schon einmal gehört. Ihr habt König Richards Bogenschützen bei Arsuf befehligt. Ich bin Jean de Bresac und gehörte zum französischen Kontingent, das der Bruder unseres jetzigen Anführers in die Schlacht geführt hat. So viel zu Eurer Beschuldigung, dass sich keiner von uns traut, gegen die Sarazenen zu kämpfen. Schon damals wollte Euch der Bischof von Beauvais brennen sehen, und nur Löwenherz konnte Euch davor bewahren. Kein Wunder, dass Ihr es auch hier mit den Ketzern haltet.«
»Noch ein Wort, und Ihr tretet augenblicklich vor Euren Schöpfer. Ich lasse Euch für heute gehen, damit Ihr fortan mit Eurer Schande leben müsst. Geht und tut, was ich Euch geheißen habe. Oder sterbt hier an dieser Stelle, mir ist es gleich.«
In diesem Moment zischte ein Armbrustbolzen heran, und der war besser gezielt als die beiden vorherigen. Robin spürte einen brennenden Schmerz an seinem linken Oberarm, und fast hätte er den Bogen losgelassen. Bevor der Schütze in Deckung gehen konnte, hatte Robin ihn erspäht und einen Pfeil hinübergeschickt. Doch der hatte keine Bodkinspitze und wurde auch nicht mit voller Kraft abgeschossen, sodass er vom Helm des Schützen abprallte und, ohne Schaden anzurichten, zu Boden fiel.
Robin konnte sich nicht daran erinnern, jemals einen derart jämmerlichen Schuss abgegeben zu haben. Jetzt blieb ihm nur der Rückzug, wollte er nicht selbst zum Opfer werden. So gelassen, wie es ihm nur möglich war, wandte er sich um und schritt den Hügelkamm auf der dem Flüsschen gegenüberliegenden Seite hinunter. Dabei spürte er, wie Blut seinen Arm hinabrann, aber auch, dass er ihn noch bewegen konnte. Robin schwang sich, nicht ohne Mühe, in den Sattel seines Hengstes und feuerte ihn mit einem scharfen Zuruf an, aus dem Stand heraus anzutreten. Das fehlte gerade noch, dass die Kreuzritter ihn mit ihren schweren Schlachtrössern einholten! Er ritt parallel zur Le Lot nach Süden, um die Stelle zu erreichen, wo sie sich mit der Garonne vereinigte. Dort gab es, wie er wusste, mehrere Sandbänke im Fluss, die es ihm ermöglichen sollten, das andere Ufer des breiten Stromes zu erreichen.
Als Robin sich umwandte, sah er, dass er tatsächlich verfolgt wurde. Drei Reiter waren ihm bereits näher gekommen, als er vermutet hätte. Einholen würden sie ihn zwar kaum, aber wenn er sie nicht abschütteln konnte, würden sie sehen, wohin er sich wandte, und später vielleicht kommen, um sich zu rächen. Aber wieso waren sie so schnell? Robin blickte erneut zurück und sah, dass nichts an ihnen glitzerte oder in der Sonne funkelte. Offenbar hatten sie ihre Rüstungen abgelegt, um es ihren Pferden leichter zu machen.
Da war auch schon die Garonne, und Robin lenkte seinen Hengst die recht hohe Uferböschung hinunter. Er hoffte nur, dass der Fluss zwischen den Sandbänken so seicht war, dass er nicht schwimmen musste. An einem Bad im dezemberkalten Fluss, noch dazu mit einem verletzten Arm, der sich mittlerweile taub anfühlte, war ihm nicht unbedingt gelegen.
Ares widersetzte sich ganz gegen seine Gewohnheit. Er versuchte seitlich auszubrechen, um nicht in das Wasser zu müssen, stemmte die Vorderhufe in den Boden und war nicht dazu zu bewegen, weiter vorwärts zu gehen. Robin sah die Verfolger näher kommen und tat etwas, das er bisher noch nie getan hatte – er zog dem Hengst mit dem Langbogen eins über, um dessen Widerstand zu überwinden. Erschrocken schnellte sich Ares von der Böschung ab, sprang mit weitem Satz in die Garonne, die hier eigentlich flach hätte sein müssen, und versank sofort bis über die Karpal- und Sprunggelenke.
Treibsand, durchfuhr es Robin siedend heiß! Er begriff sofort, dass er einen fatalen, wenn nicht gar tödlichen Fehler begangen hatte. Verdammt, hätte er doch nur auf das Pferd gehört! Ares hatte ihn wie so oft vor einer Gefahr warnen wollen, aber er war abgelenkt und unaufmerksam gewesen. Und das konnte sie beide jetzt das Leben kosten.
Mit einer verzweifelten Anstrengung riss der Hengst die Vorhand aus der tödlichen Umklammerung, sank dafür aber hinten tiefer ein. Sich der Gefahr instinktiv bewusst, warf Ares sich zur Seite in Richtung auf das Ufer, und Robin, der aus dem Sattel auf die Böschung geschleudert wurde, hörte es knacken. Ein eisiger Schauer lief ihm den Rücken hinunter, und der kam nicht vom Wasser, in dem er zur Hälfte lag.
Wider Erwarten kam der Hengst aber auf die Beine und schaffte es mit einer gewaltigen Kraftanstrengung ans Ufer. Dort blieb er allerdings am ganzen Leib zitternd stehen, und Robin wusste sofort, dass das nichts mit der eisigen Kälte zu tun hatte. Das Pferd war schwer verletzt, die Hinterhand eigenartig abgewinkelt, und blanke Todesangst stand in seinen Augen. Doch sein Reiter konnte sich im Moment nicht um ihn kümmern, denn auf der Böschung tauchte der erste Verfolger auf.
Robin wusste, dass es jetzt auch bei ihm um Leben und Tod ging. Der Bogen, den er mit dem verletzten Arm kaum würde halten können und der außerdem ein Stück von ihm entfernt im welken Schilf lag, nutzte ihm nichts. Er zog stattdessen das Schwert, wusste aber, dass er einen schweren Stand gegen drei erfahrene Kreuzritter haben würde und der Ausgang des Kampfes nahezu feststand. Noch dazu, wo er zu Fuß und sie beritten waren.
Der Erste lachte auch höhnisch, gab seinem Streitross die Sporen und preschte den Abhang hinunter auf den Feind zu. Das Pferd hatte nicht das feine Empfinden von Robins Hengst und gehorchte seinem Herrn, ohne zu zögern. Im letzten Moment warf sich der Angegriffene vor dem von oben geführten Schwertstreich zur Seite, der Hieb ging ins Leere, und das Streitross rutschte auf der abschüssigen und zerstampften Böschung in den Fluss und damit in den Treibsand. Im Gegensatz zu Ares aber kämpfte es nicht, sondern wieherte nur erschrocken und ängstlich und hoffte offenbar auf menschlichen Beistand. Sein Herr allerdings war mit der plötzlichen Gefahr selbst überfordert, sprang »Merde!« brüllend aus dem Sattel und versank sofort bis zum Gürtel im Wasser und losen Sand. Verzweifelt ruderte er mit den Armen und schrie dabei gellend um Hilfe.
In dem Moment tauchten seine beiden Gefährten auf der Böschungskrone auf, doch statt ihrem Kameraden beizustehen, saßen sie, gewarnt von dem, was sie im Fluss sahen, ab und stürzten sich zu Fuß auf Robin. Der parierte den ersten Hieb, unterlief einen zweiten und versuchte nun seinerseits zum Angriff überzugehen. Doch verletzt wie er war, räumte er sich selbst keine große Chance ein, gegen die zwei Kreuzritter lange bestehen zu können. Zumindest wollte er versuchen, den Böschungskamm zu erreichen, um nicht bergauf kämpfen zu müssen.
Auf den Beinen war er immer noch flink. Einem Gegner schlug er die Klinge zur Seite, den anderen rammte er mit der linken Schulter. Dass das keine gute Idee gewesen war, merkte er, als ihm schwarz vor Augen und schlecht vor Schmerz wurde. Er strauchelte, konnte noch einmal einen Hieb abwehren, sah aber das zweite Schwert, geführt von einer erfahrenen Hand, herabsausen.
Marian, war sein letzter Gedanke und dann, was wohl tatsächlich nach dem Tod kam. Aber offenbar hatte der Schöpfer noch kein Interesse an ihm.
Stahl klang auf Stahl, Robin wurde rüde zur Seite gestoßen, hörte ein geknurrtes »Aus dem Weg!«, und was er gleich darauf sah, erinnerte ihn an seinen verstorbenen Schwiegervater. Wie dieser führte d’Artagnan die Klinge einfach meisterhaft. Obwohl, eigentlich waren es zwei, denn in der Linken hielt der Gascogner einen langen, spitzen Dolch mit kräftiger Parierstange, und beide Waffen handhabte er bewundernswert. Seine Hiebe kamen blitzschnell, gleichzeitig erspähte er offene Deckungen wie ein Bussard die Maus, und fast hatte Robin den Eindruck, gegen nur zwei Gegner zu kämpfen, empfand sein Freund als Beleidigung. Er kam auch nicht dazu, ihn zu unterstützen, denn der Kampf war vorbei, bevor er sich aufgerappelt hatte. Den einen Ritter erledigte Charles mit einem Stich des Dolches ins linke Auge, den zweiten mit einem Schwerthieb in die Halsbeuge.
Robin schaute in den Fluss nach dem dritten Angreifer, aber von dem fehlte jede Spur. Der tückische Treibsand hatte ihn, der wie ein Berserker gegen die tödliche Umklammerung angekämpft hatte, verschlungen und würde sich auch das Pferd holen, das immer tiefer einsank und nicht einmal mehr die Kraft besaß, zu wiehern.
»Wer hat noch vor Kurzem gesagt, er wolle sich auf keinen Nahkampf einlassen, hm?«, fuhr Charles d’Artagnan seinen Freund an, bückte sich, riss ein Bündel Schilfgras ab und machte sich daran, seine blutigen Klingen abzuwischen.
Robin dankte ihm nicht und fragte auch nicht, wie der Gascogner hierherkam. Seine Sorge galt Ares, der völlig regungslos dastand und wie Espenlaub zitterte. Mit wenigen Schritten war er bei ihm, legte die Hand auf die Nüstern und seinen Kopf an den Hals des Hengstes. Sofort spürte er, dass das Pferd schwer, wenn nicht gar tödlich, verletzt war. Aber so schnell wollte Robin nicht aufgeben. Er griff in die Zügel und versuchte, seinen Kameraden aus vielen Jahren dazu zu bewegen, einen Schritt nach vorn zu gehen. Und Ares gehorchte dem sanften Zügelzug, setzte zuerst ein Vorderbein vor und ließ dann ein Hinterbein folgen. Allerdings war der Weg, den es zurücklegte, stark verkürzt, und Robin sah, dass die Hinterhand nicht untertreten konnte.
Der Gascogner war in der Zwischenzeit auf den Böschungskamm gestiegen und hielt nach weiteren Verfolgern Ausschau. Erst als er weit und breit niemanden erblickte, sah er nach seinem Freund und dessen Pferd. Nachdenklich beobachtete er, wie Robin den Hengst zum Gehen animieren wollte, Ares aber nur äußerst widerwillig mit kleinen, kurzen Schritten seinem Herrn folgte.
»Meinst du, das wird noch mal? Er scheint sich irgendetwas gebrochen zu haben, wie es aussieht. Denkst du nicht, es wäre besser, ihn zu erlösen? Schau doch nur, wie er sich quält.«
»Als junger Hengst hatte er sich schon einmal das rechte Vorderbein unterhalb des Ellbogens gebrochen. Ich wollte ihm weiteres Leiden ersparen, aber ich sage dir, er hat mich angesehen und mit seinen Augen gesagt: Ich will nicht sterben. Und was soll ich dir sagen, nach einem Jahr war der Bruch verheilt, und seither hat er mich in unzählige Kämpfe und Schlachten getragen. So einfach kann ich ihn nicht töten. Marian hat ihm damals geholfen, wieder gesund zu werden, und vielleicht gelingt es ihr noch einmal. Die Hoffnung gebe ich erst auf, wenn er keinen Schritt mehr vorwärtsgeht. Ich werde versuchen, ihn nach Lisse zu bringen. Schafft er es nicht, erlöse ich ihn. Aber erst dann.«
Charles wusste, wie sehr Robin, aber vor allem dessen Frau Marian an ihren Pferden hingen. Hier war jedes weitere Wort reine Zeitverschwendung, vor allem weil sie zusehen sollten, endlich auf das andere Ufer der Garonne zu gelangen. Die beiden toten Kreuzritter ließen sie liegen, doch die Pferde nahmen sie mit. Robin wollte schließlich nicht den ganzen Weg zu Fuß gehen, und seinen Hengst konnte er auf keinen Fall reiten.
»Wo kommst du eigentlich so plötzlich her?«, wollte Robin von Charles wissen. »Meintest du nicht, du wolltest dich nicht an diesem Irrsinn beteiligen?«
»Was hätte ich denn deiner Frau und meiner Familie sagen sollen? Dass ich einen Freund im Kampf gegen eine Übermacht allein gelassen habe? Du bist wohl nicht ganz richtig im Kopf! Ich habe den Wagen mit über die Furt gebracht und bin dir dann gefolgt. Von Weitem konnte ich das Massaker beobachten, das du angerichtet hast. Dann sah ich, wie du wegrittest und drei Kreuzzügler sich ihrer Rüstungen entledigten, um dir zu folgen. Also heftete ich mich an ihre Fersen und wäre trotzdem fast zu spät gekommen.«
»Danke, Charles.« Mehr gab es dazu nicht zu sagen.
»Was ist denn mit deinem Arm? Schlimm?«
»Ich weiß nicht. Bis jetzt hatte ich noch keine Zeit, mich darum zu kümmern.«
»Na, dann lass mal sehen.«
Der Gascogner schlitzte mit seinem Dolch den Ärmel von Robins Gambeson auf. Zum Vorschein kam eine übel aussehende Wunde, die von den Spitzen des Armbrustbolzens gerissen worden war. Haut und Muskelgewebe waren zerfetzt, doch offenbar Knochen und Gefäße unverletzt, sodass kaum noch Blut den Arm herabrann.
»Nur ein Kratzer, wie du siehst«, wehrte Robin ab. »Kaum der Rede wert.«
»Das hat dein Löwenherz auch gesagt, als ihn so ein Ding traf«, mahnte d’Artagnan. »Dann erwischte ihn das Wundfieber, und zehn Tage später war er tot. Aber was sage ich, in ein paar Stunden bist du zu Hause, und deine Frau wird schon wissen, wie sie dich zu verarzten hat. Verbluten wirst du ja bis dahin offenbar nicht.«
Marian besaß einen fast legendären Ruf als Heilerin unter den Bewohnern der Gascogne. Ganz gleich, ob Mensch oder Vieh, bevor man einen Bader oder Mönchsarzt zurate zog, kamen die Leute lieber zu ihr.
»Dann lass uns gehen. Ich hoffe nur, dass mein Pferd es auch schafft. Vor nicht einmal einer Woche sind wir frohgemut aufgebrochen, und jetzt kommen wir als Invaliden heim. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was ich von meiner Frau zu hören bekommen werde.«
Erstaunlicherweise schien sich Ares mit der Zeit sogar etwas einzulaufen. Er setzte zwar die Hinterbeine jeweils nur bis etwa zum Hüfthöcker unter, ging also mit kurzen Schritten, aber immerhin kam er voran. Und das war mehr, als Robin zu hoffen gewagt hatte.
Jean de Bresac hatte die Überlebenden zurück nach Agen geführt und dort von dem Überfall durch Robert von Loxley berichtet. Aber den Namen kannte hier niemand, und Bischof Arnaud de Rovinha ging davon aus, dass es sich wahrscheinlich um einen Engländer handelte, der zur Garnison von Bordeaux gehörte. Er ermahnte seine Soldaten, nicht erneut auf angevinisches Gebiet vorzudringen. Zumindest nicht, bevor Simon de Montfort oder der neue päpstliche Legat es befahlen. Allerdings gab sich der Bischof nicht der Illusion hin, dass sich die Männer des Herzogs von Narbonne an seine Anordnungen hielten.
Ausgeschickte Späher fanden zwei der verschollenen Kreuzritter tot am Ufer der Garonne. Von dem dritten und den Pferden fehlte jede Spur. Irgendwie war das alles unheimlich und nur mit Hexerei zu erklären. Der Bischof selbst las eine Messe für die Gefallenen und beschloss, Nachricht an den Erzbischof und den Vertreter des Heiligen Stuhls zu senden und um Instruktionen zu bitten.
Zu seinem Erstaunen überschüttete Marian Robin nicht mit Vorwürfen, als sie endlich in Lisse ankamen. Sie bat ihre Schwiegertochter Blanche, die selbst erst vor Kurzem einer Tochter das Leben geschenkt hatte, sich um die junge Frau und das tote Kind zu kümmern, bis sie Zeit hatte, sich der Verbrennungen anzunehmen. Nach Ares würde sie am nächsten Tag sehen. Wichtig war erst einmal, dass der Hengst in seiner Box zur Ruhe kam. Robin deckte ihn ein, denn immer noch schüttelte es seinen vierbeinigen Freund, als hätte dieser das Wechselfieber.
»Zeig mir mal deinen Arm«, verlangte Marian, als ihr Mann endlich zu ihr kam und das gemeinsame Gemach betrat. »Seit wann lässt du denn Armbrustschützen so nahe an dich heran, dass sie dich mit ihren Bolzen erreichen können? Du wirst doch nicht etwa langsam alt?«
»Danke, ich liebe dich auch. Ich wollte den Kreuzrittern eine Botschaft zukommen lassen, und nicht einmal meine Stimme trägt über dreihundert Yards. Aber zugegeben, es war leichtsinnig und wohl mehr der Wut als der Vernunft geschuldet.«
»Also doch immer noch jugendlicher Überschwang statt Altersweisheit. Wirst du denn nie erwachsen, Robin?«
»Das musst du gerade sagen«, knurrte Robin seine mädchenhafte Frau an, die wie gewohnt in Beinlingen und einer kurzen Tunika herumlief. Das Haar, in dem sich kein grauer Faden zeigte, hatte sie am Hinterkopf mit einem einfachen Band zusammengerafft, und ihre schlanke Figur würde nach wie vor jeder Zwanzigjährigen zur Ehre reichen. Aber sie saß täglich auch mehrere Stunden im Sattel, ritt die jungen Pferde an, kontrollierte die Stallknechte und Mägde, und Müßiggang war für sie ein Fremdwort, dessen Bedeutung sich ihr nicht erschloss. Ihr Mann war sich sicher, würde man von Marian die üblichen Tätigkeiten einer hochgestellten Dame wie Nähen, Sticken und Beten verlangen, ginge sie innerhalb kürzester Zeit ein wie eine Blume, der man das Wasser nahm. Dabei hatte sie das fünfzigste Lebensjahr bereits überschritten, aber Frauen wie sie waren offensichtlich unverwüstlich, und dafür dankte Robin täglich Gott. Eleonore von Aquitanien, König Richards Mutter, von gleicher Statur und ähnlichem Temperament wie Marian, hatte mit über achtzig Lebensjahren noch mit ungebeugtem Rücken an seiner Seite im Winter die Pyrenäen überquert, um ihre Tochter in Kastilien zu besuchen, und kein Wort der Klage war ob der Anstrengungen und der Kälte über ihre Lippen gekommen.
»Hast du ihnen womöglich den Namen genannt, unter dem wir hier leben?«, erkundigte sich Marian besorgt. Nichts fürchtete sie mehr, als ihre neue Heimat zu verlieren. »Nicht, dass wir in nächster Zukunft Besuch von Montfort und seiner unter dem Kreuz – Gott möge ihnen die Sünde vergeben – reitenden Mörderbande bekommen.«