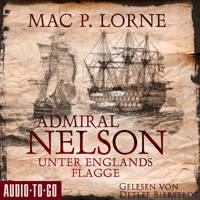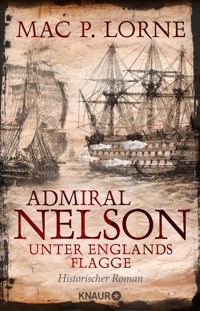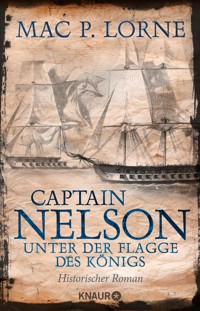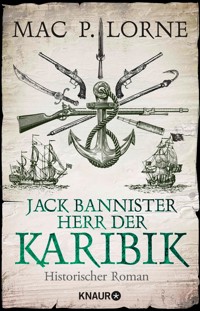6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte des Mannes, der dem Heer des Kalifen Einhalt gebot – ein actionreicher historischer Roman über den kaum bekannten Eudo (auch Odo) von Aquitanien Als Eudo im Jahr 700 zum Herzog von Aquitanien ernannt wird, träumt er davon, dort als unabhängiger König zu herrschen. Dazu muss er sich sowohl gegen seinen Lehnsherren, den König der Franken, behaupten, als auch seine südlichen Grenzen gegen die Mauren schützen. Zu diesem Zweck geht Eudo ein gewagtes Bündnis ein: Er verheiratet seine Tochter mit dem Berberfürsten Munuza. Bei Toulouse gelingt Eudo bald darauf ein überraschender Sieg über die Mauren, als seine schwere Reiterei deren leichte Kavallerie einfach überrennt. Doch dann bringt der Herzog den neuen König der Franken gegen sich auf, und während dieser mit seinem Heer in Aquitanien einfällt, ziehen die Mauren gegen Munuza. Eudo kann dem Verbündeten nicht zu Hilfe kommen, Munuza unterliegt, und Eudos Tochter wird als Geisel genommen und in den Harem des Kalifen nach Damaskus verschleppt … Mit Eudo von Aquitanien hat Mac P. Lorne erneut einen Mann zur Hauptfigur eines historischen Romans gemacht, der entscheidenden Einfluss auf die Geschichte Europas genommen hat. Wer actionreiche, abenteuerliche Romane liebt, kommt hier genauso auf seine Kosten wie historisch Interessierte. Entdecken Sie auch Mac. P. Lornes historische Romane »Der Pirat« über Sir Francis Drake und »Der Herr der Bogenschützen« über John Holland, den erbitterten Gegner Jeanne D'Arcs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 810
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mac P. Lorne
Der Herzog von Aquitanien
Historischer Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die Geschichte des Mannes, der dem Heer des Kalifen Einhalt gebot – ein actionreicher historischer Roman über den kaum bekannten Eudo (auch Odo) von Aquitanien
Als Eudo im Jahr 700 zum Herzog von Aquitanien ernannt wird, träumt er davon, dort als unabhängiger König zu herrschen. Dazu muss er sich sowohl gegen seinen Lehnsherren, den König der Franken, behaupten, als auch seine südlichen Grenzen gegen die Mauren schützen. Zu diesem Zweck geht Eudo ein gewagtes Bündnis ein: Er verheiratet seine Tochter mit dem Berberfürsten Munuza.
Bei Toulouse gelingt Eudo bald darauf ein überraschender Sieg über die Mauren, als seine schwere Reiterei deren leichte Kavallerie einfach überrennt. Doch dann bringt der Herzog den neuen König der Franken gegen sich auf, und während dieser mit seinem Heer in Aquitanien einfällt, ziehen die Mauren gegen Munuza. Eudo kann dem Verbündeten nicht zu Hilfe kommen, Munuza unterliegt, und Eudos Tochter wird als Geisel genommen und in den Harem des Kalifen nach Damaskus verschleppt …
Inhaltsübersicht
Widmung
Personenregister
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Epilog
Historische Anmerkungen des Autors
Danksagung
Zeittafel
Glossar
Für Inga, Jette und Svea,
meine drei liebsten Frauen
Personenregister
Historisch verbürgte Personen, die der Leser im Laufe der Handlung kennenlernen wird:
Eudo – ein Herzog, der König werden wollte, aber an seinen mächtigen Gegnern scheiterte
Hunold – sein ältester Sohn
Hatto – sein jüngerer Sohn
Lampegia – seine Tochter
Hubertus – Eudos Bruder, Bischof von Lüttich und als Schutzpatron der Jäger in die Kirchengeschichte eingegangen
Germier – Bischof von Tolosa, später heiliggesprochen
Karl – mit Beinamen Martell, vom Lateinischen martellus, der Hammer, fränkischer Hausmeier zuerst des austrischen Teils des Frankenreiches, später des gesamten, und damit der eigentliche Herrscher des Reiches sowie Begründer der Dynastie der Karolinger
Raganfrid – Hausmeier des neustrischen Teils des Frankenreiches und Karls Gegenspieler
Chilperich II. – aus der Dynastie der Merowinger, nur dem Titel nach König des Frankenreiches, in Wahrheit aber eine Marionette seiner Hausmeier
Abd ar-Rahman – erstmals 721 und ab 730 zum zweiten Mal Statthalter von al-Andalus bis zu seinem Tod 732 in der Schlacht von Tours und Poitiers, zeit seines Lebens ein Räuber
Uthman ibn Naissa – genannt Munuza, ein Berberfürst, der für die Statthalter von al-Andalus zuerst Asturien, später Cerdanya verwalten sollte, aber ein Verbündeter und Schwiegersohn Eudos wurde
as-Samh ibn Malik al-Chawlani – Statthalter von al-Andalus, verstarb 721 in Narbonne an den Verletzungen, die er sich in der Schlacht um Toulouse zugezogen hatte
Anbasa ibn Suhaym al-Kalbi – von 721 bis 726 Statthalter von al-Andalus, verstarb während eines Raubzuges nach Burgund
Kalif Umar ibn Abd al-Azīz – scheiterte bei der Belagerung von Konstantinopel, erließ ein Edikt, das Juden vorschrieb, einen gelben Fleck auf ihrer Kleidung zu tragen und sich wie Christen zu betragen, um den muslimischen Glauben nicht zu beleidigen
Maslama ibn Abd al-Malik – sein Feldherr und Cousin
Kalif Hischām ibn Abd al-Malik – herrschte von 727 bis 743 über das moslemische Reich der Umayyaden, das zu seiner Zeit von den Pyrenäen über Nordafrika bis weit hinein nach Vorderasien reichte
Leo III. – byzantinischer Kaiser, leitete erfolgreich die Verteidigung von Konstantinopel gegen die Araber 717/718
Artabasdos – sein Schwiegersohn und Stratege (Heerführer)
Oppas – Bischof von Sevilla, fiel in der Schlacht von Covadonga
Corrado – ein Einsiedler, der im Tal von Covadonga lebte
Nambad von Urgell – ein verräterischer Bischof in Cerdanya
Prolog
Südarabien, 717
Al-Hurr ibn Fihri erstickte röchelnd an seinem eigenen Blut. Abd ar-Rahman vom Stamme der Ghafiqi hatte dem Karawanenwächter die Kehle von einem Ohr zum anderen durchgeschnitten. Der Mann gehörte den verachteten Achdam, der niederen, dunkelhäutigen Kaste der Diener an, ihm würde bestimmt niemand eine Träne nachweinen, dessen war sich der Wüstenräuber sicher. Die Frauen und Kinder des Getöteten zählten schließlich nicht. Ihrer nahm sich nach den Lehren des Korans schließlich Allah der Allbarmherzige an. Und für den Fall, dass er das nicht tat und sie verhungerten oder in die Sklaverei gerieten, war dies eben Kismet und im Heiligen Buche verzeichnet, wie die Imame der neuen Religion lehrten.
Im Schutze der Dunkelheit und der hohen Sanddüne hatte Abd ar-Rahman sich an den Posten herangeschlichen. Schon oft geübt, gelang die lautlose Überwältigung auch diesmal. Als er merkte, wie der Wächter in seinen Armen erschlaffte und dass von ihm keine Gefahr mehr ausging, stieß er ihn achtlos in den Sand der südlichen arabischen Wüste und gab seinen Kameraden das vereinbarte Zeichen, dass die Ausschaltung des Wachpostens gelungen war.
Die Karawane kam aus Aden am Arabischen Meer, dem wichtigsten Umschlagplatz für die begehrten Güter aus Afrika und Asien. Die Händler hatten reichlich eingekauft und wollten Weihrauchharz aus Afrika, Seide aus China und Gewürze aus Indien nach Damaskus bringen, da sie sich in der Hauptstadt des Umayyaden-Reiches reiche Gewinne versprachen. Natürlich wussten die Kaufleute um die Gefahr räuberischer Beduinen in der Wüste und hatten deshalb einige Bewaffnete als Eskorte angeworben. Zwar hatte der Prophet Mohammed, gepriesen sei sein Name, verkündet, dass alle Anhänger des von ihm verbreiteten Glaubens Brüder wären und keiner dem anderen ein Leid antun oder ihm etwas wegnehmen dürfe, wollte er nicht auf ewig in der Hölle schmoren und von neunschwänzigen Dämonen gepeinigt werden. Aber so ganz trauten die Kaufleute dem Frieden nun auch wieder nicht und hatten letztendlich nicht an Söldnern gespart. Denn selbst wenn die Bewohner der ganzen Arabischen Halbinsel und weiterer Gebiete darüber hinaus den Islam mittlerweile als die einzig wahre Religion ansahen und man hier, unweit des Ortes, wo Allah sich dem Propheten offenbart hatte, weitestgehend sicher sein dürfte, galt doch immer noch: Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Obwohl, immer wieder verschwanden Karawanen in den unendlichen Weiten der Wüste. Doch sie konnten schließlich auch Sandstürmen oder Wassermangel zum Opfer gefallen sein. Große Sorgen machten sich die Händler deshalb nicht, denn die Jahreszeit war für die Reise günstig, und sie führten ausreichend Wasser in Ziegenschläuchen mit sich. Sie vertrauten auf den Allmächtigen und wähnten sich unter dem unendlichen Sternenzelt nahezu so sicher wie in Abrahams Schoß.
Der Stamm der Ghafiqi wiederum lebte seit ewigen Zeiten vom heimlichen Raub. Sicher, man besaß auch Ziegen, einige Kamele und züchtete pfeilschnelle Pferde. Doch die Haupterwerbsquelle war der Überfall auf Karawanen, die auf den uralten Handelswegen durch das Land zogen. Der neue Glauben verbot das zwar, aber ob Allah wirklich alles sah, so wie es sein verstorbener Prophet behauptet hatte? Das anzunehmen überstieg die Vorstellungskraft der Beduinen, und so gingen sie nach wie vor ihrem altvertrauten Gewerbe nach. Freilich durfte keiner der Überfallenen überleben, alle Spuren mussten anschließend verwischt und die Leichen sorgfältig beseitigt werden, damit keine Blutrache über den Stamm kam. Doch vieles besorgte in der Wüste allein schon der ständig wehende Wind, und die Toten fand in den tiefen, steinigen Schluchten und verborgenen Höhlen niemand mehr.
Gebückt huschten einige der Kameraden von Abd ar-Rahman, der sich trotz seiner jungen Jahre schon als Anführer bei derartigen Raubzügen bewährt hatte, auf den Kamm der Sanddüne und legten Pfeile auf die Sehnen ihrer Bogen. Gleich würden ihre Stammesgenossen auf ihren schnellen Pferden aus einer versteckten Senke hervorbrechen und mit ihren Krummsäbeln und Speeren alles niedermachen, was sich ihnen in den Weg stellte. Die Aufgabe der Schützen bestand darin, jeden am Entkommen zu hindern, der zu fliehen versuchte. Wie immer musste die Überraschung ihr bester Verbündeter und alles vorbei sein, bevor sich ernsthafter Widerstand formieren konnte.
Abd ar-Rahman ließ den schellenden Balzruf des Lannerfalken, das charakteristische Akzick-akzick, aus der hohlen Hand heraus erklingen, und gleich darauf hörte er das Trommeln von Pferdehufen, das aber im Wüstensand längst nicht so laut war wie auf Stein. Von drei Seiten griffen die Reiter der Ghafiqi die ruhenden Händler, Kameltreiber und ihre Bewacher an, deren Unaufmerksamkeit und mangelnde Wachsamkeit ihnen zum Verhängnis werden sollte. Die vierte Seite deckten die Schützen ab und warteten auf diejenigen, die auf sie zulaufen würden. So waren die Wüstenräuber schon viele Male erfolgreich vorgegangen und davon überzeugt, dass ihr Überfall mit Allahs Hilfe auch diesmal glücken würde. Alles sprach dafür – nur schlug ihnen diesmal Widerstand entgegen, mit dem sie nicht gerechnet hatten.
Abū Hubaira, der jüngste Sohn des reichsten Handelsherrn von Sanaa aus dem Stamm der Quraisch und hoch angesehenem Geschlecht der Banū Hāschim, dem auch der Religionsgründer Mohammed angehört hatte und der seit vielen Jahren in Mekka beheimatet war, begleitete die Karawane auf Wunsch seines Vaters persönlich. Von gleichem Tatendrang und Mut beseelt wie sein Erzeuger, sammelte er blitzschnell diejenigen um sich, die den ersten Angriff der Wüstenreiter überlebt hatten, und feuerte sie an, sich erbittert zur Wehr zu setzen. Das fiel nicht allzu schwer, denn der Tod wartete so oder so auf jeden, gleich, ob er im Kampf fiel oder sich ergab. Gnade gewährten die Beduinen erfahrungsgemäß nie. Höchstens verschonten sie das Leben der Frauen und kleinen Kinder, verschleppten sie aber und ließen sie ein erbärmliches Sklavendasein in den Tiefen der arabischen Wüste fristen.
Die Krieger der Ghafiqi waren von dem plötzlichen Widerstand überrascht. Pfeile und Speere flogen ihnen aus der Mitte des Lagers entgegen. Die Wachmannschaft hatte sich hinter den am Boden liegenden und jetzt erschrocken blökenden Kamelen verschanzt und streckte den Angreifern ihre Lanzen entgegen. Aber es waren zu wenige, als dass sie sich auf die Dauer hätten wirkungsvoll behaupten können. Nach und nach sank einer nach dem anderen von ihnen tot in den Wüstensand, doch auch die Ghafiqi erlitten diesmal herbe Verluste.
Als Abū Hubaira sah, dass auch der Karawan-Baschi gefallen war und der Widerstand zusammenzubrechen drohte, sah er nur noch einen Ausweg – die Flucht. Von seinem Vater hatte er einen prachtvollen Araberhengst als Geschenk erhalten, der sorgfältig ausgebildet und abgerichtet worden war. Das edle Tier lag unweit seines Herrn zusammen mit den Kamelen im Wüstensand und harrte als Fluchttier ganz entgegen seiner Natur gelassen, aber bereit, jederzeit blitzschnell aufzuspringen und davonzupreschen, der Dinge, die da kamen. Abū Hubaira, der mit seinem Bogen so manchen Angreifer aus dem Sattel geholt hatte, kroch nun heran, hing sich an die linke Seite des Sattels und feuerte den Hengst mit einem schrillen Ruf an, aufzuspringen und aus dem Stand heraus seine Höchstgeschwindigkeit im Galopp zu entwickeln. Das brave Tier tat, wie ihm geheißen und beigebracht worden war, und stürmte, ehe die Angreifer es sich versahen, wie der Sturmwind davon. Da die Räuber keinen Reiter in seinem Sattel sahen, schenkten sie sich für den Moment die Verfolgung. Irgendwann würde das Pferd schon stehen bleiben oder sich wieder zu seinen Artgenossen gesellen. Auf alle Fälle war es eine zu wertvolle Beute, als dass man es verletzen oder in der Wüste sich selbst überlassen würde.
Nur Abd ar-Rahman erkannte von der Anhöhe herab im silbernen Schein des Mondes den Mann, der an der Seite des Hengstes hing. Das Pferd preschte genau am Fuße der Sanddüne auf dem Weg dahin, auf dem die Wüstenräuber gekommen waren. Für einen gezielten Schuss war es bereits zu spät, aber auf gar keinen Fall durfte der Flüchtende entkommen und Kunde von dem Überfall nach Sanaa oder gar Mekka bringen. Denn dann würden all die anderen Stämme vereint über die Ghafiqi herfallen, obwohl sie nur gar zu gerne ebenfalls ihre Finger nach leichter Beute ausstreckten. Während seine Kameraden den letzten Karawanenbegleitern den Garaus machten und schon begannen, sich um die Beute zu streiten, pfiff Abd ar-Rahman seinem Pferd. Er hatte es in der Talsohle zurückgelassen, und willig kam der Hengst nun auf seinen Herrn zu, der ihm mit wehendem Burnus entgegenrannte, in den Sattel sprang und die Verfolgung aufnahm.
Abd ar-Rahman verfügte gleichfalls über ein hervorragendes Reittier und zweifelte keinen Augenblick daran, den Fliehenden bald einzuholen. Doch zu seinem Erstaunen gelang es ihm nicht, die Distanz zu dem Reiter vor sich zu verkürzen. Im Gegenteil, er hatte eher den Eindruck, dass sie wuchs. Doch dann machte der Fremde einen Fehler. Wahrscheinlich weil er die Gegend nicht kannte, umging er einen Hügelrücken, anstatt einfach über ihn hinwegzureiten. Abd ar-Rahman frohlockte und war sicher, dem Verfolgten nun den Weg abschneiden zu können. Er jagte über den Höhenzug, und tatsächlich, auf der anderen Seite kam der Fliehende gerade erst an. Erschrocken riss er seinen Hengst hoch, um nicht mit dem plötzlich aufgetauchten Reiter zusammenzuprallen, und im nächsten Moment wurden Schwerter aus ihren Scheiden gerissen.
Abū Hubaira war jünger und weniger kampferfahren als sein Gegner, aber er wehrte sich mit dem Mut der Verzweiflung, denn er wusste, welches Schicksal im bevorstand, wenn er unterlag. Außerdem verfügte er über ausgezeichnete Waffen. Die Klinge seines Säbels war aus speziell gehärtetem Damaszener Stahl und damit der des Wüstenräubers eindeutig überlegen.
Und handzuhaben wusste sein Gegner sie auch, wie Abd ar-Rahman zu seiner Verblüffung feststellen musste. Er hatte geglaubt, leichtes Spiel zu haben, sah sich aber getäuscht. Der junge Mann ließ ein solches Stakkato von Hieben auf ihn einprasseln, dass er sich ihrer nur mühsam erwehren konnte. Im Eifer des Gefechts rutschte ihm das Tuch herunter, das er vor Mund und Nase getragen hatte – und auf einmal blickte Abū Hubaira in ein ihm bekanntes Gesicht. Er hielt für einen Moment inne und fuhr seinen Angreifer wutentbrannt an.
»Dich kenne ich! Beim Schaitan, du bist Abd ar-Rahman vom Stamme der Ghafiqi! Von deinem Vater hat mein Vater das Pferd gekauft, das ich reite. Willst du es dir womöglich auf diesem Wege zurückholen?«
Der Wüstenräuber hatte das natürlich schon zu Beginn des Kampfes erkannt. Schließlich galten die Ghafiqi als die besten Pferdezüchter in der südlichen arabischen Wüste und rühmten sich der Stammbäume ihrer edlen Rosse, die angeblich bis auf die Stuten des Propheten zurückreichten. Doch nun gab es einen Grund mehr, warum der junge Mann sterben musste. Seine Sippe und sein Stamm gehörten zu den einflussreichsten in diesem Teil Arabiens zwischen Medina, Mekka und den Handelsstädten Sanaa und Aden. Ihre Rache könnte furchtbar sein und ihn und die Seinen vernichten, gelänge es seinem Gegner zu entkommen.
Deshalb sparte sich Abd ar-Rahman eine Erwiderung. Er täuschte mit seinem Säbel einen Stich gegen die Brust seines Gegners vor, riss aber nach dessen Parade schnell sein Schwert nach oben, um einen Hieb gegen dessen Kopf zu führen. Der mit aller Wucht geführte Schlag traf aber erneut auf die Waffe des jungen Mannes, der durch eine harte Schule im Schwertkampf gegangen war. Und jetzt erlebte der Wüstenräuber den Albtraum eines jeden Kriegers – seine Klinge brach an der härteren des Feindes, und im hellen Mondlicht sah er sie durch die Luft fliegen.
Abd ar-Rahman war ein zu erfahrener Kämpfer, um sich seiner Verblüffung hinzugeben. Bevor er von einem Hieb oder Stoß Abū Hubairas getroffen werden konnte, ließ er sich blitzschnell aus dem Sattel gleiten. Schnell rannte er ein paar Schritte davon, um etwas Distanz zwischen sich und den Gegner zu bringen, riss aber im Laufen schon den Bogen von der Schulter und einen Pfeil aus dem Köcher. Doch als er sich umwandte, um den Gegner mit einem gezielten Schuss niederzustrecken, sah er, dass dieser weit klüger war als erwartet.
Abū Hubaira dachte gar nicht daran, sich auf einen Kampf einzulassen, in dem er auf Dauer nur unterliegen konnte. Blitzschnell hatte er die Zügel des zweiten Pferdes ergriffen und jagte nun, tief über den Hals seines eigenen Hengstes gebeugt und das andere Tier mit sich führend, davon. Wütend schickte Abd ar-Rahman ihm einen Pfeil nach, aber nicht einmal das Hohngelächter seines Gegners hörte er mehr, denn der war schon viel zu weit weg.
Dem Anführer der Wüstenräuber blieb nun nichts anderes mehr übrig, als sich zu Fuß auf den Rückweg zu seinen Kameraden zu machen. Dabei durchdachte er alle möglichen Optionen für ihr weiteres Vorgehen. Aber wie er es auch drehte und wendete, es blieb ihnen eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, wollten sie überleben.
Nach fast einer Stunde erreichte er das Karawanenlager, wo seine Stammesgenossen immer noch dabei waren, die Beute unter sich aufzuteilen. Als die Ersten begannen, ihn wegen seiner missglückten Verfolgung zu verspotten, fuhr er sie wutschnaubend an.
»Habt ihr überhaupt eine Ahnung, ihr Ausgeburten der Hölle, was für eine Katastrophe durch eure Unachtsamkeit auf uns zurollt?«, brüllte er so laut, dass man ihn fast bei den heimischen Zelten hätte hören können. »Warum war ich eigentlich der Einzige, der den Fliehenden verfolgt hat? Wisst ihr Söhne von räudigen Eseln eigentlich, wer das war? Abū Hubaira, der Sohn von Abd al-Musa, dem reichsten Handelsherrn von Sanaa aus dem Geschlecht der Quraisch, dem auch der Prophet Mohammed entstammt! Habt ihr überhaupt eine Ahnung davon, wie mächtig dieser Clan hier im Westen und Süden Arabiens ist? Glaubt ihr, die Angehörigen dieses Stammes werden es uns nachsehen, dass wir ihre Karawanen überfallen und ihre Männer töten? Wie der Sturmwind werden sie über uns kommen und nicht eher rasten noch ruhen, bis auch der Letzte von uns sich vor Allah rechtfertigen muss. Ich denke nicht, dass wir Zeit für Spott und Hohn haben. Stattdessen sollten wir überlegen, was wir nun tun und wie wir überleben können.«
Betretenes Schweigen machte sich in der Runde breit, denn so hatte das noch keiner der Räuber gesehen. Bisher war es aber auch noch nie vorgekommen, dass es jemandem gelungen war, ihren tödlichen Säbelhieben, Speeren und Pfeilen zu entgehen. Zwar hatte es ja irgendwann einmal dazu kommen müssen, doch die Gedanken an die Folgen waren von allen verdrängt worden. Einer von Abd ar-Rahmans Unteranführern war deshalb nach einigem Nachdenken auch der Erste, der mit einem Vorschlag herausrückte.
»Ich denke, wir müssen das gesamte geraubte Gut herausgeben und für die Erschlagenen ein Blutgeld anbieten, um selbst der Blutrache zu entgehen. Du hast recht, die Quraisch sind zu einflussreich, als dass wir uns mit ihnen anlegen können. Wir sollten Reue geloben und uns ihnen und Allahs Gnade unterwerfen. Nur so können wir und unsere Familien ihrer Vergeltung entgehen. Oder was meint ihr, meine Brüder?«
Du bist ja so naiv, dachte Abd ar-Rahman bei sich. Als ob der Vater des jungen Mannes, den er verfolgt und zu töten beabsichtigt hatte, sich davon würde beeindrucken lassen. Bis nach Damaskus würde sein Wehklagen zu hören sein, und seine Abgesandten würden schon bald vor Kalif Sulaimān ibn Abd al-Malik auf den Knien liegen und ihn um Hilfe anflehen. Schließlich stammte dieser selbst aus dem Stamm der Quraisch, genau genommen aus dem Clan der Umayyaden. Und wenn der Kalif seine Todesreiter schickte, dann konnte nichts, aber auch gar nichts mehr den Stamm der Ghafiqi retten. Abd ar-Rahman jedenfalls wollte dann so weit wie möglich weg sein und keineswegs darauf warten, bis ihm nach unendlichen Folterqualen endlich die Erlösung des Todes gewährt wurde.
»Ich denke nicht, dass uns das helfen wird«, entgegnete er deshalb. »Abd al-Musa ist viel zu reich, um sich von unserem Blutgeld beeindrucken zu lassen. Wahrscheinlicher ist, dass er ein Exempel an uns statuieren wird, damit es niemand mehr wagt, sich an seinen Karawanen zu vergreifen. Und die anderen Handelsherren werden ihm beipflichten und ihn dabei unterstützen, da bin ich mir ganz sicher. Nein, das, was du sagst, ist gewiss keine Lösung, die uns das Überleben sichern wird.«
»Und was wäre dann dein Vorschlag?«, wollte der Unteranführer von seinem Hauptmann wissen. »Schließlich bist du nicht ganz unschuldig an unserer prekären Lage.«
»Ich weiß. Und deshalb bin ich auch bereit, meinen Anteil an der Misere zu übernehmen und mich der Verantwortung vor Allah zu stellen. Hier können wir jedenfalls nicht bleiben. Also werden wir unsere angestammte Heimat verlassen müssen, wollen wir unsere Familien nicht in Gefahr bringen. Nur wenn der Sheikh und alle anderen Stammesangehörigen guten Gewissens beim Barte des Propheten schwören können, dass sie von unseren Unternehmungen nichts wussten und auch keine Ahnung haben, wo wir uns aufhalten, haben sie eine Chance, der Rache der Quraisch zu entgehen.«
»Wir sollen in die Fremde gehen und unsere Familien, unsere Väter und Mütter, unsere Brüder und Schwestern verlassen? Das kann doch nicht dein Ernst sein!«
»Sehe ich so aus, als wäre ich zu Scherzen aufgelegt? Jeder hier ist ein freier Beduine, der seinen eigenen Weg gehen kann. Meiner jedenfalls wird mich noch heute von hier fortführen.«
»Aber wohin willst du gehen, wohin sollen wir die Köpfe unserer Pferde wenden? Hast du darüber schon einmal nachgedacht? Müssen wir uns zukünftig womöglich als Kameltreiber oder Ziegenhirten verdingen, um zu überleben? Das ist doch kein erstrebenswertes Ziel. Lieber sterbe ich, als um etwas Hirse und ein paar Datteln betteln zu müssen.«
»Vor Allah treten kannst du noch früh genug. Fragt euch doch einmal, was wir sind. Krieger, oder etwa nicht? Und wo werden Männer wie wir gebraucht? Natürlich dort, wo gekämpft wird. Dorthin sollten wir uns wenden und einem Kriegsherrn unsere Dienste anbieten, der uns fürstlich dafür entlohnt.«
Nachdenkliches Schweigen breitete sich unter den Wüstenräubern aus, bis der Unteranführer die entscheidende Frage stellte.
»Du hast doch bestimmt auch schon eine Idee, wohin du gehen willst, oder?«
»Natürlich. Und die könntest du ebenfalls haben, wenn du einmal nachdenken würdest. Wovon hat denn der heilige Mann, der ehrwürdige Imam, gesprochen, als er unlängst bei unseren Zelten weilte? Vom Heiligen Krieg, vom Dschihad, gegen die Ungläubigen. Viele Ländereien sind von den wahrhaft Gläubigen bereits erobert und das Wort des Propheten Mohammed ist dort verkündet worden. Jetzt stehen die Truppen unseres Kalifen Sulaimān ibn Abd al-Malik vor der größten Stadt der Kuffār, vor dem unglaublich reichen Konstantinopel. Dorthin sollten wir uns wenden und Allah und unserem Herrscher unsere Kräfte zur Verfügung stellen. Ungeheure Beute wartet auf alle, die bei der Erstürmung der Kaiserstadt dabei sein werden. Und vielleicht auch Vergebung und Barmherzigkeit, wenn wir uns im Kampf auszeichnen und bewähren. Was meint ihr, wer will mir folgen, wenn ich zuerst nach Norden und später nach Osten reite? Dorthin, wo die Sonne aufgeht und die Mauern von Konstantinopel darauf warten, erstürmt zu werden?«
Abd ar-Rahman hatte mit der Ansprache, wie von ihm erwartet, die Herzen seiner Mitstreiter erreicht und gewonnen. Es gab keinen Einzigen, der zurückbleiben wollte. Die Wüstenräuber strebten wie ein Mann danach, für Allah, ihren noch recht jungen, neuen Glauben und den Kalifen in den Heiligen Krieg zu ziehen.
1. Kapitel
Bordeaux, 717
Eudo, seit mehr als zwanzig Jahren Herzog von Aquitanien, konnte sich nicht erinnern, jemals so ratlos gewesen zu sein. Die Hände auf dem Rücken verschränkt, lief er in der großen Halle des Palastes, der einmal dem römischen Dichter und Konsul Ausonius gehört haben sollte und den er zu seiner Residenz in Bordeaux erwählt hatte, auf und ab. Die Stadt, von den Römern einst Burdigala genannt, musste einmal prachtvoll gewesen sein. Davon zeugten noch heute die allerdings meist verfallenen Paläste, die Überreste des riesigen Amphitheaters und der Befestigungsanlagen. Sowohl von den Visigoten als auch später von den Franken war die Stadt erobert und geplündert worden, doch die schlimmsten Verwüstungen hatte ein schweres Erdbeben angerichtet, von dem alte Chroniken berichteten. Eudo, der um die Bedeutung der Hafen- und Handelsstadt in früheren Zeiten wusste, hatte beschlossen, sie wieder zu neuer Blüte zu führen und zur Hauptstadt seines Reiches zu machen, das sich von der Loire bis zu den Pyrenäen, vom großen Ozean bis an die Rhone erstreckte. Schon seit Jahren waren umfangreiche Bauarbeiten im Gange, doch gegenwärtig galten sie in erster Linie den Stadtmauern und dem Kastell, denn von überallher drohte Gefahr.
Der Herzog hatte es bisher geschafft, dem Land, über das er herrschte, größtenteils sowohl die Unabhängigkeit von den Franken als auch den Frieden zu bewahren. Es war aufgeblüht, die Landwirtschaft, der Weinbau und der damit verbundene Handel florierten fast wieder wie zu Zeiten der Römer, deren Straßen man noch heute nutzte und die Eudo so gut wie möglich instand halten ließ. Schon allein deshalb, damit er mit seinen Truppen, wenn Not am Mann war oder Aufstände und Einfälle in sein Reich drohten, schnell von einem Ort zum anderen eilen konnte. Sein großes Ziel, das Herzogtum Aquitanien wieder zu einem selbstständigen Königreich zu machen, hatte er bereits in greifbarer Nähe gesehen.
Die Franken, deren Oberhoheit er zu seinem Leidwesen bisher anerkennen musste, waren in sich zerstritten, ihre Stammlande zersplittert und in die zwei Reichsteile Neustrien und Austrien aufgeteilt worden. In allen beiden herrschte ein Hausmeier als Regent und bekriegte den anderen erbittert. Der König, aus dem geheiligten Geschlecht der Merowinger stammend, dem eigentlich der Thron und die Krone seit alters her gebührte, war mittlerweile eher eine lächerliche Figur, die vom neustrischen Hausmeier mit einem Ochsengespann von einem Ort zum anderen durch das Land gekarrt wurde, damit sich dieser mit dem Titularherrscher an seiner Seite als wahrer Machthaber legitimieren konnte. Nun hatten beide Hausmeier, Raganfrid für Neustrien und Karl für Austrien, Abgesandte zu Eudo geschickt, um ihn jeweils auf ihre Seite und damit in ihre Auseinandersetzung hineinzuziehen. Das war nun wahrlich das Letzte, was sich der Herzog wünschte. Noch dazu, wo eine zusätzliche und vielleicht viel größere Gefahr von Süden her drohte. Ja sah denn niemand dort oben im Norden, was gerade auf der Iberischen Halbinsel vor sich ging? Dass ihnen allen die Vernichtung drohte, wenn sie sich nicht zusammentaten, ihren kleinlichen Zwist begruben und eine Phalanx gegen die Eindringlinge aus Ifrīqiya bildeten, die schon an den Grenzen des Frankenreiches standen und deren Vorausabteilungen bereits mehrmals mordend und plündernd über die Pyrenäenpässe gekommen waren?
In nur wenigen Jahren hatten sie das mächtige Reich der Visigoten erobert und deren König in der Schlacht am Río Guadalete besiegt und getötet. Jetzt stießen sie nach Septimanien, der reichen Provinz am Mittelmeer, vor und bedrohten damit die Südostflanke Aquitaniens. Eudo, der sich über ein Jahrzehnt hatte in Sicherheit wiegen können und geschickt die Streitigkeiten zwischen den Franken ausgenutzt hatte, um seine eigene Macht zu festigen und auszubauen, sah sich plötzlich von allen Seiten bedrängt. Deshalb waren auch seine Söhne Hunold und Hatto von ihm ausgesandt worden, die Lage zu erkunden. Nun hatte er sie zum Rapport zurückbeordert, damit sie ihm berichten konnten, wie die Lage im Norden und Süden tatsächlich aussah, bevor er die Abgesandten der Franken empfing, die ihm die Gegebenheiten sicherlich in rosigen Farben schildern würden, nur um den mächtigen Herzog als Bundesgenossen für ihren jeweiligen Herrscher zu gewinnen. Doch Eudo war klug genug, sich stets ein eigenes Bild zu machen, und begierig, den Berichten seiner Söhne zu lauschen. Was ihm diese allerdings eröffneten, diente keineswegs dazu, ihn zu beruhigen.
Hunold, der Älteste, war auf der Iberischen Halbinsel unterwegs gewesen. Kein ungefährliches Unternehmen, angefangen von der Überquerung der Pyrenäen bis hin zu einer Reise durch ein Land, in dem noch immer Krieg herrschte. Aber der Zwanzigjährige war listig und geschickt, hatte sich einmal als Händler, ein anderes Mal sogar als verkrüppelter Bettler ausgegeben und brachte nun beängstigende Neuigkeiten mit nach Hause.
»Es ist unglaublich, was den Visigoten in kürzester Zeit widerfahren ist. Hätte ich es nicht selbst gesehen, ich würde es nicht glauben. Sie waren einst Furcht einflößende Feinde, und wir hatten an der Grenze zu Septimanien und auch an den Pyrenäen so manchen Kampf mit ihnen zu bestehen. Doch jetzt sind sie von den Eindringlingen aus Ifrīqiya regelrecht hinweggefegt worden. Es gibt auf der gesamten, großen Iberischen Halbinsel, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, nur noch zwei Regionen, die ihnen Widerstand leisten und sich nicht unterworfen haben. Das ist an der Ostküste Graf Teodomiro, der sich so energisch widersetzt hat, dass ihm die neuen Herren die Unabhängigkeit seiner Ländereien und Städte gegen eine jährliche Tributzahlung und Anerkennung ihrer Oberhoheit zugestehen mussten. Man nennt seinen Herrschaftsbereich jetzt das Reich Tudmir. Ich war selbst in der stark befestigten Hafenstadt Alicante, habe mich aber nicht an den Hof des Grafen gewagt, da ich dort Spione des Statthalters von al-Andalus, wie die Eroberer die Iberische Halbinsel jetzt nennen, befürchtete. Wäre ich in ihre Hände gefallen, hätten sie mich als Geisel nehmen und dich, Vater, mit mir erpressen können. Außerdem war der Graf nach Damaskus gereist, um sich seine Privilegien von dem Oberherrscher der Eindringlinge bestätigen zu lassen.«
»Ich verstehe es einfach nicht«, meinte Eudo nachdenklich. »Bisher hat mir noch niemand genaue Auskunft darüber geben können, woher diese fremden Krieger auf einmal gekommen sind. Es müssen furchtbare Streiter sein, und wie man hört, kämpfen sie für einen Gott, den sie Allah nennen, und im Namen eines Propheten namens Mohammed. Hast du darüber Näheres in Erfahrung bringen können?«
»Die Visigoten bezeichnen die Invasoren, die über das Meer gekommen sind, allesamt als Mauren. Aber es sind in Wahrheit zwei unterschiedliche Stämme. Die einen nennen sich selbst Araber und kommen von weit her, aus den Wüsten des Ostens. Sie bringen auch diese neue Religion mit und zwingen sie allen, die sie unterwerfen, auf. Sie führen in ihren Augen einen Heiligen Krieg gegen diejenigen, die nicht an ihren Gott glauben und die sie deshalb Ungläubige nennen. Wenn sie im Kampf für ihren Glauben sterben, kommen sie angeblich auf direktem Wege in ihr Paradies. So hat es jedenfalls dieser Prophet Mohammed gelehrt und in einem Buch, das sie Koran nennen, aufschreiben lassen. Deshalb fürchten die Araber in der Schlacht auch nicht den Tod, sondern suchen ihn sogar. Haben sie ein Land erobert, verlangen sie, dass alle Bewohner zu ihrem Glauben übertreten, gleich, welcher Religion diese zuvor angehörten. Wer das nicht tut, der wird zumindest schlecht behandelt, wenn nicht versklavt oder gar getötet. Im günstigsten Fall muss er nur eine Kopfsteuer zahlen, die der jeweilige Statthalter willkürlich festlegt. Die Anhänger des neuen Glaubens nennen sich selbst Muslime oder Rechtgläubige, alle anderen Kuffār. Dazu zählen vor allem wir Christen und auch die Juden. Treffen die Muslime aber auf Anhänger von Götzenkulten, wie sie unter anderem bei den Basken und, wenn wir ehrlich sind, auch noch in Aquitanien von Druiden ausgeübt werden, kennen sie überhaupt keine Gnade. Die christlichen Bischöfe verlangen ja auch von uns, dass wir gegen den alten Glauben an die vielen Götter vorgehen sollen, aber was die Muslime mit Götzendienern anstellen, wenn sie ihrer habhaft werden, widerstrebt mir fast zu erzählen. Ich habe die Hinrichtung eines Ungläubigen gesehen und muss sagen, sie war an Grausamkeit nicht zu übertreffen.«
»So kenne ich dich gar nicht, Bruderherz«, meldete sich Hatto zu Wort. »Bist du womöglich dort unten im sonnigen Süden weich geworden?«
»Schweig, Hatto!«, fuhr Eudo seinen jüngeren Sohn an. »Ich will hören, was dein Bruder noch zu berichten hat. Du hast doch von zwei muslimischen Stämmen gesprochen, Hunold. Wer ist denn der andere?«
»Man nennt sie Berber, und sie stammen aus den Ländern, die der Iberischen Halbinsel genau gegenüberliegen, aus dem Maghreb. Die Araber haben die Berber selbst erst unlängst unterworfen, sie mit Worten, aber auch mit dem Schwert zu ihrem Glauben bekehrt und später zu ihren Verbündeten gemacht. Ich vermute, mit der Aussicht auf reiche Beute, denn sie müssen früher sehr arm gewesen sein und in einem kargen Landstrich leben. Jedenfalls habe ich gemerkt, dass es Spannungen zwischen den beiden Stämmen gibt. Vielleicht kann man sich das einmal zunutze machen.«
»Genauso wie bei den Franken die Spannungen zwischen den Austriern und den Neustriern?«, wollte Eudo wissen.
»Vielleicht nicht ganz so sehr«, beantwortete Hunold die Frage. »Jedenfalls habe ich keine offenen Kampfhandlungen zwischen ihnen gesehen und auch von keinen gehört. Aber die Araber sind sehr stolz, man könnte auch anmaßend und arrogant sagen, und behandeln alle anderen von oben herab. Selbst ihre Verbündeten, wie ich schon sagte. Es brodelt zwischen ihnen, aber es brennt zumindest gegenwärtig noch nicht.«
»Was nicht ist, kann ja noch werden, und vielleicht ist es sogar möglich, etwas nachzuhelfen«, meldete sich Hatto erneut zu Wort. Diesmal wurde er von seinem Vater nicht gerügt, denn Eudo verfolgte bereits den gleichen Gedanken.
»Man hört doch, dass es vor allem Reiterkrieger sind, die da über das Meer gekommen sind. Dass sie auf diese Weise die Visigoten in offener Feldschlacht besiegen konnten, leuchtet mir ein. Vor allem, wenn sie mit großer Übermacht angreifen, wie es von der Schlacht am Río Guadalete berichtet wurde, in der König Roderich gefallen ist. Aber wie konnten sie so große und stark befestigte Städte wie Toledo oder Sevilla einnehmen? Dafür brauchen sie doch Erfahrung in der Belagerung und entsprechendes schweres Gerät. Ich war vor Jahren dort, ich habe die Befestigungen von Roderichs Hauptstadt gesehen. Das dürfte keine leichte Aufgabe für die Angreifer gewesen sein.«
»Vater, die Mauren kämpfen äußerst verbissen und zudem noch schlau. Man darf sie auf gar keinen Fall unterschätzen. Die Städte haben einige Zeit widerstehen können, aber dann gingen die Vorräte zur Neige. Es kam kein Nachschub mehr hinein, weil die Angreifer sie völlig von der Außenwelt abgeschnitten hatten. Irgendwann mussten die Belagerten deshalb die Tore öffnen, wollten sie nicht alle verhungern. Von Sevilla heißt es, dass die Stadt zwei Jahre widerstanden hätte. Die Mauren waren darüber so erbost, dass sie jeden Mann in der Stadt haben umbringen lassen und die Frauen und Kinder in die Sklaverei verschleppt haben.«
»Nun, das machen die Franken auch nicht anders, wenn sie ein Exempel statuieren wollen«, warf Hatto ein. »Ich kann da ebenfalls einiges darüber berichten.«
»Später«, wies Eudo seinen Sohn erneut zurecht. »Hunold, wer herrscht eigentlich über diese fremden Krieger? Wer befehligt sie? Ist es ein König oder gar ein Kaiser, wie der Gebieter über das riesige Byzantinische Reich ganz im Osten?«
»Ihren obersten Herrscher nennen sie Kalif. Er ist sowohl ihr weltlicher als auch geistlicher Führer und versteht sich als Nachfolger des Propheten Mohammed und Stellvertreter ihres Gottes auf Erden. Dadurch verfügt er über nahezu unbegrenzte Macht.«
»So als wären der byzantinische Kaiser und der Papst in Rom in einer Person vereint?«, wollte Hatto neugierig wissen.
»Ich denke, das kann man nicht miteinander vergleichen. Keiner von beiden verfügt auch nur annähernd über die Machtfülle des Kalifen, nicht einmal vereint. Dieser Kalif residiert im fernen Damaskus. Wie weit es bis dahin ist, entzieht sich meiner Kenntnis, aber es muss nahe am Ende der Welt sein. Und doch reicht sein Arm bis nach al-Andalus. Die beiden Feldherren, die mit ihren Heeren die Visigoten geschlagen und die ganze Iberische Halbinsel unterworfen haben, taten das angeblich ohne seinen ausdrücklichen Befehl. Er selbst belagert nämlich gerade Konstantinopel und braucht dafür jeden Mann. Doch anstatt ihm Krieger zu schicken, hat der Statthalter von Ifrīqiya seinen Truppenführer Tāriq ibn Ziyād beauftragt, über die Meerenge bei den Säulen des Herkules zu setzen und die Visigoten anzugreifen. Etwas später ist er diesem dann gefolgt, und gemeinsam sind sie bis zu den südlichen Pyrenäen vorgestoßen. Aber weil sie eigenständig und ohne Order aus Damaskus gehandelt haben, hat der Kalif die Kommandeure zu sich beordert. Obwohl sie so viel Land für sein Reich erobert haben, fielen sie in Ungnade und wurden ihrer Ämter enthoben.«
Während Hatto ungläubig den Kopf schüttelte, hakte Eudo nach.
»Sag das noch mal! Diese Muslime greifen das mächtige Oströmische Reich mit seiner gewaltigen Hauptstadt Konstantinopel an, über die man wahre Wunderdinge hört? Ich kann das nicht glauben! Bist du dir da auch wirklich ganz sicher?«
»Wenn ich es dir doch sage! In al-Andalus spricht man von fast nichts anderem. Seit Monaten berennen die Anhänger dieser neuen Religion die Mauern der mächtigsten Stadt der Christenheit, nachdem sie zuvor viele der bis dahin von den Byzantinern beherrschten Länder unterworfen haben. Das ganze Mittelmeer soll sich mittlerweile nahezu vollständig in der Hand der Araber befinden, die auch gelernt haben, die See zu bezwingen.«
Eudo ließ sich aufseufzend in einen Armstuhl fallen.
»Dann sind sie die wahren Nachfahren der Römer, denn auch diese beherrschten alle Länder diesseits und jenseits des Meeres, das sie mare nostrum nannten. Die Muslime werden wohl nicht eher ruhen, bis sie ebenfalls über ein solch großes Reich gebieten und jeden, der sich ihnen entgegenstellt, hinwegfegen. Ich sehe schwere Zeiten auf uns zukommen. Sag, hast du auch etwas über ihre weiteren Pläne in Erfahrung bringen können?«
»Offenbar hat ihr Kalif ein weiteres Vordringen in unsere Region gegenwärtig untersagt. Zumindest so lange, wie er vor Konstantinopel steht. Wir dürften also noch einige Zeit Ruhe vor ihnen haben, aber ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert, fällt das Byzantinische Reich. Der Herrscher in Damaskus hat einen neuen Statthalter für al-Andalus eingesetzt, der al-Hurr genannt wird und in Córdoba residiert. Das muss ein sehr energischer Mann sein, der mit großer Härte Steuern eintreibt und das Geld an seinen Herrscher schickt, damit dieser seinen Krieg finanzieren kann. Wer nicht zahlt, wird gefoltert. Selbst die eigenen Leute verschont der Statthalter nicht. Ich habe auf einem Marktplatz gesehen, wie ein Berberfürst, der seine Beute nicht abgeliefert hat, in einen Sack voller Maden, Würmer und Ratten gesteckt wurde. Es dauerte keine Stunde, und er hat alles gestanden, was man von ihm hören wollte.«
»Das kann ich mir gut vorstellen«, lachte Eudo in sich hinein. »Die Methode sollte man sich vielleicht merken. Aber du hast doch noch von einem anderen Landstrich als dem des Grafen Teodomiro gesprochen, der sich nicht unterworfen hat und in dem die Menschen Widerstand leisten. Wo liegt denn diese Region, und glaubst du, dass die Bewohner sich dort auf die Dauer den Eroberern widersetzen können?«
»Ja, jetzt wird es richtig interessant. Das Gebiet grenzt nämlich unmittelbar an unser Herzogtum Vasconien. Es liegt westlich auf der anderen Seite der Pyrenäen in den ebenfalls schwer zugänglichen Kantabrischen Bergen. Der Schwertträger König Roderichs konnte nach der vernichtenden Schlacht am Río Guadalete entkommen und hat sich in seine Heimat im Norden der Halbinsel, nach Asturien, zurückgezogen. Zuerst musste er sich wie alle Visigoten mit den Eroberern arrangieren, aber als der Druck immer stärker wurde und seine eigene Schwester auf Wunsch des Statthalters mit einem Berber verheiratet werden sollte, begann er Widerstand zu leisten. Mit ein paar Getreuen zog er sich in die unwirtlichen Berge zurück und fing zuerst im Kleinen an, die Eindringlinge zu piesacken. Ein Überfall hier, danach ein schneller Rückzug und erneut ein Angriff, wo man mit keinem rechnete. Daraufhin bekam er großen Zulauf von seinen Landsleuten, und seine Anhänger haben ihn sogar zum König ausgerufen.«
»König einer kleinen, unwirtlichen Berggegend? Und ich als Herrscher über das große, reiche Aquitanien darf mich nur Herzog nennen?«, entrüstete sich Eudo. »Wie heißt der Mann?«
»Pelayo. Ich habe es nicht gewagt, ihn aufzusuchen, denn der Weg dorthin aus al-Andalus heraus wäre für mich zu gefährlich gewesen. Aber ich denke, wir sollten uns mit ihm in Verbindung setzen. Vielleicht kann man ihn als Verbündeten gewinnen, sollten die Mauren mit geballter Macht über die Pyrenäen kommen. Fällt er ihnen dann in den Rücken, haben sie kein so leichtes Spiel, wie sie es sich vielleicht vorstellen. Bis dahin könnten wir ihn mit Waffen versorgen, an denen es ihm bestimmt mangelt, um ihn für uns zu gewinnen.«
»Hunold, ich habe das vielleicht noch nie gesagt, aber ich bin stolz auf dich. Du denkst bereits strategisch und in genauso großen Zusammenhängen wie ein Herrscher. Ich habe wahrlich Hoffnung, dass du einmal ein würdiger Nachfolger werden wirst. Dein Vorschlag ist so gut, er könnte glatt von mir sein!«
Während Hunold sich im Lob seines Vaters sonnte, bemühte sich Hatto darum, dass man ihm seine Eifersucht nicht allzu deutlich ansah. Schließlich war er durch Neustrien und Austrien geritten, um die dortige Lage zu sondieren, was ebenfalls mit großen Gefahren verbunden gewesen war, denn auch in den beiden fränkischen Reichsteilen herrschte Krieg, wenn auch derzeit kein offener. Die Auseinandersetzungen beschränkten sich eher auf Scharmützel, aber auch wer dabei zwischen die Fronten geriet, hatte nichts zu lachen und konnte schnell sein Leben verlieren. Allerdings war Hatto in Begleitung einer bewaffneten Eskorte unterwegs gewesen, denn er hatte die Sondierungen gleichzeitig dazu genutzt, die jährlichen Tributzahlungen an die Höfe der fränkischen Hausmeier zu überbringen. Beide erhoben Anspruch darauf, denn sie regierten als selbstständige Herrscher anstelle des unbedeutenden Merowinger-Königs Chilperich und nahmen nur vorgeblich dessen Interessen wahr. Darin unterschied sich Raganfrid nicht von seinem Gegenspieler Karl, und Hatto wusste von seinem Vater, dass dieser fest davon ausging, dass es bald zur Entscheidungsschlacht zwischen den beiden kommen würde.
Eudo überlegte ständig hin und her, auf welche Seite er sich dabei schlagen sollte. Er hoffte, nun von seinem jüngeren Sohn wichtige Informationen zu erhalten, die ihm die Entscheidung erleichterten. Am liebsten wäre es ihm allerdings, könnte er sich aus dem Konflikt gänzlich heraushalten und letztlich der lachende Dritte sein. Doch die Abgesandten beider fränkischen Herrscher warteten bereits auf eine Audienz, und so würde er sich wohl oder übel schweren Herzens für eine Seite entscheiden müssen, wollte er nicht später vom Sieger für seine Wankelmütigkeit zur Verantwortung gezogen werden. Die Frankenherrscher, keineswegs zimperlich, waren nicht gerade dafür bekannt, übermäßig Gnade mit ihren besiegten Feinden walten zu lassen, und konnten furchtbare Rache nehmen. Darin unterschieden sie sich wohl nicht wesentlich von den Mauren im Süden, wie Hunold gerade berichtet hatte. Der Herzog hoffte nur, dass er mit seiner Einschätzung, was die Macht und Stärke Raganfrids im bevorstehenden Kampf mit seinem Konkurrenten Karl um die Vorherrschaft im Frankenreich betraf, nicht falschlag, denn das konnte seinen eigenen Untergang und den seines ganzen Geschlechts nach sich ziehen.
Eudo schaute zu seinem jüngeren Sohn hinüber, der im Gegensatz zu dem zwei Jahre älteren Hunold eher unbedacht und spontan war und zum Leidwesen seines Vaters auch oft so handelte. Aber nichtsdestotrotz hatte er ihm die verantwortungsvolle Aufgabe anvertraut, sich ein Bild von der Lage im Norden zu machen, denn so richtig vertraute der Herzog nur seiner engsten Familie.
Schmerzlich vermisste er seine Frau, die vor fünf Jahren verschieden war und mit der er in der Abgeschiedenheit seines Schlafgemaches so manch langes und erbauliches Gespräch geführt hatte. Ihrer beider Tochter Lampegia bemühte sich zwar, in die großen Fußstapfen ihrer Mutter zu treten, was für die Sechzehnjährige trotz all ihres Bemühens selbstredend völlig unmöglich war. Doch Eudo liebte das Mädchen – auch, aber nicht nur, weil es das Abbild seiner verstorbenen Frau war – abgöttisch und konnte sich gar nicht vorstellen, dass es einmal heiraten und ihn verlassen würde. Solange sich dies vermeiden ließe, wollte er es auch verhindern, wobei er in seinem Innersten wusste, dass der Tag wohl bald kommen würde. Andere junge Frauen in ihrem Alter waren schon längst den Bund der Ehe eingegangen und hatten bereits Kinder. Nun, er würde sicher mit Gottes, Teutates’ oder auch Venus’ Hilfe – ganz konnte sich Eudo in Gedanken noch immer nicht von den Göttern seiner gallo-römischen Vorfahren trennen, auch wenn er wie die meisten Aquitanier mittlerweile getauft war – eine gute Partie für Lampegia finden. Eudo hoffte nur, dass ein zukünftiger Gemahl seinem Augenstern auch die Liebe entgegenbringen würde, die sie nach seinem Dafürhalten verdiente. Für Hatto, der von keiner Magd die Finger lassen konnte, musste gleichfalls baldmöglichst eine passende Frau her, während Hunold mit Adela, der Tochter Totilos, einem vasconischen Grafen, glücklich verheiratet und allnächtens bestrebt war, für Nachwuchs zu sorgen. Eudo wollte gar nicht daran denken, womöglich bald Großvater genannt zu werden, und strich sich nachdenklich durch sein noch dichtes schwarzes Haar, in dem sich erst wenige graue Strähnen zeigten.
»Nun, Hatto, jetzt bist du an der Reihe. Erzähle uns, was du im Frankenland in Erfahrung bringen konntest. Bringst du auch Nachrichten von meinem Bruder? Als Bischof von Lüttich müsste er ja am besten über das Bescheid wissen, was rings um ihn vor sich geht.«
Eudos Bruder Hubertus war von ihrem gemeinsamen Vater Bertrand an den Hof des Merowinger-Königs Theuderich III., der damals zumindest nominell noch über das gesamte Frankenreich herrschte, entsandt worden. Der mächtige Hausmeier Pippin, Vater von Karl, hatte sich des Jünglings damals angenommen und ihn mit hohen Ämtern bedacht. Doch bei einem Jagdausflug in den Ardennen war Hubertus angeblich ein Hirsch mit einem goldenen Kreuz zwischen den Geweihstangen erschienen und hatte ihn zu einem gottgefälligen Leben ermahnt. Daraufhin hatte er eine Zeit lang als Einsiedler gelebt, war dann nach Rom gepilgert und dort von Papst Konstantin zum Bischof von Lüttich ernannt worden, was Pippin später bestätigte. Eudo glaubte von der Geschichte mit dem Hirsch zwar kein Wort, kannte er doch seinen träumerischen und spirituell veranlagten Bruder, aber das hinderte ihn nicht daran, zu Hubertus guten Kontakt zu halten, um durch ihn zu erfahren, was im Fränkischen Reich vor sich ging.
»Sprich, Hatto, ich werde dir ebenso aufmerksam lauschen wie Hunold«, forderte Eudo wohlwollend seinen Jüngsten dazu auf, ihm Bericht zu erstatten.
Der Angesprochene holte tief Luft und wollte gerade mit seinem Vortrag beginnen, als seine Schwester in die Halle hereingestürmt kam, der noch gerade eben die Gedanken seines Vaters gegolten hatten.
Lampegia hatte das kupferrote Haar, das sich nur schwer bändigen ließ, und auch die blauen Augen ihrer Mutter geerbt, die jetzt zornig blitzten. Ohne sich lange mit Vorreden aufzuhalten, fiel sie mit Vorwürfen über die versammelte Männerrunde her.
»Da sitzt ihr zusammen und schwätzt, als gebe es nichts Wichtigeres zu tun. Könnte mir vielleicht einer von euch sagen, wo ich das Gefolge der geladenen Gäste unterbringen und vor allem wie ich es verköstigen soll? Ich habe doch nie im Leben mit solch einer Invasion gerechnet! In der Küche droht ein Aufstand, und ihr sitzt hier gemütlich beim Wein!«
Anklagend zeigte Lampegia auf die halb geleerten Becher. Nur mühsam konnte sich ihr Vater angesichts ihres Wutausbruchs ein herzhaftes Lachen verkneifen und es in ein wohlwollendes Lächeln umwandeln.
»Du solltest doch langsam wissen, dass hohe Herrschaften niemals ohne Begleitung eintreffen, mein Mädchen.« Für Eudo würde Lampegia zeitlebens das kleine Kind bleiben, das er in seinen Armen gewiegt hatte und das auf seinen Knien geritten war. »Hast du das denn nicht bedacht? Du sagtest mir, dass die Vorbereitungen für das Fest bei dir in guten Händen wären, und ich habe mich auf dich verlassen. Hätte ich das vielleicht besser nicht tun sollen?«
»Es konnte doch niemand ahnen, mit welcher Streitmacht die Langobarden und Bretonen anrücken«, versuchte sich die junge Frau zu verteidigen. »Von deinem Schwiegervater ganz zu schweigen, Hunold. Der will wohl sein ganzes Volk von uns verköstigen lassen! Ich kann mir kaum vorstellen, dass es derzeit noch Basken in der Gascogne gibt. Die sind jetzt wohl alle hier, und wie die sich aufführen! Unsere Vorfahren hatten schon recht damit, sie als Barbaren zu bezeichnen.«
»Lampegia, wie redest du von unseren Verbündeten?« Eudo gelang es einfach nicht, seine Stimme streng klingen zu lassen, wenn er mit seiner Tochter sprach. »Aber Hunold, da wir soweit alles besprochen haben, geh und hilf deiner Schwester dabei, für Ordnung zu sorgen. Ansonsten sind alle Mägde womöglich auf einmal geschwängert und niemand mehr da, der in ein paar Monaten noch die anfallenden Arbeiten verrichten kann. Aber pass auf, die Stammesfürsten nicht zu verärgern. Wir werden vielleicht in nächster Zeit mehr auf ihre Unterstützung angewiesen sein, als uns lieb ist.«
Seufzend stemmte sich Hunold aus seinem Lehnstuhl hoch, um dem Befehl seines Vaters Folge zu leisten. Denn nichts anderes war die wenn auch ruhig vorgetragene Aufforderung gewesen. Aber Lampegia war noch nicht fertig und wandte sich erneut an Eudo, und das weit weniger respektvoll als zuvor ihre Brüder.
»Mit dem Fleisch werden wir dank der erfolgreichen Jagd der letzten Tage auskommen, aber nie im Leben mit dem Brot. Wir schaffen es auch nicht, noch mehr zu backen. Kann ich daher in die Stadt schicken und welches aus den dortigen Backstuben holen lassen? Denn mit Hafergrütze werden sich diese raubeinigen Kerle sicher nicht zufriedengeben.«
»Tu, was immer du für nötig erachtest, mein Kind. So hat es deine Mutter auch gehalten, und da du jetzt unserem Hausstand vorstehst, hast du all ihre diesbezüglichen Rechte, aber auch Pflichten übernommen. Und bitte, zieh heute Abend dein schönstes Kleid an und erscheine mir um Himmels willen nicht in einem abgetragenen Kittel oder gar in fränkischen Hosen! Dir muss ich das zu meinem Leidwesen sagen, denn beides würde ich dir zutrauen.«
Eudos Sorge war nicht ganz unbegründet, denn seine Tochter war ein bisher kaum gezähmter Wildfang, der lieber mit den Pferdeknechten um die Wette ritt, statt sich gesitteten fraulicheren Tätigkeiten zu widmen. Ihr Versuch, ein Altartuch für die Basilika Saint-Michel, die größte Kirche und Sitz des Bischofs von Bordeaux, zu besticken, war kläglich gescheitert und nie wiederaufgenommen worden. Dafür kannte sich Lampegia mit den Rössern fast so gut aus wie der Stallmeister, und Eudo glaubte oft, eher einen dritten Sohn zu haben als eine Tochter.
»Wenn ich es bei all der Arbeit noch schaffe, mich umzuziehen …« Lampegia ließ die letzten Worte schnippisch im Raum stehen und war dann – ihren großen Bruder im Schlepptau – genauso schnell wieder verschwunden, wie sie zuvor aufgetaucht war.
»Du solltest ihr nicht alles nachsehen, Vater«, meldete sich Hatto zu Wort, als er mit Eudo allein war. »Jeder ernst zu nehmende Bewerber um ihre Hand nimmt schleunigst Reißaus, wenn er sie einmal so sieht und erlebt.«
»Sag du mir nicht, wie ich deine Schwester erziehen soll! Sie ist so, wie sie ist, genau richtig! Erzähl mir lieber, was du in Austrien und Neustrien erfahren hast. Stimmt es tatsächlich, dass die beiden Reiche kurz vor einem Bürgerkrieg stehen? Und wenn ja, auf welche Seite sollen wir uns schlagen? Was meinst du? Ich will ganz offen deine Meinung hören.«
»Das ist schwer zu sagen, und ich wünschte, ich könnte dir eine eindeutige Antwort auf deine Fragen geben, Vater. Aber so sehr ich mich auch bemüht und die Schwächen und Stärken beider Regenten gegeneinander abgewogen habe, erscheinen sie mir nahezu gleich stark. Selbst Onkel Hubertus weiß diesbezüglich keinen Rat und schwankt in seiner Treue zwischen beiden Hausmeiern hin und her. Auch er ist davon überzeugt, dass es über kurz oder lang zu einer Entscheidungsschlacht zwischen ihnen kommen wird. Zweimal konnte Karl die Neustrier schon bezwingen, aber es waren wohl nur kleinere Scharmützel und keine großen Gefechte. Auch aus der Schlacht von Vincy, einer, wie ich von Onkel Hubertus hörte, größeren Auseinandersetzung, ging keiner als endgültiger Sieger hervor. Raganfrid hat sich mit seinem König Chilperich nach Paris, Karl nach Köln zurückgezogen. Es heißt, er sucht händeringend nach einem Abkömmling der Merowinger, den er zum König proklamieren kann, um seinen Machtanspruch gleich Raganfrid zu legitimieren. Solange er das nicht kann, ist das Recht aufseiten der Neustrier, und Karls Anhänger laufen in Teilen zu diesen über.«
»Das Recht ist immer auf der Seite der Stärkeren, mein Sohn. Das solltest du in deinem Alter eigentlich wissen. Was ist denn das für ein Mann, dieser Karl? Beschreibe ihn mir einmal.«
»Nun, er ist groß und stattlich. Nach außen hin wirkt er meist schroff, kann aber auch freundlich und gewinnend sein, wenn er es für nötig erachtet. Außerdem tritt er sehr selbstbewusst auf und scheint von sich und seiner Mission überzeugt zu sein. Das muss er wohl auch, denn sonst wäre er nie bis zum Hausmeier aufgestiegen. Dieser Weg war ihm jedenfalls nicht vorbestimmt, obwohl sein Vater Pippin einst als Hausmeier noch ganz allein über die drei fränkischen Teilreiche Austrien, Neustrien und Burgund herrschte. Seine Stiefmutter Plektrud hatte ihn nach dem Tod ihrer eigenen Söhne und seines Vaters lange Zeit einsperren lassen, weil sie selbst die Nachfolge ihres Gemahls antreten wollte. Als Frau, das muss man sich einmal vorstellen! Aber Karl konnte fliehen, sammelte ein Heer, musste eine Niederlage gegen die Friesen hinnehmen, die seine Stiefmutter zu Hilfe gerufen hatte, siegte aber, wie gesagt, etwas später über die Neustrier. Dann hat er Köln eingenommen. Dorthin hatte sich Plektrud mit einem Teil des Merowinger-Schatzes zurückgezogen. Der ist nun ebenfalls Karl in die Hände gefallen. Aber Raganfrid nagt auch nicht gerade am Hungertuch. Die Ländereien, über die er im Namen des Merowinger-Königs Chilperich herrscht, sind wesentlich reicher als die Stammesgebiete der germanischen Stämme, die zu Karl stehen. Du siehst, es ist eine vertrackte Angelegenheit.«
»Da hast du zweifelsohne recht, aber das hilft mir auch nicht viel weiter«, knurrte Eudo ungnädig. Hatto hingegen zuckte nur mit den Schultern.
»Was willst du, Vater? Dass ich dich belüge? Sieh es doch einmal so: Zwischen uns und Austrien, über das Karl herrscht, liegen Neustrien und Burgund. Durch diese Länder müsste er sich erst einmal durchkämpfen, will er bis zu uns vordringen. Stellen wir uns aber auf seine Seite, dann könnte Raganfrid ganz schnell in Aquitanien einmarschieren, denn er steht schließlich an unseren Grenzen. Zugegeben, es ist fraglich, ob er das tut, denn dann hätte er Karl im Nacken. Aber ganz auszuschließen ist es auch nicht.«
»Hat Raganfrid womöglich derartige Andeutungen gemacht?«
»Im Gegenteil! Als ich ihm in Paris den Tribut überreichte, meinte er beinahe beiläufig, dass das vielleicht bald nicht mehr nötig wäre, denn wahre Treue wüsste er zu belohnen, und wonach der Herzog von Aquitanien strebe, sei ihm durchaus bewusst.«
Eudo setzte sich mit einem Ruck auf.
»Das hat er gesagt? Wörtlich?«
»Ich kann es beschwören.«
»Das heißt, wenn wir uns auf seine Seite stellen, gewährt er uns die Unabhängigkeit vom Fränkischen Reich?«
»Nun, so weit ist er mit seiner Aussage mir gegenüber nicht gegangen. Aber vielleicht überbringt sein Bote eine entsprechende Nachricht oder ein diesbezügliches Angebot.«
Eudo rieb sich grinsend die Hände. Das klang ja viel besser, als er gehofft hatte. Sollten seine kühnen Träume wirklich wahr werden und er es noch erleben, dass sein geliebtes Aquitanien, wie bereits in alten Zeiten unter Charibert geschehen, erneut zum Königreich aufstieg? Dafür lohnte es sich, ein Risiko einzugehen, und Eudo war schon beinahe davon überzeugt, an der Seite Raganfrids gegen Karl anzutreten. Den neustrischen Hausmeier, seinen direkten Nachbarn, kannte er schließlich. Zugegeben, auch dessen Verschlagenheit. Karl aber hatte er noch nie getroffen. Er wusste kaum etwas über ihn und konnte ihn auch nicht einschätzen. Doch Voraussetzung dafür war natürlich, der Neustrier machte wahr, was er angedeutet hatte.
»Hattest du den Eindruck, dass Raganfrid durch die beiden Niederlagen sehr geschwächt ist? Wirkte er niedergeschlagen, und hast du Chilperich gesehen und sprechen können?«
»Letzteres leider nicht. Der Titularkönig ist von Raganfrid in die Pfalz von Compiègne verbannt worden. Wie es aussieht, will er die lächerliche Gestalt nicht ständig um sich haben und holt sie nur zu bestimmten zeremoniellen Anlässen hervor. Chilperich lebte unter dem Namen Bruder Daniel bis vergangenes Jahr ja noch im Kloster und soll, nach allem, was man so hört, wahrlich kein Herrscher sein. Falls Karl tatsächlich noch jemanden aus dem Clan der Merowinger auftreibt und zum König proklamiert, könnte es jedoch interessant werden.«
»Das braucht uns nicht zu kümmern, diese Könige sind sowieso nur Staffage. Aber ich bin mit dir sehr zufrieden, mein Sohn. Genau wie dein Bruder hast du mir wichtige Informationen von deiner Reise mitgebracht, dafür danke ich dir. Jetzt weiß ich, wie ich die beiden Abgesandten der Franken anzupacken habe.«
»Noch eins, Vater. Vertraue Karls angeblichem Unterhändler Rigobert nicht zu sehr. Er behauptet, der Bischof von Reims zu sein und im Namen seines Herrn zu sprechen. In Wahrheit ist er aber – so hat es mir Onkel Hubertus in Lüttich berichtet – von Karl abgesetzt und in die Gascogne verbannt worden. Ich denke, er gibt nur vor, ein Abgesandter des Austriers zu sein, um bei Erfolg dessen Gunst wiederzuerlangen. Ganz durchschaubar ist sein Spiel jedenfalls nicht, und auch auf mich wirkt er arglistig und durchtrieben.«
»Das war ein wertvoller Hinweis, Hatto, für den ich dir dankbar sein muss. Doch wie ich Rigobert anzupacken habe, das lass meine Sorge sein. Nun geh, hilf deinen Geschwistern, unsere Gäste zu empfangen und das Festmahl vorzubereiten. Ihr müsst mich vertreten, denn ich will noch in aller Ruhe über das Gehörte nachdenken. Lass mich deshalb jetzt allein, ich bitte dich.«
Auch für Hatto war der Wunsch seines Vaters Befehl. Er erhob und verabschiedete sich mit einer leichten Verbeugung. Eudo bekam es gar nicht mehr mit, so sehr war er bereits in Gedanken versunken.
Wenn der Herzog von Aquitanien einlud, auch wenn es nur zu einer Besprechung über mögliche Bündnisse war und kein so freudiger Anlass wie eine Hochzeit, gab es keinen, der diese Offerte ausschlug. Eudo unterhielt intensive Beziehungen zu allen Nachbarreichen und tauschte selbst mit Papst Gregor II. in Rom Botschaften aus. Das Christentum stellte zwar keinen bedeutenden Machtfaktor dar und war auf das Wohlwollen sowohl des byzantinischen Kaisers als auch des Langobarden-Königs Liutprand angewiesen, der weite Teile Italiens beherrschte. Aber schließlich konnte man nie wissen, wie sich die Dinge entwickelten, und mit dem Christengott oder auch den früheren heidnischen Göttern hatten sich schon Eudos Vorfahren stets gutgestellt. Der Herzog gedachte, es ihnen gleichzutun und besser keinen der Himmelsherrscher übermäßig zu bevorzugen, auch wenn er bereits als Kind getauft worden war. Aber die alten gallischen und römischen Götter waren ihm traditionell immer noch nahe. So richtig glaubte er allerdings keinem der Priester der verschiedenen Religionen und Kulte und hielt ihre Predigten und Erzählungen eher für nette, unterhaltsame Geschichten denn für bare Münze. Das hatte ihn sein Vater gelehrt, und der war in Eudos Augen ein sehr weiser Mann gewesen.
Während des Festmahls in der großen Halle des Palastes des verblichenen römischen Konsuls – irgendwann einmal hatte eine weise Frau Eudo sogar einzureden versucht, dass er von ihm abstammte – beobachtete der Herzog aufmerksam seine geladenen Gäste. Er sah, wie sich Burgunder und Langobarden giftige Blicke zuwarfen. Kein Wunder, kam es doch zwischen ihnen immer wieder zu Grenzstreitigkeiten. Der Abgesandte Raganfrids würdigte Rigobert von Reims keines Blickes, und die Vertreter der Bretagne – auf der kleinen Halbinsel herrschten dem Namen nach gleich vier Könige – gönnten sich untereinander nicht einmal die Brotfladen, auf denen sie ihr Fleisch zwischenlagerten, bevor sie es sich in die hungrigen Mäuler stopften. Eudo seufzte innerlich. Wie er es schaffen sollte, aus diesem zerstrittenen Haufen eine Allianz zu schmieden, mit der man gemeinsam alle Angriffe, ob von Süden oder Norden her, abwehren und seine Unabhängigkeit beibehalten konnte, war ihm ein Rätsel. Aber irgendwie musste es gelingen, wollten sie nicht allesamt zwischen den Franken und den Mauren zerrieben werden wie Korn zwischen den Mahlsteinen.
In den nächsten Tagen, so hatte es Eudo geplant, wollte er mit allen Abgesandten einzeln sprechen und sie danach reich beschenkt wieder nach Hause schicken. Bis dahin galt es, sie bei Laune zu halten, und wie ginge das besser als mit köstlichem Wildbret und aquitanischem Wein. Schon der Konsul und Dichter Ausone war den leiblichen Genüssen nicht abgeneigt gewesen und hatte unweit von Bordeaux wie die meisten adeligen Römer ein großes Landgut unterhalten, das bereits von Eudos Vater für die Familie vereinnahmt worden war und von dem der edle Rebensaft stammte, der nun in Strömen floss.
Zu Eudos Rechter saß Hatto, zu seiner Linken Lampegia, die es tatsächlich geschafft hatte, sich zu waschen, ihr Haar zu flechten und hochzustecken sowie sich ein Kleid überzuwerfen. Ihr Vater staunte immer wieder, zu was für einer atemberaubenden Schönheit sein kleines Mädchen herangewachsen war und mit welcher Selbstverständlichkeit und ohne jede Geziertheit sie ihre Aufgaben wahrnahm und die Familie zu repräsentieren gelernt hatte. Der Mann, der sie einmal heimführte, konnte sich überaus glücklich schätzen, würde aber auch keinen leichten Stand haben, sollte er womöglich über sie bestimmen wollen.
Hunold hatte sich mit seiner Gemahlin zu seinem Schwiegervater gesellt und war in eine heftige Diskussion mit ihm verstrickt. Die Vasconen, auch Basken genannt, die größte Volksgruppe im Herzogtum Gascogne, das wiederum zu Aquitanien gehörte, hatten lange Jahre gegen die Visigoten um ihre Unabhängigkeit gekämpft. Nach deren vernichtender Niederlage gegen die Mauren sahen sie sich kurzzeitig schon am Ziel ihrer Träume, nur um bald darauf einem noch weit mächtigeren und unbarmherzigeren Feind gegenüberzustehen. Immer wieder drangen maurische Streifscharen in ihr Gebiet vor, brannten Dörfer nieder, töteten die Männer, verschleppten die Frauen und Kinder und trieben die Viehherden weg. Das musste ein Ende haben, und Graf Totilo war nicht zuletzt hier, um Eudo um militärische Unterstützung zu bitten. Zwar oblag die Grenzsicherung eigentlich dem vasconischen Grafen, doch hatte er zu wenige Bewaffnete, um dieser Aufgabe erfolgreich nachkommen zu können. Außerdem wusste niemand, wo die Mauren als Nächstes zuschlagen würden, und an allen Stellen zugleich konnte der Graf nun einmal nicht sein.
Eudo ließ seine Blicke durch die Halle schweifen, nickte dort einem Abgesandten zu, hob seinen Pokal einem anderen zum Gruße, und hatte für alle, die an seiner Tafel Platz genommen hatten, ein freundliches Wort. Doch dabei dachte er eigentlich immer nur an eins: Welchem Fürsten würde er über kurz oder lang seine Tochter zur Frau geben, welche Allianz ließe sich dadurch schmieden, und könnte er seine politischen Interessen wirklich mit dem Glück seiner Tochter in Einklang bringen? Denn dies war ihm keineswegs gleichgültig wie so vielen anderen Vätern, außerdem hatte er es seiner Frau auf deren Sterbebett versprechen müssen. Aber so sehr er auch grübelte, fiel ihm in dieser Runde keiner ein, der ihm wirklich nützlich wäre und dem er Lampegia hätte anvertrauen wollen.