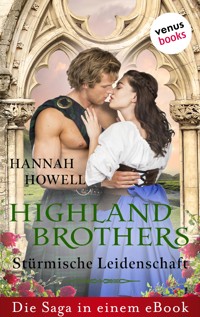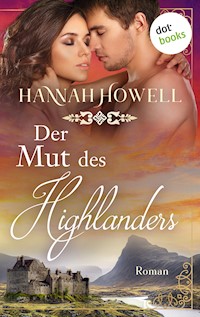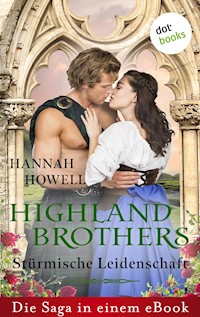1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: venusbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Highland Dreams
- Sprache: Deutsch
Eine gefährliche Liebe in Schottland: Der historische Liebesroman »Das Begehren des Highlanders« von Hannah Howell jetzt als eBook bei venusbooks. Schottland im Jahr 1480. Eine Frau heiraten, die er noch nie gesehen hat? Undenkbar für den Highland-Lord Artan Murray – bis zu dem Tag, als er den letzten Wunsch eines entfernten Verwandten nicht ausschlagen darf. Also bricht Artan auf, um dessen Nichte Cecily kennenzulernen … und erlebt eine Überraschung: Die wilde Schönheit und er sind zwar wie Feuer und Wasser, doch sie erobert trotzdem schon bei der ersten Begegnung sein Herz! Noch dazu schwebt Cecily in größter Gefahr, denn ein ruchloser Lord hat es auf ihr Erbe abgesehen. Artan gelingt es im letzten Moment, Cecily zu befreien. Während der dramatischen Flucht kommen sie sich immer näher – aber können zwei Menschen, die so unterschiedlich sind, wirklich glücklich werden? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das Romance-Highlight »Das Begehren des Highlanders« von New-York-Times-Bestsellerautorin Hannah Howell ist der Auftakt zur romantischen Saga »Highland Dreams«. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch:
Schottland im Jahr 1480. Eine Frau heiraten, die er noch nie gesehen hat? Undenkbar für den Highland-Lord Artan Murray – bis zu dem Tag, als er den letzten Wunsch eines entfernten Verwandten nicht ausschlagen darf. Also bricht Artan auf, um dessen Nichte Cecily kennenzulernen … und erlebt eine Überraschung: Die wilde Schönheit und er sind zwar wie Feuer und Wasser, doch sie erobert trotzdem schon bei der ersten Begegnung sein Herz! Noch dazu schwebt Cecily in größter Gefahr, denn ein ruchloser Lord hat es auf ihr Erbe abgesehen. Artan gelingt es im letzten Moment, Cecily zu befreien. Während der dramatischen Flucht kommen sie sich immer näher – aber können zwei Menschen, die so unterschiedlich sind, wirklich glücklich werden?
Über die Autorin:
Hannah Howell, geboren 1950 in Massachusetts, kann ihren amerikanischen Familienstammbaum bis in das frühe 17. Jahrhundert zurückverfolgen – liebt aber vor allem die Geschichte Englands und Schottlands; auf einer Reise dorthin lernte sie auch ihren späteren Ehemann kennen. Hannah Howell hat in ihrer schriftstellerischen Karriere über 60 Liebesromane veröffentlicht, darunter den großangelegten Zyklus über die Familie Murray, in dem sie mitreißend vom Schicksal mehrerer Generationen einer weitverzweigten schottischen Highlander-Dynastie erzählt. Hannah Howell wurde für ihr Werk mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Golden Leaf Award und dem Preis des Romantic Times Bookclub Magazine.
Bei venusbooks erschienen die folgenden Romane von Hannah Howell:
HIGHLAND HEROES: Das Schicksal des Highlanders; Die Lust des Highlanders; Das Schwert des Highlanders
HIGHLAND ROSES: Die Spur des Highlanders; Die Sehnsucht des Highlanders
HIGHLAND LOVERS: Der Fürst der Highlander; Der ungezähmte Highlander; Der Held der Highlands
HIGHLAND DREAMS: Das Begehren des Highlanders; Der Stolz des Highlanders; Die Versuchung des Highlanders
Der Kuss des Schotten
Das Herz des Highlanders
***
eBook-Neuausgabe Februar 2020
Ein eBook des venusbooks Verlags. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Die amerikanische Originalausgabe dieses Romans erschien 2006 unter dem Titel »Highland Barbarian« bei Zebra Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2012 unter dem Titel »Der Barbar aus den Highlands« bei Weltbild.
Copyright © der Originalausgabe 2006 by Hannah Howell
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 2012 by Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Lizenzausgabe 2020 venusbooks GmbH, München
Copyright © der aktuellen eBook-Neuausgabe 2020 venusbooks Verlag. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von shutterstock/Oilyy, Double Bind Photography, Yellowj, Mariabo2015
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-95885-733-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des venusbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Begehren des Highlanders« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.venusbooks.de
www.facebook.com/venusbooks
www.instagram.com/venusbooks
Hannah Howell
Das Begehren des Highlanders
Roman
Aus dem Englischen von Angela Schumitz
venusbooks
Kapitel 1
Schottland, Sommer 1480
»Du siehst nicht wie ein Toter aus, auch wenn du vielleicht versuchst, wie einer zu riechen.«
Angus MacReith starrte den jungen Mann, der sich vor seinem Bett aufgebaut hatte, finster an. Artan Murray war groß, stattlich und attraktiv. Artans Vater hat seine Sache gut gemacht, dachte Angus. Weit besser als all seine näheren Verwandten, die keine Kinder hatten oder nur solche wie den jungen Malcolm, den sie ihm ins Haus geschickt hatten. Angus’ Blick verfinsterte sich weiter, als er an diesen Burschen dachte – der Kerl war feige, habgierig und unzuverlässig. Doch in Artans Venen floss ebenfalls das Blut der MacReiths, und bei ihm zeigte sich das auch, genau wie bei seinem Zwillingsbruder Lucas. Erst in diesem Moment ging Angus auf, dass Artan allein an seinem Bett stand.
»Wo steckt der andere?«, fragte er.
»Lucas hat sich das Bein gebrochen«, erwiderte Artan.
»Schlimm?«
»Gut möglich. Als mir dein Bote über den Weg lief, war ich gerade auf der Suche nach denjenigen, die ihm das angetan haben.«
»Weißt du denn, wer es war?«
»Ich habe eine gewisse Vorstellung, eine ziemlich klare sogar.« Artan zuckte mit den Schultern. »Ich werde sie aufstöbern.«
Angus nickte. »Da bin ich mir ganz sicher. Glaubst du, dass sie sich erst einmal verkrochen haben?«
»Aye. Aber wenn ein bisschen Zeit verstrichen ist und ich nicht gekommen bin, um mich zu rächen, werden sie sich bald sicher fühlen. Es wird mir ein großes Vergnügen sein, ihnen zu zeigen, wie sehr sie sich irren.«
»Du bist ziemlich gemein, Artan«, meinte Angus bewundernd.
»Danke.« Artan lehnte sich an den Bettpfosten. »Ich glaube nicht, dass du im Sterben liegst, Angus.«
»Es geht mir nicht gut.«
»Das mag schon sein, aber im Sterben liegst du nicht.«
»Was weißt du schon davon?«, grummelte Angus und rappelte sich so weit auf, dass er sich auf die Kissen fallen lassen konnte, die Artan ihm rasch hinter den Rücken gestopft hatte.
»Du weißt doch, dass ich ein Murray bin. Ich bin fast mein ganzes Leben lang von Heilerinnen umgeben gewesen. Es stimmt schon, gut geht es dir nicht, aber ich glaube nicht, dass du sterben wirst. Du musst nur ein bisschen auf dich aufpassen. Jedenfalls riechst du nicht wie jemand, der schon mit einem Fuß im Grabe steht. Du miefst zwar ziemlich, aber es ist nicht der Geruch des Todes.«
»Der Tod hat einen Geruch, noch bevor er die Seele eines Menschen erobert?«
»Aye, ich glaube schon. Aber nachdem du nicht sterben wirst, werde ich mich jetzt wieder auf die Jagd nach den Kerlen machen, die Lucas angegriffen haben.«
Er schickte sich zu gehen an, doch Angus packte ihn am Arm und hielt ihn zurück. »Nay! Du weißt sehr wohl, dass ich sterben könnte; schließlich bin ich schon sechzig. Selbst das kleinste Fieber könnte mich ins Grab bringen.«
Das stimmt natürlich, dachte Artan, während er den Mann musterte, der ihn und Lucas fast zehn Jahre lang unter seine Fittiche genommen hatte. Angus war zwar nach wie vor groß und stattlich, aber manchmal schwächt das Alter einen Körper, ohne dass man es ihm ansieht. Dass Angus mitten am Tag im Bett lag, zeigte, dass ihn etwas Ernstes plagte. Artan fragte sich, ob er sich einfach gegen die Tatsache stemmte, dass Angus alt war und bald sterben würde.
»Dann hast du mich also rufen lassen, damit ich an deinem Sterbebett wache?«, fragte er und runzelte die Stirn, weil er bezweifelte, dass Angus ihn um so etwas bitten würde.
»Nay. Du musst etwas für mich erledigen. Das Sumpffieber oder was es auch sein mag, das mich quält, hat mich dazu gebracht, einzusehen, dass meine Jahre gezählt sind, selbst wenn ich davon genese. Es ist höchste Zeit, dass ich anfange, mir Gedanken zu machen, was getan werden muss, um das Wohl von Glascreag und dem Clan zu sichern, wenn ich nicht mehr da bin.«
»Dann solltest du mit Malcolm sprechen.«
»Pah, dieser Feigling ist nichts weiter als ein Fleck auf dem Namen MacReith. Diesem hinterlistigen Hasenherz würde ich nicht einmal die Pflege meiner Hunde anvertrauen, geschweige denn meiner Ländereien und der Menschen, die hier leben. Er könnte diesen Ort keine zwei Wochen lang verteidigen. Nay, den will ich nicht als meinen Erben.«
»Soviel ich weiß, hast du keinen anderen.«
»Doch, das habe ich, auch wenn ich das bislang nicht an die große Glocke gehängt habe. Jetzt bin ich froh darum. Meine jüngste Schwester hat vor zweiundzwanzig Jahren ein Kind bekommen. Die arme Moira ist ein paar Jahre später bei der Geburt eines weiteren Kindes gestorben«, murmelte er, und die Schatten der Erinnerung verdüsterten seinen Blick.
»Und wo steckt er jetzt? Warum wurde er nicht hierhergebracht, um in das Amt des Lairds eingeführt zu werden? Warum vertreibt er den elenden Jammerlappen Malcolm nicht aus Glascreag?«
»Es ist ein Mädchen.«
Artan machte den Mund auf, um lautstark dagegen Einspruch zu erheben, dass ein Mädchen die Erbin von Glascreag sein sollte, doch dann schloss er ihn wieder. Er widerstand der Versuchung, einen Blick nach hinten zu werfen, um zu sehen, ob seine weiblichen Verwandten sich auf ihn stürzten, um ihm Verstand einzubläuen. Sie alle wären schwer gekränkt, wenn sie wüssten, welche Worte in seinem Kopf herumschwirrten. Worte wie zu schwach, zu gefühlsselig, zu vertrauensvoll; geschaffen, um Kinder zu bekommen, und nicht, um ein Heer anzuführen – dabei hätten seine Verwandten erbost mit den Zähnen geknirscht.
Aber Glascreag war nicht Donncoill. Es lag hoch oben in den Highlands und war umringt von rauen Ländereien und rauen Männern. In der Zeit, in der Angus Lucas und ihn zu sich genommen und erzogen hatte, hatten sie Viehdiebe und andere Clans bekämpft, von denen so mancher ein Auge auf Angus’ Land geworfen hatte. Glascreag erforderte ständige Wachsamkeit und einen starken Schwertarm. Die Frauen der Murrays waren stark und schlau, doch sie waren Heilerinnen, keine Kriegerinnen, auch wenn sie in Artans Augen einzigartig waren. Er bezweifelte, dass Angus’ Nichte vom selben Schlag war.
»Wenn du ein Mädchen zu deiner Erbin ernennst, Angus, wird dir jeder Mann, der je dein Land begehrt hat, die Türen eintreten.« Artan verschränkte die Arme vor der Brust und starrte Angus zornig an. »Malcolm ist ein Wiesel ohne Rückgrat, aber er ist ein Mann – mehr oder weniger. Wenn du ihn zu deinem Erben machst, werden die Männer es sich immerhin überlegen, bevor sie sich für den Kampf rüsten. Und außerdem würden deine Männer seinen Befehlen weitaus bereitwilliger folgen als denen eines Mädchens, das weißt du ganz genau.«
Angus nickte und fuhr sich mit einer vernarbten Hand durch die schwarzen Haare, die noch immer dicht und lang, doch jetzt auch von vielen weißen Strähnen durchzogen waren. »Das weiß ich, aber ich habe einen Plan.«
Artan wurde mulmig zumute. Angus’ Pläne bedeuten häufig Ärger. Auf alle Fälle bedeuteten sie harte Arbeit. Und Angus’ Augen – silberblau wie seine eigenen und jetzt versteckt unter halb gesenkten Lidern – waren ihm eine deutliche Warnung: Angus war klar, dass Artan dieser Plan nicht besonders gefallen würde.
»Ich möchte, dass du losziehst und meine Nichte nach Glascreag bringst, wohin sie gehört. Ich möchte sie noch einmal sehen, bevor ich sterbe.« Seufzend ließ sich Angus auf die Kissen fallen und schloss die Augen.
Artan knurrte abfällig über einen derart erbärmlichen Versuch, sein Mitleid zu erregen. »Warum schickst du nicht einfach einen Boten zu ihren Leuten und lässt sie herbringen?«
Angus richtete sich wieder auf und funkelte ihn zornig an. »Das habe ich getan. Ich habe dem Mädchen jahrelang geschrieben, ich habe sogar darum gebeten, dass man sie zu mir bringt, als vor zehn, nay, zwölf Jahren ihr Vater und ihr Bruder starben. Doch die Verwandten ihres Vaters weigerten sich, sie meiner Obhut anzuvertrauen, obwohl keiner von ihnen so nah mit ihr verwandt ist wie ich.«
»Warum bist du nicht selbst losgezogen und hast sie geholt? Du hättest sie zu deiner rechtmäßigen Erbin erklären und mitnehmen können. Briefe und Boten lassen sich leicht ignorieren, einem Mann persönlich ein Anliegen auszuschlagen ist weitaus schwerer. Dann hättest du dich auch nicht mit dem elenden Malcolm herumschlagen müssen.«
»Ich wollte, dass das Mädchen freiwillig nach Glascreag kommt.«
»Du solltest endlich deine Versuche einstellen, sie oder die Verwandten ihres Vaters mit freundlichen Worten umstimmen zu wollen.«
»Ganz genau. Deshalb will ich, dass du sie holst. Ach, mein Lieber, ich bin mir sicher, dass es dir gelingen wird. Dein Geschick, andere zu betören, ist genauso groß wie das, sie einzuschüchtern. Du kannst solche Dinge bewerkstelligen, ohne dass es dir die Leute übel nehmen. Ich hingegen würde bestimmt nur eine unnötige Fehde verursachen.«
Angus’ Schmeicheleien steigerten Artans Unbehagen. Angus schien sehr darauf erpicht, dass seine Nichte nach Glascreag gebracht wurde, aber er wusste offenbar auch, dass Artan sich wahrscheinlich weigern würde, ihm diesen Gefallen zu tun. Die Frage war nur, wie er darauf kam. Hielt er die Sache für gefährlich? Nein, das konnte nicht sein; denn der Mann wusste sehr wohl, dass nur etwas, was einem Selbstmord gleichkam, Artan dazu verleiten würde, vielleicht ein wenig zu zögern. In seinem Kopf schwirrten rasch zahllose Möglichkeiten herum. War es ungesetzlich oder einfach nur ausgesprochen mühsam? Doch dann beschloss er, dass er dieses Spielchen leid war.
»Jetzt reicht’s, Angus«, sagte er, richtete sich auf und stemmte die Hände auf die Hüften. »Warum hast du die Frau nicht persönlich hergeholt, und warum glaubst du, dass ich mich weigern werde, es zu tun?«
»Du würdest einem Mann auf seinem Sterbebett die Hilfe verweigern?«
»Jetzt raus mit der Sprache, Angus, sonst gehe ich und du wirst nie erfahren, ob ich es getan hätte oder nicht.«
»O je«, murmelte Angus. »Du wirst bestimmt Nay sagen. Cecily lebt in Dunburn in der Nähe von Kirkfalls.«
»In der Nähe von Kirkfalls? Kirkfalls?«, murrte Artan, dann begann er zu fluchen. »Das liegt doch in den Lowlands!« Artans Stimme klang leise, war jedoch mit Abscheu erfüllt.
»Nur ein paar Meilen in die Lowlands hinein.«
»Jetzt weiß ich, warum du dich nie persönlich darum gekümmert hast. Du hast die Vorstellung nicht ertragen, dorthin zu gehen. Aber mich willst du in diese elende Gegend schicken.«
»So schlimm ist es dort auch wieder nicht.«
»Du hättest mich genauso gut bitten können, nach London zu reiten. Nay, ich tue es nicht!«, erklärte Artan und schickte sich zu gehen an.
»Ich brauche einen blutsverwandten Erben!«
»Dann hättest du nicht zulassen dürfen, dass deine Schwester einen Mann aus den Lowlands heiratet. Das ist ja beinahe so schlimm, als wenn du sie mit einem Engländer hättest durchbrennen lassen. Am besten lässt du das Mädchen dort, wo es ist. Mittlerweile ist sie bestimmt völlig verdorben.«
»Warte! Du kennst noch nicht meinen ganzen Plan!«
Artan riss die Tür auf und starrte auf Malcolm, der auf dem Boden kauerte und wohl sein großes Ohr ans Schlüsselloch gepresst hatte. Der dürre, blasse junge Mann wurde noch bleicher und richtete sich auf. Er stolperte ein paar Schritte nach hinten, dann machte er sich eilig aus dem Staub. Artan seufzte. Eine solch deutliche Erinnerung an die schwere Wahl eines Erbens, vor der Angus stand, hätte er nicht gebraucht.
Doch außerdem brachte ihn seine Neugier dazu, an der Schwelle zu verharren, auch wenn ihn seine Instinkte drängten, zu gehen, und ihm deutlich zu verstehen gaben, dass er ein Narr war, wenn er sich nun anhörte, was Angus noch zu sagen hatte. In seinem Kopf flüsterte eine kleine Stimme, dass sein nächster Schritt sein Leben für immer verändern würde. Artan wünschte sich, diese Stimme hätte ihm auch gesagt, ob es eine gute Wendung sein würde. Inständig hoffend, dass es nicht eine sehr schlechte Entscheidung war, drehte er sich um und sah auf Angus.
Angus wirkte ziemlich selbstgefällig, wie Artan verdrossen feststellte. Der Alte hatte sein Opfer richtig eingeschätzt. Die Neugier war schon immer Artans Schwäche gewesen. Öfter, als ihm lieb war, hatte sie ihm Arger und sogar mehrere Verletzungen eingehandelt. Er wünschte sich, Lucas wäre bei ihm, denn sein Bruder war der Besonnenere. Doch dann verdrängte er diesen Gedanken rasch. Er war jetzt erwachsen, er war kein tollkühnes Kind mehr, und er hatte genügend Verstand, um seine Entscheidungen mit Sorgfalt und Umsicht zu fällen.
»Was hast du denn sonst noch ausgeheckt?«, fragte er Angus.
»Nun – es ist doch ganz einfach: Ich brauche einen starken Mann, der nach meinem Tod oder wenn ich beschließe, dass es an der Zeit ist, mich zurückzuziehen, meine Nachfolge als Laird antritt. Malcolm ist es nicht, und Cecily ist es auch nicht. Aber es sollte jemand sein, in dessen Adern Blut der MacReiths fließt, je mehr, desto besser.«
»Aye, so sollte es sein.«
»Nun, auch in deinen Adern fließt das Blut der MacReiths, obgleich es stark verdünnt ist, da du von einem fernen Cousin abstammst. Doch wenn du Cecily heiratest …«
»Ich soll sie heiraten?«
»Du meine Güte, warum entsetzt dich das denn so? Auch du wirst nicht jünger, mein Lieber. Es ist höchste Zeit, dass du ans Heiraten denkst.«
»Ich habe nichts dagegen. Eines Tages werde auch ich auf Brautschau gehen.«
Angus grunzte abfällig. »Eines Tages – am Sankt Nimmerleinstag vielleicht? Ich weiß, wovon ich rede, mein Lieber. Jetzt hör endlich auf, dich aufzuregen, und lass mich ausreden. Wenn du meine Nichte heiratest, bist du der zukünftige Laird von Glascreag. Ich würde dich zu meinem Erben machen, und keiner meiner Männer würde etwas dagegen haben. Und besser noch – auf Malcolm würde keiner hören, wenn der sich beschweren würde. Cecily ist meine engste Blutsverwandte, und du stehst mir im Verwandtschaftsgrad beinahe so nah wie Malcolm. Kurzum – wenn du das Mädchen heiratest, gehört Glascreag eines Tages dir.«
Artan trat ins Zimmer und schloss langsam die Tür hinter sich. Angus bot ihm etwas an, was er sich nie hätte träumen lassen – die Chance, Laird zu sein und eigenes Land zu besitzen. Als Zweitgeborener hatte seine Zukunft immer hinter der von Lucas rangiert, in Donncoill würde er nur Laird werden können, wenn Lucas etwas zustieße, und darüber wollte er lieber erst gar nicht nachdenken. Bislang hatte es immer nur eine einzige Möglichkeit gegeben, diese Zukunft zu verändern – eine Frau zu heiraten, die Land als Mitgift in die Ehe brachte.
Und genau das bot ihm Angus jetzt an. Artan spürte, wie die Versuchung an ihm nagte. Wenn er Cecil heiratete, würde er Glascreag erben, einen Ort, der ihm zur zweiten Heimat geworden war. Jeder, der nicht vollkommen schwachsinnig war, würde diese Gelegenheit sofort beim Schopf packen. Doch trotz der starken Versuchung zögerte er. Warum tat er das?
Weil er eine Ehe schließen wollte, wie sie seine Eltern führten und auch seine Großeltern und ein Großteil seines Clans, ging ihm auf. Er wollte eine Ehe, bei der er seine Frau selbst ausgesucht hatte, eine leidenschaftliche Ehe, eine Verbindung, die ein Leben lang hielt. Wenn Ländereien, Geld oder Bündnisse ein Paar aneinanderbanden, waren die Chancen auf eine glückliche Ehe deutlich verringert. Zu dieser Schlussfolgerung war er gelangt, nachdem ihm bereits viel zu viele unglückliche Gemahlinnen ihre Gunst angeboten hatten. Hätte die Vorstellung eines Ehebruchs ihn nicht so sehr gestört, wäre er mittlerweile ein äußerst erfahrener Liebhaber, dachte er und wehrte sich nach Kräften gegen das leichte Bedauern, das sich bei diesem Gedanken in ihm regte. Seiner Gemahlin wollte er es ersparen, zu einer solchen Frau zu werden, und er selbst wollte nicht zu einem Mann werden, dem die Bindung zu seiner Gemahlin so wenig bedeutete, dass er sein Ehegelübde immer wieder brach. Oder schlimmer noch, der in einer Ehe ohne Liebe und Leidenschaft feststeckte und bei keiner anderen Frau suchen konnte, was ihm fehlte, weil ihm durch seine Überzeugung die Hände gebunden waren.
Er sah Angus an, der mit kaum verhohlener Ungeduld auf seine Antwort wartete. Er konnte nicht einwilligen, eine Frau zu heiraten, die er nicht kannte, egal wie verlockend ihre Mitgift war; doch er konnte Angus wenigstens versprechen, darüber nachzudenken. Er konnte die Frau aufsuchen und die Entscheidung, sie zu heiraten, fällen, wenn er sie gesehen hatte. Auf dem gemeinsamen Rückweg nach Glascreag würde er genügend Zeit haben, sie kennenzulernen und herauszufinden, ob sie die Frau war, mit der er den Rest seines Lebens verbringen wollte.
Doch dann fiel ihm wieder ein, wo sie lebte und wie lange sie dort schon gelebt hatte.
»Sie kommt aus den Lowlands.«
»Sie ist eine MacReith«, fauchte Angus.
Der Alte wirkte wieder ziemlich selbstgefällig, und das nicht ohne Grund; denn wahrscheinlich bekam er seinen Willen, dachte Artan. In vielerlei Hinsicht wollte er es ja selbst. Alles hing davon ab, wie diese Frau war.
»Cecily«, murmelte er. »Klingt wie ein englischer Name.« Er musste lächeln, als Angus ihn grimmig anstarrte und seine blassen Wangen sich zornesrot färbten.
»Es ist kein englischer Name! Es ist der Name einer Märtyrerin, du elender Heide, und das weißt auch du ganz genau. Meine Schwester war sehr fromm. Ich habe das Mädchen immer Sile genannt – so heißt die Heilige auf Gälisch.«
»Weil du findest, dass Cecily zu englisch klingt.« Artan überhörte den zögernden Widerspruch. »Wann hast du das Mädchen zum letzten Mal gesehen?«
»Vor langer Zeit war ihr Vater mit ihr und ihrem kleinen Bruder hier, bevor er und der Junge gestorben sind.«
»Wie sind sie denn gestorben?«
»Sie wurden auf der Rückreise überfallen und ermordet. Es waren wohl Räuber. Das arme kleine Mädchen hat alles gesehen. Die alte Meg, ihre Kinderfrau, hat es aber geschafft, sie in Sicherheit zu bringen. Einige aus der Eskorte haben überlebt und die Räuber in die Flucht geschlagen, und dann haben sie Cecily, die alte Meg und die Toten nach Hause gebracht. Sobald ich erfuhr, was passiert war, habe ich jemanden losgeschickt, der mir das Mädchen bringen sollte, aber es gab Verwandte, die sie nicht mehr gehen lassen wollten.«
»War ihr Vater denn reich?«
»Aye. Er hatte Geld und Ländereien, und jetzt herrschen die Verwandten dort über alles. Sie tun es für das Mädchen, behaupten sie. Aber ich habe mir oft über den Angriff Gedanken gemacht. Vielleicht hatten seine Verwandten sogar die Hand im Spiel.«
»Aber sie haben sich des Mädchens nicht entledigt.«
»Cecily hat es nach Hause geschafft und ist nie mehr weggegangen. Und da sie eine Frau ist, bestimmen die anderen über alles, was sie besitzt.«
»Aye, das nährt natürlich den Verdacht, auf welche Weise ihre Familie ums Leben kam.«
Angus nickte. »Das finde ich auch. Wirst du nach Kirkfalls reiten und meine Nichte holen?«
»Aye. Aber ich kann dir nicht versprechen, dass ich sie heirate.«
»Nicht einmal, wenn du dadurch zu meinem Erben wirst?«
»Nay, nicht einmal dann, so verführerisch es auch ist. Ich kann mich nicht nur aus einem solchen Grund an eine Frau binden. Es muss mehr sein.«
»Sie ist ein hübsches kleines Ding mit dunkelroten Haaren und großen grünen Augen.«
Das klang vielversprechend, doch Artan ließ sich nicht erweichen. »Als du sie zum letzten Mal gesehen hast, war sie noch ein Kind. Du weißt nicht, was für eine Frau aus ihr geworden ist. Ein Mädchen kann noch so hübsch sein, doch blinde Lust verfliegt rasch, und plötzlich findet sich ein Mann neben einem hübschen Mädchen wieder, das kalt wie Eis ist, oder boshaft oder ein Dutzend anderer Dinge, die das Leben an ihrer Seite zur Hölle machen können. Nay, ich kann dir jetzt nicht versprechen, deine Nichte zu heiraten. Aber auf dem Weg zurück werde ich genug Zeit haben, sie kennenzulernen.«
»Na gut, du wirst schon sehen – du wirst sie mit Freuden heiraten wollen. Sie ist ein süßes, sanftes, fügsames Mädchen, eine wahre Lady, die dazu erzogen worden ist, ihrem Gemahl ein Quell der Freude zu sein.«
Artan fragte sich, wie viel von diesem überschwänglichen Lob wohl zutraf, doch dann zuckte er die Schultern und fing an, seine Reise zu planen.
Kapitel 2
»Ein räudiger Köter, eine schleimige, warzenübersäte Kröte, ein … ein …« Cecily, die in ihrer Schlafkammer auf- und abgelaufen war, blieb stehen und runzelte die Stirn, während sie versuchte, sich noch ein paar weitere passende Schmähungen für den Mann einfallen zu lassen, mit dem sie demnächst vermählt werden sollte.
»M’lady?«
Cecily blickte zur Tür, an der ihre sehr junge Zofe stand und besorgt hereinspähte. Sie versuchte, ein Lächeln zustande zu bringen. Joan wagte sich zwar herein, wirkte jedoch immer noch ziemlich beunruhigt. Offenbar hatte Cecily es nicht geschafft, eine freundliche Miene aufzusetzen, aber ihr war einfach nicht danach.
»Ich soll Euch beim Ankleiden für den Beginn der Feierlichkeiten helfen«, sagte Joan und begann, die Kleider einzusammeln, die Cecily an diesem Tag tragen sollte.
Mit einem tiefen Seufzer zog Cecily ihr Gewand aus und ließ sich von dem Mädchen für das Festmahl in der großen Halle einkleiden. Sie musste sich unbedingt beruhigen, bevor sie sich ihren Verwandten, all deren Freunden und ihrem Verlobten stellte. Ihre Verwandten waren der Meinung, dass sie eine ausgezeichnete Ehe für sie arrangiert hatten, und damit standen sie sicher nicht allein: Sir Fergus Ogilvey war ein mächtiger, reicher Mann, er war nicht zu alt und hatte es im Dienst des Königs zum Ritter gebracht. Cecily hingegen war die verwaiste Tochter eines Gelehrten und einer Frau aus den Highlands. Außerdem war sie schon zweiundzwanzig und hatte widerspenstige rote Haare, eher bescheidene Kurven und Sommersprossen.
Sie war eine schwere Prüfung für ihre Verwandten und hatte deren Fürsorge mit Ungehorsam und Aufsässigkeit vergolten. Deshalb waren sie ihr gegenüber ziemlich abweisend. Cecily hatte zwar immer wieder versucht, ihre Liebe und Anerkennung zu erringen, aber es war ihr nie gelungen. Die Vermählung war ihre letzte Chance, und obgleich sie den Mann, den sie bald heiraten sollte, zutiefst verachtete, würde sie die Schultern straffen und ihn als ihren Gemahl akzeptieren.
»Ein Pickel am Arsch des Teufels«, murmelte sie.
»Wie bitte, M’lady?«, quietschte Joan.
So, wie Joan sie anstarrte, hatte Cecily den letzten unfreundlichen Gedanken offenbar zu laut geäußert. Sie seufzte ein weiteres Mal. Sie konnte einfach nicht aufhören, sich Beleidigungen für Sir Fergus Ogilvey auszudenken. Das Letzte, was sie brauchte, war es, dass solche Bemerkungen ihrer Cousine zu Ohren kamen. Dann hätte sie ihre letzte Chance auf deren Zuneigung verspielt.
»Verzeihung, Joan«, sagte sie und zwang sich, angemessen zerknirscht und ein wenig verlegen zu wirken. »Als du hereinkamst, habe ich ein paar Schmähungen ausprobiert.«
»Ihr probiert Schmähungen aus? Wozu das denn, M’lady?«
»Nun, um sie einem Gegner an den Kopf zu werfen, wenn er mich angreift. Ich kann nicht mit einem Schwert oder einem Dolch umgehen, und ich bin viel zu klein, um mich erfolgreich zu wehren. Deshalb dachte ich, es könnte nützlich sein, einen Gegner mit scharfen Worten zu geißeln.«
Na toll, dachte Cecily, als Joan sie behutsam dazu drängte, sich auf einen Schemel zu setzen, damit sie ihr die Haare richten konnte. Jetzt dachte Joan wohl, ihre Herrin habe den Verstand verloren. Und vielleicht war das ja auch wirklich der Fall. Es musste eine Art Wahn sein, wenn jemand jahrelang vergeblich versuchte, die Billigung und Zuneigung anderer Menschen zu erringen. Trotzdem hörte sie nicht damit auf. Wenn sie es wieder einmal nicht geschafft hatte, spornte sie das nur dazu an, sich noch stärker ins Zeug zu legen. Sie hatte das Gefühl, ihren Pflegeeltern unendlich viel zu schulden, doch es wollte ihr nie gelingen, ihre Schulden wettzumachen. Diesmal würde sie es schaffen.
»Ach, kleine Joan, lass mich das doch machen.«
Cecilys Laune hob sich ein wenig, als die alte Meg hereineilte. Die Frau war zwar scharfzüngig, doch Cecily hatte nie den geringsten Zweifel gehegt, dass Meg sie mochte. Ihre Verwandten verabscheuten sie und hatten sie aus dem Haus verbannt. Dass sie nun hier war, in Zeiten größter Not, war eine unerwartete Freude. Cecily erhob sich, um die große, stattliche Frau zu umarmen.
»Wie schön, dich zu sehen, alte Meg«, sagte sie und wunderte sich nicht, dass ihre Stimme rau klang, denn sie war den Tränen nahe.
Die Alte tätschelte ihr den Rücken. »Wo sollte ich denn sein, wenn meine kleine Cecily bald heiratet?« Sie drückte Cecily wieder auf den Schemel und lächelte Joan an. »Ich vermute, dass du noch eine Menge zu erledigen hast, Kleines. Geh nur!«
»Hoffentlich hast du sie nicht gekränkt«, meinte Cecily, sobald Joan gegangen war und die alte Meg die Tür zugemacht hatte.
»Nay, das arme Mädchen ist völlig abgearbeitet. Sie war gottfroh, dass ihr wenigstens eine Aufgabe abgenommen worden ist. Deine Verwandten geben sich die allergrößte Mühe, Ogilvey und seinen Tross zu beeindrucken. Offenbar wissen sie nicht, dass er nur ein Raffzahn ist, der sich für so großartig und mächtig hält, dass er wahrscheinlich sogar auf die Engel naserümpfend herabsehen würde.«
Cecily lachte kurz, doch dann verfinsterte sich ihre Miene wieder. »Er scheint tatsächlich sehr viel von sich zu halten.«
Die alte Meg räusperte sich und begann, Cecilys Haare kräftig zu bürsten. »Der Kerl ist so aufgeblasen, dass er kurz davor steht zu platzen. Er tut so, als ob er dir einen großen Gefallen erweist, dich zu heiraten, und dabei kommst du aus einem viel besseren Haus als dieser selbstgefällige Nichtsnutz.«
»Er ist im Dienst des Königs zum Ritter geschlagen worden«, wandte Cecily ein, auch wenn sie im Grunde nicht die geringste Lust verspürte, ihren Verlobten zu verteidigen.
»Der Narr ist rein zufällig in ein Schwert gestolpert, das unseren König erwischt hätte. Erst als Ogilvey einen Moment lang aufhörte, zu fluchen und zu jammern – nachdem er aus seiner Ohnmacht erwacht war, wohlgemerkt –, hat er gemerkt, dass alle dachten, er hätte es absichtlich getan. Dann besaß der verschlagene Schuft die Geistesgegenwart, den demütigen Retter unseres Herrn zu spielen, selbst wenn ihm diese Vorstellung denkbar schlecht gelungen ist.«
»Woher weißt du das denn so genau?«
»Weil ich dabei war! Ich habe meine Schwester besucht, und wir haben all die Lairds und den König beobachtet. Es kam zu einem albernen Streit, die Schwerter wurden gezückt, und der König lief beinahe direkt in eins hinein. Doch Ogilvey, der damit beschäftigt war, einen kleinen Flecken aus seinem Umhang zu entfernen, achtete nicht auf seine Füße und geriet ins Stolpern. Und so ist er direkt in den Ruhm gestolpert.«
Cecily verzog das Gesicht. »Er hat immer nur gesagt, dass er unserem König einen großen Dienst erwiesen hat. Ziemlich bescheiden, finde ich.«
»Nun, die Wahrheit kann er wohl kaum sagen, oder? Nicht, nachdem er die Sache nicht gleich richtiggestellt hat und dafür sogar zum Ritter geschlagen wurde.«
Also würde sie auch noch einen Lügner heiraten, dachte Cecily und seufzte. Aber vielleicht war dieses Urteil ungerecht; vielleicht hatte sich Sir Fergus einfach nicht aus dem Missverständnis herauswinden können. Wer würde schon einem König widersprechen? Doch warum strengte sie sich eigentlich so an, Entschuldigungen für diesen Mann zu finden?
Weil sie es musste, lautete die Antwort. Sie hatte ihre letzte Chance erhalten, ein Teil dieser Familie zu werden, mehr als nur eine Last und eine Almosenempfängerin. Sie würde zwar ihr Elternhaus verlassen müssen, doch ihre Verwandten würden sie immerhin in guter Erinnerung behalten und wären hoffentlich bereit, sie als wahres und hilfreiches Familienmitglied anzuerkennen. Endlich wäre sie in ihren Herzen willkommen und auch in ihrem Heim. Sir Fergus war ein Mann, den sie niemals als Vater ihrer Kinder gewählt hätte, doch nur sehr wenige Frauen hatten das Glück, ihren Gemahl selbst auszusuchen. So schlecht sie diese Wahl fand, so tröstete sie doch die Tatsache, dass sie endlich etwas tat, um ihre Verwandten zufriedenzustellen.
»Du siehst nicht sehr glücklich aus, Mädchen«, bemerkte die alte Meg, während sie Cecilys dichte Haarpracht mit blauen Schleifen verzierte.
»Das kommt schon noch«, murmelte Cecily.
»Was soll das denn heißen?«
»Dass ich in meiner Ehe zufrieden sein werde, auch wenn es mich einige Mühe kosten wird. Und außerdem bin ich schon fast zweiundzwanzig, es ist also allerhöchste Zeit, dass ich endlich heirate und ein paar Kinder bekomme. Ich hoffe nur, ihr Kinn gerät nicht nach dem ihres Vaters«, murrte sie, dann verzog sie das Gesicht, als die alte Meg lachte. »Das war nicht nett von mir.«
»Das mag schon sein, aber es ist die traurige Wahrheit. Der Mann hat rein gar kein Kinn.«
»Nay, ich fürchte, das stimmt. Ich habe noch nie ein derart schwach ausgeprägtes Kinn gesehen. Es sieht so aus, als gehe der Mund gleich in den Hals über.« Cecily schüttelte den Kopf, was ihr eine scharfe Rüge einbrachte.
»Warum hast du dich bereit erklärt, diesen Kerl zu heiraten, wenn du es nicht willst?«
»Weil Anabel und Edmund es wollen.«
Als die alte Meg die Hände auf die breiten Hüften stemmte und sie aufgebracht anfunkelte, erhob sich Cecily und trat zum Spiegel, um sich zu vergewissern, dass sie vorzeigbar war. Der Spiegel gehörte zu den wenigen kostbaren Dingen in ihrer kleinen Schlafkammer, und wenn sie ein wenig seitlich davon stand, konnte sie sich trotz des großen Sprungs darin recht gut betrachten. Es versetzte ihr zwar einen kleinen Stich, als sie daran dachte, dass man ihr nur beschädigte Dinge gab oder solche, die Anabel und ihre Töchter nicht mehr haben wollten, doch sie verdrängte diesen Schmerz rasch. Anabel hätte den zerbrochenen Spiegel ja auch einfach wegwerfen können, wie sie es mit zahllosen anderen Dingen getan hatte, die Cecilys Mutter gehört hatten.
Cecily runzelte die Stirn, als ihr aufging, dass sie sich etwas einfallen lassen musste, um ein paar Sachen mitzunehmen, die sie versteckt hatte. Sie warf einen Blick auf die noch immer grollende alte Meg. Diese hatte häufig darüber geklagt, dass Anabel so viel von Moira Donaldsons persönlichen Dingen weggeworfen hatte. Vielleicht war es an der Zeit, der Frau zu sagen, dass nicht alles verloren war. Anfangs war es nur die Trauer eines Kindes gewesen, die Cecily dazu veranlasst hatte, die Sachen ihrer Mutter zu bergen und zu verstecken. Im Lauf der Jahre war es zu einem Ritual geworden, und, wie sie sich zerknirscht eingestehen musste, zu einer Form der Auflehnung.
Dasselbe traf wohl auch auf ihr anderes großes Geheimnis zu, dachte sie, als sie auf die kleine, mit hübschen Schnitzereien verzierte Truhe blickte, in der ihre Schleifen und ihre karge Schmucksammlung lagen. Anabel hatte rasch all die Ketten und Ringe vereinnahmt, die einst Moira gehört hatten. Zumindest glaubte sie, dass es alle waren. Doch versteckt unter den Schleifen und dem übrigen Tand in der Truhe gab es noch einige kostbare Schmuckstücke, an denen Cecily sehr hing; denn sie hatte sie von ihrem Vater nach dem Tod der Mutter bekommen. Er hatte vorgehabt, ihr später auch den übrigen Schmuck zu geben, doch das hatte Cecily ihren Pflegeeltern gegenüber nur ein einziges Mal erwähnt, und Anabel war außer sich geraten vor Wut. Aber der Besitz der wenigen Erinnerungsstücke reichte Cecily, um den Mund zu halten, wenn sie Anabel oder ihre Töchter ein Diadem tragen sah, das einst Moira Donaldson gehört hatte.
Schließlich kümmerte sich die Frau um eine mittellose Waise, und dafür hatte sie auch eine Entschädigung verdient, mahnte sich Cecily und schob entschlossen den Ärger beiseite, über den sie nie ganz hinwegkommen konnte. Sie wandte sich wieder der alten Meg zu. In der Miene der Frau zeigte sich eine seltsame Mischung aus Sorge und Zorn. Cecily lächelte sie an und deutete auf ihr mit Schleifen geschmücktes Haar.
»Es sieht sehr hübsch aus, Meg«, sagte sie.
Meg schnaubte nur und verschränkte die Arme. »Du hast dich gar nicht richtig betrachtet, Mädchen. Du bist plötzlich ernst geworden und hast so ausgesehen, als ob du mit deinen Gedanken ganz woanders wärst. Woran hast du gedacht?«
»An ein Geheimnis, das ich sehr lange gehütet habe«, erklärte Cecily leise und trat näher zu Meg. »Erinnerst du dich noch an mein Lieblingsversteck?«
»Aye«, erwiderte die Alte ebenso leise. »Drunten im Keller, in der kleinen Kammer. Ich habe mit keinem darüber gesprochen, auch wenn ich es hätte tun sollen, denn du hättest dich dort aus Versehen einschließen können und wärst in meiner Abwesenheit von keinem gefunden worden.«
»Nun, du warst ja da, und ich habe immer gut aufgepasst. Aber bitte hör mir jetzt gut zu, denn vielleicht brauche ich deine Hilfe: Ich habe dort unten ein paar Sachen versteckt, die Mama und Papa und auch Colin sehr am Herzen lagen.« Sie lachte kläglich, als die alte Meg sie umarmte.
»Und jetzt soll ich dafür sorgen, dass sie nach deiner Hochzeit mit dir das Haus verlassen.«
»Aye.« Cecily deutete auf die Truhe, die ihre anderen Schätze barg. »Und die kleine Truhe auch.«
Die alte Meg seufzte. »Die hat dir dein Da geschenkt. Du hast dich so darüber gefreut. Sie hat ein kleines Geheimfach, in das du immer die Sachen gelegt hast, die dir besonders wichtig waren. Was hast du jetzt darin versteckt?«
»Nach Mamans Tod hat mir mein Vater ein paar ihrer Schmuckstücke gegeben. Den Rest sollte ich später bekommen, doch Anabel…« – sie überhörte Megs leise gemurrte und ziemlich derbe Meinung von Anabel – »… hat alles behalten. Sie hat gesagt, dass Mamas Schmuck und all ihre anderen schönen Sachen jetzt ihr gehören. Deshalb habe ich ihr nichts von den Schmuckstücken erzählt, die mein Vater mir geschenkt hat. Das war nicht richtig von mir, aber …«
»Es ist doch nicht falsch, wenn ein Kind an Dingen festhält, die es an seine Eltern erinnern.«
»Das sage ich mir auch immer, wenn mich mal wieder Gewissensbisse plagen.«
»Völlig grundlose Gewissensbisse!«
Cecily legte sanft einen Finger auf den Mund der Alten, um sie davon abzuhalten, in eine lange Litanei von Klagen zu verfallen, wie schlecht sie von ihren Pflegeeltern behandelt wurde. »Es spielt keine Rolle. Anabel und Edmund sind jetzt meine Familie, und ich habe sie immer schwer enttäuscht. Diesmal habe ich mir fest vorgenommen, es ihnen recht zu machen. Aber ich möchte die wenigen Dinge behalten, die ich noch von meinem Vater, meinem Bruder und meiner Mutter habe. Deshalb wollte ich dir sagen, wo ich diese Sachen versteckt habe.«
Die alte Meg nickte seufzend. »Wenn du sie nicht persönlich mitnehmen kannst, werde ich dafür sorgen, dass sie bei dir landen.«
»Danke, Meggie. Es wird mir ein großer Trost sein, sie bei mir zu haben.«
»Du willst also wirklich diesen kinnlosen Narren heiraten?«
»Aye. Es ist der Wunsch meiner Pflegeeltern, und diesmal werde ich alles tun, um sie zufriedenzustellen. Und wie gesagt – ich bin schon fast zweiundzwanzig und hatte noch keinen einzigen Freier. Ich bin noch kein einziges Mal richtig geküsst worden.« Rasch verbannte Cecily den Gedanken, von Sir Fergus geküsst zu werden, denn dabei drehte sich ihr der Magen um. »Ich möchte Kinder haben, und dafür braucht man einen Gemahl. Es wird schon gut gehen.«
Die alte Meg bedachte sie mit einem Blick, dem unschwer zu entnehmen war, was sie davon hielt, doch dann murrte sie nur leise: »Lass uns beten, dass die Kinder nicht das Kinn ihres Vaters bekommen.«
***
»Na ja, wenigstens siehst du vorzeigbar aus.«
Cecily lächelte Anabel an und beschloss, diese Worte als Kompliment zu verstehen. Sie zwang sich, den Blick von der kostbaren goldenen Granatkette um Anabels Hals abzuwenden, die ihr Vater ihrer Mutter zur Hochzeit geschenkt hatte. Es tat ihr zu weh, an die Vergangenheit und an die Liebe zwischen den beiden erinnert zu werden, zumal sie bald einen Mann heiraten sollte, den sie nie würde lieben können.
Sie sah sich in der großen Halle um und musterte die Menschen, die sich für das Festmahl versammelt hatten. Dieser Abend stand am Anfang von zwei Wochen voller Feierlichkeiten, die in ihrer Hochzeit mit Sir Fergus Ogilvey enden würden. Cecily kannte nur wenige der Anwesenden, da ihr selten gestattet war, an Festen teilzunehmen oder mit ihren Verwandten Besuche zu machen. Und nun hatten sich diese Leute wohl alle hier versammelt, um auf Kosten ihrer Gastgeber zu schmausen, zu trinken und zu jagen.
Als ihr Blick schließlich auf ihren Verlobten fiel, seufzte sie. Er war mit zwei Männern ins Gespräch vertieft, die ebenso aufgeblasen wirkten wie er. Cecily stellte fest, dass es sie nicht im Geringsten interessierte, worüber sich die drei unterhielten, und das wertete sie als schlechtes Zeichen für ihre Zukunft.
Während Anabel ihr die Gäste erklärte – wer sie waren, woher sie stammten und warum es von größter Bedeutung war, all ihre Bedürfnisse zu erfüllen –, versuchte Cecily, an ihrem Verlobten etwas zu finden, was ihr gefiel. Er war nicht hässlich, aber auch nicht attraktiv mit seinem wirklich sehr schwach ausgeprägten Kinn und seiner langen, dünnen Nase. Das braune Haar wirkte stumpf und lichtete sich bereits an den Schläfen. Ihr fiel ein, dass er grünbraune Augen hatte, eigentlich eine ganz hübsche Farbe; doch leider waren seine Augen klein und von spärlichen, sehr kurzen Wimpern umgeben. Doch er hatte eine gute Haltung und kleidete sich vorteilhaft, beschloss sie erleichtert. Wenigstens würde sie ihm dafür, falls es sein musste, ein Kompliment machen können.
»Hörst du mir überhaupt zu?«, zischte Anabel. »Das ist wichtig! Bald wirst du dich unter diesen Leuten bewegen müssen.«
Cecily blickte auf Anabel und erstarrte. Etwas hatte die Frau wieder einmal erzürnt. Sie bekam es mit der Angst zu tun. Hektisch versuchte sie, sich an irgendetwas zu erinnern, das Anabel soeben gesagt hatte, doch die rang sichtlich um Beherrschung, was Cecily allerdings noch weit mehr beunruhigte. Offenbar wollte Anabel diese Hochzeit um jeden Preis. Selbst wenn Cecily nicht so entschlossen gewesen wäre, zu heiraten, um Edmund und Anabel einen Gefallen zu tun und damit endlich einen Platz in dieser Familie zu erringen, wäre ihr gar nichts anderes übrig geblieben: Wenn sie Sir Fergus Ogilvey nicht freiwillig heiratete, würde man sie zweifellos dazu zwingen.
»Ich habe gerade Sir Fergus betrachtet«, sagte sie.
»Aye, ein stattlicher Mann. Er wird dir Ehre machen.«
Das bezweifelte Cecily, doch sie nickte.
»Und ich erwarte von dir, dass du ihm eine gute Gemahlin wirst. Ich weiß, dass ich dir das bereits gesagt habe, aber es kann nicht oft genug wiederholt werden, vor allem, weil du dazu neigst, Dinge zu vergessen und dich schlecht zu benehmen: Eine gute Gemahlin folgt den Befehlen ihres Mannes. Es ist ihre Pflicht, ihn in jeder Hinsicht zufriedenzustellen und fügsam, sanftmütig und liebenswürdig zu sein.«
Diese Ehe würde wohl die reine Folter werden, dachte Cecily.
»Du musst seinen Haushalt fuhren und alles im Griff haben. Die Mahlzeiten müssen zur rechten Zeit auf den Tisch kommen, das Leinen muss sauber und frisch sein, und die Bediensteten müssen gut ausgebildet und gehorsam sein.«
Das könnte schwierig werden, denn Anabel hatte ihr nie erklärt, wie man einen Haushalt führt, doch Cecily biss sich auf die Zunge, damit ihr diese Worte nicht entschlüpften. Viele Strafen und stumme Beobachtungen hatten ihr eigentlich zu einer ziemlich guten Vorstellung darüber verholfen, wie ein Haus zu führen war. Zweifellos hatte sie bei all den Bestrafungen einige Fertigkeiten erworben, die wahrscheinlich keine andere feine Dame besaß. Doch als sie auf Sir Fergus blickte, dachte sie unwillkürlich, dass der Mann diese Fertigkeiten wohl kaum zu schätzen wusste, ja, dass es ihn wohl eher abstoßen würde, wenn er herausfand, dass seine junge Gemahlin Wäsche waschen und Ställe ausmisten konnte.
»Eine gute Ehefrau sieht über die Schwächen ihres Mannes hinweg«, fuhr Anabel fort.
Cecily vermutete, dass Sir Fergus eine Menge Schwächen hatte, doch dann schalt sie sich stumm wegen ihrer unfreundlichen Gedanken. Bald würde sie mit diesem Mann verheiratet sein, es war höchste Zeit, an ihrem Verlobten ein paar Vorzüge zu finden. Es musste doch welche geben. Wahrscheinlich war sie zu sehr damit beschäftigt gewesen, sich in Selbstmitleid zu üben und sich dazu durchzuringen, sich klaglos in ihr Schicksal zu fügen, um seine Vorzüge zu bemerken.
»Eine gute Gemahlin sieht über die Streifzüge ihres Mannes hinweg, über seine anderen Frauen …«
»Andere Frauen? Welche anderen Frauen?«, fragte Cecily überrascht. Diese neue Wendung in dem Vortrag, den sie nun schon sehr häufig zu hören bekommen hatte, gefiel ihr gar nicht.
Anabel verdrehte seufzend die Augen, große, blaue Augen, auf die sie besonders stolz war. »Männer sind triebhafte Wesen, mein Kind. Sie können gar nicht anders, als es mit jeder Frau zu treiben, die ihnen ins Auge fällt. Eine Gemahlin muss lernen, solche Dinge nicht zu beachten.«
»Aber warum? Ihr Gemahl hat vor Gott einen Schwur geleistet, genau wie sie. Es ist doch seine Pflicht, sich an das Ehegelübde zu halten.«
Anabel vergewisserte sich, dass niemand sie beobachtete, dann zog sie Cecily noch ein Stück von den übrigen Anwesenden weg. »Sei nicht so töricht! Den Männern sind solche Dinge völlig gleichgültig. Sie betrachten es als ihr gutes Recht, mit jeder Frau ins Bett zu steigen, mit der sie ins Bett steigen wollen.«
»Mein Vater war meiner Mutter treu.«
»Woher willst du das denn wissen? Du warst doch noch ein Kind. Glaub mir, du wirst noch froh sein, wenn dein Mann seine Gelüste anderswo befriedigt und dich nur selten damit belästigt. Es ist eine widerliche Sache, die nur den Männern Spaß macht. Sollen sich doch die Mägde darum kümmern. Da die Männer immer einen Haufen Söhne haben wollen, wirst du ohnehin so oft damit behelligt werden, ihn in dein Bett zu lassen, dass du über solche Atempausen von Herzen froh sein wirst.«
»Ihn in mein Bett zu lassen? Wird er denn nicht jede Nacht darin schlafen?«
»Wie kommst du denn auf diesen seltsamen Gedanken?«
»Meine Mutter und mein Vater haben immer ihr Lager geteilt. Ich war damals zwar wirklich noch sehr jung, aber das weiß ich ganz genau.«
»Sehr merkwürdig«, murmelte Anabel, doch dann zuckte sie die Schultern. »Wahrscheinlich war das eine der sonderbaren Gepflogenheiten aus den Highlands. Dort oben hausen doch nur Barbaren. Du hingegen bist unter zivilisierten Menschen aufgewachsen, und es ist höchste Zeit, dass du solche Vorstellungen vergisst.«
Cecily unterdrückte rasch das unwillkürliche Bedürfnis, die Verwandten ihrer Mutter zu verteidigen. Sie hatte schon vor langer Zeit gelernt, dass so etwas nur Ärger einbrachte. Widerworte hatten immer nur dazu geführt, dass Anabel sie mit einer anstrengenden und häufig schmutzigen Arbeit bestrafte. Manchmal hatte Cecily den Eindruck, dass Anabel sie absichtlich provozierte. Und manchmal schien es fast, als hasste Anabel die längst verstorbene Moira Donaldson, obwohl Cecily keine Ahnung hatte, was ihre liebe Mutter getan hatte, um solche Feindseligkeit hervorzurufen. Oft äußerte sich Anabel auch abschätzig über ihren Vater. Cecily verstand diese Abneigung nicht, doch leider würde sie Anabel wohl nie eine Erklärung entlocken können.
Bei den Gedanken an ihre verstorbene Familie überkam Cecily eine Welle von Trauer. Sie starrte auf ihre Füße und kämpfte gegen die Tränen. Bald würde ihr Hochzeitstag sein, der wichtigste Tag im Leben einer Frau, und sie war umringt von Fremden und Menschen, denen sie nichts bedeutete. Wenn die alte Meg es schaffte, in die Kapelle zu schleichen oder sich heimlich zu einigen der Treffen zu gesellen, würde Cecily wenigstens wissen, dass eine Person, die sie aufrichtig liebte, in ihrer Nähe war. Natürlich weilte ihre Familie in ihrem Herzen und in ihren Erinnerungen, doch sie wünschte sich sehnlichst, sie jetzt neben sich zu wissen.
»Kannst du dir vielleicht mal ein Lächeln abringen?«, zischte Anabel. »Meine Güte, du siehst ja aus, als ob du gleich losheulen würdest. Pass bloß auf, dass Sir Fergus dich nicht mit dieser Miene ertappt. Er würde bestimmt denken, dass du dich nicht freust, ihn zum Gemahl zu bekommen.«
In Anabels Stimme lag eine deutliche Warnung. Wenn es dazu kam, würde Cecily sofort schwer dafür büßen müssen. Deshalb bemühte sie sich, ihr Leid zu verbergen, auch wenn sie kein glaubwürdiges Lächeln zustande brachte. Doch als sie auf Anabel blickte, stellte sie fest, dass die Frau mit offenem Mund auf den Eingang zur großen Halle starrte, ebenso wie alle anderen. Und es war erstaunlich leise geworden.
Der Anblick von so vielen stummen Menschen mit weit aufgerissenen Augen und Mündern war zwar faszinierend, doch Cecilys Neugier brachte sie dazu, ihren Blicken zu folgen. Als sie den Mann erblickte, der dort stand, hielt nur ein plötzlicher Anflug von Stolz sie davon ab, es den anderen gleichzutun. Er war sehr groß, sehnig und muskulös. Sein langes schwarzes Haar reichte ihm über die breiten Schultern, auf beiden Seiten seines markanten Gesichts war es zu einem dünnen Zopf geflochten. Er trug einen dunkelgrünen, mit schwarzen und gelben Karos gemusterten Plaid. Seine Hirschlederstiefel und sein weißes Leinenhemd zeigten Spuren einer langen Reise. Hinter seinem Kopf ragte das Heft eines Breitschwertes auf. Ein weiteres Schwert hatte er gegürtet, und in seinem linken Stiefelschaft steckte ein Dolch.
Cecily war froh, dass sie sich nicht dazu hatte hinreißen lassen, die Highlander zu verteidigen. Dieser Mann sah wirklich aus wie ein prachtvoller Barbar. Sein Auftritt wurde gekrönt durch das, was er in den Händen hielt: zwei Wachen, die er an ihren Wämsern gepackt hatte und deren Beine in der Luft baumelten. Die Männer schienen sich nicht besonders zu wehren, dachte Cecily leicht belustigt, und ihr Häscher schien nicht besonders unter ihrem Gewicht zu leiden. Schließlich beschloss Cecily, dass jemand etwas tun musste. Sie atmete tief durch, um sich Mut zu machen, und ging auf den Mann zu.
Kapitel 3
Artan musterte die Menschen in der großen Halle, die ihn mit offenem Mund anstarrten. Er rang um Beherrschung, doch es fiel ihm schwer. Sobald er in die Lowlands gekommen war, war seine Reise mühsam geworden. Auf Schritt und Tritt hatten ihn die Leute angestarrt, verspottet und beleidigt, oder sie waren vor ihm geflohen. Ab und an hatte er ein paar Köpfe aneinandergeschlagen, doch das hatte seine Laune kaum verbessert. Als man ihm den Eintritt ins Haus der Donaldsons verwehrt hatte, war das Maß voll gewesen. Doch der Empfang, der ihm in der großen Halle bereitet wurde, überbot alles Bisherige.
Aus den Augenwinkeln nahm er eine Bewegung wahr und verspannte sich etwas. Sein Blick fiel auf eine kleine, schlanke Frau mit dunkelroten Haaren, die auf ihn zuging. Während er sie musterte, fing sein Herz an, schneller zu pochen. Sie bewegte sich mit angeborener Anmut, die schlanken Hüften sanft schwingend. Ihr blaues Gewand war so tief ausgeschnitten, dass man die sanfte Schwellung ihrer Brüste erkennen konnte. Es waren nicht die üppigen Brüste, nach denen ihn normalerweise gelüstete, doch sie waren rund genug, um seine Aufmerksamkeit zu erregen.
Als sie näher kam, bemerkte er, dass ihre großen, von dichten Wimpern gerahmten Augen tief dunkelgrün waren. Sein Herz schlug noch schneller. Ihr Gesicht war oval, ihre Haut makellos, ihre Lippen voll. Auf ihrer kleinen Nase zeigten sich ein paar Sommersprossen, und ihr Kinn ließ auf eine gewisse Sturheit schließen. Wenn das Angus’ Nichte war, hatte Artan bislang nichts dagegen, sie zu heiraten.
»Sir? Vielleicht solltet Ihr diese Männer loslassen. Ich glaube, sie leiden unter Atemnot.«
Ihre leise, rauchige Stimme klang so verlockend, dass Artan einen Moment lang brauchte, um zu verstehen, was sie gesagt hatte. Grummelnd blickte er auf die zwei Männer, die er noch immer hochhielt. Sie schienen tatsächlich schwer zu atmen. Schulterzuckend schleuderte er sie beiseite, dann starrte er auf die Leute, die erschrocken aufkeuchten und nach hinten auswichen.
»Danke, Sir«, sagte Cecily und musste sich ein Lachen verkneifen. »Dürften wir vielleicht erfahren, wer Ihr seid und was Euch zu uns führt?«
Als er sie mit seinen silberblauen Augen ansah, wurde Cecily ganz schwindelig. Rasch straffte sie die Schultern. Sie wusste nicht, woher es kam, dass dieser Mann es mit einem Blick schaffte, ihr die Fassung zu rauben, aber sie wollte ihm weiter mit ruhiger Gesetztheit begegnen.
»Ich bin Sir Artan Murray«, erwiderte er und deutete eine Verbeugung an. »Sir Angus MacReith hat mich geschickt.«
»Onkel Angus?« Cecily fragte sich, warum der plötzliche Gedanke, dass dieser Mann ein naher Verwandter sein könnte, sie so beunruhigte.
»Ach, dann seid Ihr also Lady Cecily Donaldson?« Artan musste dem Drang widerstehen, sich in Vorfreude die Hände zu reiben.
Cecily nickte und machte einen kleinen Knicks. »Was möchte mein Onkel denn von mir?«
»Er möchte, dass Ihr nach Glascreag kommt. Er ist krank und möchte Euch noch einmal sehen, bevor er stirbt.« Eigentlich glaubte Artan nicht, dass Angus kurz vor seinem Tod stand, aber wenn diese kleine Übertreibung die Frau dazu brachte, mit ihm nach Glascreag zu reiten, konnte es nicht schaden.
»Nay!«, kreischte Anabel. Sie hatte sich offenkundig von ihrem Schock erholt und stürmte nun zu Cecily.
Cecily zuckte zusammen, als Anabel sie grob am Arm packte. »Aber wenn mein Onkel im Sterben liegt …«
»Du kannst ihn nach der Hochzeit aufsuchen«, erklärte Anabel schroff.
»Hochzeit? Was für eine Hochzeit?«, wollte Artan wissen.
»Cecilys Hochzeit«, erwiderte Anabel.
»Angus hat man nichts von einer Hochzeit erzählt.«
»Warum sollte man es ihm erzählen?«
»Weil er ihr nächster lebender Verwandter ist.«
»Nun, auch wir sind ihre Verwandten, und gleichzeitig ihre Pflegeeltern. Ich bin Lady Anabel Donaldson, und das dort ist mein Gemahl, Sir Edmund. Wir hatten die Entscheidung zu fällen, nicht ihr Onkel.«
Artan musterte die Frau, die Cecilys Arm umklammerte. Sie war hübsch anzusehen mit ihrem blonden Haar und den blauen Augen, doch die Augen wirkten kalt. Ihr üppiger Körper kam in einem prachtvollen dunkelroten Gewand gut zur Geltung, aber Artan vermutete, dass diese Pracht die reine Vergeudung war bei dieser Frau, deren Blut bestimmt so kalt war wie ihre Augen. In ihrer Stimme und in ihrem Auftreten zeigte sich eine Spur Verzweiflung. Artan fragte sich sofort, welchen Nutzen sie wohl aus Cecilys Hochzeit zog.
Er blickte wieder auf Cecily. Sie wirkte etwas gepeinigt, und Artan musste dem Drang widerstehen, Lady Anabels reich beringte Finger von Cecilys schlankem Arm zu lösen. In ihrer Miene konnte er nichts entdecken, was auf die Freude schließen ließ, die eine Braut normalerweise vor ihrer Hochzeit empfand. Er hoffte, dass er sich nicht etwas vormachte, aber er hatte den Eindruck, dass sie diese Ehe nicht freiwillig einging.
»Wen heiratet Ihr denn, Sile?«, fragte er, sie mit der gälischen Form ihres Namens ansprechend.
»Mich!«
Ein Blick reichte Artan, um zu erkennen, dass ihm der Mann, der neben Lady Anabel getreten war und Cecily für sich beanspruchte, weder sympathisch noch vertrauenswürdig erschien. Er nahm sich reichlich Zeit, auf den Kerl herabzublicken, der fast einen Kopf kleiner war als er, und freute sich, als eine leichte Zornesröte auf die bleichen Wangen des Burschen trat. Er sah aus wie einer der habgierigen Speichellecker, die ständig um den König herumscharwenzelten, und er roch auch wie einer, befand Artan, als ihm das schwere Parfüm in die Nase stieg, das gern großzügig auf einen unsauberen Körper verteilt wurde.
»Und wer seid Ihr?«, fragte er.
»Ich, Sir, bin Sir Fergus Ogilvey«, erwiderte der Mann und hob sein schwach ausgeprägtes Kinn hoch genug, um einen stechenden Blick auf Artan zu werfen.
»Ich habe noch nie von Euch gehört.« Artan wandte sich von dem leise murrenden Kerl ab und blickte wieder auf Cecilys Arm, der sich nach wie vor in Lady Anabels Klammergriff befand. Unter den spitzen Nägeln breiteten sich dunkle Stellen aus. »Lasst sie los, Ihr habt ihr mit Euren Nägeln die Haut aufgeritzt!«, herrschte er Anabel an.
Cecily atmete erleichtert auf, als Anabel dem schroffen Befehl folgte. Sie rieb sich den Arm, wo sich am nächsten Tag sicher ein farbenprächtiger Bluterguss zeigen würde. Sie hoffte nur, dass es bald zu bluten aufhörte, damit das erste neue Kleid, das man ihr seit vielen Jahren gegeben hatte, nicht ruiniert war. Ihr Blick schweifte von Fergus auf Sir Artan. Sie seufzte, als ihr der deutliche Unterschied zwischen den beiden schmerzhaft bewusst wurde. Neben Sir Artan wirkte Fergus noch kleiner und bleicher, als er eigentlich war.
»Wann soll die Hochzeit stattfinden?«, fragte Artan.
»In zwei Wochen«, erwiderte Fergus und verschränkte die Arme vor der schmalen Brust. »Heute ist der erste Tag der Feierlichkeiten.«
»Dann sollte man mir meine Gemächer zeigen, damit ich mir den Staub der Reise abwaschen und mich zu Euch gesellen kann.«
»Ich glaube nicht, dass Ihr eingeladen worden seid«, fauchte Anabel.
»Eure Unhöflichkeit blieb nicht unbemerkt, doch ich verzeihe Euch.« Artan lächelte Cecily an, als diese überrascht kicherte, bemerkte jedoch, dass sie nach einem einzigen stechenden Blick von Lady Anabel gleich wieder ernst wurde.
»Aber natürlich bleibt er, meine Liebe«, erklärte Sir Edmund, der mittlerweile ebenfalls zu ihnen getreten war. »Cecilys Onkel mütterlicherseits hat ihn zu uns geschickt. Es wäre eine Beleidigung, wenn wir ihn unhöflich behandelten.« Er lächelte Artan an. »Ihr könnt in den Gemächern des Lairds übernachten, und dann nach Glascreag zurückkehren und dem guten Mann einen ausführlichen Bericht über die Hochzeit seiner Nichte erstatten.« Er klopfte Sir Fergus auf den Rücken. »Und jetzt« – er winkte eine vollbusige, blonde Magd herbei – »wird sich Davida um Euch kümmern. Das Mahl wird in einer Stunde aufgetragen.«