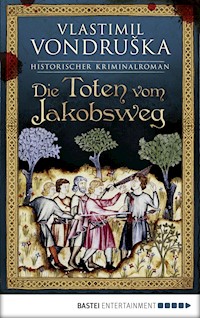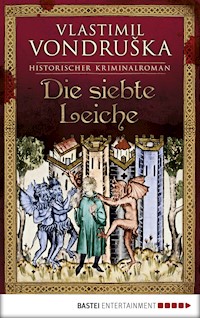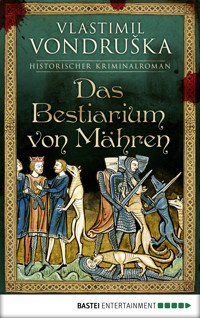
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Mähren im 13. Jahrhundert: Im Wald nahe des Dörfchens Schoschuwka wird eine Tote mit aufgerissener Kehle gefunden, und sie ist nicht die erste. Die Dorfbewohner sind überzeugt, dass einer unter ihnen sich des Nachts in einen Werwolf verwandelt und arglose Frauen tötet. Bald wird der Müller Heralt verdächtigt und von einem aufgebrachten Mob gelyncht. Doch das Morden nimmt kein Ende - bis der königliche Prokurator Ulrich von Kulm sich auf die Jagd nach der Bestie begibt ...
Ein Mörder im Wolfspelz - der dritte Fall für Ritter Ulrich von Kulm und seinen Knappen Otto
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Im Wald nahe des mährischen Dorfes Schoschuwka wird eine Tote mit aufgerissener Kehle gefunden, und sie ist nicht die erste. Die Dorfbewohner sind überzeugt, dass einer unter ihnen sich des Nachts in einen Werwolf verwandelt und arglose Frauen tötet. Bald wird der Müller Heralt verdächtigt und von den aufgebrachten Dorfbewohnern umgebracht. Doch das Morden nimmt kein Ende – bis der königliche Prokurator Ulrich von Kulm und sein Knappe Otto sich auf die Jagd nach der Bestie begeben.
Über den Autor
Vlastimil Vondruška, geboren 1955, hat in Prag Geschichte und Ethnologie studiert. Danach arbeitete er im Nationalmuseum und betrieb gemeinsam mit seiner Frau eine Werkstatt zur Nachbildung von historischem Glas. Heute widmet er sich ganz dem Schreiben und hat neben zahlreichen wissenschaftlichen Werken über 30 Historische Romane veröffentlicht. Mit einer Gesamtauflage von 500.000 Exemplaren gehört er zu den erfolgreichsten Autoren Tschechiens. Besonders beliebt ist die Serie um den Ritter Ulrich von Kulm und seinen Knappen Otto.
Vlastimil Vondruška
DAS BESTIARIUMVON MÄHREN
Historischer Kriminalroman
Aus dem Tschechischen vonSophia Marzolff
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2006, 2010 by Vlastimil Vondruška
Titel der tschechischen Originalausgabe: »Olomoucký bestiář«
Originalverlag: Moravská Bastei MOBA, s. r. o., Brno
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Hanna Granz, Herzberg am Harz
Titelillustration: © Science Photo Library/akg-images
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-6144-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
MEINER FRAU ALENAGEWIDMET
PERSONEN
Ulrich von Kulm: Königlicher Prokurator und Verwalter von Burg Bösig
Otto von Zastrizl: Knappe des königlichen Prokurators
Wolfgang: Schreiber des königlichen Prokurators
Zirro von Hohlenstein: Burgherr
Hartman von Hohlenstein: Zirros Sohn
Heralt: Müller aus Schoschuwka
Mischka: Nichte des Müllers
Michael: Kaufmann in Raitz
Radana: Michaels Tochter
Šonka: Magd auf Burg Hohlenstein
Erhard: Burgwächter von Hohlenstein
Bruno von Schauenburg: Bischof von Olmütz
Idik von Schwabenitz: Burggraf von Blanseck
Militsch von Schwabenitz: Vater von Burggraf Idik
Paul von Eulenburg: Offizial
Zwoisch von Rabensberg: bischöflicher Kanzler
Walther: Krämer
Jan: Burggraf von Olmütz
Katharina: eine Witwe
Maestro Signoretti: Gaukler
Ordonatus: Apotheker
I. KAPITEL
Es war ein warmer, heller Abend im Frühsommer. Schon seit Tagen schien die Sonne, und am Himmel war kein einziges Wölkchen zu sehen. Die Dörfler, die auf den gerodeten Waldlichtungen rings um Burg Hohlenstein lebten, waren zufrieden, denn alles deutete darauf hin, dass Gott ihnen dieses Jahr eine besonders gute Ernte schenken würde. Und sie fanden, dass sie die nach den vielen Jahren der Entbehrungen auch verdient hatten. Den Wald abzuholzen und in urbares Land zu verwandeln war harte Arbeit gewesen. Als sie vor fünfzehn Jahren mit ihrem Burgherrn Zirro in die Hügel des Drahaner Berglands gezogen waren, hatten sie nicht geahnt, welche Notzeiten auf sie zukommen würden. Doch das lag nun hinter ihnen. Jetzt hatten sie ihre kleinen Häuser, und auf den Feldern färbte sich das Getreide golden.
Zirro von Hohlenstein war kein schlechter Herr, und gewiss war er besser als Idik von Schwabenitz, der nicht weit entfernt auf Burg Blanseck residierte und im Namen des Bischofs von Olmütz mehrere Dörfer im Flusstal der Zwitta verwaltete, ein Gebiet, das vom alten Herrschaftssitz Blanz bis fast nach Boskowitz reichte. Während Burggraf Idik die Kirche vertrat, forderte Zirro von seinen Untertanen keine allzu große Frömmigkeit. Auch machte er ihnen hin und wieder Zugeständnisse, etwa indem er sie in den tiefen Wäldern lehensfrei Holz schlagen ließ. Die Hänge des Berglands waren so dicht bewaldet, dass er es ohnehin nicht bemerkt hätte, wenn sie heimlich gerodet hätten.
Schon seit dem Mittag zogen die Männer von Schoschuwka mit zwei Paar Ochsen Baumstämme aus dem Wald, säuberten sie von Ästen und hackten sie zu groben Scheiten, um einen hohen Holzstoß aufzuschichten. In Mähren war es Brauch, zur Sommersonnenwende große Feuer zu entfachen. Der frühere Pfarrer von Schoschuwka hatte den Dörflern zwar mit ewiger Verdammnis gedroht – alles, was an heidnische Zeiten erinnerte, war ihm ein Dorn im Auge –, doch der neue Pfarrer Hilarius begnügte sich mit der Ermahnung, dass am Tag der Sonnenwende Johannes der Täufer geboren sei, weshalb es das Andenken des Heiligen nicht nur mit frommem Gebet, sondern auch mit einer feierlichen Messe zu ehren gelte. Und Zirro von Hohlenstein, der nicht auf Ärger mit der bischöflichen Nachbarschaft erpicht war, behauptete, seine Untertanen würden die Feuer zu Ehren Johannes’ des Täufers abbrennen. Er wusste zwar gut, dass das nicht stimmte, aber Bruno von Schauenburg, der sich breitmachende Bischof von Olmütz, bereitete ihm schon genug Scherereien, da wollte er sich nicht wegen einer Belanglosigkeit wie ein paar Feuern noch weiteren Verdruss zuziehen. Hätte er seinen Untertanen die Sonnenwendfeuer verboten, hätten sie ihm doch nicht gehorcht.
»Wir müssen den größten Haufen errichten«, keuchte der Dorfschulze Dippold, der mit einem riesigen Holzscheit in den Armen oben auf dem Stoß balancierte. In Schoschuwka entzündete man das Feuer auf der Anhöhe hinter dem Dorf, damit es von fern zu sehen war.
»Unserer ist immer der größte«, erwiderte Hubatsch mit Stolz in der Stimme. Der dicke Bauer besaß einen ansehnlichen Hof am Dorfrand und wurde von den anderen beneidet, weil er vier Söhne hatte und daher ganz anders wirtschaften konnte als sie.
Vom Waldrand her tauchten die Jungochsen mit zwei weiteren Baumstämmen auf. Der von der Arbeit verschwitzte Kresta schnallte die Stämme ab und tätschelte den Tieren freundlich den Kopf. Die Ochsen wandten ihm ihre tiefschwarzen Augen zu, als wollten sie ihn fragen, ob sie umkehren und noch mehr Holz holen sollten. Das brachte Kresta zum Lachen. Er rief dem Dorfschulzen zu, dass es nun wohl genug sei.
Bevor Dippold etwas darauf antworten konnte, ertönte hinter ihnen lautes Geschrei, und im nächsten Moment tauchte Hubatschs Sohn Mikesch aus dem Unterholz auf. Wie alle Männer im Dorf trug er lediglich ein Leinengewand mit einem groben Strick um die Taille. »Der Werwolf!«, schrie er, während er auf die Männer am Holzstoß zurannte.
Sofort packten alle ihre Äxte, um sich verteidigen zu können, falls das Ungeheuer auftauchen sollte.
Der Dorfschulze rief: »Was sagst du da? Wo?«, und versuchte so schnell wie möglich vom Holzstoß herunterzusteigen, stolperte aber in der Aufregung und fiel geradewegs hinunter. Normalerweise hätte er brüllendes Gelächter geerntet, so aber achtete kaum jemand auf ihn. Alle standen mit weichen Knien da, und das Herz schlug ihnen bis zum Hals. Der Werwolf trieb wieder sein Unwesen!
»Die Mutter«, schrie der junge Bursche mit schreckgeweiteten Augen und blieb keuchend stehen, »er hat sie getötet!« Er war den ganzen Weg bergauf gerannt, und seine nackten Unterschenkel waren von Dornen blutig zerkratzt.
»Sie ist tot?«, fragte sein Vater heiser. Er ließ die Hand sinken und die Axt zu Boden fallen. Unwillkürlich bekreuzigte er sich und murmelte leise vor sich hin. Er hatte seine Kathrein geliebt.
Mikesch nickte stumm. Dann wandte er sich an den Dorfschulzen und begann atemlos zu erzählen, wie er und seine Brüder den Werwolf bei der Mutter hätten knien sehen. Obwohl sie schreckliche Angst gehabt hätten, seien sie losgerannt, um ihr zu helfen. Als der Werwolf sie hörte, war er aufgesprungen und weggelaufen, doch der Mutter war nicht mehr zu helfen gewesen. Wie den anderen Frauen vor ihr, hatte er ihr die Kehle durchgebissen. Also hatten sie ihre Leiche dort liegen gelassen, Mikeschs Brüder waren dem Werwolf gefolgt und er selbst hierhergelaufen.
»Hoffentlich tut die Bestie ihnen nicht auch noch etwas an«, sagte einer der Männer, die schreckensbleich vor dem Holzstoß standen und die furchtbare Nachricht angehört hatten. Insgeheim waren sie aber auch erleichtert, dass ihren eigenen Familien nichts passiert war.
»Was steht ihr noch herum?«, schrie Dorfschulze Dippold. »Diesmal erwischen wir ihn!«
»Sollten wir nicht zuerst zum Pfarrer laufen, damit er sein Weihwasser mitbringt?«, warf Kresta ein, denn er wusste, dass mit den Dämonen des Waldes nicht zu spaßen war.
Da erwachte Bauer Hubatsch aus seiner dumpfen Apathie. Er nahm seine Axt vom Boden und blickte herausfordernd in die Runde. »Sind wir Mannsbilder oder jämmerliche Wichte, die sich hinter dem Rockzipfel des Pfarrers verstecken?«
Und Dorfschulze Dippold fuhr Kresta schroff an: »Wenn du dich fürchtest, dann lauf zum Pfarrer. – Komm, Mikesch, zeig uns den Weg!«
Kurz darauf folgte das Grüppchen dem schmalen Trampelpfad durch den Wald. Kresta band die Jungochsen rasch an einer Espe fest und eilte den anderen hinterher – nicht, weil er seine Meinung geändert hätte, sondern weil er den Hohn der anderen mehr fürchtete als den Werwolf.
Der alte Hubatsch lief trotz seiner Beleibtheit mit dem Schulzen vorneweg. Er drehte sich zu seinem Sohn um und fragte schnaufend: »Was hat die Mutter denn im Wald gemacht?«
»Sie ist heute Morgen zum Bach gegangen, um Wäsche zu bleichen. Dabei muss es ihr ein Hemd fortgeschwemmt haben, und sie ging es wohl suchen, denn als wir Mutter fanden, hatte sie eines in der Hand …«
»Vermaledeites Hemd!«, fluchte der alte Hubatsch und wurde furchtbar wütend auf sich selbst. Es war noch keinen Monat her, da hatte er seine Frau verprügelt, weil sie das Sätuch verloren hatte. Seine Kathrein war oft zerstreut gewesen. Tränen stiegen ihm in die Augen. Wenn sie diesen Werwolf erwischten, dann gnade ihm Gott!
Die Männer eilten hangabwärts durch den Wald zu dem kleinen Bach und liefen das grasbestandene Ufer entlang bis zu der Stelle, wo die tote Frau mit der blutig aufgerissenen Kehle lag. Die meisten Dörfler wandten den Blick ab, auch der alte Hubatsch. Sie eilten weiter, folgten der Biegung des Baches und kamen durch einen lichten Laubwald. Dort, wo Mikeschs Brüder den Werwolf verfolgt hatten, war das hohe Gras niedergetrampelt, weshalb die Fährte leicht zu erkennen war. An den Blättern einer jungen Birke waren sogar ein paar Blutstropfen zu sehen.
Die Männer verlangsamten ihr Tempo, denn allmählich gerieten sie außer Atem. Das sommerliche Wetter ließ sie schwitzen, und der grobe Leinenstoff klebte ihnen am Leib. Die besondere Erregung der Jagd hatte sie erfasst, und sie hatten keine Angst mehr. Die Äxte fest umklammert, stapften sie durch das Dickicht, den Blick stets nach unten gerichtet, um nicht über eine Wurzel zu stolpern.
»Da seid ihr!«, hörten sie weiter vorn eine Stimme. Hubatschs jüngster Sohn Bendikt kam ihnen entgegengelaufen.
Dippold blieb keuchend stehen. »Was ist passiert? Ist er euch entwischt?«, schnaufte er mit finsterer Miene.
Der Junge schüttelte den Kopf. »Nein. Und wir wissen jetzt, wer der Werwolf ist. Es ist der Müller Heralt! Wir haben ihn erkannt. Er ist in die Mühle gerannt. Meine Brüder bewachen sie, damit er nicht fliehen kann.«
Schon eilte die Schar der Dörfler wieder los. Jetzt mussten sie nicht mehr nach niedergetrampeltem Gras Ausschau halten, sondern nahmen den bequemeren Weg das Bachufer entlang, vorbei an dem hellen Kalksteinfelsen, über den der Bach einige Klafter in die Tiefe rauschte. Unterhalb des Felsens stand auf einer hellen Lichtung das hölzerne Mühlgebäude. Müller Heralt war bei den Dorfbewohnern nicht besonders beliebt. Er galt als Miesepeter und tauchte nur selten in der Schenke auf. Erst vor wenigen Jahren war er mit der Familie seines Bruders nach Schoschuwka gekommen, und nachdem die Frau seines Bruders gestorben und sein Bruder verschwunden war, war er allein mit seiner Nichte Mischka zurückgeblieben.
Sobald die Mühle in Sichtweite kam, verlangsamten die Dörfler ihren Schritt. Dort irgendwo lauerte der Werwolf, und auch wenn sie sich gemeinsam stark fühlten, blieben sie doch auf der Hut. Nur der junge Bendikt drängte zur Eile. Er winkte seinen Brüdern zu, die mit ein paar anderen jungen Männern aus dem Dorf, die sich ebenfalls der Verfolgung angeschlossen hatten, in der Nähe der Mühle standen. Die Jünglinge machten keinen ängstlichen Eindruck und gebärdeten sich eher so, als sei das Ganze ein großer Spaß, so wie Jugend eben zum Leichtsinn neigt.
Mit dem Dorfschulzen vorneweg näherten sich die Männer dem Mühlhaus und blieben vor der verschlossenen Tür stehen.
Hubatsch rief: »Müller, komm heraus!«
Von drinnen war kein Laut zu hören. Es war, als wäre die Mühle leer und verlassen.
»Er ist da drin!«, versicherte einer der jungen Männer, die zu ihnen herüberspähten.
Dippold versuchte die Tür zu öffnen, aber sie war von innen verriegelt. Er hämmerte mit den Fäusten dagegen und befahl dem Müller mit scharfer Stimme, sofort die Tür aufzumachen. Die einzige Antwort war Stille.
Niemand hatte mitbekommen, von wo sie aufgetaucht war, doch auf einmal stand neben ihnen Mischka, die Nichte des Müllers. Die schwarzlockige junge Frau mit dem hübschen Gesicht hielt eine Schüssel mit Waldbeeren in der Hand.
»Was ist hier los?«, fragte sie schroff, doch die angespannten Mienen der Dörfler verunsicherten sie.
Bauer Hubatsch brüllte: »Die Nichte des Werwolfs! Haltet sie fest, dass sie nicht entkommt!«, und im nächsten Moment hatten die Männer sie auch schon umringt. Hubatsch wandte sich zur Tür und schrie: »Wir haben deine Nichte, Müller! Wenn du nicht aufmachst, erwürge ich sie hier und jetzt mit meinen eigenen Händen, das schwöre ich dir!«
Kurze Zeit regte sich immer noch nichts. Dann ertönte ein leichtes Knacken, und die Tür der Mühle öffnete sich. Ein großer, hagerer Mann erschien auf der Schwelle. Die Dörfler wichen erschrocken zurück. Zwar erkannten sie den Müller Heralt, doch er sah verändert aus. Der Dämon, der sich seiner bemächtigt hatte, hatte ihn noch in seiner Gewalt, das Untier hatte sich noch nicht ganz in einen Menschen zurückverwandelt. Die lange Nase des Müllers ragte aus seinem Gesicht wie eine Wolfsschnauze, die sonst glatt rasierten Wangen waren von struppig wucherndem Barthaar bedeckt, die grausamen schmalen Lippen standen leicht offen und entblößten spitze gelbliche Zähne. Doch am meisten Furcht flößte den Dörflern sein Blick ein, der nichts Menschliches mehr besaß. Zu alledem trug der Müller ein zerfetztes Leinengewand, das über und über mit Blut befleckt war. Sein ganzer Anblick war so grausig, dass selbst seine Nichte Mischka sich die Hand vor den Mund schlug, um nicht aufzuschreien.
Der zum Wolf gewordene Müller blieb in der Tür stehen, und sein Blick irrte umher wie ein Tier, das ein Schlupfloch in der Erde sucht, durch das es verschwinden kann. Er hob die Arme, und die Dörfler sahen seine schmutzigen langen Krallen. Eine Weile stand er nur so da, dann versuchte er, etwas zu sagen. Es schien ihm schwerzufallen wie jemandem, der lange nicht gesprochen hat. »Lasst sie los.«
In diesem Moment sprang Dippold auf den Werwolf zu und schlug ihm mit der stumpfen Seite seiner Axt heftig auf den Kopf. Mit einem Schrei sank der Müller zu Boden. Darauf stürmten mehrere andere auf ihn los, um mit ihren Äxten und Knüppeln auf ihn einzuschlagen, doch der alte Hubatsch hielt sie zurück. »Halt!«, schrie er. »Lasst ihn uns lieber auf dem Scheiterhaufen verbrennen! Nur Feuer kann einen Dämon vernichten! Wir haben Sonnenwende, und das Brandopfer wird die Geister des Waldes besänftigen.«
Seine Worte überzeugten die Dörfler, die von dem am Boden Liegenden abließen. Niemand konnte schließlich leugnen, dass im Wald Geister, Feen und Dämonen lebten und es besser war, sich mit ihnen gut zu stellen. Mochte ihr Pfarrer Hilarius predigen, was er wollte, sie wussten es besser. Also fesselten sie den Werwolf.
»Und was ist mit ihr?«, fragte einer und deutete auf Mischka, die immer noch von drei jungen Männern festgehalten wurde. Die Jünglinge wussten, wie stark sie war und wie schnell sie laufen konnte, denn wenn es im Dorf eine spaßhafte Rangelei gab, gewann Mischka über die meisten Burschen schnell die Oberhand, obwohl sie nicht besonders groß war.
»Fesselt sie ebenfalls und bringt sie in die Mühle. Wir werden sie dort verbrennen!«, sagte Dippold kurzentschlossen.
Die Jünglinge zögerten und schwiegen, und Hubatschs Jüngster, Bendikt, fragte, ob das wirklich nötig wäre, Mischka sei doch ein nettes, liebes Mädel.
Der Dorfschulze fuhr ihn an: »Aber ihr Onkel hat deine Mutter getötet! Und das Wölfische liegt ihr im Blut! Wenn sie einst ein Kind bekommt, wird dieses wieder ein Werwolf, begreifst du das denn nicht?«
Die Söhne mussten den Vätern gehorchen. Sie waren vielleicht nicht ihrer Meinung, wagten aber nicht, sich ihnen zu widersetzen. Also brachten sie die gefesselte Mischka in die Mühle und vernagelten von außen Fenster und Türen. Dann legten sie rund um die Mühle Stroh aus und gossen Holzteer darüber, den sie in einem Fass im Werkzeugschuppen gefunden hatten. Der alte Hubatsch entzündete das Feuer. Da die Holzwände und das Reetdach der Mühle von der Sonne so ausgetrocknet waren, stand das Gebäude innerhalb weniger Minuten in Flammen. Die Dörfler verharrten in einigem Abstand und sahen schweigend zu, wie das Feuer sich ausbreitete und das ganze Gebäude verzehrte.
Als schließlich der Dachstuhl in sich zusammenstürzte und der Brand allmählich kleiner wurde, knieten sie auf dem Boden nieder und beteten für die Seele der armen Mischka. Den gefesselten Müller banden sie mit Händen und Füßen an eine Wagendeichsel und trugen ihn wie ein erlegtes Wild den Hügel hinauf, bis zu ihrem bereits aufgeschichteten Holzstoß. Lediglich zwei Männer blieben bei der schwelenden Ruine der Mühle zurück, um aufzupassen, dass von den glimmenden Resten kein Funke auf den Wald übersprang.
In dieser Nacht brannte auf der Anhöhe über Schoschuwka ein großes Feuer. In der Mitte des Scheiterhaufens stand ein Pfahl, an den der wölfische Müller gefesselt war. Als man ihn kurz vor seinem Tod aufforderte, zu beichten oder zu beten, blieb er stumm, als hätte er nichts gehört. Der Dämon, so schien es, hatte ihn noch immer in seiner Gewalt und schenkte ihm sein menschliches Antlitz nicht mehr zurück. Und so schrie und jammerte der Müller nicht, als die Flammen seinen Leib verschlangen, sondern heulte nur wie ein sterbendes Tier.
Eine Woche war vegangen, als eine Frau aus Schoschuwka, die im Wald hinter dem Dorf Honig aus Bienenstöcken sammeln wollte, zwei Gestalten im Dickicht erblickte. Sie schwor, es seien der tote Müller und seine Nichte gewesen, doch niemand schenkte ihr Glauben. Zwei Tage später meinte Hubatschs Sohn Bendikt den Geist der Nichte zu sehen. Er lief ihr nach, doch im nächsten Moment war sie verschwunden, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Da breitete sich Furcht aus im Dorf.
Die Bewohner verschlossen am Abend ihre Häuser und legten Zauberkräuter und Amulette vor Türen und Fenster, die sie vor den unheilvollen Kräften der Dunkelheit schützen sollten. Sie vermieden es, in den Wald zu gehen, und wenn doch einmal einer dorthin musste, ließ er sich von Nachbarn begleiten, die Äxte dabeihatten. Das Kräuterweib kam kaum damit nach, kleine Skapulire als Gegenzauber anzufertigen. Und alle fragten sich bang, wann der Werwolf erneut zuschlagen würde.
Es sollte nicht lange dauern. Ein Bauer aus dem Nachbardorf Slaup, der auf dem Rückweg vom Blanzer Markt bei ihnen vorbeikam, erzählte, dass nicht weit von Burg Blanseck die Schwägerin des Burggrafen Idik von Schwabenitz tot aufgefunden worden sei. Ein Werwolf habe ihr die Kehle aufgerissen. Obwohl es eine schreckliche Nachricht war, atmeten die Bewohner von Schoschuwka auf. Das Ungeheuer hatte zuvor nur in ihrem Dorf gemordet, und Burg Blanseck war immerhin über drei Fußstunden entfernt. Sie beteten im Stillen, der Werwolf möge auf dem Territorium des Bischofs bleiben und sie selbst endlich in Ruhe lassen.
II. KAPITEL
Auf dem Weg nach Raitz kamen drei Reiter vor der Furt über die Zwitta zum Stehen. Der Älteste von ihnen war ein kleiner Mann mit Buckel, der einen altmodischen grünen Umhang trug. Auch sonst war er keine Schönheit, mit seinem spitzen Näschen und dem ausdruckslosen Mund, doch sein wacher Blick zeugte von Intelligenz. Er saß recht unsicher auf seinem Pferd, jammerte ohne Unterlass und verhielt sich, obwohl er noch keine vierzig Jahre alt war, wie ein alter Mann, der mit einem Fuß im Grabe steht. Sein Name war Wolfgang, und er war einst ein Wundheiler gewesen, doch seit den Mordfällen auf Burg Grafenstein stand er als Schreiber in den Diensten des königlichen Prokurators Ulrich von Kulm, den er auch jetzt begleitete.
Sein Herr war ein hochgewachsener Mann von rund dreißig Jahren, mit markanten Gesichtszügen und einem struppigen dunklen Bart. Seine dichten Augenbrauen verliehen ihm einen strengen Ausdruck, und auch wenn kein Geschlechterwappen seinen Umhang zierte, bestand kein Zweifel, dass es sich um einen bedeutenden Mann handelte.
Der Dritte im Bunde war ein junger Mann, nicht weniger groß, allenfalls ein wenig schlanker als der königliche Prokurator. Sein blondes Haar trug er nach deutscher Mode etwas länger und gewellt, er hieß Otto von Zastrizl und stand als Knappe in Ulrichs Diensten. Hinter sich her führte er ein viertes Pferd, das mit Reisesäcken beladen war. Während die beiden Edelleute an ihren Gürteln Schwerter trugen, war der Bucklige im grünen Umhang es sichtlich nicht gewohnt, eine Waffe zu tragen, geschweige denn zu benutzen, und das Jagdmesser, das er dabeihatte, hing viel zu tief an seinem Gürtel.
Ulrich stieg von seinem Pferd und streckte sich ausgiebig, dann sagte er zu Otto: »Solche langen Reisen sind eigentlich nichts mehr für mich …«
»Ganz meine Rede! Wir hätten längst Pause machen sollen!«, beschwerte sich Wolfgang mit seinem starken deutschen Akzent, den er nicht losgeworden war, obwohl er schon vor vielen Jahren aus der Lausitz nach Nordböhmen gezogen war. Der kleine Mann rutschte aus seinem Sattel und setzte sich ins Gras. Er war lange Ritte nicht gewohnt und hatte lauthals protestiert, als er hörte, dass er Burg Bösig, den Verwaltungssitz seines Herrn, verlassen sollte, denn er hielt es für ein verrücktes Unterfangen, von Nordböhmen bis nach Mähren zu reiten. Doch als sein Schreiber musste er seinem Herrn wohl oder übel gehorchen.
Otto sprang seinerseits schwungvoll vom Pferd und warf Ulrich einen amüsierten Blick zu: »Wenn unser König Ottokar Euch hören könnte, mein Herr, wie Ihr beinahe ebenso lamentiert wie unser Schreiber Wolfgang, würde er Euch wohl verspotten …«
Otto war Anfang zwanzig und eigentlich nicht mehr in dem Alter, ein Knappe zu sein, streng genommen war er es auch nicht. Er diente Ulrich von Kulm schon so lange, dass er zu dessen engsten Vertrauten gehörte, und oft hatte er ihm bei der Aufklärung komplizierter Fälle geholfen. Deshalb konnte er sich auch mehr herausnehmen, als es sich für einen Knappen ziemte. Der königliche Prokurator nahm ihn so, wie er war, und sah in ihm eher einen jüngeren Freund als einen Diener. Ulrich mochte auch seinen Schreiber, denn Wolfgang war nicht nur klug, sondern auch ein ehrbarer, empfindsamer Mensch – wenn auch nervöser Natur und zum Wehklagen neigend. Bis zu einem gewissen Grad konnte Ulrich ihn verstehen, denn wegen seiner buckligen Gestalt hatte er es im Leben nie leicht gehabt, nichts konnte schließlich grausamer sein als menschliche Dummheit und Vorurteile.
Während Wolfgang seinen steifen Nacken massierte, murmelte er, wenn er geahnt hätte, wie strapaziös diese Reise werden würde, wäre er lieber in die Wälder abgetaucht und hätte sich einer Räuberbande angeschlossen. Und als erstes Opfer hätte er Otto überfallen, weil dieser es nicht anders verdiene.
Otto erwiderte amüsiert, dass er sich mit Freuden von ihm überfallen lassen würde, weil er dann wenigstens etwas zu lachen hätte. Die Vorstellung, wie der Schreiber Wolfgang maskiert und mit seinem Jagdmesser in der Hand aus einem Gebüsch hervorspringe und lautstark Geld oder Leben fordere, sei einfach gar zu lustig. Wolfgang zog eine Grimasse, war aber nicht wirklich beleidigt, denn während seiner Zeit auf Burg Bösig hatte er sich an Ottos gutmütige Sticheleien gewöhnt. Außerdem war ihm bewusst, dass er kein einfacher Reisegefährte war und ihr Grüppchen eher aufhielt. Aber er hatte ja auch nicht darum gebeten, mit nach Mähren zu reiten!
»Mach dir nichts draus, es war auch nicht mein Wunsch, hierherzureisen«, sagte Ulrich beschwichtigend. »Aber selbst ich muss gehorchen, wenn der König sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Ich halte zwar das ganze Unterfangen für recht sinnlos, aber versuche einer, König Ottokar etwas auszureden!«
Ulrich zog eine Pergamentrolle aus seiner Satteltasche, setzte sich auf einen Felsbrocken und entrollte das Schriftstück. In seiner Jugend hatte er die Klosterschule in Magdeburg besucht, wo er nicht nur Lesen und Schreiben, sondern auch Latein und Deutsch gelernt hatte sowie weitere nützliche Dinge, die Rittersleute gewöhnlich verachteten, da ihnen die Schwertkunst als einzige wichtig erschien. Für sein Amt des königlichen Prokurators war Gelehrsamkeit jedoch von unschätzbarem Nutzen.
Dennoch war Ulrich kein verkopfter Gelehrter, sondern auch im Kampf mit der Waffe versiert und ein gefährlicher Gegner. Aus diesem Grund hatte er sich auch die Gunst des manchmal recht wankelmütigen und eigensinnigen Königs erworben, der außer den Frauen nichts so sehr bewunderte wie ritterliche Tugenden. Obwohl Ulrich keiner bedeutenden Familie entstammte, hatte Přemysl OttokarII. ihm ein wichtiges Landesamt anvertraut, denn er schätzte ihn wegen vieler guter Eigenschaften, am meisten jedoch für seine Treue, eine am Königshof eher rare Tugend. Offiziell huldigten zwar alle Edelleute und Kleriker dem Herrscher, doch in Wahrheit kümmerte sich jeder nur um seine eigenen Interessen.
Ulrich studierte eine Weile das Pergament, dann erklärte er lächelnd: »Wir haben uns nicht verirrt. Diese Furt hier kommt in der Wegbeschreibung vor. Wenn alles gut läuft, werden wir heute Abend Burg Hohlenstein erreichen.«
»Gott sei’s gepriesen«, sagte Wolfgang und bekreuzigte sich. Doch gleich darauf verfinsterte sich seine Miene. »Wollt Ihr damit sagen, mein Herr, dass wir uns noch bis zum Abend auf dem Pferderücken abplagen müssen?«
»Und zwar im Galopp«, ergänzte Otto schadenfroh. »Schließlich müssen wir ankommen, bevor auf der Burg das Abendessen ausgegeben wird, wenn wir noch etwas abbekommen wollen. Mein Magen knurrt jetzt schon so laut, dass sich selbst unsere Bösiger Köchin meiner erbarmt hätte. Und die ist die knauserigste der ganzen Christenheit!«
»Verwechsele nicht Knauserei mit Ordnung«, bemerkte Ulrich amüsiert.
»Ich an ihrer Stelle hätte kein Mitleid mit Otto«, murmelte Wolfgang. Er erhob sich vom Boden und ging ein paar kleine Schritte, um seine schmerzenden Waden zu lockern. Dann blieb er stehen und band seinen Stiefel auf, in dem ihn ein Steinchen drückte. Plötzlich erklang lautes Gepolter, er blickte erschrocken auf und sprang schnell ins Unterholz.
Ein voll beladenes Fuhrwerk, das von zwei Paar Pferden gezogen wurde, kam über den Weg auf sie zu, dem Aussehen nach der Wagen eines Händlers. Auf dem Bock saß ein rothaariger Kutscher, und neben dem Wagen schritten der Kaufmann in einem Mantel aus blauem Tuch und zwei ebenfalls gut gekleidete Gehilfen. Als der Kaufmann Ulrich und seinen Knappen erblickte, legte er die Hand auf den Griff seines Messers und raunte seinen Leuten etwas zu.
In Zeiten wie diesen konnte man nicht vorsichtig genug sein, und die Route von Prag nach Olmütz war berüchtigt, da große Teile des Weges durch tiefe, unbewohnte Wälder führten, in denen nicht nur gewöhnliche Räuberbanden, sondern auch Gruppen von Raubrittern ihr Unwesen trieben. Und wenn man als wehrloser Händler von Räubern überfallen wurde, konnte es einem einerlei sein, ob diese von edler Herkunft waren oder nicht, denn sie standen einander an Grausamkeit in nichts nach.
Ulrich wandte sich wieder seinem Schriftstück zu – nicht, weil er sich noch einmal den Weg einprägen wollte, sondern um dem Kaufmann zu signalisieren, dass er sich weder für ihn noch für seine Waren interessierte. Währenddessen stapfte Wolfgang wieder aus dem Dickicht und breitete seine Arme aus, um deutlich zu machen, dass er keine feindlichen Absichten hegte – was Otto wiederum äußerst belustigte.
Das Fuhrwerk holperte über den steinigen Weg und an ihnen vorbei bis zum Flussufer. Dort trieb der Kutscher die Pferde an und begann, mit straffen Zügeln langsam in die Furt hinabzufahren. Der Kaufmann und seine Gehilfen stellten sich daneben ins Wasser und stemmten sich in die Seiten des Fuhrwerks, um die Pferde zu unterstützen. Einen Fluss zu durchqueren ist immer eine mühsame Angelegenheit, und die Zwitta war an dieser Stelle kein seichtes Bächlein.
Kaum war der Wagen in die Furt eingefahren, kamen von Bistritz her vier Reiter angaloppiert, die einen prächtig gekleideten Edelherrn begleiteten. Auf ihren Umhängen prangte das Wappen des Bischofs von Olmütz.
»Aus dem Weg«, rief der Mann, der an der Spitze des kleinen Trupps ritt. »Hier kommt Burggraf Idik von Schwabenitz, auf dem Weg zum bischöflichen Offizial, dem edlen Herrn Paul von Eulenburg! Wir überbringen eine eilige Botschaft!«
Das voll beladene Fuhrwerk befand sich gerade mitten im Fluss. Der Kaufmann und seine Gehilfen schoben mit noch größerer Anstrengung, um es so schnell wie möglich ans andere Ufer zu bekommen, aber eines der Räder war in den sandigen Grund eingesunken. Die Pferde mussten sich mit aller Kraft in die Riemen stemmen und kamen nur mit größter Mühe voran. Der Kutscher knallte mit der Peitsche und trieb sie weiter an, doch es zeigte keine große Wirkung, weil die Tiere nach der langen Strecke erschöpft waren.
»Gebt unverzüglich den Weg frei«, schrie der Kommandeur des Burggrafen erneut.
Ulrich blieb auf seinem Stein sitzen. Er hatte zwar immer noch den Kopf über das Pergament gebeugt, verfolgte die Szene aber mit Neugier. Leise sagte er zu Otto: »Soso, die sind also auf dem Weg zu einem Kollegen … aber sie benehmen sich nicht entsprechend!«
»Zu was für einem Kollegen?«, fragte Otto mit düsterer Miene, denn das Verhalten der Reiter gefiel ihm gar nicht.
»Nun, zu einem von mir«, sagte Ulrich. »Bei uns in Böhmen gibt es das Amt des Offizials nicht. Aber Bruno von Schauenburg hat es für Mähren eingerichtet. Ein Offizial vertritt das Recht innerhalb des Klerus. Und zwar nicht nur auf den bischöflichen Gütern, sondern in der ganzen Diözese. Ursprünglich fiel nur die priesterliche Disziplin in seine Zuständigkeit, doch seit einiger Zeit gelten auch von Geistlichen begangene Diebstähle und Morde als sittliche Vergehen. Der bischöfliche Offizial entscheidet darüber, ob er einen Verbrecher der königlichen oder der bischöflichen Gerichtsbarkeit übergibt. Ich habe sagen hören, dass Bruno von Schauenburg in einigen Fällen ausgesprochen harte Urteile fällt, in anderen wiederum auffallend milde urteilt, wenn es sich nämlich um einen Günstling von ihm handelt.«
Neugierig fragte Otto: »Ihr habt unterwegs gesagt, wir würden wegen des Bischofs verkleidet reiten. Warum eigentlich?«
Ulrich zögerte. »Das erkläre ich dir vielleicht später«, antwortete er. »Hier in Mähren hätte ich sowieso nicht die gleichen Machtbefugnisse wie in Böhmen, selbst wenn ich unter der Standarte des Königs ritte. Bruno von Schauenburg ist zwar ein Vertrauter und Verbündeter unseres Herrschers, trotzdem hat er es nicht gern, wenn sich königliche Beamte in seiner Diözese herumtreiben.«
Unterdessen spitzte sich die Auseinandersetzung am Fluss zu. Das Fuhrwerk des Kaufmanns war nun endgültig im Sand stecken geblieben und blockierte dadurch die Passage. Als Ulrich hörte, dass Burggraf Idik seinen Söldnern befahl, den störenden Wagen umzustoßen, weil er seinen Weg behinderte, erhob er sich, sprang auf sein Pferd und ritt zum Fluss. Gemächlich näherte er sich dem Kommandeur des Trupps und sagte freundlich: »Sollten wir dem Kaufmann nicht lieber helfen? Lasst uns gemeinsam sein Fuhrwerk zum anderen Ufer schieben, dann ist die Furt wieder frei.«
»Was erlaubt Ihr Euch?«, rief Idik von Schwabenitz. Der Burggraf war ein stattlicher, noch junger Ritter, und hätte er seine Miene nicht so grimmig verzogen, wäre er eine gut aussehende Erscheinung gewesen. Er musterte Ulrich verächtlich, und sein Blick streifte schnell sein Schwert. Da er kein Wappen auf seinem Umhang bemerkt hatte, ging er davon aus, dass dieser lästige Unbekannte kein Ritter und Edelmann war und folglich auch nicht mit dem Schwert umzugehen verstand, und so wandte er sich einem seiner Söldner zu und befahl mit kalter Stimme: »Erteile ihm eine Lektion!«
Sogleich ritt der Söldner auf Ulrich zu. Da er von den mäßigen Kampffertigkeiten des wappenlosen Mannes ebenso überzeugt war wie sein Herr, zog er sein Schwert ohne besondere Eile. Im selben Moment drückte Ulrich seinem Pferd die Fersen in die Flanken, preschte ihm entgegen und zog dabei blitzschnell sein Schwert. Der überrumpelte Söldner kam gar nicht mehr dazu, seine Waffe zu heben, da stieß Ulrich ihn schon mit der stumpfen Seite seines Schwerts vom Pferd. Gleich darauf galoppierte Otto zu ihm und schwang seinerseits gekonnt das Schwert, um den Männern deutlich zu machen, dass er sich oft und gerne schlage.
Hinter ihnen am Wegrand kletterte Wolfgang unbeholfen auf sein Pferd, zückte sein Jagdmesser und ritt ebenfalls auf sie zu. Er hatte nicht wirklich die Absicht zu kämpfen, aber er wusste, dass der Anblick eines Buckligen allgemein Furcht erregte, war er doch sein Leben lang dem törichten Aberglauben begegnet, dass missgestaltete Menschen Abgesandte der Hölle seien.
»Was untersteht Ihr Euch? Dafür werdet Ihr hängen!«, schrie Idik von Schwabenitz wütend. Er hätte sich nur zu gern auf ein Gefecht mit den beiden erfahrenen Kämpfern eingelassen – wenngleich er sich über die Fertigkeiten seiner Söldner keine großen Illusionen machte –, aber der Bucklige jagte ihm Angst ein. Und nicht nur ihm, wie er feststellen musste: Seine Männer wichen nervös zurück, einer trieb sogar sein Pferd bis zum Ufersaum der Zwitta, sodass er im Ernstfall durch das Wasser fliehen konnte. Um sein Gesicht nicht zu verlieren, dröhnte Idik noch: »Mein Herr wird auf seinem Territorium keine Willkür dulden!«
»Meiner auch nicht«, entgegnete Ulrich kühl. Und darauf ritt er, ohne sich noch einmal nach dem Burggrafen und seinen Männern umzudrehen, mit Otto und Wolfgang in den Fluss hinein. Als sie sich neben dem Fuhrwerk befanden, glitten er und Otto von den Pferden. Das Wasser reichte ihnen an dieser Stelle knapp über die Taille. Wolfgang blieb klugerweise im Sattel sitzen – da ihm das Wasser vermutlich bis über die Brust gereicht hätte, wäre er ohnehin keine große Hilfe gewesen. Dafür hielt er sein Messer fest in der Hand, als wolle er seine Gefährten damit verteidigen. Der kleine Trupp mit dem Bischofswappen verharrte zögernd am Ufer. So wie es aussah, würde es nicht zu einem Kampf kommen.
Ulrich, Otto, der Kaufmann und dessen Leute stemmten sich mit vereinten Kräften gegen den Wagen, und nach ein paar Anläufen gelang es ihnen, das Rad aus dem Schlamm zu befreien. Schon kurz darauf stand das Fuhrwerk am steinigen Ufer, und die Furt war wieder frei. Der Kaufmann und seine Männer blieben mit gezogenen Messern neben dem Wagen stehen und warteten misstrauisch darauf, dass der Trupp der Bischofstreuen sich näherte. Erst als die vornehm gekleideten Reiter an ihnen vorbeigetrabt waren, um anschließend in Richtung Raitz weiterzugaloppieren, steckten sie die Waffen wieder ein.
Kurz vor der Wegbiegung zügelte Idik von Schwabenitz noch einmal sein Pferd, drehte sich zu Ulrich um und rief aus der Ferne drohend: »Wir sehen uns noch!«
Nachdem er verschwunden war, spuckte der Kaufmann verärgert auf den Boden und stieß einen unflätigen Fluch aus, wie er eigentlich nicht zum Wortschatz angesehener Geschäftsleute und ehrbarer Christen gehörte. Dann machte er eine tiefe Verbeugung und sagte: »Ich danke Euch, edler Herr! Mein Name ist Michael, und ich bin ein redlicher Kaufmann. Um Euch wenigstens geringfügig meine Dankbarkeit zu beweisen, möchte ich Euch gerne zu Speis und Trank einladen, und hoffe aufrichtig, Ihr werdet meine Einladung nicht ablehnen.«
Ulrich zögerte, dann sagte er freundlich: »Eigentlich sind wir in Eile. Wir haben noch einen längeren Weg vor uns.« Mit Blick auf die verlassene Flussgegend fügte er hinzu, hier in der Nähe gebe es ohnehin keine Taverne, in der sie auf ihre zufällige Begegnung anstoßen könnten.
Als hätte er genau auf diesen Einwand gewartet, erwiderte Michael schnell: »Selbstverständlich würde ich nicht wagen, Euch in eine gewöhnliche Taverne einzuladen. Ich möchte Euch bei mir zu Hause bewirten. Ich lebe nämlich in Raitz, edler Herr. Wir müssen nur den nächsten Wald passieren, dann sind wir schon fast da. Ihr werdet sehen, meine Frau kocht hervorragend …«
Ulrich wollte noch einen Einwand äußern, aber der Kaufmann ließ ihn nicht zu Wort kommen, sondern fuhr mit einem vielsagenden Blick auf Otto fort: »Ich habe zu Hause auch eine sehr tüchtige, hübsche Tochter. Meine Frau und sie würden sich sicher sehr über Euren Besuch freuen …«
Da mischte Otto sich schnell ein und sagte scherzhaft, während er seinem Herrn einen ebenso vielsagenden Blick zuwarf: »Na ja, wenn es sich so verhält …«
Als Ulrich auch noch den flehenden Gesichtsausdruck seines Schreibers Wolfgang sah, brachte er es nicht übers Herz, die Einladung auszuschlagen. Im Grunde spielte es keine Rolle, ob sie einen Tag früher oder später ihrem Auftrag nachkamen, schließlich lag der Raubüberfall, den er untersuchen sollte, fast zwei Monate zurück, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch Spuren finden würden, war äußerst gering.
Das hatte er auch zu König Ottokar gesagt, als dieser davon sprach, ihn nach Mähren zu schicken. Aber Přemysl OttokarII. hatte nun mal seinen eigenen Kopf. Fünf Truhen mit Silbermünzen aus preußischer Kriegsbeute waren abhandengekommen, ein Geldschatz, der die ewig leere Kasse des Königs hätte auffüllen sollen. Und diese Truhen waren in Mähren, in der Nähe von Olmütz, geraubt worden. Kurz vor Ulrichs Abreise hatte der König noch zu ihm gesagt, ihm sei bewusst, wie schwierig es werde, das gestohlene Geld ausfindig zu machen, weshalb ihn auch nicht sein Zorn träfe, falls es ihm nicht gelänge, andererseits wäre er, Ottokar, doch maßlos enttäuscht, wenn der fähigste Ermittler seines Reiches nicht dazu imstande wäre. Und zum Schluss hatte er noch beiläufig bemerkt, ohne das Geld brauche er gar nicht erst zurückzukehren.
Ulrich lächelte den Kaufmann an. »Nun, wenn das so ist, nehme ich deine Einladung gerne an«, sagte er. »In diesem Fall ist es wohl angebracht, dass auch ich mich vorstelle. Mein Name ist Ulrich von Kulm, und ich bin auf Wunsch unseres hochgnädigen Königs in Mähren unterwegs. Dies hier sind mein Knappe Otto von Zastrizl und mein Schreiber Wolfgang. Sehr gerne werden wir in deinem Heim eine Pause einlegen, aber unter einer Bedingung.«
»Und die wäre?«, fragte der Kaufmann neugierig. Er hatte seine Einladung nicht nur aus Höflichkeit ausgesprochen und schien sich aufrichtig zu freuen.
»Deine Tochter sollte sich stets mindestens drei Schritte von meinem Knappen entfernt halten«, sagte Ulrich mit schadenfrohem Lächeln. Otto machte ein Gesicht, als könne er kein Wässerchen trüben, aber seinen Herrn konnte er nicht täuschen. Wie er verstand er es vorzüglich, mit dem Schwert umzugehen, und er hatte sogar schon einige Turniere gewonnen; noch mehr Lorbeeren, so munkelte man, hatte er sich allerdings in den Schlafkammern von Frauen erworben. Früher hatte Ulrich seinen Knappen deswegen oft getadelt, doch mit der Zeit hatte er festgestellt, dass Ottos Schwäche für das weibliche Geschlecht bei der Aufklärung von Verbrechen durchaus von Nutzen sein konnte. Daher duldete er inzwischen seine Techtelmechtel, vergaß aber nicht, sie in der Öffentlichkeit zu rügen.
Michael lachte auf. »Keine Sorge, edler Herr. Meine Tochter Radana ist eine vernünftige Maid. Und wird von meiner Frau mit Argusaugen bewacht. Auf uns wartet gewiss ein unterhaltsamer Abend. Hauptsache, es entsteht keine Langeweile!«
Der Kutscher wartete schweigend auf Anweisungen, dann schnalzte er und ließ die Zügel knallen. Nach der Kraftanstrengung in der Furt hatten sich die Pferde kurz ausgeruht und setzten nun, wenn auch lustlos, ihren Weg fort. Sobald sie jedoch den Wald hinter sich gelassen hatten, reckten sie die Köpfe und wieherten freudig, denn sie erkannten, dass sie sich dem heimatlichen Stall näherten.
Gemächlich bewegten sich Fuhrwerk und Reiter zu der flachen Anhöhe hinauf, auf der der ansehnliche Marktflecken Raitz lag. Vor den Toren der Ansiedlung säumten kleine Arme-Leute-Hütten den Weg. Die Ortschaft selbst war von einer nicht sehr hohen Palisade aus Holzpfählen umgeben, die oben zugespitzt und gegen Fäulnis mit Feuer geschwärzt waren. Im Zentrum befand sich ein lang gezogener Marktplatz mit stattlichen Steinhäusern und im Osten des Orts ein imposanter Rittersitz, der den Gebrüdern Herman und Vschebor von Raitz gehörte, die auch die Hälfte der Ansiedlung ihr Eigen nannten. Auf der anderen Seite befand sich eine zweite, etwas kleinere Burg, die neuer und besser befestigt erschien. Michael erklärte, dass sie dem Bischof von Olmütz gehöre, und fügte missmutig hinzu, dass der üble Geselle von vorhin – womit er den Burggrafen Idik von Schwabenitz meinte – mit seinem Gefolge ganz sicher dorthin geritten sei.
»Ein hübscher Ort«, sagte Ulrich anerkennend.
Der Kaufmann machte eine leichte Verbeugung, um seinen Dank für die freundlichen Worte auszudrücken, und erklärte weiter: »Den Teil der Anhöhe, auf dem die bischöfliche Feste liegt, nennen wir Hradisko. Einst sollen dort irgendwelche Fremden gelebt haben. Mein Haus steht zum Glück im anderen Teil, der den Herren von Raitz gehört und Příhradek genannt wird. Und nun lasst uns gehen!«
III. KAPITEL
Kaufmann Michael besaß ein Anwesen, das selbst fast wie eine kleine Festung erschien, denn es stand etwas abseits von den anderen Häusern auf einem Felsausläufer am Rande einer Schlucht. Das Grundstück war von einer Steinmauer umgeben und umfasste ein zweistöckiges Haus mit kleinen, schießschartenähnlichen Fenstern, dem ein Speicherhaus mit einem Erdgeschoss aus Stein und einem Kornboden aus dunklen Holzbalken gegenüberstanden. Daneben folgten großzügige Ställe und eine Scheune, an die sich ein Unterstand für Fuhrwerke sowie das Gesindehaus anschlossen. Der ganze Hof war sehr sauber gehalten. Als Michael mit seinen Gästen ankam, fuhr gerade ein mit Roggengarben beladener Leiterwagen in das offene Tor der Scheune ein. Man befand sich mitten in der Getreideernte, und die Bediensteten arbeiteten von morgens bis abends. Michael war offenbar ein sehr vermögender Mann.
Seine Frau, die beim Abladen der Garben in der Scheune geholfen hatte, kam in ihrem einfachen Leinengewand über den Hof gelaufen, warf sich ihrem Mann an den Hals und begann ihn freudig zu küssen. Michael wand sich etwas verlegen aus ihrer Umarmung und informierte sie rasch darüber, dass er drei Herren zum Abendessen eingeladen habe, die ihm in der Furt über die Zwitta edelmütig die ganze Ladung Tuch gerettet hätten.
Seine Frau war sichtlich überrumpelt. Während der Ernte verlor man möglichst keine Zeit mit Kochen, und alle begnügten sich mit kalten Speisen. Sie sagte zwar kein Wort, nickte nur und wartete darauf, dass er sie vorstellte, doch Ulrich entging nicht, dass sie ihm einen strafenden Blick zuwarf und Michael unmerklich den Kopf einzog.
»Dies ist meine Frau Genoveva«, verkündete er nicht minder mit Stolz. »Das Abendessen wird heute ein bisschen später stattfinden, da sie mich noch nicht erwartet hat. Aber habt keine Sorge, im Keller habe ich guten Wein und herrliches Rauchfleisch, ihr werdet also bis dahin nicht darben müssen.«
»Ich habe schon gehört, dass Ihr eine ausgezeichnete Köchin seid«, sagte Ulrich höflich zu Genoveva, die ihm gut gefiel, denn mit ihrem offenen runden Gesicht und ihren lebhaften Gesten machte sie gleich auf den ersten Blick einen aufgeweckten, klugen Eindruck – eine Eigenschaft, die er an Frauen am meisten schätzte. Nicht zuletzt deswegen liebte er seine Frau Ludmilla, die neben ihrer Klugheit auch Schönheit besaß. Rasch versuchte er den Gedanken an sie zu verdrängen und fuhr fort: »Aber obwohl ich wahrhaftig neugierig auf Eure Kochkünste wäre, solltet Ihr unseretwegen keine Zeit vergeuden. Gott hat Euch ein prächtiges Erntewetter beschert, und das Korn hat natürlich Vorrang vor ein paar Reisenden. Das Rauchfleisch, von dem Euer Gemahl gesprochen hat, wird uns vollauf genügen. Wir sind ohnehin müde von dem langen Ritt und würden deshalb gerne, wenn es möglich ist, ein Bad nehmen und dann schlafen gehen.«
»Kommt gar nicht in Frage!«, erwiderte Genoveva resolut. »Gegen das Bad habe ich allerdings nichts einzuwenden – und wenn Ihr meinen Mann gleich mitnehmen wollt, wäre ich Euch sogar dankbar.« Wieder warf sie dem Kaufmann einen strengen Blick zu, der zu besagen schien, dass sie über gewisse Angewohnheiten ihres Mannes einiges erzählen könnte. »Aber Rittersleute wie Ihr werden doch wohl noch nicht müde sein, es ist ja noch nicht einmal Abend! Schlafen, ach was! Ich werde Euch gleich das Bad einheizen, und dann mache ich mich ans Kochen. Was für Geschichten wegen ein paar Garben! Wir haben sowieso schon fast alles eingebracht, und den Rest wird das Gesinde alleine abladen.«
Ein Knecht übernahm die Pferde von Ulrich und seinen Begleitern und führte sie in den Stall, um sie abzusatteln und zu striegeln. Währenddessen geleitete Michael seine Besucher in den großen Raum im Erdgeschoss seines Hauses, in dem prächtige Möbel aus feinem Holz standen. Hinten befand sich ein Kamin mit einer Einfassung aus poliertem Kalkstein und in einer Nische darüber eine kleine Statuette der heiligen Katharina mit dem Marterrad.
Michael ließ seine Gäste auf breiten Bänken an einem Tisch unter dem Fenster Platz nehmen, bat sie um ein wenig Geduld und verschwand in einem Nebenraum.
Otto wand sich etwas unbehaglich auf seinem Platz. »Wir sind wohl nicht gelegen gekommen«, meinte er.
»Ach, das ist jetzt einerlei«, entgegnete Ulrich. »Wer weiß, vielleicht hat ja der Herrgott unsere Schritte hierhergelenkt. Womöglich erweist sich diese Verzögerung unserer Reise noch als nützlich.«
»Hoffentlich …«, murmelte Otto. Er wunderte sich über die Äußerung seines Herrn, denn er kannte dessen misstrauische Haltung gegenüber allem Religiösen. Normalerweise verließ der königliche Prokurator sich bei seinen Ermittlungen nie auf Gottes Gunst, sondern einzig auf seinen Verstand.