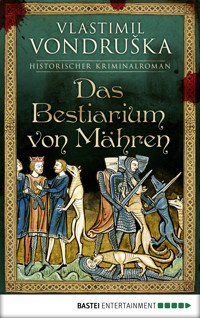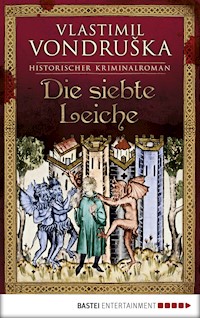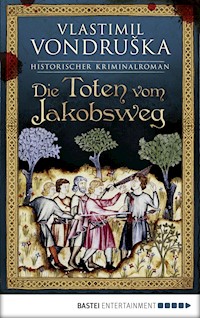
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Prag im 13. Jahrhundert: Im Auftrag des Königs begleiten der Ritter Ulrich von Kulm und sein Knappe Otto die Äbtissin Agnes von Böhmen auf eine Pilgerreise nach Santiago de Compostela. Doch unterwegs kommt es zu mehreren rätselhaften Todesfällen. Offenbar hat sich ein Mörder unter die Pilger gemischt, der mit allen Mitteln verhindern will, dass sie ihr Ziel erreichen. Ulrich und Otto begreifen schnell, dass die vermeintliche Pilgerfahrt in Wahrheit keine religiösen Motive hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
X. Kapitel
XI. Kapitel
XII. Kapitel
XIII. Kapitel
XIV. Kapitel
XV. Kapitel
XVI. Kapitel
XVII. Kapitel
XVIII. Kapitel
XIX. Kapitel
XX. Kapitel
XXI. Kapitel
XXII. Kapitel
XXIII. Kapitel
XXIV. Kapitel
XXV. Kapitel
XXVI. Kapitel
XXVII. Kapitel
XXVIII. Kapitel
XXIX. Kapitel
XXX. Kapitel
Über den Autor
Vlastimil Vondruška, geboren 1955, hat in Prag Geschichte und Ethnologie studiert. Danach hat er im Prager Nationalmuseum gearbeitet und gemeinsam mit seiner Frau eine Werkstatt zur Nachbildung von historischem Glas betrieben. Heute widmet er sich ganz dem Schreiben. Neben zahlreichen wissenschaftlichen Werken hat er über dreißig historische Romane veröffentlicht und gehört zu den erfolgreichsten Autoren Tschechiens. Besonders beliebt ist die Serie um Ritter Ulrich von Kulm und seinen Knappen Otto.
Vlastimil Vondruška
DIE TOTENVOMJAKOBSWEG
Historischer Kriminalroman
Aus dem Tschechischen vonSophia Marzolff
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2010 by Vlastimil Vondruška und
Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Brno
Titel der tschechischen Originalausgabe: »Tajemství abatyše z Assisi«
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Hanna Granz, Witten
Titelillustration: © akg-images/Album/Oronoz;
© Johannes Wiebel | punchdesign, München,
unter Verwendung von Motiven von © shutterstock/m.bonotto;
shutterstock/B art
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel, punchdesign, München
eBook-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-2855-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
MEINER FRAU ALENAGEWIDMET
PROLOG
Als im Jahre des Herrn 1186 der siebenjährige König von Jerusalem Balduin V. starb und seine Mutter Sibylle als Thronfolgerin die Herrschaft ihrem zweiten Gatten Guido von Lusignan überließ, geschah, was nie hätte passieren dürfen. Der neue Jerusalemer König vertrieb den Regenten Raimund III. in die Grafschaft Tripolis im Norden und erklärte alle Friedensabkommen, die sein Vorgänger mit den Muselmanen geschlossen hatte, für ungültig. Anders als Raimund III. war Guido von Lusignan ein Kriegsbefürworter. Ihm ging es nicht um den Glauben, er war ein Abenteurer. Er wollte kämpfen und war auf Beute aus. Die Jahre relativen Friedens waren damit vorbei.
Guido von Lusignan wurde von etlichen Rittern unterstützt, die alle mit dem gleichen Ziel ins Heilige Land gekommen waren – Reichtümer zu erwerben. Der wohl skrupelloseste unter ihnen war Rainald von Châtillon, Fürst von Antiochia. Er war ein schon nicht mehr junger Mann, der nach Herzenslust mordete und plünderte. Im Roten Meer besaß er sogar eine Piratenflotte, aber selbst das genügte ihm nicht, und so überfiel er im Namen des christlichen Glaubens die Insel Zypern, die dem byzantinischen Kaiser gehörte. Er massakrierte die wehrlosen Bewohner und kümmerte sich nicht darum, dass sie sich ebenfalls zum Christentum bekannten, wenn auch zur Variante der Ostkirche. Er beging derartige Grausamkeiten, dass man in der ganzen christlichen Welt lieber über seine Taten schwieg. Niemand nun hatte an Guido von Lusignans Thronbesteigung in Jerusalem größere Freude als gerade Rainald. Noch am Tag des Machtwechsels begann er jenseits des Jordans erneut muselmanische Karawanen anzugreifen. Und wieder färbte sich der Sand entlang der Handelswege rot vom Blut der Anhänger Allahs. Ein neuerlicher Krieg war unausweichlich.
Zu jener Zeit einigte Sultan Saladin die muslimische Welt. Auf die Provokationen der Christen reagierte er dennoch zunächst besonnen. Er forderte vom Jerusalemer König eine Entschuldigung sowie die Herausgabe der Gefangenen und der Raubgüter. Doch Guido von Lusignan dachte nicht daran, Rainald von Châtillon zur Verantwortung zu ziehen, denn er glaubte, einen möglichen Krieg gewinnen zu können. Und sogleich begann er mit den Vorbereitungen. Im Frühling des Jahres 1187 hatte er ein Heer versammelt, wie es noch keiner der Jerusalemer Könige besessen hatte. Unter seiner Standarte fand sich auch der vertriebene Raimund von Tripolis ein, denn wie den meisten der moderateren Ritter war ihm bewusst, dass es hier um Sein oder Nichtsein der Christen im Heiligen Land ging. Sie waren zwar mit Guidos Vorgehen nicht einverstanden, aber das bedeutete nicht, dass sie dem Ansturm der Muselmanen untätig zuschauen würden, waren sie doch trotz allem christliche Ritter.
Und so rückten sie alle in den Tagen nach Ostern von Jerusalem aus. Am See Genezareth warteten die Truppen Saladins auf sie. Es dauerte nicht lange, und die beiden Heere waren nur noch einen Tagesmarsch voneinander entfernt. Doch tatsächlich war die Strecke zwischen ihnen fast unüberwindlich, denn der Weg zum See führte durch eine öde und völlig ausgedorrte Hügellandschaft. Da ein Weitermarsch unter der heißen Sonne, durch den Staub und über die glühend heißen Steine die Männer, aber vor allem ihre Pferde ohne ausreichende Wasservorräte zu sehr erschöpft hätte, sahen die Christen von einem weiteren Vorrücken ab. Durch diese Landschaft hindurch geradewegs in die Arme der Feinde zu marschieren wäre gleichbedeutend mit einem Gang zur Schlachtbank gewesen, das wusste der König von Jerusalem ebenso gut wie Saladin.
Nicht weit von einem kleinen Fluss schlugen sie deshalb ihr Lager auf, und es begann, was in solchen Situationen üblich war. Die Ritter zogen mit ihrem Gefolge plündernd durch die Gegend. Der Langeweile entgingen sie auch dadurch, dass sie gelegentlich mit muselmanischen Spähtrupps zusammenstießen. Derartige Scharmützel hatten beide Seiten schon etliche hinter sich. Sie endeten gewöhnlich mit einer Aussöhnung, und oft kehrten die Heere nach einigen Wochen vergeblichen Wartens auf den entscheidenden Zusammenstoß wieder nach Hause zurück.
Saladins Truppen waren zwar zahlenmäßig unterlegen, doch diesmal wollte er sich nicht mit einer schnellen Aussöhnung zufriedengeben, zu gravierend waren die Beleidigungen und Gewalttaten der Christen gewesen. Allerdings wollte auch er nicht den Marsch durch die trockene Ödnis riskieren, sondern suchte sich ein näheres und einfacheres Ziel: Er griff die Stadt Tiberias an, die am Ufer des Sees Genezareth lag. Zufällig befehligte die Gemahlin des Raimund von Tripolis die Verteidigung der Stadt. Doch nicht einmal dieser Umstand bewog ihren Mann dazu, sich für den riskanten Vormarsch durch das Hügelland auszusprechen. Raimund äußerte im Gegenteil in einer Rede, es sei besser, eine Stadt zu verlieren als das ganze Heer und dazu Jerusalem. Er wusste, dass Saladin im Geiste ein Ritter war wie er selbst und deshalb seiner Frau nichts antun würde. Sollte Tiberias fallen, würde er allenfalls ein Lösegeld für sie zahlen müssen. Eindringlich bat er deshalb den König von Jerusalem, sich nicht provozieren zu lassen und abzuwarten. Doch Guido von Lusignan sah in dem Überfall auf Tiberias einen willkommenen Anlass, den Krieg fortzusetzen. Einen ganzen Nachmittag lang beriet er sich mit seinen Getreuen, um am Ende doch einzusehen, dass eine Offensive zu riskant wäre.
Es sah also zunächst so aus, als hätte die Vernunft gesiegt. Doch noch in der gleichen Nacht erhielt Guido von Lusignan in seinem Zelt Besuch vom Großmeister des Tempelordens. Dieser versuchte den König mit Schmeicheleien zu überreden, sein Schwert nicht ruhen zu lassen. »Handelt nach dem Vorbild der ersten Kreuzritter, als sie in das Heilige Land kamen! Sie befanden sich in einer schlechteren Lage als wir. Und doch griffen sie die Ungläubigen an und siegten über sie. Gott ist mit uns!«, rief er und reckte das heilige Schwert seines Ordens in die Höhe. Schließlich überzeugte er Guido von Lusignan: Die Schlacht am darauffolgenden Tage war beschlossen und damit auch das Schicksal Jerusalems – und das des Ulrich von Kulm.
In der Morgendämmerung erklang im Lager der Christen der Schall der Trompeten, die das Heer zum Kampf gegen Saladin zusammenriefen. Raimund von Tripolis eilte zu Guido von Lusignan, um ihn im letzten Moment umzustimmen, doch dieser wollte ihn nicht empfangen. Die Getreuen des Königs liefen von Zelt zu Zelt, stachelten die Zaudernden an, malten ihnen die Beute aus, die sie im Lager der Muselmanen erwarten würde, und argumentierten weiter damit, dass sie laut ihren Spähern gegenüber Saladins Truppen deutlich in der Überzahl seien. Und noch bevor die Sonne über den Horizont gestiegen war, brach das Heer auf.
Es war ein heißer Julitag. Die Ebene, die die Kreuzzügler durchqueren mussten, war baumlos, nirgendwo gab es auch nur ein Fleckchen Schatten, in das man sich für einen kurzen Moment hätte zurückziehen können. Wasser hatte der trockene Erdboden seit Monaten nicht gesehen. Die Wasservorräte, die sie in ledernen Schläuchen mit sich führten, waren bereits vor Mittag verbraucht, und die Helme auf ihren Köpfen waren so glühend heiß, dass man sie fast nicht berühren konnte. Sie abzusetzen wäre jedoch noch schlimmer gewesen. Um Mittag herum starb der erste Mann an Entkräftung. Trotzdem gab niemand den Befehl zum Rückzug. Mit hängenden Köpfen taumelten sie weiter und versuchten, nicht darüber nachzudenken, was sie erwartete. Das war nun einmal ihr Leben als Kämpfer Christi.
»Haltet durch!«, versuchten die Ritter ihr Gefolge zu ermutigen. »Heute Abend sind wir am See Genezareth. Ihr dürft ihn ganz austrinken, wenn ihr wollt! Sein Wasser ist schön frisch, klar und kühl …« Doch ein paar Stunden später hatten sie selbst nicht mehr die Kraft, die anderen aufzurichten. Das Heer rückte zusehends langsamer vor. Die Fußsoldaten gerieten ins Stolpern, und etliche Pferde gingen zu Boden. Allmählich wurde es dunkler, und die Ufer des Sees waren immer noch nicht zu sehen.
Dem Großmeister des Tempelordens klebte die Zunge am Gaumen, als er hervorbrachte: »Lasst uns hierbleiben! Wir müssen ausruhen.« Er und seine Tempelritter waren wohl in der schlechtesten Verfassung von allen. Und in noch schlechterem Zustand waren ihre Pferde. Schließlich gab der König von Jerusalem seine Zustimmung. Sie befanden sich in einer flachen Talmulde nahe des Dorfes Hattin und ließen sich einfach nieder. Keiner baute Zelte auf, niemand machte Anstalten, wenigstens eine provisorische Befestigung zu errichten. Und niemand bezog Stellung als Wache. Alle waren zu Tode erschöpft. Sie ließen sich auf den Boden sinken und beteten zu Gott, dass die Sonne bald hinter dem Horizont versinken möge. In Hattin gab es einen einzigen Brunnen, und darin stand nur wenig Wasser. Rainald von Châtillon und seine Männer erbeuteten alles für sich.
In der Nacht näherten sich die Muselmanen und begannen, das Lager einzukreisen. Die christlichen Ritter waren am Ende ihrer Kräfte, doch sie mussten fortwährend in Habachtstellung bleiben, denn Saladin konnte jeden Moment angreifen. Aber er tat es nicht, er wollte den Morgen abwarten. Die Christen litten. Der Durst schnürte ihnen die Kehle zu, und Krämpfe durchzogen ihre Eingeweide. Kaum einer von ihnen verspürte die Gnade Gottes, welche die Waffen zum Sieg führt. Sie hatten jegliche Hoffnung aufgegeben.
»Das ist deine Schuld!«, schrie Raimund von Tripolis wutentbrannt Rainald von Châtillon an. »Du hast diesen Krieg heraufbeschworen. Du bist ein Räuber und kein Ritter!«
»Es war die Entscheidung unseres Königs, gegen die Muselmanen in den Kampf zu ziehen«, entgegnete Rainald müde, ohne seine übliche Arroganz zur Schau zu stellen.
»Und der Wille Gottes«, fügte der Großmeister der Templer tonlos hinzu. Er kniete vor seinem Schwert, das er in die Erde gebohrt hatte, legte seine Hände auf die Parierstange und betete, als wäre es das Kreuz.
Im ersten Morgengrauen rotteten sich einige Tausend Fußsoldaten zusammen, die in der Nacht beschlossen hatten, ihren Rittern den Gehorsam zu verweigern. Guido von Lusignan hatte nicht die Kraft, sie zurückzuhalten, und so marschierten die Söldner los in Richtung Hattin, um sich zum See Genezareth durchzuschlagen. Sie alle trieb nur eine einzige Sehnsucht: Wasser.
Doch ohne die Unterstützung der Ritter auf ihren Pferden und ohne Führung wurden die Fußtruppen zur leichten Beute der Muselmanen. Gnadenlos wurden sie von ihnen niedergemacht. In der Zwischenzeit griffen Saladins berittene Truppen das Zentrum des christlichen Heeres an. Der erste Ansturm ließ sich zwar abwehren, doch die Ritter waren völlig entkräftet. Überdies hatten sie den Großteil ihres Fußvolks verloren, und ohne dessen Unterstützung ließ sich keine Schlacht führen. Die Pferde der Ritter scheuten, und es wurde immer aussichtsloser, noch in eine Angriffsformation zu finden.
»Wir werden allesamt umkommen«, jammerte ein älterer Johanniter, der von der grellen Sonne so entzündete Augen hatte, dass er fast nichts mehr sehen konnte.
Und ein junger Mann, der erst vor wenigen Wochen ins Heilige Land gekommen war, schrie verzweifelt: »Ich will nicht hier sterben!«
»Gott wird uns beschützen«, versuchte der König von Jerusalem ihnen gut zuzureden und bemühte sich dabei um einen festen Ton. Er blickte ringsum in die Gesichter der Ritter, die schweigend seine Entscheidung abwarteten, und er wusste, sie würden sowieso nicht auf ihn hören. Um den Anschein königlicher Würde zu wahren, sagte er mit gepresster Stimme: »Ich entbinde euch vom Treueschwur zu unserer Krone. Ein jeder von euch versuche, alleine der Belagerung zu entkommen. Und Gott erlaubt es euch auch. Versucht, euer Leben zu retten!« Ebenso gut hätte er verkünden können, dass er die Schlacht aufgebe. Sie waren verloren!
Umgeben von seinen Männern bestieg Raimund von Tripolis sein Pferd und folgte Guido von Lusignan mit düsterer Miene. Der König hatte ihn zwar nicht dazu aufgefordert, doch es blieb ohnehin nicht viel anderes übrig, als die Flucht zu wagen. Er lächelte seine Ritter aufmunternd an. Viele kannte er schon seit Jugendzeiten. »Wir werden als Erste sterben, edle Brüder. Ich danke euch allen für eure treuen Dienste!«
Dann zog er sein Schwert und galoppierte in Richtung der Anhöhe, wo Saladins grüne Standarten aufragten. Dies war kein Angriff nach ritterlichen Regeln. Seine Truppe blieb nur mit großer Mühe zusammen. Vor ihnen glänzten die Schilde und Helme der Muselmanen. Gewöhnlich machten die angreifenden Ritter sich mit lautem Geschrei Mut, aber diesmal fehlte ihnen die Energie dazu. Sie waren schon froh, sich im Sattel halten zu können. Ihre letzte Willenskraft sparten sie sich für das Zusammentreffen mit den Ungläubigen auf.
Aber auch von den Feinden war kein Laut zu vernehmen, als die Ritter auf sie zugaloppierten. Zu ihrer Überraschung kamen ihnen auch keine Pfeile entgegen, stattdessen öffneten sich die Reihen der Muselmanen. Raimund von Tripolis zügelte sein Pferd und brachte es zum Stehen. Sein Blick suchte Saladin. Er entdeckte ihn schnell. Der Sultan saß auf einem prachtvollen Rappen unter einem Baldachin. Sein scharf geschnittenes, braun gebranntes Gesicht wurde von einem gestutzten Bart gerahmt. Sie kannten sich gut, hatten oft gegeneinander gekämpft und noch öfter miteinander verhandelt. Immer auf redliche Weise.
Saladin zeigte ein leichtes Lächeln und bedeutete ihnen mit einer Geste, dass sie hindurchreiten dürften. War Saladin guter Dinge, konnte er sehr großzügig sein. Zum Zeichen seines Danks neigte Raimund ein wenig den Kopf und hob die Hand zum Gruß, dann trieb er sein Pferd an. Sobald er mit seinem Gefolge die Gasse der Muselmanen passiert hatte, schlossen sich die Reihen wieder. Zusammen mit Raimunds Männern war auch der Sohn des Rainald von Châtillon der Belagerung entkommen.
Gleich darauf begann die Schlacht. Doch der Kampf währte nicht lange. Noch zwei weiteren Truppen gelang dabei die Flucht. Die eine befehligte Balian von Ibelin, die andere Graf Rainald von Sidon. Von beiden wussten die Muselmanen, dass sie zum gemäßigten Lager des Raimund von Tripolis gehörten. Sie schätzten sie als tapfere und ehrenhafte Ritter, die niemals wehrlose Händler oder Dorfleute umbringen würden – ganz anders als jene, die sich nun in der Talmulde um das Zelt kauerten, über dem schlaff die Fahne des Königreichs Jerusalem herabhing.
Als Saladins Mannen das Lager stürmten, fanden sie den König von Jerusalem und einige seiner Getreuen völlig entkräftet im Zelt auf dem Boden liegen. Sie konnten nicht einmal mehr aufstehen, weshalb die Muselmanen sie auf Tragen in ihr eigenes Lager beförderten.
Saladin erwartete sie in einem großen Zelt aus schwarzer Seide. Er hatte einen überwältigenden Sieg errungen und wusste, dass er soeben seine Position in der muselmanischen Welt bedeutend gefestigt hatte. Es war noch nicht lange her, dass er an die Macht gelangt war, und er musste seine Stellung als bester Kämpfer Allahs erst beweisen. Nach dem heutigen Tag konnte niemand mehr daran zweifeln. Er war jedoch nicht so töricht zu glauben, damit sei alles erreicht. Sein Ziel lag noch höher. Er wollte Jerusalem zurückerobern. Aus diesem Grund begegnete er Guido von Lusignan mit Freundlichkeit – stand dem Sieger einer Schlacht Diplomatie doch besser zu Gesicht als hohle Prahlerei.
Er reichte dem König von Jerusalem einen Becher mit klarem Wasser, das herrlich kühl war, da seine Sklaven es in Behältnissen mit Schnee transportiert hatten. In Saladins Welt bedeutete das Reichen des Bechers, dass man die Sicherheit seines Gastes garantierte. Indirekt drückte er damit aus, dass er den König von Jerusalem am Leben lassen würde. Dieser musste jedoch zu verhandeln beginnen und seine vollständige Niederlage eingestehen.
Guido von Lusignan trank gierig und reichte den Becher an Rainald von Châtillon weiter, der neben ihm stand. Er ahnte nicht, welchen Fehler er damit beging. Als Christ hatte er einfach mit seinem Nächsten teilen wollen.
Zornentbrannt fuhr Saladin den Dolmetscher an, er solle den Christen übersetzen, er habe den Becher lediglich dem König von Jerusalem gereicht. Damit gab er zu verstehen, dass er für das Leben der anderen keine Gewähr leiste.
Rainald von Châtillon war zwar ein Räuber, aber kein Feigling. Er hatte immer ein raues Leben geführt, und rau war auch sein Handeln, selbst in einer Lage, in der sein Leben auf dem Spiel stand. Er grinste verächtlich und machte eine höchst respektlose Bemerkung, die der Dolmetscher kaum zu übersetzen wagte.
Doch Saladin verstand auch so. Er runzelte die Stirn und presste wütend die Lippen zusammen, dann zog er blitzschnell sein Schwert und schlug Rainald den Kopf ab. Den entsetzten Christen hielt er vor, dass ebendieser Mann der Hauptschuldige an dem Krieg zwischen den Christen und ihnen sei, da er so unzählige Grausamkeiten begangen habe. Deshalb habe er den Tod verdient. Im Grunde hätten auch die anderen ihn verdient, da sie den Verbrecher frei wüten ließen.
Der Großmeister der Tempelritter kniete neben dem toten Rainald von Châtillon nieder. Er hob den abgeschlagenen Kopf auf und legte ihn zum Stumpf des Halses. Dann drückte er dem Toten die Augen zu und strich über seinen Körper, als wolle er sich von ihm verabschieden. Doch gleichzeitig durchsuchte er dabei unauffällig seine Sachen. Dann bekreuzigte er sich erschrocken.
Saladin hatte ihnen den Rücken zugewandt. Er hatte genug von diesen Christen und befahl, sie abzuführen und ihnen Wasser zu geben. Er werde den Besiegten später seine Bedingungen mitteilen.
Unterdessen flüsterte der Großmeister dem König von Jerusalem heimlich zu: »Er hat es nicht bei sich!«
»Was meinst du?«, fragte der geschlagene Guido von Lusignan resigniert.
»Das heiligste Geheimnis unseres Ordens.«
»Großer Gott, wie ist es denn zu ihm gelangt?«
»Ich selbst habe es ihm gestern Nacht anvertraut. Ich rechnete mit meinem nahen Tod«, erklärte der Großmeister der Templer verstört. »Er schwor mir, er werde es nach der Schlacht unserem Orden zurückgeben.«
»Du Narr!«, brauste Guido von Lusignan auf. »Du hättest die Schatulle mir geben sollen.«
»Gewiss«, pflichtete der Großmeister ihm zerknirscht bei.
Der König bekreuzigte sich. »Das ist eine schreckliche Katastrophe«, sagte er leise. Er sprach nicht von der Niederlage bei Hattin. Er sprach von dem, was Rainald von Châtillon bei sich getragen hatte und was nun verschwunden war.
Etwa zwei Monate später, am 2. Oktober 1187, übergab Balian von Ibelin, der als Letzter die Verteidigung Jerusalems befehligt hatte, nach kurzem und erbittertem Kampf die Stadt Jerusalem und das Grab Christi an Sultan Saladin.
I. KAPITEL
Es war schon Abend, als der königliche Prokurator Ulrich von Kulm mit seinen Männern in das Gehöft unweit von Leipa zurückkehrte, das er als Verwalter Nordböhmens derzeit erneuerte. Er war müde, hatte eine Schramme im Gesicht, und seine Stimmung war auf dem Tiefpunkt. Zwei Tage lang hatte er eine Räuberbande verfolgt, die auf den Wegen nach Zittau Kaufleute überfallen hatte, doch die Gauner waren ihm wieder entwischt. Er hatte Adalbert von Habstein in Verdacht, die Bande zu leiten, aber solange er ihn nicht in flagranti ertappte, konnte er ihn nicht verurteilen. In letzter Zeit war er vom Pech verfolgt. Im Frühjahr war seine Ehefrau Blanka gestorben. Dann hatte er auf der Prager Burg zwar den Mord an Landrichter Dobřej aufklären können, sich gleich darauf aber den Unmut König Přemysl Ottokars II. und vermutlich auch des höchsten Burggrafen Wilhelm von Landstein zugezogen, als er die Hand von dessen Tochter Lucia ablehnte. Und zu Hause in Nordböhmen taten die Herren von Dauba und von Wartenberg, was ihnen beliebte, als wollten sie ihm zeigen, dass dies ihr Herrschaftsgebiet war und ein Vertreter des Königs ihnen nichts zu sagen hatte.
König Přemysl Ottokar II. regierte nun schon das zweite Jahr und erwies sich als tatkräftiger Monarch, allerdings wuchsen ihm die Probleme über den Kopf. Und sie beschränkten sich längst nicht auf das Königreich Böhmen. Sein Vater Wenzel I. hatte ihn vor seinem Tode mit Margarete von Babenberg vermählt, die mit ihren fünfzig Jahren nahezu Ottokars Großmutter hätte sein können. Zusammen mit ihrer Hand erhielt er das Herzogtum Österreich, und nach Wenzels Ansicht musste das für eine glückliche Ehe ausreichen. So wurde der böhmische König der mächtigste Herrscher nördlich der Alpen. Ein altes Sprichwort seiner Vorfahren besagte jedoch, je zahlreicher die Verwandten, desto zahlreicher die Sorgen, und so war es dann auch. Jenseits der Grenzen hatte Přemysl Ottokar II. so viele Sorgen, dass ihn das läppische Gezänk der nordböhmischen Adligen nicht weiter interessierte.
Es war also Ulrich von Kulms Aufgabe, in der Gegend von Leipa für Ordnung zu sorgen, und deshalb war er so verärgert darüber, dass ihm die Räuber wieder entkommen waren.
Dieses hügelige und bewaldete Stück Böhmen war ihm ans Herz gewachsen. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte er sich an einem Ort zu Hause. Er war mit seiner Frau hier glücklich gewesen, solange sie lebte. Nun, nach ihrem Tod, blieb ihm nur noch das Gefühl der Verantwortung. Aber es gab im Leben eines Ritters schließlich höhere Werte als ein flüchtiges Glück. Gott hatte ihm ein Schwert gegeben, um die Schwachen zu schützen, und dieser Aufgabe hatte er sich mit Leib und Seele verschrieben. Selbst auf die Gefahr hin, dass er damit zeitweilig den Unmut des Königs, der Kirche oder eines nordböhmischen Magnaten erregte.
Als er durch das Tor in den Vorhof einritt, wartete dort schon sein Knappe auf ihn. Otto von Zastrizl war ein besonderer Bursche. Unlängst war er zum Ritter geschlagen worden, doch obwohl er längst erwachsen war, bezeichnete er sich selbst weiterhin als Knappe. Und so blieb es schließlich dabei. Im Grunde war Otto ein Einzelgänger, und daran änderte selbst die Tatsache nichts, dass er mit allerlei Mädchen anbandelte und manchmal sogar – wie der örtliche Kaplan säuerlich moniert hatte – mit verheirateten Frauen. Der Knappe hatte dem Geistlichen freundlich entgegnet, Gott wolle offenbar nicht, dass er das Sakrament der Ehe eingehe, da er ihm die Richtige bislang noch nicht zugeführt habe. Worauf der Kaplan spitz bemerkt hatte, er werde schwerlich die Richtige finden, wenn er sich mit allen versündige.
»Du kannst das nicht verstehen«, hielt Otto dagegen. »Wie soll ich deiner Meinung nach herausfinden, welche die Richtige ist, wenn ich sie nicht genauestens kennenlerne?«
»Gewiss sollst du dein zukünftiges Eheweib kennenlernen. Aber auf eine fromme Weise, bei der Kirchenandacht«, beharrte der Kaplan.
»Aber ich suche doch keine Nonne! Frauen lerne ich lieber dort kennen, wo ich mit meinem Eheweib, wie ich hoffe, öfter sein werde als bei der Andacht.«
Auf solche Argumente wusste der Kaplan nichts mehr zu erwidern. Manchmal beschwerte er sich bei Ulrich von Kulm, und dieser rügte seinen Knappen gelegentlich, doch er wusste, dass es nicht viel nutzte, weshalb seine Ermahnungen auch eher halbherzig klangen. Vor allem aber hatte Ulrich seinen Knappen sehr gern, war Otto doch der treueste Diener, den man sich nur wünschen konnte. Er war jederzeit bereit, für seinen Herrn sein Leben zu geben, nur in Herzensdingen ließ er sich nicht befehlen, wie er selbst zu sagen pflegte. Wenn er besonders gut gelaunt war, fügte er noch hinzu, man dürfe die Treue zu einem Herrn nicht mit der Treue zu einer Frau verwechseln – einen Herrn wähle man im Unterschied zur Frau fürs ganze Leben.
Auch wenn Otto so leichtfertig über seine Liebesabenteuer sprach, hätte er in Wahrheit doch niemals die Gefühle eines Mädchens verletzt. Er suchte sich vor allem solche aus, die wie er auf ein kurzfristiges Vergnügen aus waren. Und er hatte durchaus etwas zu bieten: Er besaß ein gefälliges Gesicht, das nach deutscher Mode von lockigem, hellem Haar umrahmt wurde. Er war groß und kräftig und bewegte sich dabei geschmeidig und mit einer gewissen Eleganz. Bei allem sorgfältig gepflegten Äußeren hatte er jedoch nichts von der weibischen Art vieler seiner Altersgenossen, die sich, wie man am Königshof spottete, in der Frauenkemenate wohler fühlten als auf dem Turnierplatz. Otto bemerkte dazu gerne, er sei wohl die goldene Ausnahme, denn er fühle sich an beiden Orten gleichermaßen wohl.
»Mein Herr«, rief der Knappe nun, als Ulrich von Kulm in den Hof ritt. »Ein Bote unseres erhabenen Königs war hier.«
»So? Was wollte er denn?«, fragte der Prokurator verwundert, sprang aus dem Sattel und warf die Zügel dem Knecht zu, der darauf wartete, das Pferd in den Stall zu führen.
»Er hat einen Brief überbracht. Es sei von höchster Wichtigkeit. Mehr wusste er selbst nicht zu sagen. Nur dass es wohl mit der erhabenen Tante unseres noch erhabeneren Königs zu tun habe. Die erhabene Äbtissin Agnes nämlich wolle …«
»Jetzt übertreibe es mal nicht mit der Erhabenheit«, fiel Ulrich ihm ins Wort. Seine gute Laune kehrte langsam zurück. »Agnes von Böhmen ist nicht mehr Äbtissin, falls du das noch nicht weißt. Sie hat das Amt aus Gründen der Demut niedergelegt. Jetzt lässt sie sich nur noch soror maior – ältere Schwester – nennen.«
»Das ändert nichts daran, dass Ordensschwestern doch nur Kalamitäten verheißen. Wir müssen nämlich auf eine Wallfahrt und …« Der Knappe unterbrach sich. Ulrich von Kulm musterte ihn prüfend, dann begann er zu lachen.
»Gib zu, du hast den Brief gelesen.«
»Der Bote hatte von höchster Wichtigkeit gesprochen. Und dass uns eine eilige Abreise bevorstünde. Und da das Siegel aus irgendeinem Grunde nicht richtig am Pergament haftete und sich löste … Nur aus reinem Pflichtgefühl habe ich den Brief gelesen, um nicht irgendetwas zu versäumen«, erklärte Otto schuldbewusst.
»Der Brief ist also entsiegelt?«
»Nicht gänzlich … Ich habe das Siegel auf der Rückseite leicht erwärmt und hernach wieder aufgedrückt. Ich fürchtete, Ihr würdet Euch nicht darüber freuen, dass ich meine Nase in Eure Angelegenheiten stecke, mein Herr. So weiß ich nun freilich, wohin unser erhabener König uns zu schicken gedenkt.«
»Als hätte ich hier nicht genug zu tun«, stöhnte Ulrich und ging auf das im Umbau befindliche Herrenhaus zu. »Wohin soll es denn diesmal gehen? Warte, lass mich raten! Der Jahrestag des heiligen Wenzel war zwar bereits, aber vielleicht nach Alt-Bunzlau?«
»Viel weiter, mein Herr.«
»Zum heiligen Adalbert an die Sasau? Nein? Dann irgendwohin nach Mähren?«
Wieder schüttelte Otto den Kopf.
»Sag nicht, der König will uns ins Herzogtum Österreich schicken?«
»Als wäre mit den österreichischen Besitzungen die christliche Welt schon zu Ende … Nein, er schickt uns viel weiter. Im Grunde fast bis ans Ende der Welt. Nach Galicien. Auf die Wallfahrt zum heiligen Jakobus in Compostela. Dorthin nämlich gedenkt die ältere Schwester zu reisen…«
»Moment … sprichst du von Agnes von Böhmen?«
»Ich dachte, sie hätte den Titel der Äbtissin niedergelegt?«, fragte Otto unschuldig. »Nun, wir sollen also die ältere Schwester begleiten.«
»Nenne sie doch lieber Äbtissin. Aus deinem Munde klingt ›Schwester‹, als würdest du von einer Kellnerin sprechen … Aber wie auch immer, der Weg nach Compostela ist der berühmteste Pilgerweg der Christenheit. Ich bin noch nie dort gewesen. Allerdings wird diese Reise mehrere Monate in Anspruch nehmen, und dafür habe ich gar keine Zeit. Schließlich muss ich den König hier vertreten«, sagte Ulrich ratlos. »Warum also ausgerechnet ich? Der König hat am Hof doch genug Ritter, die nichts taugen und sich ausgezeichnet als Begleiter eignen würden – warum schickt er nicht sie? Wer soll dann hier in Nordböhmen für Ordnung sorgen?«
»In dem Schreiben steht, der Papst werde für die Dauer der Wallfahrt eine treuga Dei, also einen Gottesfrieden über ganz Nordböhmen verhängen. Sollten die Herren von Dauba oder von Wartenberg den geringsten Vorstoß gegen den König unternehmen, so droht ihnen die Exkommunikation. Sie werden es sich daher gut überlegen, ob sie uns Schwierigkeiten bereiten. Und mit allem anderen wird Kommandeur Diviš schon fertigwerden.«
»Was ist das denn für ein Unsinn?«, brummte der königliche Prokurator skeptisch. Den Gottesfrieden verhängte der Papst sonst nur, wenn er die Besitzungen von Christen schützen wollte, die das Kreuz auf sich nahmen und ins Heilige Land zogen, um die Ungläubigen zu bekämpfen. Er selbst war einst in Magdeburg zur Klosterschule gegangen und kannte sich in Kirchendingen recht gut aus, deshalb war er sich fast sicher, dass der Papst im Fall einer gewöhnlichen Pilgerreise nicht die gleichen Befugnisse besaß. Aber er würde sich hüten, die Entscheidungen des Heiligen Vaters in Rom zu kritisieren. Es genügte, dass er einmal die Beschlüsse des Magdeburger Bischofs beanstandet hatte und dafür beinahe mit dem Leben bezahlt hätte. Dies war auch der Grund, warum er letztlich kein Kleriker geworden, sondern in die Dienste des böhmischen Königs getreten war. Zwar entstammte er keiner bedeutenden Familie, doch er hatte schon zu einer Zeit Ottokars Vertrauen gewonnen, da dieser noch Thronanwärter war. Deshalb erhielt er später auch sein wichtiges Amt.
Wenn Papst Innozenz IV. die Reise der Äbtissin unter einen so ungewöhnlichen Schutz stellte, dann musste es sich um eine hochwichtige Angelegenheit handeln. Ulrich konnte nicht glauben, dass es dabei wirklich nur um eine Pilgerreise zum Grab des Apostels Jakobus ging, denn welchen Grund sollte der Papst haben, einen Pilger zu schützen, und sei dieser aus königlichem Geblüt? Ein diffuses Unbehagen machte sich in ihm breit. Er kannte dieses Gefühl. Gott schien ihm die Gabe der Vorahnung verliehen zu haben, denn dieses Unbehagen beschlich ihn jedes Mal, wenn ein schwieriger Auftrag auf ihn zukam.
Dabei hatte seine Sorge durchaus nichts Irrationales – auch bei klarem Verstand betrachtet blieb die Situation ungewöhnlich. Warum sollte der Papst Agnes von Böhmen seinen Schutz gewähren, solange sie doch in keiner Gefahr schwebte? Schließlich waren schon ganze Pilgerscharen nach Compostela aufgebrochen, ohne dass ihnen etwas passiert wäre. Ein kleines Rittergefolge hätte für diesen Zweck völlig genügt. Und doch übergab der König seine geliebte Tante in die Obhut des Ulrich von Kulm, da er sich offenbar um sie sorgte. Ebenso wie der Papst.
Otto beobachtete seinen Herrn aufmerksam und schien zu begreifen, weshalb er zögerte. Mit Bedauern fügte er hinzu, weiter habe in dem Brief leider nichts gestanden. Der Bote habe ihm nur noch vertraulich mitgeteilt, dass Willibald Odo, der Propst von Vyšehrad, sie auf der Reise begleiten werde.
»Das wird ja immer besser«, seufzte Ulrich. Er kannte den Propst der Prager Hochburg Vyšehrad gut, und sie konnten sich herzlich wenig leiden. Willibald Odo gehörte zu den Mitgliedern des königlichen Rates, die sich unlängst gegen ihn gestellt hatten, als er im Mordfall des Richters Dobřej ermittelt hatte. Der Propst war für ihn ein aufgeblasener Dummkopf. Vorsichtig fragte Ulrich, ob sein Knappe nicht vielleicht noch irgendeine gute Nachricht für ihn hätte.
»O doch«, antwortete Otto prompt. »Ich habe mir erlaubt, für Euch zu packen. Der Bote sagte, wir sollten spätestens übermorgen in Prag sein. Und die Köchin habe ich angewiesen, einen Pflaumenkuchen zu backen.«
Ulrich von Kulm liebte Pflaumenkuchen. Niemand hatte ihn jedoch so gut zuzubereiten verstanden wie seine verstorbene Frau. Fast alles hier zu Hause erinnerte ihn an sie, ob er wollte oder nicht. Dabei wusste er, es war nicht gut, ständig an sie zu denken. Im menschlichen Leben musste alles sein Maß behalten – auch die Trauer. Insofern würde die lange Pilgerreise ihn ein wenig ablenken, deshalb sollte er sich eigentlich darauf freuen. Zudem war er immer neugierig auf neue Erlebnisse, und so weit war er noch nie gereist. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Er konnte nicht wissen, wie sehr sein christlicher Glaube in den folgenden Wochen auf die Probe gestellt werden würde.
Falls Ulrich gedacht hatte, in Prag würde er weitere Auskunft über die geplante Wallfahrt erhalten, so hatte er sich getäuscht. Der König befand sich nicht in der Stadt. Nicht lange nachdem Přemysl Ottokar II. den Thron bestiegen hatte, hatte im vergangenen Jahr Béla IV. von Ungarn mit seinen Kumanen die Stadt Olmütz überfallen. Zeitgleich waren der bayerische Herzog Otto und traditionsgemäß auch die Polen in Mähren eingefallen. Die Olmützer wussten sich zwar zu verteidigen, und auf Betreiben von Papst Innozenz IV. kam es zu einem Friedensschluss, doch an der Ostgrenze des Landes kehrte immer noch keine Ruhe ein. Und so war Ottokar abermals mit dem Heer nach Mähren gezogen.
Zwar empfing Agnes von Böhmen Ulrich in ihrem Kloster, doch beschränkte sich ihr Austausch auf ein paar freundliche Worte nach der Messe in der St.-Franziskus-Kirche. Das Einzige, was er in Erfahrung bringen konnte, war, dass der Komtur des Tempelordens, Jakob de Vries, die Pilgerschaft leiten würde. Die Komturei für die Provinz Böhmen befand sich neben der Laurentiuskirche in der Prager Altstadt. Von St. Franziskus aus waren das nur wenige Schritte, sodass er auch dort seine Aufwartung machte. Er traf den Komtur jedoch nicht an.
Äußerst missmutig kehrte er darauf in die Taverne Zum Goldenen Rad zurück, in der er und sein Knappe Unterkunft bezogen hatten. Otto war noch nicht da. Ulrich setzte sich an einen Tisch hinten am Fenster, was sein bevorzugter Platz war, denn man konnte von dort auf den Hof der Taverne hinausschauen und saß gleichzeitig nah am Kamin. Es war Oktober und in den frühen Abendstunden bereits empfindlich kalt. Er bestellte sich einen kleinen Krug warmen Met und grübelte darüber nach, was die nächsten Tage wohl bringen würden. Von draußen erklang Hufgeklapper, und kurz darauf sah er durch das Fenster, wie ein Reiter durch das offene Tor in den Hof geritten kam. Er erkannte ihn sofort: Auf dem Pferd saß Burggraf Wilhelm von Landstein. Er vertrat den König in dessen Abwesenheit auf der Prager Burg.
Der Burggraf hatte stets seine schützende Hand über den königlichen Prokurator gehalten, auch bei dem Fall um das Judaszeichen, doch Ulrich war sich unsicher, ob er ihm auch jetzt noch gutgesinnt war. Schließlich hatte er die Hand seiner Tochter Lucia verschmäht und, was noch schlimmer war, den Rang des Landrichters missachtet, um das Leben eines unbedeutenden Ritters zu retten. Die Tatsache, dass Wilhelm von Landstein hier angeritten kam, war so außergewöhnlich, als würde der König höchstpersönlich die Taverne besuchen. Es konnte bedeuten, dass der Burggraf alles längst vergessen hatte und Ulrich von Kulm weiterhin als seinen Schutzbefohlenen betrachtete. Oder aber es bedeutete, dass er die Sache mitnichten vergessen hatte und ihn seine Macht spüren lassen wollte. Einen Vorwand dafür fand ein so mächtiger Beamter jederzeit.
»Diese vermaledeite Äbtissin!«, fluchte Ulrich leise vor sich hin und fuhr mit der Hand unwillkürlich über seinen kurzen Bart, wie so oft, wenn er sich zu konzentrieren versuchte. Was konnte er jetzt auf die Schnelle tun? Er stellte fest, dass Wilhelm von Landstein lediglich von zwei Soldaten begleitet wurde, die im Hof zurückblieben. Ihr Gespräch würde also privater Natur sein, und offenkundig war er nicht gekommen, um ihn zu verhaften. Immerhin etwas! Er trank einen Schluck aus seinem Krug und wartete ergeben ab.
Kurz darauf flog die Tür zur Gaststube auf, und ein hochgewachsener älterer Mann mit blauem Samtwams betrat hoheitsvoll den Raum. Über die Schulter hatte er einen dunklen Mantel geworfen, der gemäß seinem Familienwappen mit fünfblättrigen goldenen Rosen durchwirkt war, und um die Taille trug er einen prächtigen Silbergürtel mit Amethysten. Er schloss die Türe nicht hinter sich, nahm seinen Helm ab und ging zielgerichtet auf die Ecke zu, in der Ulrich von Kulm saß. Er wusste genau, wo er ihn finden würde.
Der korpulente Schankwirt schloss diensteifrig die Tür und wieselte ihm hinterher. Mit höflicher Geste rückte er ihm einen Stuhl heran und erkundigte sich, welchen Wein er kredenzen dürfe, er habe die allerbesten Sorten – sogar zwei Krüge thessalischen Wein, der eigens aus Venedig hergebracht worden sei. »Diesen Wein trank schon Alexander der Große«, erklärte er schmeichlerisch und schien im Stillen schon zu berechnen, wie viel er damit verdienen könnte.
»Was trinkst denn du, Ulrich?«, fragte Wilhelm von Landstein freundlich. »Met? Dann bring mir, Schankwirt, auch einen kleinen Krug.«
Der Wirt verzog seine verfetteten Wangen zu einem langen Gesicht. »Einfachen Honigwein?«, fragte er, doch der Burggraf beachtete ihn schon nicht mehr. Ulrich hingegen war wachsam geworden. Er wusste, dass Wilhelm von Landstein sich gewöhnlich nicht in Liebenswürdigkeiten erging. Zumindest nicht, wenn er nicht einen Nutzen daraus schlagen wollte. Was mochte es also bedeuten, dass er ihn so sanftmütig anlächelte?
»Ich sehe, du bist dieser Taverne treu geblieben. Hier also hast du Christian letztes Mal versteckt?«, fuhr der Burggraf leutselig fort.
»Das gehört der Vergangenheit an«, antwortete Ulrich höflich, aber bestimmt. Christian war jener Ritter, den er vor dem Tod bewahrt hatte, indem er seine Unschuld bewies.
»Gewiss, gewiss«, pflichtete Wilhelm von Landstein ihm bei. Er nahm den Metkrug vom Schankwirt entgegen, und sie prosteten einander zu. »Das gehört der Vergangenheit an. Aber weißt du, was interessant ist? Dass der König nicht den geringsten Zorn gegen dich hegt. Dabei hast du einem Gefangenen zur Flucht verholfen, den er persönlich zum Tode verurteilt hatte. Ich meine sogar, er schätzt dich seitdem nur noch mehr. Und meine Tochter nicht minder.«
Ulrich wusste, dass es nun angebracht war, sich wenigstens höflich nach Lucias Wohlergehen zu erkundigen, doch er tat es nicht. Wilhelm von Landstein schwieg und wartete ab. Dabei funkelten seine Augen belustigt, als könnte er die Gedanken des königlichen Prokurators lesen. Der Burggraf war ein kluger Mann, er hatte an einem berühmten Basler Kolleg studiert, und anders als die meisten Magnaten achtete er die Bildung hoch, obwohl er Ritter war. Vermutlich hatte er es sich deshalb nach dem Tod von Ulrichs Frau in den Kopf gesetzt, dass er ihn gern an der Seite seiner Tochter sehen würde. Auf seine etwas berechnende Art hatte er ihn nämlich gern.
Um die Rede auf ein anderes Thema zu lenken, sagte Ulrich mit Stirnrunzeln: »Dieser Auftrag, mit dem mich unser erhabener König diesmal betraut hat, macht mir Sorgen.«
»Ganz unbegründet«, antwortete der Burggraf entschieden. Er nahm noch einen Schluck und schmatzte zufrieden. »Du wirst keinerlei Verantwortung tragen. Ja du wirst noch nicht einmal zum eigentlichen Gefolge der Äbtissin gehören.«
»Warum zum Teufel soll ich dann nach Compostela?«, platzte es aus Ulrich heraus. Allmählich schwante ihm, dass die Sache komplizierter war als gedacht.
»Vielleicht weil du dich versündigt hast und unser König dir die Möglichkeit geben will, deinen Eigensinn mit einer Wallfahrt abzubüßen«, sagte Wilhelm von Landstein und lachte. Ulrich wusste, dass er ihn nur necken wollte, und deshalb faltete er fromm die Hände und erklärte demütig, das sei natürlich etwas anderes und besänftige seine Seele außerordentlich.
»Ich habe Compostela selbst einmal besucht«, erzählte der Burggraf jovial. »Für einen Christen ist es ein unvergessliches Erlebnis! Ich denke immer noch häufig an diese Reise zurück.«
Ulrich hatte den Burggrafen noch nie dergleichen erzählen hören.
»Meine Tochter hast du ja kennengelernt«, fuhr Wilhelm von Landstein fort. »Sie ähnelt dir in mancherlei Hinsicht. Sie hat einen wahren Dickkopf, und wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, kann man es ihr nicht ausreden. Störrisch wie ein Maulesel … Ich muss ihr wohl allzu begeistert von meiner Pilgerreise zum Apostel Jakobus berichtet haben, jedenfalls hatte es zur Folge, dass Lucia nun ebenfalls Compostela besuchen möchte. Sie hat noch drei andere Mädchen aus den edelsten böhmischen Familien überredet, mit ihr zu reisen. Möglicherweise wird die eine oder andere von ihnen dereinst in den Damianitinnenorden unserer Agnes von Böhmen eintreten … Deshalb hat diese ihr Einverständnis gegeben, dass die Jungfrauen sie begleiten dürfen, unter der Bedingung allerdings, dass sie ein eigenes Geleit erhalten. Schließlich ist es ein sehr weiter Weg, und wer weiß, was alles geschehen könnte. Und unser König hat sie in diesem Ansinnen unterstützt.«
Wilhelm von Landstein verstummte und hob unmerklich die Augenbrauen. Was sollte er auch weiter hinzufügen? Ulrich hatte längst begriffen. So wütend war er lange nicht gewesen.
In diesem Moment ging die Tür auf, und sein Knappe Otto kam in die Gaststube. Er ging direkt auf ihren Tisch zu, machte eine höfliche Verbeugung und begann seinem Herrn begeistert zu berichten, er habe glänzende Neuigkeiten. In der Pilgerschaft, welche die Äbtissin Agnes nach Compostela begleiten werde, befinde sich auch eine Gruppe von Edelfräulein. Die Reise verspreche also weniger langweilig zu werden, als er zunächst befürchtet habe.
II. KAPITEL
Bald zeigte sich, dass es mit der Abreise aus Prag doch nicht so dringlich war, wie der Bote behauptet hatte, als er in Nordböhmen den Brief übergab. In vier Tagen erst würde man aufbrechen. Ulrich beschloss, die freie Zeit dafür zu nutzen, so viele Informationen wie möglich über die vor ihnen liegende Wegstrecke zu sammeln. Gleich am nächsten Morgen begab er sich ins Stiftskapitel von Vyšehrad. Im dortigen Skriptorium befanden sich vor allem Glaubenstraktate christlicher Kirchenlehrer, aber auch einige wissenschaftliche Werke. Im Domkapitel der St.-Veits-Kathedrale gab es zwar wesentlich mehr Bücher, aber Ulrich kannte den Vyšehrader Bibliothekar Emmeran von Greifsfeld und schätzte seine etwas steife Gelehrtenart. Wenn ihm jemand helfen konnte, dann er.
Der Bibliothekar nickte bedächtig mit seinem kahlgeschorenen Kopf. »Ihr seid schon der Dritte in kurzer Zeit, der sich für den Jakobsweg interessiert.« Er trug ein braunes Ordenshabit und hatte dunkle Ringe unter den Augen, weil er in der Nacht vor Zahnschmerzen nicht hatte schlafen können. Wenn ihn etwas quälte, sah er noch dünner und knochiger aus, als er ohnehin schon war.
»Das wird wohl daran liegen, dass die edle Äbtissin Agnes sich auf diese Wallfahrt begibt«, entgegnete Ulrich sanft. Doch da verdüsterte sich der Blick des hageren Bibliothekars, und er wies ihn streng darauf hin, die ehrwürdige Agnes sei nicht mehr Äbtissin, sondern nur noch ältere Schwester in Christo. Dann öffnete er eine Truhe und holte daraus vier in helles Schweinsleder gebundene Kodizes hervor.
»Ich habe alles bereitliegen. Könnt Ihr glauben, königlicher Prokurator, dass sich sogar unser Propst hierher in die Bibliothek verirrt hat?« Er bemühte sich gar nicht erst, seine Gehässigkeit zu verbergen. Der Vyšehrader Propst Willibald Odo war von seiner Herkunft Normanne. Zwar lebte er schon seit seiner Jugend in Böhmen, hatte jedoch nie richtig Tschechisch gelernt. Er war ein großer, muskulöser Mann, hatte strahlend blondes Haar, helle Augen und ein streitbares Temperament wie seine wikingischen Vorfahren. Der Bibliothekar war nicht gut auf den Propst zu sprechen, weil Willibald Odo nur ein paar grundlegende christliche Lehrsätze kannte und überzeugt war, damit auszukommen. Durch irgendeine unergründliche Fügung war er Agnes von Böhmens Beichtvater geworden. Er verachtete Gelehrsamkeit und kämpfte lieber mit dem Schwert für den Glauben. Und er verachtete auch Emmeran von Greifsfeld und ließ ihn das merken.
»Ei, so weiß unser Willibald Odo doch tatsächlich, wo sich in seinem Stiftskapitel die Bibliothek befindet!«, sagte Ulrich lachend. Er wusste, wie er den mageren Ordensmann für sich einnehmen konnte.
»Ja. Zuweilen geschehen noch Zeichen und Wunder«, antwortete Emmeran ebenso respektlos. »Damit, dass er hierherfand, war es dann freilich auch schon vorbei. Der erhabene Propst blickte von der Türschwelle aus durch den Raum und wies mich an, ihm nur die allerwichtigsten Dinge auf Pergament zu notieren. Nicht ein einziges Buch hat er aufgeschlagen! Er behauptete, er hätte nicht genug Zeit, um jeden Unfug zu lesen, den irgendwer irgendwann niedergeschrieben habe. Wenn Ihr gesehen hättet, wie er mich dabei angeschaut hat! Er weiß nämlich genau, dass ich derzeit ein Traktat über Leben und Werk des Apostels Jakobus verfasse. Dieser Mann beherrscht die Kunst der Erniedrigung, aber das habt Ihr wohl selbst schon zu spüren bekommen. Es bereitet ihm Freude, obgleich er doch ein Diener Christi ist und unser Bruder sein sollte.«
»Wollt Ihr mir verraten, was Ihr ihm Wichtiges auf Pergament notiert habt, Bruder Bibliothekar?«, fragte Ulrich mit unverhohlenem Interesse.
»Ihr könnt es Euch ansehen, denn er hat es noch nicht abholen lassen«, antwortete der hagere Bibliothekar gallig und zog eine Pergamentrolle aus der Truhe. Er öffnete sie und reichte sie seinem Gast.
Auf dem Pergament stand zu lesen: Jakobus der Ältere (unter den Jüngern Jesu Christi gab es noch einen anderen Jünger namens Jakobus, der als der Jüngere bezeichnet wird) ist der ältere Bruder des Evangelisten und Apostels Johannes. Er war bei Jesu Erscheinung nach der Auferstehung dabei. Er gehörte zu den erstberufenen Jüngern, verkündete das Evangelium in Spanien und starb als Erster der zwölf Apostel den Märtyrertod in Jerusalem, worauf die Jünger seine sterblichen Überreste auf ein unbemanntes Boot legten und es aufs Meer hinausschickten. Durch Gottes Hand geleitet trieb das Boot bis nach Spanien, wo Fischer es entdeckten, die Jakobus’ Leichnam dort begruben, wo sich heute Santiago de Compostela befindet. Wohlgemerkt, Bruder Propst: Der Ort heißt Compostela, nicht Santiago. Nur um sicherzugehen: Santiago ist spanisch für ›heiliger Jakob‹.
Ulrich rollte das Pergament zusammen, gab es dem Bibliothekar zurück und bemerkte leicht amüsiert: »Ungewöhnlich kurz und bündig, allerdings weiß dies doch jeder Klosternovize.«
»Der Propst hat mich angewiesen, nur das Allerwichtigste zu notieren«, erwiderte Emmeran von Greifsfeld spöttisch, »und das habe ich getan, wie Ihr seht, denn ich habe meine Zweifel, dass dieser wikingische Seeräuber so viel weiß wie ein einfacher Novize. Es wäre ein Wunder, wenn er mein Pergament bis zum Ende durchläse. Aber warum sollte ich mir noch mehr Mühe geben? Schließlich will der Propst, dass ich mit ihm reise, da kann er also jederzeit nachfragen.«
»Ihr reist mit uns nach Compostela? Das ist eine gute Nachricht«, sagte der königliche Prokurator erfreut, doch der knochige Bibliothekar unterbrach ihn meckernd, das sei überhaupt keine gute Nachricht. Er habe einen Haufen Arbeit, sein Zahn schmerze und außerdem sei das Reisen im Sattel nicht seine Sache. Dann verstummte er, als wäre ihm bewusst geworden, dass der königliche Prokurator bestimmt nicht hergekommen war, um sich sein Gejammer anzuhören. Er bekreuzigte sich, wohl um Gedanken zu vertreiben, die sich schlecht mit der Demut eines Ordensbruders vertrugen, und fragte, womit er ihm nun eigentlich dienen könne.
»Ich würde gerne so viel wie möglich über die Wallfahrt nach Compostela erfahren. Und damit meine ich die Route selbst. Denn ich darf mit aller Bescheidenheit behaupten, dass ich über den Apostel Jakobus genug weiß.«
»Und was Ihr nicht über ihn wisst, kann ich euch gerne noch erläutern, denn auf der Reise werden wir sicher genug Zeit zum Unterhalten haben«, bot Emmeran von Greifsfeld ihm versöhnlich an. »Was die Route betrifft, so bedauere ich, nicht viel sagen zu können, denn in keinem unserer Kodizes wird darüber ausführlich berichtet. Lediglich ein Benediktinermönch hat auf dem Vorsatzblatt des Johannes-Evangeliums ein paar Anmerkungen über seine Pilgerreise niedergeschrieben. Sie sind allerdings auf Okzitanisch. Zwar ähnelt keine Sprache der christlichen Welt dem Lateinischen so sehr wie gerade diese, dennoch würdet Ihr vermutlich nicht alles verstehen. Ich könnte Euch den Text übersetzen, aber es würde Euch nicht viel Gewinn bringen, denn dieser Mönch hat pure Belanglosigkeiten notiert: Wo es eine gute Wirtschaft gibt, wo sich eine Furt befindet, wie man die Berge umgehen kann und so fort. Kein Wort darüber, welche Gebete der Pilger sprechen sollte. Zum Glück kenne ich sie alle. Der ehrenwerte Isidor von Sevilla hat ein höchst lehrreiches Traktat über die geistliche Bedeutung der Wallfahrt verfasst. In unserer Bibliothek haben wir es leider nicht zur Verfügung, aber ich kann es fast auswendig. Außerdem …«
»Ich wäre Euch dennoch dankbar, Bruder«, unterbrach Ulrich ihn, »wenn Ihr mir diese Notizen auf dem Vorsatz des Evangeliums übersetzen würdet.«
Emmeran von Greifsfeld nickte und schlug seufzend einen dicken Kodex auf. Auf der Innenseite des Buchdeckels stand in winziger Schrift eine Wegbeschreibung: von Konstanz aus nach Besançon, dann per Schiff über den Doubs und die Rhone bis zum Meer, von dort zu Fuß weiter durch das Gebiet des Languedoc bis nach Toulouse, anschließend über den Fluss Garonne nach Bordeaux und schließlich mit dem Schiff entlang der Meeresküste bis zum Hafen unterhalb von Compostela. Dem Benediktiner nach war diese Route zwar länger als der Landweg, aber wesentlich schneller. Er habe nur etwas über einen Monat gebraucht, da er auf den Flüssen stromabwärts unterwegs gewesen und so zügig vorangekommen sei. Ulrich dankte dem Bibliothekar und ließ sich von ihm den dicken Kodex in die Hand geben. Interessiert betrachtete er den Text und dachte nach.
Die Strecke von Prag bis nach Konstanz kannte er: Von hier war es nicht weit bis zum niederösterreichischen Kloster in Melk. Von dort konnte man auf der Donau nach Sigmaringen gelangen, und dann waren es nur noch ein oder zwei Tagesritte bis zum Bodensee. Allerdings galt dies für den Frühling und den Sommer; jetzt war bereits Oktober, und der Winter rückte näher. Er begriff nicht, warum Agnes von Böhmen just in der Jahreszeit reisen musste, die dem Reisen am abträglichsten war. Aber was auch immer der Grund dafür war – sicher würden sie genau diese Strecke wählen, da sie die bequemste war.
Agnes von Böhmen war immerhin nicht mehr die Jüngste. Sie musste mindestens fünfzig Jahre alt sein, wenngleich sie jünger wirkte. Sie war schlank und fortwährend in Bewegung, denn sie pflegte den Leitsatz des heiligen Gregor zu zitieren, Müßiggang sei die Mutter der Sünde. Sie hatte zwar das Prinzip der Entsagung übernommen, wie es der heilige Franziskus von Assisi gepredigt hatte, aber deswegen würde sie wohl kaum einen Weg wählen, der unbequem war, zumal die Reise dadurch länger dauern und sie entsprechend später zum Grab des heiligen Jakobus gelangen würden. Ulrich vermutete, dass Agnes von Böhmen die Weihnachtstage in Compostela begehen wollte. Vielleicht war das auch der Grund dafür, dass sie so bald aufbrechen wollte.
Der hagere Bibliothekar hatte die Hände in den Ärmeln seiner Ordenstracht verborgen und beobachtete ihn ruhig. Was für ein Christ einer war, äußerte sich für ihn darin, wie er mit Büchern umging. Ulrich von Kulm wendete die Blätter achtsam und mit angemessener Ehrfurcht um. Fast ebenso behutsam wie Emmeran selbst.
Als Ulrich gerade sorgfältig den Kodex schloss und mit der Metallspange vor dem selbsttätigen Aufspringen sicherte, hörte man das Quietschen der Türangeln. Der Propst von Vyšehrad erschien in der Bibliothek. Überrascht blickte er Ulrich von Kulm an und brummte: »So, Ihr hier? Was tut Ihr hier? Es heißt, Ihr seid ein äußert gelehrter Mann, königlicher Prokurator. Aber so ganz weit her, wie die Leute denken, kann es dann doch nicht sein mit Eurer Gelehrsamkeit. Sonst müsstet Ihr nicht in den Büchern nachsehen, sondern hättet alles im Kopf.«
»Meine Gelehrtheit lässt sich gewiss nicht mit Eurer vergleichen, ehrwürdiger Propst«, antwortete Ulrich, ohne mit der Wimper zu zucken. »Ihr müsst keine Bücher zu Rate ziehen.«
»Hier habe ich die Anmerkungen für Euch vorbereitet«, unterbrach Emmeran von Greifsfeld hastig und reichte dem Propst die Pergamentrolle. Dieser öffnete sie sogleich, überflog die Zeilen und stöhnte, weshalb das denn so viel sei. Er warf noch einen Blick durch die dämmrige Bibliothek, segnete die beiden und ging davon.
»Habt Ihr das gehört? Und so jemand nennt sich Propst des Vyšehrader Kollegiatstifts! Als König Vratislav es gründete, sollte es ein Sitz kirchlicher Gelehrsamkeit sein«, ächzte der Bibliothekar gequält. »Jetzt schicken sie Ordensleute hierher, deren einziges Verdienst darin besteht, aus einer vornehmen Familie zu stammen, ansonsten sind sie Faulenzer und Dummköpfe. Aber glaubt nicht, edler Herr, es sei andernorts besser. Die Kirche verkommt zusehends. Und an allem sind die Bettelorden schuld. Sie halten ein Leben in Armut, Dreck und Unbildung für den einzig richtigen Weg zum Heil. Wohin soll das nur führen?«
»Nun, es macht nicht den Eindruck, als habe Willibald Odo viel mit Armut im Sinn«, bemerkte Ulrich ironisch.
»Das nicht. Umso mehr jedoch mit Unbildung. Aber gut, was kann man von einem Nachfahren von Seeräubern auch erwarten? Die Normannen haben einst unser Gehöft am Rhein niedergebrannt und fast meine ganze Sippe ermordet.«
Ulrich neigte höflich seinen Kopf und faltete die Hände, um anzudeuten, dass er für das Heil der verstorbenen Seelen bete. Im Stillen rechnete er jedoch schnell nach. Die Geschehnisse, von denen der hagere Bibliothekar berichtete, lagen mindestens zweihundert Jahre zurück. Er musste seinen Propst wahrhaftig hassen!
Otto hatte von seinem Herrn keinen spezifischen Auftrag erhalten, und so kam er auf die Idee, sich seinerseits ein wenig über die geplante Reise kundig zu machen. Ihn interessierte am meisten, welche Jungfrauen mitreisen würden. Vielleicht sollte er einmal im Palas des Burggrafen auf der Prager Burg bei Lucia vorsprechen? Vor nicht allzu langer Zeit hatte er ihr das Leben gerettet, wenngleich sie davon überzeugt war, das Verdienst gebühre vor allem seinem Herrn. Trotzdem schenkte sie ihm immer ein Lächeln, wenn sie einander begegneten. Allerdings erschien es ihm taktisch ungünstig, sie ausgerechnet jetzt zu befragen, denn sie könnte hinterher über ihn spotten, dass er sich vor der heiligen Wallfahrt nur für Weibsbilder interessiere. Lucia konnte sehr spitz sein, und Otto vermochte sich nur schwer vorzustellen, dass sie eines Tages eine demütige Ehefrau oder gar Ordensschwester werden könnte.
Er schlenderte über die breite Straße in Richtung Altstädter Ring und überlegte, wie er am ehesten an Informationen gelangen könnte. Er kam zu dem Schluss, am verlässlichsten sei es wie immer, sich an die besten Kennerinnen der Materie zu wenden, nämlich an die herrschaftlichen Ammen und Köchinnen. Und so wusste er bereits vor Mittag die Namen der drei Edelfräulein, die zu Lucias Jungfrauengefolge gehören würden.
Johanna von Blatna kannte er noch nicht, und er konnte sich auch nicht erinnern, sie je am königlichen Hofe gesehen oder etwas über sie gehört zu haben. Auch an Katharina von Gutstein konnte er sich nur vage erinnern, da er sie länger nicht gesehen hatte. Er wusste allerdings, dass einer seiner Freunde, Michael Kekule von Stradonitz, um sie warb. Was er sich freilich nicht so recht vorstellen konnte, denn er kannte kaum einen scheueren und unbeholfeneren Ritter, wenn es um Mädchen ging. Der dritte Name indessen bereitete ihm ein wenig Sorgen.
Zdena Berken von Bürgstein gehörte zur weitverzweigten Familie derer von Dauba. Im Frühling, nach einem üppigen Festmahl in Leipa, war er ihr wesentlich nähergekommen, als es sich nach Kirchenmeinung ziemte. Seither hatte er sie zwar nicht wiedergesehen, doch Otto war sich nicht sicher, wie Zdena auf ihn reagieren würde. Er war zwar in jener Nacht nicht ihr erster Liebhaber gewesen, und als sie am Morgen auseinandergingen, hatten sie einander nichts weiter versprochen – das musste jedoch nichts heißen. Mit den Edelfräulein war die Sache komplizierter als mit den einfachen Mädchen, denn für sie schien oft auch das Unausgesprochene zu gelten. Wie sollte sich da einer auskennen!
Am günstigsten wäre es, wenn irgendein Ritter aus Nordböhmen um Zdena Berken freien würde; dann hätte sie vielleicht anderes im Kopf, und alles wäre in bester Ordnung. Doch seines Wissens hatte Zdena keinen Brautwerber, denn das wäre ihm bestimmt zu Ohren gekommen. Er wunderte sich darüber, war sie doch hübsch und obendrein wohlhabend. Ihm wurde etwas mulmig, wenn er daran dachte, welche Komplikationen ihre gemeinsame Reise mit sich bringen könnte – zumal wenn sich am Ende noch Agnes von Böhmen einmischen würde. Deren zweite Leidenschaft neben ihrer Frömmigkeit war es nämlich, die Vermählung von Töchtern aus vornehmer Familie zu arrangieren.
Als Otto mit seinen Befürchtungen bis hierhin gelangt war, sagte er sich plötzlich: Was soll’s? Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Warum in Verteidigungsposition gehen, wo doch der Feind noch nicht einmal vor den Mauern steht? Er wusste nun, was er tun würde. Es wäre ganz unsinnig, Zdena aus dem Weg zu gehen. Lieber würde er bei der erstbesten Gelegenheit das Gespräch unter vier Augen mit ihr suchen, denn es erschien ihm redlicher, gleich zu Beginn klarzustellen, dass das, was zwischen ihnen vorgefallen war, zu Ende war. Oder noch besser: erst gar nicht begonnen hatte. Besser riskierte er gleich einen Streit, als später vorwurfsvolle Blicke oder gar verliebte Seufzer und Tränen ertragen zu müssen. Seine Freunde beneideten ihn oft um seine Erfolge bei den Mädchen – wenn sie nur wüssten, wie viel Mühe es bedeutete, sie anschließend in allen Ehren wieder loszuwerden!
»Seid Ihr der Knappe Otto von Zastrizl?«, riss eine forsche Stimme ihn aus seinen Gedanken. Der Mann war von recht kleiner Statur, hatte ein scharf geschnittenes Gesicht und sprach Deutsch. Er war jedoch ganz offenkundig kein Deutscher, denn er hatte einen unüberhörbaren fremdländischen Akzent. Otto war so in Gedanken versunken gewesen, dass er ihn gar nicht bemerkt hatte, dabei war er ihm wohl schon länger gefolgt. Er hatte einen dunklen Teint, trug das Panzerhemd eines Kriegers und über den Schultern einen schwarzen Mantel. Ein Schwert war nicht zu sehen, doch an seinem Gürtel hing ein Dolch mit einem wunderbar ziselierten Griff, der mit braunen Topasen besetzt war.
»Zu Euren Diensten«, sagte Otto mit einer höflichen Verbeugung und wartete gespannt ab. »Kennen wir uns?«
»Ihr seid mir wohlbekannt. Ein erwachsener Mann und doch weiterhin Knappe, ist das nicht etwas Seltsames?«, sagte der Fremde lächelnd. »Ich wüsste, wie Ihr das ändern könntet.«
»Und wenn ich es nicht ändern möchte?«
»Nur Heilige wollen in Armut leben. Und Ihr seid keiner, wie mir zu Ohren gekommen ist. Würden wir sämtliche Schenken der Altstadt zusammen aufsuchen, würde sich wohl mindestens die Hälfte der dortigen Kellnerinnen an Euch erinnern. Eine anständige Leistung, wahrhaftig!«
»Ihr übertreibt«, sagte Otto lachend. Er war neugierig, was diese Begegnung bedeutete, und blieb deshalb ebenfalls freundlich. »So viele Kellnerinnen sind es nicht. Höchstens in jeder vierten Schenke würde man sich an mich erinnern. Alles andere ist üble Nachrede.«
»Solchen Neigungen zu frönen kostet Geld. Wie würde Euch das hier gefallen?«, fragte der Fremde. Er griff in seinen schwarzen Mantel und holte einen prall gefüllten kleinen Beutel hervor. Dann fasste er nach Ottos Hand und drückte den Beutel hinein. Waren darin wirklich Denare, mussten es mindestens zehn Schock sein. So viel verdiente Otto im ganzen Jahr nicht.
Der Knappe verzog das Gesicht. »Das ist ganz unnötig«, sagte er. »Ich muss mir die Kellnerinnen nicht kaufen, und so brauche ich auch keine Silberlinge. Vor allem keine fremden.«
»Geld kann man immer gebrauchen! Schließlich steht Euch eine lange Reise bevor. Wenn Ihr Euch erst einmal auf dem Gebiet des französischen Königs befindet, werdet Ihr staunen, was die Schneider dort Prachtvolles vollbringen. Und aus welchen Stoffen! Auf den Märkten werdet Ihr gar nicht wissen, wohin Ihr Euren Blick zuerst wenden sollt. Maurische Waffen, byzantinische Duftöle, Spitzen aus Venedig … Gönnt Euch ein wenig Prunk! Das Leben ist zu kurz, um zu darben, edler Herr von Zastrizl.« Der Fremde verneigte sich mit ernster Miene, trat einen Schritt zurück und fügte noch hinzu: »Dankt mir nicht, vielleicht werden wir einander ja noch einmal begegnen.« Er ließ den Beutel in Ottos Hand, drehte sich um und eilte in Richtung der Judit-Brücke davon.
»He! So wartet doch!«, schrie der völlig überrumpelte Otto und rannte ihm hinterher. Er konnte ihn gerade noch am Mantelsaum fassen und wollte ihm das Geld zurückgeben, doch der Fremde verschränkte die Arme vor der Brust und sagte in tadelndem Ton: »Wir wollen doch hier auf der Straße nicht miteinander rangeln wie zwei Markthändler. Lasst mich freundlichst los! Solltet Ihr so unklug sein und etwa diesen schieläugigen Büttel dort hinten um Hilfe rufen, der uns schon von weitem beobachtet, dann werde ich abstreiten, dass dies mein Geld ist. Ich wünsche eine glückliche Reise nach Compostela!« Dann riss er Otto den Saum seines Mantels aus der Hand und eilte weiter in Richtung Fluss.
III. KAPITEL
Jakob de Vries, der Komtur des Tempelordens in der Provinz Böhmen, stammte aus Flandern. Er war ein gedrungener Mann mittleren Alters mit markanten Gesichtszügen: blauen Augen, einer breiten, etwas platten Nase und einem schmalen, strengen Mund, den ein gepflegter rötlicher Bart umgab. Auch sein Haar, das ihm üppig gelockt bis auf die Schultern fiel, war rot. Er trug das Gewand seines Ordens mit dem roten Kreuz auf der Brust und dem grauen Umhang. In demütiger Haltung kniete er vor Agnes von Böhmen, doch seine Miene drückte Groll aus.
»Verzeih mir, ältere Schwester Agnes, aber ich kann dir nicht beipflichten. Ich leite die ganze Pilgerschaft und trage die Verantwortung für die Sicherheit aller. Deshalb bin ich entschieden dagegen, dass dieser Mann mit uns reist. Ulrich von Kulm hat keinen guten Leumund. Er missachtet die kirchlichen Sakramente, legt die Dogmen für sich aus, wie es ihm gerade passt, und unlängst hat er gar dem König die Stirn geboten. Wenn er als Büßer im einfachen Gewande mitreiste, würde ich nichts sagen. Aber warum als Ritter?«
»Halt ein!« Agnes von Böhmen streckte ihm müde ihre gepflegte weiße Hand entgegen. Aus Gründen der Demut trug sie ein schlichtes, grobleinenes Gewand, an ihrem Finger aber glänzte ein prächtiger goldener Ring. Sie mochte die Vorsteherin eines Ordens armer Damianitinnen sein, doch sie war auch die Tochter eines böhmischen Königs.