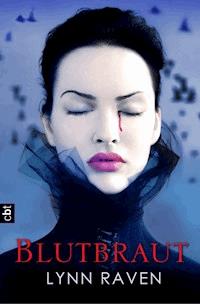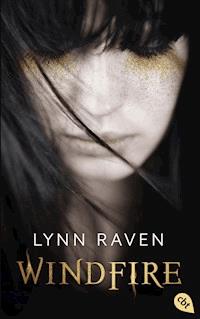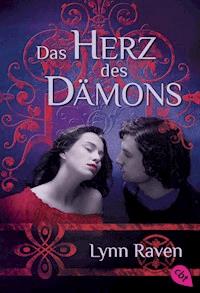7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die "Dämon"-Reihe
- Sprache: Deutsch
Romatisch, düster und sexy
Das Glück von Dawn und Julien scheint nur von kurzer Dauer: Dawn schwebt in Lebensgefahr, ihr Körper versagt langsam, aber unaufhaltsam. Allein Juliens Blut hält sie noch bei Kräften. In seiner Verzweiflung weigert der sich, das Unausweichliche hinzunehmen, und will Dawn mithilfe der mystischen Kräfte seiner Vorfahren retten. Dafür bricht Julien ein ehernes Gesetz der Welt der Lamia – ein Verbrechen, für das es nur ein Urteil gibt: den Tod ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 678
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
DIE AUTORIN
© Katja Theiß
Lynn Raven lebte in Neuengland, USA, ehe es sie trotz ihrer Liebe zur wildromantischen Felsenküste Maines nach Deutschland verschlug. Nachdem sie zwischenzeitlich in die USA zurückgekehrt war, lebt sie heute wieder in der Nähe von Mainz und ist unter den Namen Alex Morrin und Lynn Raven als Fantasyautorin ausgesprochen erfolgreich.
Weitere lieferbare Titel bei cbt:
Der Kuss des Dämons (30554)
Das Herz des Dämons (30690)
Der Kuss des Kjer (30489)
Werwolf (30657)
Der Spiegel von Feuer und Eis (30502, unter dem Namen Alex Morrin)
Blutbraut (16070)
Lynn Raven
Das Blut des Dämons
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2010 Verlag Carl Ueberreuter, Wien Alle Rechte dieser Ausgabe bei cbt/cbj Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: Carolin Liepins
Covermotiv: Shutterstock.com (Amanda Carden, Relight Motion, AS Inc, Olga Nikonova, Tusumaru)
MI · Herstellung: AnG
ISBN: 978-3-641-24106-3 V004
www.cbt-jugendbuch.de
Eyes, look your last!Arms, take your last embrace! and, lips, O youThe doors of breath, seal with a righteous kissA dateless bargain to engrossing death!
(Shakespeare – Romeo and Juliet, Act 5, Scene 3)
Wie lange wollte ich die Augen davor verschließen? Leugnen, was von Anfang an nicht zu leugnen war? – Die Krämpfe. Das Rebellieren ihres Magens in immer kürzeren Abständen. Die Erschöpfung. – ›Ein Magen-Darm-Virus. Menschen werden nun einmal von Zeit zu Zeit krank. Es wird mir bald besser gehen.‹ Und ich habe ihr geglaubt. Weil ich ihr glauben wollte.
Hätte es etwas geändert, wenn sie mir gleich erzählt hätte, was Bastien in jener Nacht in der Lagerhalle zu ihr gesagt hat? Dass es sich mit ihr ›demnächst erledigt‹ hat. Hätte ich es aufhalten können, wenn ich es früher gewusst hätte? Gewusst! Pah! Wenn ich früher die Augen aufgemacht hätte.
Ich werde sie halten, solange ich kann. Ihre Haut ist durchscheinend wie Porzellan. Und kalt. Ich kann die Adern darunter sehen. Bläuliche, feine Linien. Mit jedem Tag wird sie schwächer.
Zu wie vielen menschlichen Ärzten habe ich sie gezerrt? Ich weiß es nicht. Es waren nicht viele. Wozu auch? Sie hätten ihr niemals helfen können. Samuel hat ihren Wechsel viel zu früh erzwingen wollen und ihre Chemie vollkommen durcheinandergebracht. Ihr Körper weiß nicht mehr, was er ist: Mensch oder Lamia.
Und keiner kann ihr helfen. Auch Vlad nicht. – Fürst Vlad. Sollte er je erfahren, wie es seiner Großnichte geht, wird er sie mir wegnehmen. Ich kann ihm nichts davon sagen.
Deshalb bin ich hier. Ich bin auf mich gestellt. – Und treffe selbstsüchtig eine Entscheidung, die eigentlich ihre ist. Weil ich mich an etwas klammere, an das ich selbst niemals geglaubt habe: Legenden. Legenden über das Blut der Allerersten.
Ihretwegen verrate ich mein Legat als Kideimon. Papas Erbe. Das Einzige, was mir von ihm geblieben ist. Ich breche das Wort, das ich ihm gegeben habe. Und es ist mir egal. Ebenso, wie es mir egal ist, dass Adrien dagegen ist.
›Beende es! Jetzt! Du weißt, wo es hinführt!‹ Seine Worte hallen noch immer in meinem Kopf. Jedes einzelne wie ein Stich ins Herz. Ja, ich weiß, wo es hinführt. Qual. Wahnsinn. Tod. Ich war auch an dieser Schwelle, Bruder. – Selbst wenn es nur den Hauch einer Hoffnung gibt, dasBlutkönnte verhindern, dass sie stirbt. Selbst wenn das bedeutet, dass ich mich mit dir überwerfen muss. Ich lasse es mir nicht verbieten.
»Wir gehen gleich in den Landeanflug, Sir. Wenn Sie sich bitte anschnallen«, meldet sich der Pilot von di Ulderes Gulfstream über die Bordsprechanlage. Dafür, dass er mir die Maschine überlassen hat, stehe ich noch tiefer in seiner Schuld.
Kaum merklich legt der Jet sich in eine Kurve, bricht durch die Wolken. Das Meer ist für einen Novembertag überraschend blau und klar. Die Sonne funkelt auf seiner Oberfläche. Vor der Küste Pomègues, Ratonneau, Tiboulen und d’If mit dem alten Château …
Marseille. Die Stadt, aus der ich seit nahezu einem Menschenleben bei Todesstrafe gebannt bin.
Ich habe keine andere Wahl.
Mein Leben stirbt.
Anfang vom Ende
Bis vor Kurzem war ich noch der festen Überzeugung gewesen, es gäbe nichts Schlimmeres, als Gesprächsthema Nummer eins der hiesigen Highschool zu sein und ständig begafft zu werden wie die Hauptattraktion einer Freakshow. Inzwischen wusste ich, dass es Schlimmeres gab: die Gewissheit, dass es sich mit mir – wie hatte Bastien das in dieser Lagerhalle so hübsch ausgedrückt? – demnächst erledigt hatte. Ich starb. Daran ließ sich wohl tatsächlich nicht mehr rütteln.
Allerdings wurde ich allmählich das Gefühl nicht los, dass sich selbst diese Tatsache noch toppen ließ: durch einen Freund, der mich nur mit einem mageren »Ich habe etwas zu erledigen« als Begründung und »Bitte frag nicht weiter« einfach sitzen ließ. – Nun, wenn man es genau nahm, traf sitzen ließ es nicht ganz. Fakt war: Julien hatte mich allein gelassen. Ohne mir mehr zu sagen, als »Ich bin zurück, so schnell ich kann«, war er in der vergangenen Nacht zum Flughafen von Bangor gefahren, wo ihn der Privatjet von Timoteo Riccardo di Uldere bereits erwartete. Das Ziel des Fluges? Fehlanzeige. Julien hatte sich geweigert, es mir zu verraten. Alles, was ich wusste, war, dass er binnen vierundzwanzig Stunden zurück sein wollte.
In einer Mischung aus Ärger und Hilflosigkeit starrte ich das aufgeschlagene Buch vor mir an und versuchte mich auf das zu konzentrieren, was Mr Barrings, unser Lehrer für englische Literatur, uns gerade zu Herman Melville und seinem Roman Moby Dick erzählte. Und bemühte mich gleichzeitig die Blicke meiner Mitschüler und ihr Getuschel zu ignorieren. Beides mit mäßigem Erfolg.
Wir hatten ihnen in den letzten Wochen genug Grund zum Tratschen geboten und die Gerüchte reichten von Dawn Warden sollte von ihrem Onkel dem Teufel geopfert werden und Julien DuCraine hat es im letzten Moment verhindert bis zu Julien DuCraine dealt mit Crystal und wäre deshalb beinah von den Cops verhaftet worden. Die Wahrheit dahinter sah ganz anders aus. Aber sie irgendjemandem – selbst den Leuten aus meiner Clique – zu erzählen, stand völlig außer Frage. Noch nicht einmal Beth, die immerhin meine beste Freundin war, durfte etwas davon erfahren. Beth, die Juliens Verhalten mir gegenüber seit jener Nacht, in der ich mir ihren Käfer geliehen hatte, mit Argus-Augen beobachtete. Sie hatte damals angenommen, dass Julien mich nach einem Streit einfach im Ruthvens hatte stehen lassen und ich mir ihr Auto geborgt hatte, um ihm hinterherzufahren. Auch wenn sie wohl stillschweigend annahm, dass wir uns wieder vertragen hatten und deshalb davon abgesehen hatte, Julien zur Schnecke zu machen, änderte das nichts daran, dass sie offenbar nach wie vor damit rechnete, er könne mich genauso fallen lassen, wie er es bei seinen anderen Freundinnen vor mir stets getan hatte.
Mit ein wenig Verspätung blätterte ich meinen Moby Dick um, ohne zu wissen, ob ich wirklich noch auf der richtigen Seite war.
Dass ich heute Morgen allein – ohne Julien! – zum Unterricht erschienen war, schürte den Klatsch noch ein Stück mehr. Vor allem für Cynthia – Schulschönheit von Gottes Gnaden – war es ein gefundenes Fressen. Stand mein Freund neben mir, wagte sie es nicht, mir gewisse Dinge ins Gesicht zu sagen. Ohne ihn kannten ihre Sticheleien keine Grenzen. Gerade eben warf sie mir erneut einen schnellen Blick über die Schulter zu. Was sie sagte, als sie sich wieder umdrehte, konnte ich nicht hören, aber ihr Hofstaat kicherte. Mit zusammengebissenen Zähnen starrte ich auf die Moby-Dick-Ausgabe. Ich hätte mir das hier ersparen können. In meiner Tasche steckte eine Entschuldigung von meinem Großonkel Vlad – von Julien gefälscht. – Wobei ich mir fast sicher war, dass selbst Onkel Vlad den Unterschied zwischen seiner Schrift und der auf dem Papier kaum, oder nur mit großer Mühe, erkennen würde. – Aber ich hatte es nicht ertragen, zu Hause zu sitzen. Allein mit meinen Gedanken; dem Wissen, dass mir die Zeit unter den Händen davonrann … Ob ich Weihnachten noch erlebe? Die Frage war einfach da. Ebenso wie der Kloß in meiner Kehle. Nein! Ich würde nicht diesen Gedanken nachhängen. Nicht jetzt! Deshalb hatte ich mich – seit zweifelsfrei feststand, dass ich sterben würde – in einen Wirbel an Aktivitäten gestürzt. Ich wollte keine Zeit, um zu denken, zu grübeln; wollte mich nicht immer wieder fragen, ob es nicht doch irgendeinen Ausweg gab, einen, den wir nicht sahen. Einen anderen als den, den Julien kategorisch ablehnte: Nach wie vor weigerte er sich, mich zu einem Vampir zu machen. – Und noch war ich nicht bereit, zu meinem Onkel Vlad zu gehen und ihn zu bitten, das zu übernehmen. Ganz abgesehen davon, dass auch er sich weigern konnte, fürchtete ich, dass er mich nicht länger in Juliens Obhut lassen würde, wenn er erst wusste, wie es um mich stand. Er war der Letzte, der davon erfahren durfte.
Meine Gedanken schweiften zu den vergangenen Wochen zurück. Als meine Anfälle immer häufiger und immer heftiger kamen und ich mir selbst endlich eingestanden hatte, dass Bastien recht hatte, hatte ich Julien gezwungen, Dinge mit mir zu unternehmen, die er niemals freiwillig mit mir unternommen hätte: Achterbahnfahrten auf dem Rummel in Darven Meadow – hintereinander, bis selbst ihm schlecht war – und durchtanzte Nächte im Ruthvens waren nur ein paar davon gewesen. Ich war bis an meine Grenzen gegangen. Und mehr als einmal hatte ich es bei solchen Gelegenheiten anschließend gerade noch auf den Beifahrersitz der Corvette geschafft, ehe meine Kräfte mich verließen – oder mich einer meiner Anfälle schüttelte. Er hatte nie etwas gesagt, sondern mich dann immer nur stumm nach Hause gefahren und die Treppe hinauf in mein Bett getragen. – Aber in den Stunden danach – wenn er dachte, dass ich schlief oder bewusstlos war – saß er neben mir und hielt meine Hand umklammert, als könne er so irgendetwas verhindern. Oder als brauche er selbst diesen Halt.
Ich schluckte gegen die Enge in meiner Kehle an, bis sie vergangen war. Auch wenn der Tod wie eine dunkle Wolke über uns hing, war ich entschlossen so zu leben, als sei sie nicht da. Es gab noch so vieles, was ich tun wollte … Vor allem aber wollte ich in dem bisschen Zeit, das mir noch blieb, nicht behandelt werden, als sei ich aus Glas. Glas, das bereits einen Sprung hatte. Und trotzdem fühlte ich mich manchmal wie erstarrt. Ich ballte die Fäuste. Aber nicht heute! Auch wenn Julien nicht da war. Noch war ich am Leben.
Wie zum Hohn zog ein Krampf genau in diesem Moment meinen Magen zusammen. Vollkommen überraschend. Unwillkürlich schnappte ich nach Luft, legte die Hand auf meinen Bauch und krümmte mich ein Stück vornüber.
Nein! Bitte nicht!
»Dawn, alles in Ordnung mit Ihnen?«
Ich versuchte gegen den Schmerz zu atmen. Die Muskeln nicht weiter zu verkrampfen, sondern sie zu entspannen, so wie Julien es mir gezeigt hatte.
»Dawn, geht es Ihnen nicht gut?«
Die Augen zusammengepresst drückte ich die Faust fester in die Stelle, in der schon ein Messer zu bohren schien. Dabei hatte ich heute noch keinen Bissen gegessen.
»Dawn?«
Ich blinzelte, als mir klar wurde, dass Mr Barrings neben mir stand. »W-was?« Meine Stimme klang heiser.
Er beugte sich ein wenig zu mir. Seit seinem Unfall zu Beginn des Schuljahres bewegte er sich ziemlich steif. »Stimmt etwas nicht mit Ihnen, Dawn? Soll Sie jemand zur Schulschwester bringen?«
»Nein!« Ich brachte ein Kopfschütteln zustande. »Nein, alles … in Ordnung.« Atmen! Atmen! Ob mein Lächeln mehr war als eine Grimasse, konnte ich nicht abschätzen. Mr Barrings’ Gesichtsausdruck nach zu schließen, war es das nicht. Alle starrten mich an.
»Sind Sie sicher?«
Ich nickte. Atmen!
»Vielleicht geht es Dawn ja schneller besser, wenn sie einfach mal wieder den Finger in den Hals steckt«, ließ Cynthia sich in die betretene Stille um uns herum vernehmen. Stimmte mein Verdacht also und das Gerücht mit der Bulimie ging tatsächlich auf ihr Konto? Zum Teufel mit ihr!
Die Hand noch ein wenig fester auf meinen Bauch gepresst hob ich den Kopf und sah sie an. Atmen. »Nein danke. Das überlass ich dir. Ich bin mit meinem Gewicht durchaus zufrieden.« Obwohl meine Stimme nach wie vor entsetzlich rau war, starrte sie mich eine Sekunde mit schmalen Lippen wütend an. Doch dann reckte sie mit einem süffisanten Lächeln die Nase ein bisschen höher.
»Dass du das jetzt bist, kann ich mir durchaus vorstellen. – Wie viel hast du seit dem Halloween-Ball abgenommen? Zehn Pfund?«
Es waren zwanzig. Aber das musste sie nicht wissen.
»Solche Kommentare sind absolut unnötig, Cynthia.« Mr Barrings warf ihr einen unwilligen Blick zu. Der, mit dem er mich bedachte, war dafür umso nachdenklicher. Hoffentlich hatte mir Cyn nicht gerade zu einem Termin mit irgendeinem Schulpsychologen verholfen.
»Sind Sie sicher, dass wieder alles in Ordnung ist, Dawn?«, erkundigte er sich noch einmal.
»Ja, Sir. Danke.« Der Schmerz sank tatsächlich allmählich wieder auf sein übliches halbwegs erträgliches Level herab. Vielleicht würde er ja für ein paar Stunden ganz verschwinden, wenn Julien wieder da war. Meine Hände – eigentlich alles an mir – zitterten allerdings noch immer. Ich drückte sie unter der Bank auf meine Oberschenkel.
Abermals maß Mr Barrings mich auf diese nachdenkliche Art, doch dann nickte er und kehrte nach vorn zu seinem Tisch zurück. »Nun gut, wieder zu Herman Melville, meine Herrschaften. Kann mir jemand in den letzten fünf Minuten unserer Stunde zusammenfassen, welchem seiner Autorenkollegen Moby Dick gewidmet war und auf welcher Vorlage beziehungsweise auf welchen realen Geschehnissen der Roman basiert, ehe wir in den eigentlichen Text einsteigen?«
Scott zwei Tische vor mir meldete sich. Sosehr ich mich bemühte: Es gelang mir nicht, mich auf seine Antwort zu konzentrieren. Schließlich gab ich es auf. Ich musste nur noch eine Pause und anschließend Mathe und Erdkunde hinter mich bringen, dann war dieses Elend für heute vorbei. – Und zu Hause wartete nichts als Stille auf mich. Der Gedanke schnürte mir einmal mehr die Kehle zu. Wo steckst du, Julien? Bitte, komm heim. Die Schulglocke erlöste mich für den Moment und ich flüchtete vor weiterem Gaffen, Getuschel und hämischen oder mitleidigen Bemerkungen ins nächste Mädchen-Klo.
Die Hände um den Rand eines der weißen Waschbecken geklammert versuchte ich das Zittern irgendwie zu beherrschen. Meine Finger waren eiskalt. Ich konnte sie kaum spüren. Ein Mädchen ging hinter mir vorbei, ich begegnete seinem Blick im Spiegel vor mir. Sie schaute hastig weg, gleich darauf schloss sich eine der Toilettentüren, der Riegel schabte. Ich starrte weiter in den Spiegel. An seinem Rand waren winzige dunkle Flecken. Eine der Ecken war abgesplittert. Mein Spiegelbild starrte zurück. Von Anfang an hatte ich nicht verstanden, was Julien an mir fand, warum er mich für schön und bezaubernd hielt, aber jetzt … Ich hatte dunkle Ringe unter den Augen, die mir inzwischen nur noch in einem undefinierbaren, stumpfen Braun entgegensahen. Meine Haare waren glanzlos und strähnig, ich konnte waschen, Spülungen machen und Kuren draufpacken, so viel ich wollte, nichts davon wirkte. Vielleicht sollte ich froh sein, dass es mir noch nicht büschelweise ausfiel. Beinah unbewusst hob ich eine Hand, drehte sie vor meinem Gesicht, berührte es, fuhr mir über die rissigen Lippen. Meine Haut war blass – fast so blass wie Juliens –, bitter verzog ich den Mund. Was hätte ich darum gegeben, wenn sie es aus demselben Grund gewesen wäre! Aber offenbar würde es den Wechsel für mich nun endgültig nicht mehr geben, so schwer es mir auch fiel, diese Hoffnung aufgeben zu müssen. Unter der Haut konnte man die Adern erkennen. Und ich glaubte sogar zu sehen, wie das Blut darin pulste. Ich ließ die Hand fallen, schloss die Augen, krallte die Finger wieder um den Waschbeckenrand. – Ich sah aus wie etwas, das aus einem Bestattungsinstitut davongelaufen war.
Aus der Toilettenkabine, in die das Mädchen zuvor verschwunden war, wehte Zigarettenqualm.
»Dawn?«
Erschrocken keuchend fuhr ich herum. Prompt wurde mir schwindlig. Wie häufiger in letzter Zeit, wenn ich mich zu hastig bewegte. Erneut klammerte ich mich am Waschbeckenrand fest, führte die Bewegung sehr viel langsamer zu Ende. Beth stand hinter mir, wie stets von Kopf bis Fuß in Schwarz. Auch wenn ihr Look heute mit Rüschenbluse, Jeans und Schnürstiefeln geradezu normal wirkte im Vergleich zu dem, was sie sonst trug. Ihr Haar war zu zwei Zöpfen geflochten, die ihr Gesicht umrahmten. Vielleicht sollte ich mich zukünftig auch im Goth-Style schminken? Möglich, dass die Ringe unter meinen Augen dann wie gewollt aussahen.
»Bist du okay?« Sie musterte mich besorgt. Sosehr ich Beth mochte, mit ihrem Gluckengetue ging sie mir inzwischen auf die Nerven. Ebenso wie Julien. Ich starb, in Ordnung. War nicht mehr zu ändern. Aber mussten sie so ein Drama daraus machen? Ich grub mir die Zähne in die Lippe, um es nicht laut zu sagen. Wie oft in den letzten Tagen hatte ich Julien angefahren, wenn er mir nur die Hand reichte, um mir aus dem Auto zu helfen, oder blitzschnell meinen Ellbogen packte, wenn ich unversehens wankte? Ich wusste es nicht mehr. Jedes Mal glaubte ich zu sehen, was er sonst so sorgfältig vor mir verbarg; was dann aber für einen Sekundenbruchteil in seinen Augen stand: Schmerz. Und jedes Mal schrie etwas in mir: Verzeih mir! Aber ich brachte die Worte nie laut über die Lippen. – Ich hatte Angst. Todes-Angst. Und in dieser Angst war ich gereizt und ungerecht, biss um mich wie ein Tier in der Falle. Ich wusste es. Und Julien war derjenige, der alles abbekam. Wie lange seine Geduld noch reichen mochte, ehe auch er einmal ausrastete – oder vielleicht sogar etwas Dummes tat, um seinen Frust nicht an mir auszulassen –, darüber versuchte ich gar nicht erst zu spekulieren. Beth wollte ich das nicht auch noch antun.
Ich atmete tief durch und versuchte es mit einem Lächeln. »Alles okay. Mir war nur ein bisschen schwindlig.«
Beth maß mich erneut mit einem Blick, der zugleich besorgt und unwillig war. »Kein Wunder, du hast heute Mittag ja auch keinen Bissen angerührt.« Ihre Augen wurden schmal. »Lass mich raten: Gefrühstückt hast du auch nichts, oder?« Sie schnaubte und wühlte in ihrer Tasche herum. »Wenn Julien hier in der Schule nichts isst, weil er gegen alles Mögliche allergisch ist, musst du das nicht auch tun.« Sie wühlte tiefer.
Dass Julien wegen einer endlosen Latte an Nahrungsmittelallergien nur ganz bestimmte Dinge zu sich nehmen durfte, war die Begründung dafür, dass er sich nur sehr selten in der Schul-Cafeteria sehen ließ und dort gewöhnlich nie etwas anrührte. Eine von vielen Lügen, die seine Anwesenheit hier in Ashland Falls und bei mir überhaupt erst möglich machten – und von denen die Hälfte einer genaueren Überprüfung durch gewisse Stellen niemals standhalten würden. Was seine eigentliche Diät war, mussten Beth und die anderen nicht wissen.
»Ha, wusste ich es doch! – Hier!« Entschieden drückte sie mir einen Schokoriegel in die Hand. »Aufessen!«
Ich starrte ihn an, als habe er sich direkt vor meinen Augen in irgendetwas Ekliges verwandelt. Ein Bissen würde genügen, und ich würde mir sofort wieder die Seele aus dem Leib spucken.
»Danke. Aber nein, danke.« Ich wollte ihn ihr zurückgeben, doch Beth schüttelte abwehrend den Kopf.
»Du musst irgendetwas essen, Dawn«, beharrte sie. »Schau mal …«
»Lieb von dir, Beth, aber ich mag nicht.« Unter ihrem Arm hindurch stopfte ich ihn in ihre Tasche zurück.
Abermals dieser Blick. Eine Spülung rauschte, das Schaben eines Schlosses, eine Toilettentür öffnete sich und das Mädchen, das mich zuvor schon so neugierig angesehen hatte, ließ uns nicht aus den Augen, während es neben uns an das zweite Waschbecken trat. Beth funkelte sie herausfordernd an, ergriff meine Hand und zog mich so abrupt mit sich, dass ich die ersten Schritte nur hinter ihr herstolperte.
»Beth, was … lass mich los!« Sie ignorierte mich, schleppte mich aus dem Mädchen-Klo. Hinter der Tür warteten Susan, Mike und Tyler offenbar auf uns. Beth zerrte mich durch das Gedränge und den Lärm weiter, den Gang hinunter bis zu einem der Getränkeautomaten, förderte ein paar Münzen zutage und zog eine Cola, die sie aufriss und mir unter die Nase hielt.
»Du hast die Wahl: fester oder flüssiger Zuckerschock.«
Ich konnte die anderen drei hinter mir spüren. Mike räusperte sich. Es klang irgendwie unbehaglich. Seit er sich die Haare wachsen ließ, sah er seiner Halbschwester Susan noch viel ähnlicher. Allerdings war er noch weit davon entfernt, sie zu einem Pferdeschwanz zusammenfassen zu können, so wie Susan ihre glatte dunkelbraune Mähne gewöhnlich trug. Wie lange dauerte diese verdammte Pause eigentlich noch?
Ohne meinen Unwillen zu verbergen, schnappte ich mir die Dose – dass dabei Cola über meine Finger schwappte, war mir mehr als recht – und nahm einen winzigen Schluck.
»Zufrieden?« In meinem Magen meldete sich ein Brennen.
»Wenn du ausgetrunken hast.« Beth warf ihre Zöpfe nach hinten und verschränkte die Arme vor der Brust – und ich wünschte sie zum Teufel. Oder wahlweise mich in irgendein dunkles Loch, damit sie mich alle in Ruhe ließen. Meine Folterknecht-beste-Freundin neigte den Kopf ein wenig und ich nippte in unübersehbar widerwilligem Gehorsam noch einmal an der Cola.
»Sollen wir uns auf die Bank da drüben setzen?«, schlug Susan hinter mir zögerlich vor. Ich warf ihr einen bösen Blick zu. Was kam als Nächstes? Ein Rollstuhl?
Dass Neal Hallern genau in diesem Moment um die Gangecke bog und durch das Gewühl hindurch auf uns zusteuerte, kaum dass er uns – oder besser: mich – entdeckte, bewahrte sie vor einem bissigen Kommentar. Um wie viel lieber ließ ich meine schlechte Laune an ihm aus. Immerhin war Neal schuld daran, dass Julien kurz vor dem Halloween-Ball so ausgetickt war und ein Jungs-Klo demoliert hatte. Was genau Neal zu ihm gesagt hatte, um ihn so weit zu treiben, hatte er mir bis heute nicht verraten. – Aber es hatte ihm ziemlichen Ärger mit unserem Direktor Mr Arrons eingebracht – der wegen der Geschichte mit dem Crystal in Juliens Spind ohnehin gerade alles andere als gut auf meinen Freund zu sprechen gewesen war. – Und es hatte dazu geführt, dass Julien zwangsweise der Fechtmannschaft der Montgomery High hatte beitreten müssen. Was noch zusätzlich Öl in das Feuer – nein, den Waldbrand – zwischen Neal und ihm goss: Bisher war Neal nur sauer auf Julien gewesen, weil ich mich für ihn als meinen Freund entschieden hatte und nicht mit ihm, Neal, zusammen war. Jetzt waren sie auch zu Rivalen auf der Planche geworden. Es tat mir zwar leid, Neal nicht länger zu meinen Freunden zu zählen, doch er hatte den Bogen überspannt. Ich wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben.
Das hinderte ihn natürlich nicht daran, direkt vor mir stehen zu bleiben und mich mit einem sauren Blick zu mustern, nachdem er den anderen zugenickt hatte.
»Wo ist dein Freund, Dawn?«, erkundigte er sich endlich, nachdem er mich geschlagene fünf Sekunden einfach angestarrt hatte.
Ich schob das Kinn vor und gab seinen Blick kalt zurück. Zwei Mädchen verteilten quietschbunte Flyer und eine davon drückte auch Beth einen in die Hand.
»Auch wenn’s dich eigentlich nichts angeht: Er ist zu Hause. Krank.« Ich hatte heute Morgen brav seine – gefälschte – Krankmeldung bei Mrs Nienhaus im Sekretariat abgegeben. Eine Gruppe Juniors drängte sich schnatternd und kichernd an uns vorbei zum Getränkeautomaten. Tyler und Mike wichen ihnen mit einem unwilligen »He!« aus. Susan bekam einen Stoß, schimpfte »Passt doch auf!« und machte einen Schritt in Beths Richtung.
»Krank?« Neal schnaubte. »Was hat er, die Beulenpest? – Ich meine, schau dich an, du siehst aus wie eine aufgewärmte Leiche.« Danke auch, Neal.
Susan holte neben mir Luft, die hellbraunen Augen wütend zusammengekniffen. Beth zischte etwas. Hatte sie ihn gerade tatsächlich »Idiot« genannt?
»Aber du bist hier, und der arme Julien ist so krank, dass er zu Hause bleiben muss?« Er musste das Weichei nicht aussprechen, sein Tonfall schrie es regelrecht heraus.
Ich biss die Zähne zusammen. »Was willst du, Neal?« Das Brennen in meinem Magen verstärkte sich wieder und holte auch das Zittern in meine Glieder zurück. Plötzlich standen sie alle viel zu dicht um mich herum. Ich wich ein kleines Stück zurück in der Hoffnung, dass es ihnen nicht auffallen würde. Beth räusperte sich mahnend, und ich setzte ein weiteres Mal die Dose an den Mund. Mein Nippen war nicht mehr als ein Befeuchten der Lippen.
»Ich soll ihm was vom Coach ausrichten: Er hat ihn für den Vorentscheid im County-Schulturnier gegen die Stearns High, die Penobscot Valley, die Orono und die Kathadin in vier Wochen aufgestellt – zusammen mit mir, Tyler und Paul. Ab Montag haben wir dreimal die Woche Training. – Sag ihm das.«
Ich grub mir selbst die Fingernägel in die Handfläche. Eben deshalb hatte Julien sich bis zu Mr Arrons Erpressung – entweder Beitritt zur Fechtmannschaft und Teilnahme an Wettkämpfen oder Anzeige und Schulverweis – geweigert, bei den Fechtern mitzumachen. Genau das hatte er die ganze Zeit vermeiden wollen. Verdammt. Wie sollte er da nur wieder rauskommen? Oder würde er alles auf eine Karte setzen und den Rauswurf aus der Montgomery riskieren? Der einzige Grund, der ihn hier hielt, war schließlich ich. Und nachdem es diesen Grund in absehbarer Zeit nicht mehr geben würde … was hinderte ihn daran? »Ich bestell’s ihm. – War’s das?«
Bei meinem bissigen Ton zuckte Neal zusammen. In das Gedrängel hinter mir kam ein bisschen mehr Bewegung. Ein Mädchen quietschte, ein Rucksack stieß mir in die Rippen. Ich verhinderte gerade noch, dass mir der Riemen meiner Tasche von der Schulter rutschte. Einen Moment sah es so aus, als wolle er noch etwas sagen, doch dann zuckten seine Augen zu etwas hinter mir. Auch die Blicke der anderen richteten sich darauf. Beinah in derselben Sekunde legten sich Arme von hinten um mich. Mein Schreck dauerte kaum mehr als einen Herzschlag. Es war nicht nötig, dass ich mich umdrehte. Es gab nur eine Person, die mich so festhielt: Julien! Er war wieder da! Erleichtert lehnte ich mich in seine Umarmung. Ich hatte bisher gar nicht gewusst, dass er auch eine helle Wildlederjacke besaß.
»Doch nicht so krank, was, DuCraine?«, spottete Neal und schob ein »Neue Brille?« hinterher, während Susan gleichzeitig irgendwie entsetzt »Was hast du mit deinen Haaren gemacht?« fragte. Ich erstarrte schlagartig. Die Arme legten sich fester um mich, drückten mich enger gegen die Brust in meinem Rücken.
»Was soll Dawn mir sagen?« Juliens Atem streifte meinen Hals. Die falsche Stimme! Nicht dass der Unterschied so eklatant gewesen wäre, dass es den anderen zwingend auffallen musste – mir aber dafür umso mehr. Adrien! Ich drehte mich so weit um, dass ich ihn über die Schulter ansehen konnte.
Tatsächlich! Hätte ich nicht gewusst, woran man die beiden – zumindest im Moment – unterscheiden konnte, hätte ich möglicherweise auch mehr als einen Blick gebraucht: Hinter mir stand nicht mein Freund, sondern sein Zwillingsbruder. Der, für den Julien sich gegenüber seiner eigenen Art ausgab, um – offiziell als mein Leibwächter – hier bei mir in Ashland Falls bleiben zu können. Denn eigentlich war Julien nach Dubai verbannt. Allerdings hatte Adrien inzwischen seinen Platz dort eingenommen.
Doch jetzt war Adrien wieder hier und schlüpfte in die Rolle seines Bruders. Warum? Mir fielen nur zwei Gründe dafür ein: Julien brauchte mehr Zeit und hatte seinen Bruder gebeten, während seiner Abwesenheit auf mich aufzupassen, oder aber … – Plötzlich waren meine Hände schweißnass und meine Kehle eng. – Es war ihm etwas zugestoßen.
Ich drehte mich ein Stück weiter zu Adrien um. Die Spuren dessen, was Onkel Samuels Handlanger ihm angetan hatten, waren nicht mehr zu sehen. Auch seine Haare waren nicht mehr wasserstoffblond, nur die Länge war wie zuvor: stoppelkurz. Ein wenig hilflos suchte ich in seinen Zügen nach irgendeinem Hinweis. Immerhin konnte ich ihn ja kaum vor all den anderen nach Julien oder seinem Bruder fragen. Ob er wusste, dass Kate vor drei Tagen zu ihren Eltern nach Boston zurückgefahren war?
Die Schulklingel schrillte durch den Gang. Hatte ich bis eben das Ende der Pause herbeigesehnt, wünschte ich mir jetzt, dass sie noch ein Stück länger gedauert hätte.
»Was soll Dawn mir sagen?«, wiederholte er gerade und blickte dabei über mich hinweg Neal an.
»Dass du für den Vorentscheid im County-Schulturnier in einem Monat aufgestellt bist. Ab Montag dreimal die Woche Training. Der Plan hängt am schwarzen Brett aus.« Neal schob die Hände in die Hosentaschen.
»Aha.« Was hätte Adrien auch sonst sagen sollen. Ich bezweifelte, dass Julien ihn in mehr als das unbedingt Nötigste eingeweiht hatte – wenn überhaupt Zeit dazu gewesen war. »Was haben wir jetzt?« Adrien sah auf mich herab.
»Mathe.« Mehr brachte ich nicht hervor. Julien würde es nicht riskieren, dass die Fürsten ihnen auf die Schliche kamen, indem er Adrien hierherbestellte, nur damit der auf mich aufpasste. Das Brennen in meinem Magen zog sich zu einem dünnen Schmerz zusammen.
Adrien ließ mich los und trat zurück. »Dann sollten wir gehen, ehe wir zu spät kommen.« Über seiner Schulter hing Juliens Rucksack. Er trug sogar ein paar von Juliens schwarzen Jeans und eines seiner Hemden – die Sachen konnten aber auch aus Dubai stammen, immerhin war das meiste von Juliens Garderobe noch immer dort. Trotzdem: Er musste im Haus gewesen sein. Hatte er mich zuerst dort gesucht? Warum? Hatte Julien ihm gesagt, was mit mir los war? Woher hatte er einen Schlüssel? Und was war mit der Alarmanlage? Ich zuckte zusammen, als Beth sich bei mir einhängte und mich in Richtung Mathesaal zog. Susan winkte mir zu und trollte sich zusammen mit ihrem Halbbruder zu ihrem eigenen Unterricht. Auch Tyler hastete den Gang hinunter. Nur Neal zögerte noch einen Moment, ehe auch er sich davonmachte. Ich drehte mich zu Adrien um. Er folgte uns schweigend. Seine Miene verriet nichts.
Lieber Gott, bitte lass Julien nichts zugestoßen sein!
Wir schafften es gerade rechtzeitig in den Mathesaal. Die noch fast volle Cola-Dose hatte ich im Vorbeigehen in einem der Mülleimer entsorgt – und dafür einen bösen Blick von Beth kassiert. Ich sank auf meinen Platz neben ihr und versuchte Adrien unauffällig klarzumachen, dass seiner auf der anderen Seite des Ganges war. Nachdem Julien es geschafft hatte, seinen Stundenplan meinem bis auf ein paar wenige Kurse anzupassen, hatte er Paul, den Jungen, der ursprünglich dort gesessen hatte, dazu gebracht, ihm diesen Platz zu überlassen. Als habe es meine Blicke und das verstohlene Nicken gar nicht gebraucht, setzte Adrien sich, holte Stift, Block und Buch aus Juliens Rucksack und stellte ihn auf den Boden. Ich biss mir auf die Lippe. Warum sagte er nichts? Sah er denn nicht, dass ich mir Sorgen machte? Ich wollte alle Vorsicht über Bord werfen und mich zu ihm hinüberbeugen, als die Saaltür zuschlug und Mrs Jekens mit einem brüsken »Guten Morgen, wir haben Mathematik, stellen Sie Ihre Privatgespräche ein« in den Raum gefegt kam. Hilflos sank ich auf meinem Stuhl zurück. Jedem anderen hätte sie es vielleicht noch durchgehen lassen: Ich hatte diesbezüglich keine Chance. Mrs Jekens mochte keine Schüler, die mit so wenig mathematischem Verständnis geschlagen waren wie ich. – Und Julien hatte es sogar geschafft, binnen drei Unterrichtsstunden ganz oben auf ihrer Abschussliste zu landen: Indem er ihr bewiesen hatte, dass einige der Gleichungen, die sie uns hatte durchrechnen lassen, entweder gar nicht oder zumindest nicht auf die Art, wie sie behauptet hatte, zu lösen waren. Ein Schüler, der in Mathematik offensichtlich mehr draufhatte als sie selbst, war für sie anscheinend ebenso inakzeptabel wie einer, der trotz allen Bemühens und Büffelns nie auf einen grünen Zweig kommen würde.
Ihre Tasche landete klatschend auf dem Pult, dann wandte sie sich auch schon mit einem »Schlagen Sie Ihre Bücher auf Seite 107 auf« der Tafel zu und begann eine Gleichung darauf zu schreiben.
Die anderen gehorchten unter Geraschel und Scharren. Hastig riss ich vor dieser Geräuschkulisse die Ecke einer Seite von meinem Block ab und zerrte einen Stift hervor. In meinen Fingern saß ein Kribbeln, während sie sich zugleich taub anfühlten. Meine Hand zitterte. Mrs Jekens würde mir den Kopf abreißen, wenn sie mich dabei erwischte, wie ich Julien einen Zettel zuschob, aber ich musste einfach wissen, weshalb er den Platz seines Bruders eingenommen hatte. Als sie sich von der Tafel ab- und uns zuwandte, stieß Beth mir gerade noch rechtzeitig den Ellbogen in die Seite, um mich zu warnen.
»Nun, meine Herrschaften, wer von Ihnen hat die Güte, uns diese Gleichung durchzurechnen und uns seine Vorgehensweise dabei zu erklären?« Die Frage war rein rhetorisch, denn Mrs Jekens kam schon auf unserer Seite zwischen den Tischen entlang. Eilig legte ich die Hand auf den Papierfetzen und zog mein Buch darüber. Gott sei Dank hatte Beth es für mich auf Seite 107 aufgeschlagen. »Mr DuCraine. Bitte schön. Wenn Sie so freundlich wären.« Sie streckte Julien die Kreide hin. Adrien zögerte, und einen Moment dachte ich, er würde Mrs Jekens einfach auflaufen lassen, so wie sein Bruder es früher getan hatte, ehe er beschloss, dass er bei mir bleiben, im nächsten Schuljahr dieselben Kurse wie ich belegen wollte und entsprechend versetzt werden musste. Doch dann stand er auf, nahm ihr die Kreide ab und ging zur Tafel.
Mrs Jekens blieb neben mir stehen. Ihr Parfum drang mir in die Nase. Es roch süßlich. Vanille. In meinem Mund war plötzlich ein saurer Geschmack. Ich schluckte mühsam dagegen an.
Vor der Klasse betrachtete Adrien die Gleichung, eine Hand in die Jeanstasche geschoben, während er die Kreide zwischen den Fingern der anderen drehte. Es war still. Die Uhr über der Tür tickte. Jemand tuschelte und wurde von Mrs Jekens mit einem Blick zum Schweigen gebracht.
»Nun, Mr DuCraine? Irgendwelche Schwierigkeiten?«, erkundigte sie sich nach ungefähr einer weiteren halben Minute. »Oder sind wir heute einfach nicht in Form?«
Adrien warf ihr einen Blick über die Schulter zu und begann zu schreiben. Beth stöhnte neben mir. Selbst ich sah, dass es der falsche Ansatz war. Offenbar gab es in der Familie Du Cranier nur ein Mathegenie. »… x3 – 2y …«, soufflierte sie drängend, viel zu leise, als dass ein normaler Mensch es hätte hören können.
Mrs Jekens lehnte sich an den Tisch hinter mir. An der Tafel hielt Adrien inne. Die Kreide schwebte über der Gleichung. Vanille! Eindeutig. Und dazu Kokosnuss. Mein Magen zog sich zu einem brennenden Klumpen zusammen. Beth rang die Hände auf ihrem Mathebuch, murmelte weiter. »Ja, genau da. Die Klammer weg und …«
Ich taumelte hoch, die Hand vor den Mund gepresst. Mein Stuhl krachte nach hinten. Die Tür. Panisch tastete ich nach dem Griff. Stimmen riefen durcheinander. Ich fand ihn, riss sie auf, flüchtete auf den Gang. Ich schaffte es bis zum nächsten Mülleimer – und übergab mich. Meine Eingeweide schienen sich wie jedes Mal von einer Sekunde zur nächsten in flüssige Lava verwandelt zu haben. Alles um mich war verschwommen. Ein weiterer bitterer Schwall. In meinem Magen war nichts außer Galle. Im selben Augenblick, in dem meine Knie nachgaben, legte sich ein Arm um meine Mitte und hielt mich aufrecht.
»Hol unsere Sachen! Ich bringe sie nach Hause!« Adrien! Wieder zog mein Magen sich zusammen. Etwas Schwarzes. Den Gang hinunter zurück zum Saal. Ich würgte. Immer wieder. Bis endlich nichts mehr kam. Nur der Arm verhinderte, dass ich zusammenbrach. Jemand wischte mir mit einem Taschentuch den Mund ab. Meine Kehle brannte. Hob mich hoch. Trug mich. Setzte mich wieder ab. Ein Auto. Eine Jacke wurde über mich gebreitet. Eine Tür schlug, gleich darauf eine zweite, dann noch eine. Der Motor sprang an. Nicht das vertraute Dröhnen der Corvette Sting Ray. Ich zog die Beine an den Leib, presste die Arme auf den Bauch. Julien! Ich wollte Julien.
Wie aus weiter Ferne nahm ich wahr, dass der Wagen irgendwann anhielt. Erneut das Schlagen einer Tür, wieder Arme, die mich hochhoben. Ich erkannte das Hale-Anwesen. Zu Hause. Gleich darauf trug Adrien mich die Treppe hinauf, in mein Zimmer im ersten Stock, und legte mich auf mein Bett. Ich drehte mich auf die Seite, kauerte mich zusammen.
»Danke.« Ich war mir nicht sicher, ob ich das Wort verständlich hervorbrachte. Adrien beugte sich über mich, griff nach dem zweiten Kissen – und drückte es mir aufs Gesicht.
Obwohl die Sonne scheint, ist es kalt. Das Meer ist unruhig. Der Wind, der von See in die Calanque hereinweht, klatscht die Wellen hoch gegen die zerklüfteten Karstfelsen. Weiter drinnen wäre es sicherlich ruhiger. Aber genau deshalb habe ich diese Stelle damals ausgesucht. Weil nur diese Wand hier senkrecht aufragt und sich teilweise sogar über das Wasser hinausneigt. Selbst mit der entsprechenden Ausrüstung weder von oben noch von der Seite zu erreichen. Auch nicht für einen geübten Kletterer. Nur der Weg von einem Boot aus nach oben. Ein Mensch, der es hier versucht, ist lebensmüde. Vor allem, nachdem es tiefer in der Calanque sehr viel einfachere und von der Aussicht schönere Aufstiege gibt. Allerdings ist dieses Versteck eher meinem Versprechen gegen Papa geschuldet. Bis vor Kurzem war es mir gleichgültig, ob nicht – wider Erwarten – doch irgendein verrückter Kletterer das Blut findet. Jetzt sitzt die Angst in meinen Gedanken, dass es nicht mehr da sein könnte.
Die Taue zu kontrollieren, die das kleine Sportboot zwischen den aus dem Meer ragenden Felszacken halten werden, ist reine Gewohnheit. Etwas, das Papa uns eingebleut hat, als erAdrienund mir unsere erste Jolle schenkte. Vom Meer aus ist diese Stelle nicht einzusehen. Falls irgendwelche Touristen die Sonne heute nutzen und sich an der Küste entlangschippern lassen, werden sie mein Boot nicht entdecken. Auch wenn das mehr als unwahrscheinlich ist. Wir haben November. Die Saison für Sonnenhungrige in Marseille ist vorbei. Dazu der Seegang. Selbst wenn ich das Boot nicht schon von den Staaten aus gechartert hätte, hätte ich wohl keine Schwierigkeiten gehabt, heute eines zu bekommen. Allerdings hätte mich das unnötig Zeit gekostet. So hat der Bootsverleiher alles erledigt und mir auch die entsprechende Kletterausrüstung besorgt. Ein Service, den er nicht jedem seiner Kunden bietet. Aber man bekommt auch heutzutage in Marseille noch immer alles Nötige, wenn man nur die entsprechenden Preise zahlt. Mit einem Grund, weshalb meine Wahl auf ihn gefallen ist. Er hat mir sogar das Edelstahlseil und alles andere beschafft.
Die Fender werden das Boot davor bewahren, vom Wasser gegen die Felsen gedrückt zu werden. Mit einem Fuß auf dem Rohr der Reling das Gleichgewicht zu halten, ist deutlich einfacher, als auf einem Hochseil stillzustehen und Geige zu spielen. Die Wellen heben das Boot in die Höhe. Die Taue knirschen. Ein Griff in das helle, beinah weiße Gestein und abstoßen. Das Boot sackt unter mir weg. Gischt spritzt. Nässe durchdringt meine Jeans. Ich habe Halt. Keine Kunst in dem ausgewaschenen Karst. Ein weiterer meiner ›Flirts mit dem Tod‹, wieAdriendas immer nannte: Freeclimbing. Kein Berg zu hoch, keine Wand zu steil, kein Überhang zu waagerecht. Wenn er wüsste, dass ich tatsächlich darüber nachgedacht habe, ein paar Sicherungshaken und ein Seil auf die Liste des Bootsverleihers zu setzen, würde er sich vermutlich Sorgen machen.
Heute ist mein Aufstieg kein Flirt mit dem Tod. Das Ziel ist eine in der zerklüfteten Wand kaum auszumachende Spalte etwa fünfzehn Meter über mir und ungefähr vier nach links versetzt. Für meine Verhältnisse bin ich langsam. Immer nur einen Halt lösen und einen neuen sicher finden, ehe ich den alten aufgebe. Der Fels ist kühl. Rau. Fühlt sich vertraut an. Früher waren wir bei gutem Wetter häufig hier draußen zum Klettern. Auch in den anderen Calanques oder auf der Île Maïre und am Cap Croisette. Vor allem nachdem Papa dahintergekommen war, was wir auf der Île d’If trieben, und sie daher für uns zum Sperrgebiet erklärt hatte. Nicht dass wir uns daran gehalten hätten. Wir waren nur vorsichtiger, nicht wieder erwischt zu werden. Wenn er das mit den Ketten herausgefunden hätte, hätten wir mindestens drei Wochen nicht sitzen können. Und der Stubenarrest, den er uns verpasst hätte, wäre lange genug gewesen, um uns eine Vorstellung davon zu geben, wie Dumas’ Edmond Dantes sich im Kerker des Château d’If gefühlt haben muss.
Hier, direkt über dem Meer, wächst noch immer nichts. Selbst den Möwen ist es zu ungemütlich. Weiter in den Calanques findet schon mal das ein oder andere Kraut Halt auf den Felsen oder ein Vogel baut sein Nest. Raoul hätte jedes einzelne mit Namen gekannt. Er hat sie alle Cathérine gezeigt. Ein Seil schwingt hin und her. Sein leises Knarren. Staub rieselt von dem Balken. Die Tauben scharren und … Ein falscher Tritt! Der Felsen bricht. Für einen Moment hänge ich nur an den Händen. Dann finde ich wieder Halt. – Eine kurze Unaufmerksamkeit genügt und das hier wird unschön. Ein Sturz wäre auf jeden Fall äußerst schmerzhaft. Und auf den Felsen dort unten kann man sich problemlos das Genick brechen, wenn man sich dumm anstellt. – Willst dumichnachholen, Cathi? Im Augenblick ist der Zeitpunkt äußerst schlecht. Gedulde dich noch ein wenig. Wenn das hier schiefgeht, komme ich ohnehin freiwillig.
Ich löse die Hände nacheinander und wische sie an den Jeans ab. Rücke das Stahlseil über meiner Schulter und den Beutel mit dem, was ich noch brauche, zurecht, ehe ich weiterklettere.
Je höher ich komme, umso heftiger reißt der Wind an mir. Die Wellen tragen weiße Schaumkronen. Unter mir spritzt die Gischt höher hinauf als noch vor wenigen Minuten. Offenbar bekommen wir einen Sturm. Der Sonnenschein ist manchmal trügerisch. Ich sollte mich beeilen, wenn ich hier nicht festsitzen will.
Die Spalte ist noch genauso eng, wie ich sie in Erinnerung habe. Kaum erreichbar. Der Fels bietet hier so gut wie keinen Halt. Erst nachdem ich dasSeilund den Beutel mit den übrigen Utensilien hineingeworfen habe, kann ichmichhindurchzwängen.
Von draußen fällt gerade genug Licht durch die Spalte, um die ersten Meter dahinter zu beleuchten. Dann brauche selbst ich eine Taschenlampe. Auch nachdem ich die getönte Brille abgenommen habe.
Zwischen den Felsen ist gerade genug Platz, dass ichmichseitlich vorwärtsschieben kann. Das Gestein um mich herum ist hell, teilweise fast weiß. Der Boden an manchen Stellen von Rissen zerfressen, an anderen glatt gewaschen.
Ein Stück tiefer gabelt sich die Spalte. Nach links geht es sanft abwärts,wirdsie breiter, öffnet sich nach knapp sechs oder sieben Metern in eine Höhle, in der sich Wasser zu einem See gesammelt hat. Nur hüfttief. Im Licht strahlend blau. Damals war das zumindest so. Am nördlichen Ende ist eine Wand mit Malereien bedeckt. Robben, Wisente und anderes Getier. Um den See herum ein Wald aus Stalagmiten und Stalaktiten. Ein paar davon zusammengewachsen. Wunderschön. Einer von jenen Orten, die ich Dawn gerne zeigen würde. Aber nicht kann. Sie auch nur in die Nähe von Marseille zu bringen, wäre Wahnsinn.
Ich will nach rechts. Hier geht es deutlich steiler abwärts. Irgendwo tropft Wasser. Hat es angefangen zu regnen? Wäre nicht gut.
Wie in einem Felskamin muss ichmichzu beiden Seiten mit Händen und Füßen abstützen. Welcher Teufel hat mich eigentlich damals geritten, hier herunterzuklettern? Papa hat schon geflucht, als ich ihm die Spalte gezeigt habe, aber hier … dass er solche Ausdrücke kannte, hat mein Weltbild seinerzeit ein klein wenig erschüttert. Doch er hatte keine andere Wahl, als mich zu begleiten. Offiziell weiß immer nur der Kideimon, wo dasBlutverborgen ist. Inoffiziell sind es zwei: der alte und der nächste Hüter. Bei unserer Art wäre alles andere reine Unvernunft. Und wennAdrienbei dieser Farce von einem Prozess damals die Klappe gehalten hätte, wüsste es heute gar niemand mehr. Genau das war mein Plan. Es wäre vorbei gewesen; mit mir und mit ihrem kostbaren Blut. – Wenn er den Fürsten damals tatsächlich nicht gesagt hätte, dass Papa nicht ihm, sondern mir das Amt des Kideimon übergeben hat, hätte ich Dawn nie kennenlernen dürfen. Scheint so, als müsste ich ihm doch dafür dankbar sein, dass ich es nicht beenden konnte. – Ob Gérard wusste, dass Papa der Kideimon war? Unzählige Male habe ich mich das schon gefragt.
Am Ende treffe ich auf den Felssims, nicht mehr als einen knappen Meter habe ich als Tritt. Dort, wo ich hinwill, ist er nur noch halb so breit. Daneben geht es senkrecht in die Tiefe. Es dauert verdammt lang, bis ein Stein den Boden dieses Nichts erreicht hat.
Zweihundertsiebenundachtzig Schritte vom Ende des Felsschachtes aus. Ab einem gewissen Punkt schiebe ichmichmit dem Rücken am Stein entlang. Kein Risiko diesmal.
Die Überreste des Seils von damals hängen noch dort drüben. Wir haben es seinerzeit nur auf dieser Seite gekappt.
Ungefähr zwölf oder dreizehn Meter. Zu weit, um hinüberzuspringen. Ohne Platz, um ein paar Schritte Anlauf zu nehmen. Auch für jemanden wie mich. Das Ende des Seiles hinüberzubefördern war damals schon ein kleines Kunststück. Dieses Malwirdes nicht anders.
Erst beim dritten Versuch verhakt sich der Wurfanker auf der anderen Seite sicher. So, dass selbst ich ihn nicht wieder losreißen kann. DasSeilhier zu verankern ist vergleichsweise einfach. Ein Haken, dessen Ende man in den Felsen treibt und dessen Spitze man sich mittels eines Gewindes ins Gestein hineinspreizen lässt. Möglichst dicht über dem Boden. Vorspannen und dann mit einer Ratsche nachziehen, so fest es geht.
Als ich endlich fertig bin, entspricht die Spannung des Seils nicht wirklich der eines Hochseils. Um das zu erreichen, wäre eine Ausrüstung nötig gewesen, für die hier kein Platz ist. So hat es eher Slackline-Tendenz.
Ohne Schuhe steige ich auf das Seil. Brauche einen Moment, um mein Gleichgewicht zu finden. Hier, in einer Höhle, fühlt es sich anders unter den Füßen an als im Freien, wie ich es gewohnt bin. Es spricht nicht so, wie ich es kenne. Die Taschenlampe ist in einen Riss in den Felsen hinter mir geklemmt. Ihr Licht reicht mühelos bis zur gegenüberliegenden Wand.
Die Arme leicht zur Seite gestreckt gehe ich los. Schritt. Ich muss ganz anders balancieren als auf einem richtig gespannten Seil. Schritt. Unter mir das schwarze Nichts. Schritt. Ein Teil von mir wartet auf den Ruck. Höhnt, dass dasSeilplötzlich nicht mehr da sein wird. Wie damals. Schritt. Mir gegenüber zuckt mein Schatten. Schritt. Schritt …
Es braucht einen gefährlich langen Schritt, um jenseits der Spalte vomSeilauf den Boden zu gelangen. Ich lassemichvon meinem eigenen Schwung gegen die Felswand tragen. Schließe für einen Moment die Augen. Meine Hände sind schweißnass. Wie jedes Mal seit meinem Sturz, wenn ich auf ein Seil gehe. Ein noch immer irgendwie zittriger Atemzug, ich stoße mich von dem rauen Stein ab. Auch auf dieser Seite ist der Sims gerade breit genug zum Stehen. Der Riss im Fels ist nur einen guten halben Meter von mir entfernt. Ungefähr in Schulterhöhe. Ich strecke den Arm hinein, soweit es geht. Den Ärmel muss ich bis zur Achsel hochschieben. Taste. Nichts. Nein! Das ist nicht möglich. Es kann niemand hier gewesen sein. Ich drücke mich fester gegen die Wand, gewinne ein paar Zentimeter. Taste wieder. Wieder nichts … Doch! Da! Gerade noch in Reichweite meiner Fingerspitzen. Dem Himmel sei Dank!
Vorsichtig rolle ich das Röhrchen ein Stückchen weiter zu mir heran, bis ich es besser zu fassen bekomme, hole es behutsam endgültig aus seinem Versteck. Es funktioniert nur, wenn ich es längs zwischen zwei Finger klemme. Einzig auf diese Weise kann ich die Hand wieder aus dem Riss ziehen.
Es ist nicht länger als mein Ringfinger. Mit ungefähr dem gleichen Umfang. Sein Gold ist matt geworden. Das Wachs, mit dem wir den Verschluss in seiner Mitte versiegelt haben, ist hart. Mit dem Fingernagel breche ich es auf. Das Gewinde kreischt, als ich es aufschraube, und im ersten Moment braucht es einiges an Kraft, ehe sich überhaupt etwas bewegt. In seinem Inneren verbirgt sich eine Glasphiole. Ebenfalls versiegelt. Und darin wiederum ein dunkles Pulver. Fast schwarz. Es rieselt von einer Seite auf die andere, als ich sie kippe. Wirkt … harmlos. Dabei sagt man ihm Unmögliches nach. Habe ich mir tatsächlich Sorgen gemacht, es könne in den vergangenen Jahrzehnten verrottet sein? Nachdem es zuvor Jahrhunderte überdauert hat? Was für ein Idiot ich doch bin.
Verzeih mir, Papa. Ich verrate, was dir heilig war. Aber … das hier bedeute mir nichts und Dawn … alles.
Ich schraube die goldene Hülle wieder zusammen. Erneut Kreischen.
Am einen Ende ist eine Öse. Gut möglich, dass einer meiner Vorgänger es immer bei sich getragen hat. Vielleicht ist es tatsächlich besser, wenn ich es nicht einfach in die Hosentasche stecke. Meine Hände zittern ein wenig, als ich es zu dem St.-Georgs-Amulett an meine Kette fasse. Ich lasse sie unter mein Hemd zurückgleiten. Das Gold des Röhrchens fühlt sich kalt und auf verwirrende Weise zugleich warm an.
Ich brauche zwei Anläufe, um zurück auf dasSeilzu kommen. Es ist schlicht knapp zehn Zentimeter zu weit über dem Boden, um für mich noch bequem zu sein. Und abermals fühlt es sich auf dem Weg hinüber irritierend fremd unter den Füßen an. Die Stimme ist wieder da. Vielleicht hätte ich in den letzten Jahren ein bisschen häufiger auf einSeilgehen sollen, um sie gründlicher zum Schweigen zu bringen. In Dubai hätte ich genügend Zeit gehabt.
Zurück auf der anderen Seite löse ich nur das Seil. Mit einem Zischen rasselt es durch die Ratsche und schlägt klatschend unten in der Spalte gegen den Fels. Alles andere bleibt, wie es ist. Ganz abgesehen davon, dass es mehr als unwahrscheinlich ist, dass hier tatsächlich noch einmal jemand herkommen wird, werde ich ohnehin ein anderes Versteck für das Blut suchen. Sofern das überhaupt nötig sein wird.
Ohne dasSeilund den Beutel komme ich auf dem Rückweg deutlich schneller voran. Jenseits der Spalte ist der Fels nass. Es muss tatsächlich geregnet haben, während ich im Innern war. Wie dasSeilund das übrige Equipment lasse ich auch die Taschenlampe einfach in der Spalte zurück.
Der Abstieg gestaltet sich kaum schwieriger als der Aufstieg. Im Gegenteil. Eine dichte Wolkendecke hängt grau und drohend tief über dem Meer. Bei diesem Licht werde ich noch nicht einmal die Brille brauchen.
Das Boot wirft sich am Fuß der Wand unruhig auf den Wellen hin und her. Die Felsen haben den Fendern übel mitgespielt. Selbst von hier ist das nicht zu übersehen. Der Sturm lässt offenbar trotzdem noch auf sich warten. Gut.
Um an Bord zurückzugelangen, braucht es nicht mehr als einen Sprung und eine halbe Drehung in der Luft. Das Deck ist glatt. Die Sitze nass.
Ich zerre das Handy aus der Hosentasche, während ich noch die Taue löse. Die Nummer von di Ulderes Piloten habe ich im Kopf. Er geht nach dem zweiten Klingeln ran.
Ich werde Dawn nicht noch eine weitere Nacht mit ihren Albträumen allein lassen. »In spätestens zwei Stunden bin ich am Flughafen. Sorgen Sie bitte dafür, dass wir ohne Verzögerung starten können. – Egal wie das Wetter dann aussieht. Jeder Preis ist akzeptabel.« Auch wenn ich nicht weiß, wie ich das Geld aufbringen soll, sollte es tatsächlich nötig sein.
»Natürlich, Sir.« Mehr braucht es nicht. Wir legen beinah gleichzeitig auf. Sie wird trinken müssen, wenn ich zurückkomme. Vielleicht ergibt sich in Marseille noch eine Gelegenheit zur Jagd. Ich könnte mein Glück im Panier versuchen. Nein. Zu weit. Eine der Kneipen direkt am Alten Hafen wird es tun. Der Wind zerrt an meinen Haaren und peitscht sie mir in die Augen. Draußen vor der Einfahrt in die Calanque ist das Meer dunkel. Die Wellen schlagen gefährlich hoch.
Vielleicht können Legenden meinen Traum retten.
Der Wind trägt das Geräusch eines anderen Bootes zu mir. Ein Rennboot, dem Klang des Motors nach. Durchaus möglich, dass es ein paar PS mehr hat als dieses. Eine Witterung hängt daran. Unverkennbar. Mindestens einer davon hatte erst kürzlich direkten Kontakt mit Gérard. Wenigstens steht er im Moment günstig für mich. Sie fahren an der Calanque vorbei. Dummköpfe. – Trotzdem. Das kann kein Zufall sein. Woher wissen sie, dass ich hier bin? Der Bootsverleiher kennt nur einen falschen Namen und ein falsches Ziel. Es ist noch nicht einmal derselbe, unter dem ich eingereist bin. Di Uldere? Unwahrscheinlich. Er kennt auch nur das Flugziel. Aber nicht ausgeschlossen. Wir werden sehen.
Ich warte gerade lange genug, um sicher zu sein, dass auch sie den Motor meines Bootes nicht mehr hören können, ehe ich ihn starte. Selbst jetzt lasse ich ihn nur gedrosselt laufen, damit er möglichst wenig Lärm macht. Draußen auf dem Meer ist die Witterung verweht. Keine Spur mehr davon. Der Bug hebt sich aus dem Wasser, als ich den Gashebel bis zum Anschlag vorschiebe. Mein Boot schießt über die Wellen. Jede kracht bei dieser Geschwindigkeit mit einem dumpfen Schlag gegen den Rumpf.
Ich werde in Bangor jagen müssen. Oder direkt in Ashland Falls. Hier in Marseille könnte ich die Beute werden.
Bruderzwist
Adrien hatte mich töten wollen und ich war noch am Leben! Das war irgendwie schwer vorstellbar, eigentlich ein Widerspruch in sich. Wenn Adrien – oder Julien – jemanden töten wollte, dann überlebte man das nicht. Punkt. Und trotzdem lag ich auf meinem Bett und atmete. Finde den Fehler, Dawnie. Dummerweise verweigerte mein Gehirn die Zusammenarbeit.
Mein Hals brannte und meine Brust tat weh. Ich erinnerte mich daran, dass ich geschrien hatte, als er mir vollkommen unvermittelt das Kissen – Juliens Kissen – aufs Gesicht drückte, dass ich mich unter ihm wand, dass ich kämpfte, keine Luft mehr bekam. Und dass es dunkel um mich geworden war, als ich erstickte. Natürlich. Ich hatte niemals eine Chance gegen Adrien. Er war ungleich stärker als ich. Und schneller. Und wusste der Himmel was nicht noch alles. Immerhin war er kein Mensch. Er war ein Lamia! Ebenso wie sein Zwilling. Wer die Unterschiede nicht kannte, hätte sie und ihresgleichen vielleicht als Vampire bezeichnet. Tatsache war: Lamia wurden wie normale Menschen geboren und machten meist um ihr zwanzigstes, fünfundzwanzigstes Lebensjahr den Wechsel zu einem richtigen Lamia durch, in dessen Anschluss sie sich nur noch von Blut ernährten. Vampire wurden von ihnen geschaffen – und standen in der Hierarchie ihrer Welt offenbar deutlich unter ihren Erschaffern.
Ganz nebenbei gehörten Adrien und Julien zu den Vourdranj, jenen gefürchteten Killern, die für den Rat der Fürsten die Jäger und Henker spielten, wenn irgendeiner der übrigen Lamia und Vampire sich etwas zuschulden kommen ließ. Wenn er wollte, könnte er mir vermutlich mit einer Hand das Genick brechen, ohne dass ich es im ersten Augenblick überhaupt bemerkte. Er brauchte kein Kissen, um mich umzubringen. Wahrscheinlich rangierte das unter Fingerübung. Und trotzdem lag ich hier und atmete, war ich immer noch am Leben. Ich sollte Angst haben. Aber vielleicht war das in den letzten Wochen einfach ein bisschen zu viel für mich gewesen, denn seltsamerweise war da nur die dumpfe Frage Warum? –Warum hatte er mich töten wollen? Warum war ich noch am Leben? Und einmal mehr: Warum war er hier?
Ob er bei mir im Raum war? Ich konnte es nicht sagen. Und selbst wenn, würde tot stellen mir nicht viel nützen. Lamia waren nicht nur schneller und stärker als Menschen, sie verfügten auch über die feinen Sinne von Raubtieren. Vermutlich hatte er gehört, dass mein Atem anders ging oder mein Herzschlag seinen Rhythmus beschleunigt hatte. Abgesehen davon hatte ich mich, seit ich zu mir gekommen war, garantiert unbewusst bewegt oder irgendwelche Laute von mir gegeben.
Dennoch öffnete ich die Augen ziemlich zögerlich. Über mir war die Decke meines Zimmers. Dem Licht nach zu urteilen musste es später Nachmittag sein. Allzu lange war ich demnach wohl nicht bewusstlos gewesen. Es war still. Langsam wandte ich den Kopf. Adrien saß in meinem Rattan-Schaukelstuhl und sah durch die Glastüren zum Balkon hinaus. Er schien mich überhaupt nicht zu beachten. Die dunkle Brille, die er in der Schule getragen hatte, baumelte an einem Bügel von seinem Finger. Ich lag wie erstarrt. Die Angst, auf die ich bis eben vergeblich gewartet hatte, war plötzlich da. Schnürte mir die Kehle zu, nahm mir den Atem und machte meine Hände feucht.
Als er irgendwann zu mir hersah, erstarrte ich ein Stück mehr – sofern das überhaupt möglich war. Dieses Mal war ich mir sicher, dass ich mich weder bewegt noch einen Laut von mir gegeben hatte. Fühlte sich so ein Kaninchen im Angesicht einer Kobra? Doch sein Blick ruhte nicht auf mir, sondern auf meinem Nachttisch. Genauer gesagt auf meiner Ausgabe von Oscar Wildes Das Bildnis des Dorian Gray, die ich – nachdem ich heute Morgen an ihrer Stelle Melvilles Moby Dick in meine Tasche gestopft hatte – achtlos dort liegen gelassen hatte. Sehr, sehr vorsichtig wagte ich es, mich aufzusetzen.
»Er hat ihr immer vorgelesen. – Dorian Gray war ihr Lieblingsbuch.« Seine Stimme klang, als würde er nicht mit mir sprechen. Ich krallte die Finger in meine Decke. Er, Julien, und ihr konnte nur Cathérine sein. »Poe, Dumas, Wilde, Dunsany, Stevenson, Verne, Zola, Hugo, Barrie … Sie lagen eigentlich jeden Abend vor dem Kamin im privaten Salon und er hat ihr vorgelesen. Und immer wieder hat sie um den Dorian Gray gebettelt. – Er war ihr Held, ihr Ritter in weißer Rüstung. Egal was sie angestellt hat, wenn er konnte, hat er sie jedes Mal rausgehauen und obendrein noch gedeckt.« Adrien schüttelte den Kopf, als könne er es nach all der Zeit noch immer nicht glauben. »Hat er dir gesagt, dass er es war, der sie gefunden hat? Am Seil? Mit gebrochenem Genick? Lass mich raten: Hat er nicht. Natürlich. – Sie hatte seit Wochen kein Wort mehr mit ihm gesprochen. An diesem Tag wollten Freunde von der Resistance uns aus Marseille schmuggeln. Alles war vorbereitet. Sie war … seltsam. Schon seit Stunden. Hat Julien sogar die Hand an die Wange gelegt. Dann ist sie noch einmal auf den Dachboden. Sie wollte noch irgendetwas erledigen. Wir dachten, sie wolle sich von der Katze verabschieden, die sich dort oben versteckt hatte. Sie hat manchmal Stunden bei dem Tier verbracht. – Sie kam nicht zurück. Eigentlich wollte ich ihr hinterher, aber dann … ist Julien gegangen.« Er sah wieder auf den Balkon hinaus.
Ich wagte nicht, mich zu rühren. O lieber Gott, Julien. Er hatte mir erzählt, dass seine Schwester ebenfalls Selbstmord begangen hatte, nachdem der junge Lamia – den Juilen zu einem Vampir gemacht hatte, um ihm das Leben zu retten – sich in der Sonne umgebracht hatte; aber nicht das.
»Ich habe meinen Bruder noch nie so schreien gehört. – Auch danach nie mehr. – Und dazwischen immer wieder: ›Cathérine! Nein! Nein! Nein!‹ Wieder und wieder. So laut, dass die Freunde, die uns versteckt hatten, fürchteten, er würde die Deutschen auf uns aufmerksam machen. Ich musste ihn mit Gewalt ruhigstellen. Wir konnten sie noch nicht einmal mehr begraben.« Adrien seufzte fast unhörbar. »Auf dem ganzen Weg nach Griechenland habe ich kaum ein Wort aus ihm herausbekommen. Ja, nein, ab und an ein Danke. Bei jedem Satz, der aus mehr als drei Worten bestand, habe ich ein bisschen Hoffnung geschöpft. – Ich habe erst ein paar Jahre später herausgefunden, dass er Papa versprochen hatte, auf Catherine aufzupassen. Ebenso wie auch auf mich.« Erst jetzt richteten seine Augen sich auf mich. Sie waren genauso quecksilbern wie die seines Bruders – und im Moment ein Stück dunkler, als Juliens es normalerweise waren. Ich schluckte hart. »An diesem Tag ist etwas in meinem Bruder zerbrochen. Er war … hart an der Grenze zum Wahnsinn. Sein Leben hat ihm nichts mehr bedeutet. In der ganzen Zeit seitdem gab es für ihn nur zwei Dinge: Rache an Gerard und wenigstens die zweite Hälfte seines Versprechens an Papa zu erfüllen, soweit es ihm möglich war.« Sein Mund verzog sich zu einer schmalen, harten Linie und sein Blick kehrte zu meinem Dorian Gray zurück. »Aus diesem Grund hat er auch die letzten Jahren in Dubai verbracht und nicht ich.« Er klemmte die Brille an die Hemdtasche.
»Was …« Ich biss mir auf die Zunge. Zu spät. Für einen Sekundenbruchteil zuckten seine Augen zu mir, doch dann erhob er sich abrupt, trat an die Glastür zum Balkon hinaus und lehnte sich dagegen, den Ellbogen gegen die Laibung gestemmt, die Faust an den Lippen. Wie oft hatte ich Julien in den letzten Tagen in genau der gleichen Haltung dort stehen sehen? Ich wagte nicht, auch nur einen Ton von mir zu geben.
»Welchen Grund hat Julien dir genannt, dafür, dass er in Dubai war?« Adriens Züge spiegelten sich schwach in der Scheibe. Zu schwach, als dass ich in ihnen hätte lesen können – sofern er nicht die gleiche kühle Maske aufgesetzt hatte, wie Julien das bei solchen Gelegenheiten gern tat.
Ich schluckte erneut, ehe ich antwortete. »Ich weiß nur, dass er dorthin verbannt wurde. Warum, hat er mir nie gesagt.«