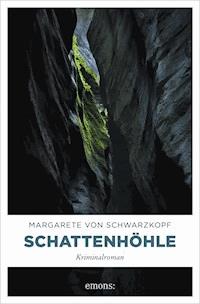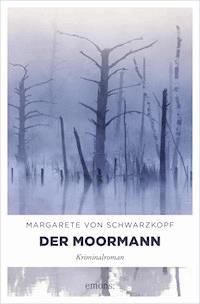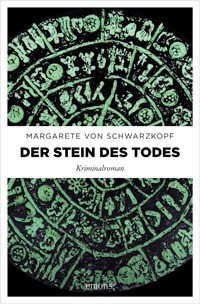Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Anna Bentorp
- Sprache: Deutsch
Mittendrin: Hobbyermittlerin Anna Bentorp. Eigentlich wollte Kunsthistorikerin Anna Bentorp nur das Haus sanieren, das ihre Tante ihr vermacht hat – stattdessen steht sie vor dem mysteriösesten Fall ihres Lebens. Wer sind die beiden Skelette im Keller, und was haben ein römisches Schwert und ein Mönch aus dem 16. Jahrhundert damit zu tun? Ein antikes Schriftstück könnte Aufklärung schaffen, aber es verschwindet spurlos. Und irgendwo lauert ein skrupelloser Mörder, der weder Moral noch Gewissen kennt..
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Margarete von Schwarzkopf, geboren in Wertheim am Main, studierte in Bonn und Freiburg Anglistik und Geschichte. Sie arbeitete zunächst für die Katholische Nachrichtenagentur, dann als Feuilletonredakteurin bei der »Welt« und viele Jahre beim NDR als Redakteurin für Literatur und Film. Heute ist sie als freie Journalistin, Autorin, Literaturkritikerin und Moderatorin tätig.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Dave Wall/Arcangel.com
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Hilla Czinczoll
E-Book-Produktion: CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-9604-1761-3
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für meine Familie (TLF), insbesondere meinen Mann, und für unsere Freunde in guten und in schlechten Zeiten
Land und Leute könnten voller Ruhe sein, Wären nicht zwei kleine Wörter: mein und dein;Die wirken manche Wunder auf der Erde.Wie gehn sie rüttelnd, wie so wütend überallUnd treiben alle Welt herum wie einen Ball.Ich denke ihres Krieges nie mehr Ende werde.
Gottfried von Straßburg (gestorben um 1215), aus »Tristan« (entstanden 1210)
Prolog
Köln im November A. D. 1520
Die Öllampe spendete wenig Licht. In dem hohen Raum sammelte sich die Kühle des spätherbstlichen Abends, gegen die das kleine Feuer im Kamin kaum ankam. Ambrosius seufzte und legte den Federkiel beiseite. Er rieb sich die Augen. Seit drei Tagen und fast auch drei Nächten brütete er über einem Text, den er aus dem Lateinischen ins Deutsche übertrug. Seit er diese alte Handschrift durch Zufall in einem Schrank in der Eingangshalle des Klosters entdeckt hatte, vergraben hinter Vasen aus Ton, mottenzerfressenen Büchern und zerbrochenen Gläsern, verbrachte er jede freie Minute damit.
Er hatte den Schrank aus- und aufräumen sollen, eigentlich keine ihm würdige Arbeit. Aber alles Murren half nichts. Die Arbeit musste getan werden, da dieser alte Schrank bereits von Holzwürmern so stark befallen war, dass Abt Hieronymus einen neuen an seinen Platz stellen lassen wollte, einen sehr viel schöneren aus soliden Eichenbohlen, der sogar mit Malereien verziert sein würde. Als Ambrosius die vergitterten Türen des alten Schrankes geöffnet hatte, waren ihm sofort etliche ramponierte Trinkgefäße aus Zinn entgegengepurzelt. Sie stanken nach abgestandenem Wein. Wer mochte das Geschirr wohl vor längerer Zeit in diesen Schrank gestellt haben? Und wer hatte diese zerfledderten Kutten darin aufgehängt, die fürchterlich müffelten? Der arme Schrank war offensichtlich sehr lange nicht mehr entrümpelt worden. Wahrscheinlich das letzte Mal unter Abt Hugo vor gut zehn Jahren.
Mit verbissener Miene räumte der junge Mönch den ganzen Plunder heraus und stopfte fast alles in Leinensäcke, die er später würde entsorgen müssen. Stöhnend wischte er sich den Schweiß von der Stirn. Dies wäre eher eine Arbeit für den Novizen Gregorius gewesen. Aber der ordnete sicherlich einmal mehr mit Pater Albert die Weinvorräte. Gregorius wurde seit seinem ersten Tag im Kloster vor vier Wochen mit Samthandschuhen angefasst, da der Abt aus demselben Dorf am Niederrhein stammte wie der zarte Novize mit den seelenvollen Augen.
Verdrossen zog Ambrosius ein Stück Abfall nach dem anderen aus dem Schrank und füllte die Säcke damit. Auf dem obersten Regal erblickte er plötzlich einen hölzernen Kasten mit hübschen Verzierungen aus Metall. Er zog ihn heraus und öffnete das Kästchen. Darin lag ein Bündel mit Blättern aus Pergament. Sie waren eng beschrieben und nur wenig verblichen.
Behutsam nahm Ambrosius die Seiten aus dem Kästchen. Sein Latein war zwar gut, doch hatte er zunächst ein wenig Mühe, die Schrift zu entziffern. Diese Dokumente mussten sehr alt sein. Wie sie in den Schrank gelangt waren, ahnte er nicht. Das Kloster Sankt Gallus war vor fünfhundert Jahren auf den Überresten einer Kapelle zu Ehren des heiligen Bonifatius errichtet und immer wieder erweitert worden. Diese Kapelle wiederum hatte man auf der Ruine eines römischen Tempels zu Ehren der Venus erbaut. Der Schrank selbst konnte noch nicht älter als ein- oder zweihundert Jahre sein und stand wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten am selben Platz. Das Kästchen dagegen wirkte wesentlich älter. Köln war eine uralte Stadt, deren Anfänge sogar in die vorrömische Zeit zurückreichten. Seit mehr als eintausend Jahren hatte es hier Kirchen- und Klostergründungen gegeben. Es wunderte Ambrosius nicht, dass man überall noch Relikte aus älteren Epochen fand.
Freudige Erregung stieg in ihm auf. Diese Papiere waren alt, schienen ihrerseits aber Kopien eines noch älteren Textes zu sein. Das Latein glich nicht dem Kirchenlatein, sondern eher den klassischen Texten, die der junge Ambrosius in seinem Heimatdorf unter Aufsicht des Pfarrers studiert hatte. Da hatte jemand sehr viel Mühe aufgewandt, einen Originaltext abzuschreiben, der ursprünglich vielleicht sogar auf Wachstafeln geritzt oder auf Papyrus niedergelegt worden war. Das allein weckte schon die Neugier bei Ambrosius, der Herausforderungen liebte.
Er versteckte seinen Fund unter seiner Kutte. Als der Abt gegen Abend kurz vor der Vesper auftauchte, um zu überprüfen, wie weit Ambrosius mit dem Ausräumen des alten Möbels gediehen war, fand er einen leeren Schrank vor und daneben drei Säcke mit Abfällen. Er nickte zufrieden und verkündete beim Abendmahl, dass der Schrank demnächst abgeholt und ein neuer an seine Stelle gestellt würde. Ambrosius schmunzelte und machte sich noch am selben Abend im Skriptorium ans Werk, den Text zu entziffern. Er würde niemandem von der Handschrift erzählen, auch seinem besten Freund im Kloster nicht, Bruder Markus, der aus einem benachbarten Dorf in der Eifel stammte und den er seit seiner Kindheit kannte.
Da er als guter Schreiber galt, wunderte sich keiner seiner Ordensbrüder, dass Ambrosius emsig arbeitete. Er übernahm gern Abschriften von Urkunden und alten Briefen und übersetzte das eine oder andere Schriftstück ins Deutsche. Seine Ordensbrüder waren mit eigenen Aufgaben beschäftigt und kümmerten sich nicht um den jungen Mönch, der noch am späteren Abend im Halbdunkel des kühlen Skriptoriums saß. Nur Gregorius, der Novize vom Niederrhein, war um Ambrosius herumgeschlichen und hatte ihn schließlich gefragt, an was er denn da so eifrig arbeite.
»Ich soll einen Bibeltext abschreiben«, antwortete Ambrosius kurz angebunden. Dabei log er nicht einmal, denn das war derzeit seine eigentliche Aufgabe. Er schob seinen Fund aus dem alten Schrank unter das Buch und arbeitete eine Weile gewissenhaft an seiner Abschrift. Er mochte Gregorius nicht, empfand ihn als aufdringlich und frech.
Gregorius blickte ihn mit leisem Zweifel an und trollte sich. Ambrosius achtete nicht weiter auf ihn. Er würde später weiter an der Übersetzung basteln und die Vorlage und seinen Text danach wieder verstecken. Denn längst hatte er erkannt, dass dieser Text brisant war und ein Geheimnis aus alter Zeit barg.
Ambrosius hatte den Zeilen bisher entnehmen können, dass der ursprüngliche Autor des Textes, offenbar ein junger Römer namens Lucius, einem Familiengeheimnis auf der Spur war. Doch war er nur langsam mit seiner Übersetzung weitergekommen, da er immer wieder gestört wurde.
An diesem Abend, drei Tage nach dem Fund der Handschrift, da er vor Müdigkeit seine Augen kaum mehr offen halten konnte, saß er wieder allein im Skriptorium. Der Wind heulte um das mächtige Klostergemäuer, die Äste der großen Eiche vor dem Skriptorium schlugen wie Trommelstöcke gegen das Fenster. Ambrosius fröstelte in dem Raum mit seinen kahlen Steinwänden und der hohen Decke. Er sah ein, dass er zu erschöpft war, um weiterzuschreiben, räumte sein Schreibzeug und die Pergamentseiten von seinem Pult und blickte sich um. Seine Brüder waren sicher alle längst in ihren Zellen.
Der feuchte Abend war einer regenreichen Nacht gewichen. Es musste schon auf die Mitternacht zugehen. Nur noch zwei Stunden bis zur Matutin, dem ersten Tagesgebet. Ambrosius ging zu einem Regal, auf dem illuminierte Bücher lagen und das Schreibgerät der anderen Mönche stand. Wieder sah er sich um. Seine Öllampe zuckte in den letzten Zügen, aber der große Raum wurde noch spärlich von einigen Fackeln erleuchtet. Die Pulte ragten schwarz in die wabernde Dämmerung des Saals. Kein Geräusch außer dem Wind in den Zweigen der Eiche und dem gleichmäßigen Rauschen des Herbstregens, der seit mehreren Stunden ohne Unterlass vom Himmel floss. Ambrosius schob einige der Bücher beiseite. Behutsam legte er die Papiere an den hinteren Rand des Regals und zog die Bücher wieder davor, sodass sie die Schriften verdeckten.
»Aha, ich wusste doch, dass du etwas zu verbergen hast«, ertönte in diesem Moment hinter ihm die seidenweiche Stimme von Gregorius.
Ambrosius hatte den jungen Mann nicht kommen gehört. Jäh stand er nun hinter ihm, mit einer Kerze in der Hand und einem boshaft triumphierenden Lächeln auf seinem dünnen Gesicht, das Ambrosius an eine Spitzmaus erinnerte.
»Zeige mir doch mal, was es ist! Ich werde es auch niemandem weitersagen«, fuhr Gregorius fort. Das Kerzenlicht spiegelte sich in seinen hellgrauen Augen und verlieh ihnen einen unnatürlichen Glanz.
»Ich denke gar nicht daran«, antwortete Ambrosius. »Was spionierst du mir nach? Das geht dich nichts an!«
»Oh doch! Du bist schon seit einigen Tagen seltsam abwesend und ständig an deinem Pult. Das muss ja eine ganz besondere Handschrift sein, die dich so in Beschlag nimmt. Sicherlich keine Bibelabschrift! Sage mir doch einfach, um was es dabei geht. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Schreiben kann ich recht ordentlich.«
»Nein, Gregorius! Lass mich einfach in Ruhe und schere dich um deinen eigenen Kram.« Ambrosius spürte Ärger in sich aufsteigen.
Der Novize lächelte spöttisch. »Sicherlich wird Bruder Martinus sich auch dafür interessieren.«
Ambrosius zuckte zusammen. Bruder Martinus war ein älterer Mönch, der wie Gregorius und der Abt ebenfalls vom Niederrhein stammte und die Eltern von Gregorius gut kannte. Martinus hatte sich für den jungen Mann verbürgt, sodass er nach Sankt Gallus gekommen war. Seine Eltern hatten ihn ursprünglich nach Xanten schicken wollen und nicht in das weiter entfernt liegende und wesentlich größere Köln. Mit Martinus verstand sich Ambrosius nicht übermäßig gut. Martinus sah in ihm, obgleich Ambrosius fast dreißig Jahre jünger war, einen unliebsamen Rivalen. Denn bis Ambrosius ins Kloster eingetreten war, hatte niemand Martinus das Wasser reichen können, wenn es ums Schreiben und die Kenntnisse des Lateinischen ging. Doch der Junge aus der Eifel, der auf einem Bauernhof aufgewachsen war, übertraf den Älteren bei Weitem an Begabung.
»Wage es, du kleiner Mistkerl!«, rief er aus.
»Aber Ambrosius, was für Ausdrücke!« Gregorius wackelte mit dem Zeigefinger vor Ambrosius’ Nase. »Du scheinst ja wirklich ein schwerwiegendes Geheimnis zu hüten.« Er kicherte. »Martinus ist noch wach. Er ist in der Kapelle. Ich werde ihn am besten gleich holen. Du weißt ja, was mit Pater Konradin geschehen ist, den man dabei erwischt hat, Liebesgedichte von Ovid abzuschreiben. Martinus mag solche Heimlichkeiten gar nicht.« Gregorius hielt inne. Als er weitersprach, klang seine Stimme bedrohlich. »Oder willst du mir nicht lieber doch sagen, was du hier versteckst?«
Gregorius erkannte die Warnzeichen nicht, als er mit seinen unverschämten Worten dem jungen Mönch die Zornesröte ins Gesicht trieb. Ambrosius war von Haus aus gutmütig und hilfsbereit. Groß gewachsen mit kräftigen Armen, einem freundlichen Gesicht mit einem Grübchen im Kinn und ersten Lachfalten um seine klaren hellbraunen Augen. Aber eines war er nicht: geduldig. Schon seine Eltern hatten ihren viertältesten Sohn, dem ein knapp ein Jahr jüngerer Bruder, zwei Schwestern und drei kleinere Brüder nachfolgten, immer wieder ermahnt, weniger aufbrausend zu sein. Vor allem, wenn Ambrosius glaubte, dass jemand ungerecht behandelt wurde oder sich selbst nicht wehren konnte, warf er sich in die Bresche. Mancher Dorfjunge in dem kleinen Ort bei Dudeldorf hatte ein blaues Auge davongetragen, wenn Ambrosius seine Wut nicht mehr zügeln konnte und zuschlug.
Seine Eltern waren auch deshalb sehr dankbar gewesen, als ihr temperamentvoller Sohn nach Köln ins Kloster ging, unterstützt vom Dorfpriester, der die Gaben des Jungen schätzte und meinte, das Klosterleben würde Ambrosius’ Hang zum Jähzorn sicherlich mildern. »Verschwinde!«, rief er. »Geh mir aus dem Weg, du Widerling!«
Aber Gregorius stand mit über der Brust gekreuzten Armen direkt vor ihm und feixte. Ambrosius überkam eiskalte Wut. Dieser dreiste Bursche! Er versuchte, an ihm vorbeizukommen, doch Gregorius tänzelte vor ihm hin und her. Ein äußerst kindisches Betragen, das aber Ambrosius noch stärker reizte. Er schubste den kleineren Novizen kräftig, um sich an ihm vorbeizuschlängeln. Der taumelte rückwärts und fiel zu Boden. Dabei schlug er mit dem Hinterkopf auf den harten Stein und blieb reglos liegen.
Ambrosius ärgerte sich. Was sollte das Theater nun schon wieder! »Steh auf, komm schon!«, drängte er.
Aber Gregorius rührte sich nicht. Ambrosius spürte, wie eine eisige Welle über ihm zusammenschlug. Ihm stockte der Atem. Er kniete sich neben den Gestürzten und legte sein Ohr auf dessen Brust. Sie hob und senkte sich nicht mehr, und er vernahm keinen Herzschlag. Unter dem Kopf des Novizen breitete sich eine Blutlache aus. Ambrosius glaubte in einen Abgrund zu stürzen. Was hatte er getan? Sein Stoß hatte den Novizen wie ein Rammbock getroffen.
Ambrosius keuchte. Es war ein Unfall, aber dass Gregorius tot war, ließ sich durch nichts beschönigen. Was sollte er jetzt tun? Bruder Martinus rufen? Den Abt aus dem Schlaf reißen, versuchen, Bruder Clemens zu wecken, den Medicus des Klosters?
Wie sollte er das Unglück überzeugend erklären? Abt Hieronymus wusste, dass die beiden jungen Männer sich nicht sonderlich schätzten. Mehr als einmal waren sie wegen Nebensächlichkeiten miteinander in Streit geraten. Würde der Abt ihm glauben, dass er Gregorius aus Versehen zu heftig geschubst hatte und der sich beim Aufprall auf dem Boden eine tödliche Verletzung zugezogen hatte?
Egal, ob willentlich oder nicht, er hatte einen Menschen getötet. Ein schreckliches Verbrechen, eine Todsünde. Man würde ihn verhaften, und sein Schicksal wäre besiegelt. Vielleicht würde man ihn nicht hinrichten, aber in einen Kerker werfen und für immer aus dem Kloster verbannen. Diese Schande könnten seine Eltern, die ihn mit Liebe und Geduld erzogen hatten, niemals verwinden! Und auch seinen Brüdern und seinen beiden Schwestern, beide frisch verheiratet und schwanger, würde durch seine Tat das Leben vergällt werden. Einen Mörder in der Familie zu haben wäre ein Kainsmal.
Ambrosius sank auf seinen Stuhl und warf einen Blick auf den Toten. Gregorius sah aus, als ob er schliefe. Ambrosius überliefen Schauer der Angst und der Kälte, die den Raum immer mehr erfüllte, je später es wurde. Hätte er doch diese verfluchten Blätter nie gefunden! Auch wenn sie eine spannende Geschichte erzählten, in der es um Verrat, einen ungesühnten Mord und offensichtlich um das Geheimnis eines geraubten Schatzes ging, so hätte er nun gern darauf verzichtet. Aber nichts konnte den Toten wieder lebendig machen.
Ambrosius schluchzte auf. Sollte er fliehen? Die Papiere an sich nehmen und das Kloster verlassen? Aber wohin könnte er flüchten? Er wäre vogelfrei. Er konnte nicht nach Hause, und auch sonst gab es keinen Ort für ihn. Vor einigen Wochen hatte eine Geschichte die Runde gemacht, dass ein Priester, den man in Schande aus dem Kirchendienst entlassen hatte, sich im Hunsrück einer Räuberbande angeschlossen habe. Aber Ambrosius sah sich nicht als Mordbrenner durch die Lande ziehen. Was sollte er tun?
Als er sich verzweifelt umschaute, fiel sein Blick auf eine Tür in der Wand am anderen Ende des Skriptoriums. Dahinter ging eine steile Treppe hinunter in den Weinkeller des Klosters. Gregorius war, das wusste man, dem Wein trotz seines jugendlichen Alters von eben achtzehn Jahren nicht abgeneigt. Er hatte damit geprahlt, dass er schon als kleiner Junge seinen Vater in den »Wilden Hirschen« in seinem Dorf begleitet und mit zehn Jahren seinen ersten Krug Bier getrunken habe.
Was Ambrosius nun tat, vermochte er nie mehr aus seinem Gewissen zu verbannen. Aber er sah darin die einzige Möglichkeit, diese Katastrophe zu überstehen und zu überleben. Es bedeutete für ihn kaum Anstrengung, den eher zarten Gregorius vom Boden aufzuheben und zur Tür zu tragen. Das Blut auf den Steinplatten würde er gleich beseitigen. Es war nicht sehr viel. Er wankte zwar, als er den jungen Mann durch den dunklen Raum zur Tür schleppte. Aber nicht wegen der Last, sondern weil er sich seelisch ausgelaugt und erschöpft fühlte.
Als er ihn die Treppe zum Weinkeller hinunterwarf, glaubte er, einen schwachen Laut aus der Kehle des Novizen zu vernehmen, ein fast unhörbares Stöhnen. Ambrosius erstarrte. Doch es war zu spät. Mit einem dumpfen Ton schlug der Körper des Jungen am Fuß der Treppe auf. Und Ambrosius betete, dass er sich den flüchtigen Ton nur eingebildet hatte.
Als Pater Albert am nächsten Morgen nach dem Novizen fragte, der mit ihm zusammen die Kirche für die Sonntagsmesse schmücken sollte, war Gregorius nirgendwo zu finden. Die Mönche suchten ihn überall, und auch Ambrosius ging mit und spähte im Kreuzgang und im Kräutergarten, in der Kirche und in den Küchenräumen nach dem Verschwundenen. Schon munkelte man, der Junge habe das Kloster heimlich verlassen und sei in sein Dorf zurückgekehrt. Martinus erklärte sich bereit, den Ritt zum Dorf am Niederrhein auf sich zu nehmen, um nach dem Verbleib des Novizen zu forschen. Man vertagte dies erst einmal in der Hoffnung, der Junge würde wieder auftauchen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Novize für einige Stunden widerrechtlich das Kloster verlassen hatte. Die Strafe dafür war recht streng, aber Abt Hieronymus erklärte, er wolle Gregorius wieder in Gnaden aufnehmen. Allein schon seinen Eltern zuliebe.
Am späten Nachmittag schickte der Abt zwei Brüder in den Weinkeller, um Wein für das sonntägliche Abendmahl zu holen. Ihr entsetzter Schrei drang bis in die Kapelle, wo gerade eine Andacht stattfand. Mehrere Brüder folgten dem Schrei zum Weinkeller und erstarrten: Am Fuß der steinernen Treppe lag Gregorius zusammengekrümmt, neben ihm ein zerbrochener Krug. Das schmale Rinnsal des Rotweins aus dem Krug hatte sich mit der Blutlache unter dem Kopf des Novizen vermischt, die im Kerzenschein schwarz schimmerte.
Kellergeister
Ein leises Quietschen schreckte mich aus meinem Schlaf. Verwirrt blickte ich mich um. Wo war ich? Meine Augen mussten sich erst an die Dunkelheit gewöhnen. Diese hohe Stuckdecke, das große Bett mit den Kugeln auf den Bettpfosten, an der Wand der riesige Schrank, der einen mächtigen Schatten warf, und ein kaum sichtbarer Lichtstrahl von der Straßenlaterne ein Stück entfernt, der Kreise auf den grauen Teppichboden malte. Genau, ich lag im Gästezimmer des Hauses meiner verstorbenen Patentante Amelie Feldmann im Kölner Süden, unweit des Rheins.
Meine Patentante war kurz verheiratet gewesen, hatte aber keine eigenen Kinder und keine direkten Verwandten. Wie sie selbst immer sagte: »Ich bin die letzte meines Clans«, womit sie darauf anspielte, dass sie schottische Vorfahren hatte. Sie hatte sich aber nie darum bemüht, ihre Familiengeschichte weiter aufzuarbeiten. Sie wäre dabei sicherlich auf weitverzweigte Verwandtschaftsverhältnisse gestoßen, Vettern und Cousinen um viele Ecken. Doch das interessierte sie nicht. Es genügte ihr, zu wissen, dass sie die letzte Nachfahrin eines Schotten war, der vor mehr als zweihundertsiebzig Jahren in Deutschland gelebt hatte.
Ihr Tod hatte mich tief bewegt, aber nun fing mich der Alltag wieder ein. Am Nachmittag war ich mit dem Zug aus Hannover mit einstündiger Verspätung in Köln angekommen, hatte einige Einkäufe erledigt und mich im Gästezimmer im ersten Stock eingerichtet. Der Tod meiner Tante lag nun fast ein Jahr zurück, doch glücklicherweise war einmal in der Woche ihre gute alte Haushilfe Elvira Montecristo gekommen, die aus Sizilien stammte und dreißig Jahre lang bei meiner Tante segensreich gewirkt hatte. Meine Tante hatte sie großzügig in ihrem Testament bedacht, und so konnte Elvira mit ihren fast siebzig Jahren jetzt kürzertreten, betreute aber nach wie vor das Haus, lüftete, putzte, wischte vor allem Staub und versorgte den Garten. Mein Bett war frisch bezogen, auf dem Wohnzimmertisch stand eine Vase mit Chrysanthemen und in der Küche eine Kiste mit Mineralwasser, die sicherlich Elviras Enkel Marco für seine »Nonna« ins Haus transportiert hatte.
Einige der alten Möbel und fast alle Bilder aus der Sammlung meiner Tante hatte ich verschenkt oder zur Versteigerung gegeben. Einige wenige Bilder hingen in meiner Wohnung in Hannover. Ihre älteren Bücher waren vor mehreren Monaten schon abgeholt worden, darunter Originalausgaben aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Museen und Bibliotheken freuten sich über diese Gaben. Dennoch wirkte das Haus nicht ungemütlich, da noch alle Lampen funktionierten und auf den Fußböden im unteren Stockwerk schöne Teppiche lagen.
Ich liebte dieses Haus, zumal meine Mutter nur drei Straßen entfernt wohnte. Doch ich wollte es verkaufen. Was brauchte ich als alleinstehende Frau ein Haus mit vier Schlafzimmern, zwei Bädern, einem Wohnzimmer, einem Salon, einem Esszimmer und einer Bibliothek? In Hannover bewohnte ich eine hübsche Wohnung, und mein Freund Richard hatte sich dort vor Kurzem ein kleines Reihenhaus am Mittellandkanal gekauft und mir darin ein eigenes Arbeitszimmer eingerichtet. Tante Amelies Haus war eher für eine Familie mit drei Kindern ideal.
Unter dem Haus lag der Keller mit der Heizung, einem großen Abstellraum, einer Waschküche, einem kleinen Abstellraum, der wohl mal zur Lagerung von Getränken gedient hatte, und einem ehemaligen winzigen Badezimmer, das nie richtig genutzt worden war. Wozu auch? Toilette, Waschbecken und Dusche waren noch zu Tante Amelies Lebzeiten entfernt worden. Zurückgeblieben war ein kleiner, unansehnlicher Raum. Aber ausgerechnet dort schien ein Rohr gebrochen zu sein. Ehe ich das Haus auf den Markt brachte, musste dieser Schaden behoben und auch der übrige Keller renoviert werden, der einen eher vergammelten Eindruck machte. Meine Mutter hatte die Handwerker bestellt, die am nächsten Tag mit ihrer Arbeit beginnen sollten.
Da meine Mutter aber weder die nötige Energie noch die Lust aufbrachte, sich um die Sanierungsarbeiten in dem Haus meiner Patentante zu kümmern, war ich selbst nach Köln gereist und plante, mindestens zehn Tage hierzubleiben und die Zeit zusätzlich zu nutzen, um alte Freunde zu treffen, Museen und Kirchen zu besuchen, natürlich meine Mutter zu sehen und an einem Buch zu schreiben, das ein Verlag in Auftrag gegeben hatte. Es sollte eine autobiografische Geschichte meiner Abenteuer in den vergangenen Jahren sein, vom Moormann bis hin zur Suche nach einem verschollenen Gemälde des Künstlers Paolo Uccello, die mich in diesem Frühling fast das Leben gekostet hatte. Der etwas alberne Arbeitstitel lautete »Von Moormännern und Drachenrittern«. Aber da eine Veröffentlichung erst in zwei Jahren eingeplant war, würde sich dieser Titel sicherlich noch ändern lassen.
Ich war an diesem Abend todmüde ins Bett gesunken und sofort eingeschlafen. Bis mich nun dieses Quietschen aus dem Schlaf riss. Mein Blick fiel auf den altmodischen Radiowecker auf dem Nachttisch. Kurz vor drei Uhr morgens. Mühsam rollte ich mich aus dem Bett. Seit einiger Zeit verspürte ich einen leichten Dauerschmerz in meiner linken Hüfte und hatte mich schon für eine Physiotherapie angemeldet. Meine Mutter hatte weise genickt, als ich bei unserem letzten Treffen im Spätsommer davon erzählte. »Ja, ja, die Hüfte. Dann wirst du mit einer Hüftoperation rechnen müssen. Das liegt bei uns in der Familie.« Dafür fühlte ich mich mit zweiundfünfzig Jahren zu jung. Das musste noch warten. Dann lieber Physiotherapie und weniger Tennis.
Das Quietschen schien von der Straße zu kommen. Ich machte kein Licht an, sondern ging im dämmrigen Zimmer hinüber zum Fenster und schob die schweren Vorhänge beiseite. Die kleine Nebenstraße, in der das Haus lag, war still. Der Asphalt schimmerte im Licht der einsamen Straßenlaterne. Nur wenige Autos parkten am Straßenrand. Wieder das quietschende Geräusch. Es näherte sich dem Vorgarten. Und jetzt konnte ich auch eine Gestalt erkennen, die einen dunklen Anorak trug. Das sonderbare Quietschen hörte auf, als die Person an der Pforte zum Vorgarten sachte rüttelte und sie dann langsam öffnete. Ich stand erstarrt am Fenster, halb verborgen hinter dem Vorhang. Die Gestalt schlüpfte durch die Pforte in den Vorgarten und näherte sich zielstrebig der Eingangstür.
Da riss ich mich aus meiner Trance, griff zum Handy und tippte zitternd die 110. Eine Frauenstimme meldete sich, und ich stieß hervor: »Bitte schicken Sie einen Wagen vorbei. Jemand versucht, in mein Haus Unter den Eichen 14 einzubrechen.«
»Wagen kommt sofort.« Die Stimme klang beruhigend, dennoch beschlich mich ein Gefühl der Panik. In Filmen wandern oft die Damen, die in ihrem Haus Geräusche hören, tapfer mit irgendeinem schweren Gegenstand in der Hand die Treppe hinunter und rufen beherzt: »Wer ist da?« Immer wenn ich das sehe, möchte ich am liebsten rufen: »Tu es nicht!« Aber keiner hört je auf mich, und in vielen Filmen liegt die mutige Dame dann wenig später tot im Wohnzimmer.
Ich war nicht so mutig, lauschte aber dennoch an meiner Schlafzimmertür. Tatsächlich. Die Haustür knarrte leise. Und dann wieder das Quietschen, das offenbar von den Schuhen des Eindringlings rührte. Er schien sich seiner sehr sicher zu sein und wusste wohl, dass das Haus seit Längerem unbewohnt war. Bei meinen Aufenthalten in Köln, als ich mich um den Abtransport der kostbarsten Bilder, einiger älterer Möbelstücke und wertvoller Erstausgaben gekümmert hatte, wohnte ich bei meiner Mutter. Nun hatte ich mich das erste Mal seit Amelies Tod in ihrem Haus einquartiert, das inzwischen ja mir gehörte. In zehn Tagen wollte ich das Haus einem Immobilienmakler präsentieren. In dieser Gegend im Kölner Süden war das Haus von Tante Amelie eine begehrte Immobilie.
Der Fremde allerdings ahnte nicht, dass ich nun oben in meinem Schlafzimmer stand und mit einem Grummeln im Magen und Angstschweiß im Nacken auf das Eintreffen der Polizei wartete. Ich hörte das leise Quietschen, als der nächtliche Besucher in den kleinen Eingangsraum trat. In der Garderobe hingen nur noch ein paar Mäntel meiner Tante, die für die Altkleidersammlung bestimmt waren, und mein eigener Mantel. Von dort aus führte die Treppe hinauf zu den Schlafzimmern, es gab ein Gäste-WC, und eine Glastür trennte das kleine Entree vom Wohnzimmer. Eine weitere Tür führte zum Keller. Das quietschende Geräusch näherte sich aber nicht der Treppe, auch nicht dem fast leer geräumten Wohnzimmer. In einem Bücherschrank standen noch einige Dutzend Bücher, der Fernseher hatte auch schon bessere Tage gesehen, und das Silber und rare Stücke Meissner Porzellan hatte meine Mutter in Verwahrung genommen. An den Wänden hingen ein paar Stiche, vereinzelte Familienporträts ohne besonderen künstlerischen Wert und eine pompöse Gebirgslandschaft aus der Zeit um 1900, deren Schöpfer mit Tante Amelies Großvater Rudolf befreundet gewesen war. Aber nicht einmal mein Freund Richard, hauptberuflich Antiquitätenhändler, hätte dafür mehr als eintausend Euro geboten oder sie bei »Gutes für Geld« betreut, einer Fernsehsendung, in der allerlei Plunder neben recht beachtlichen Objekten begutachtet wurde. Richard wirkte seit einigen Jahren gelegentlich als Experte in dieser Show mit und ärgerte sich regelmäßig darüber, wie schlecht Bilder dabei wegkamen. »Immer unter Preis«, meinte er. Die Landschaft von Alfred Liebner hätte allerdings keine Lorbeeren errungen.
Offenbar strebte der Eindringling zum Keller. Da gab es außer einigen Gartenstühlen und anderen ausrangierten Objekten nichts zu holen. Das meiste war schon vor Wochen in einem Container gelandet. Also was konnte ein Einbrecher in diesem Keller suchen? Meine Neugierde begann meine Furcht in den Hintergrund zu drängen. So idiotisch das klingen mochte – am liebsten wäre ich hinuntergelaufen und hätte den Mann auf sein Vorhaben angesprochen.
Ich wurde jäh aus meinen sonderbaren Gedanken gerissen, als ich einen Wagen kommen hörte. Gleich darauf erspähte ich einen Streifenwagen mit Blaulicht, der lautstark vor dem Haus abbremste. Warum mussten sie immer so viel Lärm veranstalten? Das warnte doch jeden Schurken schon von Weitem und störte zudem die nächtliche Ruhe in diesem friedlichen Stadtteil!
Und natürlich hatte der Einbrecher es auch vernommen. Es gab einen furchtbaren Knall, als er die Kellertür zuschlug, deutlich hörbar durch das Wohnzimmer hastete, in aller Eile die Terrassentür aufriss, über die Terrasse rannte und im Dunkel des Gartens untertauchte. In diesem Moment klingelte die Streife an der Haustür Sturm, ich stolperte die Treppe hinunter und öffnete. »Er ist durch den Garten weg!«, gelang es mir zu sagen, ehe die beiden Männer ins Haus traten. Sie rannten in die Richtung, die ich ihnen wies. Doch der Eindringling war verschwunden.
Am Schloss der Haustür fanden sich eindeutige Spuren, dass dort jemand mit einem Schraubenzieher zugange gewesen war. Ein altes Türschloss, leicht zu knacken. Und die Alarmanlage, die meine Tante vor ein paar Jahren nach bestimmten Ereignissen hatte installieren lassen, war längst abgeschaltet und abgemeldet worden.
»Sieht nicht so aus, als wären da Fingerabdrücke«, murmelte der jüngere der beiden Polizisten.
»Na, der wird Handschuhe getragen haben«, brummte der zweite und betrachtete das gesplitterte Holz. »Ist ja auch ein Kinderspiel, dieses vorsintflutliche Schloss aufzustemmen.«
Wie er das sagte, klang es sehr vorwurfsvoll. Ich errötete, obgleich ich mich nicht schuldig fühlte. »Ich wohne gewöhnlich nicht hier«, erklärte ich und stellte mich vor: »Anna Bentorp. Ich bin erst gestern gekommen. Eigentlich steht das Haus leer und soll verkauft werden. Aber es muss vorher noch einiges daran gemacht werden.«
Die beiden Polizisten kommentierten das nicht weiter.
Wenig später saßen wir im Wohnzimmer, und ich berichtete den beiden von dem Mann mit den quietschenden Schuhen. »Converse«, sagte der Jüngere, der sich inzwischen als Lutz Hallmann vorgestellt hatte. »Habe ich auch. Sind super, aber quietschen wie blöd. Hätte ich als Einbrecher nicht angezogen.« Der Ältere, dessen Namen ich nicht verstanden hatte, weil er ziemlich undeutlich sprach, nickte nur.
»Er wollte in den Keller«, sagte ich. »Was er da zu finden hoffte, ist mir ein Rätsel. Da gibt es nichts Wertvolles, wobei ohnehin dieses Haus schon ziemlich leer geräumt ist. Nur die Schlafzimmer im ersten Stock sind noch halbwegs möbliert, und im Esszimmer steht ein Tisch mit zehn Stühlen.«
Die Polizisten blickten sich um. Im Wohnzimmer gab es nur das Sofa, einen Couchtisch, drei Sessel, das Bücherregal und einige Lampen. Dazu den Fernseher, eine uralte CD-Anlage und leicht angestaubte Vorhänge vor den Fenstern und der Terrassentür. Bei seiner Flucht hatte der Eindringling die Vorhänge beiseitegezerrt.
Als die beiden Polizisten meinen wenig ergiebigen Bericht protokolliert hatten, gingen sie noch einmal zur geöffneten Terrassentür und spähten hinaus. Auf den Fliesen der Terrasse waren ein paar Dreckspuren zu sehen, aber kein deutlicher Schuhabdruck, und der Garten lag still und schattig da.
Sie schlossen die Tür und folgten mir zur Kellertür. Die schmale Treppe in die unteren Räume wies auch zahlreiche Erdkrumen auf. Am Ende der Treppe hob Lutz Hallmann etwas vom Boden auf und reichte es seinem Kollegen. »Schau mal, Steffen, das sieht doch wie ein Bonbonpapier aus.«
Der Kollege wirkte eher gelangweilt. »Na und?« Er wandte sich an mich. »Haben Sie in letzter Zeit den Keller betreten?«
»Ja, vor einigen Wochen, als ich das letzte Mal kurz in Köln war. Damals habe ich aber nicht hier übernachtet. Bonbons habe ich nicht gelutscht und schon gar kein Papier auf den Boden geschmissen.«
Lutz Hallmann nickte. »Dann stecke ich das mal ein. Könnte ja DNA dran sein.«
»Na, wohl jetzt vor allem von dir«, knurrte sein Kollege. »Du hast das Papier ganz schön begrapscht.«
Aber Lutz Hallmann ließ sich nicht beirren. Er holte ein Taschentuch aus seiner Jacke und wickelte das Bonbonpapier ein. »Die moderne Forensik wirkt Wunder.«
Sein Kollege schnaufte: »Du siehst zu viele Fernsehkrimis.«
Viel blieb nicht mehr zu tun. Die beiden Männer versicherten sich nochmals, dass die Terrassentür fest verschlossen war, und ermahnten mich, die Haustür hinter ihnen abzuschließen. Das allerdings ging nicht so einfach, da der Fremde am Schloss herumgewerkelt hatte. Aber ich hatte ohnehin keine Angst, dass der Eindringling in dieser Nacht noch einmal auftauchen würde.
Es ging auf vier Uhr zu, als die Polizisten mich verließen. Der freundliche Lutz Hallmann drückte mir seine Handynummer in die Hand. »Im Falle eines Falles«, sagte er. Sein Kollege, dessen Namen ich immer noch nicht wusste, verdrehte die Augen. Vielleicht übten die beiden für ihre Rollen als bad cop, good cop.
Müde taumelte ich zurück in mein Bett und schlief sogar wieder ein. Ich wachte erst gegen acht Uhr auf, als es an der Tür schellte. Die Handwerker, die den Keller sanieren sollten. Elvira hatte sich schon mehrfach darüber beschwert, dass es da unten im hintersten Raum, dem früheren Bad, seltsam roch. Schimmel, glaubte sie.
Drei Männer betraten das Haus, ein älterer, der sich als Thomas Krauss vorstellte, ein jüngerer Mann, der Carlo Rivera hieß, und ein dritter, der seinen Namen nuschelte. Ich verstand nur »Dieter«.
»Unser Neuer« nannte ihn Thomas Krauss. Fast entschuldigend sagte er: »Wir haben derzeit akuten Mitarbeitermangel. Zu viele Aufträge, zu wenig Fachkräfte. Da sind wir froh über jede Hilfe.«
Krauss sah sich im Eingang um. »Ach je, wie oft ich bei Ihrer Tante in all den Jahren war! Ist ja ein altes Haus. Da war mal die Heizung nicht in Ordnung, dann wieder eine Leitung geplatzt, dann war der Wasserhahn in der Küche verkalkt. Und jetzt fehlt sie mir, die alte Dame!« Er sah mich mit einem melancholischen Blick an. »Ich arbeite seit bald dreißig Jahren bei der Sanitätsfirma Hülstermann. Da kennt man seine Kundschaft.«
Ich hörte nur mit halbem Ohr hin. Nach dem Erlebnis der vergangenen Nacht kam es mir seltsam vor, die drei Männer in den Keller zu schicken. Ich rätselte immer noch herum, was der Einbrecher ausgerechnet dort unten gesucht haben sollte. Da ich Keller nicht besonders mochte, hatte ich es vermieden, allein hinunterzugehen. Vor ein paar Wochen hatte mich meine Mutter begleitet, um den alten Trödel anzuschauen, der da unten noch herumlag. »Vielleicht findest du ja doch etwas für diese Fernsehsendung, die dein Richard gelegentlich betreut, ›Gutes für Geld‹«, scherzte meine Mutter. Doch da gab es wenig zu entdecken. Nur eine alte Tischlampe holte ich aus dem Vorratsraum, die recht passabel aussah.
Als ich nun mit den drei Männern hinunterging, sah ich mich automatisch um, ob noch irgendeine Spur des Eindringlings zu finden war. Doch Hallmann und sein Polizeikollege hatten sich ziemlich gründlich umgetan, und sehr weit konnte der Fremde nicht in den Keller vorgedrungen sein. Die Polizei hatte sehr schnell auf meinen Notruf reagiert.
Die steinerne Treppe mündete in einem großen Abstellraum, von dem aus es in den Heizkeller, in die Waschküche und in den Vorratsraum ging. Dort hatten einst Regale gestanden und ein paar Schränke für Konserven. Jetzt war da nur noch ein kleines Regal mit zwei Dutzend Flaschen Rotwein, von Spinnweben bedeckt. Die Gartenstühle sahen alle ramponiert aus. Der Sperrmüll müsste sie abholen. Ein kurzer Gang führte in den hinteren Teil des Kellers.
In dem kleinen ehemaligen Minibad roch es, wie ich bemerkte, tatsächlich ziemlich unangenehm. Ich trat zurück und wandte mich an Krauss. »Sie merken es selbst. Hier muss saniert werden. Ich weiß nicht, ob meine Tante diesen Raum in den vergangenen Jahren überhaupt je benutzt hat. Das Bad selbst wurde vor einiger Zeit abgebaut, aber die Leitungen liegen noch. Der Geruch dringt bis in die vorderen Räume.«
Thomas Krauss nickte. »Ganz klar. Da ist eine alte Wasserleitung in der Wand defekt. Wahrscheinlich noch aus Blei. Die Wand ist völlig feucht. Kein Wunder, wenn es hier nach Moder riecht.«
Die Männer stellten ihre Werkzeugkästen auf den Boden. Die unter der Decke baumelnde Birne spendete nur wenig Licht, sodass Thomas Krauss eine mitgebrachte Halogenleuchte aufstellte. Ich überließ die Handwerker ihrer Arbeit, bot an, ihnen einen Kaffee zu kochen, und ging wieder ins obere Stockwerk. Krauss meinte, sie würden sicher den ganzen Tag mit diesem Teil des Kellers beschäftigt sein und sich die anderen Räume erst in den nächsten Tagen vornehmen können.
Ich hatte im Bademantel die Tür geöffnet, ging rasch in den ersten Stock und zog mich nun nach einer kurzen Dusche in dem mit Carrara-Marmor gefliesten Bad an. Dieses Bad war erst vor wenigen Jahren modernisiert worden, ein Traum, den meine Tante selbst kaum je genutzt hatte. Aufgrund ihrer Behinderung hatte sich ihr Leben weitgehend auf das Erdgeschoss beschränkt. In dem Keller war sie sicherlich seit Jahren nicht mehr gewesen.
Frisch geduscht fühlte ich mich für diesen Tag gerüstet und verdrängte allmählich den Schrecken der vergangenen Nacht. Ich ging in die Küche, die noch vollständig eingerichtet war. In den Schränken stand das Alltagsgeschirr. Amelies kostbares Tafelservice für vierundzwanzig Personen samt dem Tafelsilber lagerte in mehreren Kartons im Haus meiner Mutter.
Bald hörte ich Krauss und seine Gehilfen im Keller klopfen und bohren. Ich setzte den versprochenen Kaffee auf. Tante Amelies alte Kaffeemaschine gluckerte vor sich hin, und ich zog mich mit einem Becher Kaffee ins Wohnzimmer zurück. Wenig später klingelte es. Lutz Hallmann stand vor der Tür, frisch rasiert und erstaunlich munter nach der kurzen Nacht, diesmal ohne seinen grummeligen Kollegen, dafür aber mit einer freundlich lächelnden jungen Polizistin.
»Wir wollten nur mal schauen, wie es Ihnen geht, Frau Bentorp, und ob Sie noch irgendetwas gehört oder gesehen haben, nachdem der Eindringling weg war. Konnten Sie überhaupt schlafen?«
Ich bat die beiden ins Wohnzimmer und bot auch ihnen einen Kaffee an. Beide nahmen dankend an. »Ich habe überraschend gut geschlafen. Und jetzt sind Handwerker im Keller. Ich ahne nicht, was dieser Kerl hier wollte. Im Keller steht eigentlich nur noch Gerümpel herum, nichts Wichtiges. Also, ich bin überfragt. Haben Sie denn irgendetwas gefunden?«
Hallmann hob die Schultern. »Dieses Bonbonpapier, das ich gefunden habe, könnte natürlich schon lange da gelegen haben. Wir lassen es dennoch untersuchen. Vielleicht haben wir Glück und entdecken brauchbare Spuren.« Das klang wie aus einer dieser Soko-Serien im Fernsehen, die ich öfter sah.
Die Polizistin sah sich im Wohnzimmer um. »Schön ist es hier.«
Ich folgte ihrem Blick. Ja, da hatte sie recht. Ein großer heller Raum mit einer breiten Glasschiebetür zur Terrasse und mit Sicht auf den kleinen, aber gepflegten Garten mit zwei großen Rosenbeeten, einem Apfel- und einem Kirschbaum, einer steinernen Vogeltränke und jeder Menge Rhododendron an der hinteren Gartenmauer zum Nachbargrundstück, das einem emeritierten Professor für griechische Literatur gehörte. Plötzlich überkam mich Zweifel. Sollte ich dieses schöne Haus wirklich verkaufen? Oder besser vermieten oder, wie meine Mutter schon mehrmals vorgeschlagen hatte, es für mich selbst behalten? »Du bist doch ein freier Mensch und nicht an Hannover gebunden«, betonte sie öfter. Dass meine Freunde in Hannover lebten, dass mein On-and-off-Freund Richard Bernhard dort wohnte und ein Geschäft besaß, das fand sie alles nicht weiter relevant.
»Du kannst ja häufiger dort hinfahren. Und Platz für Gäste hast du auch reichlich in Tante Amelies Haus. Aber so ein Haus bekommst du nie wieder. Du weißt, dass ich nur zur Miete lebe und du von mir kein Haus erben wirst.«
Ich seufzte. Keine einfache Entscheidung. Aber das änderte im Moment auch nichts. Egal, wie ich mich im Endeffekt entschied, musste dieses Haus erst einmal gründlich renoviert werden. Glücklicherweise hatte mir meine wohlhabende Tante ausreichend Geld hinterlassen, um notwendige Arbeiten am Haus finanzieren zu können. Selbst nach Abzug der Erbschaftssteuer stand ich zum ersten Mal in meinem Leben finanziell abgesichert da. Als freischaffende Kunsthistorikerin, die ihren Unterhalt durch das Erstellen von Gutachten und Katalogen und mit gelegentlichen Vorträgen verdiente, hatte ich auch schon schwierige Zeiten durchlebt.
Ich konzentrierte mich wieder auf die beiden Polizisten. »Sie sind sicher, dass es in dem Keller nichts gibt, was einen Einbrecher anlocken könnte?«, fragte Hallmann.
»Nein, da steht, wie schon gesagt, nur noch Gerümpel, darunter eine uralte Waschmaschine und Gartenstühle. Die Alarmanlage ist abgemeldet. Sie befindet sich im Eingangsbereich. Das muss der Typ gewusst haben. Er ist ziemlich keck hier hereinmarschiert. Ich bin schlicht überfragt.«
»Es ist nicht ganz unbekannt, dass dieses Haus schon länger leer steht«, sagte die Polizistin. »Und Sie waren in den letzten Monaten wohl auch nicht sehr oft hier.«
»Nein, leider nicht, und ich habe auch nie hier übernachtet. Da es hier nichts Wertvolles zu stehlen gibt, hat die Haushilfe meiner Tante die Alarmanlage abgemeldet. Aber immerhin ist sie öfter hier und kümmert sich um das Haus.« Ich fühlte mich plötzlich erschöpft.
Aus dem Keller drang gedämpft das Hämmern, Bohren und Klopfen der Handwerker. Hallmann erhob sich. Er wollte offensichtlich gehen. Seine Kollegin aber blieb noch sitzen. Er sah sie streng an.
»Entschuldigung«, sagte sie mit ihrer etwas dünnen, hohen Stimme. »Aber könnte es sein, dass dieser Mann vielleicht im Keller irgendetwas versteckt hat, als niemand in dem Haus gewohnt hat? Vielleicht wollte er sich das jetzt wiederholen.«
Hallmann wirkte ein wenig konsterniert.
»Dann müsste er ja schon einmal hier gewesen sein«, antwortete ich. »Aber das wäre doch aufgefallen. Die Haushilfe ist, wie gesagt, mehrfach in der Woche hier, meine Mutter sieht auch manchmal nach dem Rechten. Also wie hätte er hereinkommen sollen, ohne dass sichtbare Spuren entdeckt wurden?«
»Da haben Sie natürlich recht.« Die junge Frau errötete und blickte ihren Kollegen etwas hilflos an. »Aber die Einbrecher werden immer kühner. Die steigen ja selbst in bewohnte Häuser am helllichten Tag ein, und diesem Haus sieht man an, dass hier niemand mehr wohnt. Also bedeutet es vom Zeitpunkt her kein besonderes Wagnis, hier hineinzuspazieren.« Sie wandte sich an mich. »Ihre Tante ist ja schon etwas länger tot, oder?«
Ich nickte. »Ja, das liegt bald ein Jahr zurück. Das Haus soll demnächst auf den Markt. Zwei namhafte Immobilienhändler sind interessiert, aber ich möchte es erst sanieren und dann überlegen, ob ich es verkaufe oder vermiete.«
Vielleicht lag die junge Frau mit ihrer Vermutung richtig, und jemand war vor einiger Zeit hier eingestiegen, um etwas im Keller zu verstecken. Vielleicht ein Einbrecher, der seine Beute vorübergehend unterbringen wollte? Nur hatte der gute Mann nicht ahnen können, dass ich ausgerechnet gestern aus Hannover anreisen und hier übernachten würde. Schlechtes Timing. Aber was konnte das sein? Die Polizei hatte nichts Besonderes entdeckt und ich erst recht nicht.
Ich wandte mich an die junge Frau. »Wie heißen Sie eigentlich?«, wollte ich wissen.
Sie errötete wieder und antwortete: »Dörte Huth. Dörte mit ohne h.«
»Frau Huth ist noch in der Ausbildung«, fügte Lutz Hallmann hinzu. Ein rookie, wie das in den amerikanischen Krimis so schön heißt, dachte ich bei mir, sagte aber laut: »Frau Huths Idee ist gar nicht so abwegig. Vielleicht wusste jemand, dass das Haus leer steht, und hat es als eine Art Zwischenlager benutzt.«
»Wenn Sie wollen, dann sehen wir uns Ihren Keller noch einmal genauer an«, schlug Hallmann vor.
Ehe ich antworten konnte, ertönte genau von dort ein lauter Schrei. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass das Hämmern und Klopfen verstummt waren. Die Tür zum Wohnzimmer wurde aufgerissen, ein kreidebleicher Thomas Krauss platzte herein. »Frau Bentorp, kommen Sie schnell! In Ihrem Keller liegt ein Skelett!«
Nachrichten aus der Vergangenheit
Winter 1520/21
Die Weihnachtstage verbrachte Ambrosius bei seiner Familie in der Eifel. Er hatte seit der Entdeckung der Leiche von Gregorius über Unwohlsein geklagt und endlich die Erlaubnis erhalten, für einige Zeit das Kloster zu verlassen. Den alten Text und seine Übersetzung nahm er mit. Seltsamerweise plagte ihn zunächst sein Gewissen nur wenig, wenn er an den toten Gregorius dachte. Und da sehr schnell das Urteil über die Todesursache des Jungen gefällt worden war, fürchtete er auch nicht, damit in Zusammenhang gebracht zu werden. Der Tod des jungen Mannes galt als Unfall. Er sei wohl unter Alkoholeinfluss die Treppe hinuntergestürzt.
Nur einer hatte wirklich um den jungen Mann getrauert, der alte Bruder Martinus. Er war dazu ausersehen worden, den Eltern des Verstorbenen die traurige Kunde zu überbringen. Martinus war von seiner Mission nicht mehr zurückgekehrt. Er wurde krank und war vor wenigen Tagen in seinem Heimatdorf gestorben. Ambrosius fühlte, als er diese Nachricht hörte, einen kleinen Stich. Wenn der Tod des alten Mönchs eine Folge von Gregorius’ Tod sein sollte, den Martinus seit seiner Kindheit gekannt hatte, dann tat das Ambrosius bitter leid. Er tröstete sich damit, dass Martinus schon jenseits der siebzig gewesen war und seit Längerem über Magenschmerzen und Atemnot geklagt hatte.
Doch Alpträume begannen den jungen Mönch zu plagen. Er sah den Körper des Novizen die steile Treppe in den Keller hinabstürzen und glaubte, einen Klagelaut zu vernehmen. Sollte Gregorius doch noch gelebt haben, als er ihn hinunterwarf? Dann wäre er ein Mörder und der Tod des jungen Mannes nicht einem Unfall geschuldet. Ambrosius wachte eines Morgens schweißgebadet auf. Sein Herz raste, und seine Mutter betrachtete ihn besorgt.
»Ich hoffe nicht, dass du krank wirst«, sagte sie. »In Manderscheid hat es letzthin einige Fälle einer neuartigen Krankheit gegeben, die sich in hohem Fieber und heftigem Schweißausbruch zeigt. Sie scheint aus England zu kommen und von einem Kaufmann mitgebracht worden zu sein.«
Ambrosius beruhigte seine Mutter. Und tatsächlich hörten die bösen Träume an Weihnachten auf, doch die leise Unruhe hielt an. Er würde nie erfahren, ob der Novize bereits tot gewesen oder erst durch den schweren Sturz gestorben war.
Kurz nach dem Weihnachtsfest zog sich Ambrosius in seine kleine Kammer im Hofgebäude zurück, um weiter an dem Dokument zu arbeiten. Bei manchen Formulierungen des Textes war er an seine Grenzen gestoßen und wollte noch einmal an der Übersetzung feilen. Ambrosius teilte sich die Kammer mit seinem um ein Jahr jüngeren Bruder Hermann, der ihm so täuschend ähnelte, dass man die beiden Bauernsöhne für Zwillinge halten konnte. Allerdings trug Hermann ein münzgroßes Geburtsmal an der Stirn, welches er immer wieder vergeblich unter seinen Haaren zu verstecken suchte.
»Was machst du?«, fragte Hermann den Bruder, der an dem kantigen Holztisch saß und aus dem Fensterchen hinausschaute.
Ambrosius zuckte zusammen. Ihm war es nicht recht, dass sein jüngerer Bruder ihn störte, sosehr er ihn auch schätzte. »Ich studiere ein altes Dokument«, erwiderte er kurz angebunden.
Doch damit ließ sich Hermann nicht abspeisen. Er war von Haus aus unangenehm neugierig, und zudem langweilte er sich. Während draußen die dichten Schneeflocken um das Gehöft wirbelten, hatte er nur wenig zu tun. Das übrige Jahr half er wie seine älteren Brüder auf den Feldern und im Wald. Aber jetzt herrschte Winterruhe, und auch seine abendlichen Ausflüge in die Dorfschenke, wo er seit seinem siebzehnten Lebensjahr zu den ständigen Gästen zählte, fielen derzeit aus. Der Schnee lag zu hoch, um die fünf Meilen ins Dorf für ein paar Bier zu gehen. Selbst der Vater, einem kräftigen Schluck nicht abgeneigt, blieb zu Hause, und die Schwestern, die mit ihren Familien in der Nähe lebten, halfen der Mutter bei Flick- und Näharbeiten. Hermann vermochte zwar zu lesen und zu schreiben, aber nicht so flüssig wie Ambrosius, der schon früh von Pfarrer Walter gefördert worden war.
Und so trödelte Hermann herum und sehnte sich nach dem Frühling, der zwar sehr viel mehr Arbeit, aber auch sehr viel mehr Freiheit bedeutete. Zumal er ein Auge auf die Tochter des Dorfschulten geworfen hatte. Und Martha schien ihn nicht abzulehnen. Hermann war jetzt einundzwanzig Jahre alt, das richtige Alter, um eine Familie zu gründen. Der Hof seines Vaters zählte nicht zu den großen Anwesen in der Eifel, die eher kargen Böden gaben nicht viel her. Aber der Vater besaß daneben noch eine Schmiede, die er mit seinen beiden ältesten Söhnen Albrecht und Karl erfolgreich betrieb, und der dritte Sohn Friedrich verdiente in der Bäckerei des Großvaters mütterlicherseits bereits ausreichend, um seine Frau und die rasch wachsende Schar seiner Kinder gut zu ernähren. Mangel litt keiner in der großen Familie, und nun erwartete die Mutter, die schon die Mitte vierzig erreicht hatte, noch ein weiteres Kind. Hermann drängte es, den Hof zu verlassen und sein eigenes Leben aufzubauen. Aber er war abhängig von seinen Eltern, und Ambrosius wusste, dass Hermann ihn, der immerhin in Köln leben durfte, fast beneidete. Auch wenn Hermann das Klosterleben nie gereizt hätte.
Hermann ließ nicht locker: »Jetzt sag schon, was ist das für ein mysteriöser Text?«
Ambrosius zögerte mit seiner Antwort. Er und sein Bruder waren in ihrer gemeinsamen Kindheit unzertrennlich gewesen. Doch er wusste nicht, ob er ihm wirklich vertrauen konnte. Schon früher hatte Hermann ihn nach gemeinsamen Streichen verraten oder der Mutter gepetzt, wenn Ambrosius, der, ehe er sein Gelübde ablegte, Eckart hieß, am frisch gebackenen Brot genascht oder heimlich ein Bier getrunken hatte.
Aber dann gab er sich einen Ruck, schob die Blätter auf dem wackligen Tisch beiseite und sagte: »Hermann, du darfst niemandem etwas erzählen. Diese Papiere sind die Übersetzung eines lateinischen Dokuments, das ich im Kloster durch Zufall entdeckt habe. Irgendjemand muss den alten Text, der vielleicht sogar noch auf Täfelchen geschrieben worden ist, schon lange vor mir gefunden, ihn auf Papier übertragen und dann in einem Holzkästchen verborgen haben. Ich habe ihn nun fast vollständig ins Deutsche übertragen, und es scheint eine recht spannende Geschichte dahinterzustecken. Aber ich bin noch nicht fertig, und da ich in zwei Tagen zurück ins Kloster muss, möchte ich jetzt so viel wie möglich daran arbeiten. Im Kloster warten wieder andere Aufgaben auf mich, und ich kann dann nur nachts heimlich im Skriptorium daran arbeiten.« Ambrosius blickte seinen Bruder mit leiser Skepsis an. »Du versprichst, nichts zu erzählen?«
Hermann nickte eifrig. »Aber was erhoffst du dir denn von diesem alten Text?«, fragte er. Er hatte nie viel mit lateinischen Schriften anfangen können, obgleich auch er bei Pfarrer Walter zusammen mit Ambrosius Unterricht erhalten hatte. Sein Vater hatte einmal gedacht, dass aus Hermann ein guter Priester werden könne. Doch der Junge zeigte keinerlei Ehrgeiz und war zudem dem weiblichen Geschlecht allzu wohlgesonnen. Er hatte den Beinamen »Der Wilde«, und man munkelte, dass das Kind der Müllerstochter Agatha, das traurigerweise kurz nach der Geburt gestorben war, von ihm stammte. Aber das waren Gerüchte, denn Agatha, die inzwischen als Dienstmagd in Manderscheid lebte, hatte nicht wenige ihrer Verehrer in jenem Sommer vor drei Jahren erhört.
Ambrosius atmete tief durch und erwiderte: »Ich glaube, dass dieser Text von einem jungen Mann stammt, der vor anderthalbtausend Jahren in Köln nach der Hinterlassenschaft seines offenbar gewaltsam zu Tode gekommenen Großvaters gesucht hat. Irgendwie hat mich diese mysteriöse Geschichte, in der es um kostbare Münzen, Raub, Verrat und wohl auch Mord geht, in ihren Bann gezogen. Aber noch habe ich nicht alles übersetzt.«
»Du meinst, es könnte irgendwo ein Schatz versteckt sein?« Hermanns Gesicht rötete sich.
Ambrosius schüttelte den Kopf. »Also, von einem Schatz habe ich nichts gesagt. Wenn ich aber richtig verstanden habe, geht es um eine Kriegskasse römischer Legionen, die damals in Germanien stationiert waren. Die ist wohl kurz nach einer großen Schlacht verschwunden. Ob sie noch irgendwo existiert, ist nach so langer Zeit natürlich fraglich. Und falls dieser Lucius, wie der junge Mann heißt, sie gefunden hat, ist sie vielleicht von ihm nach Italien zurückgebracht worden.«
Hermann wirkte enttäuscht. »Nun, was soll das Ganze? So viel Mühe und dann kein Lohn?«
Ambrosius sah seinen jüngeren Bruder strafend an. »Kein Lohn? Diese Dokumente enthüllen eine spannende Geschichte aus dem antiken Köln, egal, ob damit ein Schatz, wie du es nennst, verbunden ist. Und es geht offenbar um Mord. Das allein ist schon recht aufregend. Mich interessiert, was damals geschehen ist. So viel wissen wir nicht über jene ferne Zeit. Köln ist eine römische Stadt gewesen, auch wenn in dieser Gegend zuvor Kelten gesiedelt haben. Dann ist ein Oppidum dort entstanden, eines der wichtigsten militärischen und kulturellen Zentren im ganzen Gebiet. Und schließlich um das Jahr 50 nach der Geburt unseres Herrn die Stadt Köln.«
Hermann gähnte. »Diese Einzelheiten sind wohl etwas für deinen alten Freund und Förderer, Pfarrer Walter. Aber vielleicht entdeckst du ja die verschwundene Kriegskasse. Solche Münzen würden heute auch noch einiges einbringen.«
Ambrosius verbarg seine Enttäuschung über die Reaktion seines Bruders. Hermanns Interessen galten grundsätzlich materiellen Dingen. Mit geistigen Beschäftigungen hatte er wenig im Sinn, und er brauchte handfeste Belege, um etwas zu glauben. Das war nie anders gewesen. Dennoch liebte Ambrosius seinen Bruder und bedauerte nur manchmal, dass dieser so wenig aus seinen Talenten machte. Hermann konnte sehr gut zeichnen und mit Zahlen umgehen. Wobei Zahlen ihm auf dem Land mehr nützen würden als seine zeichnerische Begabung.
Hermann trollte sich, und Ambrosius setzte sich wieder an den Text. Als der Abend dämmerte, stieß er auf eine Stelle, die ihn erstarren ließ. Konnte wahr sein, was er da las? Er entzündete eine kleine Öllampe und starrte auf die Zeilen, die er gerade übersetzt hatte. Am liebsten hätte er Hermann gerufen und ihm den Absatz gezeigt. Aber er wollte erst ganz sicher sein. Wenn es stimmte, was er da entzifferte, dann hatte jener Lucius tatsächlich eine mit Münzen gefüllte Kiste entdeckt:
Ich komme dem Geheimnis um die verschollene Kriegskasse immer näher. Was mir Großvaters treuer Diener Briann anvertraut hat, entspricht der Wahrheit. Mein Großvater war weder ein Mörder noch ein Dieb. Er hat versucht, die Kriegskasse aus den Händen des wahren Täters zu retten, und musste dafür sein Leben lassen. Briann hat ihn bestattet und ihm Opfergaben beigegeben. Denn Briann stammt aus einer anderen Kultur, und dort gibt man den Toten Verpflegung mit auf ihre letzte Reise. Statt Brot und Wein aber waren es wohl einige der Goldmünzen aus dieser Kiste, die ich entdeckt habe. Ich werde sie wieder in ihr Versteck bringen. Zu gegebener Zeit, bevor ich nach Italien zurückkehre, werde ich sie dem hiesigen Kommandanten überreichen, in der Hoffnung, dass der Name meines Großvaters dadurch von jedem Makel gereinigt wird. Mir liegt nichts an diesem Blutgeld. Der eigentliche Mörder aber, so hat mir Briann auf seinem Sterbebett zugeflüstert, war einst ein mit Ehren überhäufter Offizier, ein enger Vertrauter meines Großvaters und einige Jahre jünger als er. Mein Großvater starb bei dem Bemühen, dem Verräter den Schatz zu entreißen.
Mich überkam wilder Zorn. Dieser Mörder war schuld am Tod wahrscheinlich nicht nur meines Großvaters, sondern auch einiger anderer Männer, die er in seiner Gier nach Gold getötet hatte. Mein Großvater wäre in diesem Jahr achtzig Jahre alt, sein Mörder müsste um die siebzig Jahre alt sein. Er könnte also noch leben. Aber wo? Noch in Colonia? Ich werde mich auf die Suche machen. Als ich Briann darauf ansprach und ihm sagte, wie furchtbar es doch sei, dass der einstige Freund und Vertraute meines Großvaters davongekommen sei und diese Münzen besitze, da sah mich der alte Mann mit einem Blick an, den ich nicht zu deuten vermochte. Es schien, als wollte er mir etwas sagen, doch ihm fehlte die Kraft. Er flüsterte nur: »Später, später erzähle ich dir mehr.«
An dieser Stelle brach der Text ab. Ambrosius stöhnte auf. Wo war der Rest der Dokumente? In dem Holzkästchen war nichts weiter als Staub gewesen. Aber irgendwo, so glaubte er, musste sich der zweite Teil dieser Aufzeichnungen befinden. Er würde in der Klosterbibliothek suchen. Im alten Schrank, der inzwischen durch ein prächtiges Möbel ersetzt worden war, konnten die Dokumente nicht mehr sein. Den hatte er gründlich ausgemistet. Oder sollte sich darin ein Versteck befunden haben, das er übersehen hatte?
Ihn überlief es eiskalt. Längst war der alte Schrank sicherlich in Stücke zerlegt und verbrannt worden. Auf jeden Fall hatte Tischler Heribert, der für das Kloster gelegentlich neue Stühle und Tische zimmerte, ihn eigenhändig abgeholt. Vielleicht aber stand der Schrank noch irgendwo auf dessen Gelände in der Nähe des Rheins.
Ambrosius kaute an dem Federkiel. Er musste so schnell wie möglich zurück nach Köln. Aber die Straßen in der Eifel lagen unter einer dicken Schneedecke, die selbst das Pferdegespann seines Vaters kaum bewältigen konnte. Bei diesem Wetter und der früh einsetzenden Dunkelheit schien es nicht ratsam, sich auf den Weg zu machen.
Ambrosius fühlte sich auf dem Hof seiner Eltern in den folgenden Tagen wie ein Gefangener, gequält von Ungeduld und der Angst, dass er das Rätsel um das Schicksal des jungen Römers nie würde lösen können. Er dachte dabei weniger an die Kriegskasse als an das Drama, das sich mit Lucius’ Suche nach der Wahrheit hinter dem Tod seines Großvaters verband. Er fühlte sich kurz vor dem Ziel und gleichzeitig endlos weit davon entfernt.
Mitte Januar legten sich die heftigen Schneefälle. Und am Mittwoch, den 19. Januar des Jahres 1521, verabschiedete sich Ambrosius von seiner Familie. Er müsse dringend zurück ins Kloster und dürfe dies nicht länger aufschieben. Seine Mutter, die im Juni ihr elftes Kind zur Welt bringen würde, schluchzte heftig, der Vater nickte stumm, die Geschwister drängten sich um ihn. Nur Hermann blieb gelassen und versprach Ambrosius, ihn bald in Köln zu besuchen.
»Ich möchte in Köln eine Lehrstelle antreten«, verkündete er zur Überraschung seiner Eltern. »Gern Steinmetz, da ständig am Dom gebaut wird und immer Arbeiter gebraucht werden.«
Ambrosius schmunzelte. Hermanns Begabung mit Zahlen und Zeichnen mochte sich hier als hilfreich erweisen. »Ich wünsche dir Glück. Du weißt, wo du mich findest«, sagte er. Dass Hermann für eine Lehrstelle eigentlich bereits zu alt war, bemerkte keiner laut.
Mit dem Versprechen, bald nach Ostern, dieses Jahr am 31. März, die Familie wieder zu besuchen, brach er schließlich auf. Sein Vater brachte ihn mit dem Pferdegespann ein paar Meilen bis zu dem Weiler Kringelsheim, von wo aus Ambrosius dann weiterwanderte, von der Mutter gut versorgt mit einem Laib Brot und frischer Wurst. Die Nacht verbrachte er bei einem Vetter seiner Mutter in Weilerswist, der dort einen kleinen Hof besaß, und erreichte am nächsten Nachmittag Sankt Gallus.
Der Abt begrüßte ihn persönlich, wirkte aber beunruhigt. Ambrosius überkam leichte Panik. Hatte diese offensichtliche Unruhe mit dem Tod von Gregorius zu tun? Der lag nun zwei Monate zurück, aber vielleicht war der Verdacht aufgekommen, dass Gregorius nicht von allein die Stufen hinabgestürzt war. Doch die Worte des Abtes beruhigten ihn zumindest in dieser Hinsicht: »Wir haben Kunde aus Rom bekommen. Der Heilige Vater hat Martin Luther exkommuniziert.«
Ambrosius wusste nur vage, wer dieser Luther war, ein Augustinermönch, der offenbar mit seinen Thesen heftige Kritik an Zuständen in der Kirche, vor allem am Ablass, geübt hatte. Ihn interessierte das wenig, hatte es doch solche Kritiker immer mal wieder gegeben, wie zum Beispiel den Böhmen Jan Hus vor gut einhundert Jahren. Höflich erwiderte er: »Das ist in der Tat schrecklich«, und versuchte, so rasch wie möglich in seine Zelle zu gelangen.
Am nächsten Morgen erhielt er die Erlaubnis, das Kloster für einige Stunden zu verlassen. Die Stimmung dort war seltsam beklommen. Ob das alles mit dem Mönch zusammenhing, den Leo X. exkommuniziert hatte und dessen Reformthesen für Unruhe sorgten? Ambrosius scherte das wenig. Zielstrebig eilte er durch die Gassen zum Rhein. Auch in Köln hatte Schnee gelegen, doch inzwischen kümmerten nur noch matschige graue Haufen vor den Häusern dahin. Die Wolken am Himmel sahen weniger nach Schnee als vielmehr nach Regen aus. Ambrosius hasste diesen feuchten Winter, der endlos schien. Die Nässe kroch unter seine Kutte. Er fröstelte. Hoffentlich würde er nicht krank werden. Die Worte seiner Mutter über diese seltsame Krankheit aus England, die ein Kaufmann beim Besuch seiner Familie von London nach Manderscheid gebracht haben sollte, hallten in seinem Kopf wider. Er beschleunigte seine Schritte.
Das Gelände, das Tischler Heribert beanspruchte, reichte bis zu den Rheinwiesen. Er besaß mehrere Werkstätten und beherbergte sogar einige Künstler, die sich mit dem Ausbessern von Altarbildern und dem Schnitzen und Kolorieren von Heiligenstatuen ihr Auskommen verdienten. Ambrosius wusste, wo der Tischler alte Möbel abstellte, die er entweder herrichtete und wohlfeil verkaufte oder zu Brennholz zerlegte. Manchmal bediente er sich auch bei Schränken, um Teile davon in andere Möbel einzubauen.
In der Nähe eines baufälligen Schuppens erblickte er eine ganze Ansammlung von übereinandergestapelten Brettern. Ihn überlief ein Schauder. Hatte Heribert also doch schon den Klosterschrank auseinandergelegt? Was hatte er sich nur gedacht und zu hoffen gewagt? Ambrosius trat näher an den Bretterhaufen heran. Er konnte aber nicht erkennen, ob der in Teile zerlegte Schrank aus dem Kloster dabei war.
Als er sinnend vor dem Haufen stand und sich schon damit abgefunden hatte, dass er zu spät gekommen war, spürte er plötzlich eine Hand auf seiner Schulter. »Na, wenn das nicht unser eifriger Schreiberling ist!«, tönte eine dumpf grollende Stimme. Ambrosius wandte sich um und sah in das Gesicht von Meister Heribert. Voller Runzeln und Furchen, pockennarbig und mit einer vom Alkohol geröteten Nase – oder kam es von der feuchten Kälte? –, erinnerte der Tischler den jungen Mönch an die Beschreibung der Erdgeister aus den Sagen der Eifel. Er mochte an die sechzig Jahre alt sein, mit schütterem grauweißem Haar und kleinen dunklen Äuglein. Doch sein breites Lächeln verwandelte das vom Leben gezeichnete Gesicht des alten Mannes und ließ es fast liebenswert erscheinen.
Ambrosius rang nach Worten. »Ja, Meister Heribert, ich bin es. Und ich bin gekommen, um nach dem Schrank zu schauen, den ich im November ausgeräumt habe. Darin habe ich leider wohl etwas liegen gelassen, was ich nun vermisse.« Mehr wollte er nicht sagen. Das war aber auch nicht nötig. Meister Heribert lachte auf.
»Dann ist das deine kleine Holzkiste, die wir ganz hinten im Schrank hinter einem losen Brett gefunden haben? Ich habe mich schon gewundert, was darin ist. Doch wir haben sie nicht geöffnet. Mein neuer Lehrling Ludwig sollte sie in den nächsten Tagen bei euch vorbeibringen.« Er zwinkerte. »Na, hoffentlich ist nichts in dem Kästchen, das deine Seele belasten könnte.«
Was er damit meinte, verstand Ambrosius zwar nicht, aber er schüttelte heftig den Kopf. »Nein, es sind nur Papiere, die beim Ausräumen des Schranks liegen geblieben sind und die ich ordnen sollte. Mir ist das erst gar nicht aufgefallen, bis der Abt mich darauf angesprochen hat. Wie gut, dass Ihr das Kästchen noch nicht weggeworfen habt.« Das war nicht einmal eine große Lüge.