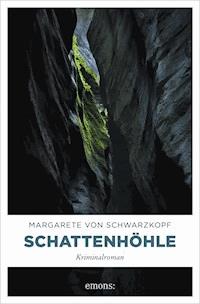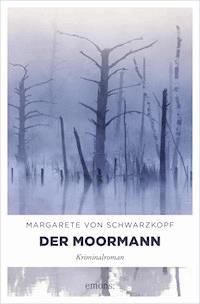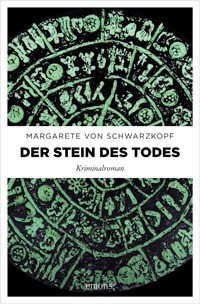Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Anna Bentorp
- Sprache: Deutsch
Geheimnisvoll und hochspannend: eine kriminalistische Reise in eine längst vergessene Zeit. Kunsthistorikerin Anna Bentorp wird in einer mysteriösen Angelegenheit um Hilfe gebeten: Aus einem alten Kloster am Steinhuder Meer ist ein Buch verschwunden, in dem von keltischen Masken von unschätzbarem Wert die Rede ist. Als dann auch noch ein Toter auf dem Klostergelände gefunden wird, ist Anna alarmiert. Steht der Mord mit den kostbaren Kultobjekten in Verbindung? Sie geht dem Rätsel der Masken auf den Grund, das sie bis nach Irland und tief in die Geschichte ihrer Heimatregion führt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Margarete von Schwarzkopf, geboren in Wertheim am Main, studierte in Bonn und Freiburg Anglistik und Geschichte. Sie arbeitete zunächst für die Katholische Nachrichtenagentur, dann als Feuilletonredakteurin bei der »Welt« und viele Jahre beim NDR als Redakteurin für Literatur und Film. Heute arbeitet sie als freie Journalistin, Autorin, Literaturkritikerin und Moderatorin.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2019 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: shutterstock.com/Sviluppo
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-568-8
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für TLF, meinen wachsenden magischen Kreis,und für meine Schwester Konstanza.
Vor allem aber in Erinnerung an den Onkel.
I write it out in a verse –MacDonagh and MacBrideAnd Connolly and PearseNow and in time to be, Wherever green is worn, Are changed, changed utterly:A terrible beauty is born.
»Easter, 1916«,William Butler Yeats (1865–1939)
Prolog
Die Schreie der Möwen, die im Nebel die Felsen hinunterstürzten und im Dunst über den Wellen untertauchten, klangen wie die eines Menschen in Todesangst.
Der eisige Wind, der seit Tagen über die Insel fegte, legte sich wie ein kaltes Band um seinen Hals. Die dunkle Ahnung überkam ihn, dass er seinem Verfolger nicht entkommen war. Vielleicht bildete er es sich nur ein, aber er spürte seine anfängliche Überzeugung, auf der einsamen Felseninsel einen sicheren Hort gefunden zu haben, einem Gefühl der Unsicherheit weichen. Irgendwo lauerte der Namenlose auf ihn, der Mann ohne Gesicht, der ihn wie ein Raubvogel umkreiste. Er hatte ihn nicht abschütteln können, obgleich er seine Flucht aus Irland sorgfältig geplant und immer wieder versucht hatte, seine Spuren zu verwischen. Doch wie ein Schweißhund war der Namenlose seiner Fährte gefolgt, berechnend, kühl, ein erfahrener Jäger, der nur auf den richtigen Moment lauerte, um zuzuschlagen.
Oh ja, der Namenlose wusste, wie man jagte, hatte er doch lange Jahre in Amerika als Fallensteller und später als Pionier gelebt, ehe er wieder in seine Heimat zurückgekehrt war, um anderer Beute nachzustellen. Er wusste einiges über den Mann, den er erstmals vor drei Monaten in Dublin gesehen hatte und der ihm von seinem Lieblingspub »The Holy Grail« durch die Gassen bis zu seinem Haus gefolgt war, stumm, den Hut tief in die Stirn gezogen. Hogan, der Wirt des »The Holy Grail«, hatte ihm berichtet, dass er den Mann schon einige Male gesehen habe. Man erzählte sich Geschichten über ihn. Keiner wusste, wie er wirklich hieß. Er sei erst vor Kurzem zurück nach Dublin gekommen. Er tauchte gelegentlich in dem Pub auf, trank wortlos sein Bier und ging, ehe ihn jemand in ein Gespräch verwickeln konnte. Er wirkte wie ein Phantom, das nicht einmal Hogan genauer beschreiben konnte. »Groß ist er, hat dunkle Augen, aber man sieht nicht viel von seinem Gesicht wegen dieses Hutes, den er nie ablegt. Und er trägt einen dichten Bart.«
Eines Abends war ihm der Fremde bis zu seiner Wohnung gefolgt, und er hatte ihn nicht bemerkt, bis der Hund seiner Nachbarin den Fremden mit wütendem Knurren ansprang. Der Mann verschwand darauf im Schatten des nahen St. James Parks. Was der Fremde von ihm wollte, konnte er nur ahnen.
Wenige Tage später hatte er Dublin verlassen und war zunächst nach London gereist, wo er für einige Wochen bei Verwandten seines Onkels Reginald blieb. Aber das Ziel seiner Reise lag in Deutschland. Er musste den Auftrag seiner Tante erfüllen, die ihm mehr vertraute als allen anderen Verwandten ihres verstorbenen Mannes. In London glaubte er, dem Fremden entkommen zu sein, und machte sich auf den Weg in Richtung Kontinent.
Seit er vor vier Tagen nach einer stürmischen Seereise auf Helgoland gelandet war, schien sich die Natur gegen diese kleine Insel verschworen zu haben. Das Meer brandete mit gewaltigen, von Schaum gekrönten Wellen gegen die Felsen, der Sturm zerrte an den Häusern und Bäumen, die Schiffe im Hafen tanzten auf dem grauen Wasser. Kein Schiff verließ in diesen Tagen den sicheren Hafen. Soweit er wusste, war auch kein Schiff seit seiner Ankunft mehr gelandet.
Man hatte ihn gewarnt, um diese Jahreszeit hierherzukommen. Aber die karge Insel, die nach fast hundertjähriger dänischer Herrschaft nun seit siebzehn Jahren als Kronkolonie unter englischer Oberhoheit stand, erschien ihm als erste Station auf seiner Reise nach Deutschland bestens geeignet. Wer sollte ihn ausgerechnet hier suchen? Dieser bei schlechtem Wetter isolierte Felsen im Meer war der ideale Ort für eine Verschnaufpause, ehe er seine Reise fortsetzte. Er war sicher gewesen, dass er dem Namenlosen ein Schnippchen geschlagen hatte.
Aber auch ohne die Bedrohung durch den Fremden hatte er bei der Planung seiner Route von Dublin nach Deutschland in Helgoland den geeigneten Ort gesehen, um eventuelle Verfolger abzuhängen. Ein Freund von ihm hatte von Helgoland erzählt, das 1807 noch während der Kontinentalsperre in den Kriegen gegen Napoleon von den Engländern besetzt worden war. Vor drei Jahren hatten die englischen Truppen die Insel dann verlassen, und Gouverneur Henry King war nun auf seine eigene Autorität gestellt. Kein schlechter Mann, wie es hieß, der aber mit der Bedeutung Helgolands für das Empire seine Probleme hatte. Was sollte man anfangen mit dieser winzigen steinernen Insel, die den Ruhm Großbritanniens wohl kaum mehrte? Helgoland war noch kleiner als Gibraltar, das sich seit mehr als hundert Jahren unter englischer Herrschaft befand. Nützlich war die Insel allenfalls unter strategischen Gesichtspunkten.
Aber ihm gefiel es hier, obgleich dieser Ort so weit von seiner irischen Heimat entfernt lag, fast sechshundert Meilen im Vogelflug, wie ihm ein Freund erzählt hatte. Die Reise hierher dauerte insgesamt fast drei Wochen, zunächst mit dem Schiff von Dún Laoghaire an die englische Westküste, dann nach London und schließlich von Harwich nach Helgoland. Das waren noch einmal gute dreihundert Seemeilen über offenes Wasser gewesen. Bei einem älteren Fischer, einem wortkargen Mann mit wallendem Bart und roter Nase, hatte er nach der anstrengenden Überfahrt eine Unterkunft gefunden. Hinnerk fragte nicht, was ihn, den jungen Iren, hierhergeführt hatte, und hatte seine alte Seemannskiste nur mit einem kurzen Blick gestreift.
Diese Kiste war ein Erbstück seines Onkels Reginald, der einst als Kartograph für die Royal Society gearbeitet und einige Zeit in Deutschland in einem kleinen Haus am Rande eines Moors gewohnt hatte, wo er laut Gerüchten viele Abenteuer erlebt und überlebt hatte. Reginalds Schwiegervater, ein ehemaliger Seemann und späterer Besitzer eines Pubs in der Londoner Hafengegend, hatte sie seinem Schwiegersohn geschenkt. Und Reginald, der nach seiner Rückkehr aus Deutschland im Trinity College in Dublin eine lohnende Arbeit gefunden hatte, um seine stetig wachsende Familie zu ernähren, hatte die Seemannskiste seinem Neffen übergeben, als der ihm erzählte, er werde bald eine lange Reise antreten.
Er zog seine Taschenuhr aus der Manteltasche. Zeit, zum Haus zurückzugehen und die dicke Suppe zu essen, die der alte Hinnerk abends kochte. Hinnerk war schon lange Witwer, hatte keine Kinder und die Insel nie verlassen. Ein grummeliger, aber dennoch nicht unfreundlicher Einzelgänger, der in seiner Kate hin und wieder für wenige Münzen eine Kammer an durchreisende Seeleute vermietete. Einschließlich Brot und einem Stück Käse am Morgen und einer kräftigen Suppe am Abend. Wenn Hinnerk gut gelaunt war, was aber in der kurzen Zeit, die er jetzt bei ihm wohnte, erst einmal der Fall gewesen war, servierte der alte Mann zur Abendsuppe ein dünnes Bier. Zum Frühstück gab es immerhin einen starken Tee, egal, welche Laune Hinnerk hatte.
Er steckte die Uhr wieder in die Manteltasche. Die Uhrenkette hatte er irgendwann verloren, aber er konnte sich von dem guten Stück nicht trennen, das ihm sein Vater einst geschenkt hatte. Er seufzte und wandte sich inseleinwärts. Der Gedanke an seinen Vater Gilbert, der vor vier Jahren bei dem Versuch, einen bei den Straßenkämpfen in Dublin verletzten Mann zu retten, von einem übereifrigen Soldaten Seiner Majestät getötet worden war, schmerzte noch immer. Sein Vater hatte sich als Arzt stets aus allen politischen Kontroversen herausgehalten, auch wenn er als überzeugter Katholik wenig von der religiösen Intoleranz in seinem Land hielt und von der Gleichberechtigung aller Konfessionen träumte. Aber König Georg III. schätzte diese Vorstellung wenig, und so wunderte es nicht, dass es seit gut dreißig Jahren in Irland immer wieder brodelte.
Der Pfad zu Hinnerks Kate, die in der Nähe eines steilen Hangs auf dem oberen Teil der Insel lag, verlief zwischen hohem Gras, das im kühlen Abendwind flirrende Geräusche von sich gab. Die Dämmerung vermischte sich mit dem Nebel und löste ein unbehagliches Gefühl in ihm aus. Er beschleunigte seine Schritte.
Er wollte dem alten Mann, der neben seinem friesischen Dialekt, dem Halunder, recht gut Englisch verstand, sagen, dass er die Insel schneller als ursprünglich geplant verlassen wolle. Er wartete nur darauf, dass sich das Meer und der Wind beruhigten. Das konnte am nächsten Tag oder auch in einer Woche sein. Ein unterschwelliges Gefühl, das sein Onkel Reginald als sechsten Sinn bezeichnen würde, drängte ihn zur Weiterreise.
Pitter Petersen, ebenfalls ein älterer Fischer, hatte ihm angeboten, ihn gegen ein geringes Entgelt nach Cuxhaven zu bringen. Die Entfernung bis zur deutschen Küste betrug keine vierzig Seemeilen. Mehr als einen halben Tag würde seine Reise nicht dauern, vorausgesetzt, das Wetter spielte mit. Und erst einmal im Königreich Hannover angelangt, würde er bis zu seinem Ziel nur noch wenige Tage unterwegs sein.
Er pfiff leise vor sich hin. Seine Furcht, dass ihn der namenlose Fremde verfolgt haben könnte, kam ihm plötzlich albern vor. Niemand wusste von seinem Abstecher nach Helgoland, selbst seine Tante glaubte, er habe den direkten Weg zum Kontinent gewählt.
Das letzte Stück des Pfades zu Hinnerks Kate führte an einigen Fischerhütten vorbei. Sie lagen unbeleuchtet in der feuchten Dunkelheit, die sich in den letzten Minuten wie ein Vorhang über die Insel gesenkt hatte. Er kannte ihre Bewohner nur vom Sehen. Die Männer brachten ihre Zeit am Hafen zu, um ihre Boote zu reparieren und die Netze zu flicken, die Frauen blieben in den Häusern, und die wenigen Kinder besuchten die kleine Schule im Unterland und kamen erst am späten Nachmittag nach Hause. Hie und da schrie ein Säugling, aber ansonsten war es oft geradezu beklemmend ruhig hier oben.
Er beschleunigte seinen Schritt. Auf dem Weg lag auch die Schenke »Zum Wilden Wassermann«, in der er schon manches Bier getrunken hatte. Fröhliche Stimmen und das Klirren von Krügen waren zu vernehmen. Gerne wäre er eingekehrt, doch es zog ihn weiter. Endlich tauchte Hinnerks Behausung vor ihm auf. Der alte Fischer hatte sein Haus erst vor Kurzem neu gekalkt und einen kleinen Vorgarten angelegt, in dem allerdings zu dieser Jahreszeit nur einige zerzauste Sträucher und ein kahler Rosenstock standen. Aus dem Haus drang Licht. Er atmete erleichtert auf. Geschafft!
»Hinnerk, ich bin wieder da. Ich hoffe, dass die Suppe fertig ist, ich habe einen Mordshunger«, rief er und stieß mit dem Fuß die Tür auf, die Hinnerk nie verschloss. »Bei mir gibt es nichts zu holen«, hatte seine Antwort auf die Frage gelautet, weshalb er die Tür immer nur angelehnt ließ. »Hier kennt jeder jeden, und jeder weiß, dass ich nichts habe.«
Er betrat die Kate, die aus einem Vorraum, einer Wohnstube mit Kochstelle und zwei Kammern bestand, von denen er eine gemietet hatte. Waschen konnte man sich an der Regentonne hinter dem Haus, und die Notdurft verrichtete man in einem winzigen Holzschuppen ein Stück von der Regentonne entfernt. Jeden zweiten Tag entsorgte Hinnerk den Behälter im Schuppen und spülte alles gründlich aus. Da es fast jeden Tag regnete, blieb die Regentonne stets gut gefüllt und enthielt reichlich Wasser fürs Waschen, Kochen, Teetrinken und für Hinnerks Bemühungen, sein kleines Haus sauber zu halten.
Er streifte seine Stiefel ab und sah sich nach Hinnerk um. Auf dem grob geschnitzten Holztisch im Vorraum standen zwei Öllampen, die vor sich hin schwelten und ein schwaches Licht verbreiteten. Er schnupperte, doch er konnte keine Suppe riechen. Als er zur Kochstelle trat, sah er, dass Hinnerk zwar eine Rübe und einige Kartoffeln geschält und die Schalen neben dem Herd liegen gelassen hatte, aber offenbar noch keine weiteren Anstrengungen unternommen hatte, das Abendessen zuzubereiten. Seine gute Laune verflog jäh. Hier stimmte etwas nicht.
Ein unwirkliches Gefühl überkam ihn. Sein Atem verlangsamte sich, als er mit zitternden Händen den groben braunen Stoff beiseiteschob, der Hinnerks Schlafkammer vom Wohnraum trennte. Fast wäre er über die Gestalt gestolpert, die dort quer auf dem fest gestampften Lehmboden lag. Aus Hinnerks Brust ragte ein Messer, dessen Griff aus Walknochen im matten Licht der Öllampen aus dem Nebenraum schwach glänzte. Er erkannte Hinnerks Messer, das dieser zum Ausnehmen von Fischen benutzte. In den halb geschlossenen Augen des Toten glaubte er einen Ausdruck des Entsetzens zu erkennen. Auf dem grauen Kittel, den der alte Mann über einer Leinenhose trug, zeichneten sich rostrote Flecken ab. Ein rotes Rinnsal war auf den Boden gelaufen und hatte dort eine winzige Lache hinterlassen.
Einen Augenblick erstarrte er. Doch dann löste er sich aus dem Schock und kniete sich neben die Leiche des alten Mannes, berührte sie aber nicht. Er sah sich um. Fast fürchtete er, dass sich aus dem Schatten der Kammer jeden Moment eine Gestalt auf ihn stürzen könnte. Doch nichts regte sich. Es war im wahrsten Sinne des Wortes totenstill in der Hütte.
Aus dem Augenwinkel erkannte er, dass Hinnerks Kleidertruhe, sein einziges Möbelstück außer einem schmalen Bett, offen stand und seine Kleidungsstücke auf dem Boden verstreut lagen. Der Vorhang zu seiner eigenen Schlafkammer war heruntergerissen worden.
Mühsam richtete er sich auf und tastete sich zurück in die Wohnstube, holte eine der beiden Öllampen und ging vorsichtig hinüber zu seiner Kammer. Das flackernde Licht der Funzel genügte, um zu erkennen, dass seine Seemannskiste aufgebrochen und ihr Inhalt ebenfalls auf den Boden geworfen worden war.
Zitternd blickte er sich um und leuchtete in den Teil des kleinen Raumes, wo er gleich nach seiner Ankunft auf der Insel ein Versteck für die Objekte seiner Tante eingerichtet hatte. Trotz seines Entsetzens über den toten Hinnerk spürte er Erleichterung. Das Versteck schien unangetastet. Als er darauf zugehen wollte, hörte er von draußen ein knackendes Geräusch. Vorsichtig näherte er sich dem kleinen Fenster und sah einen gebückten Schatten an der Mauer kauern wie ein sprungbereites Raubtier.
Das genügte ihm. Er stürzte aus der Kate ins Dunkle, rutschte den schmalen Pfad hinunter und hielt erst an, als er die Schenke erreicht hatte. Mit einem gurgelnden Schrei riss er die Tür auf und taumelte in den Schankraum. Später erinnerte er sich nur noch verschwommen an die fassungslosen Gesichter der Gäste, an den Wirt, der auf ihn zueilte. Der Rest des Abends versank in einer Flut von wirren Momenten, entsetzten Rufen, dem Versuch des Wirtes, ihn mit Schnaps von seinem furchtbaren Zittern zu befreien. Immer nur ein Gedanke jagte durch seinen Kopf: Seine Ahnung hatte ihn nicht getrogen! Der Namenlose, der Mann ohne Gesicht, war ihm doch nach Helgoland gefolgt. Und er würde nicht ruhen, bis er ihm das entrissen hatte, was ihm seine Tante anvertraut hatte.
Und täglich grüßt das Murmeltier
Anna spürte ein unangenehmes Kratzen im Hals und ein Kribbeln im Rücken. Nicht schon wieder! Erst im November hatte sie an einer Erkältung laboriert, die sie sich bei einer Veranstaltung in Hamburg eingefangen hatte. Anna schob sich eine Pastille in den Mund, die nach Lavendel und Pfefferminz schmeckte. Seit Tagen freute sie sich auf diesen Abend im Kloster Lüne in Lüneburg, wo sie über »Schätze aus dem Moor« referieren sollte. Sie würde sich diesen Abend nicht durch einen lächerlichen Schnupfen verderben lassen.
Energisch betrat sie die kühle Eingangshalle des Klostergebäudes. Dort erwartete sie eine schmale Frau von etwa fünfundsiebzig Jahren, die jetzt auf sie zutrat.
»Roswitha Ebersberg. Ich bin derzeit für die Organisation der Klosteraktivitäten verantwortlich, sozusagen ausgeliehen vom Kloster Ebstorf«, stellte sie sich ohne Umschweife vor. Sie reichte Anna eine zarte, mit Altersflecken übersäte Hand, die sie kaum zu drücken wagte. »Schön, dass Sie heute Abend Zeit für uns haben, Frau Bentorp«, fuhr Roswitha Ebersberg fort. »Wir freuen uns sehr auf den Vortrag. Er findet im Kapitelsaal statt. Ich hatte nicht allzu viel Zeit für die Vorbereitung, da ich erst vor einer Woche hierhergekommen bin und nur für einen Monat bleiben werde. Aber ich hoffe, dass alles so weit in Ordnung ist.«
Anna beeilte sich, Roswitha Ebersberg zu versichern, wie sehr auch sie sich auf diesen Abend freute.
Roswitha Ebersberg nickte. »Dann würde ich Ihnen gerne bei einer Tasse Tee die Details der Veranstaltung erläutern.« Sie marschierte voran, und Anna folgte ihr in einen kleinen, gemütlichen Raum, wo bereits Teetassen, eine dickbauchige Kanne und ein Teller mit Keksen auf einem ovalen Tisch standen.
Das Prozedere wich kaum vom Verlauf ähnlicher Veranstaltungen ab. Fünfunddreißig Minuten Vortrag, kleine Pause, danach noch mal eine halbe Stunde Gelegenheit für Fragen und Antworten aus dem Publikum. Falls es keine Fragen geben sollte, erklärte Roswitha Ebersberg, würde sie ihren eigenen Fragenkatalog einbringen. Sie lächelte und goss Tee aus der dicken Kanne ein.
Anna wollte gerade erwidern, dass ihr alles recht sei, als ein sanfter Celloklang ertönte. Frau Ebersberg blickte Anna entschuldigend an und zog ein Handy aus der Tasche ihres dunkelgrauen Jacketts. »Einen Moment, bitte. Mein Neffe ruft mich von Kloster Warnstedt aus an.« Sie stand auf und verließ mit dem Handy am Ohr das Zimmer.
Anna trank ihren heißen Tee und versuchte, sich an die Geschichte des Klosters Warnstedt zu erinnern. Aber ihr fielen nur ein paar Daten ein: Gründung im 13. Jahrhundert, Benediktinerkloster, seit der Mitte des 16. Jahrhunderts ein lutherischer Konvent. Bekannt war das Kloster heute wegen seiner großen Bibliothek und einer sehr elitären Ausbildungsstätte für Gärtner. Es wohnten auch einige Stiftsdamen dort. Doch von den ursprünglich zwanzig Frauen waren heute nur noch vier übrig geblieben. Zwei Tanten ihrer Mutter hatten dort nach dem Krieg gelebt, beide verwitwet, da ihre Männer im Krieg gefallen waren.
Anna leerte ihre Teetasse und nahm die Blätter mit den Stichworten für den Vortrag aus ihrer Umhängetasche.
Doch sie konnte sich nicht darauf konzentrieren. Fetzen des Telefonats, das Roswitha Ebersberg im Nebenraum führte, drangen zu ihr. Offenbar ging es um nichts Angenehmes, der Anrufer hatte sich wohl mit jemandem gestritten, wertvolle Bücher schienen gestohlen worden zu sein.
Als Anna einen Blick auf ihre Armbanduhr warf und dabei erste Zeichen von Ungeduld spürte, öffnete sich die Tür, und Roswitha Ebersberg trat ein. Sie war blass und wirkte fahrig.
»Entschuldigung, das war wichtig.« Sie räusperte sich. »Die Eltern meines Neffen leben nicht mehr, und ich bin seine einzige Bezugsperson. Er macht derzeit eine Gärtnerausbildung in Kloster Warnstedt. Jetzt scheint ein Freund von ihm, der Bibliotheksassistent, verschwunden zu sein. Gerade jetzt, wo wegen des Neubaus alle achtzigtausend Bücher ausgelagert werden müssen.«
Anna nickte verständnisvoll. Sie hatte gehört, dass die Bibliothek des Klosters Loccum, das knapp zwölf Kilometer von Kloster Warnstedt entfernt lag, einen Neubau erhalten sollte. Dass auch das wesentlich kleinere Warnstedt offenbar eine neue Bücherei bekommen sollte, war ihr nicht bekannt gewesen. Sie wusste nur, dass seit einigen Jahren Archäologen Grabungen auf dem Klostergelände vornahmen, um nach den Vorläufern der heutigen Klostergebäude zu forschen, die schon im frühen Mittelalter bei Warnstedt errichtet worden waren. Man hatte schon einige Mauerreste und Teile einer sehr alten Kapelle entdeckt.
»Kein Problem«, erwiderte Anna. »Wir haben ja noch Zeit.«
Roswitha Ebersberg schien sie nicht zu hören. »Hoffentlich hat er sich nicht wieder in etwas hineinmanövriert«, murmelte sie. Dann hob sie den Blick. »Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie damit behelligt habe. Ich bin wie gesagt Felix’ einzige nahe Verwandte.« Sie zuckte mit den Achseln. »Na ja, wahrscheinlich klärt sich das alles ganz schnell wieder. Mein Neffe liebt Krimis und steigert sich schon mal in Geschichten hinein.« Sie lächelte. »Jetzt sollten wir zu Ihnen kommen und zu unserem heutigen Abend.«
Anna schob ihre Teetasse beiseite. An diesem Märztag würde sie ihren Vortrag in Lüneburg halten und am nächsten Abend in Hannover der Einladung ihres alten Bekannten – oder war er mehr als das? – Richard Bernhard folgen, der im Kreis »einiger Weggefährten« in einem neu eröffneten Restaurant seinen vierundfünfzigsten Geburtstag feiern wollte.
Anna hatte den umtriebigen Antiquitätenhändler seit Dezember nicht mehr gesehen, obwohl er ihr regelmäßig SMS schickte und sie immer wieder einlud, sich mit ihm zu treffen. Ganz harmlos, zum Kino oder zum Kaffee. Aber Anna hatte keine Zeit gehabt. Sie war im letzten Jahr nach Dublin gereist, um dort für ein Museum ein Bild zu begutachten und ihrer irischen Freundin Deirdre bei deren Arbeiten an einer Biografie eines Ahnen zu helfen. Auch nach ihrer Rückkehr hatte sie ein dicht gedrängtes Programm, das sie an den Wochenenden häufiger nach Köln zu ihrer Patentante und ihrer Mutter führte und ihr deswegen weniger Muße für Hannover ließ.
Ihre Patentante hatte sie gebeten, die vielen Bilder in ihrem alten Haus genauer unter die Lupe zu nehmen und sie einzuschätzen. »Wichtig für mein Testament und für die Steuer«, hatte die alte Dame gesagt, die seit mehreren Jahren im Rollstuhl saß, geistig aber noch sehr rege war.
Viel war bei Annas Analysen diverser Gemälde noch nicht herausgekommen. Fast alles war solide Kunst aus dem 19. Jahrhundert, darunter etliche Porträts von Damen und Herren mit eher starren Gesichtern und dunkler Kleidung, erstellt von unbekannten Malern diverser Malerschulen. Interessanter als die Bilder war für Anna die große Sammlung alter Bücher, die ihre Tante testamentarisch dem Kölner Stadtarchiv überlassen wollte – »sollte das je wieder in neuem Glanz erstehen«.
Doch Richards Geburtstag morgen konnte und wollte Anna nicht auslassen, zumal sie gespannt war auf die »Weggefährten« Richards, der immer eine Überraschung aus dem Hut zauberte. Sie hoffte nur, dass nicht irgendwelche Figuren aus der Halbwelt auftauchten, die vielleicht einmal mit ihm einen Deal gemacht hatten.
Der Abend in Kloster Lüne verlief harmonisch, das Publikum stellte nach dem Vortrag gute Fragen, und als Anna gegen Mitternacht in ihrem Hotel ankam, war sie zufrieden und müde. Roswitha Ebersberg versprach Anna, wegen eines eventuellen weiteren Vortrags über das Thema »Schätze vom Dachboden« mit ihr in Kontakt zu bleiben. Eine Vorstellung, die Anna auch deshalb reizte, weil sie von Richards Erfahrungen mit angeblichem Trödelkram bei der Sendung »Gutes für Geld« zehren konnte. »Da ist oft wahnsinniger Ramsch dabei, andererseits aber manchmal auch wahre Goldstücke«, schilderte er seine Arbeit als Experte in der beliebten Fernsehshow. Etwa zehnmal im Jahr durfte er als Fachmann Objekte beurteilen. Sein Spezialgebiet waren Geschirr, Lampen und Bilder.
Anna gähnte. Ein guter Tag, ein schöner Abend und ihre angehende Erkältung hatte sich mit Hilfe von heißer Zitrone verzogen. Sie wollte gerade ihr Handy für die Nacht ausschalten, als sie eine SMS entdeckte, die ihr entgangen war: »Dringend! Muss dich noch vor meinem Geburtstagsessen morgen treffen. Richard«. Zu spät für eine Antwort, dachte Anna und fiel wenig später in einen festen Schlaf ohne störende Träume.
Am nächsten Morgen gönnte sie sich ein ausgiebiges Frühstück, ehe sie Richard anrief.
»Wie wunderbar, deine Stimme nach so langer Zeit wieder zu hören«, sagte Richard und klang ehrlich erfreut. Ehe sie ihm zum Geburtstag gratulieren konnte, kam er zur Sache. »Ich muss etwas mit dir besprechen. Es geht um eine merkwürdige Geschichte. Aber am Telefon ist das nicht so gut. Kannst du mich um vierzehn Uhr im Geschäft treffen? Ich mache den Laden dann sowieso dicht.«
»Ja, ich komme, und übrigens alles Gute zum Geburtstag«, rief Anna, ehe er auflegte.
Gegen vierzehn Uhr betrat sie seinen Laden in der Nähe der hannoverschen Marktkirche. Im kalten Licht dieses Märztages tanzten Staubfäden über dem Parkettboden des geräumigen Geschäfts mit den hohen Bücherregalen, den Vitrinen mit Vasen und Porzellanfiguren, den alten Lampen, kleinen Salonsesseln und den Stichen an den zartgrün gestrichenen Wänden. Auf einem Sessel saßen zwei Puppen, die Anna zusammen mit Richard vor gut einem halben Jahr in einem Schloss im Ith in einem Schrank auf dem Dachboden entdeckt hatte. Sie besaß die dritte im Bunde dieser Puppen und hatte vermutet, dass Richard die Porzellanmädchen längst verkauft hatte. Irgendwie berührte sie der Anblick der beiden bleichen Damen in ihren hübschen Rüschenkleidern. Sie wirkten weltfremd und verloren, wie Puppen-Aliens inmitten von alten Möbeln und Porzellan.
Doch ehe sie sentimental werden konnte, kam Richard aus seinem Büro gestürmt, das im hinteren Teil des Ladens lag und durch einen dicken dunkelgrünen Samtvorhang vom Rest des Raumes getrennt wurde. Seine Umarmung riss sie fast von den Füßen.
»Prima, dass du Zeit für mich hast, bevor heute Abend dieser Trubel ausbricht. Wir werden zwanzig Personen beim Essen sein. Da kommen wir wieder nicht dazu, uns richtig zu unterhalten. Und du meldest dich leider nicht gerade oft!« Er sah sie vorwurfsvoll an, lächelte dann aber und umarmte sie noch einmal. »Komm, ich schließe schnell ab, und wir gehen rüber ins Marktcafé. Ich habe Lust auf ein Stück Geburtstagstorte.«
In einer Ecke des Cafés fanden sie noch einen kleinen Tisch, der nicht von fröhlichen Damen besetzt war, die ihren Samstagskaffeeklatsch genossen. Richard nahm Annas Hände in seine und sah sie versonnen an. Anna wurde unruhig. Wollte er ihr an seinem Geburtstag etwa einen romantischen Antrag machen? Die Kellnerin, die an ihren Tisch kam, um ihre Bestellung entgegenzunehmen, befreite Anna aus dieser etwas unangenehmen Lage. Richard ließ ihre Hände los und bestellte einen Cappuccino und ein großes Stück Schokoladentorte, Anna hätte es ihm gerne gleichgetan, entschied sich dann aber für Apfelkuchen: »Ohne Schlagsahne.«
Richard lächelte. »Ein paar Kalorien mehr würden dir nicht schaden.«
Als ihre Bestellung kam, nahm er eine Gabel voll mit cremiger Torte, verzog verzückt das Gesicht und seufzte tief. Anna musste lächeln. Das Kind im Manne lauerte allzeit hinter der Kulisse selbst eines sogenannten »reiferen« Herrn. Dann fragte sie etwas ungeduldig: »Warum wolltest du mich unbedingt heute Nachmittag sehen? Sicher nicht, um mit mir Kuchen zu essen?«
Richard legte die Gabel auf den Teller. »Nein, das ist nur eine herrliche Gelegenheit, in Kindheitserinnerungen zu schwelgen. Meine Mutter war eine große Tortenbäckerin, was sie besonders an meinen Geburtstagen unter Beweis stellte. Meine Kindergeburtstage waren immer eine schier endlose Abfolge von Tortenschlachten und Spielen wie Topfschlagen und Blinde Kuh.« Für einen Augenblick wirkte er melancholisch. Aber rasch verscheuchte er seine Erinnerungen an ferne Kindheitstage und fuhr fort: »Nein, es geht um eine etwas sonderbare Geschichte. Dazu muss ich etwas weiter ausholen.«
Anna spürte wieder einmal das Prickeln, das sie häufig überkam, wenn Richard ihr »sonderbare« Geschichten erzählte. In den knapp zwei Jahren, die sie ihn nun kannte, zeigten diese oft seine Neigung, ein wenig abseits der legalen Pfade zu wandeln. Richard war eine Spielernatur, die manchmal Risiken einging, die sich nicht immer als segensreich erwiesen und ihm auch schon einigen Ärger beschert hatten.
Richard bemerkte ihren besorgten Ausdruck und lächelte. »Keine Angst. Obgleich du richtig geraten hast, dass sich damit auch Fragwürdiges verbindet. Diesmal aber habe ich mich aus allem herausgehalten.« Er wirkte sehr zufrieden mit sich.
»Hör auf, in Rätseln zu sprechen«, grummelte Anna, die ihren Apfelkuchen noch nicht angerührt hatte.
»Du kannst ruhig essen, während ich spreche«, sagte Richard und zwinkerte ihr zu. »Also, vor einigen Jahren kontaktierte mich ein Mann, dessen wirklichen Namen ich nie erfahren habe, und bot mir Illuminationen aus alten Büchern an. Einzelne Seiten, die man, wie dieser Mann vorschlug, schön rahmen und gut verkaufen könne. Auf meine Frage hin, woher die Blätter stammten, antwortete er, dass sie Teile von Büchern aus einer Bibliotheksauflösung seien, sozusagen Reste von alten Werken, die durch Umwelteinflüsse so zerstört worden seien, dass nur noch einige Seiten pro Buch erhalten geblieben seien.« Richard trank einen großen Schluck Kaffee. Anna schwieg und kaute an einem Stück Apfelkuchen.
»Natürlich habe ich diesem Menschen kein Wort geglaubt, zumal er dann nichts weiter über seine Quellen oder die Provenienz der Seiten sagen wollte. Er schickte mir auf meine Bitte hin ein paar Fotos der Seiten, die eindeutig aus Büchern des Spätmittelalters stammten. Ich weiß, dass ich sofort die Polizei hätte informieren müssen. Aber ich habe ihm nur gesagt, dass ich keine Verwendung für diese Blätter hätte. Als ich ihn am nächsten Tag unter der Handynummer, unter der er mir die Fotos per WhatsApp geschickt hatte, anrief, um ihn vielleicht doch noch aus der Reserve zu locken und mehr über diese Blätter zu erfahren, war die Nummer nicht mehr existent. Ich hatte das Ganze rasch verdrängt, bis ich ein paar Wochen später erfuhr, dass jemand in der Bibliothek des Klosters Wienstätten in der Nähe von Celle Seiten aus illuminierten Werken gelöst und gestohlen hatte.«
Richard leerte seine Tasse. Er sah Anna nachdenklich an, die ihren Apfelkuchen inzwischen fast vertilgt hatte. Mit leiser Stimme fuhr er fort: »Leider sind mir alle Bilder auf WhatsApp verloren gegangen, als mein Handy einmal streikte. Aber ich war mir sicher, dass es sich um einige dieser Seiten gehandelt hat. Der eigentliche Dieb ist wohl gefasst worden, konnte aber nichts weiter über seine Auftraggeber und den Verbleib der Blätter aussagen, die auf dem schwarzen Markt gelandet und auf Nimmerwiedersehen verschwunden sind. Ich war natürlich erleichtert, dass ich mich da herausgehalten hatte.«
Richard sah sich in dem kleinen Café um und senkte seine Stimme noch mehr, sodass er beinahe flüsterte. »Das alles liegt fast acht Jahre zurück.« Er schob sich ein Stück Torte in den Mund.
Anna rutschte nervös auf ihrem Stuhl herum. »Und? Mach’s doch nicht so spannend!«
Richard grinste, wurde dann aber gleich wieder ernst. »Tja, und dann ist diese Geschichte bei mir gestern wieder hochgekommen, als ich zufällig einen kleinen Artikel über den Neubau der Klosterbibliothek von Warnstedt und die Auslagerung der Bücher gelesen habe. Sie läuft parallel zu dem großartigen Projekt in Loccum. Warnstedt ist zwar ein wesentlich kleineres Kloster, aber auch schon gute siebenhundertfünfzig Jahre alt. Ein alter Freund von mir ist damit befasst. Er ist seit einigen Jahren Bibliotheksleiter von Warnstedt. Ich hatte ihn für heute Abend eingeladen, aber gestern rief er spätabends an und sagte für heute ab. Er war unterwegs und hat gestern erfahren, dass angeblich ein paar Bücher fehlen. Ein junger Kerl, eigentlich Student, der ihm beim Registrieren, Sortieren und Ordnen der ausgelagerten Werke helfen sollte, ist ebenfalls spurlos verschwunden. Er wird nun verdächtigt, diese Bücher gestohlen zu haben. Wäre ja auch ein idealer Zeitpunkt bei dem Chaos beim Umsortieren, und leider wächst der Schwarzmarkt im Darknet fröhlich vor sich hin. Abgesehen von all den anderen Kanälen, über die gestohlene Kunstobjekte an Käufer gebracht werden können.«
Anna rührte nachdenklich in ihrer Kaffeetasse. Ob diese Geschichte mit dem gestrigen Anruf bei Roswitha Ebersberg zu tun hatte? Dieser Felix hatte ja auch etwas von Büchern und dem vermissten Assistenten gesagt. Das konnte kein Zufall sein. Irgendetwas war faul im Kloster Warnstedt.
Seltsamerweise amüsierte es sie, dass ihr ausgerechnet Richard davon erzählte. Denn der war früher selbst nicht immer so standhaft gegenüber der Versuchung gewesen, auf ungeraden Pfaden an interessante Objekte zu gelangen. Aber das war wohl endgültig Teil seiner Vergangenheit.
Richard aß das letzte Stück seiner Torte mit andächtig geschlossenen Augen und sagte dann: »Du bist erstaunlich schweigsam. Aber der Hammer kommt noch. Das war der Stand von gestern. Und nun halt dich fest! Heute früh kam per Einschreiben ein Päckchen bei mir an.«
»Und darin waren die gestohlenen Bücher?« Anna versuchte ironisch zu klingen und Richards Hang zur Dramatik zu konterkarieren.
Richard lachte auf. Sein Sinn für Humor war glücklicherweise stärker ausgeprägt als seine Selbstverliebtheit.
»Nicht ganz richtig geraten, aber ein Buch war schon in dem Paket, und ein kleiner Zettel lag dabei.« Er zog ein völlig verkrumpeltes Stück Papier aus seiner Jackentasche.
»Oh je«, sagte Anna. »Das erinnert mich doch sehr an unser letztjähriges Abenteuer im Ith. Täglich grüßt bei uns wohl das Murmeltier!« Bücher, geheimnisvolle Zettel, gestohlene Kunstwerke – ihr Leben schien sich im Kreis zu drehen.
Richard nickte. »Du hast nicht ganz unrecht. Lies das mal.« Er reichte Anna den Zettel.
Lieber Herr Bernhard,
das Buch, das ich Ihnen schicke, ist sehr wertvoll. Meiner Ansicht nach könnte es der Schlüssel zu einem Geheimnis sein, auf das ich durch Zufall gestoßen bin, aber noch nicht genauer erforschen konnte. Ich bin leider in etwas hineingeraten, das wenig erfreulich ist. Doch nur so viel: Jemand ist hinter diesem Buch her. Ich habe es unter Tausenden von Büchern in Kloster Warnstedt für einen Bekannten gefunden und kurz angelesen. Dabei habe ich erkannt, dass es auf keinen Fall in falsche Hände geraten sollte. Wie ich gehört habe, sind Sie bewandert mit alten Büchern und haben einen Sinn für Rätsel. Zudem kennen Sie, wie ich weiß, meine entfernte Tante Anna Bentorp aus gemeinsamen früheren Begegnungen. Eigentlich wollte ich mich an sie wenden, aber ich konnte ihre Adresse nicht recherchieren. Deshalb schicke ich das Buch zu Ihren Händen. Bitte leiten Sie es an meine Tante weiter, die ich gerne treffen würde, ehe ich zur Polizei gehe oder mir Rat an anderer Stelle hole. Hier meine Handynummer: 01520 5678001. Ich weiß das Buch bei Ihnen und Anna in sicheren Händen. Bitte nicht die Polizei verständigen – jedenfalls noch nicht!
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Piehlau
»Etwas wirr, aber du verstehst, warum ich dich sehen wollte? Kennst du diesen angeblichen Neffen?«
»Daniel Piehlau?« Anna stockte. Vor ihrem inneren Auge erschien ein Junge von etwa zwölf Jahren, der sich beim fünfzigsten Geburtstag seiner Mutter Henriette Piehlau, einer entfernten Cousine ihrer Mutter, neben sie gesetzt und ihr vergnügt plappernd erzählt hatte, er wolle Forscher werden und in Südamerika nach den verschollenen Ruinen indianischer Hochkulturen suchen. Das lag zwölf Jahre zurück. Seitdem hatte sie Daniel nicht mehr gesehen, der damals mit seiner Mutter bei Bonn gelebt hatte. Sie war fast fünfundzwanzig Jahre älter als er, der heute etwa vierundzwanzig Jahre alt sein musste. Seine Mutter Henriette war, wie sie am Rande erfahren hatte, vor zwei Jahren bei einem Tauchunfall vor der Küste Floridas gestorben, sein Vater Alfred lebte schon lange nicht mehr. Geschwister hatte Daniel keine. Er war das einzige und spät geborene Kind seiner Eltern. Ihre Mutter hatte nur wenig Kontakt zu ihrer Cousine Henriette gehabt, und deshalb war ihr Daniel weitgehend aus dem Gedächtnis gewichen.
»Ach herrje«, entfuhr es ihr, als sie auf den Zettel mit der krakeligen Handschrift starrte. Daniel war also der ominöse Assistent in Warnstedt, der beim Sortieren und Ordnen der ausgelagerten Buchbestände half? Das Buch, das er Richard geschickt hatte, war immerhin ein Werk aus den Klosterbeständen.
»Was für ein Buch ist das?«, fragte sie mit etwas zittriger Stimme.
»Liegt bei mir zu Hause. Das zeige ich dir noch. Ich habe versucht, den jungen Mann anzurufen, da es sich bei ihm wohl eindeutig um den Assistenten von Alfons Gremitzer, dem Klosterbibliothekar, handelt. Gremitzer kenne ich seit Jahren und habe mit ihm gelegentlich zu tun gehabt, wenn es um spätmittelalterliche Bücher ging. Da ist er Experte. Wie gesagt, er stand auf meiner Gästeliste, hat aber abgesagt, weil einige Unklarheit wegen der Bücher herrscht. Aber ich erreiche diesen Piehlau nicht. Ist er denn wirklich ein Neffe von dir?«
»Ja, sehr entfernt. Aber wir müssen damit sofort zur Polizei. Ich mache nichts mehr im Alleingang oder nur mit dir!« Annas Stimme nahm einen fast schrillen Ton an. Erinnerungen schwappten über sie hinweg, und aus der Ferne glaubte sie die Stimme von Hans Schumann zu hören, dem ermittelnden Kommissar aus ihren früheren Abenteuern: »Miss Marple vom Moor und nun auch noch Miss Marple vom Ith.« Sie schauderte. Nie wieder!
»Okay, okay«, beruhigte Richard sie. »Dann lass uns zu mir gehen, ich zeige dir das Buch.« Er grinste. »Das klingt doch besser, als dass ich dir meine Briefmarkensammlung zeigen möchte.«
Richard konnte es nicht lassen, aber heute zeigte sich Anna wenig empfänglich für seinen Kleinjungen-Charme. Sie stand abrupt auf.
»Wir können immer noch zur Polizei gehen«, sagte er beschwichtigend. »Du weißt ja, dass dein alter Freund Schumann seit Februar hier vor Ort ist. Ich habe ihn übrigens auch für heute Abend eingeladen. Er mag mich zwar nicht besonders, aber da mein Motto ›Weggefährten‹ lautet, gehört er auch dazu. Und er hat sogar zugesagt.« Er zwinkerte Anna zu. »Wahrscheinlich ahnt er, dass du auch da bist. Aber keine Angst, Harald Frostauer habe ich nicht gebeten.«
Dieser Pedant und einstige Verehrer von Anna hätte garantiert mit Begeisterung zugesagt und zumindest ihr den Abend verdorben. Frostauer war ein notorischer Besserwisser und Intrigant, aber manchmal durchaus hilfreich aufgrund seines enormen Wissens und seiner überbordenden Allgemeinbildung.
Anna aber hörte kaum zu. Ihre Gedanken kreisten um Daniels mysteriöse Worte. Und sie spürte ihre alte Schwäche: die Neugierde. Es war eine Art Déjà-vu, doch alten Büchern und geheimnisvollen Nachrichten vermochte sie nicht zu widerstehen. Aber selbstverständlich würde sie sich diesmal aus allem heraushalten und nur einen Blick auf das seltsame Buch werfen. Selbst wenn täglich das Murmeltier grüßte, hoffte sie, dass es bei diesem Rätsel ohne Leichen abgehen würde.
Sie lächelte Richard an und sagte: »Morgen in deinem Laden. Dann sehe ich mir das Buch in Ruhe an.« Den erwartungsvollen Ausdruck in seinen Augen ignorierte sie. Das Kribbeln in ihrem Nacken, das sie zu verdrängen versuchte, bezog sich nicht auf ihn. Doch was konnte der Blick auf ein altes Buch schon anrichten?
Der dunkle Felsen
Hans Schumann stand am Ufer des Steinhuder Meers unweit des Ortes Mardorf und fror in der feuchten Luft. Die Spurensicherung hatte das Gelände abgesichert, die Leiche des jungen Mannes, die ein Spaziergänger mit Hund in den frühen Morgenstunden entdeckt hatte, war unterwegs in die Gerichtsmedizin in Hannover. Das Auto des Toten, ein roter Golf, stand mit den Vorderreifen im Schlick des Uferrandes.
Schumann seufzte. Er war in aller Früh aus dem Tiefschlaf gerissen und zu diesem Tatort gerufen worden. Der Spaziergänger, der mit seinem Hund den Wagen mit der Leiche gefunden hatte, hieß Herbert Meier, der aufmerksame Hund Ferdi. Meier bezeichnete sich als »Frühaufsteher«, aber was ihn ausgerechnet an diesen abgelegenen Teil des Ufers geführt hatte, konnte er nicht genau sagen. »Heute wollte ich mit Ferdi mal ’ne andere Strecke gehen.« Er tätschelte seinem Golden Retriever den Kopf. Eigentlich habe ja Ferdi das Auto aufgespürt, das schräg im Schlamm inmitten des winterbraunen Schilfes stand. »Der hat plötzlich ganz wild an der Leine gezerrt und gefiept. Da habe ich gewusst, dass was nicht stimmt, bin ins Schilf hinein und hab dann dieses Auto so halb im Wasser stehen gesehen.«
Meier hatte Schumann einen Moment angesehen, dann war er mit belegter Stimme fortgefahren. »Ja, und dann bin ich näher ran und habe gesehen, dass da einer drinnen sitzt. Erst habe ich gedacht, dem sei schlecht oder so oder der schläft. Kommt ja vor. Aber Ferdi war ganz unruhig, und als ich ans Auto so richtig ran bin, konnte ich erkennen, dass der sich nicht mehr gerührt hat. Ich habe ans Fenster geklopft, aber keine Reaktion.« Herbert Meier schluckte. »Wie gut, dass ich mein Handy immer dabeihab, obwohl es schon so ein olles Ding ist.«
Meier hatte die Polizei in Neustadt alarmiert und einen Rettungswagen gerufen. Schumann bestätigte ihm »vorbildliches Verhalten«, worauf Herbert Meier ein strahlendes Lächeln mit weiß überkronten Zähnen zeigte. Sein Hund Ferdi hatte ein ähnlich prächtiges Gebiss. Meier erklärte, dass er sich mit Ferdi dann auf einen Baumstamm ein paar Meter entfernt gesetzt habe.
»Der Ferdi ist wegen dem Geruch, der da aus dem Wagen kam, so nervös gewesen, und ich wollte nicht im Weg stehen, als dann der Rettungswagen und die Polizei kamen.«
Noch hielt sich der Verwesungsgestank sehr in Grenzen, aber Hunde haben nun mal wesentlich feinere Nasen als Menschen. Der Gerichtsmediziner hatte als erste vage Zeitangabe für den Todeszeitpunkt des jungen Mannes im Wagen »etwa zweiundzwanzig Uhr bis Mitternacht« angegeben. Als Meier die Leiche entdeckte, musste sie schon mindestens sieben Stunden im Auto gelegen haben. Da der Wagen ein Hannoveraner Kennzeichen hatte, riefen die Polizisten aus Wunstorf, die zuerst am Tatort gewesen waren, ihre Kollegen aus Hannover. Und so kam es, dass Kommissar Schumann an diesem diesigen Morgen übermüdet am Ufer des Steinhuder Meers stand, dessen landschaftliche Reize er ignorierte.
Inzwischen hatte Schumann Mann und Hund nach Hause geschickt. Meier besaß ein kleines Elektrogeschäft in Neustadt, das er zusammen mit seiner Frau führte, und eine Werkstatt für Fernsehgeräte. »Obwohl das heute nicht mehr so viel bringt«, erzählte er Schumann. »Die Leute kaufen lieber neu.«
Als der gesprächige Herr Meier zu seinem etwas abseits stehenden Wagen gegangen und mitsamt Ferdi abgefahren war, besah sich Schumann die Umgebung näher. Er kannte diese Gegend von Niedersachsen noch nicht, war nur einmal vor einigen Jahren im berühmten Kloster Loccum für eine kleine Besichtigungstour gewesen. Damals war er noch verheiratet gewesen, und seine Frau Dagmar hatte sich stets für alles Kulturelle interessiert, vor allem für Kirchen und Klöster. Inzwischen lebte sie in Berlin, wo es zwar weniger Kirchen und Klöster, aber viel anderweitige Kultur gab. Und verheiratet war sie auch wieder. Mit Gregor, Inhaber eines Reisebüros für Afrikareisen.
Schumann riss sich von diesen Erinnerungen los. Zwanzig Jahre hatte seine Ehe mit Dagmar gehalten, immerhin. Und ihre Trennung war recht friedlich verlaufen. Sie hatten keine Kinder, nicht einmal einen Hund oder eine Katze, deretwegen sie sich hätten streiten können. Seither hatte er nur eine einzige Freundin gehabt, eine Kinderärztin mit drei Kindern und wenig Zeit für ihn, und zwischenzeitlich mit der Vorstellung geliebäugelt, dass Anna Bentorp sich für ihn interessieren könnte.
Er hatte sie vor knapp zwei Jahren erstmals bei einem Fall in der Nähe von Stade getroffen und dann bei einem weiteren Fall im vergangenen Herbst im Ith. Und gestern Abend nach längerer Zeit privat bei dem Geburtstagsessen seines Rivalen Richard Bernhard, dieses windigen, wenn auch zugegebenermaßen charmanten Antiquitätenhändlers. Sie hatten sich leider nur kurz unterhalten können, weil Richard Anna in Beschlag genommen hatte. Aber immerhin hatte es gereicht, um zu verabreden, dass sie sich bald einmal zu einem Mittagessen treffen würden. Zum Abschied hatte Anna noch gescherzt: »Hoffentlich kommt nicht wieder eine Leiche dazwischen!«
Na ja, dieser Tote, so traurig der Fall auch lag, hatte garantiert nichts mit Anna zu tun. Da war Schumann sich sicher. Aber der Fall würde eventuell dafür sorgen, dass er in den nächsten Tagen keine Muße für ein nettes Mittagessen mit ihr hatte. Er kam mit Anna nicht recht vom Fleck, wusste aber selbst nicht genau, was er eigentlich wollte. Eine Beziehung? Eine Freundschaft, wie sie laut »Harry und Sally« zwischen Männern und Frauen unmöglich erschien? Schumann schnaubte ärgerlich. Zurzeit lief bei ihm nichts wirklich rund.
Es war sein erster Toter, seit er vor wenigen Wochen von Hameln nach Hannover versetzt worden war. Der junge Mann hatte keine Papiere bei sich, keine Brieftasche, der Wagen sah aus, als ob ihn jemand gründlich auf- und ausgeräumt hätte. Im Handschuhfach lagen nur Papiertaschentücher und eine Packung Hustenbonbons. In der linken Seitentasche steckten eine Flasche Mineralwasser und ein Eiskratzer. Ansonsten wirkte das Auto wie ausgeweidet.
Dr. Emil Sauerwein, der Gerichtsmediziner, hatte bei der ersten Untersuchung der Leiche noch keine unmittelbare Todesursache feststellen können. Keine sichtbare Verletzung, keinerlei äußere Anzeichen für Gewalteinwirkung. Der junge Mann lag mit dem Kopf auf dem Steuerrad, beide Arme hingen seitlich hinab. Die Augen waren geschlossen, sodass er wirklich auf den ersten Blick wie ein Schlafender aussah. Gerade wurde das Kfz-Kennzeichen in Hannover überprüft, um den Halter des Wagens zu ermitteln und damit eventuell die Identität des Toten – falls es sich nicht wieder einmal um einen gestohlenen Wagen handelte.
Alles lief bisher routinemäßig. Dennoch spürte Schumann ein vages Unwohlsein. Vielleicht lag es aber auch an diesem diesigen Wetter, dieser wässrigen Kälte, die er, obwohl er so lange im nicht weniger feuchten Stade gelebt hatte, nicht abkonnte.
Von Stade hatte es ihn im vergangenen Jahr für ein paar Monate nach Hameln verschlagen und nun nach Hannover. Sein Vorgänger war vor Kurzem aus gesundheitlichen Gründen in den vorzeitigen Ruhestand getreten, und Schumann freute sich auf seine Arbeit in der Landeshauptstadt. Nur ein paarmal hatte er in den letzten Monaten so etwas wie Heimweh nach Stade und dem westlichen Landesteil verspürt.
Er ging noch einmal um das Auto herum. Das Schilf rund um den Wagen war zum großen Teil geknickt, aber die Spusi hatte bisher weder besonders markante Fußabdrücke noch andere Reifenspuren erkennen können. Nur die Abdrücke von Herbert Meiers wasserdichten Wanderschuhen und die Spuren von Ferdis Pfoten. Schumann, den seine Freunde ironisch Schumanski nannten, bückte sich und spähte unter das Auto. Es sah aus, als wäre der Wagen ohne Fremdeinwirkung in diese Schilfbüschel hineingerollt. Vielleicht war sein Fahrer zu diesem Zeitpunkt schon bewusstlos oder gar tot gewesen, und der Wagen kam zum Halten, als die Vorderreifen im Schlamm stecken blieben.
Schumann richtete sich wieder auf und blickte hinaus auf den See. Einige Meter vom Ufersaum entfernt erhob sich ein kleiner schwarzer Felsen im Wasser. Schumann wusste, dass das Steinhuder Meer an keiner Stelle tiefer als drei Meter war und in Ufernähe nur etwa fünfzig Zentimeter. Wäre der Wagen nicht vorher im Schlick stecken geblieben, hätte er sich spätestens an dem Felsen festgefahren.
Er kniff die Augen zusammen. Irgendetwas Dunkles wippte neben dem Felsen im trüben Wasser, wahrscheinlich eine Plastiktüte, die ein wenig umweltbewusster Ausflügler entsorgt hatte. Eine Welle spülte die Tüte an den Felsen, wo sie hängen blieb.
Einen Moment lang überlegte er, ob er ins Wasser waten und die Tüte herausfischen sollte. Das wäre eigentlich korrekt gewesen. Er verspürte eine tiefe Abneigung gegen Plastikmüll. Doch der Gedanke an das kalte Wasser schreckte ihn ab. So beließ er es bei der Theorie.
Als er erneut über den See blickte, fiel ihm auf, dass dies bei besserem Wetter eigentlich eine wunderhübsche Landschaft sein müsste. Doch an diesem Märzmorgen wirkte alles nur verlassen, trostlos und eintönig graubraun.
Schumann fragte sich, was der Tote hier verloren hatte. War er mit jemandem verabredet gewesen? An der Leiche fanden sich keinerlei Zeichen für äußere Gewalt, und das Innere des auffällig aufgeräumten Wagens ließ auch keinerlei Rückschlüsse auf eine handgreifliche Auseinandersetzung zu. Und doch überkam Schumann das Gefühl, dass es eine geplante Tat gewesen war, dass irgendjemand den jungen Mann an diesen abgelegenen Ort gelockt hatte, um ihn zu beseitigen. An dieser einsamen Stelle am See gab es nachts ganz sicher keine Zeugen. Es war Zufall gewesen, dass Herbert Meier an diesem Morgen so früh seinen Ferdi ausgerechnet hier Gassi geführt hatte. Ansonsten wäre die Leiche wahrscheinlich erst etliche Stunden, wenn nicht sogar Tage später gefunden worden.
Laute Vogelrufe rissen ihn aus seinen Überlegungen. Er sah hinüber zum anderen Ufer. Unter den Regenwolken jenseits des Sees zog ein Schwarm Wildgänse dahin, und für eine Sekunde überkam ihn ein Glücksgefühl. Die Wildgänse waren für ihn ein Zeichen, dass der Frühling nicht mehr weit sein konnte. Er sah den Gänsen nach, die in wohlgeordneter Formation durch die Luft glitten. Ihre Schreie hallten noch einmal kurz über den See, dann verschwanden die großen Vögel in den Wolken.
Schumann wollte sich gerade umdrehen und zum Tatort zurückkehren, da bemerkte er, dass eine Welle die kleine Plastiktüte, die an dem dunklen Felsen geklebt hatte, wieder losgerissen hatte und sie zum Ufer trieb. Jetzt gab es für ihn kein Zögern mehr. Er stapfte in die graugrüne Brühe hinein und bückte sich nach der Tüte. Dabei verlor er fast das Gleichgewicht, weil seine Gummistiefel im Schlick stecken blieben. Das hätte ihm gerade noch gefehlt, kopfüber in diesen Morast zu purzeln! Leise fluchend griff er nach dem glibberigen Ding und hob es hoch. Brackiges Wasser tropfte herunter. Eine eher unscheinbare kleine Tüte ohne Logo. Schumann betastete sie. Da steckte etwas drin. Ein kleiner, länglicher Gegenstand.
Er widerstand der Versuchung, die Tüte sofort zu öffnen. Erst einmal wollte er wieder ans Ufer zurück. In seinen Stiefeln schwappte Wasser, das seine Socken schon durchnässt hatte. Er schimpfte leise vor sich hin. Jetzt ein heißer Tee! Er wollte endlich weg von hier, am liebsten zurück in sein Büro, und abwarten, was ihm Sauerwein und die Spurensicherung berichten würden.
Mit unbeholfenen Schritten watschelte er zurück zum Schauplatz, gab seinem Assistenten Hartmut Brink zu verstehen, dass er genug gesehen habe und nach Hannover zurückfahren wolle. Dann öffnete er mit klammen Fingern die kleine Tüte. Darin befand sich ein Objekt, das einem Kugelschreiber ähnelte. Aber Schumann erkannte, dass es etwas ganz anderes war.
Das gestohlene Buch
Während Hans Schumann den kühlen Winden des Steinhuder Meers zu trotzen versuchte, saß Anna an diesem Sonntagvormittag in ihrem Wohnzimmer und las eine lange Mail, die ihr Deirdre O’Brien, ihre irische Freundin, geschickt hatte.
Liebe Anna,
als Du in Dublin warst, habe ich Dir von einer angeheirateten Tante von Reginald erzählt. Auf ihre Existenz war ich durch einen Zufall gestoßen, durch einen Brief, den Reginald ihr im Jahr 1799 geschrieben hatte. Damals hatte sie sich, frisch verwitwet, in ein Haus in den Wicklow Mountains zurückgezogen, das zum Besitz von einem alten Bekannten Reginalds gehörte.
Sie hat, wie ich Reginalds Brief entnehmen konnte, mit ihrem Mann bis 1795 in Amerika gelebt, später sind die beiden zurück nach Irland gegangen. Sie betätigte sich nach dem Tod ihres Mannes als Forscherin und Sammlerin irischer Mythen. Angeblich soll sie einige unglaublich wertvolle Relikte der irischen Vergangenheit entdeckt haben. Aber offenbar ist ein Großteil dieser Gegenstände entweder verloren gegangen oder gestohlen worden, denn Reginald vermerkt in einem seiner letzten schwarzen Notizbücher aus dem Jahr 1838, dass seine zehn Jahre zuvor verstorbene Tante zwar viele Bücher und schöne Möbel, einige recht gute Gemälde und eine Sammlung mit Meißner Porzellan hinterlassen habe, aber nur wenige ältere Objekte. Diese Tante ist, wie es heißt, eine Treppe hinuntergestürzt und mit achtundsiebzig Jahren gestorben. Ihr Wohnhaus Fleetwood House kam in die Hände einer Familie O’Toole. Da diese Tante keine eigenen Kinder hatte und der Besitzer im selben Jahr gestorben ist, hat sein Sohn das Haus verkauft.
Das Schicksal dieser Tante würde ich gerne weiterverfolgen, obgleich Reginald nur am Rande mit ihr zu tun hatte. Vielleicht interessiert sie Dich ja auch. Komm uns bitte bald wieder besuchen!
Anna hielt den Atem an. Laut keltischer Überzeugung verlief die Zeit in Spiralen und nicht in einer geraden Linie, und sie hatte immer stärker das Gefühl, dass auch ihre Zeit seit den Entdeckungen im Moor bei Bresterholz vor knapp zwei Jahren in Kreisen verlief und alle Ereignisse irgendwie miteinander verknüpft waren.
Deirdre war eine Urururenkelin von Reginald Fitzgibbon, dem Kartographen, der einst das Geheimnis des Moormannes entdeckt hatte. Diesem Geheimnis war Anna zweihundertdreißig Jahre später auf die Spur gekommen, als sie sich in einem Häuschen am Brester Moor mit Karten aus der Zeit des englischen Königs Georg III. befasst hatte. Ihre erste Begegnung mit Deirdre lag gut anderthalb Jahre zurück, als die junge Irin nach Hannover gekommen war, um Anna zu treffen. Seitdem waren sie in Kontakt geblieben, und es war eine Art Freundschaft entstanden, obwohl Deirdre zwanzig Jahre jünger als sie war. Deirdre schrieb an einer Biografie ihres Vorfahren, der nicht nur als Kartograph für die Royal Society und später als Kurator am Trinity College gearbeitet hatte, sondern offensichtlich auch, wie Deirdre bei ihren Recherchen in der Universität von Dublin festgestellt hatte, aktiv als Verfechter der irischen Unabhängigkeitsbestrebungen aufgetreten war. Gerne würde sie mit Deirdre über diese Erkenntnisse sprechen.
Schon im letzten Herbst war Anna nach Dublin gereist, um Deirdre zu besuchen und mehr über die spannenden Recherchen zu Reginald zu erfahren. »Reginald hat sich als Mitglied einer Gruppe mit dem Namen ›The Sons of Ireland‹ für die Möglichkeit einer akademischen Ausbildung für Katholiken eingesetzt. Eine unpolitische Gruppe, aber recht erfolgreich in bestimmten Kreisen«, hatte Deirdre ihr erklärt.
Anna hatte ihren Besuch mit einer Anfrage des National Museum in Dublin verbinden können, das sie um Rat wegen der ungeklärten Provenienz eines auf einer Auktion erstandenen Bildes von Caspar David Friedrich gefragt hatte. Dabei war sie einem entfernten Vetter von Deirdre begegnet, Desmond Casey, Archäologe und Spezialist für keltische Kunst – ein attraktiver Mann von Anfang fünfzig mit dunklen, schon ein wenig angegrauten Haaren und sehr blauen Augen. Desmond galt als Experte für irische Mythologie und frühkeltische Religionen. Die viel zu kurze Begegnung mit ihm hatte Anna sehr beeindruckt. Desmond stand kurz vor einer Reise in die USA, um in Boston bei der Irish Society of Historical Heritage einen Vortrag über die Bedeutung keltischer Mythen für die Identität Irlands in der Neuzeit zu halten. Gerne hätte sie mehr Zeit mit dem klugen und humorvollen Mann verbracht, doch ein längeres Treffen vertagten sie auf »ein nächstes Mal«. Vielleicht bot ihr ja Deirdre durch diese Mail eine Gelegenheit dazu. Sie würde ihre Einladung bald annehmen.
Anna hatte noch etwas Zeit bis zu ihrem geplanten Treffen mit Richard. Ohnehin brauchte sie noch mindestens eine weitere Tasse Kaffee, um munter zu werden. Das Geburtstagsessen am gestrigen Abend hatte bis zwei Uhr morgens gedauert, und sie hatte sich sehr gut mit dem Gastgeber, der vor lauter Charme sprühte, und einigen anderen Gästen unterhalten. Schade nur, dass sie mit Hans Schumann, der Richards Einladung zu ihrer Freude und Überraschung tatsächlich gefolgt war, nur wenig sprechen konnte. Er verschwand wie Aschenbrödel kurz vor Mitternacht, hinterließ zwar keinen gläsernen Schuh, aber das Versprechen, sich bald mal zu melden, was immer »bald« in seinem Fall hieß. Anna hatte kaum etwas über seinen neuen Job erfahren und wie er sich in Hannover fühlte, wo er in einer kleinen möblierten Wohnung in der Nähe des Maschsees lebte.
Ein leiser Klingelton in ihrem Laptop kündete eine weitere Mail an, die wiederum von Deirdre stammte.
Um noch einen Teaser anzubringen: Der Mann dieser Tante ist übrigens 1798 in den irischen Aufständen unter der Führung von Wolfe Tone umgekommen. Mich beschäftigt die Frage, wohin all jene Objekte verschwunden sind, die die emsige Witwe im Laufe der Jahre gesammelt hat. Ich wünschte, Du könntest mir bei meiner Arbeit helfen. Reginald vermerkt im Übrigen in einem seiner Tagebücher, dass ein Neffe, der in engem Kontakt mit dieser Tante stand, 1824 praktisch über Nacht verschwunden sei. Reginald verweist auf einen Brief, den er nach ihrem Tod in ihrem Haus in einer versteckten Schublade eines Sekretärs gefunden hat. Dieses Schreiben kam aus Deutschland, aus einer Gegend, die den sonderbaren Namen Steinhuder Meer trägt. Und laut dieses Briefes sei »der Bote« gut angekommen. Der Brief selbst existiert nicht mehr, und Reginald hat auch den Absender nicht namentlich genannt. Aber vielleicht finde ich noch irgendwo eine Spur in seinen Notizbüchern. Es ist schon seltsam, dass gewisse Fährten immer wieder nach Deutschland führen. Ich habe ein wenig recherchiert, wo dieses Steinhuder Meer liegt. Damals gehörte diese Gegend ja noch zum Vereinigten Königreich, Reginald ist 1838 gestorben, ein Jahr nach dem Ende der Personalunion zwischen Großbritannien und Hannover. Mehr dazu, wenn Du kommst. Desmond würde sich sicher auch über einen Besuch von Dir freuen. Er ist jetzt den ganzen März in Dublin, da er an der Universität Doktorandenkurse leitet.
Anna schmunzelte. Deirdre hatte sie durchschaut. Sie hatte wohl ihre Begeisterung für Desmond Casey allzu deutlich gezeigt. Aber ein winziges bisschen mehr noch als die Chance, ein weiteres Mal mit ihm zusammenzukommen, reizte sie der Gedanke, Deirdre bei ihren Recherchen über Reginald und in diesem Fall der namenlosen Tante zu helfen, die sich nach dem Tod ihres Mannes mit der irischen Frühgeschichte befasst hatte. Das klang spannend.
Bei ihrem letzten Fall hatte Anna mit Schottland zu tun gehabt, als es um das Schicksal einer Familie ging, die 1746 nach der Schlacht bei Culloden in den Ith geflüchtet war. Zwar war das Rätsel um das Geschick der MacNeills weitgehend gelöst, doch es waren immer noch einige offene Fragen geblieben. Nicht auf alles ließen sich immer Antworten finden, auch wenn es in Anna rumorte und es sie ärgerte, dass es ungelöste Geheimnisse gab.
Jetzt aber war Irland dran. Anna wagte zwar nicht zu hoffen, dass sie zusammen mit Deirdre die verschollenen Objekte aus dem Besitz der Tante finden würde, aber vielleicht erwies sich die Beschäftigung mit der mysteriösen Dame als Abwechslung ihres derzeit nicht sehr aufregenden Alltags und als eine Möglichkeit, Irlands geheimnisvoller keltischer Vergangenheit näherzukommen – und natürlich Desmond wiederzusehen. Einen Moment spürte Anna einen Hauch von schlechtem Gewissen Richard gegenüber. Aber dieser Hauch löste sich sofort wieder auf.
Anna griff nach ihrem Terminkalender. Theoretisch hätte sie in der kommenden Woche einige Tage Zeit. Aber ehe sie Deirdre kontaktierte, wollte sie sich um das Buch kümmern, das ihr Richard zeigen wollte.
Sie stand auf, schaltete den Computer aus und sah kurz zum Fenster hinaus. Der Wind hatte aufgefrischt, die ersten Regentropfen platschten auf die Straße. Während sie ihren Regenmantel anzog, blickte sie noch einmal hinaus. Neben ihrem kleinen Wagen entdeckte sie eine regungslose Gestalt, das Gesicht unter einer Kapuze verborgen. Zufall? Oder wartete dieser Mensch etwa auf sie?
Sie schüttelte den Kopf. Nur weil er neben ihrem Auto stand, hieß das noch lange nicht, dass er sie treffen wollte. Ihre Phantasie brannte wieder einmal mit ihr durch. Sie verscheuchte diese Gedanken. Am helllichten Tag schreckten sie diese Figuren nicht, die sich unter ihren Kapuzen zu verstecken schienen. Abends begegnete sie ihnen schon wesentlich weniger gerne. Dass dieser Typ ihr Auto klauen wollen könnte, glaubte sie nicht. Der Wagen würde kaum den nächsten TÜV im Sommer schaffen.
Als sie auf die Straße trat, verschwand die Gestalt mit schnellen Schritten um die Ecke. Das machte ihr doch ein wenig zu schaffen. Anna glaubte selten an Zufälle. Aber es blieb ihr keine Zeit zum Nachdenken. Sie stieg in ihren guten alten Wagen und startete.
Eine halbe Stunde später stand sie vor Richards Laden. Er öffnete die Tür, und Anna staunte, wie fit er nach dieser kurzen Nacht wirkte. Keine dunklen Ringe unter den Augen wie bei ihr, wenn sie weniger als sieben Stunden geschlafen hatte. Frisch rasiert und wie immer schick in einem blauen Hemd, einem dazu passenden dunkelblauen Pullover und hellen Cordhosen. Automatisch verglich Anna ihn mit Desmond. Richard war durchaus konkurrenzfähig, dachte sie, schüttelte diesen Gedanken aber sofort wieder ab. Desmond würde wohl eher eine romantische Phantasie bleiben.
Richards Begrüßungskuss fiel enttäuschend flüchtig aus. Er führte sie in den hinteren Teil seines Geschäfts. Dort lag auf einem kleinen Mahagonitisch ein schmales Buch.