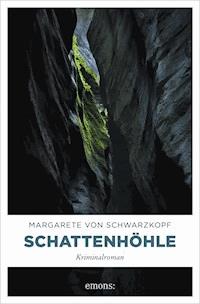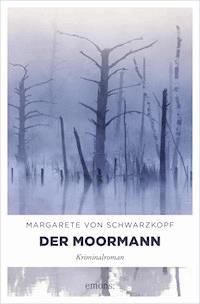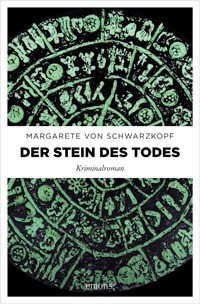11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein kundig geschriebener Kriminalroman mit zeitgeschichtlichen Bezügen. Anna Bentorps Teilnahme an einem exklusiven Filmfestival wird zum Alptraum, als bei einer Retrospektive für einen 1937 im Exil verstorbenen Filmemacher mehrere Verbrechen geschehen. Ein Fragment des Films, an dem er bis zu seinem mysteriösen Tod arbeitete und der als verschollen galt, soll als Höhepunkt des Festivals gezeigt werden – doch es wird gestohlen. Anna gerät immer tiefer in den Fall hinein, der längst kein Cold Case mehr ist. Wer würde für den alten Filmausschnitt über Leichen gehen?.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Margarete von Schwarzkopf, geboren in Wertheim am Main, studierte in Bonn und Freiburg Anglistik und Geschichte. Sie arbeitete zunächst für die Katholische Nachrichtenagentur, dann als Feuilletonredakteurin bei der »Welt« und viele Jahre beim NDR als Redakteurin für Literatur und Film. Heute ist sie als freie Journalistin, Autorin, Literaturkritikerin und Moderatorin tätig.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2022 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Montage aus istockphoto.com/Rattanachai Singtrangarn, shutterstock.com/Kris Mari
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Hilla Czinczoll
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-960-0
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Wie immer für meine Familie,insbesondere für meine Schwester Konstanza,und im Gedenken an meine Eltern,die Deutschland 1933 verlassen mussten
Filmemacher sollten bedenken, dass man ihnen am Tagdes Jüngsten Gerichts all ihre Filme wieder vorspielen wird.
Charles Chaplin
Vorspann
London, Anfang Oktober 1937
Chief Inspector Charles Howell blickte auf den Toten, der schräg in dem Regiestuhl saß, eine alte Armeepistole neben sich auf dem Boden.
»Eindeutig Selbsttötung«, sagte Howell zu dem jungen Mann, der neben ihm stand und voller Entsetzen die Leiche anstarrte. »Warten wir noch auf Sir Stephen Kings. Aber der Gerichtsmediziner wird meine Vermutung bestätigen.«
Der Chief Inspector sah sich im Raum um, der von zwei Lampen notdürftig erhellt wurde. Überall lagerten leere Filmdosen, es gab mehrere Schneidetische, und an einem davon hatte der Mann im Regiestuhl offensichtlich noch kurz vor seinem Tod gearbeitet. Howell wandte sich an den jüngeren Mann. »Rufen Sie bitte die Mitarbeiter des Verstorbenen zusammen, auch wenn es schon spät ist. Und wir müssen sehen, ob er einen Abschiedsbrief hinterlassen hat. Ansonsten das übliche Prozedere.«
Howell bückte sich und hob ein Stück Zelluloid vom Boden auf, das er dem jungen Inspector in die Hand drückte. Missmutig bemerkte er: »Der Tote war Deutscher. Einer von diesen Immigranten, die derzeit in unser Land fluten und meinen, sie hätten ein Recht auf Arbeit und Unterkunft. Wenn es nicht so eindeutig ein Suizid wäre, würde ich darauf tippen, dass sich zwei dieser bloody foreigners gestritten haben, und der eine hat den anderen umgelegt.«
Sein Assistent, ohnehin schon blass, wurde noch blasser. Leise sage er: »Sir, dieser Mann war ein berühmter Filmregisseur.«
Howell lachte und zeigte dabei seine großen gelblichen Zähne. »Diese alberne Pseudowelt des Kinos. Das soll Kunst sein? Na ja, meine Frau steht auch auf Charlie Chaplin und auf die Thriller von diesem Hitchcock. Alles wertloses Zeugs, sage ich. Aber wie dem auch sei, wir müssen korrekt vorgehen. Also, Mitarbeiter befragen und, falls er verheiratet war, seine Frau informieren. Und, mein Lieber, halten Sie die Medien zurück, bis wir Näheres wissen!«
Damit verließ Howell den Raum. Sein Assistent Christopher Kinley blieb allein mit dem Toten zurück. Der junge Mann sah sich vorsichtig um. Tod im Schneideraum, doch wo war der Film, an dem der Regisseur gearbeitet hatte? Keine Spur davon. Er steckte das Stück Zelluloid in seine Jackentasche und suchte noch einmal das Zimmer ab.
Doch ehe er sich mit der Frage, wo Welfensteins Film war, eingehender beschäftigen konnte, betrat Sir Stephen Kings den Raum, und Christopher war entlassen. Er musste versuchen, die engeren Mitarbeiter des Toten zu befragen, und, was ihm auf der Seele lastete, die Frau des Toten informieren. Howell dagegen war längst in sein hübsches Haus in Richmond gefahren. Dem Chief Inspector wäre ein zweiter Jack-the-Ripper-Fall am liebsten, Selbstmorde interessierten ihn nicht, und deutsche Immigranten passten nicht in sein Weltbild. Filmen stand er misstrauisch gegenüber, da er fiktive Geschichten nicht mochte und weder ins Kino ging noch Romane las. Alles überflüssiger Nonsens!
Christopher Kinley dagegen schätzte das Werk des toten Leopold Welfenstein und hatte den Medien entnommen, dass der Regisseur in den Ealing Studios an einem Film mit dem Titel »Das Geheimnis des dunklen Hauses« arbeitete, vorgesehener Starttermin im April 1938. Das würde wohl leider nicht passieren.
Schweren Herzens machte Kinley sich auf den Weg zu Elisa Welfenstein, der Frau des Regisseurs.
Erster Akt
London, Anfang Oktober 1937
»Drama in Ealing! Filmregisseur nimmt sich das Leben – der aus Deutschland stammende, international renommierte Regisseur Leopold Welfenstein erschießt sich im Schneideraum der Ealing Studios.«
Alexander Schönfels starrte ungläubig auf die dicke Schlagzeile des »Daily Express«. Er hatte die Zeitung nach seiner Ankunft in England im Bahnhof Dover Priory gekauft und sie ungelesen in seine Manteltasche gestopft. Auf der Zugfahrt zur Victoria Station in London wollte er die Zeitung in Ruhe studieren, um sich ein wenig in seiner neuen Umgebung zu akklimatisieren. Sein Englisch war weniger flüssig als sein Französisch, das er neun Jahre in der Schule gelernt hatte, aber er konnte Englisch lesen und sich einigermaßen verständigen. Immerhin hatte er in den letzten drei Monaten vor seinem Aufbruch aus Wien intensiven Unterricht genommen. Seine Lehrerin, eine in Wien studierende Engländerin namens Miss Elizabeth Curtis, bescheinigte ihm eine »für einen Österreicher erstaunlich gute Aussprache«.
»Internationally renowned film director commits suicide« – diese Zeile traf ihn wie ein glühender Pfeil. Er schnappte nach Luft. Schönfels wurde fast schwarz vor Augen.
Ihm gegenüber in dem stickigen Abteil saßen eine junge Frau, in einen Roman von Dorothy Sayers vertieft, und ein korpulenter älterer Herr, versteckt hinter der »Times«. Keiner der beiden Mitreisenden schien seine Reaktion zu bemerken. Schönfels hielt die Zeitung umklammert. Sein Kopf dröhnte, ihm brach der Schweiß aus. Sein bester Freund Welfenstein tot? Seinetwegen hatte er Wien verlassen, um in London gemeinsam mit ihm an dem neuen Film zu arbeiten. Welfenstein hatte vor drei Monaten die Regie übernommen, in der Hoffnung, dass diese Produktion seine große Chance bedeutete, fern seiner Heimat und der Babelsberger Studios in England Fuß zu fassen – und vielleicht sogar London als Sprungbrett für Hollywood zu nutzen wie schon etliche Filmkünstler vor ihm, darunter Ernst Lubitsch und Billy Wilder. Was für einen Grund sollte Leopold Welfenstein gehabt haben, Selbstmord zu begehen? Er war achtunddreißig Jahre alt, verheiratet mit einer entzückenden Frau und Vater einer einjährigen Tochter. Vor anderthalb Jahren war die Familie gemeinsam von Berlin nach London übersiedelt und hatte in der Nähe der Kensington High Street ein kleines Haus bezogen. Und er plante, einen großen Film zu drehen.
In seinem letzten Brief vor drei Wochen hatte Leopold ihm geschrieben, dass die Dreharbeiten ein wenig langsam vorangingen, da es Probleme mit dem Skript und der Hauptdarstellerin Claire Wilcox gegeben habe, dass aber alles geklärt und nunmehr vier Fünftel des Drehs im Kasten seien. »Ich erzähle dir alles en détail, wenn du kommst. Es wird dringend Zeit, dass wir an die Filmmusik denken und du dich bald an die Arbeit machen kannst. Der Film soll zu Weihnachten fertig sein und im April 1938 in die Kinos kommen. Es eilt. Meine Geldgeber drängen.«
Das waren die letzten Worte in dem Brief, den Schönfels am 15. September erhalten hatte. Heute war der 6. Oktober, ein Mittwoch, genau drei Wochen später. Schönfels hatte damals nicht lange gezögert. Seine wenigen Koffer waren schnell gepackt. In Wien wartete derzeit kein neuer Auftrag auf ihn, und Leopold hatte ihn schon vor seiner Abreise aus Berlin am 11. April 1936 gefragt, ob er sich vorstellen könne, ihm nach London zu folgen und für ihn zu arbeiten. Als Leopold Berlin verließ, da er trotz des großen Erfolgs seines hochgelobten Films »Die Lichter von Berlin« als jüdischer Künstler keine Arbeit mehr bekam, physisch bedroht und ausgegrenzt wurde, war sich Schönfels noch unsicher gewesen.
Doch auch die Atmosphäre in seiner Geburtsstadt Wien veränderte sich spürbar, und so hatte er seinem alten Freund zugesagt, für den er schon die Musiken zu fünf Filmen in Deutschland komponiert hatte. Seine Frau Sonja sollte im nächsten Monat mit der zweijährigen Tochter Eve nachkommen. Sie räumte in Wien noch die Wohnung aus. Ansonsten hatte er keine engere Familie mehr, seine Eltern waren an der Spanischen Grippe gestorben, als er einundzwanzig war und in Berlin studierte, und seine einzige Schwester Doris, vier Jahre älter als er, hatte 1917 einen Australier geheiratet und lebte schon seit Langem in Perth. Mit ihr hatte er kaum mehr Kontakt. Leopold Welfenstein stand ihm nahe wie ein Bruder, seit sie sich in Berlin kennengelernt hatten.
Und nun diese schreckliche Nachricht! Der kurze Artikel verwies darauf, dass Welfenstein offenbar Montagnacht, am 4. Oktober, tot in einem der Schneideräume der Ealing Studios aufgefunden worden war. Die Polizei hielt sich mit Einzelheiten zurück. Am Ende des Artikels stand ein Hinweis, dass in den nächsten Tagen ein Interview mit dem Produzenten des Films, Sir Albert Rowland, folgen sollte. Rowland hatte Welfenstein als Regisseur für »Das Geheimnis des dunklen Hauses« engagiert und wurde mit den Sätzen zitiert: »Die Filmwelt hat einen großen Verlust erlitten. Welfenstein war auf dem Weg zu internationalem Ruhm.«
Die Landschaft flog an Schönfels vorbei. Er sah weder die saftigen Weiden noch die sanften Hügel Kents, sondern starrte verloren auf den Artikel. Immer wieder las er Zeile um Zeile. Gelegentlich fing er einen Blick der jungen Frau auf, die ihn, wie es ihm schien, mit verhaltener Neugierde musterte. Der korpulente Mann dagegen hatte längst die Lektüre der »Times« aufgegeben und schnarchte lautstark.
Schönfels hatte in London ein Zimmer in einem kleinen Hotel nahe den Ealing Studios gebucht, da er sich nicht bei seinem Freund einquartieren wollte, obgleich dieser ihn herzlich eingeladen hatte. Rasch brachte er nach der Ankunft in London sein Gepäck ins »Little Royal«, warf einen kurzen Blick auf sein Zimmer mit den bunt geblümten Vorhängen, öffnete das Fenster, um den abgestandenen Geruch im Raum zu vertreiben, und machte sich dann auf den Weg zu Welfensteins Haus. Er musste mehrmals umsteigen, bis er sein Ziel erreichte.
Von der U-Bahn-Station Kensington ging er nur wenige Minuten. Nahe der St.-Mary-Abbot’s-Church in der Drayson Mews fand er das kleine Haus, das ihm sein Freund in mehreren Briefen glühend geschildert hatte. »Ruhig und freundlich, genügend Zimmer für noch mindestens zwei weitere Kinder«, schrieb Leopold. »Zwar ein Stück entfernt von den Studios, aber das empfinde ich als Wohltat.«
Um die blaue Tür wuchsen Kletterrosen, die noch vereinzelte Blüten trugen. Der Türklopfer aus Bronze zeigte einen Bärenkopf mit grimmig gefletschten Zähnen. Schönfels musste wider Willen lächeln. Das passte zu seinem Freund, der immer schon ein Faible für wilde Tiere gehabt hatte und ihm einmal gestand, er wolle eine gänzlich neue Interpretation von »Die Schöne und das Biest« drehen, wenn er in Hollywood angekommen sei. Ein Stich bohrte sich in Schönfels’ Herz. Diesen Traum würde sich Leopold nicht mehr erfüllen können.
Kaum hatte er den Türklopfer betätigt, wurde die Tür aufgerissen. Vor ihm stand Elisa Welfenstein. Ohne ein Wort fiel sie in seine Arme und schluchzte bitterlich. Schönfels hatte sie als zarte Frau in Erinnerung, doch jetzt wirkte sie hager. Die rot geweinten Augen in ihrem bleichen Gesicht sprachen Bände. Ein wenig ungeschickt streichelte er ihren bebenden Rücken.
Schließlich löste sie sich von ihm, schluckte und sagte mit heiserer Stimme: »Entschuldige, Alex. Komm bitte herein.« Elisa führte ihren Gast in ein kleines helles Wohnzimmer, von dem aus man einen Blick auf den winzigen Garten hatte. Alles sehr gepflegt, aber, wie Schönfels es empfand, ein wenig trostlos. Das mochte auch an dem kühlen Herbstwetter liegen. Der erste Sturm war gestern über England gefegt und hatte auch in diesem Teil Londons Blätter von den Bäumen gezerrt und Blumen geköpft.
Er setzte sich in einen der gemütlichen Sessel und wartete eine Weile, bis Elisa zurückkam und ein Teetablett auf den runden, niedrigen Tisch stellte, der zwischen dem Sofa und den drei Sesseln stand. Mit einem tiefen Seufzer setzte sie sich auf das gegenüberliegende Sofa. Doch schon sprang sie wieder auf, eilte in eine Ecke des Raums und kehrte mit zwei gefüllten Brandygläsern zurück. »Ich glaube, das brauchen wir jetzt beide«, meinte sie, und Schönfels sah so etwas wie ein leises Lächeln auf ihrem verweinten Gesicht, das aber rasch wieder verschwand. Sie trank einen großen Schluck und schwieg.
Endlich wagte er die Frage zu stellen, die ihn seit der Zugfahrt beschäftigte. »Was ist passiert, Elisa? Stimmt es, dass Leopold sich selbst erschossen hat?« Noch während er dies fragte, schoss ihm ob seiner Direktheit die Röte ins Gesicht. Elisa aber schien dies nicht zu bemerken.
»So sagt man«, antwortete sie. »Er wurde vorgestern Nacht von einem der Nachtwächter im Schneideraum gefunden. Der hat dann die Polizei gerufen. Chief Inspector Charles Howell, ein bekannter Mann. Aber nicht an Suiziden interessiert und schon gar nicht an dem Schicksal von Immigranten. Sein Assistent hat mich aufgesucht, ein freundlicher, etwas schüchterner junger Mann.« Ein Zittern durchfuhr sie. Tränen schossen in ihre Augen.
Ihre Stimme bebte, als sie fortfuhr. »Angeblich hat er sich mit einer alten Armeepistole in die Schläfe geschossen. Sie lag neben ihm auf dem Boden.« Elisa holte Luft. »Ich hatte ihn nicht vermisst, als er abends nicht zum Essen kam, da er mir gesagt hatte, dass er noch im Schneideraum eine Szene bearbeiten wolle. Das hat er in den letzten zwei Wochen oft gemacht. Er war unter Zeitdruck geraten, und auch mit dieser Schauspielerin hatte er Ärger. Das Drehbuch musste mehrmals umgeschrieben werden, weil es da eine Beschwerde gegeben hat. Doch Leo hat mich nicht mit seinem Ärger behelligen wollen. Es lief nicht richtig rund. Deshalb war es ihm so wichtig, dass du kommst. Er war nervös, weil er fürchtete, dass der Produzent ihm sein Vertrauen entziehen könnte. Als Immigrant, hat er gesagt, müsse man sich erst recht beweisen. Aber das sind doch keine Gründe, sich das Leben zu nehmen! Und mich und Josephine alleinzulassen.«
Ihre Augen flossen über, die Tränen liefen ihre Wangen hinab. Schönfels nahm ihre Hände in seine und sagte: »Nein, das hätte Leopold schon irgendwie geschafft. Er hat in Berlin größere Schwierigkeiten gemeistert, vor allem bei den Arbeiten an ›Die Lichter von Berlin‹. Hat er denn etwas hinterlassen, einen Brief, eine Nachricht?«
»Das hat mich dieser junge Inspector auch schon gefragt. Nein, kein Brief, nichts.« Elisa richtete sich jäh auf. Ihre Augen glänzten feucht, aber ihre Stimme klang überraschend fest: »Nein, ich glaube nicht an Selbstmord, Alex. Mein Mann ist ermordet worden. Und ich habe sogar einen Verdacht. Ich bin mir sicher. Leopold ist einem Anschlag zum Opfer gefallen, und das hat alles mit diesem verdammten Film zu tun, an dem er wie ein Besessener gearbeitet hat.«
Sie stellte das Glas mit einem Ruck auf den Tisch. »Ich bitte dich, Alex, mir zu helfen, den Mörder zu finden. Und wenn es all mein Geld und meine Kraft kostet. Leopold Welfenstein hätte sich nie selbst getötet!«
Überraschungen
Der halb zerfallene Turm der Burgruine von Angerrath ragte in den milchig blauen Frühlingshimmel. Aus der Ferne sah er wie eine Fata Morgana aus. Von der 1220 erbauten Burg standen gut achthundert Jahre später nur noch die Trümmer des einst mächtigen Wehrturms und der vor wenigen Jahren restaurierte Rittersaal, der, wie mir meine Freundin Marianne Hufstedt erzählt hatte, für Feste und Veranstaltungen genutzt wurde. Und in seinen Mauern sollte auch das kleine Filmfest über die Bühne gehen, weswegen ich mich auf den Weg in die Voreifel gemacht hatte.
Die Voreifel im Frühling. Welch romantische Landschaft! Ich streckte und reckte mich. »Lass das, du ruckelst viel zu sehr!«, tönte es vom Fahrersitz des Autos, in dem ich durch diese freundliche Gegend in Richtung eines kleinen Ortes in der Nähe von Monschau fuhr. Mein Freund Richard Bernhard hatte sich bereit erklärt, mich nach Angerrath zu chauffieren und bei diesem »Filmevent«, wie er es spöttisch nannte, an meiner Seite zu bleiben. Nach anfänglicher Begeisterung war er inzwischen ein wenig ernüchtert. »Wenn’s im Kino zu langweilig wird, wandere ich eben ein bisschen umher und besuche das Rote Haus von Monschau oder fahre nach Köln«, erklärte er. Sicherheitshalber wollte er sich einen Mietwagen organisieren, um unabhängig zu bleiben. Mir sollte es recht sein.
Angerrath liegt zehn Kilometer von Monschau entfernt und hat offenbar knapp unter eintausend Einwohner. Sehenswürdigkeiten sind zwei Kirchen und die malerische Burgruine, ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer. Marianne Hufstedt, die mich hierhergelockt hatte, stammte aus Papenburg, hatte mit mir vor mehr als fünfzehn Jahren in Hannover als Kontaktfrau zu anderen Museen an einer Ausstellung über den Film der dreißiger Jahre gearbeitet und zusammen mit ihrem Mann, dem früheren Filmjournalisten Valentin Rohrmeister, mehrere Jahre ein kleines Filmfest in Heedebüttel bei Papenburg geleitet.
Rohrmeister hatte bis zu ihrer Hochzeit vor fünf Jahren in Starnberg gelebt. Nach langen Jahren Wochenendehe lebten sie nun endlich zusammen. Marianne hatte ihren Nachnamen behalten, mit diesem Namen sei sie in der Branche bekannt geworden, erklärte sie. Valentin hatte eine Tochter aus seiner ersten Ehe, die in München Film studierte, Marianne war vorher nicht verheiratet gewesen. Ihre große Liebe, der Filmregisseur Bernd Maler, hatte kurz vor der geplanten Hochzeit einen Badeunfall im Atlantik gehabt. Das lag nunmehr zwanzig Jahre zurück, aber Marianne vermochte es lange nicht zu verschmerzen. Ihm zu Ehren hatte sie das Filmfest im Emsland, wo Bernd zu Hause gewesen war, vor fast zwölf Jahren gegründet. Und nun war sie weitergezogen. Zu neuen Ufern und einem neuen Festival. Mit einem anderen Mann.
Nach acht Jahren des Schweigens hatte sich Marianne auf einem Festnetzanschluss in Hannover, den ich eigentlich kaum mehr benutzte, kurz nach Weihnachten bei mir gemeldet. Seit bestimmten Ereignissen im vergangenen Herbst teilte ich mein Leben zwischen Hannover und Köln auf, wo ich das ererbte Haus meiner Patentante sanieren ließ. Nach langen Überlegungen hatte ich es nicht verkauft, sondern zwei Zimmer darin an einen Pfleger aus Polen vermietet, der seit März einen alten Herrn und stundenweise meine Mutter betreute. Nach Weihnachten hatte ich mich mal wieder in meine kleine Wohnung in Hannover geflüchtet, um an einem Buch über meine bisherigen Abenteuer als »Miss Marple« zu arbeiten. In Köln waren die Handwerker emsig dabei, mein Haus auf Vordermann zu bringen. Und das war mit viel Staub und noch mehr Lärm verbunden.
Irgendwie hatten sich Mariannes und meine Wege getrennt. Jede ging ihrem eigenen Beruf nach, die anfänglich häufigen Mails versandeten, die SMS ebenfalls. Umso erfreuter und erstaunter reagierte ich, als ich ihre Stimme am Telefon hörte. Marianne berichtete kurz, dass sie mit dem ehemaligen Journalisten Rohrmeister, der früher im Fernsehen die Sendung »Filmgeflüster« moderiert hatte, »nun endlich« verheiratet sei und im vergangenen Jahr in Angerrath bei Monschau ein Filmfestival ins Leben gerufen habe.
»Im letzten Mai war der Probelauf«, sagte sie mit ihrer tiefen, rauen Stimme, die ihrem Kettenrauchen geschuldet war. »Da hatten wir das Motto ›Heimatgefühle‹. Im Mittelpunkt stand der Thriller ›Schattenburg‹ von Helmar Ranzau, den er in der Burgruine von Angerrath in den frühen fünfziger Jahren gedreht hat. Ranzau, inzwischen über neunzig, war anwesend. Und im Programm haben wir dann neuere Film mit Regionalbezügen gezeigt.« Sie hielt inne.
»Gratuliere«, sagte ich.
Sie lachte. »Na ja, wir hatten Anfängerglück. Dieses Jahr nehmen wir uns mehr vor, haben ein sehr umfangreiches Programm mit noch ziemlich neuen Produktionen, auch Fernsehfilme, die erst im Herbst gezeigt werden. Das zentrale Thema in diesem Jahr lautet ›Vergessen, aber nicht vergangen‹ und ist einem 1936 aus Deutschland emigrierten Regisseur gewidmet. Es ist uns gelungen, Filme von Leopold Welfenstein für eine kleine Retrospektive aufzutreiben. Ehe er Deutschland verlassen musste, hatte er mehrere Filmhits gedreht, darunter ›Die Lichter von Berlin‹ Anfang 1936 und ›Die Dragonerschule‹ 1935.«
Ich hatte keine Ahnung, wer dieser Welfenstein sein sollte und noch nie von den Filmen gehört. Zwar ging ich mit Begeisterung ins Kino, aber mit Filmhistorie kannte ich mich nicht so gut aus wie Marianne. Die Namen Fritz Lang oder Friedrich Wilhelm Murnau, Georg Wilhelm Pabst oder Joseph von Sternberg waren mir geläufig, aber wer war Leopold Welfenstein? Sein Name war damals bei unserem gemeinsamen Projekt nicht aufgetaucht.
Ehe ich Marianne danach fragen konnte, fuhr sie fort: »Also, das ist echt phantastisch! Wir haben ein ganzes Jahr mit den Filmarchiven Berlin und Frankfurt gerungen, ehe sie uns seine fünf in Berlin gedrehten Filme für das Festival zugesagt haben. Doch der größte Clou wird sein, dass wir eventuell Welfensteins Tochter zu Gast haben werden.« Marianne senkte ihre Stimme: »Sie war erst ein Jahr alt, als ihr Vater sich 1937 in London das Leben genommen hat.«
Was sollte ich dazu sagen? »Wie schrecklich!« Was für ein Klischee. Aber Marianne antwortete, als sei dies eine überaus tiefgründige Reaktion gewesen.
»Da hast du recht! Das arme Ding! Ihre Mutter Elisa ist dann 1938 zusammen mit Welfensteins bestem Freund, dem Filmkomponisten Alexander Schönfels, und dessen Familie in die USA emigriert. Dass Josephine Welfenstein, die heute Stone heißt, tatsächlich zu uns nach Angerrath kommen möchte, ist eine Sensation.«
Ich unterbrach Marianne ein wenig brüsk. »Und warum erzählst du mir das alles?«
»Ach herrje!« Marianne lachte laut. »Ich bin echt trottelig. Du sollst bei unserer Jury mitmachen! Wir haben insgesamt fünf Jurymitglieder, darunter übrigens den TV-Star Carsten Trojahn, Hauptdarsteller dieser tollen Serie ›Mord am Morgen‹. Und dich als Kunsthistorikerin und bekennenden Filmfan hätte ich auch gerne dabei. Unterkunft und Kost inklusive, eine Art Tagegeld gibt es auch, aber da unser Budget nicht sehr groß ist, können wir kein dickes Honorar zahlen. Der Termin ist Dienstag, 9. Mai, bis einschließlich Samstag, 13. Mai. Am 14. ist Muttertag. Das betrifft dich und mich wohl weniger.« Sie lachte wieder.
Ihr Lachen dröhnte in meinen Ohren. Ich zuckte zusammen. Automatisch hielt ich den Hörer ein Stück weiter von meinem Kopf weg. Carsten Trojahn hatte ich einmal in einer ziemlich misslungenen Fernsehkomödie mit dem Titel »Mutter braucht das alles nicht« gesehen. Da spielte er den verwöhnten Sohn einer stets in Pink gekleideten Dame, die ihr Alter ständig verleugnet und vor allem keine Enkel akzeptieren will. Ihr einziger Sohn überrascht sie mit der frohen Kunde, dass sie bald Großmutter sein werde. Natürlich gab es ein Happy End, und die Dame in Pink erwarb viele pinke Babysachen für ihre Enkelin. Trojahn sah wenigstens recht nett aus. »Okay«, erwiderte ich und erhob mich aus meinem Lesesessel. »Ich schaue mal in meinen Kalender.«
Tatsächlich, die Woche sah noch öd und leer aus. Bisher keine Vorträge, kein neuer Auftrag für die Erstellung eines Katalogs, keine größeren Gutachten. »Wie es aussieht, kann ich«, sagte ich. »Und ich freue mich darauf, dich wiederzusehen und deinen Mann zu treffen. Du weißt ja, ich liebe Filme, und diese Retrospektive klingt gut.«
Marianne juchzte auf, versprach mir, alle nötigen Informationen »ganz schnell« per E-Mail zu schicken, und legte mit einem »Ciao, ciao, bella!« auf.
Ich versuchte Mariannes Konterfei vor meinem inneren Auge heraufzubeschwören, kam aber nicht weit. Ob sie immer noch diese wilde Haarpracht besaß? Und noch immer so mager war wie damals? Ich beneidete sie, weil sie Unmengen essen konnte, ohne ein Gramm zuzulegen. Im Internet fand ich ein Foto von ihr. Haarpracht gestutzt, Gesicht ein wenig voller, was ihr gut stand.
Drei Wochen später – das nannte Marianne »ganz schnell« – war ihre Mail mit einer Fülle von Informationen gekommen, einem ersten Überblick über für das Festival angemeldete Filme, der Liste der Welfenstein-Klassiker, den Namen der anderen Jurymitglieder und dem Hinweis, dass wir alle, auch die Gäste, im Hotel »Kaiser Karl« in Angerrath untergebracht seien. Laut Internet ein kleines Hotel mit hübschen Zimmern, einer Gaststube und einem Garten mit großer Terrasse. »Alle unsere frisch renovierten Zimmer verfügen über ein eigenes Bad, TV, freies WLAN und einen Wasserkocher.« Letzteres schien in Angerrath die ultimative Auffassung von Luxus zu sein. Ich musste grinsen.
Was die anderen Jurymitglieder anging, war mir außer Carsten Trojahn nur die Schauspielerin Lydia Merkur ein vager Begriff. Sie hatte letztens einen Fernsehpreis für ihre Darstellung einer Lehrerin bekommen, die an einer Persönlichkeitsspaltung litt und wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde zwei völlig unterschiedliche Charaktere zeigte. Als Lehrerin Magda freundlich und besonnen, als Carla ein Partygirl mit Neigung zu Alkohol. Alles recht überzogen, aber Lydia Merkur spielte ihre Doppelrolle überzeugend. »Die verlorenen Schwestern« war ein großer Fernseherfolg.
Als ich Richard von Mariannes Bitte erzählte, hatte er begeistert gerufen: »Da komm ich mit!« Und so zuckelten wir an diesem schönen Tag im Mai durch die Landschaft und waren bester Dinge. Richards Vorfreude auf die Filme hatte sich zwar gelegt, doch er sah diese Woche als Gelegenheit, fern von Hannover und in angenehmer Distanz zu Köln auf gänzlich andere Gedanken zu kommen.
»Diesmal garantiert kein Mord!«, meinte er gut gelaunt. »Wer kennt schon Angerrath? Weit weg von allen dunklen Mächten, eine friedliche Woche, in der du sicher das letzte Kapitel von deinem Buch fertig schreiben kannst. Denn laut Programm hast du nicht mehr als drei Filme pro Tag, und die beginnen alle zwischen neun und fünfzehn Uhr.«
Ich widersprach: »Abends sind die Vorführungen dieser Welfenstein-Klassiker. Die will ich nicht versäumen. Ich habe ein bisschen über ihn recherchiert. Ein spannendes Schicksal. Leider hat er sein Leben mitten während der Dreharbeiten zu seinem ersten Film im englischen Exil selbst beendet. Dieser Film sollte sein großer Wurf werden und ihm das Tor nach Hollywood öffnen.«
»Ja, das ist tragisch.« Mein Freund versuchte, ergriffen auszusehen. Ein absoluter Fehlschlag.
In diesem Augenblick passierten wir das Ortsschild Angerrath und gelangten auf eine gepflegte Dorfstraße, gesäumt von Fachwerkhäusern unterschiedlicher Größe. Wir kamen an einer Kirche vorbei, an einer Gaststätte mit dem schönen Namen »Zum Frohsinn« und landeten wenig später vor einem mit wildem Wein bewachsenen weißen Haus, über dessen Eingang ein großes Schild hing. »Kaiser Karl«, stand in frischen goldenen Buchstaben darauf. Wir hatten unser Ziel erreicht.
Laut Programm sollte sich die Jury erst einmal kennenlernen. Gegen siebzehn Uhr im Foyer des Hotels, hieß es. Und abends würde dann der Filmreigen mit der Darbietung der restaurierten Fassung von Leopold Welfensteins Drama »Die blinde Prinzessin« aus dem Jahr 1931 beginnen. Sein erster großer Film, dem 1932 die Komödie »Die drei Korsaren« folgte, 1933 »Das vergessene Tal« und 1935 und 1936 seine größten Erfolge »Die Dragonerschule« und »Die Lichter von Berlin«. Wenig später hatte Welfenstein Deutschland verlassen und war nach London gegangen.
Je mehr ich über diesen vergessenen Regisseur las, desto faszinierender fand ich ihn. Und ich war sehr gespannt auf seine Tochter, die zur Abendvorstellung anreisen und die kommenden Tage in Angerrath bleiben sollte. Sie würde sich nicht mehr an ihren Vater erinnern, da sie erst ein Jahr alt war, als er starb. Doch gewiss hatte ihre Mutter Elisa viel von ihm gesprochen. Jedenfalls wollte Josephine Stone gegen Ende des Festivals einen kleinen Vortrag über Leben und Werk ihres Vaters halten.
Sie musste mit ihren siebenundachtzig Jahren noch recht rüstig sein, was mich wenig wunderte. Meine Mutter hatte mit neunzig noch ein hervorragendes Gedächtnis, war nur leider körperlich inzwischen etwas hinfällig, meine Patentante Amelie war trotz ihres Rollstuhls mit über neunzig noch unverdrossen zu Konzerten in die Philharmonie »gegangen«, und die alte Baronin Rödelshausen lebte noch immer in ihrem Schloss im Ith und plante die Festivitäten anlässlich ihres fünfundneunzigsten Geburtstages im August.
Unser Zimmer im »Kaiser Karl« war groß und hell, das Badezimmer frisch saniert, der angepriesene Wasserkocher frei von Kalk und umrahmt von Teebeuteln und Tüten mit Instantkaffee. Erleichtert sank ich auf das Bett. Richard dagegen drängte mich zu einem Spaziergang. »Lass uns den Ort erkunden«, sagte er, »und wir haben auch noch Zeit, zur Burg zu gehen.«
Widerstrebend erhob ich mich. Ich hätte trotz meiner Müdigkeit gern noch an meinem Buch gearbeitet. In zehn Tagen sollte ich das korrigierte Manuskript von »Moormänner und Drachenritter« abgeben. Im September war die Premiere in Hannover angedacht, im Oktober eine Lesung im Kölner Literaturhaus. Mir schwirrte der Kopf. Meine Lektorin saß mir im Nacken, und fast bereute ich, dass ich meine Teilnahme an dem Festival zugesagt hatte.
Doch was sollte dieses Grübeln! Das Leben bestand nicht nur aus Stress. Und ich freute mich auf mein Wiedersehen mit Marianne und auf die Filme. Zumal als weiterer Ehrengast Philippa Sullivan angekündigt war, die Enkelin von Alexander Schönfels, der alle Filmmusiken für Welfenstein komponiert und später in Hollywood erfolgreich weitergearbeitet hatte – bis zu seinem überraschenden Tod 1950. Schönfels war während eines Besuchs in Berlin auf dem Bahnsteig gestolpert und auf das Gleis direkt vor einen einfahrenden Zug gestürzt, der nicht mehr bremsen konnte. Eine Tragödie.
Ich verscheuchte die trüben Gedanken und beschloss, ein paar Schritte durch das Dorf zu laufen. Richard war im letzten Moment eingefallen, dass er schnell noch in seinem Geschäft in Hannover anrufen müsste, da er neue Ware erwartete. Seit einem halben Jahr half ihm dort eine clevere junge Frau, ehemalige Kunststudentin und Tochter einer alten Freundin von Richard. Sarah Winter war tüchtig, freundlich und diskret. Und absolut zuverlässig.
Die Maisonne badete die Fachwerkhäuser in Pastelltönen, hoch oben kreisten ein paar Mauersegler, und vor einem Eiscafé in der Nähe der Kirche hatte sich eine lange Schlange von Jugendlichen gebildet. Angerrath, das hatte ich gelesen, besaß eine Grundschule und sogar ein Gymnasium mit Internat. Das erklärte die vielen eisgierigen Jugendlichen.
Langsam schlenderte ich die Dorfstraße hinunter. Auf einer Bank neben der Kirche saßen zwei Gestalten im Schatten einer Linde. Zunächst sah ich nur ihre Konturen. Doch als ich näher kam, erkannte ich selbst nach so vielen Jahren Marianne wieder, trotz ihrer gestutzten Haarpracht. Die andere Gestalt schälte sich allmählich aus dem Schatten der Linde. Ich erstarrte. Das war doch mein alter Kampfgefährte Hans Schumann, genannt Schumanski, mit dem ich bereits fünf Abenteuer erlebt und der es in Hannover inzwischen zum Ersten Kriminalhauptkommissar gebracht hatte.
Was trieb er hier? So weit weg von Hannover und mitten in der Voreifel? Sein Aufenthalt in Köln im vergangenen Jahr, wo er gemeinsam mit seinem von ihm wenig geschätzten Kollegen Andrea di Luccio einen heiklen Fall klären musste, war ihm schon wie eine Reise in feindliche Gefilde erschienen. Sonderbar! Zögernd setzte ich meinen Weg fort.
Die beiden hatten mich noch nicht bemerkt, und ich hörte Schumann sagen: »Sag aber bitte Anna nichts davon. Sie verwandelt sich sonst in die Miss Marple von Angerrath, und das möchten wir sicherlich alle nicht so gerne! Ich würde lieber unauffällig agieren können. Als filmbegeisterter Festivalbesucher und dein alter Freund.«
Hinter den Kulissen
Im Foyer des Hotels »Kaiser Karl« hatte sich die Jury versammelt. Gedankenverloren saß ich in einem Sessel und nippte an meinem Tee. Ich war die Erste gewesen, die nach einem kleinen Nachmittagsschlaf – Richard hatte sich allein zur Burg aufgemacht – in den Raum kam, noch etwas verschlafen und gierig nach einem Tee.
Mir saß der Schock noch in den Gliedern. Hans Schumanns Worte über die »Miss Marple von Angerrath« hatten mich verletzt. Immerhin hatte ich ihm fünf Mal zur Seite gestanden und zur Lösung seiner Fälle beigetragen. Mit dem Moormann hatte es angefangen, danach folgten unsere Abenteuer im Ith, am Steinhuder Meer, in Hannover und Braunschweig und im vergangenen Jahr in Köln und Kalkriese bei Bramsche. Gut, ich war ihm gelegentlich auf die Nerven gegangen, und die Bezeichnung »Miss Marple« war ironisch gemeint. Aber dass er so über mich mit meiner alten Freundin Marianne sprach, das hatte ich nicht verdient.
Als ich zu der Bank getreten war, um ihn mit einem herzlichen »Hallo, du hier?« zu begrüßen, hatte ich mir nicht anmerken lassen, dass ich einen Teil des Gesprächs mitgehört hatte. Was immer er für kritische Anmerkungen gegenüber Marianne über mich hatte fallen lassen, merkte man seiner Begrüßung nicht an. Er umarmte mich stürmisch, und auch Marianne zog mich in ihre Arme. »Wie schön, dass du hier bist, und wie großartig, dass du Zeit hast, uns zu unterstützen.«
Ich lächelte ein wenig verkrampft, nickte dann aber und erwiderte: »Ich bin sehr froh, dich wiederzusehen! Es war eine viel zu lange Zeit.«
Ehe ich meiner Verwunderung über Schumanns Anwesenheit weiter Ausdruck verleihen konnte, schaltete er sich ein. »Du wunderst dich sicherlich, mich hier zu sehen?«
»Ja, sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass du in die Voreifel zu einem Filmevent kommen würdest, zumal du doch in Hannover reichlich viel zu tun hast, wie du mir bei unserem letzten Telefonat erklärt hast.«
Schumann errötete. »Nun ja, der Fall ist inzwischen abgeschlossen. Wir konnten den Hehlerring, der in großem Stil Autos in die Türkei verschoben hat, ausheben. Ich habe ein paar Tage frei, und da ich Marianne schon längere Zeit kenne, dachte ich mir, dass ich hierherkommen könnte, etwas ausspannen, ein paar Filme sehen, dich in entspannter Atmosphäre treffen und mal nicht an Mord und Totschlag denken.«
Marianne unterbrach ihn. »Also, ich kenne Hans seit zehn Jahren. Da war er noch in Meppen, kurz bevor er dann nach Stade wechselte. Wir hatten damals einen schweren Diebstahl bei unserem kleinen Festival in Heedebüttel. Ein paar wertvolle Filmplakate wurden gestohlen und zwei Filme, die wenig später als Raubkopien im Internet landeten. Hans hat sich der Sache angenommen. Die Täter, zwei Studenten von der Uni Oldenburg, wurden gefasst. Die Plakate allerdings waren längst unter der Hand verkauft worden, die beiden Filme haben wir wiederbekommen. Seitdem sind Hans und ich locker in Kontakt.« Sie lächelte. »Als er hörte, dass du in meiner Jury sitzt, hat er gleich gefragt, ob er kommen könnte.«
Warum glaubte ich den beiden nicht? Die Bemerkung, die ich überhört hatte, besagte etwas anderes. Eher beiläufig fragte ich: »Was macht dein Hund in dieser Zeit, oder hast du ihn dabei?«
»Ach, der ist bei meiner Nachbarin untergekommen. Um dich gleich auf den neusten Stand zu bringen: Ich bin mit ihr nur noch befreundet. So richtig hat unsere Beziehung dann doch nicht Fahrt aufgenommen. Aber unsere Hunde sind dicke miteinander.«
Oje, Hans Schumann war wieder ungebunden. Und ich hatte letzten Herbst sogar noch kurz bedauert, ihn trotz seines Interesses an mir immer wieder zurückgewiesen zu haben, obgleich er ein liebenswerter Mann war. Nur eben ein wenig statisch. Mein Freund Richard dagegen war manchmal unzuverlässig und eigenbrötlerisch, aber ein spannender Typ, sehr charmant und immer für Überraschungen gut. Wobei ich gelegentlich eine Auszeit von ihm brauchte. Was, wenn Schumann wieder ins Rennen einsteigen wollte?
Er sah meinen Gesichtsausdruck und lachte laut auf. »Keine Angst, du und ich bleiben gute Freunde, aber für eine Dauerbeziehung bist du mir viel zu eigenwillig!«
Erleichterung mischte sich bei mir mit Enttäuschung. So sah er das also! Na gut, Freunde sind auf Dauer wertvoller als Liebschaften, redete ich mir ein. Ich schluckte meinen Stolz herunter.
Zusammen mit den beiden ging ich in den Gasthof »Zum Frohsinn« und simste Richard, ich würde mit Marianne essen, worauf er mir zurückschrieb, er werde nach der Wanderung zur Burg weiter die Gegend erkunden. Er musste ja nicht sofort wissen, dass Hans Schumann auch in Angerrath war. Die beiden vertrugen sich nach anfänglichen Schwierigkeiten recht gut, vor allem seit Richard bei der Lösung eines Falls, in dem es um Kunstfälschung und Schwarzmarktgeschäfte ging, geholfen hatte. Dennoch blieb ein winziger Stachel in ihrem Verhältnis. Dicke Freunde würden sie wohl nicht werden.
Marianne hatte sich in all den Jahren kaum verändert und beim Essen über ihre diversen Filmfesterfahrungen sowie über ihre großen Erwartungen an den Erfolg dieses neuen Festivals erzählt und von ihrer geplanten Retrospektive geschwärmt.
»Dieser Welfenstein war ein ganz Großer! Er hätte in Hollywood mit Billy Wilder gleichziehen können. Warum er sich erschossen hat, ist nie geklärt worden. Er hatte wohl Ärger mit seinem letzten Projekt, einem Thriller, der auf dem Tagebuch einer jungen englischen Landadligen basierte. Die Familie der jungen Frau hatte davon Wind bekommen und ihm nahegelegt, das Drehbuch noch einmal völlig überarbeiten zu lassen, da es zu nahe an der Realität sei. Jede Ähnlichkeit mit realen Personen sollte getilgt werden, wogegen Welfenstein und sein Drehbuchautor sich wehrten. Die Familie behauptete, die junge Frau, die Catherine oder Cathleen oder so ähnlich hieß, hätte sich ihre Notizen über ein angebliches Familiendrama aus den Fingern gesogen, um sich interessant zu machen. Sie habe sich zu wenig beachtet gefühlt und unter dem frühen Tod ihrer Mutter gelitten.«
Marianne kaute energisch auf ihrer Bratwurst, spülte den zähen Bissen mit einem kräftigen Schluck Apfelschorle herunter und fuhr fort: »Diese adlige Familie, die großen Einfluss in England hatte, setzte Welfensteins Produzenten Albert Rowland so lange zu, bis er schließlich mit Welfenstein ein ernstes Wort sprach. Welfenstein soll wohl schon einen Großteil des Films fertig gehabt haben, erklärte sich aber dann bereit, einige Änderungen vorzunehmen. Damit war wiederum sein Drehbuchschreiber Rudolf Kampinski nicht glücklich. Er hatte das Skript auf Deutsch verfasst, das dann von einem englischen Drehbuchautor ins Englische übertragen worden war. Offenbar ein renommierter Dramatiker, der unter dem Pseudonym Benjamin Hartford für Filmproduktionen arbeitete. Auch die Hauptdarstellerin Claire Wilcox moserte herum, da sie fürchtete, es würden Szenen mit ihr herausgeschnitten werden. Es war ihre erste größere Filmrolle. Also, einfach war die Situation für Welfenstein nicht, zumal für ihn als jüdischen Immigranten. Man sagt, dass die Familie, die ihn hart anging, mit Oswald Mosley sympathisierte, dem Gründer der britischen faschistischen Partei, und sogar entfernt mit ihm verwandt war. Und Welfenstein wartete wohl auch verzweifelt auf seinen Komponisten Alexander Schönfels, dessen Abreise aus Wien sich immer wieder verzögerte. Aber sind das ausreichende Gründe für einen Suizid?« Marianne blickte uns fragend an.
»Keine Ahnung«, antwortete ich. »Da kann mehr dahinterstecken, als wir wissen. Ist seine Witwe nicht 1938 nach Amerika gegangen? Vielleicht kann uns Josephine Stone mehr dazu erzählen. Vielleicht war es Mord.« Ich sah zu Schumann hin, der aber nicht reagierte.
Während wir friedlich unser Mittagessen verzehrten – Schumann ein Riesenschnitzel, ich einen Salat, Marianne die Bratwurst mit Bratkartoffeln –, beschlich mich mehr und mehr das Gefühl, dass Schumann nicht zum Vergnügen nach Angerrath gekommen war. Um das zu erkennen, bedurfte es keines messerscharfen Verstandes, wobei ich seine Bemerkung von vorhin nicht als eindeutigen Beweis werten konnte.
Der Hans Schumann, den ich seit sieben Jahren kannte, wäre nie zur Erholung in die Voreifel zu einem Filmfest gereist, egal, ob er Sehnsucht nach mir oder seiner alten Bekannten Marianne gehabt hätte. Schumann liebte das Meer und hätte seine freien Tage sicherlich lieber an der Ost- oder Nordsee verbracht. Möglichst unauffällig betrachtete ich ihn. Aber ihm war nichts anzumerken. Er saß vergnügt am Tisch und berichtete uns von dem Autohehlerring, den er mit seinen Leuten hatte auffliegen lassen, und von seiner Überlegung, sich im hannoverschen Zooviertel eine Altbauwohnung zu mieten.
»Viel Platz für meinen Hund und genügend weit entfernt von meiner Nachbarin, die derzeit nach der Devise agiert, dass die Hoffnung zuletzt stirbt«, fügte er mit einem Seitenblick auf mich hinzu. Schade, ich hatte ihm diese Liaison von Herzen gegönnt.
Zu gern hätte ich Marianne direkt angesprochen und sie nach dem wahren Grund für Schumanns Besuch in Angerrath gefragt. Aber das musste warten. Sie erzählte mit sichtlichem Stolz von den Höhepunkten der kommenden Tage und verkündete, dass nicht nur Josephine Stone, Welfensteins Tochter, sondern auch Welfensteins Enkel, Josephines einziger Sohn Rupert, als ihr Begleiter kommen würde.
»Er lehrt Filmgeschichte an der Columbia in New York, allerdings mit Schwerpunkt frühes 21. Jahrhundert, nicht die 1930er Jahre«, sagte sie. »Am meisten bin ich aber auf den Vortrag der alten Dame gespannt, in dem sie ein paar Details über ihren Vater bringen wird. Sie hat mir am Telefon erklärt, dass sie mit einigen Überraschungen aufwarten könne.«
Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Ach du lieber Himmel, schon nach vierzehn Uhr! Ich muss los. Denk dran, Anna, Treffpunkt um siebzehn Uhr in der Hotellobby!« Und damit war sie davongerauscht. Schumann hatte es auf einmal auch eilig, und so trank ich allein einen Kaffee, ehe ich ins Hotel zurückging, wo ich mich aufs Bett gelegt hatte und fest eingeschlafen war.
Langsam trudelten meine Mitjuroren ein. In der Realität sah der hübsche Carsten nicht ganz so blendend wie im Fernsehen aus, wirkte eher unscheinbar, während seine Kollegin Lydia auch ungeschminkt beeindruckend attraktiv war. Ihr auf dem Fuß folgten zwei Männer, der eine groß und sehr adrett in einem hellen Sommeranzug, der andere leger in Jeans und Polohemd mit einem Pullover locker über seine Schultern drapiert.
Der große Anzugträger stellte sich mit dröhnender Stimme als Oliver Petrowski vor. »Aus Köln, ich besitze da mehrere Kinos.«
Der andere grinste verschmitzt und sagte: »Und ich sitze oft in diesen Kinos und muss mir Filmkritiken aus den Rippen schneiden. Ich bin Martin Guderian.« Der Name war mir bekannt. Guderian hatte in einer Kölner Tageszeitung eine wöchentliche Kinokolumne mit dem Titel »Sehen oder nicht sehen«.
Nach dem üblichen Begrüßungsgeplänkel tauchte Marianne auf. An ihrer Seite ein elegisch aussehender, schlanker Mann mit langen grauen Haaren und einem blassen Gesicht. Das musste Valentin Rohrmeister sein. Er lächelte schüchtern, während Marianne uns alle willkommen hieß, darauf hinwies, dass Tee und Kaffee auf Kosten des Festivals gingen und der angebotene Erdbeerkuchen hervorragend sei. Sie ging mit uns noch einmal das Programm der nächsten Tage durch.
»Um neun Uhr starten wir oben in der Burg, wo im alten Rittersaal dank der großzügigen Unterstützung eines Kinos aus Aachen die perfekten technischen Voraussetzungen für die Filmvorführungen vorhanden sind.« Am Nachmittag durfte dann auch Publikum teilnehmen, und abends um einundzwanzig Uhr würde dann jeweils ein Film aus der Welfenstein-Retrospektive gezeigt werden.
»Wir beginnen morgen mit einem Fernsehfilm, der im Juli ausgestrahlt werden soll. Der Hauptdarsteller wird dabei sein, und der Kameramann hat sich auch angesagt. Nach ›Liebe kann es nicht sein‹ folgt nach kurzer Pause um zwölf Uhr der Kinofilm ›Verräterische Freunde‹ mit dem Shootingstar Ben Wender, und um fünfzehn Uhr sehen wir zusammen mit Publikum ›Echospiele‹, den Überraschungserfolg der letzten Berlinale. Abends dann Welfensteins ›Die drei Korsaren‹. Heute steht zur Eröffnung ›Die blinde Prinzessin‹ an.«
Mir schwirrte der Kopf. Die anderen Jurymitglieder wirkten ebenfalls ein wenig verwirrt. Carsten Trojahn flüsterte: »Mannomann! Sich das alles zu merken ist schwieriger, als Drehbuchdialoge zu lernen.«
Lydia Merkur lächelte. »Dafür bist du ja auch nicht gerade bekannt, oder?«
Oh weh, bahnte sich da eine Art Zickenkrieg an?
Trojahn aber erwiderte nur: »Speak for yourself!« Er war mir sympathischer als seine Kollegin, und als er hinausging, drehte er sich zu mir um: »Wir haben einen gemeinsamen Bekannten. Harald Frostauer ist ein Freund meines älteren Bruders Jan, der Lektor bei dem Verlag ist, in dem Haralds Bücher erscheinen.«
Das bestätigte einmal mehr das Klischee, dass die Welt klein ist. Der gute Harald! Er schrieb gerade wieder an einem Buch, kaum dass er das vorige beendet hatte. Um was es dabei ging, wusste ich nicht. Er hüllte sich in diskretes Schweigen. Seit unserem letzten gemeinsamen Abenteuer, bei dem zwei doppelte Gräber, römische Münzen und ein uraltes Geheimnis eine Rolle gespielt hatten und ein Freund von ihm fast gestorben war, übte er mir gegenüber Zurückhaltung. »Dann grüßen Sie ihn bitte«, antwortete ich.
Trojahn nickte. »Das werde ich in drei Wochen gerne machen. Mein Bruder feiert dann seinen fünfzigsten Geburtstag und lädt Harald ein.«
Für einen Moment fehlte mir Harald, der unverbesserliche Besserwisser, der im Grunde aber ein gutmütiger Mensch war. Das hatte ich allerdings längere Zeit nicht wahrhaben wollen. Ich musste ihm schreiben. Er telefonierte nicht gerne.
In diesem Moment ging die Eingangstür des Hotels auf, und eine hochgewachsene Frau in Begleitung eines jüngeren Mannes trat ein. Alle Augen richteten sich auf diese Erscheinung.
Über Mariannes Gesicht ging ein Strahlen, und sie eilte den Neuankömmlingen entgegen. »Josephine«, rief sie. »Wie wunderbar, dass Sie gekommen sind!«
Bei näherem Hinschauen sah man, dass Josephine Stone in Würde gealtert war. In ihrem von vielen Falten durchzogenen Gesicht leuchteten auffallend hellgrüne Augen, und ihre schneeweißen Haare verliehen ihr eine besondere Aura. Der jüngere Mann an ihrer Seite musste ihr Sohn Rupert sein. Auch er war groß, dabei ein wenig korpulent und hatte ähnlich grüne Augen wie seine Mutter.
Marianne wuselte um die beiden herum, überschüttete sie mit begeisterten Ausrufen und brachte sie dazu, sich erst einmal hinzusetzen und Kaffee zu trinken. Ich wollte mich verziehen, aber Marianne winkte mich herbei.
»Josephine«, sagte sie zu der alten Dame, die mich freundlich, aber etwas irritiert ansah, »das ist meine Freundin Anna. Sie ist Kunsthistorikerin und hat sich einen Namen gemacht, indem sie in den letzten Jahren bei mehreren Kriminalfällen zur Lösung beigetragen hat.« Es fehlte nur noch, dass Marianne mich vor Josephine Stone bei meinen Spitznamen Miss Marple nannte. Aber glücklicherweise verzichtete sie darauf.
Josephines Blick änderte sich. Er wurde wacher, neugieriger. »Kriminalfälle? Sind Sie Detektivin?« Ihr Deutsch war makellos. Ich spürte, wie mir die Röte ins Gesicht schoss.
»Nein, nein«, wehrte ich ab. »Ich bin durch Zufall in diese Geschichten geraten. Eigentlich ist mein Spezialgebiet ältere Kunst, und nebenbei liebe ich Filme.«
Josephine wandte sich an ihren Sohn. »Rupert, perhaps we should have a talk with Anna later.«
Ich sah sie verwundert an. »Warum? Wie gesagt, ich bin keine Detektivin, sondern Amateurin. Wenn Sie einen Profi brauchen, kann ich Ihnen einen Freund von mir empfehlen.«
Josephine lachte und übersetzte für ihren Sohn. »Rupert spricht zwar auch Deutsch, immerhin hat er einen Teil seiner Kindheit in der Gegend von Münster verbracht. Aber er lebt seit vielen Jahren wieder in New York, und wir sprechen meistens Englisch miteinander«, erklärte sie und sah mich nachdenklich an. »Eventuell komme ich auf Sie zu. Doch vielleicht erst nach meinem kleinen Vortrag. Jetzt möchte ich mich gerne ausruhen. Die Fahrt vom Frankfurter Flughafen hierher war wegen der vielen Baustellen langwierig.«
Die Sonne stand tief im Westen und verwandelte den Himmel in ein orangerotes Farbenmeer, das mich an Bilder von Jackson Pollock erinnerte. Gegen zwanzig Uhr brach unsere Truppe mit einem Shuttlebus zur Burg auf. Richard hatte mir begeistert von dem Rittersaal berichtet und von dem zwischen 1226 und 1234 erbauten Wehrturm geschwärmt. »Der hat alles überdauert, ein steinerner Zeitzeuge«, meinte er.
Der Rittersaal entpuppte sich als ein in der Tat imposantes Bauwerk. Fast sieben Meter hoch mit jeweils einem riesigen Kamin an der Stirn- und Rückseite des Saals, halb verblichenen Fresken an den Seitenwänden und einem überdimensionalen Kronleuchter, der drei Meter über dem mit großen Fliesen ausgelegten Boden hing. Allerdings hatte man wegen des Holzgebälks und den zwischen den Fresken eingemauerten Holzstreben auf Kerzen verzichtet und den Leuchter mit Glühbirnen versehen. Auf dem zwanzig Meter langen Esstisch in der Mitte des Saals standen Tabletts mit Gläsern und diverse Platten mit allerlei Köstlichkeiten.
Inzwischen waren außer der Jury auch andere zum Eröffnungsabend geladene Gäste erschienen, darunter der Bürgermeister des Ortes, Dr. Alfred Marholz, der die einzige Arztpraxis in Angerrath betrieb, die lokale Apothekerin und der katholische Pfarrer, der für beide Kirchen zuständig war. Dazu kamen der Direktor des Internats, die Leiterin der Grundschule, die lokale Buchhändlerin und etliche andere Promis von Angerrath. Aus dem Nachbarort war die protestantische Pfarrerin mit Mann angereist, und Hans Schumann mischte sich auch unter die Gästeschar. Er redete angeregt mit einem Mann, dessen Blick während des Gesprächs ständig umherschweifte.
Marianne, die gerade mit einem frisch gefüllten Sektglas an mir vorbeiging, flüsterte mir zu: »Hans hat schon einen Kollegen getroffen. Das ist Polizeihauptmann Claude Herbert, eigentlich pensioniert, der aber sozusagen das Gesetz hier vertritt. Ein ruhiger Job für einen Pensionär, denn in Angerrath hat es seit Menschengedenken außer Falschparken keine Delikte gegeben.«
Das Stimmengewirr nahm zu, die Gläser klangen, die Stimmung war angeregt locker. Mit dem Beginn der Vorführung von »Die blinde Prinzessin« wartete man noch bis zum Eintreffen der ausländischen Ehrengäste. Inzwischen, so hieß es, sei auch Philippa Sullivan, die Enkelin des Komponisten Alexander Schönfels, in Angerrath angekommen. Richard hatte sich zu Hans Schumann und Claude Herbert gesellt, und ich plauderte mit dem Kölner Kinobesitzer über die Konkurrenz für Kinos durch Streaming-Angebote, wobei sich Oliver – wir hatten beschlossen, uns als Mitglieder der Jury zu duzen – als humorvoller Zeitgenosse entpuppte. Er entschuldigte sich nach einigen Minuten und trat zu der kleinen Gruppe um Marianne und den Bürgermeister, der, wie ich beobachtete, kräftig dem Alkohol zusprach. Mich zog es an die frische Luft.
Die Sonne war hinter den Hügeln versunken, aber noch immer lag ein rötlicher Schimmer im Westen. Meine Uhr zeigte Viertel nach neun, der Film würde heute mit einer halben Stunde Verspätung laufen. Noch waren Josephine Stone und ihr Sohn nicht aufgetaucht.
Durch die hohen Fenster des Rittersaals schimmerte Licht nach draußen, doch die Geräusche und das Lachen drangen nur gedämpft zu mir. Von Weitem sah ich die Scheinwerfer eines Wagens, der sich der Burg näherte. Offenbar die Ehrengäste. Plötzlich hörte ich ein leises Hüsteln in meiner Nähe. Ich fuhr herum.
Vor mir stand ein freundlich lächelnder Mann mittleren Alters. »Oh, Entschuldigung! Habe ich Sie erschreckt?« Ich schüttelte den Kopf. Der Fremde hüstelte wieder. »Reizhusten, deshalb musste ich kurz an die frische Luft. Der Film startet sicher gleich, denn wie ich sehe, ist die Grande Dame eingetroffen.«
Er wollte gehen, wandte sich aber noch mal um: »Übrigens heiße ich Walter Schröter und bin Archivar an der Kölner Internationalen Filmhochschule. Ich habe mich in meiner Magisterarbeit mit Welfensteins Werk befasst. Deshalb bin ich sehr gespannt auf diese restaurierte Fassung. Ihnen viel Spaß und Erfolg für Ihre Jurytätigkeit!«
Ehe ich antworten konnte, huschte er davon. Ein seltsamer Geselle, dachte ich und ging auch zurück in den angenehm warmen Saal. Draußen war es merklich kühler geworden.
Wir wurden in einen Nebenraum geführt, in dem Platz für etwa hundert Menschen war. Dort standen bequeme Kinosessel und eine Leinwand, die mich an die einstigen Kunstkinos in Bonn und Hannover erinnerte. Nicht geeignet für Epen wie »Dune« oder »Avengers«, aber groß genug für die Art von Filmen, die uns erwarteten.
Kaum saßen wir – wobei Josephine Stone, ihr Sohn und eine zierliche Frau um die sechzig, offenbar Philippa Sullivan, mit männlicher Begleitung in der Mitte platziert wurden –, trat Marianne vor die Leinwand, begrüßte uns in einem sonderbaren Mischmasch aus Deutsch und Englisch und schloss mit den Worten:
»Es ist uns eine große Ehre und Freude, gemeinsam mit Ihnen das Werk eines zu Unrecht fast vergessenen Regisseurs in Angerrath neu zu entdecken. Josephine Stone, die Tochter von Leopold Welfenstein, wird uns am Freitag in einem Vortrag mehr über das Leben ihres Vaters berichten. Und wie sie mir verriet, hat sie einige Überraschungen in petto. Jetzt aber erst einmal viel Vergnügen mit ›Die blinde Prinzessin‹, dem ersten Film Welfensteins. Er drehte ihn 1931, Anfang 1932 kam der Film in die Kinos. Damit wurde Welfenstein über Nacht berühmt. Die Musik komponierte Alexander Schönfels, dessen Enkelin uns heute auch die Ehre ihrer Anwesenheit erweist, das Drehbuch stammt, wie bei allen Filmen Welfensteins, von Rudolf Kampinski.« Marianne atmete tief durch.
»Alexander Schönfels und Rudolf Kampinski, die beiden Wegbegleiter Welfensteins, der 1937 in London starb, kamen 1949 beziehungsweise 1950 durch Unglücksfälle zu Tode. Schönfels in Berlin, Kampinski kurz zuvor in Hollywood. Kampinski arbeitete bis zu seinem Tod an einem Drehbuch, das die Idee und das Thema von Welfensteins nie beendetem letzten Film für eine amerikanische Version adaptierte, Schönfels sollte die Musik dazu komponieren, wollte aber zuerst in Berlin einige Recherchen anstellen. Sein Leben endete tragisch auf den Schienen des U-Bahnhofs Friedrichstraße. Unsere kleine Retrospektive ist allen drei Künstlern gewidmet.«
Donnernder Applaus. Ich sah mich um. Nur wenige Sitze entfernt saß der seltsame Archivar, neben ihm ein Mann mit einer knallbunten Krawatte, den ich nicht kannte, und daneben der Bürgermeister.
Mitten im Applaus begann die Leinwand zu flimmern, die etwa fünfzig Ehrengäste des heutigen Abends, dank des üppigen Büfetts gut gesättigt und mit Sekt abgefüllt, hielten, so schien es mir, gespannt den Atem an. Musik ertönte, und wenig später tauchte die Heldin des Dramas auf, ebenjene »blinde Prinzessin«, um deren Liebe zu einem einfachen Bauernburschen sich dieser Film drehte. Er spielte im frühen 19. Jahrhundert und war, wie ich gelesen hatte, in der Nähe von Brühl gedreht worden, da Welfensteins Eltern aus Köln stammten und er die Gegend genau kannte.
Das wunderschöne Barockschloss Augustusburg, erbaut in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, diente als Kulisse für Prinzessin Matildas Zuhause. Bei einem Spaziergang außerhalb des Parks, den die blinde Matilda gemeinsam mit ihrer Zofe macht, stolpert sie und fällt dem jungen Bauernsohn Clemens vor die Füße. Er verliebt sich in das Mädchen, dessen Herkunft er zunächst nicht erahnt, und auch sie fühlt sich zu dem jungen Mann mit der schönen Stimme und den starken Händen hingezogen. Die Zofe wird zur Mittlerin zwischen den beiden und unterstützt das junge Paar, von dessen Affäre Matildas Vater durch die Intrige seiner Frau, Matildas Stiefmutter Cecile, erfährt. Er reagiert sofort und verbietet Matilda von Stund an, das Schloss zu verlassen. An dieser Stelle setzt Schönfels’ Musik einen besonders dramatischen Akzent.
Gegen Ende des Dramas taucht ein Wunderheiler auf, der Matilda von ihrem Augenleiden heilt, und ihr Vater erkennt, welche üble Rolle Cecile gespielt hat. Dennoch ist der schönen jungen Frau kein Happy End vergönnt. Denn ihr Geliebter zieht in die napoleonischen Kriege, um sich dort zu bewähren und sich so seiner Geliebten, wie er unsinnigerweise hofft, als würdig zu erweisen. Sie bleibt zurück und erfährt am Schluss, dass Clemens gefallen ist und ihr kurz vor seinem Weggang noch einen Brief geschrieben hatte. Den aber hatte ihre Stiefmutter unterschlagen, die inzwischen aus dem Schloss verbannt wurde. Matilda entdeckt ihn durch Zufall. Das letzte Bild zeigt die junge Frau mit tränenüberströmtem Gesicht, und man hört sie flüstern: »Als Blinde war ich glücklicher!«
Was für eine Seifenoper! Dennoch musste ich ein paar Tränen wegwischen, und selbst Richard schnäuzte sich geräuschvoll. Als das Licht anging, ertönte wieder heftiger Applaus, und manch einer rieb sich die Augen. Josephine Stone saß regungslos in ihrem Sessel. Da ertönte von hinten eine polternde Stimme: »Was für ein sentimentaler Kitsch! Vielleicht besser für Welfenstein, dass man ihn vergessen hat.«
Alle drehten sich um, auch Josephine erwachte aus ihrer Starre. Der dies in den Saal trompetet hatte, war der Mann mit der grässlich grellbunten Krawatte. Marianne fuhr auf ihn los. »Was unterstehen Sie sich, Herr Stoffelmann! Und wie sind Sie überhaupt hier hereingekommen? Ich bin mir sicher, dass Sie keine Einladung hatten!«
»Aus gutem Grund wollten Sie mich nicht dabeihaben!«, feixte der Attackierte. »Na ja, man hat so seine Beziehungen! Und ich bin mal gespannt, ob die anderen Filme des von Ihnen so hochgelobten Regisseurs auch solche Schmachtfetzen sind!« Ehe Marianne noch etwas erwidern konnte, eilte Stoffelmann davon.
Seltsamerweise brach Josephine Stone in schallendes Gelächter aus. »What a silly little creep!«, rief sie. »Ich kenne ihn. Er hat schon mehrmals versucht, mich für seine Online-Filmgazette zu interviewen. Aber ich habe das jedes Mal abgelehnt. Rache des kleinen Mannes!« Alle atmeten erleichtert auf. »Let’s have a drink!«, schlug die alte Dame vor, und alle folgten ihr in den Rittersaal.
Marianne aber war hochrot im Gesicht. »Dieser verfluchte Kerl! Er hat schon letztes Jahr über unser Festival unangenehme Dinge verfasst. Der Regisseur Ranzau wollte sogar gerichtlich gegen ihn vorgehen. Leider kam es nicht dazu, da Ranzau im Oktober einen Schlaganfall erlitten hat und seither in einem Pflegeheim lebt. Stoffelmann ist ein übler Typ, den wir natürlich nicht auf unserer Liste hatten. Ich frage mich, wie er es heute Abend hier hereingeschafft hat.«
Mein Blick fiel zufällig auf Walter Schröter. Stoffelmann hatte eben neben ihm gesessen. Der Archivar bemerkte meinen Blick und erwiderte ihn, wie es mir schien, mit einem verlegenen Achselzucken. Wenig später hastete er an mir vorbei und verschwand im Dunkel der Nacht.
Der brutale Einwurf von Stoffelmann, der, wie ich erfuhr, mit Vornamen Hans Peter hieß, diente schon bald eher der Belustigung der Gäste, die sich nach einigen weiteren Drinks allmählich auf den Heimweg machten. Ich ging zu Josephine Stone, die auf einem Stuhl am Tisch saß und sehr erschöpft wirkte. Ihr Sohn Rupert und Philippa Sullivan standen in ihrer Nähe. »Ich freue mich schon auf morgen Abend«, sagte ich zu der alten Dame, die mich anlächelte. »Mir gefällt die Musik, und auch die Kamera ist beeindruckend.«
Josephine nickte. »Der Kameramann war Wladimir Nerow. Er wollte auch emigrieren, ist aber 1936 spurlos verschwunden. Er war zu seiner Familie nach Petersburg gereist, kam dort aber angeblich nie an. Sehr traurig! In London hat mein Vater dann einen englischen Kameramann engagiert, Hugh Mercury. Nicht so talentiert wie Nerow. Aber durchaus bemüht. Nur dass der Film dort nie zu Ende gedreht wurde und alles, was bereits fertig abgedreht war, in jener Nacht des Todes meines Vaters verschwand. Bis heute ein Rätsel.« Josephine seufzte tief. »Ich würde Ihnen gerne mehr erzählen. Hätten Sie am Donnerstag Zeit?«
»Sehr gerne!« Ich mochte Josephine auf Anhieb. Und die Geschichte ihres Vaters und auch ihr Schicksal interessierten mich.
Richard sprach noch mit dem Kinobesitzer Petrowski, dem er, wie ich hörte, ein Kinoplakat verkaufen wollte. »Metropolis« von Fritz Lang, ein Original, das Richard zufällig vor einigen Jahren aus einer Haushaltsauflösung übernommen hatte. Die Erben gaben es ihm für einhundert Euro. Oliver Petrowski würde wesentlich mehr dafür hinblättern müssen. Als ich hinausging, schüttelte er gerade Richards Hand. Deal done, dachte ich und schmunzelte.
Um die Burgruine strich ein frisches Lüftchen. Am Himmel flackerten ein paar Sterne, und der kleine Ort lag still am Fuß des Hügels. Nur noch wenige Lichter brannten in den Häusern. Ich wollte gerade losmarschieren, als ich ein Flüstern vernahm. Meine Neugierde übermannte mich. Eigentlich ging mich das nichts an, doch das Flüstern besaß eine seltsame Intensität.
Ich ging ein paar Schritte in die Richtung, aus der die Stimmen kamen. Zwei Männer standen im Schatten des Wehrturms, und obwohl es dunkel war, erkannte ich Stoffelmann an seiner blinkenden Krawattennadel. »Hör du mir jetzt mal zu, Walter«, zischte er. »Du schuldest mir etwas!«
»Dann hättest du heute Abend nicht so eine blöde Bemerkung machen sollen«, flüsterte Schröter.
»Ach was, die alte Dame weiß, dass ich recht habe. Ihr Vater hat wirklich reichlich viel Pathos in seine Filme gelegt. Aber ich brauche dieses Interview. Sie weiß etwas, das wahrscheinlich einer Sensation gleichkommt. Du kennst doch Marianne ganz gut. Nutze deine Beziehung, und ein bisschen Druck kann nicht schaden.« Er kicherte. »Rohrmeisters Geheimnis ist noch bei mir sicher, aber ich sage: noch.«
Hastig zog ich mich zurück. Richard kam in diesem Moment froh gelaunt aus dem Rittersaal, hakte mich unter, und wir gingen zu Fuß zu unserem Hotel. »Den Fritz Lang habe ich für eintausend Euro verkauft«, sagte er. »Ich rufe gleich morgen in Hannover an und lasse das Plakat an Petrowski schicken.«
Ich hörte nicht richtig zu. Denn obwohl die Nachtluft mir guttat, konnte ich sie nicht genießen, da mir Stoffelmanns Worte durch den Kopf gingen. Welches Geheimnis von Valentin Rohrmeister kannte dieser Stoffelmann, das ihn nach dessen Ansicht erpressbar machte? Und was verband Schröter, der Stoffelmann eindeutig heute Abend unter die Gäste geschmuggelt hatte, mit diesem unangenehmen Zeitgenossen?
Auf einmal erschien mir das kleine Angerrath nicht mehr als der idyllische Ort fern der großen dunklen Welt.
Das Geheimnis der alten Dame
Kurz vor neun Uhr am nächsten Morgen saß ich mit meinen vier Co-Juroren im Kinoraum auf der Burg. Marianne hatte ein paar einführende Worte gesprochen, ihr Mann stand währenddessen stumm hinter ihr, und als die ersten Bilder über die Leinwand flackerten, gesellte sich Hans Schumann zu uns, mit dem ich am gestrigen Abend kein Wort geredet hatte. Richard hatte sich verabschiedet. Er plante, nach Monschau zu fahren, um das berühmte Rote Haus zu besuchen, und wollte erst abends wieder dabei sein, wenn der zweite Welfenstein gezeigt werden würde.
Ich war nicht voll konzentriert, obgleich »Liebe kann es nicht sein« recht unterhaltsam war und vor allem die junge Hauptdarstellerin Beatrice Lappan überzeugte. Sie spielte eine traumatisierte Studentin, die stets an sich selbst zweifelt und nicht an Beziehungen glaubt. Bis dann doch der Richtige auftaucht, der sie davon überzeugt, dass sie ein wunderbarer Mensch ist. Ein etwas läppisches Happy End. Und insgesamt nicht sehr viel weniger pathetisch als Welfensteins Dramolett von der blinden Prinzessin.
Als das Licht im Raum wieder anging, tauchte Beatrice Lappan zusammen mit dem Kameramann auf, verbeugte sich anmutig und wurde mit Applaus belohnt. Sie bedankte sich mit einigen freundlichen Worten, entschuldigte sich, dass sie leider nur kurz bleiben könne, da sie in Köln zu Dreharbeiten erwartet würde. »Eine neue Krimiserie«, sagte sie. »Darin spiele ich die Assistentin eines Strafverteidigers.«
Noch mehr Beifall, und die beiden rauschten davon. Der Kameramann hatte nichts gesagt.
In der kleinen Pause vor dem nächsten Film zog ich mich in eine Ecke zurück. Immer wieder hörte ich in Gedanken Stoffelmanns Stimme, die auf Schröter einflüsterte. Am besten hielt ich mich zurück und ließ meine Neugier nicht schon wieder die Oberhand über meine Vernunft gewinnen. Was ging mich das auch an? Rohrmeister wirkte nicht wie ein Mann, der ein düsteres Geheimnis barg, aber man sah ja auch Mördern nicht unbedingt ihre dunkle Seite an. Die meisten Mörder, die mir in den vergangenen sechs Jahren begegnet waren, hatten eigentlich auf den ersten Blick alles andere als unsympathisch gewirkt.
Bevor der Thriller »Verräterische Freunde« begann, trat Oliver Petrowski an mich heran. »Du weißt sicherlich, dass ich das Plakat von ›Metropolis‹ gekauft habe. Richard meinte, er könne mir auch ein Plakat von einem der Welfenstein-Filme verschaffen. Hast du eine Ahnung, wie er darankommt?«