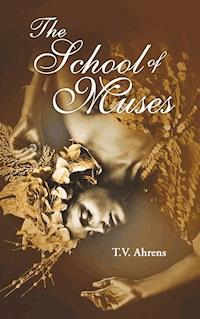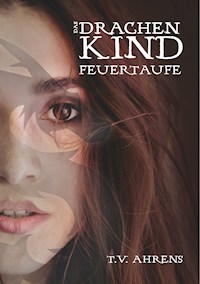
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Starke Frau vom Menschenland wird fortgeführt von Elfenhand. Zu bringen eines Kriegers Sohn, den Elfen Ehr', den Drachen Hohn. Seit Anbeginn der elfischen Zeitrechnung herrscht Krieg zwischen den Elfen und den Drachen. Weder die systematischen Ausrottungsversuche der Elfen noch die Überfälle der Drachen konnten einer Seite den endgültigen Sieg bringen. Das Volk der Elfen hofft daher auf eine alte Prophezeiung, die das Ende ihrer Qualen verspricht. Als ein Krieger ihrer Welt sich in eine junge Menschenfrau namens Moira verliebt, steht der Erfüllung dieser Prophezeiung scheinbar nichts mehr im Wege. Bis auf die schreckliche Lüge, mit der sie Moira in ihre Welt locken ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 879
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
For My Love
What would I do without you?
You are my hand when my hand trembles,
you are my eyes when my eyes fail.
What would I do without you?
You make me laugh when all is tears,
you lift me up when my legs give out.
Mein tiefster Dank gilt meinem Mann Viktor und meinem Sohn,
meiner Mutter, die mir beigebracht hat, dass Gott in jedem kleinen Ding ist,
meinem Vater, der mir bewiesen hat, dass wir auch jenseits der 50 noch über unsere Glaubenssätze hinauswachsen können,
meiner großen Schwester, die mir gezeigt hat, dass sich auch sehr kluge Frauen sehr lange hereinlegen lassen können,
und meinem kleinen Bruder, der mit seiner Ehefrau und der Band »OF COLOURS« selbst außerordentlich kreativ ist. Eure Musik rockt. Lasst euch nie etwas anderes erzählen.
Für Nessi und Katharina, meine treuesten Fans, die sich Jahr und Tag mit einer Engelsgeduld jede neue Idee von mir anhören.
Für Anne, die mindestens genau so verrückt und hochsensitiv ist wie ich. Ich weiß, sie wird etwas großes auf die Beine stellen.
Für Sarah, meine langjährigste Freundin und meinen immer bedachten, kühlen und rationalen Gegenpart.
Für Basti und Tine, die weiterhin meine Freunde sind, obwohl ich den 5. General nach ihrem (zuckersüßen!) Sohn benannt habe.
Und für alle anderen Freunde, denen ich mit meiner gnadenlosen Ehrlichkeit, Direktheit und meiner Fähigkeit, Gefühle zu lesen, sonst noch auf den Zeiger gehe.
Wie so viele Autoren vor mir habe ich mich beim Schreiben von einem sehr speziellen Musik-Mix inspirieren lassen. Deshalb einen riesigen Dank an Blind Guardian, Muse, Hurt, Evanescence, London Grammar, Shinedown, Sia, System of a Down, Linkin Park, Imagine Dragons, Nocturnal Rites und vor allem an Sonata Arctica, meine unangefochtene Lieblingsband.
Dieses Buch haben die Autoren Neale Donald Walsch (»Gespräche mit Gott«) und J. R. Ward am meisten beeinflusst, die nur auf den ersten Blick keinerlei Gemeinsamkeiten haben.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Prolog
Cornwall, England.
Zwanzig Jahre früher.
Auf den letzten Metern nach Hause rannte Moira, so schnell ihre kurzen Beine sie trugen. »Mummy, mich hat etwas gebissen!«, schrie sie, als sie durch die Türe kam.
Ihre Mutter kam mit einem Geschirrtuch in den Händen in den Flur gelaufen. »Was ist los?!«
»Mich hat ein großes Tier gebissen, im Wald!«
»Ja, sicher.« Jennifer Wright sah ihre wilde 8-Jährige vorwurfsvoll an. Das blaue T-Shirt war hin. Über die Schulter zog sich ein langer, blutiger Kratzer. So große Tiere gab es seit Jahrhunderten nicht mehr im englischen Unterholz. Aus verdammt guten Gründen. »Moira Wright, du bist wieder auf Bäume geklettert, gib's zu«, sagte sie verärgert.
»Aber Mum–«
»Kein Aber. Ab ins Bad!«, befahl Mrs. Wright.
Mit diesen Worten verschwanden Mutter und Tochter im Badezimmer, um die Wunde zu säubern.
Kapitel 1
Cornwall, England.
Heute.
»Hallo, David«, grinste Moira mit einigem Singsang in der Stimme.
Der junge Mann mit dem fast hüftlangen schwarzen Pferdeschwanz trat an ihren Schalter vor. »Hallo, M.«
Moira musste immer breiter lächeln. Seit Wochen wiederholte sich dieses Spiel. Beinahe jede Woche kam dieser Mann kurz vor Geschäftsschluss in diese gottverlassene kleine Filiale der Lloyd's Bank direkt auf Gunnislakes Hauptstraße. Deshalb begrüßte sie ihn auch schon mit Vornamen. Und er wusste bereits, unter welchem Spitznamen Moira bei ihren Freunden bekannt war.
»Was kann ich heute für dich tun?«, fragte sie kess. »Möchtest du den Kurs des arabischen Riad wissen? Der steht heute richtig gut. Oder wie wäre es mit dem neuesten Klatsch aus der Finanzkrise? Die Deutsche Bank hat wohl mächtig einen reingewürgt bekommen. Kann nicht sagen, dass uns das traurig macht.« Während ihrer letzten Worte warf sie einen vorsichtigen Blick zu ihrer Kollegin Shannon hinüber. Die lächelte – wie üblich – nur zuckersüß zurück und blätterte weiter geschäftig in ihren Unterlagen. In der hintersten Ecke des großen Raumes. Neben dem Schrank, in dem die Kundenverträge von 1990 bis 2003 archiviert wurden. All das hatte natürlich überhaupt nichts mit David zu tun.
»Hm.« David faltete die Hände auf Moiras brusthohem Schalter und schaute nervös durch die Gegend. Wie immer, wenn er das tat, nutzte sie die Gelegenheit und starrte auf seine Ohren. Er hatte zweifellos die schönsten Ohrmuscheln, die sie je gesehen hatte. Perfekte Größe und Form, bis auf eine deutliche Ecke hinten oben im Knorpel. Sagenhaft. Und sie hatte sich noch nie für Ohren interessiert.
»Wie wäre es mit dem heutigen Kinoprogramm?«, fragte er endlich, den Blick fest auf ihre Reaktion gerichtet.
Stille.
Moira spürte das Blut in ihre Wangen strömen. Sie wandte sich ab, als wolle sie etwas holen gehen, und nahm das kleine Spiel wieder auf. »Oh, ich weiß nicht, ob ich das da habe«, entgegnete sie, »wir sind nämlich leider kein Kino.«
David griff blitzartig und doch seltsam sanft nach vorne und hielt ihre Hand fest. Was sollte sie ihm jetzt bloß sagen? Er schien es tatsächlich ernst zu meinen mit seiner Avance. Sie dachte zurück an ihre letzten romantischen Verstrickungen und geriet ins Schwitzen. Moira und Männer, das war bisher noch nie gut gegangen. Für längere Beziehungen schien sie einfach nicht geschaffen. Natürlich gefielen ihr seine Besuche, das Süßholzraspeln, seine Blicke. Aber früher oder später hatten all ihre romantischen Anstrengungen im Desaster geendet. Deshalb sagte sie ihm lieber gleich auf höfliche Art, dass aus seiner fixen Idee wohl nichts werden würde, nicht wahr? »Weißt du, ich bin kein großer Kino-Fan«, sagte sie entschuldigend. Sie sah nach unten und strich sich mit ihrer freien Hand eine schwarze Haarsträhne hinter ihr Ohr, die aber sofort wieder nach vorne fiel. Verdammter Stufenschnitt. Auf der anderen Seite konnte sie sich in solchen Momenten wirklich fabelhaft hinter ihrer Mähne verstecken.
»Oh.«
Moira sah auf und die Enttäuschung in seinem Gesichtsausdruck versetzte ihr einen schmerzhaften Stich. Ihm war wohl nun auch aufgefallen, dass er noch immer ihre Hand umklammert hielt, denn er ließ sie mit einem nervösen Lächeln los und wandte sich zum Gehen. »Na dann, bis demnächst... schätze ich.«
Wie so oft waren David, Shannon und sie die Letzten in der Bank. Kein Wunder, kam er doch absichtlich immer fünf Minuten vor Geschäftsschluss. Mit wachsender Panik suchte Moira einen Ausweg aus ihrem Dilemma.
»Herrje, was ist bloß los mit mir?«, meldete sich ihr Kopf. »28 Jahre alt und keinen Funken romantische Abenteuerlust. Er wird schon nicht beißen. So ein niedlicher Typ läuft einem in einem Dorf wie Gunnislake nicht jeden Tag vor die Nase!«
Shannon räusperte sich und zog Moiras Blick in ihre Richtung. Der Gesichtsausdruck ihrer Kollegin sprach Bände – und die scheuchende Handbewegung auch.
»Shannon hat Recht«, dachte sie. »Es ist Freitagabend, verdammt noch mal. Jetzt oder nie!«
David war schon den halben Weg zur Drehtür zurück geschlurft, als sie endlich ihre Stimme fand. »Aber ehrlich gesagt habe ich einen Bärenhunger!«, rief sie ihm nach. Der Satz sollte eigentlich laut und freundlich klingen, wurde aber nur eine bedauernswerte Mischung aus Krächzen und Flüstern.
David wirbelte herum. »Ehrlich?«, fragte er überrascht. »Ich meine, großartig! Aber ich habe gar nichts Zuhause, was ich uns kochen könnte.«
Moira musste herzhaft lachen. Als ob irgendjemand heutzutage einem ersten Date zustimmen würde, das nicht auf dem neutralen Boden eines Pubs stattfand. »Tja, David«, grinste sie. Dann angelte sie in Windeseile Tasche und Mantel vom Schreibtisch einige Meter weiter hinten und kam grinsend um die Schalter herum. »Dafür gibt es Restaurants in diesem Land.«
»Tschüss, ihr Süßen«, rief Shannon ihnen nach, »passt auf euch auf!«
»Danke fürs Abschließen, du bist die Beste«, neckte Moira und hakte sich bei David unter, was sein Dauerlächeln nur noch verstärkte.
»Aber immer doch«, murmelte Shannon erleichtert, als die beiden Turteltauben schon auf die Straße getreten waren. »Pass einfach nur auf dich auf, Süße.«
Weit, weit über der geschäftigen Welt mit ihren nimmermüden Lichtern und ihren rastlosen Menschen öffneten sich die Augenpaare dreier uralter Frauen. Und noch bevor das Echo der Szene in ihren Köpfen ganz verklungen war, hatten sie ihre schweren Glieder aus der Türe geschleppt und ihre Chronistinnen zu sich gerufen, um diesen Moment gewissenhaft festhalten zu lassen. Nicht einmal die drei Prophetinnen selbst ahnten jedoch in diesem Moment, dass sie die Schreiberinnen noch viele Male in dieser Nacht rufen würden. Und dass die folgenden Teile der Nachricht ganz und gar nicht fröhlicher Natur waren.
Kapitel 2
Moira war noch nicht aus ihren Stiefeln heraus geschlüpft, da ereilte sie schon Shannons glockenhelle Stimme. Wenigstens war der Direktor bereits dabei, drinnen aufzuschließen. So war die Chance geringer, dass auch er alles hörte.
»Moira Wright, erzähl mir alles!«
Ja, das war Shannon. Berechenbar, verbissen, und auf eine nette Art und Weise nervig. Man konnte sich keine bessere beste Freundin wünschen.
»Ist er so nett, wie er aussieht?«, flötete Shannon. »Oder wollte er doch nur das Eine? Ich hoffe doch, du hast Kondome parat gehabt, du alte Pillen-Verweigerin? Habt ihr das ganze Wochenende im Bett verbracht? Ach, so einer müsste mir mal passieren!«
Draußen schüttete es wie aus Eimern, also ein typisch englischer Montagmorgen im März. Und gerade machten sie sich fertig für eine neue ereignislose Arbeitswoche in der Bank, aber Shannon war wie immer bester Laune. Beneidenswert.
»Ich... Er... Shannon, du nervst!«, rief Moira lachend. »Sowas fragt man nicht. Er ist sehr... nett, okay? Und mehr werde ich dazu jetzt nicht sagen, meine Liebe.« Moira schlüpfte in ihre Pumps, rückte den Kragen ihrer Bluse zurecht und ging wiegenden Schrittes zur Tür. »Im Übrigen haben wir nur im Busy Tandoor zu Abend gegessen, geredet und dann hat er mich nach Hause gebracht. Hörst du? Nur ge-re-det.« Sie zog das letzte Wort wie Kaugummi. »Und es war schön. Einfach schön.« Sie schloss grinsend die Tür der Kammer, die die beiden Freundinnen irgendwann annektiert und zur Umkleide umfunktioniert hatten. Das nützte ihr allerdings wenig, denn sie hörte Shannon von drinnen rufen: »Wenn du ihn doch nicht willst, sag einfach Bescheid, M.!«
Im nächsten Augenblick stand Mister Minetti, der Filialleiter, direkt vor ihrer Nase. »Miss Wright–« hob er an, und Moira stellte sich auf eine längere Standpauke ein. Der Mann war halb Italiener und halb Engländer, und er kam eher nach seinem kleinen, dicken, italienischen Vater.
»–wir haben hier Kunden.«
Kein Mensch weit und breit. Kein Wunder, welcher Kunde verirrte sich auch hinter die Türe mit der Aufschrift ‚Nur für Personal‘? Offensichtlich hatte das Wort hier eine andere Bedeutung für Minetti.
»Und diese wollen nicht Zeugen ihrer pubertären Gespräche mit Miss O’Neal werden, haben wir uns verstanden?«
Laut genug war der Giftzwerg ja. Aber nicht einmal Minetti konnte Moira heute ihre Laune verderben, ganz im Gegenteil. Ihr fiel ein, dass er im Grunde seines Herzens einfach eine gut laufende Filiale haben wollte – zum Wohle aller. Zudem war er einigermaßen fair. Er hatte eben einfach einen Stock gigantischen Ausmaßes im Hintern. Was sollte man da machen?
Moira richtete sich auf und zwang ihr Dauergrinsen auf die Parkposition. »Tut mir leid, Sir. Es kommt nicht wieder vor«, versicherte sie. Diese neun Wörter waren alles, was man für den reibungslosen Umgang mit dem Direktor brauchte. Und das war definitiv seine beste Eigenschaft.
Der Montag verlief schrecklich normal. Was für Moira bedeutete, dass sie viel an ihrem PC saß, Stammkunden beriet und Papierkram erledigte. Niemand wollte exotische afrikanische Münzen aus dem letzten Safari-Urlaub in britische Pfund umtauschen, und auch sonst wollte einfach nichts Aufregendes passieren. So hatte sie viel Zeit, auf ihren Bildschirm zu starren und an vergangenen Freitag zu denken.
Sie hatte David spontan in den indischen Imbiss unweit der Bankfiliale geschleift und stundenlang mit ihm dort gesessen. Der Busy Tandoor war ihr absoluter Lieblingsschuppen von hier bis Cardiff – und außerdem mahnte einen der Imbiss-Charme gleich dezent, es mit der Romantik langsam angehen zu lassen. Es war die perfekte Wahl gewesen, da musste Moira sich loben. Sie machte ein paar lustlose Klicks in ihren Dokumenten. Dann hatte der Gedanke an Freitag sie schon wieder eingeholt. Wie David freudestrahlend ihren Vorschlag angenommen hatte, zum Inder zu gehen. Andere Männer waren da weiß Gott schwieriger zufrieden zu stellen – beziehungsweise leichter, wenn man sieben Mal in der Woche Steak mit Kartoffeln essen konnte. Wie er fasziniert zugehört hatte, als sie von dem Giftzwerg Minetti, ihrem Job und ihrem Alltag gesprochen hatte. Wie er ihr – Gentleman durch und durch – die Türe aufgehalten hatte. Aus ihrem Mantel geholfen hatte. Den Barhocker einladend vom Hochtisch abgerückt hatte. Wenn es nach dem guten alten Knigge ging, sah es also ganz so aus, als ob Moira bald den nächsten Schritt in diesem Spiel wagen konnte.
Plötzlich erstarrte sie. Verdammt, sie? hatte ihn überhaupt nicht nach seiner Handynummer gefragt! Und er auch nicht nach ihrer. Wie hatten sie das nur vergessen können?
»Tief durchatmen«, befahl ihr Kopf. »Er weiß in jedem Fall, wo er dich findet.«
Wohl wahr. Trotzdem ärgerte sie sich die folgenden Stunden maßlos, dass nun alles von ihm abhing. Aber es blieb ihr scheinbar nichts anderes übrig, als sich mit dem Gedanken zu arrangieren.
Kapitel 3
Elhin war in die Ecke gedrängt. In seinen 231 Lebensjahren war er niemals gleichzeitig so wütend, traurig und einsichtig gewesen. Seit Beginn seiner Audienz verharrte er nun in seiner Verbeugung hier im Amtszimmer des fünften Generals. Eingerahmt von seinen fast hüftlangen, weißblonden Strähnen haftete sein Blick auf dem grauen Stein unter seinen Stiefeln.
Endlich sprach der General weiter. »Hast du mir zugehört, Elhin?«, fuhr er ihn an. »Wir haben die Menschenfrau gefunden. Diejenige, deren Fluch zu unserem größten Segen werden wird.« Er pausierte, nicht davon überzeugt, dass Elhin die Tragweite seiner Worte verstand. Deshalb gab er seiner größten Lust nach und legte den Finger weiter in die offene Wunde seines Untergebenen. »Es fällt nun also an dich, ihren Fluch zu brechen. Du wirst dies für dein Volk tun, Elhin, wie du es schon so oft getan hast. Die Seherinnen verlangten explizit nach dir. Du kannst und wirst diesen Auftrag nicht ablehnen, gerade weil du diese Frau schon eine Weile heimlich aufsuchst. Du fühlst dich zu ihr hingezogen, ist es nicht so? Enttäusche mich und unsere heiligen Seherinnen nicht mit Ausflüchten.«
Es entstand eine kurze Pause, in der Elhin jegliche Antwort verweigerte.
»Nun gut«, knurrte der General. »Geh nun und bereite dich auf deine Aufgabe vor. Vom Training in der Kaserne und der Arbeit mit den Kadetten bist du vorerst befreit. Morgen dann bringen wir die Frau zu uns auf die Ebene.«
Elhin zuckte beinahe unmerklich zusammen. »Morgen?«, stammelte er, richtete sich auf und blickte seinen Befehlshaber verbotenerweise direkt an. Dieser zog merklich die Augenbrauen zusammen, aber der Gefallen an Elhins panischer Miene zog sie schnell wieder glatt.
»Morgen«, wiederholte der General beinahe freudig.
»Das ist unmöglich, Herr. Ich kann das Vertrauen der Menschenfrau niemals innerhalb weniger Stunden gewinnen. Bei den anderen Frauen hatte ich mehr Zeit. Ich konnte Einlass in ihr Heim und ihr Herz gewinnen. Ich-«
»Diese Frau ist aber nicht wie die anderen, Elhin«, rief der General ungeduldig. »Die Prophetinnen bestehen darauf, dass alles morgen stattfinden muss. Der Mond steht günstig, so sagen sie. Außerdem ist die Prophezeite viel zu wichtig, um mit ihr zu verfahren, wie mit den restlichen Trägerinnen des Fluches. Ab morgen liegt ihr Schicksal also einzig in unserer Hand.«
Die letzten Worte ließ der General so genussvoll über seine Zunge rollen, als würde er eine Köstlichkeit preisen. Die Liebe seines Untergebenen mit Füßen zu treten gestattete ihm ein unverhofftes Fest, und er genoss, was ihm dargeboten wurde.
Elhin tat das Einzige, was ihm einfiel, um für den Moment bei Verstand zu bleiben. Er schloss die Augen und dachte an die letzten Wochen: an die kleinen Blicke und Gesten seiner Liebsten, gekrönt von einem ganzen Abend, den er vor vier Tagen mit ihr am gleichen Tisch hatte verbringen dürfen.
Ja, er würde seine Aufgabe annehmen. Erneut einen Fluch abwenden und so dem Wunsch der Seherinnen nachkommen. Wenigstens hatten sie Gnade walten lassen. Hatten ihm diese Aufgabe übertragen und keinem höherrangigen Krieger. Und keinem General. An diesem Funken Hoffnung klammerte sich Elhins Geist derart fest, dass sein Kopf schmerzte. Vielleicht waren das aber auch die Tränen, die er sich selbst versagte.
»Wird sie sich nach dem morgigen Tag an mich erinnern können?«, fragte er leise. Die Angst, wie die Antwort seines Befehlshabers ausfallen würde, schnürte ihm endgültig die Kehle zu.
»Oh ja«, lächelte der General selbstgefällig. »Schließlich hast du die zweifelhafte Ehre, dass sie jetzt deiner Verantwortung untersteht. Jedenfalls bis wir haben, was nur sie uns geben kann.«
»Ich werde meinem Schicksal gerecht werden, Herr«, antwortete Elhin nach einer Weile. Und er wusste nur zu gut, dass sein Befehlshaber ausweichende Antworten hasste.
»Gut«, entgegnete der General kalt. »Und nun geh mir aus den Augen.«
Elhin rannte, so schnell ihn seine Beine trugen, hinaus zu den Klippen. Die Zeit schien ihm durch die Finger zu rinnen wie Sand und sein nutzloser Geist hatte nichts Besseres zu tun, als sich zwischen seinen gehetzten Atemzügen wieder und wieder die gleiche Frage zu stellen: Wie hatte das alles passieren können? Trunken vor Glück hatte er die letzten Tage erlebt: Tage, in denen das menschliche Konzept namens Wochenende seine Geduld schwer strapaziert hatte. Einen völlig rast- und ruhelosen Montag. Und heute Morgen, als er sich endlich ein Herz gefasst hatte und wieder maskiert die Welten hatte wechseln wollen, war er in die Kaserne gerufen worden.
»Gütigste Göttin, es ist alles verloren«, wisperte sein Herz. Hätte er die Frau aus Gunnislake über die letzten Wochen nicht lieben gelernt, es wäre eine normale Bitte gewesen. Das Unheil von einer Frau abwenden? Das war edel. Es war ein Teil seiner Aufgaben als Krieger, für das Menschengeschlecht zu sorgen. Während er rannte und die Steilklippen näher kamen, warf er Gürtel und Schwert von sich. Hätten die Prophetinnen sie nicht entdeckt, hätte er sie langsam und vorsichtig an die Wahrheit heranführen können. Mit etwas Zeit und mit Hilfe seiner Liebe hätte er ihr Leben in normalen Bahnen halten können. Doch was nun von ihm verlangt wurde, dafür würde sie ihn auf ewig hassen. Auf ewig.
Beim letzten Wort dieses Gedankens schloss Elhin seine Augen und sprang. Der Wind peitschte durch sein Leinenhemd und zerrte an seinen Hosenbeinen. Mit weit ausgestreckten Armen fiel er dem Ozean entgegen. Für einige Sekunden ließ er sich gefangen nehmen von diesem Rausch, dachte nicht an den Albtraum, der vor wenigen Minuten sein Leben übernommen hatte. Als das wunderbar blaue Meer unter ihm nur noch wenige Meter entfernt war, wünschte er sich von ganzem Herzen zurück zu den Menschen – und zu dem kleinen Städtchen, in dem seine Liebste wohnte. Ohne ein Geräusch zerfloss sein Körper zu Nebel und verschwand.
Nach dem bescheidenen Montag zog sich auch der Dienstagvormittag wie Kaugummi. Moiras Laune schwankte zusehends zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Sie starrte zum zweihundertsten Mal auf den Wandkalender über ihrem Bildschirm und hing ihren Gedanken nach.
Hatte David sie vergessen? Oder hatte er es sich anders überlegt? Warum zur Hölle hatte sie nicht nach seiner Handynummer gefragt? Hatte er überhaupt ein Handy neben sich auf den Tisch gelegt? So wie die anderen oberwichtigen Macker, mit denen sie ein Abendessen gewagt hatte?
Sie rieb sich die schmerzenden Schläfen, die heute wohl schon zu viele Gedanken hatten wälzen müssen. Heute Abend würde sie sich endlich einen Facebook-Account anlegen und ihn suchen. Das hatte man wohl von seiner Verweigerungshaltung gegenüber den sozialen Netzwerken. Sie wusste noch nicht einmal seinen verdammten Nachnamen. Zum wiederholten Mal hatte sie mit Shannon versucht, seine Unterschrift zu entziffern. Es war hoffnungslos gewesen, wie bei so vielen Männern. Er war immer persönlich und unter höflichem Vorwand in der Bank erschienen. Hatte thailändische Münzen in amerikanische Dollar getauscht. Hatte einige Sammlermünzen aus Silber und Gold bestellt, abgeholt und bar bezahlt. Wie seltsam das heutzutage war. Fast, als wäre er achtzig Jahre alt und würde wie andere ältere Herrschaften einfach die gesellschaftliche Interaktion um ihrer selbst willen suchen.
Noch mehr Schläfen reiben. Wenn sie nicht bald von diesem Gedankenkarussell herunter kam, würde sie wieder an die Sache mit der Handynummer denken. Und das würde ihre Laune ganz sicher nicht heben.
»Verdammt!«
Sie hatte sich einfach nicht genug Mühe gegeben bei ihrem Date. Dabei wusste doch jede erwachsene Frau, dass Männer ab und an etwas Ermutigung brauchten. Oft sogar mehr, als man selbst vielleicht in dem Moment empfand. Diesen Satz aus Jane Austins Stolz und Vorurteil hatte sie sich damals dick unterstrichen und sehr zu Herzen genommen.
»Nun aber Kopf hoch«, flüsterte Shannon im Vorbeigehen.
Als Moira ihr nur wortlos zusah, wie sie sich an ihren Schreibtisch einige Meter neben ihrem eigenen setzte, legte ihre Freundin barmherzigerweise noch einmal nach.
»Es ist schließlich erst Dienstag!«, erklärte Shannon. »Er ist doch so schüchtern. Vielleicht will er dich nicht bedrängen und wartet lieber noch einen Tag länger, bis er wieder vorbei kommt? Er ist eben altmodisch. Wenn er nur halb so glücklich war, wie er deinen Ausführungen nach aussah, dann steht er bald wieder hier auf der Matte, vertrau mir!«
Ein aufgeregtes Husten von einem der Schalter ließ beide aufsehen, aber dort stand nur ein extrem schlaksiger junger Mann in verdrehter und verkrampfter Haltung. Er war offensichtlich körperlich und wahrscheinlich geistig behindert. Er hatte sich in seinen abgetragenen Klamotten ein Stück abseits mit einem Formular hingestellt und würde nun zweifellos über fünfzehn Minuten damit verbringen, es unleserlich auszufüllen, bevor er um Hilfe bat.
»Da ist deine Ablenkung«, schnurrte ihr Geist. Dieser war offensichtlich mit ihrer Erziehung im Bunde und ließ sie wie ferngesteuert aufstehen. »Shannon, ich gehe mal helfen. Kannst du eventuell den Vertrag für Ehepaar Donnerty aus dem Drucker holen und in die Post geben? Ich danke dir.« Ohne eine Antwort abzuwarten, stakste sie los und näherte sich dem Behinderten, der sie aus wässrigen blauen Augen groß ansah.
Als er zu begreifen schien, dass sie ihn ansprechen würde, stolperte er einige Schritte rückwärts und fiel rücklings durch die automatischen Türen. Moira ließ ihr Lächeln sinken und stand einen Moment einfach nur fassungslos da. Derart zurückgewiesen zu werden war mehr, als ihr Ego heute verkraftete. Sie zog sich wieder hinter den Computer zurück, legte das Kinn in die Hände und wünschte sich, ihr Flachbildschirm möge explodieren, nur um sie von ihren bitteren Gedanken abzulenken.
Viele Meter entfernt von ihr legte der schlaksige Mann eine Hand gegen das Fassadenglas. Er wollte sie ansprechen. Aber er begrub seinen Wunsch sofort tief in seinem Herzen. Dann ging er sehr langsam, aber graziös davon.
Als Elhin von seinem Besuch auf der Erde zurückgekehrt war und seine menschliche Verkleidung wie eine störende Decke abschüttelte, stand die Sonne bereits hoch über der Ebene der Elfen. Er sammelte Gürtel und Schwert auf und beschloss, den einzigen Elfen zu besuchen, dessen Gegenwart ihn jetzt nicht den Verstand kosten würde. Seine Gedanken rasten. Wenn Moira wirklich den Drachenfluch trug, dann war ihr Leben in höchster Gefahr. Deswegen war er völlig plan-, köpf- und schutzlos wieder in ihre Welt gestürzt, um mehr Informationen zu erhalten. Einen Hinweis. Irgendetwas. Aber Überraschung: Moira war einfach nur ihr bezauberndes Selbst gewesen. Etwas gelangweilt und niedergeschlagen, aber sie selbst. Und er wäre wohl kaum zu ihr marschiert und hätte sie gebeten, ihre Hüften zu entblößen, wo sich das Drachenmal normalerweise zeigte – einem Leberfleck ähnlich.
»Verdammt!«, fluchte er in Gedanken. Er war schon wieder auf der Menschenwelt gewesen. Verbotenerweise. Und er hatte aus der Ferne nach Moira gesehen, die ihm erlaubt hatte, so viel zu hoffen. Doch nun war der Traum vorüber. Und wenn die Prophetinnen und der General Recht behielten, dann würde ein Albtraum an seine Stelle treten.
Als er sich seitlich dem Holzhaus näherte, in dem sein Bruder Calenn und dessen Frau Lizzy wohnten, hörte er ein vertrautes Geräusch und bemerkte, dass Calenn im hohen Gras hinter seinem Haus saß und schnitzte.
»Elhin! Wie schön, dass du uns besuchst.« Calenn sprang auf und legte die Sachen aus der Hand. Er war ein Stück größer als Elhin und hatte die gleiche hagere und doch kraftvolle Figur wie sein Bruder. Wie beinahe alle Elfenmänner hielt er seine langen blonden Haare mit einem lederähnlichen Bändchen im Nacken zusammen. Er breitete die Arme aus, aber Elhin blieb wortlos einige Meter vor seinem Bruder stehen. Calenn ließ die Arme wieder sinken. »Was ist los?«, fragte er besorgt.
»Lass uns ein Stück gehen«, antwortete Elhin knapp und starrte zu den Klippen.
Einen langen Moment folgte sein Bruder ihm einfach wortlos durch das raschelnde Gras. Dann endlich fühlte Elhin sich bereit, zu erzählen. Oder so bereit, wie man es jemals sein konnte, wenn man eine ganze verfluchte Karrenladung scheußlicher Nachrichten überbrachte. »Ich habe mich verliebt, Calenn.«
»Ich weiß«, lächelte sein Bruder. »Es war recht schwer zu übersehen die letzten Wochen. Aber warum dieses Gesicht, kleiner Bruder? Ist sie Priesterin? Oder ist sie einem Minister versprochen?«
»Wohl kaum. Sie ist ein Mensch«, raunte Elhin.
Calenn blieb stehen und Verwirrung machte sich in seinem Gesicht breit. »Und das ist dein Problem?«, fragte er.
Elhin hatte ebenfalls angehalten und stemmte nun die Arme in die Seiten. »Nein, das ist es ganz und gar nicht.«
»Dann verstehe ich dich nicht«, sagte Calenn schulterzuckend. »Sicher, es gibt für uns Elfen leichtere Verbindungen. Aber du könntest darum bitten, sie heiraten zu dürfen. So, wie ich es mit Lizzy getan habe.«
Elhin starrte weiter auf das Gras zwischen ihnen.
Calenn ließ sowohl Schultern als auch Lächeln fallen. »Musst du mir denn alles nachmachen, kleiner Bruder?«, seufzte er. »Hat dich unser Beispiel denn gar nicht abgeschreckt?«
»Sie ist gezeichnet«, platzte es endlich aus Elhin heraus.
Calenns Gesicht verlor schlagartig an Farbe. »Was sagst du?«
»Sie trägt das Drachenmal, Calenn. Der fünfte General hat es mir heute Morgen gesagt.«
Der große Bruder war nun endgültig verwirrt. »Herrje, unser General ist in diese Geschichte verstrickt? Wer noch?«
»Wir alle?«, fragte Elhin unsicher.
»Brüderchen, du machst mich wahnsinnig. Jetzt spuck es aus!«
»Ich... Die Prophetinnen haben mich gesehen, wie ich sie besucht habe«, stammelte Elhin. »Sie sind scheinbar außer sich vor Freude, denn sie haben Moira sofort erkannt.« Es schien ihm, als würde er mit jedem Satz eine weitere Brandbombe fallen lassen.
»Ist das ihr Name?«, fragte Calenn vorsichtig.
»Ja. Sie heißt Moira. Sie hat schwarzes Haar und ist das schönste Wesen, das ich jemals gesehen habe. Sie ist selbstbewusst und stark. Elegant und wunderschön. Wir waren sogar schon zusammen etwas Essen. Hätte ich doch nur mehr Zeit! Hätte ich doch nur eine Chance gehabt, sie besser kennenzulernen, bevor–«
»Moment mal, kleiner Bruder«, unterbrach Calenn mit zunehmender Sorge im Blick. »Was heißt das, die Prophetinnen haben euch gesehen? Sie hatten eine Vision von dieser Frau?«
Elhin biss sich auf die Lippen und starrte seinen Bruder an, bis dieser sich der aufkeimenden Erkenntnis nicht mehr erwehren konnte.
»Sie ist nicht irgendeine Trägerin des Drachenfluches?«, fragte er entsetzt.
Elhin schloss die Augen und schüttelte den Kopf. »Sie ist unsere Zukunft«, flüsterte er schließlich. »Sie ist unsere größte Hoffnung. Sie ist die Heilsbringerin, die sich die Elfen seit hunderten von Jahren herbeisehnen.«
»Gütigste Göttin«, flüsterte Calenn. »Du hast die prophezeite Menschenfrau kennengelernt? Es gibt sie wirklich? Mein Gott, all die alten Legenden.« Er starrte seinen kleinen Bruder noch einen Augenblick an und wandte den Blick dann in die Ferne. »Starke Frau vom Menschenland–«, begann er zu zitieren.
»–wird fortgeführt von Elfenhand–«, setzte Elhin mit geschlossenen Augen ein.
»–zu bringen eines Kriegers Sohn. Den Elfen Ehr', den Drachen Hohn.«
Als die Worte, die sie als Kinder so oft von den Älteren gehört hatten, im Wind verhallt waren, sah Calenn immer noch auf das scheinbar endlose Meer. Als läge dort draußen die Antwort, die er so dringend suchte. »Möge die Göttin uns beistehen«, flüsterte er.
»Ja, sicher«, zischte Elhin und stemmte die Hände in die Hüften.
Calenn sah ihn einen langen Moment schmerzerfüllt an. Und Elhin kannte den Blick nur zu gut. Es war der mitleidige Blick aller Elfen gegenüber denen, die kein Vertrauen in die göttliche Instanz ihrer Welt hatten. Der Blick, aufgrund dessen Elhin mehr als einmal eine Faust durch eine Wand hatte treiben wollen. Doch selbst seine Wut ließ ihn heute im Stich.
»Und wirst du tun, was sie dir aufgetragen haben?«, fragte Calenn schließlich. »Wozu wir ausgebildet worden sind? Du könntest ablehnen. Keines unserer Gesetze kann dich zwingen, einen Fluch abzuwenden.«
»Du weißt genau, welche Katastrophen man heraufbeschwört, wenn man die Prophetinnen missachtet. Und das lehrt uns nicht die Religion. Das lehrt uns die Geschichte.«
»Also, was nun?«
»Der Befehl lautet, Moira abzuholen. Morgen schon. Und sie dann auf ihre zukünftige Rolle auf unserer Welt vorzubereiten. Sie wird spurlos aus ihrem Leben verschwinden. Sie wird gezwungen sein, hier auf der Ebene zu bleiben, gegen ihren Willen. Und das wird meine Schuld sein.«
»Willst du damit sagen, euer Schicksal ist schon besiegelt? Einfach so?«
»Es ist alles besiegelt«, krächzte Elhin. »Ihr Leben als normale Frau ist vorbei. Und ich werde es ihr entreißen müssen. Es würde mich nicht wundern, wenn die Prophetinnen sie gegen ihren Willen im Tempel oder im Schloss festhalten lassen, bis sie haben, was sie so dringend wollen. Ich wünschte–«
Es entstand eine lange Pause. Dann sprach er weiter. »Ich wünschte, Moira wäre wenigstens wie jede andere Trägerin des Fluches. Oder ich wünschte, ich könnte mit ihr fliehen. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit.«
»Haben die Prophetinnen das Drachenkind schon gesehen? Wissen sie schon, wie alles vonstattengehen wird?«, wagte Calenn zu fragen.
»Ja, sie wissen schon etwas«, entgegnete Elhin flüsternd. »Sie wissen, dass seine Seele morgen in körperliche Existenz tritt.«
Tränen sammelten sich in Calenns Augen. Er schluckte heftig. »Glaubst du, du bist stark genug für das, was vor dir liegt?«, fragte er nach einer langen Pause. »Bitte versteh mich nicht falsch-«
Elhin biss sich auf die Lippen und schüttelte den Kopf. »Das tue ich nicht. Und ein Teil von mir wünscht sich nichts sehnlicher, als den Morgen nicht zu erleben. Aber wem wäre damit geholfen? Meine Liebste wird sterben, wenn wir nichts tun. Und unsere Welt wird mit ihr untergehen. Das sind die einzigen beiden Gedanken, die mich aufrecht halten.«
Calenn setzte wieder und wieder zu seinen nächsten Worten an. Er schien noch so viele Dinge sagen, seinem Bruder wenigstens noch einige tröstende Worte mitgeben zu wollen. Aber nur ein Satz kämpfte sich schließlich an die Luft zwischen ihnen. »Möge die Göttin dir deine Tat vergeben, Bruder.«
Elhin sah auf. »Möge meine Liebste mir vergeben.«
Kapitel 4
Am Mittwoch kurz vor Feierabend lief Moira kopflos zwischen ihrem Schreibtisch und den Schaltern hin und her und sortierte Papiere. Ihre Woche war zum Albtraum verkommen, aber glücklicherweise nicht aufgrund der Arbeit. So fiel es vielleicht weniger auf, wie enttäuscht sie mittlerweile war. Kein Besuch. Keine Nachrichten. David blieb wie vom Erdboden verschluckt.
»Doch doch, er hat es sich anders überlegt«, meldete sich ihre rationale Seite. Bei dem Gedanken warf sie einen schweren Ordner vom Schrank hinüber auf ihren Schreibtisch. Er landete mit einem lauten Krachen. Gott sei Dank war sie gerade alleine bei den Schaltern, denn Shannon und Minetti waren in ihrer Zigarettenpause am Hinterausgang. Da die meisten anderen Geschäfte in der Straße schon längst geschlossen hatten, herrschte zudem die übliche abendliche Kundenflaute. Die arme Shannon. Sie war dazu verdammt, Minettis einzige Gesellschaft während ihrer Zigarettenpause zu sein. Da blieb sie doch lieber alleine hier drinnen. Außerdem hatte Moira noch nie geraucht.
Die beiden kamen wieder herein und Shannon zog es vor, geschäftig an Moiras Schreibtisch vorbei zu eilen. Sie konnte es ihr nicht verübeln, sie war im Moment auch wirklich keine genießbare Gesellschaft. Minetti hingegen sah Moira direkt an, aber sie hätte nicht sagen können, ob er verärgert war oder einfach immer so aussah. Natürlich bemerkten die beiden ihre zunehmend frostigere Laune. Schon lange traute sich ihre Freundin nicht mehr, das Reizthema Männer anzuschneiden. Nun, es sollte ihr nur Recht sein. So sehr sie Shannon mochte, im Moment musste sie ihre Gedanken erst selbst sortieren. Und das konnte sie fast nirgendwo so gut, wie an ihrem eigenen Schalter. Also nahm sie neue Vordrucke für Überweisungen aus einem Regal, legte sie in hübsch angeordneten, kleinen Stapeln auf die Schalter und hing ihren finsteren Gedanken nach.
Die automatischen Schiebetüren surrten und eine große Gruppe gut gekleideter Männer trat in die Filiale.
»Wow, eine ganze Flotte Armani-Anzüge?«, schoss es ihr durch den Kopf. Sie verstand gezwungenermaßen etwas von maßgeschneiderten Anzügen, besonders von den kostspieligen. Aber in so teurem Zwirn waren diese Männer selbst in großen Teilen des Bankgewerbes eindeutig als overdressed einzustufen. Unter anderem deshalb nahm sich Moira Zeit, die Männergruppe sehr genau zu betrachten, während der Direktor und Shannon den Trupp in geschäftsfreudiger Erwartung anstrahlten.
Dreizehn außergewöhnlich groß gewachsene und gespenstisch ähnlich aussehende Anzugträger, zu allem Überfluss in einer Art modernen Kampfformation. Vier Reihen mit jeweils drei Mann und der Ober-Banker vorneweg. Der Tag wurde offensichtlich – wenn schon vielleicht nicht schön – doch noch interessant. Besonders weil einer von ihnen derart aus dem Rahmen fiel.
Der gertenschlanke, junge Mann in der Mitte der ersten Reihe hatte weißblondes Haar, das von seinen Schultern floss und bis zu seinen Hüftknochen reichte. Er sah märchenhaft schön aus, wie aus einem Kinderbuch oder einem Kinofilm. Das war definitiv kein Banker.
Minetti ging unbeirrt auf den Trupp zu, was ihren Puls noch mehr in die Höhe trieb. Sie wagte nicht einmal, zu blinzeln.
»Herzlich willkommen, meine Herren. Was können wir–«
Der Anführer hob eine Hand. »Schweig, Mensch.«
»Mensch?«
Das war wohl ein Scherz. Leider kein witziger.
Minetti war wie angewurzelt stehengeblieben. Moira krallte ihre Finger in die Marmorplatte vor ihrem Brustkorb und starrte auf ihre weiß gewordenen Fingerknöchel. Warum beunruhigte sie diese Situation so? Da stand eine Gruppe Freaks vor ihr, Zeit für den Notrufknopf! Sie sah die Gruppe noch einmal genau an, Mann für Mann. Versteckte Kamera? Eine Wette unter Schauspielern? Die Möglichkeiten waren – Freaks sei dank – leider fast endlos heutzutage. Dann sah sie zur Tischkante direkt vor sich, unter der der feuerrote Lebensretter ihres Berufsstandes platziert war. Aber den Notruf umsonst zu betätigen und Hilfe antanzen zu lassen kostete 500 Pfund Strafe – und Minetti würde ihr das Geld ohne Zweifel vom Lohn abziehen.
»Moira, Menschenkind aus Gunnislake, komm herüber zu uns«, sagte der Anführer jetzt. Moira riss den Blick nach oben. Seine Stimme hallte von den Wänden wieder, obwohl er bemüht schien, vertrauenswürdig zu klingen. Sämtliche Augen waren auf sie gerichtet. Selbst der Direktor und Shannon, die immer noch mitten im Raum standen, sahen zu ihr hinüber, vorsichtig und hilfesuchend.
Moira trat betont gefasst um die Schalter herum. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit. Angst schnürte ihr bei jedem Schritt weiter die Kehle zu, aber sie wollte keinesfalls Schwäche zeigen. Ihr Name bedeutete schließlich Schicksal. Und sie würde ihres jetzt entgegennehmen – egal ob 15-minütigen TV-Ruhm oder Banküberfall. Und zu tun, was diese Männer verlangten, würde sich in jedem Fall für sie auszahlen. Wenn sie bewaffnet waren, sogar in Form ihres Lebens.
Der Anführer war offensichtlich entzückt von ihrer Darbietung. Er grinste seine Leute selbstgefällig an und erhob erneut die Stimme – diesmal jedoch seltsam feierlich. »Meine jungen Freunde, diese junge Frau ist vom Schicksal auserkoren worden. Sie wird unserem Volk den Krieger schenken, dessen Ankunft wir Elfen schon seit Jahrhunderten so sehnsüchtig erwarten.«
Elfen. Der Anführer hatte tatsächlich ausgesprochen, was Moira über den Blonden dachte. Sie durchbohrte den spitzohrigen Mann mit ihrem Blick, aber dieser hielt seine Augen beinahe stur auf ihren Kollegen. Sie war sich absolut sicher, dass er wusste, was gleich geschehen würde, während sie im Dunkeln tappte.
Der Anführer trieb sein kleines Spielchen weiter und funkelte sie aus seinen kalten Augen an. »Elhin–«
Der Blonde reagierte und seine Augen trafen Moiras. Mittlerweile war sie in einigem Abstand zum Anführer stehen geblieben. Keiner der Männer bewegte sich einen Millimeter oder blinzelte auch nur. Dann erschien ein widerliches, hungriges Grinsen auf dem kantigen Gesicht des Ober-Bankers. »–sie ist dein.«
Moiras Knie wurden weich. Mehr erlaubte sie sich nicht. Sie starrte den Anführer nur weiter fassungslos an. Das hier konnte einfach nicht real sein!
Der Blonde kam vorsichtig auf sie zu. Er trug keinen Anzug wie die anderen. Er trug schwarze Leinenkleidung und einen mittelalterlichen schwarzen Wollmantel. Und diese Ohren. Sie musste halluzinieren, ganz sicher.
Die widerliche Selbstgefälligkeit in der Stimme des Generals brachte Elhin zur Weißglut. Die beiden zusammengekauerten Menschen würden sich an nichts erinnern, diese Inszenierung war nur für seine Untergebenen – und für Moira.
»Dieser verdammte Sadist!«
Elhin schob seine Gedanken gewaltsam beiseite, brach die Formation und warf dann einen mitleidigen Blick auf Shannon und den Bankdirektor. »Alles wird gut«, sagte er schnell. »Ich möchte, dass Sie sich entspannen. Ihnen wird nichts geschehen.« Er signalisierte einem der anderen Krieger, zu den verängstigten Menschen hinüber zu gehen. Er selbst legte seinen Blick wieder auf Moira, die keine zwei Meter vor ihm stand und völlig erstarrt das Geschehen verfolgte. Der etwas jüngere Krieger hatte sich direkt hinter Shannon und Minetti gestellt und sah erst Elhin, dann den General an. Als Letzterer endlich mürrisch nickte, ging er in die Hocke und berührte die beiden Menschen an den Schultern. Keine zwei Sekunden später sanken die beiden Körper bewusstlos zu Boden.
Genau in diesem Moment brach etwas in Moira. Sie begann zu schluchzen. Nun schien sie zu begreifen, was sie vor sich sah, auch wenn Elhin sehr gehofft hatte, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Er verschloss noch einmal seine Gedanken und Gefühle tief in seinem Innersten und wandte sich zu ihr um. Er wusste, dieser Anblick würde ihn den Rest seines Lebens in seine Träume verfolgen: Moiras schönes Gesicht, von Angst verzerrt, tränenüberströmt. »Es tut mir leid«, flüsterte er.
Panisch riss sie die Arme hoch. Drehte sich herum und versuchte, wegzurennen. Aber Elhin griff so schnell ihre Handgelenke, dass ihr Kampf vorbei war, ehe er angefangen hatte. Er zog sie zu sich und legte sein Gesicht an ihren schneeweißen Hals. »Schhh, Moira.«
Der Laut bahnte sich wie kühles Wasser durch Moiras Gedanken und wusch all die Angst hinfort, die eben noch ihr Herz umklammert hatte. Ein leises Echo ihrer Gedanken erfasste seinen Geist. Ein Teil war schockiert. Wollte sich verzweifelt wehren. Schreien und um sich schlagen, aber ihre Arme und Beine gehorchten ihr nicht mehr. Seine Magie war stärker. Sie schloss die Augen und entkrampfte ihre Muskeln. Nach und nach verschwand auch der letzte Rest des vertrauten Hintergrundrauschens in ihrem Kopf. Sie ließ die Arme sinken, und Elhin ließ es zu.
»Du wirst ein großes Opfer für mein Volk bringen. Wir stehen schon jetzt ewig in deiner Schuld«, flüsterte er gegen ihren Hals – obwohl er wusste, dass sie ihn wahrscheinlich schon nicht mehr hören konnte. Seine Stimme klang rau und gebrochen und er glaubte, genau in diesem Moment, angelehnt an ihre warme, weiche Haut, verrückt zu werden. Doch das würde er nicht zulassen, um ihretwillen.
Elhin atmete tief ein und legte eine Hand seitlich an ihren Kopf. Auf keinen Fall sollte sie mehr von den nächsten Minuten miterleben müssen als unbedingt notwendig. Als ihre Beine nachgaben, hielt er ihren Körper fest umklammert, trug sie um ihren Schalter herum und legte sie dann sanft auf dem Boden dahinter ab. Von jetzt an würde sie unter Eid beschwören, dass dieser Tag nie stattgefunden hatte. Sein Gewissen konnte das nicht erleichtern.
Er gab seinen Kameraden das Zeichen, vor der Tür zu warten, und zückte blitzschnell seinen kleinen Dolch. Ihre feine Stoffhose leistete seiner Klinge keinen Widerstand. Unter dem unerträglichen Lärm einer Schandtat schnitt er beide Hosenbeine der Länge nach auf, bis hoch zum Bund. Zum Vorschein kamen ein schwarzer Baumwoll-Slip und eine Unregelmäßigkeit auf der schneeweißen Haut, die man für ein simples Muttermal hätte halten können – und die für Menschen gänzlich unsichtbar war. Da war es also: das Drachenmal. Dieser unscheinbare, kleine Fleck direkt über dem rechten Hüftknochen hatte Moiras wunderbar durchschnittliches Leben zunichtegemacht und sie in die Welt der Elfen gezerrt. Und sie beide würden nun einen hohen Preis dafür bezahlen. Elhin zog die Hose unter ihr hervor und warf sie dem General direkt an den Brustkorb. Der verstaute den Stoff-Fetzen sanft pfeifend, obwohl er sich sonst die Hände nicht an menschlichen Gegenständen schmutzig machte. Dann begann er, in der Bank hin und her zu streifen und die Werbeplakate und Aufsteller zu betrachten. Seine Aufmerksamkeit, so wurde Elhin schnell klar, blieb allerdings voll und ganz, wo sie gewesen war. Bei ihr.
Elhin wandte sich wieder Moira zu. Er hatte es unbedingt vermeiden wollen, ihr ins Gesicht zu sehen. Aber er musste wissen, ob sie in dem Traum angekommen war, den er gesponnen hatte. Das Echo ihrer Traumbilder war sogar in seinem Zustand leicht aufzufangen und ihre Lippen umspielte der leichteste Anflug eines Lächelns. Einzig die Gewissheit, dass sie weit entfernt vom Hier und Jetzt war, ließ ihn seinen Blick auf ihren Körper senken. Der schwarze Baumwoll-Slip war genau die Art Unterwäsche, die eine Frau trug, wenn außer ihr keiner diese Sachen zu Gesicht bekam. Er wünschte sich sehnlichst, diese Rechnung wäre aufgegangen. Aber der Anblick ihrer schönen Beine, der unmenschlich zarte Duft ihrer Haut und die Andeutung ihres Venushügels, der sich durch den Slip abzeichnete, verursachte noch etwas anderes in ihm. Auch der Slip war blitzschnell an den Seiten durchschnitten.
Als hätte der General auf dieses Signal gewartet, drehte er sich zur Türe und verschwand federnden Schrittes nach draußen.
Moira öffnete die Augen. Sie befand sich plötzlich weit weg von Gunnislake auf einer Wiese, die ebenso sorglos blühte wie ihre vorbeiziehenden Gedanken. Es war unwichtig, wie sie hier her gekommen war, schließlich musste sie Zuhause im Bett liegen und träumen.
Sie blinzelte in die Sommersonne, vorbei an Davids Kopf. Dieser kniete über ihr und war vollauf damit beschäftigt, seinen Blick immer wieder zwischen ihrem Gesicht und ihrem Sommerkleid schweifen zu lassen. Ab und an steckte er lächelnd einige Strähnen hinter ihr rechtes Ohr, die der spielerische Wind immer wieder von dort hervorholte.
»So sollte jeder Tag meines Lebens sein«, sagte sie seufzend. »Einfach hier liegen, mit dem Menschen, für den ich am meisten empfinde.«
»Hm, und wie viel ist das genau?«, fragte David frech.
»Ich würde sagen, es reicht in jedem Fall hierfür.« Sie zog ihn zu sich herunter und küsste ihn lang. Als seine Zungenspitze ihre Lippen streifte, spielten die Schmetterlinge in ihrem Bauch verrückt.
»Oh, na dann reicht deine Zuneigung bestimmt auch hierfür.« Er rutschte etwas nach unten und seine Hand glitt unter ihr Kleid. Moira stöhnte auf. Sie krallte sich in Davids Schultern und hob ihm ihr Becken entgegen.
»Das hier ist perfekt«, hörte sie sich denken. »Einfach perfekt.«
Als Beide etliche Minuten später erschöpft ins weiche Gras sanken, küsste David sie lang und zärtlich. »Ich liebe dich. Bitte vergiss das niemals, M.« Dann löste er sich in Luft auf und Moira glitt hinüber in einen tiefen, traumlosen Schlaf.
Als Elhin sich von dem kratzigen, grauen Teppichboden der Bankfiliale erhoben und seine Kleidung in Ordnung gebracht hatte, zog er unter seinem Umhang eine hauchfeine, elfenbeinfarbene Decke hervor, die an den Rändern kunstvoll mit Efeuranken bestickt war. Er breitete sie über Moira aus und wickelte sie gewissenhaft darin ein. Dann hob er sie auf seine Arme.
Der General kam mit einigen schnellen Schritten auf Elhin und seine lebendige Last zu und sah ein überaus bekanntes Bild: das Gesicht eines innerlich toten Elfen. Doch er würde diese Tatsache nicht seinen ursprünglichen Plan durchkreuzen lassen. Ebenso wenig wie er dem seltsamen Drang nachgeben würde, die Auserwählte in seinen eigenen Armen auf die Ebene zu bringen.
»Bring das Menschlein nun zum Kloster, die Priesterinnen werden sich um sie kümmern«, befahl er im Gehen. »Und dann werden wir vor den Seherinnen bezeugen, dass dem Schicksal Genüge getan wurde.«
»Nein, Herr.«
Der General versteifte sich und drehte sich wieder zu seinem Untergebenen um. »Würdest du das wiederholen, Krieger?«, grollte er.
»Nein, Herr«, knurrte Elhin jetzt lauter. »Ich bringe die Menschenfrau erst nach Hause. Ich werde ihr den Sachverhalt erklären, wenn sie in einigen Stunden aufgewacht ist und sich auf vertrautem Terrain befindet. Ich bringe sie dann hinüber, so schnell es die Lage zulässt. Ich denke, in einigen Tagen kann ich sie überzeugen, sich uns anzuschließen. Ich komme in wenigen Augenblicken nach und erstatte Bericht.« Er sah in das Gesicht seiner schlafenden Liebsten und fürchtete die Minuten, die er gleich mit ihr verbringen würde. Und die Unendlichkeit, die er mit dem Wissen und der Schuld des heutigen Tages verbringen musste.
Der General riss ihn aus seinen Gedanken. »Du Narr. Du kannst ihr Schicksal nicht leichter machen, als es ist. Aber die Seherinnen behalten wohl Recht, wie üblich. Sie hatten mich bereits gewarnt, dass du Zeit schinden würdest. Also gut, dann sei es so. Aber ganz so einfach kommst du mir nicht davon. Du bleibst bei ihr und beschützt sie mit deinem Leben, verstanden?«, befahl er zischend. »Glaubst du, wir lassen dieses wertvolle Weib aus den Augen? Die Seherinnen haben in dein Herz geblickt und die günstige Gelegenheit entdeckt, die deine Liebe zu dieser Frau ist. Sie ist jetzt deine Verantwortung. Bis das Kind da ist. Das wolltest du doch, nicht wahr? Bewache sie. Erkläre ihr vorerst nur, was sie unbedingt wissen muss. Und dann bring sie zu uns, wenn du Gewissheit hast, dass sie empfangen hat. Wie du das anstellst, ist mir gleich.« Er warf einen gleichgültigen Blick auf Minetti und Shannon und versicherte sich, dass die beiden kein Problem darstellen würden. Dann blickte er zu den restlichen Kriegern, gab ihnen das Zeichen für den Aufbruch und konzentrierte sich. Im nächsten Moment lösten sich die Umrisse des Generals auf und das restliche Bataillon tat es ihm gleich.
Elhin sah sich kurz in der Bank um und setzte sich in Bewegung. Tausend Gedanken drängten an die Oberfläche seines Geistes, aber er zwang sie zurück in die Tiefen. In ihm hatte das Programm übernommen, das jeder Krieger in Stress-Situationen nur zu gut kannte: Im Moment gab es nur Handeln. Kein Denken, kein Innehalten. Aber die Worte des Generals hallten in seinem Kopf unerbittlich wieder. »Das wolltest du doch, oder? Die günstige Gelegenheit nutzen. «
Die Denkweise, die diesen Worten zugrunde lag, ließ Elhin vor Zorn beinahe würgen. Er löschte den gesamten bisherigen Tag mit einigen schnellen Worten nochmals aus Moiras Gedächtnis, um ganz sicher zu gehen. Dann warf er einen Blick auf ihren Schreibtisch und fand sofort, was er suchte. In dem Moment, in dem er ihre Handtasche geangelt hatte, verschwand er.
Kapitel 5
Glücklicherweise hatte er Moira nach ihrem Abendessen letzten Freitag in seiner maskierten Form bis vor die Türe ihres kleinen Reihenhauses bringen dürfen. Genau dorthin wünschte er sich jetzt, in diese kleine Straße einige hundert Meter von Gunnislakes Dorfzentrum entfernt. Er materialisierte sich direkt hinter ihrer Haustüre und dankte seinen Ahnen einmal mehr für die zahlreichen Kleinigkeiten, die sein Leben erträglicher machten – wie zum Beispiel die Tatsache, niemals einen Schlüssel bemühen zu müssen. Er trug Moira die Treppe hinauf, machte ihr Schlafzimmer ausfindig und legte sie auf ihrem Doppelbett ab. Dann hob er ihr Bewusstsein aus dem Sommertraum und überließ sie ihrem normalen, tiefen Menschenschlaf. Er arrangierte ihren Kopf auf ihren Kissen und stellte sicher, dass sie es unter allen greifbaren Decken warm und bequem hatte. Als er abermals für eine Sekunde ihren Träumen lauschte, war er sicher, dass sie bis zum Morgen nicht aufwachen würde. Mit dieser Gewissheit verschwand er in das kleine Badezimmer direkt nebenan, um zu duschen und zu sich zu kommen. Er entkleidete sich hastig, zog die Schiebetüren der Dusche auf und stieg unter den warmen Wasserstrahl, immer eines seiner spitzen Ohren Richtung Schlafzimmer. Aber alles blieb ruhig. Viele Minuten später, als Elhins Haare komplett durchnässt waren, senkte er den Kopf und ließ das Wasser seine Ohren entlang rauschen. Diesen einen Moment Unachtsamkeit gönnte er sich. Sein Magen fühlte sich an, als hätte er einen heißen Klumpen Teer verschluckt. Er verabscheute sich selbst in diesem Moment brennend. Nur der Hass auf seine Befehlshaber war noch größer.
»Das wolltest du doch, oder?« Dieses Mal ließen ihn die Worte tatsächlich würgen und er lenkte seine Gedanken schnell in eine andere Richtung. Wie sollte er ihr nur alles erklären? Noch dazu in der kurzen Zeit, in der ein Drachenkind heranreifte? Schon in wenigen Tagen würde er sie auf die Ebene der Elfen bringen müssen, wenn alles verlief, wie die Seherinnen es prophezeiten. Ihr bisheriges Leben war endgültig Vergangenheit, sollte sie tatsächlich empfangen haben. Aber wie überredete man eine Frau, ihre Existenz für eine Prophezeiung aus einer anderen Welt hinter sich zu lassen?
Elhin atmete tief durch, hob den Kopf wieder und wandte sich in Richtung Badezimmertür. Entsetzt erstarrte er. Moira stand mit einem dünnen schwarzen Morgenmantel bekleidet in der Tür, hatte den ganzen Oberkörper panisch verkrampft und deutete mit etwas auf ihn.
»Oh, ein Messer.«
Es war bereits zu spät für ein Tarnmanöver, also blieb Elhin einfach, wer und wo er war und sagte nichts. Sein Gehirn gab ohnehin keinerlei Idee preis, wie er das jetzt erklären sollte. Also stellte er lediglich das Wasser ab, mit einem ganz langsamen Griff hinter seinen Rücken. »Moira?«, fragte er dann sehr vorsichtig. Der wahnsinnige Blick auf ihrem Gesicht wich einem Funken Verwunderung.
»Wer bist du?«, fragte sie laut. »Was hast du hier zu suchen? Habe ich dich nicht irgendwo schon einmal gesehen? Und warum zur Hölle bist du in meiner Dusche?!«
»Gute Fragen, ehrlich«, bemerkte sein Geist spitz. Das musste man ihr lassen: Sie hatte eine einwandfreie Panik-Reaktionskette. Im Grunde war es traurig, dass Kriegern das so gut gefiel. Offensichtlich hatte sein Geist sich erbarmt, diesem Trauerspiel beizuwohnen, denn er zwang sich, einmal tief ein- und auszuatmen.
»Also erstens«, begann er ruhig und sachlich. »Wenn du mich umbringen willst, wirst du ein größeres Messer brauchen.«
Stille.
»Darf ich aus der Dusche kommen? Oder siehst du gerne tropfnasse Männern an?«
»Zuerst will ich deinen Namen wissen, dann sehen wir weiter«, zischte Moira.
»Gut, gut. Mein Name ist Elhin«, sagte er schnell. Er nahm bedächtig ein Handtuch von der Duschwand und schlang es sich um die Hüften. »Mein Volk hat leider keine Nachnamen, deshalb wird dir das als Antwort genügen müssen«, fuhr er fort. »Könntest du bitte dieses Messer weglegen? Ich bin hier, um dich zu beschützen.«
Moira ließ das Messer sinken. Dieser Kerl war eindeutig verrückt. War er ernsthaft bei ihr eingebrochen, nur um bei ihr zu duschen? Er holte sein triefend nasses Haar über seine Schulter nach vorn, um es notdürftig auszuwringen und entblößte dabei ein verdammt langes, spitzes Ohr.
»Das ist der Typ von vorhin«, dachte Moira. Jetzt wollte sie wirklich dringend wissen, was passiert war. »Ich bin mir nicht sicher, woher ich das weiß, aber dich hat vorhin jemand als Elf bezeichnet, oder?« Der Mann in ihrer Dusche sah aus, als würde er vor Schock gleich einen Herzinfarkt kriegen, aber sie ignorierte seine Reaktion tapfer. »Habt ihr mir K.O.-Tropfen verabreicht?«, keifte sie. »Haltet ihr mich für blöde? Ich werde jetzt die Polizei rufen. Und du kommst mit zum Telefon, damit ich dich im Auge behalten kann.«
Er hob die Augenbrauen. »Menschen«, entgegnete er trocken. »Ich werde nie verstehen, wie ihr so viel auf die Polizei geben könnt. Ich mache dir einen besseren Vorschlag: Ich könnte auf der Stelle verschwinden und dich hier verwirrt zurücklassen. Oder ich erkläre dir ganz in Ruhe, in was du... wir hinein geraten sind. Klingt das nicht eindeutig besser? Du hast die Wahl.«
Langsam wurde es wirklich peinlich. Triefend wie ein nasser Hund stand er vor der Frau, die er liebte, und versuchte zu verhandeln. Und das auch noch splitterfasernackt bis auf ein lausiges Handtuch. Vielleicht sollte er ihre Antwort gar nicht erst abwarten und sich sofort aus dem Staub machen.
Moira unterbrach den letzten Gedanken. »Ich nehme die Erklärung. Ich weiß zwar immer noch nicht, wer oder was du genau bist, aber ich weiß, dass ich dich ganz bestimmt nicht hereingebeten habe. Ich wüsste also wirklich gerne, was hier gespielt wird.«
»Aber erst nach einer Kopfschmerztablette und einem ganzen Eimer Wasser«, fügte ihr Kopf hinzu. Sie wandte sich um, stapfte den Flur entlang und schließlich die Treppe hinunter in die Küche. Selbst wenn ihr ungebetener Gast sie doch von hinten überraschte und tötete – das war besser als eine einzige weitere Minute mit diesen Kopfschmerzen zu leben. Den Blondschopf mit den ellenlangen Haaren ließ sie tropfend in der Dusche zurück.
Aspirintabletten hatten etwas seltsam Fröhliches an sich, wenn sie in einem Glas Wasser vor sich hin sprudelten. Vielleicht kaufte Moira deshalb nur Brausetabletten. Sie nahm einen Teelöffel mit langem Stiel aus der Schublade und rührte einige Male um. Sie hatte das ganze Haus hell erleuchtet, jede einzelne Lampe war an. Aber sie wusste, dass ihr das im Zweifel auch nicht helfen würde. Trotzdem blieb sie ruhig. Elhin – was war das überhaupt für ein Name? – hatte zweifellos schon zweihundert Gelegenheiten gehabt, sie zu töten oder zu überwältigen. Alleine in der Zeit, in der sie wach gewesen war. Darauf war er also wohl tatsächlich nicht aus.
Der letzte Rest der Tablette hatte sich gerade aufgelöst, als Moira Schritte jenseits der Küchentür hörte. Ihr Blick schnellte nach oben. Ihr ungebetener Besucher trug wieder die gleiche altmodische Kleidung wie vorhin in der Bank. Schwarze Leinenhose, langes Leinenhemd und Ledergürtel.
»Verrückt.«
Bei dem letzten Wort schüttelte Moira unweigerlich den Kopf.
Elhin blieb stehen und sah an sich hinunter. Die Haare waren schon wieder halb getrocknet und achtlos irgendwie geflochten. »Ich kann den Kram auch wieder ausziehen, wenn er dir so missfällt«, murmelte er.
»Danke, für heute habe ich weiß Gott genug gesehen«, konterte Moira entnervt. Sie trank das ganze Glas in einem Zug leer, massierte kurz ihre Schläfen und hoffte, ihr Kopf würde sich schnell wieder einkriegen.
»Das mit dem Kopfweh tut mir leid. Das ist ein sehr unangenehmer Nebeneffekt meiner Fähigkeiten.« Plötzlich klang er leise, fast kleinlaut und gar nicht mehr so locker. Moira versuchte krampfhaft, alles zusammenzufügen. Fähigkeiten. Spitze Ohren. Mittelalter-Outfit. All die verlorene Zeit. Himmel, es war schon dunkel. Eben war sie doch noch bei der Arbeit gewesen. Und dann? Nichts. Totaler Filmriss. War sie überhaupt selbst nach Hause gelaufen? Oder hatte er sie hierher gebracht? Sie war heute Morgen aufgestanden und zur Arbeit gegangen, ganz sicher. Und dann?
»Dann war er aufgetaucht. Und dann?!«
»Ich sollte dir fairerweise sagen, dass ich dir bei deinen Gedankengängen zuhören kann, Moira«, knirschte er. »Und ich kann aus all diesen Bruchstücken ein Ganzes machen, wenn du mich lässt.«
Wortlos ging sie um ihre Küchenzeile und ihren ungebetenen Gast herum und setzte sich auf die Sofalehne im Wohnzimmer. Ihr Blick erledigte den Rest.
Seufzend ging Elhin etwa einen Meter vor der Couch in die Knie und setzte sich dann im Schneidersitz auf den Teppich. Das war schlicht die am wenigsten bedrohliche Körperhaltung, die ihm gerade einfiel. Außerdem waren seiner Erfahrung nach selbst Menschen einigermaßen empfänglich für Gesten der Deeskalation. Er hatte allerdings nicht die geringste Ahnung, warum sie sich an einige Details zu erinnern schien, während der Großteil gnädigerweise vergraben blieb. Aber wenigstens das Nötigste musste er ihr jetzt beibringen.
»Ich bin ein Elf, Moira«, erklärte er leise. »Das wusstest du schon, als ich vorhin in eure Bank kam. Und egal, ob du es in diesem Moment glauben willst oder nicht, es ist und bleibt die Wahrheit. Wir wohnen nicht unter Menschen, deshalb-«
»Beweis es mir.«
Er blinzelte sie an. »Wie bitte?«
»Beweise mir das. Es kann schließlich jeder bei mir einbrechen, unter meine Dusche steigen und dann behaupten, er wäre ein Fabelwesen.«
Diese Frau war wirklich nicht zu fassen. Noch vor neunzig Jahren hatte jede Menschenfrau sofort freudig sein Haar oder seine Ohren berührt, wenn er sich zu erkennen gegeben hatte. Das brachte einem alten menschlichen Aberglauben zufolge Glück und Fruchtbarkeit. »Verdammte Ironie«, meldete sein Kopf.
»Ich bin kein Fabelwesen. Ich bin ein Elf. E-L-F. Klar?«
»Na gut, okay. Zeig mir trotzdem etwas, damit ich es glaube.«
Elhin zeigte auf seine Ohrmuscheln. Ihr Gespräch nahm eine wirklich tragische Wendung, im ursprünglichen Sinne des Wortes. »Du meinst abgesehen von denen hier?«
»Jepp.«
Er schwieg einen Moment. Kunststücke hatte er nicht mehr für Menschenmädchen vorgeführt, seit er etwa hundert Jahre alt gewesen war. Trotzdem musste er zugeben, dass Moira sich für eine Frau des 21. Jahrhunderts tapfer hielt. Dafür bewunderte er sie sehr. »Na schön«, seufzte er. »Gib mir bitte deine Hand.«
»Wozu?«
»Um dir einen Beweis zu liefern.«
Wortlos reichte sie ihm die Hand. Er umschloss sie mit seinen großen warmen Händen und musste sich zwingen, sich nicht völlig in ihrem Geruch zu verlieren. Dann richtete er den Blick lange auf den Boden und hatte bald genug Informationsfetzen aus ihrem Geist gesammelt, um dieses kleine Spiel hoffentlich zu beenden. »Deine Lieblingsfarbe ist dunkelblau. Deine Mutter heißt Jenny Wright.«
Moira hob die Brauen und verschob ihren Unterkiefer zur Seite.
»Verdammtes Google-Zeitalter!«, fluchte Elhin wortlos. So hatte er sich ihr erstes Aufeinandertreffen ohne seine menschliche Maske nicht ausgemalt. Er setzte nach. »Mit 14 Jahren hast du den letzten Eintrag in dein geheimes Tagebuch mit dem rosa Schlösschen gemacht. Danach fandest du dich zu erwachsen für so ein kindisches Verhalten. Du hast es unter einigen großen Weiden verbrannt – und das bereust du noch heute. Du hast keinem lebendigen Wesen jemals von diesem Tagebuch erzählt. Und mal abgesehen von den Bäumen, die damals Zeuge waren, und die ihr Menschen so gern für seelenloses Grün haltet, weiß auch kein Lebewesen davon.«
Es entstand eine Pause, in der Moiras Gedanken wie in einer Art Gewitter so schnell dahin rasten, dass Elhin unmöglich weiter zuhören konnte. Noch dazu verursachte es Schwindel und ziehende Kopfschmerzen direkt hinter den Augen. Frustriert ließ er den Kopf hängen und gab sich ebenfalls kurz seinen Gedanken hin. Warum konnte sie sich an ihn erinnern? Und warum sprach sie so schlecht auf seine Gedankenkünste an? Es war seltsam: Er kannte sie zwar erst einige Wochen, aber er hörte bereits immer schlechter, was in ihrem Kopf vorging. Es war direkt unnatürlich, wie schnell der Effekt mit ihr auftrat. Sicher, er war schockiert gewesen, als er das erste Mal ihr Gedanken-Echo aufgefangen hatte. Direkt normal war es schließlich nicht für seine Rasse, die Gedanken einer geliebten Person lesen zu können. Und wenn die scheinbar zufällig auftretenden Fähigkeiten anderer verliebter Elfen ein Anhaltspunkt waren, dann würde er noch eine ganze Weile erahnen können, was in ihrem Kopf vorging. Irgendwann würde sich der Effekt dann verlieren. Aber dafür würde er sich mehr und mehr ihre Gefühlslage ins Bewusstsein rufen können – egal wo sie sich gerade befand. Und dieses Band würde jeden Tag stärker werden, nicht schwächer. Wenn nicht auch dieses Naturgesetz seiner Welt ihn im Stich ließ. Wenn sie ihn auch lieben lernte. Wenn sie ihm seine Tat vergeben konnte. Wenn das Drachenkind und sie heil auf der anderen Seite dieses Albtraumes hervorgehen würden. Wenn. Tränen stiegen in seine Augen bei den Gedanken an Moiras Zukunft. Eine Zukunft, in die er sie gestoßen hatte und vor der sie nicht hatte davonlaufen können. Er hasste die Seherinnen dafür brennend. Eines Tages würde er kurzen Prozess mit ihnen machen, für all das Leid, das ihre Prophezeiungen mit sich brachten. Eines Tages würde er-
Elhin zuckte zusammen, als Moira mit den Fingerspitzen seine Schulter berührte. Sein Kopf schnellte nach oben und er erinnerte sich, dass er noch immer vor ihr auf dem Boden saß. Sie sah besorgt und traurig aus. Schnell zog sie die Hand zurück, aber die Angst hatte definitiv nachgelassen. Ob sie ihm jetzt endlich Glauben schenkte? Selbst sie schien diese Episode aus ihrer Kindheit vergessen zu haben.
»Okay, ich glaube dir«, murmelte sie endlich.