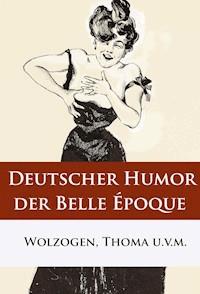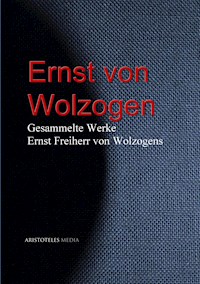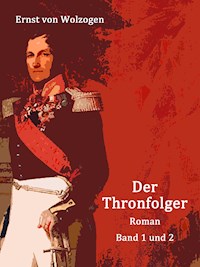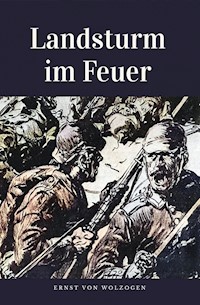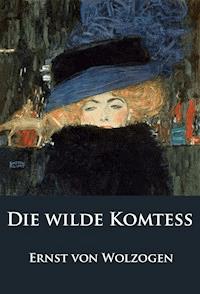0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: aristoteles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Arnulf Rau, ein Protagonist des auf die Emanzipationsbewegung des 19. Jahrhunderts eingehenden Romans, beschreibt das dritte Geschlecht als Frauenexistenzen, welche aus natürlicher Veranlagung oder unter dem Druck der Verhältnisse dazu gelangen, sich nicht mehr als Geschlechtswesen mit engumschriebenen Pflichten und Gerechtsamen, sondern einfach als Mitmenschen zu empfinden. Es hat ja immer zahlreiche Frauen gegeben, die auf die Erfüllung ihrer besonderen weiblichen Bestimmung verzichten mussten und denen dieser Verzicht auch nicht schwer wurde, weil weder das sinnliche Bedürfnis noch der mütterliche Instinkt besonders scharf bei ihnen ausgebildet war. Diese Neutra von Natur mussten sich aber in früheren Zeiten in das Schema des Frauendaseins einfügen, weil Gesetz und Sitte ihnen die Teilnahme an allen für Reservatrecht der Männlichkeit gehaltenen geistigen und physischen Kraftbetätigungen verboten. Sie huschten wie graue Motten unbeachtet durchs Dasein und auf ihrem Grabstein war nur zu lesen, dass sie Tanten gewesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Ernst von Wolzogen
Das dritte Geschlecht
Roman
Abschnitt 1
» Mach doch das Buch zu, Claire! – Das geht entschieden nicht so weiter. Ich muss Dich ernstlich bitten – heirate mich!«
Also sprach der Privatdozent Doktor Josef Reithmeyer, wohnhaft zu München in der Blütenstrasse in einem Rückgebäude über eine Stiege, zu seiner schönen Freundin Claire de Fries, in Zürich, gebürtig aus Groningen in Friesland, Studentin der Medizin derzeit zu Besuch in der Blütenstrasse im Rückgebäude über eine Stiege.
Das nicht eben grosse Studierzimmer Doktor Reithmeyers war zur Hälfte in hellen Sommersonnenschein getaucht und die beleuchteten Staubteilchen verschlangen sich mit den langsam ziehenden zartblauen Cigarettenrauchwolken zu seltsam fantastischen Mustern in dem breiten Lichtbande, das die noch nicht gar hoch stehende Sonne vom Fenster aus quer durch das Zimmer zog. Die andere Hälfte des behaglichen Raumes lag im Schatten. Eine Glasthür führte hier auf das Dach eines Holzschuppens hinaus, und über diesem Dach hatte sich der Herr Doktor ein Leinwandszelt errichten lassen, dessen Seitenteile zum Ziehen eingerichtet waren, sodass man zu jeder Tageszeit die Sonne aussperren konnte. Der Frühstückstisch stand noch unabgeräumt unter diesem Dachzelt und eine kleine Spatzenschaar balgte sich lärmend um die Brotkrumen auf dem Boden und auf dem bunten Tischtuch herum. Das Spatzengezänk, das eifrige Hämmern aus der Schusterwerkstatt im Erdgeschoss und das lustige Geschrei spielender Kinder aus einem entfernteren Hofraume schufen, mit dem massig gedämpften Strassengeräusch verquickt, eine friedliche Morgensymphonie.
In der Studierstube aber war es ganz still. Das schöne Fräulein de Fries hatte ihr dickes Lehrbuch der Pathologie zugeklappt, sich auf der schwellenden Ottomane lang ausgestreckt und die Hände unter dem dunkelblonden Lockenkopf verschränkt. Sie nagte mit den etwas grossen, weissen Zähnen nachdenklich an ihren vollen Lippen herum und starrte zu den langweiligen Obstguirlanden des Plafonds hinauf, ohne ein Wort zu reden.
Doktor Reithmeyer wartete wohl fünf Minuten lang. Er stand an seinen Schreibtisch gelehnt, zwischen der Glasthür und dem Fenster, rauchte seine Cigarette und betrachtete seine wohlgepflegten Fingernägel. Endlich wurde er ungeduldig, warf den Rest seiner Papyros in den Aschbecher, fuhr sich mit den weissen, schlanken Fingern durch den glänzend schwarzen Bart und sagte: »Nun? – Ich dächte, die Idee könnte Dir doch nicht so ganz unerwartet kommen. Du musst doch schon gelegentlich darüber nachgedacht haben. Wir leben doch schon über zwei Jahre so gut wie verheiratet – ich glaube, ich darf sagen: besser als verheiratet. Also begehen wir doch wahrhaftig keinen leichtsinnigen Streich, wenn wir unser Verhältnis gesetzlich festlegen.«
»Aber Seppl, es ist doch so viel schöner,« versetzte Fräulein de Fries im ruhigsten Ton von der Welt, ohne ihre behagliche Lage zu ändern. »Ausserdem ist's wider die Abrede. Wir sind freie Menschen.«
»Du wohl,« sagte Doktor Reithmeyer, indem er seinen Platz verliess und ein paar Schritte nach der Ottomane hin machte. »Du wohl – aber auch nur vorläufig. Wenn Du Deine Praxis als Arzt ausüben willst, bist Du auch nicht mehr frei und ich bin es schon jetzt nimmer. Also, ich will Dir was sagen, liebe Claire, die Sache ist einfach die: Ich stehe jetzt dicht vor der Professur. Ich habe gestern erst mit Professor Brenninger gesprochen; die Vakanz ist da und ich werde bestimmt vorgeschlagen; aber natürlich wird alles unmöglich, wenn ich fortfahre öffentliches Aergernis zu geben.«
Fräulein de Fries nahm ihre Hände unter dem Kopf hervor, faltete sie in ihrem Schoss über dem Deckel der Pathologie und lachte ganz behaglich.
Der Doktor wurde ärgerlich und sagte etwas gereizt: »Ach, Dir kommt die Sache komisch vor! Liebes Kind, solche Prinzipienreiterei ist doch wirklich eine etwas blöde Belustigung, wo es sich um das Lebensglück zweier Menschen handelt, die sich lieb haben und für einander geschaffen sind. Hast Du etwa schon genug von mir, dann sage es ehrlich; wenn aber nicht, warum willst Du mich dann um Stellung, Ansehen und alle Zukunftsaussichten bringen? Es wäre wirklich nicht hübsch von Dir, nach allem was wir einander gewesen sind, mich jetzt – sitzen zu lassen.«
»Hallo!« rief Fräulein de Fries, offenbar belustigt, indem sie sich rasch aufrichtete und die Füsse auf den Boden setzte: »Da geh her Seppl und setz Dich zu mir; lass mich Dich einmal anschauen.«
Er setzte sich neben sie auf das niedrige Lager und sie legte die Hände auf seine Schultern und blickte ihm lächelnd in das ernste Gesicht. »Aber es ist doch auch wirklich komisch,« sagte sie, indem sie mit ihren grossen Händen ihm den Bart und das Haupthaar glatt zu streichen begann. »Es ist doch die verkehrte Welt! Bisher waren es die Mädchen, die den treulosen Liebhaber anflehten: lass mich nicht sitzen – gieb mir meine verlorene Ehre wieder – Du hast mich unglücklich gemacht, Grausamer! u. s. w. – und jetzt verfällst Du auf solche Sprüche. Der neue Mann! Darf man da nicht ein bischen lachen?«
Doktor Reithmeyer ergriff ihre Hände und drückte sie ein wenig von sich ab, denn das Streicheln machte ihn nervös. »Sei kein so närrischer Fisch,« versuchte er zu scherzen: »Das neue Weib erzeugt freilich auch einen neuen Mann – aber es ist durchaus nicht nötig, dass der sich so komisch ausnimmt, wie Du zu glauben scheinst. Ich meine, ich hätte ein bissl mehr guten Willen von Deiner Seite verdient. Ich darf doch wohl annehmen, dass Du das freie Verhältnis aus Liebe zu mir eingegangen bist und nicht etwa blos aus Trotz gegen die liebe Familie oder der Sensation wegen – um Dich auffällig zu machen.«
Sie zog ihn rasch an sich und gab ihm einen herzhaften Kuss, ohne eine weitere Erklärung beizufügen.
«Na also!« sagte er, offenbar zufriedengestellt. »Und jetzt haben wir uns doch sozusagen in eine rechte Ehe hineingelebt, trotz aller langen Trennungen und sogar trotz unserer verschiedenartigen Temperamente und Berufe – und da möchte ich wahrhaftig wissen, warum wir es nicht wagen sollten, wie andre brave Leute eine Familie zu gründen. Die Voraussetzungen dazu sind doch sämtlich erfüllt.«
Das schöne Fräulein seufzte drollig. »Du bist ein schrecklicher Quälgeist, geliebter Seppl; Du solltest mir doch wenigstens Zeit lassen, erst einmal meine Staatsprüfung zu machen und meinen Plan auszuführen, ein halbes Jahr in Paris in den Krankenhäusern zu hospitieren.«
»So, und dann willst Du später, wenn ich hier Professor bin, gelegentlich mal gemütlich angezogen kommen, als ob nichts besonderes vorgefallen wäre. Womöglich gar mit einem Kind, das bis dahin vielleicht schon »bon jour, Papa!« sagen kann!«
»Ja, warum nicht ? Ich komme jederzeit, wenn Du mich wünschest – vorausgesetzt, dass ich sonst frei bin. Und natürlich mit dem Kinde – vorausgesetzt, dass eins da wäre!«
»Sehr freundlich, aber ich müsste danken.«
»Wieso? Das versteh' ich nicht.«
»Weil ich als königlicher Universitäts-Professor allenfalls ein heimliches Liebesverhältnis, keinesfalls aber ein öffentliches Kind aus diesem Verhältnis haben darf.«
»Aber das ist doch ein fürchterlicher Unsinn!«
»Natürlich ist's ein fürchterlicher Unsinn! Das wissen wir doch schon lange, dass alle sogenannte Sitte auf dem Grunde fürchterlichen Unsinns auferbaut ist. Wenn wir aber der herrschenden Gesellschaftsmoral einen kleinen Gefallen thun und uns dadurch ein ruhiges Leben sichern können, ohne selber einen fürchterlichen Unsinn zu begehen, so wären wir doch Narren, wenn wir es nicht thäten!«
»Alles ganz schön und gut, – gegen die Logik garnichts einzuwenden – aber ich habe nun einmal die Ueberzeugung, dass es sich bestrafen muss, wenn wir rückfällig werden.«
»Ich glaube gar, Du bist abergläubisch!«
»Jawohl, warum nicht? Wer sehr starke Ueberzeugungen hat, ist vermutlich am meisten zum Aberglauben geneigt. Seit ich es mir abgewöhnt habe, vor einer Vergeltung im sogenannten Jenseits zu zittern, nehme ich an, dass jede Schuld sich auf Erden rächt. Das befriedigt mein Gerechtigkeitsgefühl. Sollte das aber nicht der Fall sein, so giebt's ganz bestimmt so etwas wie die buddhistische Seelenwanderung. Die ganze Welt ist so logisch eingerichtet, dass eine Schuld ohne Sühne ein Verstoss wider das Causalitätsgesetz sein würde – und das mag ich nicht annehmen; dazu habe ich zuviel Respekt vor der grossartigen Gesetzmässigkeit der Weltordnung.«
Der Herr Privatdozent schnitt ein klägliches Gesicht. Er liess sich, komisch aufseufzend, in einen Polstersessel fallen und rieb sich die Kniee mit den gespreizten Händen als er erwiderte: »Ich hätte grosse Lust, die Weltordnung dadurch umzustossen, dass ich jetzt vor Deinen Augen an der Wand hinaufkletterte. Das ist ja zum Verzweifeln! Jetzt beweisest Du mir philosophisch, dass ich entweder auf meine akademische Laufbahn oder auf Deine liebreizende Person verzichten muss. Behalte Du doch Deine Philosophie und bescheere mir lieber ein zuckriges Weiberl.«
Fräulein de Fries stand gerade in der blendenden Lichtwelle drin, die ihr blondes, kurzgeschnittenes Kraushaar wie mit einem feinen, leuchtenden Schleier umhüllte, der an ihrem Rücken lang herabwallte. Ein lichtgewobener Brautschleier! Der lose Morgenrock von weissem Kaschmir liess ihren Hals frei und aus diesem Hals und den feinen Linien des Schulter- und Brust-Ansatzes hätte jeder bildende Künstler sofort mit Sicherheit auf einen wundervollen Körper geschlossen, den diese weichen Falten verbargen. Das dem Licht abgekehrte Gesicht erschien durch den Kontrast fast braun, zart rosig überhaucht, und die grossen dunklen Augen glänzten unter den dichten schwarzen Brauen und langen Wimpern weich und ruhig wie Antilopenaugen. Claire de Fries war wirklich ein wunderschönes junges Weib. Nur ihre Hände waren ein wenig gross und männlich geformt, aber edel und wohlgepflegt. Sie fühlte, wie die Blicke ihres Freundes bewundernd und begehrlich auf ihr ruhten und sie errötete. Mit zwei grossen Schritten war sie bei ihm, setzte sich auf seine Kniee und schlang die vollen Arme um seinen Hals. Sie rieb ihre Wange zärtlich an seinem Bart und sagte in mütterlich kosendem Tone: »Ach, mein süsser Seppei, was bist Du für ein unglaublich antiquirter Mensch! Ein zuckriges Weiberl mag' der! Ja, mein guter Junge, da wirst Du schon weiter suchen müssen, das ist halt nicht mein Genre.«
»Gerade ist es Dein Genre,« versetzte er eigensinnig, indem er sie zärtlich an sich drückte und auf den Hals küsste. »Das ist ja eben das Bezaubernde an Dir, dass Du, trotz Deiner Gescheitheit und Deinem wissenschaftlichen Eifer und Deiner respektablen Energie, doch so ganz Weib bist. Deshalb lieb' ich Dich ja so sehr und deshalb kann ich nicht ohne Dich leben.«
»Egoist!« lachte sie. »Ich werde entweder durch diesen vorgeschlagenen heiligen Ehestand hienieden unglücklich, oder aber ich muss bei meiner nächsten Wiedergeburt als Kettenhund oder Droschkengaul wieder auf die Welt kommen, zur Strafe dafür, dass ich die gute Sache der Vernunft schnöde verraten habe. Aber das ist Dir ganz egal, mein edler Herr, nicht wahr? Aus lauter Eitelkeit und Eigennutz willst Du mich zeitlebens festhalten! Du gönnst mir einfach keinem andern – nicht einmal mir selber.«
»Natürlich, thu' ich auch nicht!« rief er fast grimmig. »Wozu brauchst Du Dich denn auch selber? Geben ist doch seliger als nehmen – hast Du denn das nie empfunden, Himmelherrgottsakrament?!«
»Offen gestanden – nein,« erwiderte sie ein wenig nachdenklich. »So sehr Weib, wie Du zu meiner Schande annimmst, bin ich denn doch wohl nicht.«
»Du wirst Dich doch wohl nicht auf eine Stufe stellen wollen mit der Grötzinger, der Haider, der Stummer, der Wiesbeck, der Gierl, der Echdeler u. s. w.«
»Ach was, das sind überhaupt keine Weiber; die gehören zum dritten Geschlecht. Das sind Neutra mit den äusseren Kennzeichen der Weiblichkeit, die sich durch krampfhafte Anstrengungen allmählich ihr weibliches Empfinden abgewöhnt und dafür so eine Art verkrüppelter Manns-Psyche eingetauscht haben.«
»Oho!« brauste das schöne Fräulein auf: »kommt der Mannsdünkel einmal wieder heraus? Ich dachte, den hättest Du Dir abgewöhnt. Lass Dir sagen, lieber Freund, dass das ganz ungerechtes und nichtiges Zeug ist, was Du da von den andern behauptet hast. Und, wenn die zum dritten Geschlecht gehören, dann rechne ich es mir zur Ehre, auch zum dritten Geschlecht zu gehören.«
Sie war aufgestanden und zum Schreibtisch getreten, wo sie einigermassen nervös mit dem Papiermesser spielte. Doktor Reithmeyer erhob sich gleichfalls und rief fast klagend aus:
»Du gehörst aber nicht dazu – Du kannst nun und nimmer dazu gehören!«
»Warum denn nicht?«
»Warum denn nicht? Sind das etwa nicht famose Weiber?«
»Nun, erstens einmal, weil . . . hm! und zweitens, . . . hm! und drittens, weil Du überhaupt viel zu schön dazu bist.«
Jetzt wurde das Fräulein Fries ernstlich böse. »Ach, lass mich mit Deinem dummen Zeug zufrieden! Giebt's nicht vielleicht auch schöne Männer, die deswegen doch noch Wichtigeres und Besseres im Leben zu thun finden als dummen, kleinen Mädchen den Kopf zu verdrehen? Ich möchte wissen, warum schöne Frauen verurteilt sein sollen, einzig und allein zur Verfügung der edlen Männlichkeit zu stehen! Zu dumm! Und glaubst Du etwa, dass nicht jede von den Weibern, die Du da vorhin genannt hast, ebensogut Frau und Mutter werden könnte wie ich, wenn sie nur wollten?«
Doktor Reithmeyer lachte ironisch. »Wollen mögen sie schon – glaub's gerne! Aber einen Mann finden sie nicht, der ihnen dazu verhilft; das ist der Casus!«
Fräulein de Fries warf das Papiermesser heftig auf den Schreibtisch und sagte nur: »Lächerlich!« Dann ging sie nach der Ottomane, ergriff ihr Buch und schritt ohne ein weiteres Wort zu verlieren stolz zur nächsten Thür hinaus.
»Aber Claire, wir werden uns doch nicht zanken – das giebt's ja garnicht zwischen uns!« wollte ihr der Freund noch nachrufen. Aber die Thür klappte ihm in's Wort. Mit den Händen in den Hosentaschen schritt er ein Weilchen ärgerlich und unschlüssig hin und her, dann ging er hinaus, stülpte seinen Hut auf, nahm seinen Stock zur Hand und verliess das Haus.
Als der Doktor Reithmeyer durch das Thor des Vorderhauses auf die Blütenstrasse hinaustrat, sprang gerade eine Dame vom Rade – eine kaum mittelgrosse, gedrungene Gestalt, deren stämmige Beine in schwarzen Strümpfen und blauen Pumphosen steckten, während den Oberkörper eine weitbauschige Blouse mit Matrosenkragen umhüllte. Auf dem kurzgeschnittenen, braunen Haar sass eine Sammetmütze mit Schirm, die zu dem kecken Bubengesichte mit der unternehmenden Nase darin vortrefflich harmonierte. Das war Fräulein Hildegard Haider, genannt Box, in Firma Moritz Haiders Töchter, Bankgeschäft.
»Grüss' Gott, Box!« sagte der junge Privatdozent, den Hut lüftend. »Wollten Sie zu uns?«
»Grüss' Gott, Seppl,« gab die Angeredete gemütlich zurück, indem sie ihm kräftig die Hand drückte. »Ja, ich habe gerade eine halbe Stunde Zeit und wollte mich mal nach Euch umschauen. Wie geht's, wie steht's?«
»Danke, erbärmlich. Wir haben uns eben gezankt.«
»Ach wo!« rief das Fräulein erstaunt. »Ach, kommen Sie wieder mit hinauf, Doktor, ich bringe Euch schon wieder zusammen; Claire ist doch oben?«
»Jawohl, Claire ist oben; gehen Sie nur hinauf und lassen Sie sich brühwarm den Fall erzählen und dann heckt mitsammen etwas aus gegen mich unseliges Mannsbild; denn über mich geht's ja doch her.«
»Ach, was wird's weiter sein?« rief Fräulein Hildegard; »haut Euch doch und seid wieder gut.«
»Ach so, Sie würden wohl hauen in solchem Fall? Das sähe Box ähnlich.«
»Ja, ich denke mir Hauen zwischen Eheleuten sehr hübsch. Ich bin immer für abgekürztes Verfahren. Na, kommen Sie mit, Doktor?«
»Nein, bedaure, ich muss jetzt meinen Groll eine Stunde spazieren führen. Soll ich Ihnen vielleicht Ihr Rad die Treppe hinauf tragen ?«
»Nö, danke! Ich kette es unten an, Adieu! Wünsche wohl zu grollen!«
»Danke, habe die Ehre!«
Damit gingen sie jeder ihres Weges.
Die Rolljalousien waren herabgelassen, der »junge Mann« hatte sich empfohlen und Fräulein Hildegard Haider, in Firma Moritz Haiders Töchter, stand in ihrem Laden und hielt noch einmal Umschau, ob alle Gegenstände an ihrem Platz und alle Schlüssel abgezogen seien, bevor sie hinausging und die Hinterthür verriegelte und verschloss. Ihr gelber Hühnerhund sprang aufgeregt bellend um sie herum, froh, dass die tägliche Geduldsprobe wieder einmal überstanden war. Er musste während der Geschäftsstunden muckmäuschenstill zu ihren Füssen unter dem Schreibbureau liegen, aber jetzt gab's als Belohnung für sein Wohlverhalten noch ein gesundes Rennen neben dem Rade. Fräulein Haider war auch vergnügt. Sie pfiff das »Mädchen ohne Gleichen« vor sich hin und streichelte den Hund über den dicken Kopf. Sie hatte heute ein unerwartet gutes Geschäft gemacht und ausserdem freute sie sich auf den Abend, für den sie einige Freundinnen zu sich gebeten hatte. Ihre Schwester Martha hatte sie heute schon eine Stunde vor Geschäftschluss heimgeschickt, um sich mit den Vorbereitungen zu befassen. Sie schwang sich auf ihr Rad – diesmal freilich nicht in Pumphosen, denn im Geschäfte hielt sie auf Würde und trug stets weite, lange Röcke, meist von Sammet oder gar Manchester – und fuhr durch die Ludwigsstrasse zum Siegesthor hinaus. Sie hatte eigentlich Lust, direkt heim zu fahren nach der Giselastrasse, wo ihre Wohnung lag, aber Schampus, so hiess der Hühnerhund, musste seine Bewegung haben und so strampelte sie denn die übliche Pflichtstrecke bis zum fünften Kilometerstein der Schwabinger-Landstrasse ab und eilte alsdann erst heimwärts. Im raschesten Tempo, oft zwei Stufen auf einmal nehmend, erklomm sie die vier Stiegen zu ihrer bescheidenen Mansardenwohnung. Sie fand den Tisch bereits gedeckt für acht Personen. Martha hatte ihre Sache gut gemacht, das Arrangement nahm sich sehr hübsch aus, aber Fräulein Hildegard war noch nicht ganz zufrieden. So erfolgreich sie im allgemeinen in ihrem Bestreben sich zu vermännlichen gewesen war, that sie sich doch auf allerhand kleine weibliche Geschicklichkeiten viel zugute, wie z. B. auch auf ihren Reinlichkeits-und Ordnungssinn und besonders auf ihren artigen Geschmack für gefällige Ausschmückung und behagliche Einrichtung von Wohnräumen. Sie war stolz auf ihr Porzellan, das sie nicht dutzendweise im Laden, sondern stückweise auf Auktionen gekauft hatte, so dass jede Tasse, fast sogar jeder einzelne Teller und jede Schüssel einen besonderen Kunst- oder Kuriositätswert besass. Das schöne gediegene Silberzeug hatte sie vom Vater ererbt.
Dieser Vater, Moritz Haider, war ein merkwürdiger Mann gewesen. Von Haus aus ein Jude, hatte er sich seiner streng protestantischen Frau zu Liebe taufen lassen und dabei sogar seinen Namen – Cohn nannte ihn die Sage – aufgegeben. Er war ein guter Geschäftsmann, aber ein wenig Schwärmer gewesen, hatte viel über philosophische Probleme spintisiert und periodische Anfälle einer zuweilen ganz närrischen Sammelwut gehabt. Er hatte mit dieser Leidenschaft viel Geld verpulvert und gewöhnlich die vorherige Sammlung um ein Butterbrot verkauft, so oft neue Objekte ihn reizten. Seine letzte Passion waren die Pfeifenstopfer in Form von Beinchen aus Porzellan oder Edelmetall gewesen und die Töchter bewahrten die Sammetkassette mit den 75 schlanken und feisten, langen und kurzen, nackten und bestrumpften und beschuhten Frauenbeinchen als Erinnerung an die harmlose Narrheit des Vaters pietätvoll auf. Der alte Herr hatte auf seinem Sterbebett seiner Hildegard die 75 Beinchen fast mit ängstlicherer Sorge ans Herz gelegt als das Geschäft, welches in seinen letzten Lebensjahren gar sehr herunter gekommen war, und zwar Dank den Bemühungen seines einzigen, übelgeratenen Sohnes, den er endlich mit einer Abfindungssumme nach der neuen Welt hatte spedieren müssen, wo der junge Mann bald genug verdorben und gestorben war. Aber mit voller Seelenruhe hatte der alte Herr darein gewilligt, dass die Firma nach seinem Tode Moritz Haiders Töchter heissen sollte, so seltsam das auch klang. Er wusste, was seine Hildegard für ein tüchtiger Kerl war und wie gut sie die Sache verstand. Ausserdem hatte er Hildegards feierliche Erklärung, niemals heiraten zu wollen, stets ernst genommen. Er war ebenso wenig wie irgend jemand aus der Freundschaft oder Verwandtschaft imstande gewesen, sich Hildegard als Ehefrau zu denken. Es lag also seiner Ansicht nach nicht die mindeste Gefahr vor, dass sie einmal in verliebter Laune das Geschäft irgend einem Leichtfuss zur Beute ausliefern würde. Martha dagegen, »die süsse Pflanz«, wie sie zu Hause hiess, die hübsche, zärtliche und kokette Martha würde ja sicherlich bald mit Heirat abgehen und dann sollte dadurch für sie gesorgt sein, dass sie Teilhaberin des Geschäftes blieb. Hildegard hatte das Vertrauen ihres Vaters vollständig gerechtfertigt, und die schon arg gefährdete Firma wieder zu gutem Ansehen gebracht, wogegen die »süsse Pflanz« nun schon 24 Jahre alt geworden war, ohne noch ihre Bestimmung erfüllt zu haben. Sie war immer hübscher geworden und mit zweiundzwanzig war sie sogar zu einer Schönheit herangereift, die in der ganzen Stadt bekannt war und der alle Künstler huldigten. Die Männer, die als in sie verliebt gelten konnten, vermochte Martha Haider nach Dutzenden zu zählen, und fünf Jahre ihres Lebens hatte sie nun schon in steter gespannter Erwartung eines Heiratsantrages verbracht; aber niemals war es dazu gekommen. Schmeicheleien, heisse Worte, Blumen und Gedichte – ein anderes Erträgnis hatte ihre Schönheit bisher nicht abgeworfen. Die kecken Männer, die bei ihr auf leichten Sieg hofften, liess sie übel abblitzen und die Schüchternen, die sie zu ermuntern sich herabliess, wagten doch nicht mit ernsthaften Anträgen herauszurücken, weil sie sich fürchteten, dass die »Bankieuse« alsdann vielleicht allzu geschäftlich mit ihnen reden könnte, denn es waren zufällig lauter mittellose junge Leute. Der dauernde Zustand der Notwehr und Erwartung, in dem sich Martha Haider nun schon mehrere Jahre hindurch befand, hatte sie bereits nervös heruntergebracht und begann allmählich auch ihrer Schönheit Schaden zu thun. Sie konnte manchmal mit ganz glanzlosen Augen und zusammengezogenen Brauen träumend über das Hauptbuch hinwegstarren und die seelische Verstimmung, die schon seit zwei Jahren an der Arbeit war, ihr langsam scharfe Züge um Nase und Mundwinkel herumzuziehen, machte sich auch manchmal in heftigen Ausbrüchen der Schwester gegenüber Luft.
»Na, was machst Du denn für ein kritisches Gesicht?« sagte Fräulein Martha, ein bischen empfindlich, als die Schwester so lange die Tafel musterte, ohne ein Wort des Lobes zu äussern.
»Na, na – nur nicht schon wieder nervös,« entgegnete Hildegard. »Ich finde es ja sehr nett, was Du da gemacht hast, mir kam nur eben eine neue Idee mit den Servietten.« Und sie griff nach der nächsten Serviette, in die bereits ein Weissbrot hineingesteckt war und begann daraus etwas zu formen, das nach ihrer Behauptung einer Lotosblüte deutlich ähnlich sehen sollte. Es war dies eine ihrer Kunstfertigkeiten. Während sie damit beschäftigt war, sagte sie leichthin, auf einen grossen Strauss herrlicher Orchideen deutend, der inmitten der Tafel stand: »Weisst Du, süsse Pflanz, so üppig hättest Du gerade nicht zu sein brauchen wegen der paar gemütlichen Frauenzimmer. Was kostet denn der Spass?«
»Nichts« sagte Martha, achselzuckend.
Und Hildegard darauf: »Du, was kriegst Du denn für einen roten Kopf? Ich mag nicht, dass Du so etwas aus Deiner Tasche bezahlen sollst!«
»Fällt mir auch garnicht ein,« versetzte Martha, wirklich ganz rot im Gesicht. »Die Blumen sind . . . ach, Du kannst Dirs schon denken.«
»Von Arnulfen?«
»Hm, ja, natürlich! So was Schönes kommt doch immer von ihm.« Dabei lachte sie nervös und machte sich etwas ganz Ueberflüssiges am Tisch zu schaffen. Sie fühlte, dass die Schwester einen scharfen Blick auf ihr ruhen liess und so fügte sie, halb gezwungen, nach einer kurzen Pause hinzu: Er war eben hier, er lässt Dich grüssen.«
Fräulein Hildegard nahm eine zweite Serviette vor und pfiff leise durch die Zähne. Dann sagte sie, ohne aufzusehen, wie im Selbstgespräch: »Die Geschichte gefällt mir nicht.«
»Ich weiss allein was ich zu thun und was ich zu lassen habe,« fuhr Martha heftig auf und dabei zuckte es in ihrem Gesicht, als ob sie nicht übel Lust hätte in Thränen auszubrechen. »Ich dachte, es wäre der Conditorjunge und machte selbst die Thür auf, sonst hätte ich ihn garnicht vorgelassen.«
»Na, rege Dich nur nicht auf,« begütigte die Schwester. »Ich will Dir ja gar keinen Vorwurf machen. Wir sind zwei selbständige, vernünftige Frauenzimmer und wenn wir Herrenbesuche annehmen wollen, so geht das niemanden was an. Meinetwegen könntest Du Dir auch allein jemanden einladen und sogar hinter meinem Rücken techtelmechteln, wenn Dir's Spass machte – aber bloss nicht mit Arnulf Rau.«
»Ich möchte wirklich wissen, was man dabei finden sollte,« entgegnete Martha heftig. »Ein verheirateter Mann, mit dessen Frau wir so befreundet sind. . . .«
»Eben drum!« warf Hildegard rasch und hart dazwischen. »Du bist ein so vernünftiges Mädel – dass die jungen Windhunde und die alten Gecken Dir nicht gefährlich werden, weiss ich allein; aber Arnulf Rau – der ist Dir positiv gefährlich mit seinen verdammten Augen und seinen weissen Händen. Leugne nur nicht! Es hat Dir noch keiner so warm gemacht wie der. Wenn Du auf den hineinfällst wäre das Unglück viel grösser, als wenn Du irgend einen von Deinen schmachtenden Jünglingen jemals erhört hättest. Unsolidere Absichten hat jedenfalls noch keiner Dir gegenüber gehabt.«
»So – glaubst Du?« rief Martha leise und trat mit glänzenden Augen, rasch atmend, vor die Schwester hin. »Dann will ich Dir nur sagen, was er mir eben geschworen hat: er kann nicht leben ohne mich – er lässt sich scheiden!«
»Donnerwetter!« platzte Fräulein Hildegard heraus und setzte sich rasch auf den nächsten Stuhl. Sie verschluckte mit Anstrengung eine derbe kritische Bemerkung und fügte erst nach längerer Weile scheinbar ruhig hinzu: »Na, und Du?«
»Ich habe natürlich einen furchtbaren Schreck bekommen,« erwiderte Martha. Und dann trat sie vor den nächsten Spiegel, fuhr sich mit den Händen glättend über den tiefschwarzen Scheitel und betupfte alsdann mit ihrem zarten Battisttüchlein das erhitzte Gesicht. Und dabei sagte sie mit leichtbebender Stimme, aber energischer Betonung: »Jedenfalls weiss ich, dass ich noch nie einen Mann so geliebt habe.«
Da warf Hildegard ihre damastene Lotosblüte wütend auf den Tisch und rief ganz laut: »Ach Herjesses! Hör' mal, süsse Pflanz, jetzt wird mir die Sache zu dumm! Wärest Du lieber früher mit einem flotten Kerl durchgebrannt oder hättest Du einen von den schüchternen Jünglingen festgelegt – lieber hätte ich Euch mit Kind und Kegel aus meiner Tasche erhalten, als dass ich jetzt so was an Dir erleben muss!«
»Ja, höhne Du nur!« rief Martha aufgebracht: »Du mit Deiner Herzlosigkeit kannst überhaupt nicht begreifen . . .«
»Ach was, Herzlosigkeit!« unterbrach sie die Schwester rauh. »Ja, wenn bloss das Herz heissen dürfte, was unvernünftige Frauenzimmer an ungeeignete Männer zu hängen pflegen, dann habe ich freilich keins. Ich habe auch nicht das Herz dazu, Dich in solchem Blödsinn zu bestärken.«
»Ach Du – Du . .!« zornbebend trat Martha ein paar Schritte rasch auf die Schwester zu und dann fügte sie hastig hinzu: »Du hast mir überhaupt alles zerstört – Du bist ganz allein Schuld daran, dass ich dieses ganze grässliche, verfehlte Leben noch immer ertragen muss.«
»Ich? Wieso?«
»Weil Du die Männer abschreckst. Dich, mit Deiner fürchterlichen Nüchternheit und unweiblichen Derbheit fürchten sie mehr als die schlimmste Schwiegermutter. Du verhöhnst ja alle zarteren Gefühle. In Deinen Augen wird ja alles lächerlich und frivol, wonach man sich sehnt, wenn man so liebeleer dahin vegetieren muss wie ich. – Ach, Du, Du . . . wo Du hintrittst, da blüht ja gar nichts mehr!«
Zornflammend, mit funkelnden Augen stand sie der Schwester gegenüber und dann wendete sie sich plötzlich rasch ab und verliess das Zimmer. – –
Als einige Minuten später das Dienstmädchen hereintrat, stand Fräulein Hildegard am offenen Fenster und schneuzte sich mit einer ganz unnatürlichen Heftigkeit. Sie konnte doch die dumme Person nicht merken lassen, dass sie geweint hatte. –
Eine halbe Stunde später begannen sich die Gäste einzustellen. Zunächst erschien Fräulein Agathe Echdeler, die Vorsitzende des Agitationskomitees für die Evolution der femininen Psyche; in Wirklichkeit hatte der Verein einen etwas gemeinverständlicheren Namen, aber unter sich pflegten ihn die gelehrten Damen scherzeshalber also zu bezeichnen. Fräulein Echdeler war eine stattliche, schlanke Erscheinung, so gegen Ende der Dreissiger, von sicherem Auftreten und höchst intelligentem und dabei liebenswürdigem Gesichtsausdruck. Im Gegensatz zu der burschikosen Hildegard Haider war ihr Wesen durchaus damenhaft. Nach ihr erschien die Frau von Grötzinger, ein kugelrundes Persönchen mit kurzgeschnittenem, grauem Haar, rotem Vollmondgesicht mit Stumpfnase, unauffällig und dennoch geschmacklos gekleidet. Frau von Grötzinger war eine kreuzbrave Dame, die mit bescheidenen Mitteln eine wirklich erspriessliche Wohlthätigkeit übte. Man behauptete, dass sie noch einen Mann besitze, es hatte ihn aber noch niemand gesehen – es hiess, er sei schon vor langen Jahren in weite, weite Fernen geflohen, aus lauter Angst vor dem starken Geiste seiner Gattin. In der gewöhnlichen Unterhaltung fiel Frau von Grötzinger mehr durch ihr männliches Organ als durch den Inhalt ihrer Reden auf und sie liebte augenscheinlich den starken Tabak mehr in Form von Cigarren als in Form von gewagten Bemerkungen. Sie war nämlich im Stande, die gefährlichsten Giftnudeln zu rauchen, ohne eine Miene dabei zu verziehen. Nach ihr kamen die unzertrennbaren Freundinnen Frau Stummer und Fräulein Wiesbeck. Erstere, einen prächtig rein geschnittenen antiken Gemmenkopf auf kräftig geformtem Halse tragend, ganz wie ein verkleideter schöner Jüngling einherschreitend, wogegen das Fräulein an ihrer Seite so recht zum umblasen aussah, – eine schmalschultrige, spitznasige Pfarrerstochter, die aber doch die Energie besessen hatte ihren Eltern durchzubrennen, um in Zürich Philosophie zu studieren – d. h. » nur so« wie sie sich sinnig ausdrückte, denn wie sie ihre Philosophie praktisch verwerten sollte, das war ihr vorläufig selbst noch nicht klar. Sie verdiente sich ein wenig Geld damit, dass sie höheren Töchtern Unterricht im Lateinischen und Griechischen gab, im übrigen wurde sie von wohlhabenderen Freundinnen durchgefuttert. Frau Stummer hatte thatsächlich einen Mann besessen, hatte sich aber nach kurzer Zeit von ihm scheiden lassen, da es ihr im Verlauf der kurzen Ehe immer undenkbarer geworden war, wozu sie den Herrn verwenden sollte, der sie nur in ihren höheren Bestrebungen störte. Sie waren übrigens ganz freundschaftlich auseinander gegangen und Herr Stummer besuchte seine Gattin noch zuweilen – besonders, wenn er Geld brauchte, denn sie besass mehr, als sie für ihre einfachen Bedürfnisse benötigte. Zuletzt erschien Fräulein Claire de Fries in Begleitung von Fräulein Doktor juris Babette Girl, einer schlanken, festgefügten Erscheinung, in einem glatten schwarzen Sammetkleide, das zu ihrem feinen, geistvollen Kopfe mit der kühnen Adlernase vortrefflich harmonierte. Das Fräulein Doktor hatte sich bereits einen bedeutenden Ruf erworben, als eine der beredtesten und scharfsinnigsten Verteidigerinnen der modernen Emanzipationsbestrebungen ihres Geschlechtes.
Sobald die Gäste alle beisammen waren, setzte man sich zu Tisch und genoss mit auffallendem Ernst und verhältnismässiger Schweigsamkeit die guten Dinge, womit die Firma Moritz Haiders Töchter aufzuwarten hatte. Es wurde eigentlich nur über Köchinnen und Küchenfragen gesprochen, wie zu Beginn einer gewöhnlichen Damengesellschaft auch, und nur dadurch, dass diese Damen ordentlich assen wie hungrige Menschen, und nicht bloss pickten wie Ziervögelchen, bethätigten sie ihre Erhabenheit über die gewöhnlichen Schwächen ihres Geschlechtes. Dass die Unterhaltung nicht lebhafter und lauter wurde lag einesteils wohl daran, dass statt alkoholhaltiger Getränke nur Frada gereicht wurde, andernteils aber auch in der etwas gedrückten Stimmung, die von den Gastgeberinnen selbst ausging. Fräulein Martha Haider hatte sich zwar schon wieder soweit beruhigt, dass weder ihr Teint noch ihr Gebahren die eben durchgemachte Aufregung verriet und auch Fräulein Hildegard wusste sich zu beherrschen und gab der Schwester sogar ganz besonders zärtliche Namen, aber die Intimen des Hauses und feinen Beobachterinnen hatten doch sofort gemerkt, dass zwischen den Beiden etwas vorgefallen sein müsse.