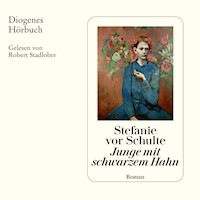21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Was bleibt, als zu fliehen, wenn Kinder plötzlich allergisch auf Erwachsene reagieren, Eltern ihre Kinder vergessen, wenn Hunde ihre Herren anfallen und die Natur des Menschen überdrüssig ist? Pflegekraft Aria und Kollegin Marion retten fünfzehn Kinder aus der vom Untergang gezeichneten Stadt und versuchen die vielleicht letzten Wochen in einem ehemaligen Badehotel würdevoll zu bestehen. Doch den Bewohnern von Einstadt und den Cowboys rund um Imre Brandt sind sie ein Dorn im Auge. Als Aria ein Pferd am Strand entdeckt und darauf beharrt, es zu bergen, geht es plötzlich um alles. Die Feindseligkeit der Männer eskaliert, aber die Frauen finden Verbündete und geben nicht kampflos auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Stefanie vor Schulte
Das dünne Pferd
Roman
Diogenes
1
Die Einrichtung ist seit Tagen unbewacht, der Parkplatz davor ohne Menschen, und also wagen sie es.
Die Busse stehen kreuz und quer. Tote Fliegen an den Scheiben, die Türen offen. Sie ducken sich im Schutz der Fahrzeuge heran. Sie schieben Rollstühle, tragen Rucksäcke, tragen Kinder. Sie lugen in die Busse und wählen einen, der scheint am saubersten. Sie helfen den Kindern auf die staubigen Sitze und hängen Infusionsbeutel an die Haltegriffe.
Keine der beiden Frauen hat jemals einen Bus gesteuert, aber Aria Schulman, immer nur eine von den Schulmans aus dem Haus mit den schiefen Jalousien, die aussahen, als hätten Katzen darin gehangen, rutscht hinter das breite Lenkrad, findet den Schlüssel neben baumelnden Plüschwürfeln am Rückspiegel und startet den Motor. Das Dröhnen scheucht Tauben auf und hallt zwischen den Gebäuden. Dieselgestank drückt in den Bus und die Frauen tauschen Blicke.
Wenn sie nun doch jemand aufhält.
Aber Aria will sich nicht länger aufhalten lassen.
Sie schrammt den Gang rein, tritt das Gaspedal durch und lenkt den Bus auf die Straße. Parkenden Autos rasiert sie die Seitenspiegel, räumt Mülltonnen ab und Hecken, schlägt eine Schneise in die Stadt. Und als sie die Ausfallstraße nehmen, folgt ihnen noch immer keine Polizei, niemand von den Behörden, scheint es einfach nicht zu kümmern.
Sie fahren durch Brachen, die wie Ringe um die Stadt liegen. Öde Baugruben. Rostige Güterwaggons und Schuttberge, auf denen der Verfall krautige Pflanzen ausgesät hat. Roggenbüschel, Löwenzahn. Bald säumen nur noch trockene Felder die Straße. Ausgezehrte Baumgruppen. Schafe auf dürren Weiden. In der Ferne, aber immer da, ein graues Meer, flach unter einem schweren Himmel. Es liegt schon Salz in der Luft.
Wie gebannt staunen die Kinder in die Landschaft. Nichts kennen sie außer der Stadt. Nichts außer der Einrichtung ist ihnen vertraut. Über ihnen schwingen die Infusionsschläuche und ihre Augen glänzen im Fieber. Wer weiß, wie sich die Fahrt auf ihren Gesundheitszustand auswirkt. Es ist nicht so, als hätten sie Erkrankungen, bei denen ein bisschen frische Luft helfen würde. Sie sind nicht auf dem Weg zur Kur. Sie kehren nicht wieder.
Aria hält das Lenkrad fest umklammert. Im Rückspiegel sieht sie Fluchtgefährtin Marion, die im schaukelnden Bus ihre Arbeitskleidung abstreift, Krankenhauskittel und Haube mit dem Fuß unter eine Sitzbank schiebt. Aus einem Beutel holt sie Hose und T-Shirt, schlüpft hinein, löst den strengen Haarknoten und bürstet sich mit starken Strichen. Dann tritt sie hinter Aria und hilft auch ihr mit den Haaren. Das Geräusch der breiten Bürste auf ihrer Kopfhaut ist beruhigend und vertraut. Und dennoch kommt es Aria vor, als habe sie die ganze Bande entführt. Dabei war sie nur die Erste, die es bemerkt hat. Dann die Erste, die etwas unternommen hat. Vielleicht ist sie jetzt die Erste, die scheitern muss.
Sie fährt fünfzehn Kinder in eine Zukunft, die keine mehr ist.
2
Angefangen hat es mit dem Kugelschreiberklicken.
Klick-Klick-Klick.
Klick-Klick-Klick.
Aria blickt von ihrem Computerbildschirm auf und über den Empfangstresen der Einrichtung hinweg die junge Mutter mit Kind auf dem Arm an, die über einem Dutzend Formularen brütet, dabei unablässig die Mine des Kugelschreibers herausfedern lässt und wieder versenkt.
Die Papiere liegen aufgefächert vor ihr, das Übliche, nichts Anspruchsvolles. Die Frau schwitzt. Das fiebernde Kleinkind hängt wie ein nasser Sack auf ihrer Hüfte. Sie schiebt es höher, versucht, sich den Schal zu lockern und starrt auf die Formulare. Hinter ihr warten andere Eltern mit kranken Kindern.
Aria sagt: »Sie können sich auch setzen. Da drüben ist ein Stuhl. Es hat keine Eile. Ich kann helfen.«
Die Frau lässt den Kugelschreiber klicken, ihr Blick wie unter Schock. Aria beugt sich zu ihr und überfliegt die Papiere. Auf keinem ist der Name des Kindes vermerkt, auch das Geburtsdatum fehlt. Aria verlässt ihren Posten und führt die Frau behutsam zur Seite. »Wir tragen es nach. Es ist heiß hier drin. Wir schauen gleich nach Ihrem Sohn.«
Die Frau folgt verwirrt und mit gesenktem Kopf. Es wird gerätselt, welche Krankheit dem Vergessen zugrunde liegen könnte. Sie bleibt kein Einzelfall. In den nächsten Wochen schaut Aria immer häufiger von ihrem Computer oder einer Krankenakte auf, sieht dann den bestürzten Gesichtsausdruck eines Elternteils und die Leerstelle auf dem Formular.
Aria sagt: »Grämen Sie sich nicht. Das passiert öfter, als Sie glauben.«
Den Eltern ist es kein Trost. Sie fühlen sich schuldig. Wie konnten sie den Namen vergessen, wo sie sich doch sonst an alles erinnern. Wie das Kind aussieht, lacht, was es mag. Aber bald kommt ihnen das ebenso abhanden.
Sie sind zu Besuch auf der Krankenstation, bringen Teddybären mit und Gasballons. Freudestrahlend stehen sie in der Tür eines Mehrbettzimmers, schauen auf vier kleine Menschen in schneeweißen Betten und haben keinen Schimmer, welchen davon sie gestillt, gewickelt, getröstet haben. Sie wissen es nicht, bis das Kind die Arme nach ihnen ausstreckt.
Aria sorgt dafür, dass immer nur ein Elternpaar das Krankenzimmer betritt, um ein Durcheinander zu vermeiden. Es ist trotzdem kompliziert, und irgendwann bleiben die Besuche aus.
Da hat es auch außerhalb der Einrichtung längst um sich gegriffen. Barfüßige Kinder im Winter. Kinder, die im Sandkasten vergessen werden wie kaputte Schaufeln. Schulaufführungen, bei denen die Eltern nicht auftauchen. Der Kinderwunsch verschwindet, wie eine aus der Mode gekommene Sache. Und wenn die Leute sehen, dass sich Tauben in den Bäumen paaren, macht sie das ratlos.
3
Aria muss anhalten, denn ihr Mut kommt und geht in Wellen.
Sie bremst den Bus am Straßenrand, stolpert aus der Fahrerkabine und kniet im körnigen Sand. Wie hatte sie nur glauben können, der Verantwortung gewachsen zu sein.
Marion berührt sie an der Schulter.
»Es geht schon wieder«, sagt Aria, aber Marion schaut an ihr vorbei und meint etwas anderes. Mit zwei klirrenden Schritten steht nämlich eine Gestalt bei ihnen, vor ihnen, wie aus dem Nichts. Eine Frau Mitte fünfzig. Ganz blaue Augen und kurzes Haar. Sie trägt ein aufreizendes, geschmackloses Oberteil und eine enge Hose. Feste Schuhe, mit Nietenschlaufen behängt. Keine Tasche. Und obwohl sie verbraucht scheint und getroffen, aus einer Wunde an der Hand blutet, wirkt sie so lässig, wie es nur jemandem eigen ist, der Situationen einschätzen kann. Und in diesem Fall scheint die Frau zu wissen, dass ihr keine Gefahr droht. Keine Gefahr droht von zwei kreidebleichen Frauen und einem schief stehenden Bus voller Kinder.
Sie sagt: »Hi. Ich bin Hayden. Was macht ihr so?«
Aria sagt langsam: »Das ist eine Menge Blut.«
Hayden zuckt mit den Schultern. »Ich weiß. Namen, habt ihr welche? Ich glaube, ich fang noch mal an. Ich bin Hayden.«
Sie stellen sich vor, und irgendwie dauert es ewig.
Aria zeigt auf Haydens Hand.
»Ich kann mir das mal ansehen. Ein Unfall?«
Hayden winkt ab.
»Nein. Nur so ein Kerl.«
Sie kramt eine zerknautschte Packung Zigaretten aus der Hosentasche und redet, während sie die Kippe zwischen Daumen und Zeigefinger hält. »So ein Killer, keine Ahnung. Serienmörder wahrscheinlich. Hat mich da draußen bei den Schafen fertigmachen wollen. Beim Stall. So eine schäbige Baracke im Nirgendwo, du weißt schon, wo niemand deine Schreie hört und all das. Da hingen so dicke Ketten mit Halsbändern. Ich habe gleich gedacht, die Ketten sind für mich. Jedenfalls war mir in der Sekunde klar, scheiße, das ist mein Ende. So ein Perverser wird mich umbringen, mich in Stücke sägen oder keine Ahnung. War ein Fehler, dass ich überhaupt ins Auto eingestiegen bin, aber ich dachte, so ein sonniger Tag, kommen nicht viele vorbei an einem sonnigen Tag. Aber die Verrückten, die sind auch an sonnigen Tagen unterwegs. Merk dir das, Schulman«, sagt sie.
Als kennten sie einander schon Jahre, und Aria weiß genau, was sie meint.
Hayden dreht ihre Zigarette in die Handinnenfläche, umwölbt sie, zieht daran und kaut den Rauch. Sie wirft den Stummel in den Sand, und wie gebannt schaut Aria ihr bei allem zu. Es ist, als wohne man einer Aufführung bei. Nur schwer zu sagen, bei was für einer.
Dann holt sie doch Verbandszeug. Es gibt keinen anderen Ort als den Schattenstreifen hinter dem Bus. Die Kinder kleben an den Fensterscheiben. Hayden winkt ihnen mit blutüberströmtem Arm zu, erntet begeistertes Kreischen.
»’tschuldigung«, sagt Hayden zu Aria, überlässt ihr die Hand.
Eine breite Hand mit kurzen Nägeln, auf denen glitzernder Lack abblättert. Ihre Finger sind warm und, wo kein Blut ist, angenehm trocken. Aria schaut sich die Wunde an, die recht tief ist, aber Nerven und Sehnen scheinen unverletzt. Sie desinfiziert die Wunde. Hayden riecht irritierend stark nach Parfüm. Es liegt wie eine Maske auf ihr.
»Wie bist du entkommen?«, fragt Aria, während sie den Verband abwickelt, sorgfältig um Wunde und Handgelenk legt und wünscht, sie würde niemals damit fertig.
Hayden sagt: »Mein Bauchgefühl. Ohne mein Bauchgefühl wäre ich schon längst tot. Früher konnte ich mich auf meinen Arsch und meine Titten verlassen, jetzt auf den hier.« Sie klopft sich auf die Mitte, die nicht mehr fest ist, aber in Form gezwängt von Top und Gürtel.
»Ich steige aus dem Auto von diesem Vogel, und da ist mir schon alles klar. Adrenalin bis über die Ohren. Ich tu dann so, als würde ich stolpern, greife mir einen dieser runden Steine, die liegen hier ja in Haufen rum, Schulman, weil die niedrigen Mauern daraus gesetzt werden, wie auf Befehl bauen hier alle so niedrige Mauern, und kein Mensch weiß, wozu die da sind, Markierung oder so, ich meine, was soll das, entweder du baust eine Mauer oder du baust keine Mauer. Also, ich hebe diesen Stein auf, und dann hau ich ihm den auf den Kopf. Vielleicht hat er mich dabei mit seinem Messer erwischt, oder schon vorher, ich weiß es nicht. Und das war’s«, sagt Hayden. »Der hat sich nicht mehr gerührt. Den Schlüssel zu seinem Wagen hatte er in der Hosentasche. Aber ich hatte keine Nerven, in seinen dreckigen Hosen zu graben. Ich krieg auch so schon genug dreckige Hosen zu sehen. Mir egal, ob er tot ist. Ist mir egal«, sagt sie.
Der Verband ist angelegt. Aria hält Haydens Hand und weiß nicht, was sie sagen soll. Was soll sie sich in ein Leben einmischen, das kein schlechtes Gewissen kennt, weil das ganze Leben aus Notwehr besteht.
Hayden schaut auf den Verband, bewegt die Finger.
»Das muss genäht werden«, sagt Aria matt.
»Bist du Arzt?«
»Ich fahre den Bus.«
»Keine gute Zeit für Ausflüge, Schulman.«
Sie nennt sie Schulman, obwohl Aria seit ihrer Kindheit dagegen ankämpft, eine Schulman zu sein. Eine, die das Bett mit den kleinen Brüdern teilt, die sich vor Hunger Arias Haare in den Mund stopfen. Aber jetzt klingt es, als könnte der Name einmal etwas anderes bedeuten.
»Wie viele seid ihr?«, fragt Hayden.
»Fünfzehn Kinder und wir.«
Die Sonne steht inzwischen hoch. Im Bus staut sich die Hitze. Die Kinder werden unruhig.
Aria fragt: »Sollen wir dich mitnehmen? Wir fahren ans Meer.«
Und hätte so gern, dass Hayden zustimmt. Aber die schaut konzentriert die Straße entlang.
»Wenn’s ans Sterben geht, fährt jeder ans Meer«, sagt sie und dreht sich um. Aber Aria glaubt ein Versprechen zu hören: Ich komme nach. Es fällt ihr schwer, zurück auf den Fahrersitz zu klettern. Sie startet den Motor und schaut im Rückspiegel nach Haydens Gestalt, die vom aufwirbelnden Staub allmählich verhüllt wird.
Hayden geht mit klirrenden Schritten und dreht die verbundene Hand hin und her.
Und als sie später von der Polizei aufgegriffen wird, weil Hayden nun mal stadtbekannt ist und sich die Bullen mit allen wichtigen Angelegenheiten an sie wenden, verrät sie nichts und niemanden. Niemand Ungewöhnliches ist ihr begegnet. Nichts Auffälliges hat sie gesehen. Bloß ein weiterer Tag am Abgrund.
4
Aria ist zwölf, als die Eltern nur mehr Gespenster sind in den verfilzten Ecken ihres Hauses, das sie halten können, weil es außer ihnen niemand will. Es gibt Probleme mit der Kanalisation und es fehlt jeglicher Komfort. Der einfache Bau passt schon längst nicht mehr zu den sanierten und um einige Stockwerke bereicherten Häuser der Siedlung. Keiner kommt zum Spielen vorbei.
Nachmittags flüchtet Aria in die breite Astgabel einer Weide.
Von dort kann sie über die angrenzenden Getreidefelder schauen, aber auch in den Garten der Nachbarn. Nebenan wohnt Benedikta, ein Mädchen im selben Alter. Aria bewundert Benedikta für deren Anmut, Schönheit, Sorglosigkeit. Benedikta spielt Klavier. Sie hat einen Pool und Freunde, mit denen sie Musik hört, Limonade trinkt und ins Wasser springt, während Aria hinter den Schleiern der Weidenzweige vertrocknet. Und sich nicht rührt, aus Angst, gesehen und fortgeschickt zu werden. Dabei hat Benedikta das Mädchen im Baum längst entdeckt und sonnt sich in dessen Ergebenheit. Benedikta cremt sich ein und lässt sich aufreizend viel Zeit, in das blaue Becken zu gleiten. Das Wasser im Pool ist klar und glitzert. Vom Anblick bekommt Arias Haut Durst. Ihr bleibt jedoch nur der trübe See, in dem sie nachmittags manchmal baden geht, wenn sich ihr vor Hitze und Langeweile das Gehirn schält.
Dann geht sie allein den Weg zum See und schwimmt so weit hinaus, dass keine Algen mehr ihre Beine befingern.
Sie lässt sich treiben, bis sich der Tag in den Abend erschöpft und die jungen Erwachsenen kommen, um am See zu feiern. Vor ihnen hat Aria keine Angst. Sie haben Instrumente dabei oder Musikboxen. Auf selbst gebauten Feuerstationen grillen sie Weißbrot und Paprika. Manche essen, manche essen nie. Sie trinken Bier, singen und machen miteinander rum.
Über Aria, das letzte Kind hier draußen, wundern sie sich nicht. Niemand stört sich hier an ihrer abgestoßenen Kleidung. Sie könnte bleiben. Aber Aria mag nicht, weil die jungen Leute trinken und Drogen nehmen. Das kennt sie alles schon von zu Hause. Und spätestens, wenn sich die Gruppe in Trance tanzt und einer dabei versehentlich ins Feuer stolpert, läuft Aria wieder heim. Fort von dem Geschrei und Gejammer im aufsteigenden Funkenregen. Sie will sich nicht betäuben. Sie muss auf der Hut sein.
Wach bleiben.
Heute ist sie aber so müde und der Bauch tut ihr weh. Sie liegt in der Astgabel der Weide. Die Nase in ihre Armbeuge gesenkt. Sie riecht an sich. Ein seltsamer Geruch, der aus der warmen Beuge aufsteigt. Er macht sie benommen. Ihr fallen die Augen immer wieder zu.
Im Nachbargarten blättert Benedikta in Zeitschriften. Sie ist gelangweilt und unzufrieden. Aria hört im Halbschlaf, wie sie die Seiten so heftig umblättert, dass es sich wie das Schnalzen einer Peitsche anhört. Dann ruft Benediktas Vater nach ihr, und das Mädchen antwortet gereizt. Er müsse noch einmal wegfahren. Sie solle Victor die Tür öffnen. Wer ist Victor, fragt sich Aria, während sie einschläft, wer ist Victor. Aber dann holt sie ein Traum, und erst ein Schrei wird sie aufwecken, und da wird es Benedikta nicht mehr geben. Wird der Körper des Mädchens im klaren Wasser leblos treiben. Und alles nur – und davon wird Aria überzeugt sein –, weil sie nicht aufgepasst hat.
5
Aria schreckt auf, als die Reifen des Busses über den Seitenstreifen brettern. Schotter spritzt hoch und das Scheinwerferlicht blendet ein paar Kojoten, die gerade überlegen, ob Menschen gut schmecken, in etwa wie Hühnchen.
Aria reißt das Lenkrad herum, und der Bus rumpelt zurück auf die Fahrbahn.
Sie wirft einen Blick in den Rückspiegel, aber keiner ist aufgewacht. Die Gesichter der Kinder sind puppenblass. Auch Marion schläft mit offenem Mund. Hat dabei ein Kleines auf dem Schoß, warm und verklebt. Der Bus schaukelt sie.
Aria fährt und fährt, und es könnten Berge oder Wälder sein, Wüsten oder Brachen wie zuvor, sie würde es nicht wissen, denn es gibt keinen Mond und keine fernen Lichter. Um sie herum ist es dunkel, und das kennt sie nicht aus der Stadt. Der helle Kegel der Scheinwerfer macht Aria nur noch blinder.
Sie wünschte, sie könnte das Radio einschalten. Aber die Sender sind schon seit Wochen tot. Ihr bleibt nichts als das Wissen, dass diese Anstrengung lediglich ein Bruchteil dessen ist, was sie noch auszustehen hat.
Alex schiebt sich plötzlich neben sie.
Er sagt: »Das war knapp.«
»Verpetz mich nicht.«
Der Junge ist neun und seit Jahren in ihrer Obhut. Aria selbst war nach ihrer Ausbildung direkt von dem vergammelten Haus in die Einrichtung gezogen. Hatte neben Überstunden und Wochenenddiensten keine eigene Wohnung benötigt. Alles, was sie gebraucht hatte, war die Arbeit und das Gefühl, nützlich zu sein. Die zunehmenden Unruhen in der Stadt hatten die meisten Pflegerinnen dazu genötigt, ihre Wohnungen aufzugeben. Zu gefährlich waren die Wege geworden. Zu wenig Zeit war geblieben. Aria mag alle Kinder der Einrichtung. Aber Alex mag sie anders.
Er klettert auf ihren Schoß, legt seine Hände mit auf das Lenkrad und folgt Arias Bewegungen. Sie treiben das Licht vor sich her. Sie sehen nur Straße und Steine, aber sie haben ein Ziel. Ein altes Badehotel, das sie von ihrem Ersparten gekauft haben. Die Route hat Aria sich seit Tagen eingeprägt.
»Wir müssen bald tanken«, sagt Alex.
»Du hast recht«, sagt Aria.
Die Tanknadel nähert sich dem roten Bereich. Der Bus säuft wie ein Loch, denkt Aria, der Bus säuft wie meine Mutter.
Sie fahren, bis der Morgen anbricht. Der Himmel wirkt noch unentschieden. Über dem Heidekraut liegt Nebel. Die Kinder wachen auf. Sie scheinen erholt und quengeln nicht. Sie sind so brav, es ist fast unheimlich. Sie strecken sich, als hätten sie nie so gut geschlafen noch geträumt. Sie malen Bilder an die beschlagenen Scheiben. Trinken brav ihre Säfte, von denen sie satt werden sollen. Aria lenkt durch Schotter und Staub und weiß, wenn sie keine Tankstelle finden, ist es aus. Aber dann erblickt sie den simplen Unterstand, erkennt die Umrisse einiger Zapfsäulen, ein abgeblättertes Schild und einen kleinen flachen Bau, in dem sie vielleicht etwas kaufen können.
Sie halten auf geborstenem Asphalt. Die Tankstelle wirkt verlassen. Niemand tritt in die geöffnete Tür und schaut nach ihnen.
Marion fragt: »Was tankt eigentlich so ein Ding.«
Es liegt ein Unbehagen in ihrer Stimme.
»Keine Ahnung«, sagt Aria. »Ich werde fragen müssen.«
6
Er ist am Verdursten und hat höllische Kopfschmerzen. Das Blut auf Schläfe und Gesicht ist getrocknet. Auf die Wunde im Nest verklebter Haare hat er lang sein Hemd gedrückt. Die Sonne hat ihm die Schultern verbrannt.
Er weiß nicht mehr, wo er seinen Wagen stehen gelassen hat.
Er weiß nur, dass er orientierungslos wie ein Schaf gefahren ist, und irgendwann ist er wohl ohnmächtig aus der Tür gekippt. Und dann hat ihn etwas in den Hintern gestochen. Er hofft, kein Skorpion.
Als er endlich in das Dämmerlicht seines Ladens taumelt, erkennt er nichts. Fahrig streckt er die Hände aus und landet im Kühlregal. Er tastet sich zu den Bierdosen, zischt eine auf, drückt sich eine andere gegen den Schädel. Ein roter, pulsierender Schmerz, von dem Blitze ausschwirren. Welcher Tag ist heute. Wie lang war er bewusstlos. Wie lang hat er vor dem Stall gelegen, und diese alte Hexe ist auf und davon. Er trinkt in großen Schlucken. Das Bier geht runter wie nichts. Er zerdrückt die Dose, lässt sie fallen, greift nach einer neuen. So lange hatte er die Schlampe schon auf seiner Liste. Wie die durch die Straßen marschiert ist, als gehöre ihr die ganze Stadt. Im Kopf hat er tausendmal alles durchgespielt. Und dann wirken die Drogen bei ihr nur halb so stark, klar, bei der Übung, die die Alte hat und verdammt, das hätte er mitbedenken müssen, jedenfalls wittert sie den Braten und zack. Wo ist eigentlich der Hund. Geliebte Tessa. Sein ganzer Stolz.
Schon immer hat er einen solchen Hund haben wollen. Der Züchter fragt, ob er Erfahrung im Halten von solchen Hunden habe. Natürlich sagt er Ja, natürlich hat er keine. Er ist mal aufbrausend, mal liebevoll und der Hund dementsprechend verwirrt. Bald reagiert das Tier auf alles und jeden aggressiv. Niemand wagt jetzt mehr, Milo zu überfallen. Tessa lauert knurrend und bebend im Schatten der Tankstelle und bohrt ihre Wut in jeden Fremden, der unaufgefordert bezahlen will. Das hat Milo gut hingekriegt. Wenigstens das.
Milo gehört zu denen, die selbst keine erfolgreichen Dinger drehen. Mit dem bisschen Serienmörderei lässt sich schlecht angeben, ist nicht gut fürs Image und bringt auch nichts ein. Die anderen dagegen scheffeln Geld wie Heu, kreuzen alle früher oder später hier bei ihm auf, und wenn sie aus ihren teuren Autos steigen, diesen glänzenden Geschossen, die sie mit Blutgeld bezahlt haben, legt Milo seine Tessa nicht gleich an die Kette, sondern lässt sie gerne ein wenig vor ihnen herumspringen und geifernd bellen, damit er den Neid besser ertragen kann, der ihn in heißen Wellen durchläuft, wenn er das alles zusammenrechnet: Uhren, Autos, Weiber, Jachten, Hubschrauber. Und er: Tankstelle im Nirgendwo.
Außer Neid und Suff durchfluten ihn noch bizarre Gewaltfantasien, die er alle paar Monate mit großem Vergnügen auslebt, wenn sich endlich Gelegenheit bietet. Er genießt die ganze Prozedur. Das Entsorgen ist allerdings nicht so sein Ding. Aber hier draußen erledigt sich vieles ja von selbst.
Früher haben die Tabletten ihn unter Kontrolle gehalten. Aber seit ein paar Wochen gibt es keine neuen Tabletten mehr, und die Ärzte sind nicht länger zuständig. Behandlungen werden ausgesetzt, Medikamente fehlen, erst Lieferengpässe, jetzt Herstellungsstopp. Klar, man kann sich den ultimativen Dämpfer kaufen. Eine Pille, groß wie ein Bullenzäpfchen. Danach sabbern und nur noch Brei in der Birne. Da gehen natürlich die üblichen Süchtigen, Kranken und Kriminellen nicht drauf ein. Aber das gute Zeug, das behalten die von der Regierung jetzt für sich. Die bauen sich Festungen. Haben Militärfahrzeuge, Versorgungsmöglichkeiten. Bunkern Zeug und Kram und haben alles, und die anderen, die haben nichts, und bald werden sich die Verrückten wohl gegenseitig umbringen, weil alle gleichzeitig auf freiem Fuß sind und keine Hemmungen mehr kennen.
Milo sieht das alles ganz klar. Er weiß, auf welcher Seite er steht. Er weiß, auf welcher Seite die von der Regierung stehen. Jeder marschiert auf seiner eigenen herum. Nur die Normalos da draußen, die haben das noch nicht kapiert. Die behaupten, es gäbe nicht nur Schwarz und Weiß. Die wollen alle das lahme Grau dazwischen. Milo durchzuckt ein fast philosophischer Gedanke: Wenn die Menschen alles lieber ein bisschen böse wollen oder beinahe gut, dann möglicherweise nur, damit sie einen Ort haben, der ihre eigene Unentschiedenheit, ihre erschöpfte Moral beherbergt. Aber so läuft das nicht. Entweder du hast die Eier, auf einer Seite zu stehen. Oder du hast sie eben nicht.
Milo läuft jetzt wieder Blut aus der Kopfwunde über die Nase und tropft ihm von den Lippen. Der eben gewonnene Gedanke ist rasch vergessen. Er findet kein Verbandsmaterial und drückt sich behelfsmäßig eine Rolle Klopapier gegen die Stirn.
Er ruft nach Tessa.
Vorgestern erst hat ihm einer erzählt, sämtliche Hunde der Stadt hätten sich wie auf Kommando von ihren Herrchen losgesagt und wären wie eine Meute durch die Straßen und fort. Auch die Katzen wären über die Dächer wegspaziert. Kanarienvögel hätten ihre Käfige aufgebrochen und wären in großen Schwärmen auf und davon.
Das kann Milo aber kaum glauben, und wenn es tatsächlich stimmt, dann muss es etwas im Wasser gewesen sein. Und er will erst recht nicht glauben, dass so ein Irrsinn bis hinaus in diese trockene Ödnis gelangen wird. Stadthunde, denkt Milo, so was verspeist Tessa zum Frühstück.
Er ruft erneut.
Draußen steht die Sonne schon hoch und das Gold kocht in der Zapfsäule. Das Gold, das Geld, die Klunker, all das, was ihm die Dealer und Menschenhändler aus der Stadt anvertrauen, weil ihnen dort irgendjemand auf den Fersen ist. Die defekte Zapfsäule ist das beste Versteck. Es steht den Leuten so unmittelbar vor der Nase, dass niemand darauf kommt, genau dort zu suchen. Nicht mal die Polizei, die natürlich auch schon da war. Er pfeift. Die Töle kommt nicht.
Heute Morgen noch alles wie immer. Mit Tessa Kunden erschrecken, was vielleicht nicht geschäftsförderlich, aber dafür lustig ist. Dann sehr früh mit dem Trinken anfangen. Das Zeug aber in der Hitze so schnell wieder ausschwitzen, dass die entsprechende Dröhnung ausbleibt. Genervt von allem in die Stadt fahren und sich nach einer Frau sehnen. Aber wie üblich sehnt sich keine nach ihm, weshalb er sich eine kaufen muss und selbstverständlich quälen will, und dann haut die einfach ab.
Endlich spürt er Tessas warmen Körper an seinem Bein. Tessa würde ihn nie verlassen. Wo sie doch sein Halt ist und sein bester Freund. Er kann sich gar nicht mehr vorstellen, ohne sie zu sein. Ja, Tessa ist ’ne Gute.
Sie steht neben ihm und schaut ihn an, wie sie ihn anschaut, wenn sie was zu fressen will, denkt er. Und dann zeigt sie ihm ihre Zähne, die er ihr putzt und für die er extra Kost besorgt, damit die Beißerchen stark und hoffentlich Furcht einflößend ausschauen, und er muss sagen, es hat sich gelohnt.
Tessa knurrt ihn unverhohlen an, und Milo macht sich fast in die Hose.