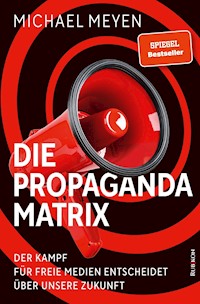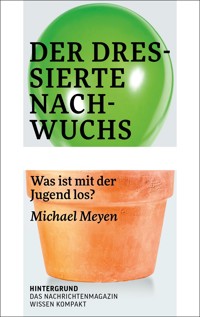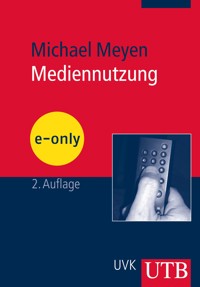Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herbert von Halem Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Michael Meyen erzählt in diesem Buch drei Geschichten: die Geschichte der Journalistenausbildung in der DDR, die Geschichte der Kommunikationswissenschaft in der westlichen Welt und seine eigene Geschichte, die eng mit den ersten beiden Geschichten zusammenhängt. Der Autor ist 1988 nach Leipzig gekommen, um Parteijournalist zu werden, und hat erlebt, wie erst der Staat verschwand, in dem er aufgewachsen ist, dann die Sektion Journalistik und schließlich auch jede Erinnerung an die Menschen, die dort gelehrt haben. Damit ist zugleich ein Paradigma entsorgt worden, das Forschung und Berufspraxis verbunden hat und deshalb eine Antwort auf die Medienkrise der Gegenwart liefern könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 626
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen BibliothekDie Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detailliertebibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.ddb.de abrufbar.
Michael Meyen
Das Erbe sind wir.
Warum die DDR-Journalistik zu früh beerdigt wurde.Meine Geschichte
Köln: Halem, 2020
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme (inkl. Online-Netzwerken) gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
© 2020 by Herbert von Halem Verlag, Köln
ISBN (Print)
978-3-86962-570-6
ISBN (PDF)
978-3-86962-571-3
ISBN (ePub)
978-3-86962-576-8
Den Herbert von Halem Verlag erreichen Sie auch imInternet unter http://www.halem-verlag.deE-Mail: [email protected]
SATZ: Herbert von Halem Verlag
LEKTORAT: Julian Pitten
DRUCK: docupoint GmbH, Magdeburg
UMSCHLAGFOTO: Armin Kühne; @ Universitätsarchiv Leipzig
GESTALTUNG: Bruno Dias, Porto (Portugal)
Copyright Lexicon ©1992 by The Enschedé Font Foundry.
Lexicon® is a Registered Trademark of The Enschedé Font Foundry.
Michael Meyen
Das Erbe sind wir
Warum die DDR-Journalistik zu früh beerdigt wurde.Meine Geschichte
Für alle, die mir ihre Geschichte geschenkt haben.
Für Antje, meinen Bruder Andreas und meine Eltern Christa und Hans-Peter, ohne die es diese Geschichte nicht geben würde.
Für Juliane, Ferdinand und Josefine, die hoffentlich die Chance bekommen, ihre eigene Geschichte zu schreiben.
MICHAEL MEYEN, Prof. Dr., Jahrgang 1967, studierte an der Sektion Journalistik und hat dann in Leipzig alle akademischen Stationen durchlaufen: Diplom (1992), Promotion (1995), Habilitation (2001). Parallel arbeitete er als Journalist (MDR info, Leipziger Volkszeitung, Freie Presse). Seit 2002 ist Meyen Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der LMU München. Seine Forschungsschwerpunkte sind Medienrealitäten, Kommunikations- und Fachgeschichte sowie Journalismus.
INHALT
1.WAS NACH REDAKTIONSSCHLUSS PASSIERT IST
2.WARUM DAS FASS NOCH EINMAL AUFGEMACHT WERDEN MUSS
3.WIE ICH GESCHICHTE SCHREIBEN WILL
4.WARUM DIE VERGANGENHEIT NICHT VERGEHT
Ein Podium, in dem alles drin ist – sogar die Ostsee-Zeitung
5.WIE ICH PARTEIJOURNALIST WERDEN WOLLTE
Ein sehr persönliches Kapitel, das von Rügen über einen T-34 in den Leipziger Herbst führt
6.WO BRIGITTE KLUMP STUDIERT HAT
Eine Reise in die 1950er-Jahre, vermittelt von Ingeborg Schmidt
7.WIE DIE LEIPZIGER JOURNALISTIK DER NABEL DER WELT WERDEN KONNTE
Eine kurze Geschichte der Kommunikationswissenschaft
8.WIE ILSE, NIKOLAI UND TILO ZU IHREM DIPLOM GEKOMMEN SIND
Drei Studentenleben, stellvertretend für mehr als 5000 andere
9.WAS EIN WESTDEUTSCHER PASTORENSOHN AUS DEM ›ROTEN KLOSTER‹ GEMACHT HAT
Ein Ost-West-Seminar, Studenten auf der Suche und ein Minister, der mit sich reden ließ
10.WAS DER ABRISS DER LEIPZIGER JOURNALISTIK MIT DER KRISE DER GEGENWART ZU TUN HAT
Eine Erbengeneration, die ihren größten Schatz nicht zeigen kann
PERSONENREGISTER
1.WAS NACH REDAKTIONSSCHLUSS PASSIERT IST
Ein Buch, das den Untertitel Meine Geschichte trägt, kann den Angriff nicht auslassen, der Ende Mai 2020 auf Twitter begann und nach einem tendenziösen Bericht in der Süddeutschen Zeitung unter anderem dazu führte, dass ich meine Position als Co-Sprecher des bayerischen Forschungsverbundes »Zukunft der Demokratie« aufgegeben und meinen Blog Medienrealität eingestellt habe.1
Auf den ersten Blick hat dieser Angriff nichts mit diesem Buch zu tun. Ich schreibe hier über die Journalistenausbildung in der DDR – über ein Thema, das ich in die Fachgeschichte der Kommunikationswissenschaft einbette und als Beispiel sehe für den Umgang mit dem Erbe der DDR. Um das zuzuspitzen: Dieses Erbe wird ignoriert. Zu diesem Erbe gehören die Erfahrungen des Scheiterns, die Debatten, die dem Scheitern im langen 89er Herbst folgten, und die Ideen, die dort produziert wurden. Egal ob an runden Tischen, auf Vollversammlungen oder in den vielen kleinen Foren, die diese Zeit für alle unvergesslich machen: Es ging um die Fragen, die uns immer noch beschäftigen. Wie wollen wir zusammenleben? Wie schaffen wir es, dass alle mitsprechen können, wenn es um ihr eigenes Leben geht?2 Wie schaffen wir es vor allem, dass auch unsere Urenkel noch darüber streiten können? Was heute die Welt bedroht, in der sich viele gemütlich eingerichtet haben, stand schon vor 30 Jahren auf der Tagesordnung.
Die Antworten von damals sind verschluckt worden von einer Vereinigungsmaschine, die nur einen kleinen Teil der Ostdeutschen brauchte, um genauso weitermachen zu können wie vorher – die Opposition und die Reste der bürgerlichen Milieus, denen Uwe Tellkamp in seinem Roman Der Turm ein Denkmal gesetzt hat.3 Man muss nur diesen Roman lesen, um zu verstehen, warum Ärzten, Künstlern, Ingenieuren, Kirchenleuten der Übergang von einer staatlichen Werteordnung in die andere längst nicht so schwer fiel wie den Kommunisten oder den vielen Aufsteigern, die die DDR getragen haben4 und denen ich mich schon deshalb verbunden fühle, weil ich wahrscheinlich einer von ihnen geworden wäre.
Das Erbe sind wir: Dieser Titel meint nicht nur Menschen wie mich, sondern auch das, was wir einbringen können. Dieses Buch erzählt eine Geschichte, die ich selbst erlebt habe. Mit der Leipziger Sektion Journalistik ist ein Paradigma entsorgt worden, das Forschung und Berufspraxis verbunden hat und heute helfen könnte, die Redaktionen aus der Umklammerung der Politik zu befreien oder von den Zwängen einer kommerziellen Medienlogik, für die Aufmerksamkeit alles ist und alles andere nichts. Das ist kein Plädoyer für eine Rückkehr zur DDR oder gar zu den ideologischen Prämissen, die die Parteipresse genauso unglaubwürdig gemacht haben wie die TV-Nachrichtensendung Aktuelle Kamera.5 Der Journalismus war damals kein Journalismus, sondern politische PR.6
Gerade die Gängelung durch die SED hat allerdings, das hoffe ich in diesem Buch zu zeigen, ein Journalismusideal gefüttert, das »Öffentlichkeit als gesellschaftlichen Auftrag« sieht.7 In Kurzform: erst das Handwerk, dann die Haltung. Alle Perspektiven und Interessen zu Wort kommen lassen, ohne die (Ab-)Wertung gleich mitzuliefern. Dieser journalistische Auftrag lässt sich leicht mit einem Demokratieverständnis verbinden, das alle als Freie und Gleiche anerkennt und den öffentlichen Debattenraum braucht, um den Frieden nach innen und nach außen zu sichern. Auch hier wieder in Kurzform: Öffentlichkeit ist der Ort, an dem Pluralität und Heterogenität in Einklang gebracht werden können. Öffentlichkeit ist das »Herzstück« der Demokratie, weil wir hier zu »argumentativen Anstrengungen« gezwungen sind, um unsere subjektiven Interessen zu objektivieren.8
Wer wie ich unter Zeitungen gelitten hat, die die Lesbarkeit und die Gunst ihres Publikums auf dem Altar der Interessen ihrer Besitzer geopfert haben, hat das Schlagwort ›publizistische Vielfalt‹ als Versprechen verstanden.9 Ich war nicht dabei, als Armin Kühne am 16. Oktober 1989 das Cover-Foto geschossen hat, wie vermutlich die meisten nicht, die mit mir studiert haben. »Pressefreiheit« und Sektion Journalistik: Das passt auch aus historischer Distanz nicht zusammen. Zwei Tage nach dieser Leipziger Montagsdemo ist neben Erich Honecker auch Joachim Herrmann zurückgetreten, sein Adlatus für Agitation und Propaganda. Fortan, so habe ich das damals gesehen, fortan wird es möglich sein, über all die unterschiedlichen Meinungen und Interessen zu diskutieren, die es in einer Gesellschaft gibt. Man wird sich nicht immer einigen können, natürlich nicht, sich aber selbst ein Bild machen können, weil die entsprechenden Informationen und die wichtigsten Interpretationen für jeden zur Verfügung stehen.
Mein Blog Medienrealität war diesem Ideal verpflichtet. Ich habe den öffentlichen Debattenraum dort mit den Mitteln der Wissenschaft seziert und all das kritisiert, was die Erfüllung des Auftrags Öffentlichkeit gefährdet. Ich will mir nicht anmaßen, hier einen schärferen Blick zu haben als andere, da es in diesem Buch aber um das ›Erbe‹ geht (ein positiv besetzter Begriff), das Menschen wie ich einzubringen haben, möchte ich hier wenigstens einen Punkt setzen und dafür den Sozialkonstruktivismus bemühen.
Jeder Mensch wird in eine »institutionelle Ordnung« hineingeboren, die uns »Wissen« über die »Wirklichkeit« liefert (über Phänomene, die ohne unser Wollen da sind). In dieser »institutionellen Ordnung«, die durch eine »symbolische Sinnwelt« legitimiert wird (etwa: Katholizismus, Marxismus, Neoliberalismus), leben wir normalerweise »ganz naiv« vor uns hin – solange jedenfalls, wie der Alltag funktioniert und bis »eine Gesellschaft auf eine andere stößt, die eine ganz andere Geschichte hat«.10 Vermutlich muss ich gar nicht mehr ausformulieren, worauf diese Argumentation hinausläuft. In den späten 1980ern hat der Alltag in Leipzig nicht mehr funktioniert. Es hat gestunken, die Läden waren leer, die Menschen sind weggelaufen – und in der Realität der Medien war der Sozialismus trotzdem auf der Siegerstraße.
Die ›institutionelle Ordnung‹ der Gegenwart und die ›symbolische Sinnwelt‹, die sie legitimiert, waren für mich nicht einfach da. Ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, die keinen Grund haben, beides in Frage zu stellen. Ich muss dafür nur durch München gehen. So viel Reichtum und so viele braungebrannte Gesichter. Gerade mit Blick auf die existenziellen Fragen, die wir in den nächsten Jahren beantworten müssen, sollten diese Menschen aber auch verstehen, welche Vorteile es hat, ›institutionelle Ordnung‹ und ›symbolische Sinnwelt‹ stets einem Wirklichkeitstest zu unterziehen. Das ist das, was Menschen wie ich zu bieten haben. Das ist das ›Erbe‹, auf das der Buchtitel anspielt. Und dafür steht der Ruf nach »Pressefreiheit«, der für den flüchtigen Blick weit weg vom Thema DDR-Journalistik zu sein scheint.
Anmerkungen
1Vgl. Michael Meyen: Kontroverse um »Medienrealität«. In: Michael Meyen (Hrsg.): Medienrealität 2020. https://medienblog.hypotheses.org/9621 (5. Juni 2020)
2Vgl. Stephan Lessenich: Grenzen der Demokratie. Teilhabe als Verteilungsproblem. Stuttgart: Philipp Reclam 2019, S. 18
3Uwe Tellkamp: Der Turm. Geschichte aus einem versunkenen Land. Roman. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2008
4Vgl. Lutz Niethammer: Erfahrungen und Strukturen: Prolegomena zu einer Geschichte der Gesellschaft der DDR. In: Hartmut Kaelble, Jürgen Kocka, Hartmut Zwahr (Hrsg.): Sozialgeschichte der DDR. Stuttgart: Klett-Cotta 1994, S. 95-115
5Vgl. Franziska Kuschel: Schwarzhörer, Schwarzseher und heimliche Leser. Die DDR und die Westmedien. Göttingen: Wallstein 2016, Michael Meyen: Denver Clan und Neues Deutschland. Mediennutzung in der DDR. Berlin: Ch. Links 2003
6Vgl. Anke Fiedler: Medienlenkung in der DDR. Köln: Böhlau 2014
7Horst Pöttker (Hrsg.): Öffentlichkeit als gesellschaftlicher Auftrag. Klassiker der Sozialwissenschaft über Journalismus und Medien. Konstanz: UVK 2001
8Rainer Mausfeld: Warum schweigen die Lämmer? Wie Elitendemokratie und Neoliberalismus unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrundlagen zerstören. Frankfurt/M.: Westend 2018, S. 192
9Vgl. Günther Rager, Bernd Weber: Publizistische Vielfalt zwischen Markt und Politik. Eine Einführung. In: Günther Rager, Bernd Weber (Hrsg.): Publizistische Vielfalt zwischen Markt und Politik. Mehr Medien – mehr Inhalte? Düsseldorf: Econ 1992, S. 7-26
10Peter L. Berger, Thomas Luckmann: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch 2016, S. 112
2.WARUM DAS FASS NOCH EINMAL AUFGEMACHT WERDEN MUSS
Dieses Buch erzählt eine deutsche Geschichte, die zwar in der DDR spielt und schon vorher angefangen hat, aber noch lange nicht vorbei ist. Auf den ersten Blick hat diese Geschichte nichts zu tun mit den Dingen, die uns gerade auf den Nägeln brennen. Es geht nicht um Klima, Natur oder Pandemien und auch nicht um die großen Fragen von Krieg und Frieden oder von Arm und Reich. Warum, so ließe sich das zuspitzen, beschäftige ich mich mit der Ausbildung von Journalisten, wenn die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel steht? Und warum steige ich dafür gewissermaßen in die Gruft und schreibe nicht über die Medienrealität der Gegenwart?
Ich bin »Exil-Ostdeutscher«. So hat Yana Milev, 1964 in Leipzig geboren, Menschen genannt, die in der DDR aufgewachsen und dann in ein »fremdes Land« gekommen sind, ohne ihre »Heimat« zu verlassen.1 Mein Gepäck habe ich bei der Ankunft versteckt. Ich musste dieses Gepäck verstecken, weil all das, was mich vorher ausgemacht hat, im größeren Deutschland verpönt war. Ich konnte nichts vom Widerstand berichten oder vom Überleben in einer Nische. Am 9. Oktober 1989 war ich in Leipzig, aber nicht in der Nikolaikirche, sondern in einer Parteiversammlung an der Sektion Journalistik. Und als ich mit Hammer und Zirkel im Ährenkranz demonstriert habe, riefen die meisten schon »Wir sind ein Volk«.
Die Mehrheit hat nicht immer Recht und der Sieger schon gar nicht. Im Dezember 1990 hat die sächsische Regierung beschlossen, meinen Studiengang zu schließen – angetrieben vom Trommelfeuer der Leitmedien und später bestätigt durch Publikationen, die alles in Bausch und Bogen verworfen haben, was an der Sektion Journalistik in Leipzig gemacht worden war. Die Folgen konnte ich an mir selbst beobachten. ›Exil-Ostdeutsche‹ wie ich haben versucht, die besseren Westdeutschen zu werden, und dabei auch all das tief in uns vergraben, was den hegemonialen Diskurs hätte aufbrechen können. Dieser Mechanismus scheint mir universell zu sein und wäre schon für sich genommen Grund genug gewesen, dieses Buch zu schreiben. Wer Erfahrungen oder Ideen hat, die der dominanten Deutung widersprechen, muss entweder schweigen, um die eigene Reputation nicht zu gefährden, oder in Arenen ausweichen, die der Stimme von vornherein jede Wucht nehmen.
In diesem Buch geht es um mehr. Die kleine Sektion Journalistik steht hier pars pro toto für einen Vorgang, den Yana Milev »Kulturkatastrophe«2 nennt. Was diese Soziologin aus der Vogelperspektive und mit einem Vokabular macht, das keinen Raum für Zweifel lässt (›Regime Change‹, ›Schockstrategien‹, ›Landnahme‹, ›struktureller Kolonialismus‹, ›neoliberale Annexion‹), schaue ich mir aus der Nähe und mit dem Blick des Insiders an, der die DDR nicht nur mit der Bundesrepublik oder mit den USA vergleichen kann, sondern auch weiß, wie es ab 1991 weitergegangen ist in seinem Feld. Was ich dabei sehe, erlaubt zu verstehen, warum der deutsche Osten auch 30 Jahre später anders ist als der Rest des Landes.
Punkt 1: Es gibt keine Sektion Journalistik mehr. Nichts, nada, niente. Inhalte weg, Personen weg, alles weg. Entsorgt auf dem Müllhaufen der Geschichte. Etwas weniger polemisch: Die westdeutsche Fachgemeinschaft hat 1991 einen neuen Standort bekommen und in Leipzig etwas ausprobiert, was woanders nicht so leicht gegangen wäre. Mit der Tradition des Standorts oder gar mit den Menschen dort hatte das alles nichts zu tun. Motto: ein bisschen Fußvolk übernehmen (in der Verwaltung, im akademischen Mittelbau), das Sagen aber haben wir. Mehr noch: Wir schreiben künftig auch eure Geschichte und die gemeinsame Geschichte sowieso. Karl Friedrich Reimers, der als Gründungsdekan aus München nach Leipzig kam, hat sich noch Ende 2019 bitter beklagt, als er einmal nicht auf einem einschlägigen Podium sitzen und sein Wunderwerk beweihräuchern durfte.
Punkt 2: Wer von 1990 spricht, muss von den Menschen sprechen und davon, was politische Entscheidungen aus Wünschen und Träumen machen. Der Lebensweg der Älteren war von einem Tag auf den anderen zu Ende. Übergang in das bezahlte Nichtstun, mit Mitte 50, wenn sich langsam die Souveränität einstellt, die jede akademische Ausbildung braucht. Die etwas Jüngeren wie Jürgen Schlimper, Wolfgang Tiedke oder Wulf Skaun, drei meiner Helden aus Studententagen, gerade auf dem Sprung in Richtung Professur, sind ins Nichts gefallen. Ökonomisch ist dieser Satz falsch, weil das reiche Deutschland jedem irgendwo ein Auskommen bietet. Intellektuell aber, und darum geht es hier, hat dieses Land all das Potenzial verschenkt, das in der DDR gewachsen war und das heute schon deshalb wichtig wäre, weil es den Umgang mit gesellschaftlichen Krisen einschließt und das Wissen, dass sich die Verhältnisse selbst dann verändern lassen, wenn sie in Stein gemeißelt scheinen.
Das führt direkt zu Punkt 3: Mit der Sektion Journalistik ist ein Paradigma entsorgt worden, das Forschung und Berufspraxis verbunden hat. Anders formuliert: Wer heute fragt, wie man die Redaktionen aus der Umklammerung der Politik befreien kann oder von den Zwängen einer kommerziellen Medienlogik, für die Aufmerksamkeit alles ist und alles andere nichts, der findet hier eine mögliche Antwort. Das klingt zunächst befremdlich. Das ›rote Kloster‹ in Leipzig, der Prototyp einer Schule für Parteijournalisten, als Lösung für die Medienkrise der Gegenwart? Ich werde den Spieß umdrehen und zeigen, wie die Gängelung durch die Herrschenden ein Journalismusideal füttern konnte, bei dem ›umfassende demokratische Öffentlichkeit‹ im Zentrum steht. Handwerk statt Haltung.
So gesehen, schreibe ich doch über die Medienrealität der Gegenwart. Ich lasse Menschen sprechen, die marginalisiert worden sind oder sich freiwillig zurückgehalten haben, weil sie in der DDR zur Elite gehört haben oder in diesem Land etwas werden wollten. Wir brauchen die Geschichten dieser Menschen. Wir brauchen die vielen Ideen, die in den anderthalb Jahren des langen 89er Herbstes reifen konnten, als die alten Fesseln abgestreift waren und die neuen nur eine Ahnung am Horizont. Ohne diese Geschichten und ohne diese Ideen können wir nicht verstehen, warum es im Osten immer noch gärt und wie wir die Probleme angehen müssen, die das deutsch-deutsche Klein-Klein schon jetzt in den Hintergrund rücken lassen.
Anmerkungen
1Yana Milev: Das Treuhand-Trauma. Die Spätfolgen der Übernahme. Berlin: Das Neue Berlin 2020, S. 246f., vgl. Yana Milev: Entkoppelte Gesellschaft – Ostdeutschland seit 1989/90. Drei Bände. Berlin: Peter Lang 2019/20
2Milev: Treuhand-Trauma, S. 8, 36, 49, 69, 91, 117, 252
3.WIE ICH GESCHICHTE SCHREIBEN WILL
Eigentlich sollte dieses Buch Rückkehr nach Leipzig heißen. Ich wollte schon im Titel einen Anspruch signalisieren, der weit über die Journalistik hinausgeht, und mich deshalb an Didier Eribon anlehnen.1 Der Bestseller Rückkehr nach Reims erklärt, was viele nicht nur in Frankreich unerklärlich finden: Wie konnte es passieren, dass die extreme Rechte in diesem Land heute ausgerechnet von denen gewählt wird, die auf den ersten Blick nichts zu verlieren haben als ihre Ketten und deshalb früher, in den 1960ern und vielleicht sogar noch in den 1980ern, gewissermaßen mit einem roten Parteibuch zur Welt kamen? Als wenn diese Frage nicht schon außerordentlich genug wäre, widmet sich ihr ein Autor, der Ungewöhnliches erlebt hat. Homosexualität in der Provinz, der Bruch mit dem Vater und mit der Familie, Freundschaften mit Bourdieu und Foucault. Das ist der Stoff, der soziologische Analysen auf die große Theaterbühne bringt.2
Wer 2020 Rückkehr nach Leipzig auf einen Buchdeckel schreibt, sagt: Ich werde den Osten Deutschlands erklären. Ich werde erzählen, warum die Menschen dort ›drüben‹ unzufrieden sind. Warum sie all das nicht zu genießen scheinen, was die Einheit ihnen beschert hat, Autobahnen, hübsche Fassaden, Kreuzfahrten in die weite Welt, und stattdessen so wählen, dass die großen Medienhäuser in München, Hamburg, Frankfurt immer wieder Reporter ausschwärmen lassen müssen. Und: Ich werde das alles mit einer persönlichen Geschichte verbinden, die so unerhört ist und so spannend, dass sie ein ganzes Buch trägt.
Ich habe gemerkt: Dieser Titel ist zu groß. Es geht um die DDR, das schon. Es geht auch um das, was aus diesem Land geworden ist und aus den Menschen, die dort gelebt und gearbeitet haben. Es geht aber nicht um alle, sondern nur um die, die ich am besten kenne: Journalistinnen und Journalisten und ihre Ausbilder an den Universitäten. Ich bin 1988 zum Studium nach Leipzig gegangen, um Heinz Florian Oertel zu beerben oder Chefredakteur zu werden. So ganz genau weiß man das nicht, wenn man 21 ist und seine Jugend auf der Insel Rügen verbracht hat. Vor allem wusste ich damals nicht, dass der Weg auf den Kommentatorensessel bei einem Fußball-Länderspiel unendlich viel weiter ist, wenn man sein Volontariat bei der Ostsee-Zeitung macht und nicht beim Fernsehen, vielleicht sogar mit dem großen Oertel als Mentor. Dass Leipzig dann in die Geschichtsbücher eingehen würde, konnte ohnehin niemand wissen.
Heute bin ich Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität München. Das heißt: ein kleines Licht, verglichen jedenfalls mit Didier Eribon und all jenen, die sonst glauben, ihre Lebensgeschichte in ein Buch gießen zu müssen. Die Kommunikationswissenschaft ist in diesem Land so unbedeutend, dass man den meisten erst einmal erklären muss, was wir da machen. Nein: Wir interessieren uns nicht für Gespräche wie das, was wir gerade führen, und auch nicht für das, was zwischen dir und deiner Chefin gerade läuft. Wir untersuchen Medien. Massenmedien. Öffentliche Kommunikation. Bei uns studieren auch Menschen, die in den Journalismus wollen, sie lernen dabei aber nicht, wie man einen Artikel schreibt oder einen Film dreht, sondern wie man solche Medienprodukte analysiert und ihren Wirkungen auf die Spur kommt.
Die öffentliche Resonanz auf unsere Forschung geht gegen Null. Wenn irgendetwas schief läuft mit den Medien, werden eher Soziologen gefragt, Philosophen oder Politiker. Welterklärung verkauft sich besser als eine Sozialwissenschaft, die jeden ihrer Befunde mit einem ›Wenn und Aber‹ versehen muss und schon deshalb nicht dazu neigt, irgendeinen Alarmismus zu bedienen. Vermutlich war diese Bedeutungslosigkeit mein Glück. Ich kann mir immer noch schwer vorstellen, dass man mit meiner Kaderakte in diesem Deutschland einen Posten bekommt, der außerhalb der kleinen akademischen Disziplin, die ich vertrete, für wichtig gehalten wird. Dafür war ich aller Jugend zum Trotz schon zu tief drin in einer DDR, die im hegemonialen Diskurs als Diktatur konstruiert wird. Die Stasi und die Mauer. Bautzen und Torgau. »Wenn ich DDR höre, dann denke ich an Schmerz«, sagte Jan, ein Schüler aus Bayern, damals 16 Jahre alt und ohne jeden Kontakt in den Osten, als wir ihn 2012 in einer Studie zum kollektiven Gedächtnis befragt haben. »Diese Unterdrückung. Die Leute wurden da mehr oder weniger eingepfercht. In so ein großräumiges KZ. Jeder musste immer genau angeben, was er tut.«3
In diesem Lager (um in Jans Bild zu bleiben) war ich dazu ausersehen, für gute Laune zu sorgen. Ist doch schön hier. Was nicht schön ist, wird schon noch. Habt Geduld. Im Zweifel ist der Kapitalismus schuld. Egal ob bei der Presse in Rostock oder beim Fernsehen in Berlin-Adlershof: In der DDR wurde man nur dann Journalist, wenn einem dieser Staat und seine Idee vom Sozialismus irgendwie gefielen. Ich habe mich immer amüsiert, wenn meine Studenten in München akribisch aufzählen wollten, was sich die SED alles ausgedacht hatte, um den Spielraum in den Redaktionen zu begrenzen. Agitationskommission, Abteilung Agitation, Donnerstags-Argu, Presseamt. Die Nachrichtenagentur ADN. Die Staatssicherheit. Und über allem der General-Chefredakteur, eine Rolle, die Erich Honecker viel mehr geliebt und gelebt hat als Walter Ulbricht.4 Das gab es, keine Frage. Nur: Wie überall steht und fällt auch in den Medien alles mit der Personalauswahl. Die Ostsee-Zeitung hätte nie und nimmer einen unsicheren Kantonisten eingestellt. Es war dort Mitte der 1980er-Jahre schon schwer, ein Volontariat zu bekommen, wenn man nicht versprechen wollte, gleich nach seinem 18. Geburtstag Kandidat der führenden Partei zu werden.
Ein SED-Mitglied an der Universität München. Ein kommunistischer Agitator. Ich werde später berichten, wie Ulrich Hörlein darauf reagiert hat, lange Ministerialdirigent im bayerischen Wissenschaftsministerium und dort 2002 für meine Berufung zuständig. So aufregend das für mich und meine Familie auch war (meine Frau bekam in dieser Zeit eine Gesichtslähmung, die man noch sehen kann, wenn man ganz genau hinschaut): Eigentlich ist das alles nichts, was man vor einem größeren Publikum ausbreiten sollte. Aus meinen Studien zur Medienlogik weiß ich, dass es dafür Prominenz braucht, Konflikte mit Spitzenleuten oder irgendetwas, das es so noch nicht gegeben hat.5 So vermessen kann niemand sein, der jeden Tag aus einer 60-Quadratmeter-Wohnung in Haidhausen in ein kleines Universitätsinstitut am Rande des Englischen Gartens spaziert und dort Mühe hat, drei Retweets zu bekommen und den Vorlesungssaal bis zum Ende des Semesters wenigstens nicht ganz leer zu spielen.
WER WARUM DDR-GESCHICHTE SCHREIBT
Ich schreibe dieses Buch, weil es sonst niemand tut. Fast bin ich geneigt zu sagen: niemand tun kann. Wer Geschichte schreiben darf, bestimmt der Staat. Es braucht dafür eine Position im Wissenschaftsbetrieb (an einer Universität oder in einem Forschungsinstitut, in einem Museum oder in einer Behörde, die die Akten hütet). Natürlich kann sich jeder daheim an den Computer setzen und vorher vielleicht sogar in die Archive fahren, wenn sein Partner das denn toleriert und das Konto ein Auskommen sichert. Ohne eine Position im akademischen Feld aber bleibt das Selbstbefriedigung. Mehr noch: Es braucht eine Position am Machtpol dieses Feldes, um gehört (rezensiert, zitiert) zu werden. In der Wissenschaft ist Reputation alles und jedes Urteil über die Qualität von Forschung in diesem Licht zu lesen. Der Matthäus-Effekt6: »Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat«.
Den Bürgerinnen und Bürgern der DDR ist ihre Geschichte genommen worden – zumindest all denen, die sich nicht wiederfinden in einem Narrativ, das vom Diskurs ›individuelle Freiheit‹ bestimmt wird und so ganz automatisch alles abwertet, was diese Freiheit einschränkt.7 Ein Staat, der sich offen einmischt in die Erziehung der Kinder, der den Feierabend in den Betrieben mitgestalten will und das Leben in Wohngemeinschaften und der zum Beispiel auch entscheidet, wie viele Menschen Journalistik studieren dürfen, und als Gegenleistung für den Studienplatz erwartet, dass jeder Absolvent die ersten drei Jahre nach dem Abschluss dort arbeitet, wo man ihn hinstellt.
Für meine Freundin und mich war das eine sehr konkrete Drohkulisse. Was tun, wenn der eine zurück an die Ostsee geschickt wird und der andere nach Karl-Marx-Stadt oder gar nach Hainichen? Wo würde unsere Tochter bleiben, die gerade ihren ersten Geburtstag gefeiert hatte, als wir nach Leipzig kamen? Wir haben uns deshalb im Frühsommer 1989 einen Termin beim Standesamt besorgt (für den 1. September 1990, kurz vor Beginn des dritten Studienjahres, in dem die Kommission entscheiden sollte und das dann hoffentlich zum Wohl des frisch vermählten Paares tun würde), und ich habe schon im zweiten Semester begonnen, auf eine Promotion hinzuarbeiten, um vielleicht als Forschungsstudent in Leipzig bleiben zu können und damit in der Nähe aller Lokalredaktionen der Freien Presse. Beides hat uns dann tatsächlich geholfen, allerdings ganz anders als gedacht. Die Wohnung, die wir im Herbst 1989 in Flöha bekommen hatten, stand im Frühjahr 1990 plötzlich unter Privilegienverdacht. Zweieinhalb Zimmer in einem Plattenbau, der inzwischen abgerissen worden ist und in dem man damals den Nachbarn beim Pullern lauschen konnte. Keine große Sache. Schwiegervater war aber im Ehrenamt Vorsitzender der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft ›1. Mai‹ und wie alle Funktionäre plötzlich suspekt. Sollte er nicht doch der eigenen Tochter an allen Regeln vorbei etwas zugeschanzt haben, was nur Verheirateten zustand? Ein Glück, dass wir den Trausaal im Schloss Augustusburg schon lange reserviert hatten. Und nochmal Glück, weil aus der Dissertation eine Laufbahn in der Wissenschaft wurde und damit ein Lebensunterhalt für die Familie.
Zurück zum Thema: Strukturen wie das System aus Delegierung und Absolventenlenkung, das die SED im Mediensystem der DDR etabliert hatte, schränken das eigene Handeln ein. Immer und überall.8 Ich konnte nicht einfach an die Universität gehen und mich für Journalistik einschreiben, und mir wäre ganz sicher nicht in den Sinn gekommen, nach Abgabe der Diplomarbeit mal eben beim Fernsehen anzurufen und mich dort als Nachfolger von Heinz Florian Oertel zu bewerben. Genauso wenig komme ich heute aber auf die Idee, das zu verurteilen, was damals war. Ohne Strukturen kann man nicht handeln. Ich wusste, wie man in der DDR Journalist wird. Am besten schon in der Schule ein paar Beiträge schreiben für die örtliche Presse, vielleicht einen der Lehrgänge für Volkskorrespondenten besuchen, sich womöglich für einen längeren Wehrdienst verpflichten, wenn man ein Mann war (als Loyalitätsbeweis), auf jeden Fall ein Volontariat durchlaufen, von dort hoffentlich zur Aufnahmeprüfung für das Studium delegiert werden und schließlich mit einem Diplom in der Tasche die Welt verbessern. Warum nicht. Wie bei jeder Struktur war auch der Weg in den DDR-Journalismus längst nicht immer so geradlinig, wie ich ihn gerade skizziert habe. Es ging zum Beispiel auch ohne längeren Wehrdienst, und wenn Mama und Papa Beziehungen hatten, dann hat die Zeitung die Tochter aus gutem Hause auch ohne Textproben und Test genommen. Dazu später mehr.
Worauf es mir an dieser Stelle ankommt: Solche Geschichten aus dem Alltag werden nicht erzählt – zumindest nicht in den Leitmedien, die das DDR-Bild bestimmen, und auch nicht in den Schulbüchern oder in den Museen, die der Staat finanziert. Es gibt dort keine DDR ohne Stacheldraht, ohne bärbeißige Funktionäre und ohne Spitzel, obwohl der Geheimdienst längst nicht omnipräsent und den allermeisten Menschen vor dem Herbst 1989 eigentlich egal war.9 Was seitdem in der Öffentlichkeit über die DDR erzählt wird, dient vor allem dazu, das politische System der Bundesrepublik zu legitimieren. Dieser Staat lässt sich das etwas kosten und fährt dabei Geschütze auf, vor denen jeder Einzelforscher nur kapitulieren kann.
Unser ›Wissen‹ über die DDR ist Ergebnis einer Geschichtspolitik, bei der es auch um den Zugang zu Fördertöpfen und Steuergeldern ging und geht, um Eitelkeiten, um persönliche Macht. »Delegitimierung der DDR«: Das sei der »Sonderauftrag« für Joachim Gauck gewesen, schreibt Daniela Dahn, einst Journalistik-Studentin in Leipzig, in ihrer »Abrechnung« mit der »Einheit«. Dieser »Sonderauftrag« erlaubte Gauck, eine Behörde aufzubauen, die zeitweise 3.000 (!) Mitarbeiter hatte und jedes Jahr immer noch rund 100 Millionen Euro kostet.10 Das ist mehr Geld, als die Universität Bamberg in ihrem Etat hat, und erklärt, wie das entstehen konnte, was Wolfgang Wippermann »Diktatur des Verdachts« nennt.11 Folgt man diesem westdeutschen Historiker, Jahrgang 1945, dann wurde die ›Dämonisierung‹ des anderen deutschen Staates nicht nur von den Hütern der Stasiunterlagen vorangetrieben, sondern zum Beispiel auch vom Forschungsverbund SED-Staat an der Freien Universität Berlin unter der Leitung von Klaus Schroeder oder von Hubertus Knabe, der 1992 eine Stelle bei der Gauck-Behörde bekam, dann von 2000 bis 2018 Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen war und bei Wippermann als »Großinquisitor« firmiert.12
Um nicht falsch verstanden zu werden: Die DDR-Forschung ist weit mehr als Gauck, Schroeder, Knabe. Das war schon vor 1989 so und ist danach noch viel besser geworden, weil es jetzt Akten gab, meist keine Sperrfristen und jede Menge Neugier selbst bei denen, die unter dem Dach von Gauck-Birthler-Jahn arbeiten durften. Um nur ein Beispiel herauszugreifen, das ich besonders gut kenne: Es gibt zum Thema Medien ein Buch von Rolf Geserick, geschrieben in den 1980ern nur mit dem Material, das damals im Westen öffentlich zugänglich war – und trotzdem erstaunlich nah dran an dem, was Anke Fiedler, geboren 1981 in Stuttgart, ein Vierteljahrhundert später aus den Tiefen des Bundesarchivs zutage fördern konnte.13 Nur: Geschichtspolitik wird nicht mit Dissertationen gemacht, sondern von Institutionen, die Medienstars an ihrer Spitze haben und schon wegen ihrer Ressourcen in der Lage sind, die Klaviatur einer medialisierten Gesellschaft zu bedienen.
Geschichtspolitik wird auch im Parlament gemacht, und das nicht nur über den Haushalt. Der Bundestag hat 1992 und 1995 zwei Enquete-Kommissionen eingesetzt, beide mit dem Schlagwort ›SED-Diktatur‹ im Titel (erst zur »Aufarbeitung von Geschichte und Folgen« und dann zur »Überwindung der Folgen im Prozess der deutschen Einheit«). Vorsitzender war jeweils Rainer Eppelmann, einer der Köpfe der Opposition in der DDR und dann für die CDU im Parlament. Die Hinterlassenschaft der beiden Kommissionen ist online. 32 Bücher, im Volltext durchsuchbar. Viele Videos, Bilder, schier endlose Experten- und Zeitzeugenlisten. Wie gesagt: Selbst mit einem Lehrstuhl für Zeitgeschichte hat man jeden Kampf um Definitionsmacht verloren, bevor er überhaupt beginnen kann. Die Politik hat das erledigt, was sonst Sache der Geschichtswissenschaft ist,14 und sie hat auch die normale Reihenfolge einfach umgedreht. Erst das Ergebnis, dann die Forschung. SED-Diktatur. Punkt. Wie wichtig das für die damals gerade Herrschenden war, zeigt ein Blick auf die vier Enquete-Kommissionen, die der Bundestag seit 2010 eingesetzt hat. Dort ging bzw. geht es um Nachhaltigkeit, um künstliche Intelligenz sowie (gleich zweimal) um die Digitalisierung und damit, wenn man so will, um die Menschheitsfragen der Gegenwart.
Die akademische Journalistenausbildung kommt in dem Enquete-Konvolut aus den 1990ern nicht wirklich gut weg. Andreas G. Graf, ein Historiker aus der DDR, der 1990 im Alter von 38 Jahren an der Humboldt-Universität zum Thema Anarchismus promovierte, beschreibt dort die Anforderungen an Volontäre beim Fernsehen als »ideologisches Vorreinigungsset unter direkter Aufsicht«. Im Klartext: Journalist wurde man in der DDR nur, wenn man parierte und, so suggeriert es der Text in den nächsten Zeilen, wenn man bereit war, jederzeit in das Ministerium für Staatssicherheit zu wechseln, falls man nicht ohnehin schon von dort bezahlt wurde. »Es gab in der DDR mithin eine Art umgekehrtes Berufsverbot, nämlich ein Berufsgebot. Die Jugend wurde nach Wunschbildern teilweise sehr alter Menschen vorsortiert, und zwar von Menschen, die ohne Lernprozesse immer älter wurden«.15
Durch die Brille eines Anarchisten, der in der DDR erst spät zu akademischen Weihen kam und sich zumindest wissenschaftlich sonst kaum mit Medien und Öffentlichkeit beschäftigt hat, mag das so ausgesehen haben. Andreas G. Graf ist tot. Ich mag ihm nichts Schlechtes hinterherrufen. Gunter Holzweißig, Autor des zweiten Enquete-Textes zum Thema, wusste schon immer, was vom Journalismus in der DDR zu halten ist. »Ein uniformer, grobschlächtig-undifferenzierter Mechanismus«.16 Bei anderen müsste man dazuschreiben, dass das Zitat von 2011 ist. Nicht so bei Gunter Holzweißig. Er hat nach 1990 einfach das gleiche geschrieben wie vorher am Gesamtdeutschen Institut, damals noch ohne Akten und ohne Zeitzeugen.17 Der DDR-Deuter Holzweißig saß nach dem Verlust seiner Lebensaufgabe zwar im Bundesarchiv (direkt an der Quelle!), aber wozu lange suchen, wenn man sich selbst zitieren kann und einem die Geschichte Recht gegeben hatte? Die Sektion Journalistik an der Karl-Marx-Universität Leipzig hat in Holzweißigs Enquete-Bericht auf der ganzen Linie versagt. »Rotlichtbestrahlung« und »fachspezifische Vorbereitung« (was immer sich dahinter verbergen mag). That’s it. Jedenfalls kein Beitrag, der irgendwelchen höheren Ansprüchen an den Journalismus dienlich gewesen wäre. Selbst die »Medienhistoriker an der Sektion Journalistik«, die mich früh mit der Aussicht auf einen Doktortitel geködert hatten, werden von Holzweißig mit einem Federstrich erledigt (»Erfüllungsgehilfen der Partei«).18
Wahrscheinlich muss ich gar nicht mehr ausformulieren, worauf diese Argumentation hinausläuft. Wie Geschichte geschrieben wird, hängt davon ab, wer sie schreibt. DDR-Geschichte wird von Westdeutschen geschrieben, die oft eine besondere Beziehung zum Gegenstand haben (Gunter Holzweißig etwa wurde 1939 in Aue geboren), von Ostdeutschen, die von der SED behindert wurden oder wenigstens nicht so in das alte System verstrickt waren, dass sie von der gesamtdeutschen Geschichtsmaschine ganz zwangsläufig ausgespuckt werden mussten, sowie von Nachgeborenen und Zugereisten. Die DDR-Eliten fehlen in dieser Aufzählung – und auch Menschen wie ich, die heute in der DDR Spitzenpositionen haben würden, wenn dieser Staat nicht implodiert wäre. Wahrscheinlich wäre ich kein zweiter Oertel geworden. Ich weiß inzwischen, dass damals viele Jungs so sein wollten wie dieser Reporter, der Goldmedaillen zu Gänsehauterlebnissen machen konnte und dabei jedes Parteichinesisch vermied.19 Aber Chefredakteur, vielleicht sogar in Berlin, oder Journalistik-Professor in Leipzig: Das hätte ich mir schon zugetraut.
Ich erzähle in diesem Buch, was aus denen geworden ist, die mit mir geträumt haben von einer Laufbahn in den DDR-Medien und dann irgendwann aufgewacht sind in einem kommerziellen Zeitungsverlag oder in einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt. Ich erzähle, wie das entstanden ist, was wir damals in Leipzig lernen sollten, was davon bis heute trägt und was aus unseren Dozenten geworden ist. Ich erzähle das oft nicht selbst, sondern lasse die sprechen, die sonst nicht zu Wort kommen jenseits der Runden von Gleichgesinnten, die immer kleiner werden.
Ich will hier nicht zu viel vorwegnehmen, aber wenigstens zwei Dinge andeuten, die ich beim Zuhören gelernt habe. Geschichtspolitik und hegemonialer DDR-Diskurs wuchern in das Private und Persönliche hinein. Und: Medienmenschen, die die DDR erlebt haben, fremdeln mit manchem, was in den Redaktionen heute passiert. Ihr Credo: Öffentlichkeit herstellen. Offen für alle, auch für alle Themen.20 Ohne es immer selbst zu wissen, sind meine Kommilitonen von einst so ein lebendes Plädoyer für eine akademische Journalistenausbildung, die sich nicht am Modell ›Fachstudium plus Volontariat‹ orientiert, das kommerziell ausgerichtete Verlage in der alten Bundesrepublik propagiert und letztlich zur Norm gemacht haben, sondern Handwerk und Selbstreflexion ins Zentrum rückt. Der Gesellschaft, so könnte man das zuspitzen, wäre sehr geholfen, wenn sie ihre Medienhäuser in jeder Hinsicht öffnen und dabei der Journalistin von morgen erlauben würde, zunächst fern vom Berufsalltag verstehen zu lernen, was sie bald tun wird. Ich könnte hinzufügen: wie früher in Leipzig, weiß aber, dass ich dafür erst noch erklären muss, was genau ich damit meine. Zu stark sind die Bilder von Rotlichtbestrahlung und vorsortierten Studenten. Deshalb zunächst nur das: Im Kleinen zeigt sich am Beispiel Journalistenausbildung und Journalismus, dass die großen Krisen der Gegenwart mit der Geschichtspolitik verknüpft sind. Ein Land, das eine große Gruppe von Menschen mehr oder weniger ausschließt oder in die zweite Reihe verbannt und die Erfahrungen dieser Menschen ignoriert oder abwertet, schwächt sich selbst.
WIE ICH EINE GESCHICHTE SCHREIBE, DIE ICH EIGENTLICH RUHEN LASSEN SOLLTE
Der Mensch ist ein Geschichtentier. Wir sind neugierig, wie andere leben, wie sie sich verhalten, was sie denken. Wir brauchen das, weil wir wissen müssen, wo wir selbst stehen und wie das einzuordnen ist, was wir machen und gemacht haben. Das geht nur, wenn wir uns mit anderen vergleichen – am besten mit denen, die uns nah sind, weil sie aus dem gleichen Milieu oder aus der gleichen Zeit stammen, weil sie mit ähnlichen Voraussetzungen angefangen haben. Ich schreibe dieses Buch deshalb zuallererst für mich. Wissenschaft als Suche nach sich selbst. Auf Englisch gibt es dafür ein Wortspiel: ›research‹ als ›me-search‹.21
Ich kann das hier so offen schreiben, weil ich Neutralität und Objektivität für Fiktionen halte. Wissenschaft wird von Menschen gemacht. Meine Geschichte: Dieser Untertitel ist keine Koketterie und keineswegs nur als Hinweis auf die autobiografischen Anteile zu lesen, die diesen Text tragen. Wie jede andere Geschichte ist auch diese Geschichte der akademischen Journalistenausbildung in der DDR kein ›Abbild‹ irgendeiner Realität. Das beginnt schon mit dem Thema (ich hätte auch über die Erfindung der Kommunikationswissenschaft schreiben können, was ich so eher nebenbei tun muss) und mit meiner Beziehung zu diesem Thema (dazu gleich mehr) und hört nicht auf bei den Gesprächen, die ich für dieses Buch geführt habe. Woran sich Menschen erinnern (wollen), hängt davon ab, wer sie fragt und wann sie gefragt werden. Davon hängt schon ab, ob sie überhaupt reden wollen.
Meine Geschichte: Das schließt ›meine‹ Zeitzeugen ein und ›meinen‹ Blick auf das, was ich in den Archiven gefunden habe. Ich habe mit den Menschen gesprochen, mit denen ich als Student am meisten zu tun hatte, oder die in irgendeiner Form herausragen und so Einblicke versprachen, die ich selbst nicht haben konnte – als Dozenten, als gewählte Studentenvertreter oder durch ihre Karriere. Manche habe ich nach knapp drei Jahrzehnten zum ersten Mal wiedergesehen und manche jetzt überhaupt erst richtig kennengelernt. Trotzdem waren das nie Gespräche zwischen Fremden. Jeder wusste, dass er dem anderen nicht wirklich etwas vormachen kann. Ich war trotzdem erstaunt, was ich alles vergessen habe. Maradona in Leipzig, Ende Oktober 1988, Lok gegen Neapel, und zwei von uns, die eine Verabredung mit ihm hatten.22 Unglaublich, aber einfach nicht mehr präsent. Vielleicht hat mich das auch deshalb so berührt, weil der rastlose Reporter, der das offenbar geschafft hatte, nicht mehr am Leben ist.
Was ich eigentlich sagen wollte: Wie ich das interpretiere und gewichte, was man mir erzählt und was in den Dokumenten steht, hängt davon ab, wer ich bin, was in meinem Leben bisher passiert ist und wie ich mir meine Zukunft ausmale.23 Bin ich ein Mann oder eine Frau, farbig oder weiß, alt oder jung, Katholik oder Marxist, ein Neuling im Metier oder viele Jahre dran am Thema? ›Wissen‹ ist nicht ohne den Menschen zu haben, der es produziert, und entspricht deshalb niemals genau dem, wovon es berichtet. Das heißt aber noch lange nicht, dass es eigentlich egal ist, welche Version der Geschichte man zur Hand nimmt. Historische Forschung steht und fällt erstens mit ihren Quellen. Jeder kann sehen, worauf ich mich stütze, und überprüfen, ob ich absichtlich Informationen unterschlage oder Gegenpositionen ausblende. Und zweitens sollte historische Forschung offenlegen, von wem sie stammt und welche Interessen sie verfolgt.
Der Untertitel Meine Geschichte ist so auch ein Lösungsvorschlag für das Problem, dass es weder ›Wissen an sich‹ gibt noch einen Schiedsrichter, der zweifelsfrei feststellen kann, wer denn nun Recht hat. Auch die quantitative empirische Sozialforschung kennt keine Methode und kein Messinstrument, die unabhängig von theoretischen Vorannahmen sind. Der autobiografische Zugang macht aus dieser Not eine Tugend. Er macht aus dieser Geschichte einen Stoff, der selbst die fesseln könnte, die mit dem Thema überhaupt nichts am Hut haben, und erfüllt zugleich die Anforderungen, die der Wissenssoziologe Karl Mannheim an wissenschaftliche ›Objektivität‹ gestellt hat. Um verallgemeinern zu können und die »Strukturdifferenz« zu verstehen, so Mannheim in einer Sprache, die ihr Alter verrät, brauche man eine »Formel der Umrechenbarkeit«.24 Zeitgemäßer formuliert: Ich muss wissen, warum der eine den Gegenstand so darstellt und der andere anders.25 Eine Autobiografie erlaubt hier das Maximum an Transparenz.
Hinabtauchen dürfen in das eigene Leben: Ich weiß, dass es ein Privileg ist, für das bezahlt zu werden, was auch die umtreibt, die Streife laufen müssen, um ihre Wohnung nicht zu verlieren, die dafür kellnern, Müll abholen, Kranke trösten. Aus diesem Privileg erwächst eine Verantwortung. Ich habe Zugang zur großen Arena (wenn auch nur über die Hinterbühne Kommunikationswissenschaft) und die Ressourcen, um so ein Buch zu schreiben. Es wäre fatal, wenn ich das nicht tun würde, zumal ich weiß, dass zumindest die darauf warten, die mir ihre Geschichten geschenkt haben, Fotos und was sonst noch übriggeblieben war von ihrem akademischen Leben in der DDR. »Durch dich leben wir weiter, Michael«, sagte Wulf Skaun Ende November 2019 bei einer Veranstaltung im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig, die im zweiten Kapitel ausführlich gewürdigt wird. Uns verbinden zwei prägende Erfahrungen: eine Umfrage zur Mediennutzung der Leipziger im Mai 1990, mit der der Hochschullehrer Skaun damals Neuland betrat, und das Ringen um ein lebensgeschichtliches Interview, das seit 2015 online ist.26 Auch wenn Wulf (wir sind seit dem Kampf um diesen Text per Du) und seine Kolleginnen und Kollegen nie und nimmer mit allem einverstanden sind, was ich über sie und ihre Arbeit schreibe: Ich weiß, dass sie diese Mühe trotzdem schätzen.
Heinz Pürer, ein Professorenkollege aus Österreich, der schon kurz nach besagter Umfrage als einer der ersten zu uns nach Leipzig in den Hörsaal kam und den ich dann viel später in München wiedergetroffen habe, hat dagegen vehement davon abgeraten, dieses Buch zu schreiben. »Nein, Michael, da bist du viel zu nah dran«. Ich höre Pürer förmlich sprechen, mit diesem Dialekt, der jeden Österreicher erst einmal sympathisch macht, und sehe, dass er Recht hat. In diesem Buch geht es um das symbolische Kapital meiner Diplomurkunde. Jeder Absolvent trägt an der Reputation seiner Universität und seiner Disziplin, so oder so. Wenn wir an der Deutschen Journalistenschule in München die Bewerber prüfen, werfen sich die Chefredakteure und Edelfedern zur Begrüßung Zahlen an den Kopf. 14, 17, 29K, 36. Das ist jeweils die Nummer der Lehrredaktion, die man selbst durchlaufen hat und die offenbar ein Leben lang an einem kleben bleibt, weil sie selbst auf Wikipedia auftaucht. Das ›K‹ steht dabei für Kompaktklasse, ein Format, das schneller zum Ziel führt und deshalb noch begehrter ist. Jede dieser Zahlen sagt: Ich bin einer von euch. Wir sind die Guten. Ich bin auch Diplomjournalist, aber aus Leipzig. Dieses ›aber‹ kann ich in den Augen der anderen sehen.
Was mir Heinz Pürer sagen wollte: Was immer du zu diesem Thema aufschreibst, man wird es dir nicht abnehmen. Du bist Partei. Man wird dir vorwerfen, dass du nur dich selbst aufwerten willst. Ja, lieber Heinz: Das will ich. Das will jeder, der ein Buch schreibt. Juan Moreno wollte alles festhalten, was zum ›System Relotius‹ zu sagen ist, und sich damit zugleich einen Schutzwall bauen aus »absoluter Transparenz«.27 Ganz so dramatisch ist die Lage für einen bayerischen Beamten wie mich hoffentlich nicht, aber ich ziele natürlich auf das, was in der Öffentlichkeit so herumschwirrt an Urteilen über meine Ausbilder und meine Kommilitonen. Auf das Verdikt von Gunter Holzweißig. Auf das Etikett ›rotes Kloster‹, das Brigitte Klump, von 1954 bis 1958 in Leipzig Studentin und dann in den Westen gegangen, der Fakultät für Journalistik in den 1970er-Jahren in einem Roman anheftete und das der Verlag dann in der Neuauflage 1991 mit dem Untertitel Kaderschmiede der Stasi an den Zeitgeist angepasst hat.28 Ich will schauen, was sich hinter diesem Etikett verbirgt, und dabei denen eine Stimme geben, die sich nicht trauen, gegen den Diktaturdiskurs anzuschreiben, oder das objektiv nicht (mehr) können.
Das ist ja das Verrückte: So ein Diskurs reproduziert sich selbst. Er bestimmt, welchen Wert eine Biografie hat, und taxiert damit auch das Gewicht von jedem, der sich in die öffentliche Arena wagt. Der Matthäus-Effekt funktioniert auch hier. Wer in den Diskurs ›passt‹, wird lauter und bekommt ein großes Publikum (etwa Wolf Biermann, der sogar im Bundestag gesungen hat und auch sonst stets gefragt wird, wenn es um die DDR geht), und wer von dem abweicht, was einmal als ›gut‹ und ›richtig‹ definiert worden ist, der schweigt. Selbst die, die es gegen jede Regel doch geschafft haben, behalten ihre Erfahrungen lieber für sich. Man muss dabei gar nicht an Andrej Holm, Jahrgang 1970, denken, der in Berlin nicht Staatssekretär sein durfte, weil er als junger Mann ein paar Monate für die Stasi gearbeitet hat, oder an Holger Friedrich, vier Jahre älter als Holm, der in eine ganz ähnliche Debatte geriet, nachdem er und seine Frau Silke im Herbst 2019 die Berliner Zeitung gekauft hatten. Für dieses Buch habe ich mit Bernd Okun gesprochen, für die Leipziger Journalistik-Studenten in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre ein Idol, weil er in seinen Vorlesungen das ansprach, was jeder dachte, aber in keiner Zeitung fand. Okun, inzwischen 75 und als Coach so erfolgreich, dass er einen Tesla fährt und sich feine Büroräume am Thomaskirchhof leisten kann, in Leipzig eine erste Adresse, sagte, er sehe »nicht so gern schriftlich« (vor allem nicht im Internet), dass er 1984 von der Sektion Philosophie an die Sektion Marxismus-Leninismus gewechselt ist. Wenn das heute jemand lese, würde er denken, »ich war ein Ideologe und ein Oberidiot«.29 Der hegemoniale DDR-Diskurs schüchtert heute selbst die ein, die früher mutig waren, weil die Fallhöhe in einer kapitalistischen Gesellschaft viel größer ist.
Eine Ausnahme ist Daniela Dahn. Das »persönliche Panorama zur Lage der Nation und zum Stand des Internationalen«, das diese Schriftstellerin 2019 vor aller Augen entfaltet hat, ist für mich einerseits ein Vorbild und andererseits auch nicht. In Kurzform: ja zur Diagnose, nein zur Methode. Es mag schon richtig sein, liebe Daniela Dahn, »dass ein verzerrtes Geschichtsbild schwerlich durch ausgewogene Gesamtdarstellungen zu erschüttern ist«, dass »das hundertmal Verschwiegene« auf »Kenntnisnahme« wartet und dass der »westliche Diskurs den fremden Blick nicht nur aushalten, sondern als Bereicherung begreifen sollte«. Die »Gegeneinseitigkeit« aber, die man einer Sachbuchautorin möglicherweise durchgehen lässt (zumal wenn sie statt »akademischer Systematik« einen »Gedankenstrom« ankündigt),30 kann sich der professionelle Historiker nicht erlauben. Ich greife stattdessen nach den Sternen und verspreche eine DDR-Geschichte, die über den Tellerrand hinausschaut – in die Bundesrepublik, in die USA. Vielleicht ist das ein Schritt zu jener »gesamtdeutschen Geschichtsschreibung«, die Jochen-Martin Gutsch, ein Ostdeutscher beim Spiegel, Jahrgang 1971, auch 30 Jahre nach dem Mauerfall noch vermisst hat.31 Möglich wird so ein großer Wurf (oder zumindest: seine Ankündigung) durch ein Thema, das klein genug ist, um sich darin wirklich auszukennen.
WAS DAS ALLES MIT DEM HIER UND JETZT ZU TUN HAT
In diesem Buch möchte ich berichten, wie man noch Ende der 1980er-Jahre auf die Idee kommen konnte, die DDR eher stärken zu wollen als sie bei Nacht und Nebel zu verlassen. Zu dieser Geschichte gehört all das, was davor und danach passiert ist. Dafür hatte ich schon einen schönen Untertitel, der den Ruf Rückkehr nach Leipzig wunderbar ergänzt hätte: Journalistik, Abriss, Medienkrise. Die Sprengkraft, die in diesem Dreiklang steckt, speist sich aus der Glaubenslehre, die im Moment die westlichen Gesellschaften dominiert:
•Journalistik, zumal in ihrer sozialistischen Variante: War es nicht ein Irrweg der Geschichte, die künftigen Propheten der herrschenden Ideologie an die Universität zu schicken und ihnen dort vor allem Handwerk beizubringen? Ist das, was dort Wissenschaft genannt wurde, etwa nicht zurecht eingestampft worden, mitsamt seinen Vertreterinnen und Vertretern? Es mag ja okay sein, dass die Reste im Archiv vor sich hin schimmeln und die Veteranen weiter ihre Treffen haben, aber ist es tatsächlich nötig, dieses Fass noch einmal aufzumachen?
•Abriss: Das führt hinein in den Streit um die Begriffe, der überall da besonders heftig tobt, wo die Interessen der Lebenden tangiert werden. Revolution. Wende. Wiedervereinigung. Umbruch. Neuaufbau. Wiebke Müller, die mit mir in Leipzig studiert hat und heute in Dresden für die Bild-Zeitung arbeitet, erinnert sich an die Unsicherheit, die das Wort ›Abwicklung‹ einst bei ihr auslöste: »Wir haben uns gefragt, was das eigentlich heißt. Werden wir jetzt dichtgemacht?« Die Beruhigungspille wurde offenbar direkt im Hörsaal verabreicht (noch so eine Sache, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnere): »Da kam eine Westdeutsche, hat tatsächlich eine Garnrolle aus der Tasche geholt und gesagt: Wir wickeln jetzt den Faden ab, aber die Rolle bleibt. Und dann kommt ein neuer Faden. Neue Leute, neue Inhalte«.32 Das Wort ›Abriss‹ weckt andere Assoziationen. Es trifft das, was passiert ist, viel besser, auch wenn das die Leute mit der Garnrolle bis heute heftig bestreiten. Ich hätte auch ›Landnahme‹ sagen können wie Hans Poerschke, einer meiner Professoren von früher,33 aber zwischen ›Journalistik‹ und ›Medienkrise‹ klingt so ein Wort mit drei Silben einfach nicht gut.
•Medienkrise: Wenn ich meinen Kolleginnen und Kollegen in der Medienforschung glaube, dann gibt es diese Krise gar nicht. Die Presse, vielleicht. Kaum noch Anzeigen und der Abonnentenstamm so alt, dass sich jede Zukunftsplanung fast von selbst verbietet. Noch weniger Anzeigen durch Corona und so noch weniger Zukunft. Aber sonst? Alles nur Gerede. Die herrschende Lehrmeinung sagt: Das Vertrauen in die Medien wächst wieder leicht oder stagniert auf hohem Niveau. Wenn das auf der Straße oder im Netz anders aussieht, dann liegt das an einer Gesellschaft, die sich polarisiert und eher dorthin schaut, wo es besonders laut ist. Und die Qualität der Berichterstattung? Alles gut, im Prinzip jedenfalls. Ein »relativ breites Meinungsspektrum«, eine »pluralistische und professionelle journalistische Medienlandschaft«.34
Ich sage, gestützt nicht nur auf die vielen Gespräche, die ich für dieses Buch geführt habe: So ganz stimmt das leider nicht. Auch hier muss ich gar nicht zu hoch greifen und zum Beispiel auf die doppelten Standards verweisen oder auf die politischen Loyalitäten der Alpha-Journalisten, die Berichte über Freunde und Verbündete anders aussehen lassen als die über Konkurrenten und Gegner und vieles von dem aus der Öffentlichkeit verbannen, was wir eigentlich diskutieren müssten.35 Ich kann beim Thema bleiben. Das Bild, das Presse und Fernsehen seit 1990 von der DDR zeichnen, hat wenig mit dem zu tun, was sich die Zeitzeugen über die Vergangenheit erzählen – vor allem, wenn sie damals im Osten Deutschlands gelebt haben.36 Die herrschende Geschichtspolitik hat es geschafft, die kritischen Geister in den Redaktionen entweder einzulullen oder ihnen die wichtigsten Publikationsplätze zu verbauen, und so sicher nicht nur mich zum Journalismuskritiker gemacht.
Natürlich: Jeder Staat (in Anlehnung an Gramsci hier verstanden als »Kristallisation der Machtverhältnisse und als umkämpftes Terrain«37) hat ein Interesse, das zu kontrollieren, was über ihn in der Öffentlichkeit gesagt wird.38 Das gilt erst recht, wenn es um die nationale Identität geht und um die Legitimation des politischen Systems. Egal ob im Ersten, in der FAZ, im Spiegel oder in der Süddeutsche Zeitung: Die DDR, die wir dort sehen, spiegelt nicht die ›Realität‹, sondern die Definitionsmachtverhältnisse. Wer hat es geschafft, seine Sicht der Dinge in der Öffentlichkeit durchzusetzen? Dass dabei mit ungleichen Waffen gekämpft wird, muss ich hier nicht wiederholen.
Die DDR der Massenmedien ist trotzdem für uns alle ganz real. Diese DDR (anders als zum Beispiel die DDR der digitalen Nostalgiegruppen) kann niemand ignorieren – selbst der nicht, der sich an etwas anderes erinnern will und vielleicht sogar alle Geschichtsberichte meidet, um sich nicht mehr ärgern zu müssen. Medien definieren, was ist. Sie ordnen die Welt. Sie liefern Kategorien, mit denen wir die Welt beschreiben können (etwa: ›Diktatur‹ oder ›totalitär‹), und sorgen so dafür, dass ihre Realitätskonstruktionen Alltagshandeln und Weltanschauungen bestimmen.39 Medienrealität ist eine Realität erster Ordnung, wie die Mauern eines Hauses, durch die wir nicht einfach hindurchmarschieren können. Die symbolische Gewalt, die von der Medienrealität ausgeht, erklärt, warum bei jeder Kritik am Journalismus auch dann das große Ganze auf dem Spiel steht, wenn es nur um die kleine DDR geht, und warum Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ganz gut leben in einem bestimmten politischen System, gar nicht so selten auf der Seite der Verteidiger zu finden sind, obwohl ihr Ethos eigentlich etwas anderes erwarten lassen sollte.
Die Begriffe ›Gewalt‹ und ›Verteidiger‹ sind mir nicht zufällig unterlaufen. Ich gehe mit Chantal Mouffe, einer belgischen Politikwissenschaftlerin, davon aus, »dass Gesellschaften stets gespalten sind« und »durch hegemoniale Praktiken diskursiv konstruiert werden«.40 Die Geschichtspolitik, die ein bestimmtes Bild der DDR durchgesetzt hat, ist eine solche ›hegemoniale Praxis‹. Sie hilft, eine Ordnung zu stützen, die das Privateigentum vergöttert und einen Kult um das Individuum entfacht, obwohl weite Teile der Bevölkerung gar nicht die Möglichkeit haben, das auszuleben, was in ihnen steckt. Ich will nicht zu tief in die Theorie einsteigen, aber wenigstens darauf hinweisen, dass Hegemonie hier mit Antonio Gramsci als eine Form der Herrschaft verstanden wird, die neben Zwang (Polizei, Gesetze, Gerichte) auch auf Konsens setzt. Die gerade »führende Gruppe« muss »die Zustimmung der Beherrschten zu ihrem Projekt gewinnen« und von »konkurrierenden gegnerischen Gruppen« zumindest akzeptiert werden. Die Konstruktion der DDR als Diktatur hat geholfen, eine »gemeinsame Perspektive« zu finden, die zum Beispiel Enteignungen und alle sonst denkbaren ›Zwangs‹-Maßnahmen zum Wohle des Kollektivs im Moment utopisch wirken lassen.41
In diesem Kampf um Definitionsmacht sind Sozialwissenschaftler nicht Beobachter, sondern Teilnehmer.42 Wer Ideen produziert, will mitmischen. Die Öffentlichkeit (oder: »die Politik«), sagt Geoffroy de Lagasnerie, ein französischer Soziologe, »ist immer schon da«, wenn wir anfangen zu forschen – in den Gegenständen, in den Untersuchungsdesigns, in unseren Interpretationen. Es gibt die DDR des hegemonialen Diskurses, und es gibt das, was ich erlebt und längst hundertfach neu geordnet und umgedeutet habe. Durch die Brille von Geoffroy de Lagasnerie ist das kein Problem. Der »Raum des Wissens« und die Politik sind für ihn ein einziger Raum – und in diesem Raum wird gekämpft. De Lagasnerie hat auch keine Scheu, Front und Gegner zu benennen. Sein Axiom: »Die Welt ist ungerecht, die Welt ist schlecht, sie ist durchzogen von Systemen der Herrschaft, der Ausbeutung, der Macht und Gewalt, die es aufzuhalten, infrage zu stellen und zu überwinden gilt«.
Ich könnte das als Programm für dieses Buch so stehen lassen, zumal ›Wahrheit‹ für Geoffroy de Lagasnerie ein »oppositioneller Begriff« ist und »objektiv« alles, was zeigt, wie und warum eine Praxis oder eine Institution »falsch« ist (»wie sie uns schlecht behandelt, wie sie lügt und auf irrationalen Überzeugungen und Praxen beruht«).43 Die Zeiten rufen aber eher nach den ganz großen Themen und nicht nach der kleinen DDR, schon gar nicht nach dem Winzling Journalistenausbildung. Matthias Krauß, 1960 in Hennigsdorf geboren, Absolvent der Leipziger Sektion Journalistik und heute in Potsdam, hat nach einem »dreißigjährigen Privatkrieg« gegen die »Aufarbeitungsindustrie« einen »Waffenstillstand« angekündigt. Schluss mit dem Kampf gegen den »einseitigen Mainstream«. Zum einen sei alles gesagt, und zum anderen würden »möglicherweise in Kürze Dinge eintreten«, die die Debatte um die deutsch-deutsche Vergangenheit »völlig überwalzen und gegenstandslos machen werden«.44
Auch wenn hier kurz vor Corona ein Prophet zu schreiben scheint: Konkreter wird Matthias Krauß nicht, vielleicht ein Erbe aus den wenigen Jahren, die er für die Parteipresse gearbeitet hat. Andeutungen genügten damals. Im November 2019 haben Uwe Krüger und ich in Leipzig ein Seminar zu einem Text von Jem Bendell angeboten. Deep Adaptation: A Map for Navigating Climate Tragedy.45 Bendell bietet dort einen neuen Blick auf das, was er »Klimatragödie« nennt. Sein Ausgangspunkt: Es ist zu spät. Der Zusammenbruch unvermeidlich, die Katastrophe wahrscheinlich, das Aussterben nicht auszuschließen. Unser Seminar in Leipzig war großartig, weil dieser Blick jeden zwingt, existenzielle Fragen zu stellen. Was will ich im Leben? Würde ich das selbst dann noch wollen, wenn ich wüsste, dass alles vergeblich ist? Jem Bendell liefert darauf keine fertige Antwort, wie sollte er. Er referiert aber Literatur zur Resilienz (verkürzt: zum Umgang mit Schicksalsschlägen46), zum Verzicht (Dinge loslassen, die man lange geliebt hat und für selbstverständlich hielt) sowie zur Erneuerung (längst verschüttete Einstellungen und Ansätze wiederentdecken) und macht daraus eine Agenda der Anpassung an das, was er für unvermeidlich hält, und damit einen Silberstreif an einem düsteren Horizont.
Mir hat Jem Bendell geholfen. Ich schreibe hier über eine eher kleine Menschheitsfrage (Journalismus und Journalistenausbildung), fordere aber trotzdem das heraus, was wir für selbstverständlich halten (etwa: zentrale Kommunikationskanäle in Familienbesitz), und grabe nach Erfahrungen, die die Sieger der Geschichte auf den Müllhaufen geworfen haben. Journalistik, Abriss, Medienkrise: In meiner Argumentation gehören diese drei Schlagworte zusammen. Der Kahlschlag in der akademischen Journalistenausbildung in Deutschland beginnt mit dem Abriss des ›roten Klosters‹, und der Vertrauensverlust der Medien, den wir heute beobachten, hat auch damit zu tun, dass der hegemoniale DDR-Diskurs ostdeutsche Journalisten in aller Regel in Nischen verbannt und sich so lange Zeit selbst verstärkt hat.
WIE DAS DDR-GEDÄCHTNIS GERADE NEU VERMESSEN WIRD
In meiner Rezension hatte ich vermutet, dass das Buch von Matthias Krauß die eigene Blase (Märkische Allgemeine, Leipziger Volkszeitung, Junge Welt, Neues Deutschland) nur deshalb verlassen konnte, weil die Süddeutsche Zeitung auch einen Dresdner beschäftigt (Cornelius Pollmer, Jahrgang 1984).47 Diese Rezension ist im April 2019 geschrieben worden – und damit (um nur zwei Beispiele herauszugreifen für die These, die gleich folgt) vor dem Film Traumfabrik und der schon zitierten Spiegel-Sonderausgabe zu 30 Jahren Mauerfall. Es sieht im Moment so, als ob auf dem ›Kampfplatz der Erinnerungen‹ eine neue Schlacht begonnen hat. Der Historiker Martin Sabrow, 1954 in Kiel geboren und seit anderthalb Jahrzehnten einer der beiden Direktoren des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam, hat 2008 drei Typen des DDR-Gedächtnisses unterschieden:
•Diktaturgedächtnis (der »Unterdrückungscharakter der SED-Herrschaft und ihre mutige Überwindung in der friedlich gebliebenen Revolution von 1989/90«): Stasi, Unrechtsstaat, Parteiherrschaft, Eiserner Vorhang, Mauerschützen, Doping (im Sport), »Verbrechen, Verrat und Versagen«, »Leid, Opfer und Widerstand«, kommunistischer Terror (von den sowjetischen Lagern in der Besatzungszeit über Schauprozesse und Militäraktionen in ganz Osteuropa bis zu den Gefängnissen und Methoden des DDR-Geheimdienstes), Missachtung von Menschenrechten und politischer Freiheit, Zwangsadoptionen, Zensur und Medienlenkung, Bürgerrechtler, Demonstrationen und Runde Tische;
•Arrangementgedächtnis (Verknüpfung von »Machtsphäre und Lebenswelt«): Freude und Leid im Alltag, Stolz auf das Erreichte (persönlich und im Betrieb, aber auch in der Gesellschaft insgesamt, gerade mit Blick auf die Bedingungen im Kalten Krieg), Zwang zur Anpassung und Ohnmacht des »kleinen Mannes«;
•Fortschrittsgedächtnis (Festhalten an der »Idee einer legitimen Alternative zur kapitalistischen Gesellschaftsordnung«): »moralische und politische Gleichrangigkeit der beiden deutschen Staaten«, kommunistische Ideale wie die Brechung des Bildungsmonopols der besitzenden Klassen, die Gleichstellung der Geschlechter, Arbeit und Wohlstand für alle, Nahrung und bezahlbaren Wohnraum sowie eine Welt, in der der Mensch sich und seine Arbeitskraft nicht verkaufen muss, keinen materiellen Reichtum begehrt und keine Kriege führt.48
Als ich 2013 meine (so dachte ich damals) letzte Studie zum Thema DDR fertig hatte, ging es mir ein bisschen wie Matthias Krauß. Genug jetzt. Egal ob Schulbücher, Museen oder Leitmedien: Es dominierte Typ 1, seit 1990, Tendenz eher steigend. Typ 2 gab es noch, immerhin. Typ 3 dagegen schien langsam auszusterben.49 Und dann kam die AfD.
Im Film Traumfabrik, produziert unter anderem von Tom Zickler, drei Jahre älter als ich und ab 1988 Student an der Hochschule für Film und Fernsehen in Babelsberg, ist die DDR ein Land, in dem die Menschen zusammenhalten. In dem man sich hilft, in dem man Spaß hat (sogar mit den Russen), in dem Aufstieg von ganz unten Normalität ist und in dem man zwar um die Kontrolleure und Beobachter weiß, sich aber im Alltag nicht groß um sie schert. Jeder wird gebraucht (sogar ein farbenblinder Kameramann), jede trägt etwas bei (hier vor allem die Sekretärin und die Maskenbildnerin). Und: Familie ist wichtig. Wichtiger jedenfalls als Karriere und Partei. Ohne seinen Bruder wäre der Held ein Nichts.
Einmal regnet es in diesem Film. Einmal wird die DDR trist und grau. Das ist die DDR, wie sie die Nachgeborenen kennen. Zwei Polizisten springen aus dem Auto und prügeln mit Schlagstöcken um sich, ohne wirklich einen Grund zu haben, nicht einmal in der Logik einer Überwachungsgesellschaft. Man kann Schwierigkeiten haben mit dieser Szene. Man kann sie aber auch als groteske Überzeichnung dessen lesen, was die Geschichtspolitik uns sonst so erzählt über die DDR. Milou, die Angebetete des Helden, ist dabei und fährt am Ende doch nicht zurück nach Frankreich, in eine Welt, in der sie von einer launischen Chefin abhängt und von einem cholerischen Mann.
Freiheit Ost vs. Freiheit West: Das ist hier die Frage. Tanzen und feiern auf den Straßen von Paris, ja. Aber zu welchem Preis? Der Preis, der in der DDR zu zahlen ist, wird in der Traumfabrik ausgesprochen und bebildert. Eingemauert sein im eigenen Land. Stacheldraht und Maschinenpistolen an der Grenze. Das Diamant-Fahrrad als größter Luxus (dies erst im Abspann, genau wie ein Zeitungscover, das die Ausreise des Traumpaars meldet). Und trotzdem. Milous Augen werden riesig sein und strahlen, wenn sie in diesen Osten zurückläuft. Man kennt dieses Bild. Aber nur für die andere Laufrichtung.
Man kennt auch den selbstherrlichen Funktionär (hier: Heiner Lauterbach), immer mit Lakai, zu allen Schandtaten bereit. In der Realität war es komplizierter, und in der Traumfabrik ist es das auch. Der Film zeigt, wie man das Kompetenzgerangel zwischen SED