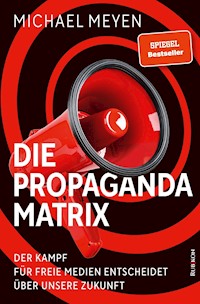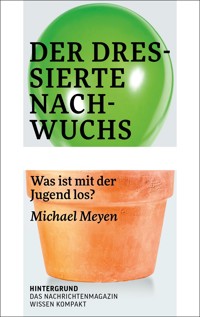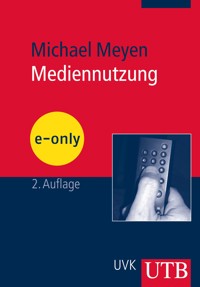14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sehnsucht nach dem Sendeschluss Nichts ist mehr so, wie es vor dreißig Jahren war. Der Imperativ der Aufmerksamkeit regiert unser Leben. Er hat erst unsere Zeitungen verändert, die Fernsehnachrichten und überhaupt alles, was wir über die Welt wissen können. Und dann hat er den Berufsalltag erobert und unsere Familien. Michael Meyen zeigt, was die Zulassung kommerzieller Sender und der Siegeszug von Internet und sozialen Medien aus dem guten, alten Journalismus gemacht haben - und aus uns. Medienrealität ist heute nicht nur in den Massenmedien, sondern überall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ebook Edition
Michael Meyen
Breaking News:Die Welt im Ausnahmezustand
Wie uns die Medien regieren
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 9-783-86489-700-9
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2018
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
1Auftakt
Wie dieses Buch zu lesen ist
Der 31. Mai 2015 war ein guter Sonntag für US-amerikanische Journalisten. Zumindest für die, die arbeiten mussten. Außenminister John Kerry hatte sich beim Radfahren in Frankreich das Bein gebrochen und wurde in ein Krankenhaus nach Genf geflogen. Ein Aufreger, der samt Rücktransport in die Heimat auch noch den halben Montag füllen würde. Und dann starb der Sohn des Vizepräsidenten. 46 Jahre, Hirntumor. Was für eine Geschichte. Joe Biden, ganz nah am Machtpol dieser Welt und doch vom Schicksal geschlagen. Ein Mann, der vor einer halben Ewigkeit schon Frau und Tochter bei einem Unfall verloren hatte. Auch der kleine Beau saß damals, 1972, mit im Wagen. John Kerry und Joe Biden. Beinbruch und Familientrauer zur Prime Time, auf jedem Kanal. Etwas Wichtigeres hatte die Welt an diesem Sonntag nicht zu bieten, zumindest nicht für Fernsehredakteure in den USA. Vermutlich wussten sie, wie gut die beiden Themen im Netz liefen. Auch Barack Obama ließ die Zuschauer schnell wissen, dass er und seine Frau Michelle für Beau Biden und die Seinen beten. Immerhin, auch das durften wir erfahren, blieb dem Präsidenten etwas Zeit, nicht nur den Herrn anzurufen, sondern auch John Kerry. Die drei mächtigsten Politiker der USA, vereint in einem Drama von biblischem Ausmaß. Selbst die Plagen, die einst Ägypten heimsuchten, hätten kein größeres Schlagzeilengetöse ausgelöst.
Natürlich: Es war Sonntag. Wer je in einer Nachrichtenredaktion gesessen hat, der weiß, was das bedeutet. Warten auf das Fußballspiel, auf ein Zugunglück, auf irgendeinen Streit. Hauptsache, man hat etwas zu melden. John Kerry und Joe Biden. Besser kann so ein Sonntag gar nicht werden. Das Problem ist: Auch montags und mittwochs bekommen Leser, Hörer und Zuschauer Dramen ohne Inhalt und das längst nicht mehr nur in den USA. Schleichend und fast unbemerkt hat sich das verändert, was deutsche Redakteure für so wichtig halten, um ihr Publikum damit zu behelligen. Journalismus war schon immer vor allem Selektion. Nicht einmal eine Kleinstadt passt in fünf Minuten Sendezeit und auch nicht auf drei Lokalseiten. Heute aber, das ist die erste These dieses Buchs, heute wählen Redakteure in Deutschland etwas ganz anderes aus als ihre Vorgänger noch vor 30 oder 40 Jahren. Und das, was sie auswählen, verpacken diese neuen Redakteure anders: grell, schrill, laut. Wenn es den objektiven Beobachter früher gegeben haben sollte – zum Beispiel in Gestalt des Fernsehmannes, den Tagesthemen-Moderator Hanns Joachim Friedrichs 1995 kurz vor seinem Tod besungen hat (»Distanz halten, sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten, nicht in öffentliche Betroffenheit versinken, im Umgang mit Katastrophen cool bleiben, ohne kalt zu sein«1) –, wenn es ihn tatsächlich je gegeben haben sollte, dann ist dieser Kollege inzwischen ausgestorben.
Hanns Joachim Friedrichs, Jahrgang 1927, erzählte seinerzeit im Nachrichtenmagazin Der Spiegel, er habe nach dem Krieg beim deutschen Dienst der BBC gelernt, was guter Journalismus sei. Informieren und aufklären, das vor allem. Eine »Art Nachhilfeunterricht für Diktaturgeschädigte«. Die Parteien raushalten, auch aus den Gremien. Der Fernsehmann als »Mensch, der mit am Esstisch sitzt, der ein bisschen mehr weiß, weil er die Fähigkeit hat, unbefangen in die Welt zu gucken und das, was er entdeckt, so wiederzugeben, dass die Leute ihm glauben«. Auch nicht unwichtig: »die Leute abends in ihrer Wohnung nicht anbrüllen«. Sie selbst entscheiden lassen, »ob sie betroffen sein wollen oder nicht«.2
Vorbei. »Lügenpresse, halt die Fresse«, schreit und stöhnt der Wutbürger. Vertrauenskrise, sagt Uwe Krüger, ein Leipziger Medienforscher, ausgelöst durch die Ukraine-Berichterstattung – durch ein »Schwarz-Weiß-Bild«, in dem »wesentliche Fakten unterschlagen« worden seien. Krüger: »Man merkt die Absicht und ist verstimmt.«3 Auch die ARD-Dokumentation »Vertrauen verspielt?«, die am 11. Juli 2016 zu später Stunde im Ersten lief, macht die Medienschelte an dem fest, was gesendet und geschrieben wurde und was vielleicht auch nicht. Flüchtlinge und die Silvesternacht von Köln, Putin, die Jagd auf Christian Wulff. Sehr konkrete Inhalte für eine eher diffuse Kritik. Dieses Buch zeigt, dass die Inhalte austauschbar sind. Und dass es nicht besser werden wird, wenn wir nicht zuerst verstehen, wie Journalisten das zusammenstellen, was wir für wichtig halten müssen, und dann darüber sprechen, was wirklich wichtig wäre.
Breaking News: Die Welt als Ausnahmezustand
Dass es nicht egal ist, was Funk und Fernsehen bringen, die Presse und all ihre Ableger und Nachahmer im Netz, das steht dabei außer Frage. »Was wir über die Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch Massenmedien.«4 Nimmt man diesen berühmten Satz von Niklas Luhmann einen Moment lang ernst und fragt, wie Gesellschaft und Welt heute durch die Brille des deutschen Journalismus aussehen, dann gibt es dafür eigentlich gar keinen passenden Vergleich. Jahrmarkt, Zirkus, Stadion. Alles auf einmal und doch viel mehr. Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. John Kerry und Joe Biden. Wie oft bricht sich ein wichtiger Minister schon ein Bein (fern der Heimat, auf dem Rad!), und wie viele Vizepräsidenten haben im Privaten solche Tragödien erlitten wie Obamas Stellvertreter?
Jeder Nutzer weiß, was die Massenmedien im Sekundentakt liefern. Exklusivnachrichten, Einmaliges, Superlative. Das Spiel des Jahres. Das Spiel des Jahrzehnts. Der Spieler des Jahrhunderts. Das, was wir so nicht erwartet haben. Thomas Müller ohne Tor bei der Europameisterschaft in Frankreich, schon drei Wochen lang. Auch Lukas Podolski hat kein Tor geschossen (und überhaupt nur ein paar Minuten auf dem Platz gestanden), aber das wussten wir schon vorher. Unbefangen in die Welt gucken und wiedergeben, was es dort so zu entdecken gibt? Mein lieber Hanns Joachim Friedrichs. Journalisten vereinfachen, spitzen zu, übertreiben. Sie erzählen uns tagelang immer wieder die gleiche Geschichte, geschmückt mit neuen Details, sie berichten, was Prominente erlebt haben und was uns anderen Außergewöhnliches passiert ist.5 Sie wollen dabei originell sein, und, ja, sie brüllen uns an, selbst abends im Wohnzimmer. Konflikte, Emotionen und Bilder, immer wieder Bilder. Möglichst auffällig, möglichst groß. Zapp! Nicht! Weg! Bleib hier, denn ich sage dir, was du wirklich wissen musst. In Schlagworten, leicht verständlich, leicht bekömmlich. Der Verdauungsschnaps im Zeitalter von Low Carb und Fruchtsaftschorle.
Wie gesagt: Jeder Nutzer weiß das. Und doch haben wir alle zusammen nicht gemerkt, wie der Imperativ der Aufmerksamkeit unsere Zeitungen verändert hat, die Fernsehnachrichten und überhaupt alles, was wir über die Gesellschaft wissen können und über die Welt, in der wir leben. Den Eurovision Song Contest zum Beispiel oder Premieren von James-Bond-Filmen gab es vor 50 Jahren nicht, wenn man Niklas Luhmann glaubt. Das heißt: Es gab das alles schon, aber nicht in den Massenmedien. Höchstens als Kurznachricht. Selbst die Bild-Zeitung kündigte den Grand Prix 1979 nur im TV-Programm an. 2002 (als Corinna May für Deutschland sang) gab es dann eine Doppelseite mit den Überschriften »Die Demütigung von Tallinn« und »Die Nacht der bitteren Tränen«.6 Das Finale im Fußball-Europapokal der Landesmeister (Vorläufer der UEFA Champions League), noch so ein Beispiel aus der Medienrealität von heute, wurde 1960 in der Süddeutschen Zeitung am Tag danach mit einer schmalen Spalte links am Rand abgehandelt, obwohl Titelverteidiger Real Madrid in Glasgow eine deutsche Mannschaft besiegt hatte (Eintracht Frankfurt). Die Redaktion gab zu, sich in der Anstoßzeit geirrt zu haben (19.30 statt 17.30 Uhr). Vor Redaktionsschluss sei einfach nicht mehr da gewesen. Man stelle sich das vor: eine Spalte, in der es erst ums Wetter geht (Sonne in Schottland!) und dann um Bundestrainer Sepp Herberger, der den Spielerfrauen »aufmunternde Worte« mit auf den Weg gegeben und auch sonst »strahlende Laune« hatte.7 Soso. Undenkbar in einer Zeit, in der ein Finale dahoam mit Sondernummern begleitet wird und uns tagtäglich Wasserstandsmeldungen zu Mario Götze erreichen – auch dann, wenn sich in der Welt da draußen gar nichts tut.
Eurovision Song Contest, James Bond und Fußball. Wenn all das gewachsen ist in der Realität der Massenmedien, dann muss anderes geschrumpft sein. Über Politik, Kultur, Wirtschaft wird heute nicht nur weniger berichtet als noch vor 30 oder 40 Jahren, sondern auch anders. Atmosphäre statt Programmdiskussion. Konflikte zwischen Spitzenpersonal statt Streit um Inhalte. »Schalten Sie Ihren Fernseher aus!«, ruft Stefan Schulz, Jahrgang 1983, der Volontär bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war und vielleicht auch deshalb jetzt das Ende des Journalismus gekommen sieht. Abendnachrichten und Politikmagazine seien »nichts anderes als Gossip-Reports«, in denen »das politisch relevante gesellschaftliche Leben in Deutschland und die Hunderttausende von Mitarbeitern umfassende Staatsverwaltung auf das persönliche Kräftespiel von zehn Bundespolitikern« zusammenschrumpfe – im »Modus der Sportberichterstattung«.8
Neue Mitspieler, neue Medienrealität
Diese neue deutsche Medienrealität war schon Mitte der 1990er Jahre zu spüren, im Spiegel-Gespräch mit Hanns Joachim Friedrichs. »Deutschlands Sinnbild für Glaubwürdigkeit und Charme« (taz) schimpfte dort ein bisschen über »irgendeinen journalistischen Strichjungen aus der ARD-Hierarchie«, aber viel mehr noch über das kommerzielle Fernsehen. »Nichts gelesen, nichts kapiert, aber immer mitten am Elend und voll im Bild.« Und weiter: »Die glauben, es reicht, eine schöne junge Frau oder einen jungen Mann vors Mikrofon zu stellen und sie Sätze voller hanebüchener Ahnungslosigkeit sagen zu lassen.«9
Trotzdem: Als Friedrichs vom Bildschirm verschwand, war die Welt noch so, wie er sie uns und unseren Eltern ein Journalistenleben lang gezeigt hatte, fast jedenfalls. Schöne Frauen und junge Männer bei RTL, okay. Ahnungslos? Meinetwegen. Aber wer informierte sich damals schon bei RTL? Und wer wusste so genau, was das Internet war? Mark Zuckerberg jedenfalls bestimmt nicht. Als Der Spiegel mit dem todkranken Friedrichs sprach, wartete der Facebook-Chef auf seinen elften Geburtstag.
Zwischen den goldenen Jahren, in denen Hanns Joachim Friedrichs am »Denkmal des politischen Moderators« baute (Die Zeit), und dem Hier und Jetzt liegen drei Medienrevolutionen. Journalistenschüler lesen zwar immer noch die Autobiografie des Meisters10 und neuerdings vielleicht sogar das Büchlein Medien: Macht & Verantwortung11, in dem Ulrich Wickert, einer der Erben von Friedrichs, Immanuel Kant bemüht, um die Ideale des Berufsstands zu beschwören (Aufklärung und Mut! Gebt den Menschen Orientierung! Helft ihnen beim Denken, bitte!), arbeiten aber müssen diese jungen Menschen dann in Büros, bei denen allenfalls noch die Adresse an Friedrichs und Wickert erinnert.
Die Konkurrenz: Das ist das, was die drei Medienrevolutionen verändert haben. Die Tagesschau heißt immer noch Tagesschau, das ja. Auch die Süddeutsche Zeitung hat sich nicht umbenannt (allerdings ist sie 2010 umgezogen, aus dem Herzen Münchens in einen Betonturm am Rande der Stadt). Und die Rundfunkgebühren fließen noch, sogar reichlicher denn je. Selbst im öffentlich-rechtlichen Refugium aber und in den Leuchttürmen der Leitmedien kann man nicht mehr so tun, als ob es die anderen nicht gibt. Kommerzielles Fernsehen und kommerzielles Radio, Internet, Social Media: drei neue Mitspieler, fixiert auf Reichweitenmaximierung. Quote und Klicks, Likes und Shares. Der Imperativ der Aufmerksamkeit. Hanns Joachim Friedrichs durfte RTL noch kennenlernen. Nur: RTL war damals ein kleines Kind, das gerade die Tutti-Frutti-Windeln abgelegt hatte. Inzwischen ist dieses Kind so erwachsen, dass es selbst im Dschungel perfektes Fernsehen produziert.
Die Theorie, auf die sich dieses Buch stützt (der Ansatz der Akteur-Struktur-Dynamiken von Uwe Schimank12), geht davon aus, dass Akteure nicht im luftleeren Raum handeln (allein, nur für sich). Man beobachtet sich, man beeinflusst sich, man verhandelt miteinander. Man versucht, seine Interessen durchzusetzen. Im System der Massenmedien: veröffentlichen, das Publikum erreichen. Vielleicht auch aufklären und informieren, Debatten anstoßen und Debatten moderieren, die Welt verbessern. Jeder Akteur (jede Journalistin, jede Redaktion, jedes Medienunternehmen) hat Ressourcen, um seine Interessen durchzusetzen. Und: Jeder Akteur weiß nicht nur um die eigenen Ressourcen und die der anderen, sondern auch um den Orientierungshorizont, vor dem jeweils gehandelt wird. Rundfunkstaatsvertrag, Landespressegesetze, Pressekodex. Berufsideale, Traditionen und Vorbilder wie Wickert oder Friedrichs. Die Ethikrichtlinien von Berufsverbänden und Beobachtern (etwa: Netzwerk Recherche). Die Wünsche des Publikums – als Bürger, als Konsument, als Schutzbedürftiger.
Das alles ist allen bekannt, aber nicht für jeden gleich wichtig. Die drei Medienrevolutionen haben nicht nur die Zahl der Mitspieler vervielfacht, sondern zugleich Akteure in das System Massenmedien gespült, die unter ganz anderen Bedingungen handeln als einst Hanns Joachim Friedrichs. Andere Kanäle, andere Erwartungen von uns, von außen, ein anderes Selbstverständnis – aber das gleiche Ziel: Ein Publikum erreichen. Für die Erben von Friedrichs bedeutet das: Ressourcen umschichten (in Onlineauftritte, in Social Media), die Strategien ändern. Sich anpassen an das, was der Konkurrenz Erfolg bringt.
Auf dem Weg zum kommerziellen Pol oder Die hausgemachte Krise
Der Schweizer Medienforscher Nino Landerer hat die Handlungslogik des Systems Massenmedien (die Art und Weise, wie Journalisten das zusammenstellen, was wir Zuschauer, Leser, Hörer für die Welt halten müssen) zwischen zwei Polen angesiedelt: normativ und kommerziell.13 Auf der normativen Seite steht das, was den Journalismus als Institution von anderen Institutionen unterscheidet (die ›öffentliche Aufgabe‹, wie sie zum Beispiel Friedrichs oder Wickert beschreiben), und auf der kommerziellen das, was sich aus der Gewinnorientierung der meisten Anbieter ergibt: Themen auswählen, für die sich möglichst viele Menschen interessieren, und diese Themen dann so anordnen und aufbereiten, dass wir Nutzer tatsächlich dranbleiben. Folgt man Nino Landerer, dann bewegt sich die Handlungslogik des Systems Massenmedien auf einem Kontinuum zwischen diesen beiden Polen. Mal stärker normativ, mal eher kommerziell, in Deutschland anders als in Spanien und in beiden Ländern heute nochmal anders als vor 30 Jahren.
Wer etwas älter ist oder in der DDR gelebt hat, wird sich erinnern, dass die Medienrealität auch hierzulande sehr wohl einer politischen, einer kulturellen oder einer pädagogischen Logik folgen kann. »Vergnügen strengstens verboten!«, schrieb die Programmzeitschrift Hör zu im Frühjahr 1965 zum TV-Angebot an einem normalen Wochenendnachmittag. Das ZDF bringe gar nichts und die ARD nur Unattraktives. Der Zuschauer müsse sich für Aktienmärkte, für die Stahlproduktion und für die Industrie am Orinoko interessieren – und das ausgerechnet dann, wenn er sich entspannen wolle.14 Ein anderer Imperativ. Erziehung, Aufklärung, Bildung. Vielleicht ist es etwas übertrieben, für die 1960er und 1970er Jahre von einer »Zwangsverpflichtung auf politische Fernsehinhalte« zu berichten (gezwungen wurde schließlich niemand) und von einem »Unterhaltungsslalom« (vorbei an den eher anstrengenden Magazinen),15 nicht zu bestreiten ist aber, dass sich die Handlungslogik des Systems Massenmedien seither zum kommerziellen Pol verschoben hat. Ulrich Wickert zum Beispiel, ein Kronzeuge ersten Ranges, spricht von einer »Banalisierung der Öffentlichkeit«, von »Betroffenheitsjournalismus« und von »Apokalypse statt Aufklärung«. Und weiter Wickert: »Tatsächlich verdrängt der Mechanismus, permanent Sensationen zu verbreiten, die Auseinandersetzung mit Themen, die Orientierung verschaffen.«16
Was genau die Massenmedien in Deutschland verbreiten, was dabei heute anders ist als vor den drei Medienrevolutionen und wie Redakteure und Reporter ihre Arbeit selbst erleben: Davon handelt Kapitel 2 dieses Buchs. Mit Hilfe von Inhaltsanalysen und Interviews wird dort gezeigt, dass der Imperativ der Aufmerksamkeit journalistische Qualitätskriterien wie Neutralität, Objektivität oder Vielfalt zu Worthülsen gemacht hat – geeignet für Sonntagspredigten und akademische Gedankenspiele, aber nicht (mehr?) zur Beschreibung der Realität, die Massenmedien konstruieren. Anders formuliert: Das System erfüllt seine ›öffentliche Aufgabe‹ nicht – und das nicht etwa, weil die Jugend nicht mehr Zeitung liest und sich überhaupt ganz anders informiert, weil den Verlagen das Anzeigengeschäft weggebrochen ist oder irgendein ausländischer Regierungschef zu schlecht behandelt wurde. John Kerry und Joe Biden: Diese Medienkrise geht tiefer, und sie ist hausgemacht. Der Imperativ der Aufmerksamkeit ist zu einem Strudel geworden, der die Glaubwürdigkeit mitgerissen hat und aus dem sich nur Baron Münchhausen selbst befreien könnte.
Resilienz und Massenmedien
Vielleicht ist es gut, an dieser Stelle einen Moment lang Luft zu holen und das Umfeld anzuschauen, in dem dieses Buch entstanden ist – den Bayerischen Forschungsverbund ForChange, der gefragt hat, wie Wandel gestaltet werden kann in einer Zeit, in der zwar jeder das Gefühl hat, dass sich alles ändert, aber keiner wirklich weiß, was kommen wird. ForChange beschäftigte sich zum Beispiel mit Pionieren der Energiewende im Allgäu, mit deutschen Unternehmen, die an Investoren aus China und Indien gehen, oder mit Teams, die oft ganz unabhängig von Erfolg oder Misserfolg immer wieder umgebaut werden. Klammer für all diese Themen war das »buzzword« Resilienz17 – ein Begriff, der längst die Ratgeberregale erobert hat.18
Resilienz: Das ist die Fähigkeit, unter widrigen äußeren Bedingungen oder in Krisenzeiten stabil zu bleiben und zu funktionieren. Ein Stück Gummi, auf dem man stundenlang herumdrücken kann und das trotzdem wieder in die alte Form zurückflutscht. Ein Ökosystem, dem Hitze oder Fluten nichts anhaben. Ein Mensch, der Schicksalsschläge verkraftet. Den Tod des Partners, die Degradierung im Job, Krankheiten. Resilienz ist positiv, das zeigen diese Beispiele. Auch deshalb hat es das Konzept geschafft, die Grenzen zwischen den akademischen Disziplinen zu überwinden und heute fast überall verwendet zu werden – auch für Organisationen, Institutionen oder soziale Funktionssysteme wie die Massenmedien.19
Trotzdem: Am Kern des Begriffs ist nicht gerüttelt worden. Wer von Resilienz spricht, hat erstens eine Bedrohung im Sinn (die von außen kommen kann, von innen oder aus beiden Richtungen zugleich), muss zweitens die Funktionen bestimmen, die (zum Beispiel) ein soziales Funktionssystem für die Gesellschaft hat, und dann nach Schwachstellen und Stärken dieses Systems suchen und konzentriert sich folgerichtig drittens auf Systemerhalt, auf Überleben und auf Verbesserung. Selbst Katastrophen sieht man durch die Brille Resilienz nicht mehr schwarz, sondern als Gelegenheit zum Lernen.20
Was die letzten drei Absätze mit dem Thema dieses Buchs zu tun haben? Antwort eins: Der Imperativ der Aufmerksamkeit ist eine Bedrohung für das System Massenmedien, allerdings nicht die einzige, wie gleich zu sehen sein wird. Dieser Imperativ bedroht weniger die Existenz von Medienangeboten an sich (sie werden weiter gekauft, gelesen und gesehen, geklickt und geteilt), sondern das, was demokratische Gesellschaften von ihnen erwarten dürfen. Antwort zwei schließt direkt daran an: Resilienz regt eine Wertedebatte an. Was genau erwartet die Gesellschaft eigentlich von den Massenmedien? Und was will sie dafür investieren?
Niklas Luhmann hätte auf diese Fragen mit einem müden Lächeln reagiert. Für ihn waren Massenmedien nichts weiter als das »Gedächtnis« der Gesellschaft. Ein System, das Information »so breit« streue, »dass man im nächsten Moment unterstellen muss, dass sie allen bekannt ist (oder dass es mit Ansehensverlust verbunden wäre und daher nicht zugegeben wird, wenn sie nicht bekannt war)«. Medieninhalte als eine »zweite, nicht konsenspflichtige Realität«, als eine Art »Hintergrundwissen«, von dem man bei jeder Kommunikation ausgehen könne.21 Was dieses »Gedächtnis« der Gesellschaft speichert und was nicht, ist für die Erfüllung dieser Funktion vollkommen egal.22 John Kerry und Joe Biden: Sei’s drum. Hauptsache wir haben etwas, über das wir reden können. Eine Kritik der Medienrealität geht aus dieser Perspektive genauso ins Leere wie jeder Versuch, die Resilienz des Systems Massenmedien zu stärken. O-Ton Niklas Luhmann, gesendet von Radio Bremen am 9. Oktober 1997: »Was könnte ein Schaden sein, der allein durch die Massenmedien verursacht wird?«23
Medienlogik: Die Metabotschaft wirkt
Zwanzig Jahre später wissen wir es besser. Der Imperativ der Aufmerksamkeit bedroht nicht nur das System der Massenmedien, sondern jeden Einzelnen von uns und die Gesellschaft insgesamt. Diese Bedrohung geht nicht von konkreten Inhalten aus, wie gut oder schlecht die Berichterstattung über Putin und Erdogan, Flüchtlinge und Terror, Griechenland und die Welt auch immer sein mag. Vielleicht wirken solche Inhalte auf uns, wer weiß. Sie lösen Emotionen aus, das sicher. Sie erweitern unseren Horizont und unser Wissen, das auch. Vielleicht verändern sie sogar unsere Einstellungen und unser Verhalten, im Supermarkt, im Familienalltag, an der Wahlurne.24 So raffiniert die Methoden der Medienforscher aber auch geworden sein mögen, der letzte Nachweis fehlt. Zum Glück. Sonst wäre Orwell schnell Wirklichkeit.
Die Medienrealität wirkt, das ist die zweite These dieses Buchs, über einen Umweg, und das gleich doppelt. Zuerst zum Umweg, der da beginnt, wo wir unterstellen, dass Massenmedien mächtig sind. Immer wieder nachgewiesen, auch und gerade bei Menschen in Spitzenpositionen. Warum sonst sollten Minister zurücktreten, Topmanager, Bundesligatrainer, wenn sie nicht befürchten würden, dass negative Berichte etwas machen mit ihrem Ansehen, ihrer Reputation, ihrem Handlungsspielraum? Wir alle nehmen an, dass Medieninhalte Folgen haben – wenn vielleicht auch nicht für uns, so doch für andere. Die Forschung spricht hier vom Third-Person-Effekt.25 Wir überschätzen, was Medien mit den Einstellungen und dem Verhalten unserer Mitmenschen machen. Ob und wie Massenmedien wirken, ist folglich genauso egal wie das, was die Wissenschaft zu diesem Thema weiß. Entscheidend ist, dass wir an solche Wirkungen glauben. Das Thomas-Theorem: »If men define situations as real, they are real in their consequences.«26 Das heißt: Wir verändern unser Verhalten, weil wir davon ausgehen, dass die anderen es ebenfalls verändern werden, und zwar so wie es der Medientenor vorgibt, den wir beobachten.
Die Untersuchungen, die es zum Third-Person-Effekt und zum Influence-of-Presumed-Media-Influence-Ansatz27 gibt, konzentrieren sich in aller Regel auf sehr konkrete Medieninhalte. Gewalt im Fernsehen, Kampagnen gegen Rauchen, Trinken, Kiffen oder Berichte über die Versorgung. Wenn ich glaube, dass Blut in den TV-Nachrichten oder im Tatort die Gesellschaft verroht, bin ich wahrscheinlich eher für Kameras an öffentlichen Orten, und wenn ich denke, dass all meine Nachbarn jetzt Bier horten, weil in der Zeitung etwas über Wasserknappheit in den Brauereien stand, dann laufe ich in den Supermarkt und stelle fest, dass Bier in der Tat knapp geworden ist.
In diesem Buch geht es um etwas anderes. Dieses Buch fragt, was die Metabotschaft mit uns macht (die Botschaft hinter den konkreten Inhalten) – der Imperativ der Aufmerksamkeit, dem die Massenmedien heute folgen. Die Soziologen David Altheide und Robert Snow haben schon Ende der 1970er Jahre von der »Medienlogik« gesprochen und damit die Perspektive gemeint, mit der seinerzeit vor allem das Fernsehen in den USA Realität konstruiert hat: Welche Themen werden ausgewählt, wie wird das Material zusammengestellt, in welchem Stil wird es präsentiert, was wird betont und was eher nicht? Kurz: Medienlogik ist die Grammatik der Medienkommunikation, die, folgt man Altheide und Snow, schon deshalb Folgen hat, weil wir den entsprechenden Angeboten kaum entkommen können.28
Kein Zweifel: Fernsehen ist nicht Radio ist nicht Presse ist nicht Internet. Und die USA sind genauso wenig Deutschland wie die späten 1970er das Heute sind. Die wissenschaftliche Literatur hat am Lack der Idee Medienlogik gekratzt und gezeigt, dass Medieninhalte von der Technik beeinflusst werden (etwa: Druck versus bewegtes Bild), von den Traditionen (zu denen zum Beispiel das Dritte Reich und die DDR gehören) und von der Journalismuskultur überhaupt. Berufsideale, Gesetze und andere normative Anforderungen (Stichwort ›öffentliche Aufgabe‹), der Eigensinn der Produzenten, die Wünsche des Publikums.29 David Altheide hat trotzdem darauf bestanden, dass die Massenmedien jenseits all dieser denkbaren Einflussfaktoren einer konzeptionellen Logik folgen – einem Gestaltungsprinzip, das man im Politikteil der Zeitung genauso findet wie in den Fernsehnachrichten und im Radiotalk, im Kulturmagazin und in der Fußballübertragung.30 Dieses Prinzip kann sich von Land zu Land unterscheiden (in Mexiko sieht die Medienrealität anders aus als in Uganda) und auch ändern. Hanns Joachim Friedrichs könnte ein Lied davon singen. Auch zu seiner Zeit aber mussten Politiker, Sportler, Künstler die Medienlogik (die damals eine etwas andere war) kennen, wenn sie in die Zeitung oder ins Fernsehen wollten.
David Altheide geht noch einen Schritt weiter und spricht von einer Art Gewöhnungseffekt, der uns alle betrifft. Allein schon durch die Dauer der Mediennutzung (für den Durchschnittsdeutschen knapp zehn Stunden am Tag)31 würden wir das Konstruktionsprinzip der Medienrealität als »normale Form« der Kommunikation verinnerlichen. Folgt man Altheide, dann formt die Medienlogik, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns im Alltag bewegen und wie wir Organisationen und Institutionen gestalten.32 Zugespitzt: Medienrealität ist nicht nur in den Massenmedien, sondern überall. Der Imperativ der Aufmerksamkeit regiert unser Leben.
Alltag und der Mythos vom medialisierten Zentrum
Kapitel 5 taucht in dieses neue Leben ein, das keineswegs nur daraus besteht, dass nicht wenige von uns ihre Erlebnisse, ihre Ansichten und Urteile, ihre Emotionen in sozialen Netzwerken teilen und sich dabei selbst dem Imperativ der Aufmerksamkeit unterwerfen (müssen), wenn sie nicht wie einst Oma und Opa einfach nur ein Tagebuch führen wollen, das unter dem Kopfkissen verstaubt und erst bei der Haushaltsauflösung von anderen gelesen wird. Auch jenseits von Facebook, Instagram und Twitter sieht Realität heute oft so aus wie das, was wir vom Bildschirm kennen: Wir feiern anders, als es bei unseren Eltern und Großeltern üblich war, wir machen etwas anderes aus unserem Urlaub, und wir erziehen unsere Kinder anders, wir richten unsere Wohnungen anders ein, und, man wagt es kaum zu glauben, wir werden tatsächlich schöner. Zumindest investieren wir mehr in unser Aussehen. David Altheide würde wissen, woran das liegt: an der Fernsehlogik oder an der Logik der bewegten Bilder, die neben Dynamik, Spannung und einer Geschichte auch und vor allem Menschen verlangt – schöne Menschen, gut trainierte Menschen. Hollywoodstars, Pep Guardiola, wenigstens Til Schweiger. Selbst wer es nie ins Fernsehen schafft und auch keine Lust hat, Livestreams zu posten, selbst diese Zeitgenossen erleben das Konstruktionsprinzip der Medienrealität als so »normal«, wie Altheide sagen würde, dass sie ihm verfallen.
Es wird in diesem Buch also auch um eine Kritik der Medienrealität gehen – um Risiken und Nebenwirkungen der Droge Aufmerksamkeit. Um Hochzeiten an ausgefallenen Orten, drei Tage lang, und um Junggesellenabschiede, möglichst noch verrückter. Um den Wunsch, einzigartig zu sein – daheim, auf Reisen oder wenigstens beim Geburtstagsbrunch. Um den Wettbewerb im Kindergarten, in der Schule, in der Nachbarschaft. Das klügste Kind, die glücklichste Familie, das ausgefallenste Wochenende. Brauchen wir das, brauchen wir den Imperativ der Aufmerksamkeit, um zufrieden zu sein oder sogar glücklich?
Was wie eine rhetorische Frage klingt (nein, natürlich nicht), würde der britische Medienforscher Nick Couldry vermutlich mit Ja beantworten. Wie David Altheide und Robert Snow spricht Couldry von strukturellen Medienwirkungen, von Wirkungen jenseits aller konkreten Inhalte.33