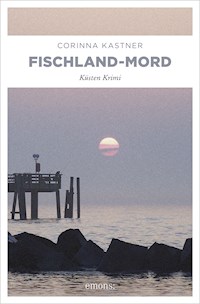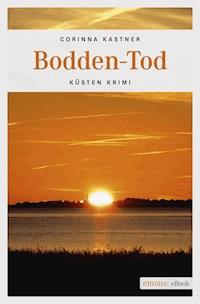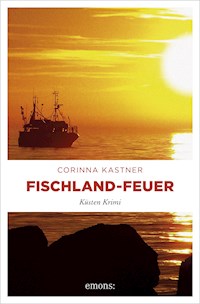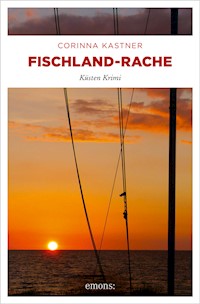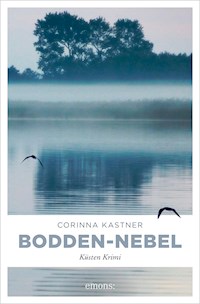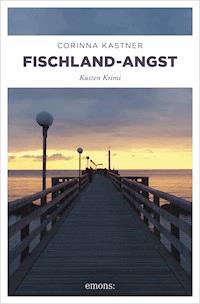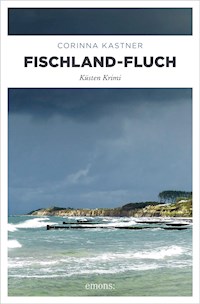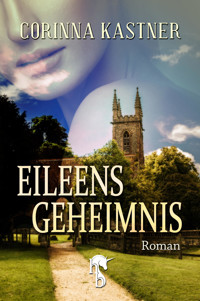6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nella erbt von ihrer Mutter eine kostbare Perlenkette. Doch immer, wenn sie sich damit im Spiegel betrachtet, geschieht etwas Merkwürdiges: Ein fremdes Gesicht scheint sich vor ihres zu schieben. Als sie kurz darauf den geheimnisvollen Antiquitätenhändler Safet kennenlernt, führen sie die Perlen nicht nur an die dalmatinische Küste nach Dubrovnik, sondern auch zurück ins 16. Jahrhundert – zurück in die Welt von Mirjana, der die Perlenkette einst gehörte. Nella muss Mirjanas wahres Vermächtnis retten – doch vor wem genau, erfährt sie erst, als es beinah zu spät ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 710
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Corinna Kastner
Das Erbe von Ragusa
Roman
Für Louise mit Dank – du weißt, weshalb …
»Wer das Paradies auf Erden sucht, soll nach Dubrovnik kommen!«
George Bernard Shaw
Liebe Leserin, lieber Leser,
sicher kennen Sie Dubrovnik, die zauberhaft Stadt an der kroatischen Adriaküste. Aber wussten Sie auch, dass sie erst seit Ende des Ersten Weltkrieges so heißt? Ursprünglich war ihr Name Ragusa – in ferner Vergangenheit eine mächtige Stadtrepublik, die problemlos mit Venedig konkurrieren konnte. Handel wurde getrieben, große Schiffe trugen ihre Waren überallhin und brachten aus fernen Ländern wieder andere mit nach Hause. Ragusa war reich an Kirchen und Klöstern, die auch heute noch beeindrucken – das Kloster der Fanziskaner beherbergt eine der ältesten Apotheken Europas. Diese Apotheke war es, die mich inspirierte zur Legende um Mirjana – der Hexe von Ragusa.
Von Mirjana ahnt Nella noch nichts, als sie im Nachlass ihrer Mutter eine geheimnisvolle Perlenkette findet. Sie spürt die Perlen unter ihren Fingern vibrieren, und sie sieht, wie sich ein fremdes Gesicht über ihres legt, wenn sie sich im Spiegel betrachtet. Doch bald wird sie weit mehr sehen: Das Ragusa des 16. Jahrhunderts ersteht vor ihren Augen. Nella gerät in den Bann von Menschen, die in ihrer Zeit längst tot und begraben sind, sie sieht und fühlt, was sie nie für möglich gehalten hätte. Nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart, in der ihr der äußerst attraktive Antiquitätenhändler Safet weder aus dem Kopf geht noch aus dem Herzen zu reißen ist.
Folgen Sie den beiden zuerst nach Dubrovnik und dann nach Ragusa, lassen Sie sich verzaubern von einer Hexe, von kostbaren Perlen und von der atemberaubenden Landschaft Kroatiens.
Viel Vergnügen beim Lesen – und vielleicht planen Sie ja Ihren nächsten Urlaub in Dubrovnik!
Herzliche Grüße
Corinna Kastner
Vorspiel
Er lief. Seine Füße flogen über den Boden, so schnell, dass sie die Erde kaum zu berühren schienen. Die Bäume und Büsche links und rechts von ihm hatten keine scharfen Konturen, sie verwischten am Rande seines Blickfeldes. Sein Keuchen dröhnte ihm in den Ohren.
Hin und wieder machte er einen großen Satz über eine Baumwurzel oder ein anderes Hindernis, ängstlich darauf bedacht, nicht zu stolpern und hinzufallen, denn er wusste, würde das geschehen, wäre er verloren.
Er hörte sie hinter sich, hörte ihre Stimmen und ihre Rufe, und er betete zum Herrn, dass Er ihm helfen möge, obwohl er nur zu gut wusste, wie selbstgerecht er gewesen war. Eine Sünde, die Gott schwer verzieh. Wie konnte er also wagen zu beten? Der Herr strafte Seine Kinder, wenn sie die Gerechtigkeit selbst in die Hände nahmen, statt auf Ihn zu vertrauen und auf den Tag des Jüngsten Gerichtes.
Jetzt war es zu spät zu bereuen – und eigentlich bereute er auch nichts.
Die Stimmen wurden lauter, kamen näher, gefährlich nahe. Im Laufen drehte er sich halb um und erhaschte einen Blick auf die Gestalt, die ihm am nächsten war. Hätte er nur den Mut stehen zu bleiben, sich ihr entgegenzustellen und ihr von Angesicht zu Angesicht zu sagen, was er stattdessen anderen berichtet hatte. Doch er war nicht mutig. Er lief.
»Da vorn, seht!«, rief einer der Verfolger. »Dort läuft er!«
»Er darf uns nicht entkommen!«, erscholl die Antwort.
Dann geschah das Unglück. Er fiel über eine Wurzel, strauchelte, wild ruderten seine Arme über seinem Kopf, schließlich landete er mit dem Gesicht auf der weichen, feuchten Erde, die er in Mund und Nase bekam, weil er panisch nach Luft rang. Er spuckte den Dreck aus und versuchte, sich zugleich aufzurappeln, dabei hörte er viel zu dicht hinter sich einen frohlockenden Ausruf.
»Hab ich dich, du Lump!«
Und tatsächlich, er spürte eine Hand, die ihm am Nacken packte und hochzerrte, eine vom Laufen gerötete und zugleich vor Genugtuung verzerrte Fratze starrte ihn an.
»Hast geglaubt, du könntest uns entwischen, was? Nicht mit mir!«
Der andere kam erst jetzt heran, ihm war die Verfolgung scheinbar schwerer geworden. »Er ist gefasst, dem Herrn sei’s gedankt!«
»Was glaubst du wohl, was wir mit dir tun zum Dank für das, was du angerichtet hast?«, fragte der Erste.
Die Antwort bestand nur aus angstgeweiteten Augen und heftigem Zittern.
»Warum plötzlich um Worte verlegen? Zuvor warst du weniger verschwiegen!«
Das Lachen klang erbarmungslos, und er wusste, er brauchte nicht um Gnade zu bitten. Sie würde ihm nicht gewährt, um keinen Preis der Welt. Nun, dann war dies das Ende seines Lebens, so würde er ihr in den Tod folgen, wenn ihm auch Hölle oder Fegefeuer für seine Sünden bestimmt waren statt des Paradieses.
Er hörte auf zu zittern und wurde ganz ruhig.
»Was ist los?«, fragte der Mann, der ihn noch immer festhielt und mit seinem Blick aufzuspießen schien. »Ist deine Furcht dermaßen groß, dass sie dich lähmt? Recht so, dann haben wir es leichter mit dir. Und sei gewiss, dein Entsetzen ist begründet.«
»Tut mit mir, was Ihr wollt«, antwortete er und schwor bei sich, kein weiteres Wort mehr über seine Lippen dringen zu lassen. Sein letzter Satz – gerichtet an einen Menschen, den er in diesem Augenblick weit mehr verachtete als fürchtete, denn auch sein Peiniger würde dereinst in der Hölle schmoren.
»Was tun wir mit ihm?«, fragte der zweite Mann, der allmählich wieder zu Atem kam.
»Was schon? Dieser Platz ist ebenso gut wieder jeder andere!«
»Ihr wollt gleich hier …?«
»Wo sonst? Danach werden wir dasselbe tun, was unser Freund hier so trefflich verstand: verbreiten, was geschehen ist!«
Erster Teil
1.
Es fiel mir schwer, mich loszureißen. Niemand war noch hier außer den Totengräbern, die in einiger Entfernung warteten, bis ich gehen würde, damit sie endlich mit ihrer Arbeit beginnen konnten. Ich bemühte mich, die Männer mit den berufsmäßigen Leidensmienen aus meinem Bewusstsein zu verbannen, und sah hinab in das Grab mit dem hellen Eichensarg, auf dem sich Erde und einzelne Blumen türmten. Noch immer hielt ich meine weiße Rose in den Händen.
Hinter mir hörte ich einen der Totengräber leise murmeln. Es war mit Sicherheit nicht die einzige Beerdigung, auf der sie heute zu tun hatten. Mit einem Seufzer ließ ich die Rose ins Grab fallen. Das dumpfe Geräusch des Aufpralls auf dem Sarg blieb mir erspart, weil sie auf einem kleinen Haufen Erde landete.
»Tschüss, Mama«, flüsterte ich, dann drehte ich mich langsam um und schritt an den zahllosen Gräbern entlang, auf dessen Steinen Namen und Daten standen, die mir weder etwas sagten noch etwas bedeuteten. Ich achtete nicht mal darauf, folgte nur dem Weg, schaute weder nach oben noch nach links oder rechts. Erst als ich an die Weggabelung kam, hob ich den Kopf. Der Engesohder Friedhof war riesig, man konnte sich leicht verlaufen zwischen all den Grabreihen und Alleen. Genauso gut konnte man an einem schönen Tag wie diesem, an dem die Sonne von einem strahlendblauen Mai-Himmel schien, einen ausgedehnten Spaziergang machen und die Grabstätten mit den verschiedensten fein gemeißelten Figuren bewundern oder die jener altehrwürdigen Familien, die sich vor langer Zeit ein kleines Mausoleum hatten leisten können.
Heute war mir nicht nach einem Spaziergang. Außerdem warteten Verwandte und Freunde meiner Mutter sicher schon auf mich. Ich hasste den Gedanken, zu dem üblichen Kaffeetrinken aufzutauchen, und hätte mich stattdessen lieber in meiner Wohnung eingeigelt und vergraben. Unwillkürlich verzogen sich meine Mundwinkel bei der ausgesprochen passenden, aber unbeabsichtigten Assoziation.
Das beeindruckende Tor des Friedhofs kam langsam in Sicht und wurde mit jedem Schritt größer. Es bestand aus rotem und gelbem Sandstein, und zu beiden Seiten des Eingangs verlief eine Mauer mit uralten Grabplatten. Kurz bevor ich es durchschritt, wandte ich mich noch einmal um und schaute zurück. Von hier konnte ich den inzwischen vermutlich aufgeschütteten und mit Kränzen und Sträußen überdeckten Grabhügel meiner Mutter nicht sehen, mein Blick fiel nur auf einen steinernen Engel mit weit ausgebreiteten Flügeln. Während der Beerdigung hatte ich nicht geweint, doch jetzt schien es plötzlich aus mir herausbrechen zu wollen. Bevor es soweit kam, schluckte ich den Kloß in meinem Hals herunter und trat auf die Straße. Hier hatte die wirkliche Welt mich wieder. Vor dem Friedhof wurde ein Baugelände erschlossen, eine große Betonwand hing an einem der Kräne und schwebte wie von Geisterhand beflügelt durch die Luft.
Ich schaute die Straße hinauf in die Richtung, in der mein Wagen geparkt stand, und wollte gerade meinen Schlüssel aus der Tasche fischen, als mein Blick auf ein anderes Auto fiel und ich mitten in der Bewegung innehielt. Der schwarze BMW glänzte in der Sonne, wahrscheinlich war er so gut gewachst, dass jeder Regentropfen einzeln davon abgeperlt wäre. Doch das nahm ich nur am Rande wahr. Der Mann, der gerade eben noch lässig an der Motorhaube gelehnt hatte, sah mich fast im selben Moment wie ich ihn. Er stieß sich vom Heck ab und kam langsam auf mich zu. Wie konnte er es wagen, hier aufzutauchen?
Ich sollte auf dem Absatz kehrtmachen und ihn mitten auf der Straße stehen lassen, sagte ich mir. Aber meine Beine verweigerten den Dienst, meine Füße hafteten wie festgefroren auf dem Asphalt.
Es trug einen schwarzen Anzug, der zweifellos maßgeschneidert war und ein Vermögen gekostet hatte – unter einem Designerstück fing ein Mann wie Henning Laurenz erst gar nicht an.
»Nella«, sagte er, als ihn nur noch ein kleines Stück von mir trennte.
Ich wich einen Schritt zurück, erleichtert, dass ich dazu endlich fähig war.
Er reagierte sofort und versuchte nicht, mir noch näherzukommen. »Ich weiß, es muss dir schwerfallen, mir zu glauben. Aber es tut mir leid. Ehrlich.«
Dieses Wort aus seinem Mund zu hören, schien mir wie purer Hohn. Es war mit Sicherheit sehr lange her, dass Henning Laurenz irgendetwas ehrlich empfunden hatte. Für ihn gab es nur zwei wirklich wichtige Dinge: Erfolg und Ansehen. Drei, korrigierte ich mich. Reichtum gehörte auch dazu, in Form von Geld oder anderen Dingen.
»Was willst du?«, fragte ich, ein Zittern in meiner Stimme unterdrückend.
»Nichts«, gab er zurück. »Nur sagen, dass es mir leidtut. Immerhin war Sonja auch mal ein Teil meines Lebens. Wir haben viele Jahre miteinander geteilt, auch wenn es so unschön geendet hat.«
»Unschön?«, wiederholte ich. »Das dürfte die Untertreibung des Jahrhunderts sein. Wenn ich gewusst hätte, dass du auf der Beerdigung bist, hätte ich dich aus der Kapelle werfen lassen.«
Mit einem Gesichtsausdruck, den mein Vater vermutlich für trauerumflort hielt, sah er mich an. »Warum musst du so feindselig sein? Ich habe Fehler gemacht, das ist mir bewusst. Aber können wir uns nicht zusammensetzen und darüber reden wie erwachsene Menschen? Ich bin sicher, Sonja hätte das auch gewollt.«
Das gab mir den Rest. »Wie kannst du dir anmaßen zu wissen, was Mama gedacht hat?«, fauchte ich. »Dich hat seit Jahren nicht mehr geschert, was in ihr vorging. Du musstest sie ja im Stich lassen, als sie dich am nötigsten gebraucht hätte, nur weil eine Frau mit einer amputierten Brust plötzlich nicht mehr in deine heile Erfolgswelt passte.«
»Nella, das ist nicht die ganze Geschichte«, widersprach mein Vater und ging doch wieder auf mich zu. Gleichzeitig wich ich weiter zurück, bis ich mit dem Rücken an der hohen Friedhofsmauer stand.
»Nein, natürlich nicht. Die ganze Geschichte, wie du das zu nennen beliebst, fing schon viel früher an. Als du nämlich fandest, dass Mama langsam zu alt wurde. Da hast du dich unter deinen Mitarbeiterinnen umgesehen, die du eine nach der anderen in dein Bett gezerrt hast. Denk bloß nicht, ich hätte das nicht mitgekriegt. Du hast dir wenig Mühe gegeben, diskret zu sein. Mama hat ausgehalten, weil sie dachte, du würdest früher oder später zur Vernunft kommen, aber dann hast du sie endgültig fallen lassen, als sie nicht mehr perfekt funktionierte. Und das hat ihr den Lebenswillen genommen.«
Meine Stimme war immer lauter geworden. Ich war wütend und traurig zugleich und hätte in diesem Moment meinen eigenen Vater liebend gern in die riesige Baugrube gegenüber gestoßen, nur um zu sehen, wie seine blitzsaubere Fassade genauso schmutzig wurde, wie er innen schon lange war. »Geh zum Teufel und lauf mir nie wieder über den Weg.«
Damit schob ich ihn zur Seite und hastete auf meinen kleinen blauen Renault zu. Aus den Augenwinkeln bekam ich mit, dass aus dem Wagen meines Vaters eine Frau ausstieg, die ihm entgegensah. Ich sollte sie warnen, schoss es mir durch den Kopf, dass er sie wegwerfen würde wie die anderen vor ihr, wenn er genug von ihr hatte. Aber das musste sie schon allein herausfinden. Alt genug dazu war sie wohl, was sie immerhin von ihren Vorgängerinnen unterschied. Trotz ihrer roten Lockenpracht schien sie nur etwa zehn Jahre jünger zu sein als mein Vater.
Ich stieg in den Wagen, gab Gas und fuhr absichtlich durch eine große Pfütze, so dass der dunkle Schlamm ans Heck des Mercedes spritzte.
Erst als ich am Abend im Bett lag und den Tag noch mal Revue passieren ließ, kam ich dazu, mich zu fragen, weshalb Henning Laurenz tatsächlich auf der Beerdigung aufgekreuzt war. Nur um sein Beileid zu bekunden und mit mir Frieden zu schließen, kam mir unglaubwürdig vor, dazu kannte ich ihn zu gut. Wenn das also nicht der Grund war – was war es dann?
2.
Während der nächsten Tage bemühte ich mich, das überraschende und vor allem unerfreuliche Wiedersehen mit meinem Vater zu verdrängen. Zumindest tagsüber gelang mir das einigermaßen, weil mich mein Job als Assistentin in Christian van Laaks Gemäldegalerie reichlich auf Trab hielt. Christian handelte nach der Devise, Arbeit sei die beste Medizin, und damit hatte er in diesem Fall wohl auch recht. Die Stelle hatte ich vor drei Jahren ergattert, indem ich Nachfolgerin einer Freundin wurde, die damals mit ihrem Mann nach Süddeutschland gezogen war. Ihr Abschiedsgeschenk bestand darin, mich van Laak zu empfehlen, und nachdem er meine Referenzen geprüft und meinen Abschluss in Kunstgeschichte für gut befunden hatte, stellte er mich ein.
Als meine Mutter starb, waren wir gerade mitten in den Vorbereitungen für eine neue Ausstellung, deshalb lag selbst ein kurzer Urlaub nicht drin. Das wiederum bedeutete, dass ich jede freie Minute dazu nutzen musste, ihre Wohnung aufzulösen. Das war keine leichte Aufgabe, besonders weil ich nicht alles aufbewahren konnte, an dem ihr Herz gehangen hatte. So vieles wanderte in den Sperrmüll oder wurde verkauft, oft war ich dabei den Tränen nahe. Wenn in diesen ziemlich kritischen Momenten dann noch mein Handy klingelte, lagen meine Nerven blank, weil ich zuerst immer noch befürchtete, die Stimme meines Vaters zu hören. Doch er verhielt sich still und machte keinerlei Versuch, mit mir in Verbindung zu treten. Nach einer Woche kam ich widerwillig zu dem Schluss, dass ich ihm möglicherweise unrecht getan und er auf der Beerdigung seiner Ex-Frau einfach nur Abschied hatte nehmen wollen.
Schließlich stand ich an einem Mittwochnachmittag, an dem ich mir ausnahmsweise ein paar freie Stunden am Stück gegönnt hatte, mit zwei Kisten in einer ansonsten leergeräumten Wohnung. Ein letztes Mal sah ich mich um, bevor ich den Schlüssel beim Hauswart abgab, einen Karton auf dem Rücksitz, den anderen im Kofferraum verstaute und mit dem wenigen, was mir als Andenken an meine Mutter bleiben würde, quer durch die Stadt nach Hause in die List fuhr. In diesem Stadtteil von Hannover hatten viele Altbauten der Jahrhundertwende den Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs überlebt, unter dem die Innenstadt fast vollständig zerstört worden war. Meine Drei-Zimmer-Wohnung befand sich im Dachgeschoss eines jener stuckverzierten Häuser, nicht weit vom Stadtwald Eilenriede entfernt.
Zu Hause stellte ich die Kisten im Flur ab und drückte mich erst mal davor, sie auszupacken. Ich würde noch eine Menge Zeit brauchen, mir zu überlegen, was ich mit den Erinnerungsstücken tun sollte. Dennoch stand ich eine ganze Weile im Flur und starrte auf die Kartons, bis mich die Türklingel davon erlöste.
Erschrocken fuhr ich zusammen und drehte mich um. Dabei erkannte ich die Silhouette eines Mannes durch die Milchglasscheiben. Kurz dachte ich daran, den Besucher zu ignorieren, aber da im Flur das Licht schien und er mich genauso sehen konnte wie ich ihn, blieb mir nichts anderes übrig, als zu öffnen.
»Hallo, Nella. Ich hoffe, ich störe nicht«, sagte Christian van Laak mit einem schiefen Lächeln.
»Durchaus nicht«, log ich, darum bemüht, meine leichte Beunruhigung zu überspielen. Christian hatte mich bisher nie zu Hause besucht, und das war mir auch immer sehr recht gewesen. Obwohl wir nämlich hervorragend zusammenarbeiteten und ich meine Arbeit sehr mochte, gab es da ein kleines Problem mit meinem Chef, der in mir gern etwas mehr als seine Assistentin gesehen hätte. Er machte das durch Blicke und Andeutungen hin und wieder deutlich und ließ sich auch durch mein Desinteresse nicht generell entmutigen, sondern wartete dann eben mal wieder ein paar Wochen oder Monate bis zum nächsten Versuch. Heute war kein passender Moment dafür.
Trotzdem trat ich einen Schritt zur Seite. »Komm doch rein.«
Christians eins neunzig große Gestalt schob sich an mir vorbei. Zweifellos war er ein attraktiver Mann – wenn man auf blond stand. Ich hatte einen anderen Geschmack, obwohl der mich wenigstens einmal schon ordentlich reingeritten hatte. Meine Ehe mit einem dunkelhaarigen Musiker, der ausgesehen hatte wie Botticellis Mann mit der Medaille, war genauso kurz wie katastrophal gewesen. Eigentlich hätte ich also mit fliegenden Fahnen zur blonden Fraktion überlaufen müssen.
Im Augenblick musste ich mir aber wohl deswegen sowieso keine Gedanken machen. Mittlerweile hatte ich erkannt, dass Christian ganz andere Dinge beschäftigten, fast wäre er sogar über die beiden Kisten gestolpert.
»Sind das …?«
»Ja«, fiel ich ihm ins Wort. »Ich bin selbst gerade erst gekommen. Möchtest du vielleicht einen Kaffee?« Damit lotste ich ihn in die Küche, wo sein regennasser Schirm weniger Schaden als auf dem Parkettboden anrichten konnte.
»Nein, danke. Ich muss gleich wieder los und wäre auch gar nicht hier, wenn ich dich übers Handy oder wenigstens über deinen Anrufbeantworter hätte erreichen können.«
»Ich hab beides ausgeschaltet«, sagte ich nur ein bisschen schuldbewusst.
»Offensichtlich«, seufzte Christian. »Erinnerst du dich, dass ich dir vor ein paar Wochen von der Vernissage bei Gülden erzählt habe?« Er wartete mein Nicken ab, dann sprach er weiter. »Die Eröffnung ist heute Abend. Es kommen ein paar wirklich wichtige Leute, die ich auch gern bei unserer eigenen Ausstellungseröffnung dabei hätte. Leider hat ja bisher erst die Hälfte zugesagt.«
Wieder nickte ich. Schließlich führte ich die Liste mit den Zu- und Absagen, und obwohl wir bereits viele positive Antworten erhalten hatten, fehlten ausgerechnet die der einflussreichsten Kunstexperten und Kunstliebhaber, auf die Christian ungern verzichten wollte.
»Ich wollte dich bitten, mit mir da hinzugehen.«
Etwas gequält schnitt ich eine Grimasse. Ich mochte solche offiziellen gesellschaftlichen Aufmärsche nicht sonderlich und war immer froh, wenn ich die von uns selbst organisierten hinter mich gebracht hatte.
»Ich weiß, du würdest lieber zu Hause bleiben«, fuhr Christian fort. »Aber so kommst du vielleicht auch auf andere Gedanken.« Er warf einen vielsagenden Blick durch die Küchentür auf den Flur zu den Kartons hinüber. »Außerdem ist das ungeheuer wichtig, Nella. Ich brauch dich da heute Abend.«
Gleich zwei Köder ausgelegt, sehr schlau von dir, dachte ich. Er versuchte es auf die »Ohne-dich-geht-gar-nichts«-Tour, obwohl er genauso gut wie ich wusste, dass das Unsinn war. Aber so wie ich generell solche Veranstaltungen mied, so sehr verabscheute er es, ohne Begleitung irgendwo hinzugehen. Ich musste mich entscheiden, wozu ich weniger Lust hatte: auf die Vernissage und ein paar nervige Stunden an diesem Abend oder auf Christians anhaltende miese Laune während der nächsten Tage, wenn ich zu Hause blieb.
»Okay. Wann soll ich da sein?«
»Ich wusste, du lässt mich nicht hängen! Die offizielle Eröffnung ist um acht, treffen wir uns doch um halb im Fundus, trinken was und gehen dann rüber.«
Bevor ich noch allzu viel sagen konnte, griff Christian nach seinem Schirm, verspritzte ein paar Regentropfen über meiner prall gefüllten Obstschale auf dem Tisch und verschwand im Flur.
»Ich find schon raus!«, rief er über die Schulter, dann hörte ich nur noch die Tür ins Schloss fallen und war wieder mir selbst überlassen.
Halb ärgerlich, halb amüsiert schüttelte ich den Kopf. Ein Gutes wenigstens hatte Christians Auftritt gehabt. Es kostete mich nicht mehr so viel Überwindung, mich den Sachen meiner Mutter zu widmen. Entschlossen schob ich die Kisten in das kleine Zimmer, in dem mein Schreibtisch mit einem Laptop und zwei große Bücherregale voller Kunstbände standen. An der einzigen freien Wand prangte ein Druck von Gauguin, dessen warme, bunte Südseefarben ich liebte.
Die Vernissage bei Gülden würde nichts damit gemein haben, wo ein zeitgenössischer japanischer Künstler seine Werke ausstellte. Angeblich war er die Neuentdeckung, aber ich konnte mir ehrlich nicht vorstellen, dass mir seine Art, verschieden dicke gelbe Linien mit blauem Hintergrund auf die Leinwand zu malen, sonderlich viel sagen würde. Allerdings gab es bei Gülden auch einen großzügigen Raum mit Renaissance-Gemälden, die mir sehr gut gefielen. Möglicherweise fand ich Gelegenheit, mich da für eine Weile zurückzuziehen.
Jetzt jedoch stand ich erst mal vor den Kartons meiner Mutter. Wie wenig von einem Leben letztendlich übrig blieb, wenn es vorbei war. Ich schluckte den erneut aufkommenden Kloß in meinem Hals herunter, trat an meinen Schreibtisch und schaltete das Notebook ein. Wenn ich in drei Stunden ein paar angemessene Bemerkungen zu den Bildern dieses Japaners machen sollte, wäre es wohl besser, mich ein bisschen über den Mann und seine Kunst zu informieren.
Ich bemerkte gar nicht, wie dabei die Zeit verging, und erschrak, als mein Blick zufällig auf die Uhr am Bildschirm fiel. Ich musste noch unter die Dusche und mich anziehen und dann zur U-Bahn. Mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, hätte nur stundenlanges Parkplatzsuchen bedeutet.
Eine Viertelstunde später spurtete ich ins Schlafzimmer, um mich in mein dunkelgrünes Etuikleid zu zwängen, das ich gar nicht mehr so richtig mochte. Aber bei solchen Gelegenheiten war es üblich, sich in Schale zu werfen, und das grüne Kleid war das Einzige in der Richtung, was mein Kleiderschrank hergab. Als ich angezogen war, warf ich erneut einen Blick auf die Uhr. Ich hatte nicht so lange gebraucht wie befürchtet und würde nun doch zu früh sein, wenn ich gleich losging.
Ich wanderte zurück in mein Arbeitszimmer und starrte auf die beiden Kisten, die mich fast ein bisschen vorwurfsvoll ansahen, weil ich sie so achtlos dort abgestellt hatte. Unsicher machte ich einen Schritt auf die linke Kiste zu, dann wandte ich mich plötzlich um und befingerte den Deckel der anderen. Ich konnte selbst nicht sagen, warum, aber ein seltsames Gefühl in mir drängte mich, ihn zu heben. Ganz oben lag die Schmuckschatulle meiner Mutter. Schon als Kind hatte ich sie gern dabei beobachtet, wenn sie eine Kette, eine Brosche oder ein Armband sorgfältig auswählte und umlegte. Ich nahm die Schatulle aus dem Karton und ging damit hinüber ins Wohnzimmer, wo ich mich aufs Sofa setzte und nacheinander die Schubladen aufzog. Da lagen viele vertraute Stücke: die goldene Kette mit dem Schmetterlingsanhänger oder der Ring mit dem Goldtopas, den meine Mutter besonders geliebt hatte. An der letzten und größten Schublade befand sich ein kleines Schloss, zu dem ich zunächst keinen Schlüssel fand. Nach einigem Suchen jedoch entdeckte ich ihn unter einer Kamee. Neugierig zog ich die Schublade auf und förderte ein schmales mit Schnitzereien verziertes Holzkästchen zu Tage, das ich nie zuvor gesehen hatte.
Ich fragte mich, weshalb ich zögerte, das Kästchen zu öffnen, aber genau wie eben beschlich mich wieder dieses undefinierbare Gefühl, wie eine Vorahnung. Ich war sonst ein ziemlich rationaler Mensch und hielt nichts von solchen Dingen, weshalb mir erst recht unwohl war. Dann jedoch gab ich meiner Neugier nach, klappte den Deckel hoch und blickte auf eine Lage weicher, bordeauxroter Seide. Ich schluckte trocken, als ich die Seide zur Seite schob. Was darunter zum Vorschein kam, ließ mir den Atem stocken. Die Kette aus apricot schimmernden, dabei leicht unregelmäßigen Perlen war außergewöhnlich schön. Daran hing eine taubeneigroße Perle in Form eines fast perfekten Tropfens, die in ihrem Goldton genau auf den Verschluss abgestimmt war, einem kunstvoll verzierten Haken mit einer ebenso fein gearbeiteten Öse.
Diesem Schmuck haftete etwas ganz Besonderes an, das ich mehr fühlte als erklären konnte. Obwohl ich mich weder mit Schmuck im Allgemeinen noch mit Perlen im Besonderen auskannte, wusste ich eins ganz instinktiv: Die Kette war nicht bei einem x-beliebigen Juwelier gekauft worden. Auch nicht in dieser Stadt – und ganz sicher nicht in diesem Jahrhundert. Oder dem letzten.
Wie hypnotisiert starrte ich die Perlen an und fragte mich, wie sie in den Besitz meiner Mutter gelangt sein mochten. Erst ein lautes Klingeln brachte mich in die Gegenwart zurück. Ich schaffte es nur mit Mühe, das Holzkästchen auf dem Tisch abzustellen, bevor ich aufstehen und nach dem Handy greifen konnte.
»Wo bleibst du denn, um Himmels willen?«, hörte ich Christians ungeduldige Stimme.
»Wieso?«, fragte ich benommen zurück. »Es ist doch erst …«
»Es ist viertel vor acht! Wir waren um halb verabredet, schon vergessen?«
Verwirrt schaute ich auf die Uhr, die offensichtlich nachgehen musste, aber Christian hatte ganz recht. Sie zeigte viertel vor acht. Es war doch noch gar nicht so spät gewesen, als ich mit der Schmuckschatulle meiner Mutter ins Wohnzimmer gekommen war. Wie lange hatte ich mit den Perlen vor mir da gehockt und alles um mich herum vergessen?
»Tut mir leid«, murmelte ich. »Ich mach mich sofort auf den Weg. Wenn du nicht warten willst, geh ruhig schon rein.«
»Kommt nicht in Frage, wie sieht das denn aus? Nimm dir ein Taxi, das geht schneller.« Damit beendete er das Gespräch.
Ich hastete auf den Flur, um meine Jacke überzuziehen. Als ich am Garderobenspiegel vorbeikam, fiel mein Blick auf mein Dekolleté. Ich zögerte einen Moment. Konnte ich das wirklich tun?
Kurz entschlossen ging ich zurück, meine Hand schwebte nur zwei Sekunden über dem Holzkästchen, dann griff ich nach den Perlen, die ich erst jetzt zum ersten Mal berührte. Ich spürte ein Prickeln in meinen Fingerspitzen, als hätte ich lange Zeit auf meiner Hand gelegen und als finge nun das Blut plötzlich wieder an zu zirkulieren. Erschrocken zuckte ich zurück. Einen Moment lang dachte ich irrationalerweise, die Perlen würden mich vor etwas warnen wollen, schüttelte aber gleichzeitig den Kopf über diese verrückte Idee. Ich nahm die Kette und ignorierte das neuerliche, aber nun weniger starke Kribbeln, das von den Perlen auszugehen schien. Stattdessen fand ich blind den Verschluss in meinem Nacken, streifte endgültig meine Jacke über und lief die Treppe hinunter.
3.
Christian wartete ein paar Meter von Güldens Galerie entfernt. Es war bereits acht Uhr vorbei, die meisten Gäste waren schon drin, aber möglicherweise waren wir noch früh genug für die offizielle Eröffnungsrede.
»Auch schon da?«, empfing mich Christian ärgerlich.
»Tut mir leid«, entschuldigte ich mich zum zweiten Mal, fühlte mich aber nicht genötigt, eine Erklärung abzugeben.
»Sollte es auch«, murmelte Christian. Dann wandte er sich um und ging auf den Eingang zu.
In der Galerie empfing uns helles, aber dennoch sehr angenehmes Licht, genau richtig, um die Bilder Takashimas zur Geltung zu bringen. Vielleicht hatte ich ein bisschen übertrieben, es waren nicht nur gelbe Linien auf blauem Hintergrund, weiter hinten im Raum an einem quadratischen Pfeiler entdeckte ich an jeder der vier Seiten Bilder mit verschieden großen roten Kreisen auf schwarzem Hintergrund. Das war immerhin eine Abwechslung.
Jemand nahm mir die Jacke ab, und Christian drängte mich vorwärts in Richtung des Galeriebesitzers. Manfred Gülden war um die sechzig und eine Institution. Stets in einen unscheinbaren grauen Anzug gekleidet, hinterließ seine Persönlichkeit genug Eindruck, so dass er auf ein auffälliges Äußeres ohne Weiteres verzichten konnte.
In unserer Branche konkurrierte man manchmal hart, manchmal arbeitete man zusammen, wie es gerade passte. Da auch wir kurz vor einer neuen Ausstellung standen, war diesmal der Konkurrenzgedanke vorherrschend, aber weder Christian noch Gülden ließen sich etwas davon anmerken.
»Herr van Laak, ich freue mich, dass Sie kommen konnten«, sagte er, bevor er meine Hand nahm. »Und in so charmanter Begleitung. Frau Simon, es ist immer wieder eine Freude, Sie zu sehen. Sie wissen ja, wenn Sie eines Tages eine neue Herausforderung suchen sollten, müssen Sie nur hier anklopfen.«
Ich lächelte. »Vielen Dank, Sie sind sehr freundlich.« Dieses Angebot hatte Manfred Gülden mir schon das eine oder andere Mal gemacht, wir kannten uns seit Langem. Gülden war mit meinem Vater befreundet, was ich normalerweise nicht als Empfehlung betrachtete, doch tatsächlich hatte er sich meiner Mutter gegenüber über all die Zeit fair verhalten und sie während ihrer Krankheit oft besucht. Es war ein gutes Gefühl zu wissen, dass ich nicht auf der Straße stehen würde, falls ich von Christians Anwandlungen doch mal die Nase voll bekäme.
»Durchaus nicht!«, widersprach Gülden. »Nur sehr eigennützig.«
»Ganz meine Meinung«, warf Christian ein. »Frau Simon ist nicht so einfach abzuwerben.«
Gülden lachte. »Ich weiß, ich weiß. Gestatten Sie mir trotzdem, es hin und wieder zu versuchen.« Er wandte sich wieder an mich, doch was immer er sagen wollte, geriet in Vergessenheit. Stattdessen blieb sein Blick an den Perlen meiner Mutter hängen. »Zauberhaft«, sagte er. »Manchmal stelle ich zu meiner Verwunderung fest, dass es doch noch andere Kostbarkeiten als Gemälde gibt. Woher haben Sie diese ausgefallene Kette?«
»Aus dem …«, begann ich, aber da wurde Gülden von seiner Assistentin angesprochen, die ihn an die Eröffnungsrede erinnerte. Er nickte, entschuldigte sich bei uns und trat zu einem asiatischen Mann in Jeans und rotem Jackett. Dieser vollkommen unpassende Aufzug machte mir Takashima trotz seiner für mich schwer verdaulichen Kunst sofort sympathisch.
Während Gülden seine Rede hielt, schielte Christian zu mir herüber. »Die ist wirklich schön«, flüsterte er. »Woher hast du sie denn nun?«
»Hat meiner Mutter gehört«, flüsterte ich zurück. Ich hob meine Hand, um die Perlen zu berühren, und fast augenblicklich spürte ich wieder das Kribbeln in den Fingerspitzen. Schnell ließ ich die Kette los. Das war idiotisch, es gab nichts zu spüren!
Christian stand sehr dicht bei mir, jetzt beugte er sich ein Stück zu mir herunter. Sein Zeigefinger tippte auf die goldfarbene Tropfenperle, ich spürte seinem Atem auf meinem Gesicht, als er sagte: »Sie passt zu dir, Nella.«
»Findest du?« Sehr bewusst trat ich einen Schritt zurück und damit jemandem hinter mir auf den Fuß. Das war mir allerdings im Moment egal, ich wollte nur nicht, dass Christian mir noch näher kam. Es schien ganz so, als sei dies mal wieder eine der Gelegenheiten, bei denen er dachte, mich umstimmen zu können.
Der Mann in dem schwarzen Anzug, der hinter mir gestanden hatte, fluchte verhalten. Ich drehte mich zu ihm um und wisperte »Verzeihung«, dann achtete ich nicht weiter auf ihn, obwohl ich spürte, dass er mich anstarrte, immer noch vorwurfsvoll vermutlich. Ich war bloß froh, Christians Nähe entkommen zu sein, und fiel in den Applaus ein, der nach Güldens Worten aufbrandete. Anschließend hielt Takashima in sehr gutem Englisch eine witzige und vor allem kurz Ansprache, in der er sich selbst viel Erfolg und uns Spaß mit seinen Bildern wünschte. Ich beschloss, seine Kunst doch mit wohlwollenderen Blicken zu würdigen, als ich es vorgehabt hatte.
Der restliche Abend verlief wie geplant. Christian gelang es, mit den meisten der Leute zu reden, die er hatte treffen wollen, um sie noch einmal an unsere Galerie zu erinnern. Der persönliche Kontakt war sehr wichtig, viel wichtiger als eine Einladungskarte auf Büttenpapier mit Goldrand, und so taten wir unser Bestes, uns und unsere Ausstellung ins Gespräch zu bringen. Zwar hatten wir keinen Takashima zu bieten, aber immerhin eine Künstlerin aus Frankreich, die sich in letzter Zeit dort einen Namen nicht nur mit ihren ausdrucksstarken Bildern gemacht hatte, sondern auch mit ihren dazugehörigen Plastiken. Beides zum themenübergreifenden Komplex Bewegungen würde demnächst bei uns zu sehen sein.
Irgendwann konnte ich mich loseisen und mich in Güldens hinteren Ausstellungsraum mit den Renaissance-Gemälden davonschleichen, wo ich jede Sekunde genoss. Auch wenn es sich bei den meisten Bildern natürlich nur um Kopien handelte, weil die echten Meisterwerke in weltberühmten Museen hingen, waren es doch fast perfekte Fälschungen, die nur ein sehr geübtes Auge als solche erkennen konnte. Selbst diese Kopien besaßen einen recht hohen Wert. Ich stand versunken in Tizians Eitelkeit der Welt, dessen Original in der Münchener Pinakothek hing, als ich ein unangenehmes Prickeln im Nacken wahrnahm. Jemand beobachtete mich. Vermutlich war das Christian, den ich zu ignorieren beschloss, indem ich langsam von Bild zu Bild wanderte, bis ich sicher sein konnte, wieder allein zu sein. Seufzend kehrte ich zu dem Tizian zurück, gönnte der schönen Frau noch einen letzten Blick und wollte dann zurück zu Takashima. Doch in diesem Moment kam mir Gülden entgegen.
»Ich dachte mir, dass ich Sie hier finde«, stellte er fest.
»Vermutlich ist es unangemessen, die Vergangenheit zu bewundern, wo doch die Gegenwart drüben gerade so gefeiert wird.«
»Aber nein, im Gegenteil. Ich bin der Meinung, dass wir zuweilen der Vergangenheit ruhig mehr Aufmerksamkeit schenken sollten. Man kann so viel daraus lernen, wenn man es versteht, richtig hinzuhören, richtig hinzusehen und sich vor allem richtig hineinzufühlen. Wissen Sie, das ist es, was mich schon als sehr jungem Menschen an der Kunst fasziniert hat. Oder auch nur an alten Dingen allgemein.«
Das konnte ich gut nachvollziehen, genauso war es mir gegangen. Meine Gefühle meinem Vater gegenüber mochten im besten Fall gespalten, im schlimmsten Fall sehr hässlicher Natur sein, aber die Faszination für Kunst und Kunstobjekte hatte ich zweifellos von ihm. Als Direktor eines privaten Museums für Kunstgeschichte hatte er mir die Liebe dazu nahegebracht. Das war lange her, und es blieb immer das Einzige, was wir beide gemeinsam hatten.
Als hätte Gülden meine Gedanken gelesen, sagte er: »Ich bin übrigens vor einigen Tagen Ihrem Vater begegnet. Er erzählte mir, er habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Sie einmal seine Nachfolgerin werden.«
Das überraschte mich. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass ihm so etwas im Kopf herumspukte. Hatte er darüber mit mir reden wollen? Selbst wenn, das war für mich vollkommen undenkbar.
»Ich erzählte ihm, dass ich Sie heute vermutlich sehe – natürlich habe ich gehofft, dass Sie kommen –, und er bat mich, Ihnen zu sagen, wie sehr er es begrüßen würde, wenn Sie Ihre Streitigkeiten begraben könnten.«
»Es ist nett, dass Sie zu vermitteln versuchen, Herr Gülden. Aber einer meiner schlechtesten Charakterzüge besteht darin, dass ich nachtragend bin und schwer verzeihen kann.«
Gülden lächelte ein bisschen traurig. »Vielleicht brauchen Sie einfach noch Zeit.«
»Ja, kann sein«, sagte ich, auch wenn ich keineswegs davon überzeugt war.
Stille breitete sich zwischen uns aus, die Geräusche aus den vorderen Ausstellungsräumen drangen nur gedämpft bis hier her. Nach einer Weile berührte mich Gülden am Arm und begleitete mich hinaus. »Möglicherweise ist zu langes Verweilen in der Vergangenheit auch nicht gut«, sagte er dabei. »Alles eine Frage der Perspektive.«
Drüben bei Takashima hatten sich die Reihen inzwischen gelichtet. Christian war in ein Gespräch mit einer Dame vertieft, die ich nicht kannte, und weiter hinten standen noch zwei, drei Grüppchen zusammen, eins davon um Takashima versammelt. Manfred Gülden gesellte sich zu ihnen, während ich zu Christian hinüberging. Ich hatte den Eindruck, dass die Dame an seiner Seite ganz erleichtert über mein Auftauchen war, weil sie sich auf diese Weise geschickt verabschieden konnte.
»Wer war das?«, fragte ich. »Jemand Wichtiges?«
»Sie vertritt Takashimas Interessen hier in Deutschland. Nicht nur seine übrigens, sie hat mehrere Künstler unter Vertrag. Kann sein, dass gelegentlich mal der eine oder andere bei uns ausstellt. Jedenfalls habe ich sie eingeladen, bei uns reinzusehen, wenn wir mit Yvonne so weit sind.«
»Gute Idee. Kommt sie?« Dabei hatte sie mir eher weniger erpicht darauf ausgesehen, noch mal in Christians Fänge zu geraten.
»Ich hoffe. Was hältst du davon, wenn wir nachholen, was wir vorhin versäumt haben? Im Fundus ist nicht mehr viel los um diese Zeit, aber mit viel Glück kriegen wir noch was im Prinz.«
Eigentlich hatte ich keine Lust mehr auf einen Drink, ich wollte nur noch nach Hause und vor allem raus aus diesen Schuhen. Ich trug normalerweise keine hohen Absätze, aber zu dem Kleid passte nichts anderes. Trotzdem hatte ich das Gefühl, Christian wegen meiner Verspätung was schuldig zu sein, also stimmte ich zu.
Das Prinz war gerammelt voll. Trotzdem ergatterten wir noch einen kleinen Stehtisch, wovon ich zuerst nur wegen meiner Schuhe alles andere als begeistert war. Bald gab es einen weiteren Grund.
»Nella«, fing Christian nach dem zweiten Caipi an und schob sich dichter an mich ran, »ich bin wirklich froh, dass du dabei warst heute Abend. Wir sollten öfter zusammen ausgehen, findest du nicht?«
Nein, fand ich nicht. Aber ich wusste auch, wie Christian reagierte, wenn er etwas mehr getrunken hatte – empfindlicher als sonst nämlich. An diesem Abend waren es außer den zwei Cocktails auch noch ein paar Gläser Sekt auf der Vernissage gewesen.
»Es ist spät«, sagte ich statt einer direkten Antwort. »Ich hatte einen anstrengenden Tag und sollte längst im Bett sein.«
Einen Augenblick lang musterte mich Christian, wie es sonst nicht seine Art war. »Es spricht nichts dagegen«, sagte er schließlich nach ein paar Sekunden.
Bevor ich etwas erwidern konnte, winkte er einem Kellner und zahlte, dann verschwand er, um unsere Jacken zu holen, und mir blieb mehr als genug Zeit, darüber nachzudenken, wie er das gemeint hatte.
»Ich fahr dich nach Hause«, sagte er jedoch wie selbstverständlich als er zurückkam. Ich hörte keinerlei Zwischentöne mehr heraus und begann, mich zu entspannen. Offenbar war ich wieder mal davongekommen, obwohl er nie zuvor so deutlich geworden war wie eben.
Zu Hause schälte ich mich aus dem Kleid und wankte mehr oder weniger ins Bad. Ich hatte nicht gelogen, sondern war wirklich müde. Außerdem stand mir morgen wohl endgültig die schwere Aufgabe bevor, die Kisten meiner Mutter durchzusehen und zu entscheiden, was ich in der Wohnung behalten und was davon ich zusammengepackt in den Keller verfrachten würde. Als ich bei diesem Gedanken angelangt war, griff ich nach einem feuchten Tuch, um mich abzuschminken. Das Make-up sah schon wesentlich weniger taufrisch aus als ein paar Stunden zuvor, doch mein Blick fiel nicht auf die verlaufene Wimperntusche, sondern auf die Perlenkette, die um meinen Hals lag.
Der irisierende Glanz der Perlen schien plötzlich noch intensiver zu sein. Das liegt am Neonlicht, sagte ich mir. Ich legte das Tuch zur Seite, wischte die cremigen Hände ab und fingerte nach dem Verschluss. Vorsichtig nahm ich die Kette ab und ließ die Perlen zwischen meine Finger gleiten. Sie fühlten sich kühl und warm zugleich an. Dann ging ich hinüber ins Wohnzimmer, öffnete das geschnitzte Holzkästchen, schob die Seide zur Seite und legte die Kette vorsichtig hinein. Ich strich noch einmal darüber, und kurz bevor ich sie ganz losließ, war es wieder da, das Kribbeln in meinen Fingerspitzen.
Mit einem Mal wurde mir klar, was es bedeuten mochte: die Erinnerung an meine Mutter, das Gefühl, ihr durch diese Kette trotz ihres Todes auf eine ganz eigene Art nahe zu sein.
4.
Bis zu unserer Ausstellungseröffnung blieb mir nicht viel Zeit, über geheimnisvolle Perlenketten nachzudenken. Mittlerweile hatte ich es zwar geschafft, die Kartons auszupacken und ein paar der für mich wertvollsten Erinnerungsstücke meiner Mutter zu Hause zu verteilen, doch das war alles, wozu ich kam. Ich musste nicht nur die Ausstellung vorbereiten, sondern mich auch noch um die Betreuung von Yvonne kümmern, die weniger pflegeleicht war, als Takashima mir gewesen zu sein schien. Ich hatte alle Hände voll zu tun und war ehrlich dankbar, dass die Eröffnung ein voller Erfolg wurde, die Künstlerin zufrieden abreiste und ich endlich, endlich seit ewig mal wieder ein Wochenende für mich ganz allein haben würde. An diesem Freitagabend beschloss ich, mich von nichts und niemandem stören zu lassen. Falls Christians Galerie abbrannte, sollte sie es ohne mich tun.
Während ich mich in meinem Renault durch den Feierabendverkehr nach Hause schlängelte, überlegte ich, was ich mit den beiden Tagen anfangen würde. Vielleicht am Samstag ein paar erholsame Stunden in der Sauna mit Verwöhn-Programm für Körper und Seele. Sonntag dann gemütlich auf dem Sofa mit einem guten Buch oder ein Treffen mit meiner Freundin Louise, die ich schon viel zu lange vernachlässigt hatte.
Ich überlegte noch, für welche der Optionen ich mich entscheiden würde, als kurz vor mir aus einer Kreuzung von links ein Wagen angeschossen kam. Erschrocken stieg ich in die Bremsen, kam gerade noch rechtzeitig zum Stehen und wusste im ersten Moment nicht, ob ich erleichtert aufatmen oder laut vor mich hin schimpfen sollte, weil mir dermaßen unverschämt die Vorfahrt genommen worden war.
Dann passierte es. Jemand krachte in mein Heck.
Dieser Jemand hatte offenbar im Gegensatz zu mir nicht mehr rechtzeitig bremsen können, musste aber doch schon langsam genug gewesen sein, dass nicht allzu viel passierte. Trotzdem wurde ich gegen den Sicherheitsgurt gepresst, mein Kopf ruckte nach vorn, und die Plötzlichkeit der Bewegung hinterließ einen bohrenden Schmerz zwischen meinen Schulterblättern.
Durch meine Benommenheit hindurch hörte ich ein dumpfes Klopfen neben mir am Fenster und drehte mich zur Seite. Der Mann, der mich von draußen besorgt musterte und dessen Lippen gerade ein fragendes »Hallo?« formten, ließ mich innerlich aufstöhnen. Auch das noch. Wieso musste mir ausgerechnet so ein Typ ins Auto brettern? Ich löste den Sicherheitsgurt und öffnete die Tür.
»Sind Sie in Ordnung?«, fragte er mit einem kaum wahrnehmbaren Akzent. Vielleicht was Südländisches, jedenfalls ließ sein Äußeres darauf schließen. Seine schwarzen Haare kringelten sich im Nacken, was diesem Mann bemerkenswert stand. Die bernsteinfarbenen Augen sahen zwar im Moment unsicher aus, aber ich hätte jederzeit geschworen, dass die auch ganz anders gucken konnten.
»Ja, es geht schon«, sagte ich im Aussteigen. Als ich vor ihm stand, merkte ich, dass er nur ein kleines Stückchen größer war als ich, sehr schlank und in einem weiß-blau gemusterten Hemd und einer verwaschenen Jeans steckte, die saß wie angegossen. Innerlich schüttelte ich über mich selbst den Kopf, weil ich überhaupt auf so was achtete, dabei gab doch erheblich Wichtigeres. Zum Beispiel nicht klein beizugeben, wenn er mich gleich zu überreden versuchen würde, auf die Polizei zu verzichten.
»Sind Sie sicher?« Er hob die Hand und legte sie auf meine Schulter. Vielleicht wollte er sich tatsächlich nur überzeugen, dass ich die Wahrheit sagte, aber das ging mir dann doch zu weit.
»Ja«, sagte ich schroff und trat einen Schritt zurück. Dabei warf ich einen Blick auf seinen Wagen hinter uns. Ich hätte was kleines Sportliches erwartet, die schwere Audi-Limousine in Silbermetallic dagegen überraschte mich, sie schien nicht zu dem Mann vor mir zu passen, der jetzt zum ersten Mal lächelte.
»Das ist gut. Tut mir leid, dass das passiert ist, aber Sie haben so plötzlich gebremst, dass ich nicht mehr reagieren konnte.«
»Tja«, machte ich unbestimmt. Wie auch immer, er war derjenige, der aufgefahren war, und deshalb wohl der Schuldige. »Wir sollten die Polizei rufen«, stellte ich fest und beugte mich in den Renault, um nach meinem Handy zu fischen. Mir wurde schwindelig, als ich mich damit wieder aufrichtete, so dass ich mich am Wagendach festhalten musste.
Instinktiv streckte der Mann wieder seine Hand aus, um mir zu helfen, zog sie aber wieder zurück, bevor er mich berührte. Dabei grinste er schief, und mir wurde klar, dass ich mich vorhin nicht getäuscht hatte. Diese Augen waren zu weitaus mehr fähig, als Unfallgegnerinnen besorgt anzusehen. Doch er schwieg und ließ mich zu meinem Erstaunen auch einen Streifenwagen verständigen, statt die Angelegenheit lieber unter uns regeln zu wollen.
Damit ich mich nicht länger mit seinem Blick befassen oder mich gezwungen sehen musste, eine Unterhaltung zu führen, während wir auf die Polizei warteten, sah ich mich auf der Straße um. Da wir in einer der engeren Wohnstraßen in der List standen, war es nicht weiter verwunderlich, dass es keine Unfallzeugen gab. Meine Augen huschten unauffällig zurück zu dem Mann. Nicht unauffällig genug, denn seine Brauen rutschten in die Höhe, und er schien genau zu wissen, was ich dachte.
»Sie müssen sich keine Sorgen machen. Das hier ist eindeutig, meine Versicherung wird für den Schaden aufkommen.«
»Ich mache mir keine Sorgen«, widersprach ich und war wütend auf mich selbst, weil er mich so leicht durchschauen konnte. Er antwortete nicht, sondern nickte nur und lächelte, wobei sich Fältchen um seine Augen bildeten. Vermutlich war er älter, als er auf den ersten Blick wirkte, eher um die vierzig.
Das war wirklich eine ausgesprochen blöde Situation. Aus irgendeinem Grund kam ich mir schlecht angezogen, schlecht geschminkt, müde und ausgelaugt vor, während er wie aus dem Ei gepellt aussah. Ich beschloss, ihn unter allen Umständen zu verabscheuen.
Erleichtert registrierte ich den Streifenwagen, der hinter dem Audi hielt. Der Unfall wurde problemlos aufgenommen, wir tauschten unsere Versicherungsdaten und Visitenkarten, dann verabschiedeten sich die Beamten. Während mein Gegenüber keinen Blick auf meine Karte geworfen zu haben schien, hatte ich sehr wohl auf seine geschaut: Safet Vujovic, Antiquitäten An- und Verkauf. Das war wie sein Wagen schon wieder eine Überraschung, einen Antiquitätenhändler hätte ich ebenfalls nicht in ihm vermutet. Ich fragte mich, welcher Nationalität er mit diesem Namen angehörte. Sicher irgendwas vom Balkan, aber da gab es mittlerweile so viele Nationalitäten wie Sand am Meer.
Bevor ich in meinen Wagen stieg, nickte ich ihm noch einmal zu, ansonsten wollte ich endlich nach Hause.
»Frau Simon«, hielt er mich zurück und überraschte mich ein drittes Mal innerhalb unserer kurzen Bekanntschaft. Also hatte er doch auf meine Karte gesehen.
Fragend blickte ich zurück.
Er stand da und zögerte eine Sekunde. »Auch wenn ich den Eindruck habe, dass Sie mich so schnell wie möglich loswerden möchten – wie wär’s mit einem Kaffee in der Espressobar da drüben? Ich würde mich einfach besser fühlen, wenn ich die ganze Angelegenheit nicht ausschließlich der Versicherung überlasse, sondern auch was zur Entschädigung beitragen kann.«
Damit hatte er mir den Wind aus den Segeln genommen, schließlich konnte ich schlecht ablehnen, ohne unhöflich zu werden. Also nickte ich zustimmend.
Zehn Minuten später hatten wir beide einen Parkplatz gefunden und trafen uns vor der Kaffeebar wieder, die ich häufig besuchte. Susanna stand hinter der Theke und begrüßte mich lächelnd, wobei sie prüfend ihren Blick über meinen Begleiter schweifen ließ, bevor sie fragte: »Das Übliche, Nella?«
Ihr Blick amüsierte mich, was sie dachte, war unschwer zu erraten. Immerhin kam ich sonst grundsätzlich allein oder mit meiner Freundin, nie mit einem männlichen Wesen. Ich nickte nur.
»Für mich dasselbe, bitte«, sagte Safet Vujovic und lotste mich zielstrebig zu einem hohen Bistrotisch mit Barhockern in der hintersten Ecke, ohne sich zu vergewissern, was er da gerade bestellt hatte. Im Geist zuckte ich mit den Schultern. Es war nicht meine Angelegenheit, ihn darüber aufzuklären, wenn er so voreilig war.
»Sie sind öfter hier?«, fragte, er als wir uns gegenübersaßen.
»Ja, mindestens zweimal in der Woche, wenn ich früh genug Feierabend habe.«
»Das klingt nach einem anstrengenden Job.«
Aha, weiter als bis zu meinem Namen hatte er meine Karte augenscheinlich nicht gelesen. Ich erklärte ihm, womit ich mein Geld verdiente, und eine Weile unterhielten wir uns über unsere neu eröffnete Ausstellung. Als Antiquitätenhändler verstand er natürlich eine ganze Menge von Kunst, wenn er auch zugab, dass er moderne Werke zwar gelegentlich mochte, aber im Allgemeinen wenig Ahnung davon hatte.
Aus den Augenwinkeln bekam ich mit, dass die zwei Cappuccinos fertig waren – und die zwei dazugehörigen Stücke Tiramisu ebenfalls schon auf der Theke standen. Ich glitt vom Hocker, um beides abzuholen.
»Wo hast du den denn aufgegabelt?«, wollte Susanna wissen und nickte zu unserem Tisch hinüber.
»Ist mir ins Auto gedonnert«, sagte ich übertrieben seufzend.
»Na, das ist ja mal eine ganz andere Art der Anmache. Sei bloß vorsichtig mit dem, er sieht aus, als hätte er’s faustdick hinter den Ohren. Ehe du dich versiehst, schleppt er nicht nur dein Auto, sondern auch noch dich ab.«
Ich lachte. »Keine Angst, ich pass schon auf.«
»Hoffentlich!«
Die beiden Tassen balancierend kehrte ich zu Safet Vujovic zurück. Susanna brachte die Kuchenteller, stellte sie auf den Tisch und ließ uns wieder allein.
Mit dem Cappuccino schien er ganz einverstanden zu sein, aber auf das Tiramisu schaute er einen Augenblick lang etwas irritiert herunter.
»Stimmt was nicht?«, erkundigte ich mich lächelnd. »Sie wollten dasselbe wie ich.«
Sein Lächeln fiel ebenso vielsagend aus wie meins. »Ich bin nicht so für Kuchen.« Damit streute er sich Zucker in den Cappuccino und rührte so lange, bis sich die Milchschaumkrone fast auflöste. Merkwürdigerweise kam mir der Gedanke, dass er sich dem nur so ausgiebig widmete, weil er nicht wusste, was er sagen sollte. Falls das zutraf, dachte ich gar nicht daran, ihm einen Gesprächsstoff zu liefern. Schließlich sah er hoch.
»Wenn ich allerdings mal was Süßes esse, dann die Rožata aus meiner Heimat. Ein bisschen was anderes als das hier.«
»Rožata?«, wiederholte ich. Darunter konnte ich mir absolut nichts vorstellen. Es klang ein bisschen italienisch, aber auf der anderen Seite auch wieder ganz fremd.
»Das kroatische Wort für Rosenkuchen«, übersetzte er. »Obwohl es weniger ein Kuchen ist.«
Kroatien also. Da hatte ich mit dem Balkan ja recht gehabt.
»Und was genau ist Rožata sonst?«
»Das war gar nicht schlecht!«, stellte er mit einem breiten Lächeln fest, das keinen Zweifel am strahlenden Weiß seiner Zähne ließ.
»Was war nicht schlecht?«
»Deine Aussprache. Du kannst nicht zufällig Kroatisch?«
Ich schüttelte den Kopf und dachte gleichzeitig darüber nach, ob mir die Schnelligkeit, mit der er zum Du übergewechselt war, gefiel oder nicht. »Nein. Englisch, Italienisch, Latein und ein paar Brocken Französisch, das ist alles.«
»Macht nichts, reden wir in deiner Sprache, dann verstehen wir uns schon.«
Wie gütig, hätte ich beinah gesagt. Aber da ich ohnehin nicht vorhatte, mich länger als unbedingt nötig mit Safet zu unterhalten, war es letztlich egal. »Zweifellos«, gab ich also zurück. »Du sprichst ausgezeichnet Deutsch. Wie lange lebst du schon hier?«
Safet zuckte mit den Schultern. »Seit vielen Jahren. Seit vor dem Krieg.«
Das brachte mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Obwohl der Krieg auf dem Balkan Anfang der Neunziger allgegenwärtig gewesen war und hin und wieder immer noch Unruhen aufflackerten, hatte ich das ganz verdrängt.
»War das schwer?«, fragte ich unwillkürlich. »Ich meine, von hier aus zuzusehen, wie deine Heimat zerstört wurde?«
Safet hob die Brauen. »Du meinst, ich hätte ich lieber nach Hause gehen und kämpfen sollen?«
Meine Güte, wieso hatte ich nicht meine Klappe halten können? Da war ich offenbar in ein sehr großes Fettnäpfchen getreten. Gerade hob ich zu einer Entschuldigung an, als sich wieder dieses leicht spöttische Lächeln in Safets Gesicht ausbreitete.
»War nicht ernst gemeint, Nella. Außerdem hab ich gekämpft. Auf meine Art. Willst du nun wissen, wie man Rožata zubereitet?« Ohne meine Antwort, geschweige denn meine Frage abzuwarten, wie er seine letzte Bemerkung gemeint hatte, fing er an zu erklären: »Milch, Zucker, Vanillezucker, Zitronenschale, unzählige Eier und noch mehr Zucker für das Karamell, in dem das Ganze gebacken wird. Falls du dich fragst, was das mit Rosen zu tun hat: Angeblich hat man früher Rosenöl rein getan, damit es danach duftete.«
»Klingt gut«, sagte ich.
»Schmeckt auch gut. Besser als das hier.« Er zeigte auf sein bisher unangerührtes Stück Tiramisu, griff nach der Gabel und begann zu essen. »Aber in der Not frisst der Teufel eben Fliegen – oder Tiramisu.«
»Wenn du’s lieber anders magst, kannst du dir deine Rožata ja zu Hause selbst backen«, schlug ich vor.
»Könnte ich, ja. Ich hab wahrscheinlich eine der modernsten und besteingerichteten Küchen in dieser Stadt, aber ich benutze sie nie.«
»Nie? Nicht mal zum Kochen?«
»Ich bin selten zu Hause zum Essen.«
»Warum hast du dir dann die Mühe gemacht, deine Küche so exzellent auszustatten?«
Safet grinste schon wieder. »Gute Frage. Wahrscheinlich weil ich jeden Tag mit so vielen alten Dingen zu tun habe, dass ich es zu Hause gern auf dem neuesten Stand habe. Du solltest mal meinen Fernseher sehen.«
Das hörte sich ja fast nach Selbstironie an. Bevor ich begann, diesen Mann doch noch als akzeptabel einzustufen und von meinem Vorhaben abkam, ihn zu verabscheuen, warf ich einen Blick auf meine Uhr.
»Vielen Dank für die Einladung, Safet, aber jetzt wird’s wirklich Zeit für mich. Ich hab noch eine Verabredung heute Abend.« Eine kleine Notlüge durfte wohl erlaubt sein, beruhigte ich mich selbst.
»Ja, natürlich. Vielleicht laufen wir uns ja mal wieder über den Weg.« Safet stapelte unsere Teller und Tassen übereinander und brachte sie zur Theke zurück, wo er bei Susanna zahlte.
»Schon möglich, Hannover ist nicht unbedingt eine Weltmetropole«, meinte ich ausweichend. Inzwischen standen wir draußen auf der Straße, wo es ganz bewölkt und düster geworden war, und so sah ich Safets Gesicht nicht richtig, als er mir die Hand entgegenstreckte und sich verabschiedete.
»Man sieht sich immer zweimal.« Damit drehte er sich um und verschwand um die Ecke, wo er vorhin eine Parklücke ergattert hatte.
Zu Hause blieb ich auf dem Flur stehen, betrachtete mich nachdenklich im Spiegel und überlegte, ob Safets letzter Satz wohl auch in Kroatien ein Sprichwort war. Wahrscheinlich würde ich das nie erfahren. Außerdem fragte ich mich, was ihm daran gelegen sein konnte, mich ein zweites Mal zu sehen. Männer wie er hatten sicher jede Menge Auswahl, auch wenn eine Frau mal die Stirn haben sollte, »nein« zu sagen.
Trotzdem sah ich ein bisschen genauer in den Spiegel. Graublaue Augen, Nase ein bisschen zu groß, volle Lippen. Durchschnitt, aber ganz in Ordnung so weit. Die Haare sahen nur nach was aus, wenn die Sonne drauf schien, weil sie dann einen rötlichen Schimmer bekamen. Ansonsten konnte man sie am passendsten mit dunkelaschblond beschreiben – die Farbe, die eigentlich keine war. Außerdem musste ich dringend mal wieder zum Friseur.
Unwillig wandte ich mich ab. Wieso kam ich auf diese Gedanken? Safet Vujovic war mir ins Auto gefahren, wir hatten einen Cappu getrunken und waren danach wieder getrennte Wege gegangen. Das war auch ganz gut so, denn aus eigener Erfahrung wusste ich, dass Macho-Typen wie er nicht in mein Leben passten und nur Ärger machten. Genau wie Susanna gesagt hatte.
5.
Ich ging tatsächlich in der nächsten Woche zum Friseur, aber ansonsten bemühte ich mich, keine Gedanken mehr an schwarzhaarige Männer aus Kroatien zu verschwenden. Damit hatte ich auch wenig Schwierigkeiten, weil wegen der Vorbereitungen zu unserer Ausstellung in der Galerie eine Menge Arbeit liegen geblieben war, die endlich erledigt werden musste.
Als ich am Donnerstagmorgen ins Büro kam, stand auf meinem Schreibtisch ein riesiger Blumenstrauß aus großen blassgelben Chrysanthemen, sonnengelben Freesien und orangefarbenen Ranunkeln. Ich mochte weder Chrysanthemen noch Freesien und konnte mir außerdem nicht vorstellen, wer mich mit so einem Strauß beglücken wollte. Vielleicht war er für meine Kollegin abgegeben worden, die sich stundenweise um die Buchhaltung kümmerte. Nach einer Karte suchte ich jedoch vergebens, und so wollte ich die Vase erst mal auf den großen Hängeregisterschrank in der Ecke stellen, damit ich sie aus dem Weg bekam und mit meiner Arbeit anfangen konnte.
»Herzlichen Glückwunsch«, hörte ich in diesem Moment hinter mir.
Ich drehte mich mit der Vase in den Händen um, und auch wenn ich Christian durch die Blumen hindurch nicht sehen konnte, erkannte ich dennoch seine Stimme. Ich senkte die Vase und schaute ihn über den Strauß hinweg stirnrunzelnd an.
»Ich hab nicht Geburtstag.«
»Das weiß ich, aber heute ist trotzdem ein besonderer Tag.«
Die Vase wurde zu schwer, ich stellte sie nun doch wieder auf dem Schreibtisch ab. Christian sah mich erwartungsvoll an, doch so sehr ich auch in meinem Gedächtnis grub, was das betraf, klaffte dort ein großes Loch.
»Jubiläum«, half er mir auf die Sprünge.
Ich hatte in meinem Leben noch kein Jubiläum gefeiert und war mir nicht bewusst, dass heute eins zu begehen war. Zur Sicherheit schaute ich auf meinen Tischkalender. Das Datum schien unbedeutend.
Christian schüttelte den Kopf. »Denk mal nach, was du heute vor drei Jahren getan hast.«
Endlich fiel der Groschen. »Dass du daran gedacht hast.« Bisher hatte er um meinen ersten Arbeitstag in seiner Galerie nie große Umstände gemacht. Warum fing er jetzt damit an?
»Ich fand, es ist ein guter Grund, dich zum Essen einzuladen. Zum Dank für die letzten drei Jahre, die bestimmt manchmal ziemlich nervenaufreibend gewesen sind. Du hast immer dein Bestes gegeben, auch wenn’s noch so schwierig wurde, und ich weiß ganz genau, was ich und die Galerie dir zu verdanken haben, Nella. Also, ich hoffe, du hast heute Abend noch nichts vor.«
Etwas überrumpelt verneinte ich. Wenn ich nicht arbeitete, hatte ich ausgesprochen selten abends was vor.
»Gut, dann wär das ja geklärt. Ich hol dich um acht ab. Sicherheitshalber. Bevor du wieder eine halbe Stunde zu spät kommst!«
»Danke für dein grenzenloses Vertrauen«, sage ich lächelnd. »Reichen Jeans für das Restaurant, in das wir gehen?«
»Hast du mir nicht zugehört?«, fragte Christian in gespielter Verzweiflung. »Ich will mich bei dir für alles bedanken, das werde ich wohl kaum in der Imbissbude um die Ecke tun.«
Oh je, dachte ich. Nicht schon wieder in Schale schmeißen. Manchmal glaubte ich, den falschen Job zu machen, in dem es so oft nötig war, sich aufzubrezeln, wo ich mich in schlichter Jeans und einem Pulli immer noch am wohlsten fühlte.
»Dann musst du mir für heute Nachmittag freigeben. Wenn ich noch einmal dieses grüne Kleid anziehen muss, schreie ich.«
Es sah so aus, als wäre Christian eine gut gekleidete Begleitung ein halber Urlaubstag wert, jedenfalls hatte er nichts dagegen, dass ich mittags meine Sachen zusammenpackte und shoppen ging. Die Ausbeute ließ ich Stunden später auf mein Bett fallen. Das Kleid war schnell besorgt gewesen, weil ich mich generell eher wenig damit aufhielt, unzählige Sachen anzuprobieren, nur um dann doch das zu kaufen, was ich als Erstes in der Hand gehalten hatte. Ich entschied mich innerhalb von zwanzig Minuten für ein kurzes schwarzes Kleid mit raffiniert über der Hüfte aufgesetzten Taschen. Aber die passenden Schuhe zu finden, wurde zur Qual. Vorne zu eng und hinten zu weit oder umgekehrt, das war ein Fluch, der mir schon seit jeher anhaftete, deswegen dauerte die Suche entsprechend lange.
Während ich mir nach dem vielen Rumlaufen ein heißes Bad gönnte, fragte ich mich, warum ich mir so viel Mühe machte. Schließlich führte mich bloß Christian zum Essen aus, und wenn ich Pech hatte, lief es auf dasselbe hinaus, auf das es beinah schon bei unserem letzten gemeinsamen Drink im Prinz hinausgelaufen wäre. Seufzend quetschte ich den Schwamm über meinem Knie aus, so dass das Wasser den Schaum von meinem Bein spülte. Vielleicht sollte ich ein schlechtes Gewissen haben, dass ich mich trotz dieser Befürchtung auf den Abend mit Christian einließ. Obwohl ich wusste, dass ich seine Hoffnungen nicht erfüllen konnte. Aber andererseits stimmte das, was er sagte: Ich hatte für den Erfolg der Galerie hart gearbeitet, also verdiente ich es auch, ein bisschen verwöhnt zu werden.
Ich musste das Etikett im Rücken des Kleides herausschneiden, weil es piekte, danach fühlte ich mich ganz gut darin. In den letzten Wochen der Krankheit meiner Mutter hatte ich Gewicht verloren, diese Zeit hatte zwar meiner Seele ganz und gar nicht, aber zumindest meiner Figur gutgetan, die durch das eng anliegende Kleid betont wurde. Jetzt fehlte nur noch ein nettes Accessoire. Die Perlenkette fiel mir wieder ein, die seit jenem Abend der Vernissage bei Manfred Gülden unangetastet in dem Holzkästchen lag.
Nachdenklich nahm ich das Kästchen in die Hand, weil ich mich an das merkwürdige Kribbeln in meinen Fingern erinnerte. Die Erklärung, die ich mir dafür zurechtgelegt hatte, war logisch, dennoch zögerte ich nun, die Perlen zu berühren. Dann schüttelte ich über mich selbst den Kopf, nahm sie entschlossen aus dem Kästchen – und ließ sie beinah sofort wieder fallen. Das war mehr als ein Kribbeln gewesen, fast ein wie elektrischer Schlag.
Benommen starrte ich auf die Perlen, die auf der roten Seide lagen, als bildeten sie die harmloseste Kette aller Zeiten, und streckte ganz vorsichtig meinen rechten Zeigefinger aus. Berührte die goldfarbene Perle, den tropfenförmigen Anhänger. Sie vibrierte. Unmöglich! Sie lag ganz ruhig auf Seide, bewegte sich keinen Millimeter. Was da vibrierte, musste meine Fingerspitze sein.
Ein lautes Schrillen ließ mich hochschrecken. Die Türglocke. Das konnte nicht wahr sein, Christian wollte doch erst um acht kommen, bis dahin blieb noch eine Viertelstunde. Die Uhr auf meinem Nachttisch zeigte allerdings seltsamerweise schon Punkt acht. Das war nun schon das zweite Mal, dass die Zeit unmerklich verflogen zu sein schien, während ich die Kette betrachtet hatte. Nach dem lauten Ton der Klingel kam mir die Stille in der Wohnung unnatürlich vor.