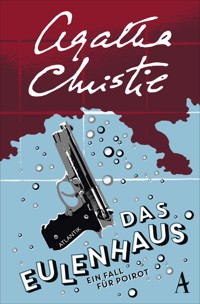
10,99 €
Mehr erfahren.
Hercule Poirot ist zur Wochenendparty auf das Anwesen von Lady Angkatell eingeladen. Als er eintrifft, liegt ein sterbender Mann am Pool. Über der Leiche steht dessen Frau, mit einem Revolver in der Hand. Die Gäste sind entsetzt. Doch was nach einer perfekten Inszenierung aussieht, ist keineswegs ein Schauspiel. Der Meisterdetektiv muss sich durch eine Vielzahl von Familiengeheimnissen kämpfen, um die Wahrheit herauszufinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Agatha Christie
Das Eulenhaus
Ein Fall für Poirot
Aus dem Englischen von Pieke Biermann
Atlantik
Für Larry und Danae – mit der Bitte um Entschuldigung, dass ich ihr Schwimmbecken als Tatort benutzt habe.
1
An einem Freitag morgens um dreizehn Minuten nach sechs tat Lucy Angkatell ihre großen blauen Augen auf. Wieder ein neuer Tag, wieder war sie sofort hellwach und ebenso schnell bei den Problemen, die ihr unglaublich reger Geist hervorgesprudelt hatte. Rat und Rede waren dringend nötig, und dafür war ihre junge Kusine Midge Hardcastle, die am Vorabend im »Eulenhaus« eingetroffen war, genau die Richtige. Lady Angkatell schlüpfte aus dem Bett, warf sich ein Negligé um die noch immer anmutigen Schultern und machte sich auf zu Midges Zimmer. Sie hatte die Angewohnheit, aufreibend schnell zu denken, und fing das Gespräch mit Midge im Kopf schon allein an, wobei sie deren Antworten aus ihrer überschäumenden Fantasie gleich selbst lieferte.
Sie riss die Tür zu Midges Zimmer also mitten im Gespräch auf. »– insofern, Schatz, musst du mir einfach Recht geben: Das Wochenende steckt voller Schwierigkeiten!«
»Ähh – waaas?« Midge, die soeben abrupt aus einem zufriedenen Tiefschlaf gerissen worden war, gab undeutliche Grunzlaute von sich.
Lady Angkatell ging durch bis zum Fenster, schob die Fensterläden auf und zog rasch die Jalousie hoch. Das blasse Licht eines sehr frühen Septembermorgens fiel herein.
»Die Vögel!«, beobachtete sie fröhlich. »Wie süß.«
»Was?«
»Na, das Wetter wird immerhin keine Schwierigkeiten machen. Sieht aus, als ob es schön bleibt. Das ist ja schon mal was. Denn einen Haufen Leute, die sich nicht leiden können, in geschlossenen Räumen einzupferchen, macht die Sache zehnmal schlimmer, da stimmst du mir sicher zu. Womöglich bei Gesellschaftsspielen, wie letztes Jahr – also, ich verzeihe mir das mit der armen Gerda ja nie. Ich habe auch zu Henry hinterher gesagt, dass das furchtbar gedankenlos von mir war. Und natürlich muss man sie einladen, es wäre einfach rüpelhaft, John allein einzuladen. Aber das macht alles so schwierig – und das Schlimmste ist, sie ist ja so nett. Das ist doch wirklich drollig, dass jemand so Nettes wie Gerda so bar jeder Art von Intelligenz sein kann. Also, wenn das ausgleichende Gerechtigkeit sein soll, dann finde ich es jedenfalls sehr ungerecht.«
»Wovon redest du eigentlich, Lucy?«
»Vom Wochenende, Schatz. Von den Leuten, die morgen kommen. Ich habe mir die ganze Nacht den Kopf zerbrochen, ich bin furchtbar in Sorge. Also, es ist ja so eine Erleichterung, mit dir darüber zu reden, Midge. Du bist so praktisch und hast Verständnis.«
»Lucy«, fragte Midge aufgebracht, »weißt du eigentlich, wie spät es ist?«
»Nicht genau, Schatz. Weiß ich doch nie.«
»Viertel nach sechs.«
»Ja, Schatz.« Lady Angkatell war nicht mal andeutungsweise zerknirscht.
Midge sah sie finster an. Lucy konnte einen wahnsinnig machen, sie war unmöglich! Wieso nehmen wir das eigentlich alle hin?
Aber Midge wusste die Antwort, noch bevor sie die Frage zu Ende gedacht hatte. Lucy Angkatell lächelte, und Midge sah sie nur an und spürte wieder den überwältigenden Charme, über den Lucy ihr Leben lang verfügt hatte und der auch heute, wo sie über sechzig war, nicht nachließ. Wegen dieses Charmes hatten Leute in der ganzen Welt – ausländische Potentaten, Adjutanten und Regierungsbeamte – unangenehme, ärgerliche und peinliche Situationen hingenommen. Lucys kindliche Freude, ihr Vergnügen an ihrem eigenen Tun entwaffnete jede Kritik und machte sie wirkungslos. Lucy brauchte bloß die großen blauen Augen aufzuschlagen und einem die zierlichen Hände entgegenzustrecken und: »O nein! Das tut mir ja so leid …« zu sagen, und Übelnehmen war augenblicklich unmöglich.
»Schatz«, sagte sie jetzt, »es tut mir ja so leid. Das hättest du mir doch sagen müssen!«
»Ich sage es dir gerade – aber jetzt ist es sowieso zu spät! Ich bin hellwach.«
»Nein, wie peinlich! Aber du hilfst mir trotzdem, ja?«
»Mit dem Wochenende? Wieso? Was soll denn damit sein?«
Lady Angkatell setzte sich auf Midges Bettrand. So saß niemand sonst auf Betträndern, dachte Midge. Es war so immateriell, als habe sich eine Elfe ein Minütchen lang niedergelassen.
Lady Angkatell streckte ihr die zitternden weißen Hände entgegen – eine hilflos-liebliche Geste.
»Es kommen lauter falsche Leute – ich meine, Leute, die nicht zusammenpassen, sonst sind sie nicht falsch. Alle ganz charmant sogar.«
»Wer kommt denn?« Midge schob sich mit ihrem stämmigen braunen Arm drahtige schwarze Haare aus der kantigen Stirn. Immateriell oder elfengleich war an ihr nichts.
»Nun ja, John und Gerda. Das ist an sich in Ordnung. Ich meine, John ist ja hinreißend – äußerst attraktiv. Und was die arme Gerda angeht – nun ja, ich meine, wir müssen einfach alle freundlich zu ihr sein. Ganz, ganz freundlich.«
»Ach komm, so schlimm ist sie auch wieder nicht.« Midge wusste selber nicht, warum sie Gerda verteidigen musste.
»Ach, Schatz, sie ist eine Jammergestalt. Diese Augen. Sie begreift doch deutlich kein Wort von dem, was man sagt.«
»Nein«, sagte Midge, »jedenfalls nicht von dem, was du sagst. Aber ich finde, das kann man ihr nicht vorwerfen. Du denkst so rasend schnell, Lucy, wenn man mit dir mithalten will im Gespräch, muss man die seltsamsten Sprünge mitmachen. Du lässt jede Verbindung zwischen zwei Themen weg.«
»Wie Affen hüpfen, was?«, fragte Lady Angkatell zerstreut.
»Und wer kommt außer den Christows noch? Henrietta, nehme ich an?«
Lady Angkatells Gesicht klärte sich auf. »Ja – und sie wird ganz bestimmt der Fels in der Brandung sein. Ist sie immer. Weißt du, Henrietta ist ein richtig freundlicher Mensch – also durch und durch, nicht nur oberflächlich. Sie ist eine große Hilfe mit der armen Gerda. Letztes Jahr hat sie das einfach wunderbar gemacht. Weiß du noch, als wir beim Limerickspielen waren, oder war es beim Wörter- oder Zitatenraten? Na, irgend so etwas war es, und wir waren alle schon fertig und stellten fest, dass die liebe arme Gerda noch gar nicht angefangen hatte. Sie wusste gar nicht richtig, was gespielt wurde. War das nicht grässlich, Midge?«
»Ich weiß wirklich nicht, warum überhaupt Leute zu euch kommen«, war Midges Antwort. »So viel Hirnschmalz, wie die Gesellschaftsspiele und deine merkwürdige Art, Gespräche zu führen, erfordern, Lucy.«
»Ja, Schatz, wir sind wohl ziemlich anstrengend – und Gerda muss das doch hassen. Ich habe schon oft gedacht, wenn sie einen Funken Verstand hätte, würde sie wegbleiben – na, jedenfalls, so war es, und das arme Kind sah so entsetzt drein und so – nun ja, tief gekränkt, nicht? Und John wirkte so schrecklich ungeduldig. Und mir ist partout nichts eingefallen, um das wieder geradezubiegen – und deshalb war ich ja Henrietta so dankbar. Wie sie sich einfach zu Gerda gedreht und sie auf den Pullover angesprochen hat, den sie anhatte. Dieses wirklich grässliche Ding, grün wie welker Salat – deprimierend, richtige Ramschware, Schatz. Aber Gerda hat ja gleich gestrahlt, sie hatte den wohl auch noch selbst gestrickt. Henrietta hat nach dem Muster gefragt, und Gerda hat ganz glücklich und stolz dreingeschaut. Siehst du, das meine ich mit Henrietta. Die kann so etwas einfach. Da gehört ein bestimmtes Talent dazu.«
»Sie macht sich eben die Mühe«, sagte Midge bedächtig.
»Ja, und ihr fällt immer das richtige Wort ein.«
»Na, nicht nur das – weißt du, Lucy, dass eigentlich Henrietta den Pullover gestrickt hat?«
»Du liebe Güte.« Lady Angkatell sah sie nachdenklich an. »Getragen auch?«
»Getragen auch. Henrietta ist konsequent.«
»Und sah das sehr schlimm aus?«
»Nein. An Henrietta sah er sehr hübsch aus.«
»Nun ja, selbstverständlich. Das ist eben der Unterschied zwischen Henrietta und Gerda. Was Henrietta anfängt, wird immer etwas. Sie wird mit fast allem fertig, auch bei ihren eigenen Sachen. Ich muss wirklich sagen, Midge, wenn irgendjemand dieses Wochenende rettet, dann Henrietta. Sie wird nett zu Gerda sein, sie wird Henry Spaß machen, sie wird John bei Laune halten und ganz bestimmt gut sein für David.«
»David Angkatell?«
»Ja. Er kommt auf einen Sprung aus Oxford – oder war es Cambridge? Jungen in dem Alter sind so schwierig – vor allem wenn sie auch noch intellektuell sind. David ist sehr intellektuell. Man wünscht sich immer, sie würden damit warten, bis sie etwas älter sind. Aber so? Immer starren sie einen verdrießlich an und kauen Fingernägel und haben so viele Pickel und manchmal noch einen Adamsapfel obendrein. Und reden tun sie entweder keinen Ton oder sehr laut und immer in Opposition. Trotzdem, ich verlasse mich wie gesagt auf Henrietta. Sie ist so taktvoll und stellt die richtigen Fragen. Außerdem ist sie Bildhauerin, da haben sie Respekt, zumal sie ja auch keine Tiere oder Kinderköpfe modelliert. Sie macht ja solche avancierten Sachen wie das komische Ding aus Gips und Metall, das sie letztes Jahr bei den Neuen Künstlern ausgestellt hat. Für mich sah es irgendwie aus wie eine Trittleiter von Heath Robinson. Es hieß aber ›Aufsteigender Gedanke‹ – oder so ähnlich. Solche Dinge beeindrucken einen jungen Mann wie David … Ich fand es eher albern.«
»Lucy, bitte!«
»Aber ein paar von ihren Sachen sind wirklich ganz hübsch. Diese Traueresche, zum Beispiel.«
»Ich finde, Henrietta hat echte Genialität. Außerdem ist sie ein sehr netter, angenehmer Mensch«, verfügte Midge.
Lady Angkatell stand auf und schwebte wieder zum Fenster. Sie spielte gedankenverloren mit der Jalousiekordel. »Wieso eigentlich Eicheln?«, murmelte sie.
»Eicheln?«
»An der Kordel hier. Genau wie die Ananasse auf Gartentoren. Ich meine, das muss doch einen Grund haben. Es könnten doch ebenso gut Tannenzapfen sein oder Birnen. Aber nein, es sind immer Eicheln. Schweinemast nennen sie das im Kreuzworträtsel. Ich finde das immer so kurios.«
»Schweif jetzt nicht ab, Lucy. Du bist hier, weil du unbedingt über das Wochenende reden musstest, aber ich weiß immer noch nicht, worüber du dir Sorgen machst. Du brauchst ja bloß Gesellschaftsspiele zu vermeiden, gegenüber Gerda zusammenhängend zu reden und Henrietta als Dompteurin für den intellektuellen David zu verpflichten – was ist da schwierig?«
»Nun ja, Schatz, zum Beispiel, dass Edward kommt.«
»Ach, Edward.« Midge schwieg, als sie den Namen gesagt hatte. Dann fragte sie leise: »Wieso in aller Welt hast du Edward zu diesem Wochenende eingeladen?«
»Habe ich gar nicht, Midge. Das ist es ja. Das hat er selber getan. Er hat uns antelegrafiert, ob wir ihn aufnehmen. Du weißt, wie Edward ist. Wie empfindlich. Hätte ich ›nein‹ zurücktelegrafiert, er hätte bestimmt nie wieder gefragt. So ist er.«
Midge nickte nachdenklich. Ja, dachte sie, so war Edward. Einen Moment lang sah sie deutlich sein Gesicht, das Gesicht, das sie so innig liebte. Es hatte einen Hauch von Lucys immateriellem Charme, dieses sanfte, scheue, leicht ironische Gesicht …
»Der liebe Edward«, sagte Lucy laut. Es war das Echo von Midges Gedanken.
Gereizt fuhr sie fort: »Wenn sich Henrietta doch endlich entschließen könnte, ihn zu heiraten. Sie mag ihn ja wirklich, ich weiß das genau. Wenn die beiden hier zusammen ein Wochenende verbringen könnten, ohne die Christows … Es steht nun mal fest, dass John Christow Edward alles andere als guttut. John wird dann immer noch mehr das und das, verstehst du, und Edward immer noch weniger das und das. Weißt du, was ich meine?«
Wieder nickte Midge.
»Aber ich kann doch die Christows nicht wieder ausladen, das Wochenende mit ihnen ist ja seit ewig verabredet. Und ich werde das Gefühl nicht los, Midge, dass das furchtbar kompliziert wird – mit dem düster blickenden, nägelbeißenden David, mit Gerda, bei der man immer aufpassen muss, dass sie sich nicht ausgeschlossen fühlt, und mit dem immer strahlenden John und dem lieben, aber nie strahlenden Edward –«
»Die Zutaten lassen tatsächlich keinen guten Pudding erwarten«, murmelte Midge.
Lucy lächelte sie an. »Na ja«, sagte sie versonnen, »manchmal löst sich alles auch einfach auf. Ich hab den Kriminalmenschen für Sonntag zum Mittagessen eingeladen. Das wird eine schöne Ablenkung, glaubst du nicht?«
»Wen?«
»Immer wie aus dem Ei gepellt«, fuhr Lady Angkatell einfach fort. »Er war auch in Bagdad, er hatte da etwas zu lösen, als Henry Hochkommissar war. Oder war es danach? Wir hatten ihn zum Essen eingeladen, mit ein paar anderen Beamten. Er trug einen weißen Leinenanzug, das weiß ich noch, mit einer rosa Blume im Knopfloch und schwarzen Lackschuhen. Ich kann mich sonst kaum noch an etwas erinnern, ich finde es ja nie furchtbar interessant, wer wen umgebracht hat. Ich meine, wenn jemand tot ist, dann ist es doch nicht mehr wichtig, warum, und ich finde es so albern, so viel Wirbel darum zu machen …«
»Habt ihr denn hier etwa Verbrechen, Lucy?«
»Ach nein, Schatz. Er wohnt einfach in einem von diesen komischen Cottages – weißt du, wo man sich den Kopf an den Balken stößt, die zwar sehr gute Sanitäranlagen, aber den völlig unpassenden Garten haben. Die Leute aus London finden so etwas ja schick. In dem anderen wohnt, glaube ich, eine Schauspielerin. Solche Leute wohnen ja nicht das ganze Jahr hier, wie wir. Aber«, Lady Angkatell ging ziellos im Zimmer herum, »es scheint ihnen zu gefallen. Midge, Schatz, es war lieb von dir, mir zu helfen.«
»Ich finde nicht, dass ich dir viel geholfen habe.«
»Ach – nein?« Lady Angkatell sah sie verblüfft an. »Na, dann schlaf jetzt schön und steh nicht extra auf zum Frühstück. Und wenn du aufstehst, darfst du muffeln, so viel du willst.«
»Muffeln?« Jetzt sah Midge verblüfft aus. »Wieso – ach so!«, lachte sie. »Jetzt verstehe ich! Sehr scharfsinnig, Lucy. Vielleicht nehme ich dich beim Wort.«
Lady Angkatell verließ lächelnd das Zimmer. Auf dem Weg an der offenen Badezimmertür vorbei sah sie den Kessel mit dem Gaskocher und hatte eine Idee.
Alle mochten doch gern Tee – und Midge würde sich die nächsten Stunden nicht blicken lassen. Sie würde ihr Tee bringen. Sie setzte das Wasser auf und ging weiter den Flur hinunter.
Vor der Tür zum Zimmer ihres Mannes blieb sie stehen und drehte den Türknopf. Aber Sir Henry Angkatell war nicht nur ein fähiger Diplomat, er kannte auch seine Lucy. Er mochte sie wirklich ausgesprochen gern, aber er schätzte auch seinen ungestörten Schlaf am Morgen. Die Tür war zu.
Lady Angkatell ging in ihr Zimmer. Sie hätte Henry zu gern konsultiert, aber das ging auch später. Sie trat ans offene Fenster und sah eine Weile hinaus. Dann gähnte sie. Sie legte sich ins Bett und hatte kaum zwei Minuten den Kopf auf dem Kissen, da schlief sie schon wie ein Kind.
Im Badezimmer fing das Wasser an zu kochen, und es kochte weiter …
»Schon wieder ein Kessel hin, Mr Gudgeon«, sagte Miss Simmons, das Zimmermädchen.
Gudgeon, der Butler, schüttelte den Graukopf und nahm Miss Simmons den verkokelten Wasserkessel ab. Dann ging er in die Speisekammer und zog einen neuen aus dem halben Dutzend Ersatzkessel unten im Tellerschrank. »Stellen Sie den hin, Miss Simmons, dann merkt ihre Ladyschaft nichts.«
»Macht ihre Ladyschaft so was öfter?«, fragte Simmons.
Gudgeon seufzte. »Ihre Ladyschaft ist herzensgut, aber auch schrecklich vergesslich, verstehen Sie? Und in diesem Haus bin ich dafür verantwortlich, dass alles Menschenmögliche getan wird, um Ärger oder Kummer von ihr fernzuhalten.«
2
Henrietta Savernake rollte eine kleine Lehmwurst und drückte sie in Form. Sie arbeitete mit ihren flinken und geschickten Fingern an einem Mädchenkopf.
Im Ohr eine piepsige, leicht ordinäre Stimme – aber die drang nur bis an die Ränder ihrer Wahrnehmung vor.
»Und ich finde wirklich, dass ich Recht hatte, Miss Savernake. ›Also, bitte‹, hab ich gesagt, ›wenn Sie so was im Sinn haben!‹ Denn ich finde wirklich, Miss Savernake, das ist man sich schuldig als junges Mädchen, dass man bei so was klar Stellung bezieht, wissen Sie, was ich meine? ›Ich bin es nicht gewohnt‹, hab ich gesagt, ›mir so was anhören zu müssen, und ich kann nur sagen, Sie müssen eine sehr schmutzige Fantasie haben!‹ Man ist ja nicht gern unhöflich, aber ich finde wirklich, dass ich Recht hatte damit, finden Sie nicht auch, Miss Savernake?«
»Aber selbstverständlich.« Henrietta klang so engagiert, dass jeder, der sie besser kannte, gemerkt hätte, wie wenig sie zugehört hatte.
»›Und wenn Ihre Frau so was sagt‹, hab ich gesagt, ›dann kann ich da jedenfalls nichts für!‹ Ich weiß auch nicht, wie das kommt, Miss Savernake, aber ich scheine immer so Ärger zu kriegen, überall, und das ist bestimmt nicht meine Schuld. Ich meine, Männer denken immer, sie sind gemeint, nicht?« Sie stieß ein kokettes Kichern aus.
»Schrecklich«, bestätigte Henrietta mit halb geschlossenen Augen. »Sehr hübsch«, dachte sie für sich, »sehr hübsch, die Fläche unterm Lid – und die andere, die von unten dazukommt. Aber der Winkel am Kiefer ist falsch … Da muss etwas weg, da muss ich neu modellieren. Knifflig.«
Laut und mit ihrer warmen, mitfühlenden Stimme sagte sie: »Das war gewiss furchtbar schwierig für Sie.«
»Ich finde wirklich, Eifersucht ist so ungerecht, Miss Savernake, so spießig, wissen Sie, was ich meine? Das ist der reine Neid, wenn ich das so sagen darf, bloß weil jemand besser aussieht oder jünger ist.«
Henrietta arbeitete an der Kinnpartie und antwortete zerstreut: »Ja, natürlich.«
Sie hatte den Trick, ihre Gedanken in wasserdicht abgeschottete Bereiche aufzuteilen, vor Jahren gelernt. Sie konnte Bridge spielen, sich intelligent unterhalten, einen klaren Brief formulieren, ohne mehr als einen Bruchteil ihres Geistes darauf zu verwenden. Im Augenblick sah sie zum Beispiel vollkommen konzentriert zu, wie sich der Kopf der Nausikaa unter ihren Fingern formte, und nichts von dem piepsigen, gehässigen Geschwätz, das aus den wirklich hübschen kindischen Lippen quoll, drang in tiefere Bewusstseinsbereiche vor. Ohne jeden Aufwand hielt sie die Konversation am Laufen. Modelle, die unbedingt reden wollten, war sie gewohnt. Es waren selten die professionellen Modelle – meistens waren es die Amateurinnen, die sich wegen der erzwungenen Bewegungslosigkeit unwohl fühlten und das mit Ausbrüchen redseliger Selbstentblößung ausglichen. Also hörte irgendein unbedeutender Teil von Henrietta zu und antwortete auch, während die wirkliche Henrietta irgendwo sehr fern dachte: Gewöhnliches, gemeines, gehässiges kleines Ding, du – aber was für Augen … Wunderwunderwunderhübsche Augen …
Solange sie an den Augen arbeitete, sollte das Ding doch schwätzen. Um Schweigen bitten würde sie sie, wenn sie zum Mund kam. Komisch, wenn man sich überlegte, dass so ein gehässiges Gepiepse aus einem so vollendet geschwungenen Mund kam.
O verdammt! dachte Henrietta plötzlich aufgebracht. Ich habe den Brauenschwung versaut! Was zum Teufel ist denn damit? Der Knochen ist falsch – er ist spitz, nicht dick …
Sie trat einen Schritt zurück und sah stirnrunzelnd vom Tonkopf zu dem aus Fleisch und Blut.
Doris Saunders plapperte weiter: »›Also‹, hab ich gesagt, ›ich wüsste wirklich nicht, warum mir Ihr Mann nicht etwas schenken sollte, wenn er das möchte, und ich finde‹, hab ich gesagt, ›derlei Unterstellungen stehen Ihnen nicht zu.‹ Das war doch ein zu und zu hübsches Armband, Miss Savernake, zu und zu entzückend – und natürlich, das muss ich wohl sagen, konnte der Kerl sich das eigentlich nicht leisten, aber ich finde es wirklich so nett von ihm, und ich dachte gar nicht dran, es zurückzugeben!«
»Aber nein«, murmelte Henrietta.
»Und das heißt nicht, dass da irgendwas war zwischen uns – also, irgendwas Schmutziges, mein ich – da war gar nichts.«
»Nein, ganz bestimmt war da nichts, nie …«
Die Brauenpartie wurde jetzt besser. Henrietta arbeitete die nächste halbe Stunde wie besessen. Tonklümpchen klebten ihr auf der Stirn und in den Haaren, weil sie sich ungeduldig über den Kopf strich. Ihre Augen waren fast blind vor lauter wildentschlossener Intensität. Es wurde langsam … Sie war nahe dran …
Bald, in ein paar Stunden, würde die Agonie zu Ende sein – diese Agonie, die sich in den letzten zehn Tagen über ihr zusammengebraut hatte.
Nausikaa – Nausikaa war sie gewesen, mit Nausikaa war sie morgens aufgestanden, mit Nausikaa hatte sie gefrühstückt, und mit Nausikaa war sie aus dem Haus gegangen. Sie war die Straßen im Zustand nervöser, reizbarer Rastlosigkeit entlanggehetzt, unfähig, ihre Gedanken auf irgendetwas anderes zu konzentrieren als das wunderschöne blinde Gesicht irgendwo dicht hinter ihrem inneren Auge – dort schwebte es herum und war einfach nicht klar zu erkennen. Sie hatte mit Modellen gesprochen, sich griechische Gesichter angesehen, ein Gefühl tiefer Unzufriedenheit bekommen …
Sie wollte etwas ganz dringend haben – etwas, mit dem sie anfangen konnte –, etwas, das ihre eigene, schon teilweise entfaltete Vision zum Leben bringen konnte. Sie war endlos weit gelaufen, hatte sich dabei erschöpft und das genossen. Und was sie dabei getrieben und gepeinigt hatte, war die unablässige drängende Sehnsucht – zu sehen …
Ihre eigenen Augen wirkten blind, während sie herumlief. Sie sah nichts, was um sie war. Sie war krampfhaft in sich verknotet, um das Gesicht herbeizuzwingen … Sie fühlte sich krank, elend, ihr war übel …
Und plötzlich hatte ihre Vision jäh Klarheit bekommen, mit normalen menschlichen Augen hatte sie sie gegenüber im Bus, in den sie gedankenlos und ohne das geringste Interesse am Fahrziel eingestiegen war, erblickt – sie hatte sie gesehen – ja, Nausikaa! Ein zu kurz geratenes kindliches Gesicht mit halb geöffneten Lippen und Augen – hübschen, leeren blinden Augen.
Dann hatte die junge Frau die Klingelleine gezogen und war ausgestiegen. Henrietta war ihr nachgegangen.
Sie war wieder ruhiger geworden, geschäftsmäßig. Sie hatte gefunden, was sie brauchte – die Agonie der vielleicht vergeblichen Suche war zu Ende.
»Entschuldigen Sie, dass ich Sie so anspreche. Ich bin Bildhauerin, und ich sage Ihnen ganz offen, Sie haben den Kopf, nach dem ich schon lange suche.« Sie war wieder freundlich und bezaubernd, so unwiderstehlich, wie sie sein konnte, wenn sie etwas wollte.
Doris Saunders hatte skeptisch und argwöhnisch, aber auch geschmeichelt gewirkt. »Nun ja, also ich weiß nicht, wissen Sie. Wenn’s nur der Kopf sein soll. Ich hab so was natürlich noch nie gemacht!«
Schickliches Zögern, vorsichtige Nachfrage nach der lukrativen Seite.
»Ich muss selbstverständlich darauf bestehen, dass Sie das angemessene professionelle Honorar dafür annehmen.«
Und so war es gekommen, dass Nausikaa jetzt auf dem Podest saß, genoss, dass ihre Reize sie offenbar unsterblich machen würden (obwohl ihr die anderen Exemplare von Henriettas Werken, die sie im Atelier sah, nicht eben zusagten), und vor allem genoss, ihre Persönlichkeit einer Zuhörerin nahebringen zu können, die offenbar die reine Sympathie und Aufmerksamkeit war.
Ihre Brille lag auf dem Tisch neben ihr … die Brille, die sie aus Gründen der Eitelkeit so selten wie möglich aufsetzte. Manchmal tastete sie sich sogar lieber fast blind durch die Welt, sie war nämlich, wie sie Henrietta gestand, so kurzsichtig, dass sie einen Meter vor sich schon kaum noch etwas sah.
Henrietta hatte verständnisvoll genickt. Das also war die physische Erklärung für ihren hübschen leeren Blick.
Die Zeit verstrich. Plötzlich legte Henrietta das Werkzeug aus der Hand und reckte die Arme. »Das wär’s. Ich bin fertig. Hoffentlich sind Sie nicht zu müde?«
»O nein, vielen Dank, Miss Savernake. Es war sehr interessant, wissen Sie. Und Sie sagen, das ist jetzt wirklich fertig – so schnell?«
Henrietta lachte. »O nein, der Kopf ist noch nicht fertig. Da werde ich noch ein bisschen dran arbeiten müssen. Aber Sie sind fertig. Ich habe jetzt, was ich wollte – die Struktur ist da.«
Die junge Frau stieg langsam von ihrem Podest. Sie setzte die Brille auf, und sofort verschwand alle blinde Unschuld, all der zerstreut-zutrauliche Charme aus ihrem Gesicht. Übrig blieb eine unbeschwerte, aber billige Hübschheit.
Sie stellte sich neben Henrietta und betrachtete das Tonmodell. »Ach«, sagte sie dann skeptisch und mit enttäuschtem Unterton, »das sieht mir aber nicht sehr ähnlich, nicht?«
Henrietta lächelte. »O nein, das soll ja auch kein Porträt sein.«
Der Kopf hatte in der Tat fast gar keine Ähnlichkeit. Die Stellung der Augen, der Schwung der Wangenknochen – das waren für Henrietta die wesentlichen Elemente ihrer Vorstellung von Nausikaa gewesen. Das hier war nicht Doris Saunders, es war ein blindes Mädchen, über das man auch Gedichte schreiben könnte. Die Lippen halb geöffnet wie die von Doris, aber es waren nicht wirklich ihre Lippen. Diese Lippen würden eine andere Sprache sprechen und andere Gedanken äußern, nicht die von Doris …
Die Züge waren noch nicht klar und deutlich. Bis jetzt war es die erinnerte Nausikaa, nicht die gesehene.
»Na ja«, sagte Miss Saunders skeptisch, »sieht bestimmt besser aus, wenn Sie noch mal drübergegangen sind … Und Sie brauchen mich wirklich nicht mehr?«
»Nein, vielen Dank«, sagte Henrietta. Und dachte: Gott sei Dank nicht! Laut fuhr sie fort: »Sie waren einfach großartig. Ich bin Ihnen sehr dankbar.«
Routiniert schaffte sie sich Doris Saunders vom Hals, um sich dann erst mal Kaffee zu kochen. Sie war müde – sie war schrecklich müde. Aber auch glücklich – glücklich und wieder in Frieden.
Das tut gut, dachte sie, jetzt kann ich wieder ein Mensch sein.
Sofort waren ihre Gedanken bei John.
John, dachte sie. Und Wärme stieg ihr kribbelnd in die Wangen, ihr Herz tat einen Hüpfer und beschwingte ihren Geist.
Morgen, dachte sie, fahre ich raus ins »Eulenhaus« … sehe ich John …
Sie saß ganz still und entspannt auf dem Diwan und ließ die heiße schwarze Flüssigkeit in sich hineinlaufen. Sie trank drei Tassen und spürte, wie die Vitalität zurückgeströmt kam.
Wie gut, wieder ein Mensch sein zu dürfen … nicht das andere Wesen. Wie gut, sich nicht mehr rastlos und elend und getrieben fühlen zu müssen. Wie gut, nicht mehr Straßen entlanghetzen zu müssen, unglücklich, auf der Suche nach etwas, reizbar und ungeduldig, weil man wirklich nicht mal weiß, nach was man eigentlich sucht! Jetzt kam Gott sei Dank nur noch harte Arbeit – und wer hatte etwas gegen harte Arbeit!
Sie stellte die leere Tasse ab, stand auf und schlenderte zurück zu Nausikaa. Eine Zeit lang musterte sie sie, und eine kleine Falte trat allmählich zwischen ihre Augenbrauen.
Das war nicht … das war doch nicht ganz …
Was stimmte da nicht?
Blinde Augen.
Blinde Augen, die schöner waren als alle Augen, die sehen konnten … Blinde Augen, die einem das Herz zerrissen, eben weil sie blind waren … Hatte sie die getroffen oder nicht?
Doch, hatte sie – aber sie hatte noch etwas anderes auch getroffen. Etwas, das sie gar nicht gemeint beziehungsweise gemerkt hatte … Die Grundstruktur stimmte – doch, ganz sicher. Aber woher kam der … dieser … leise hinterhältige Ausdruck?
Der Ausdruck eines gewöhnlichen, gehässigen Gemüts.
Sie hatte doch gar nicht zugehört, jedenfalls nicht wirklich. Und trotzdem hatte er sich irgendwie durch ihre Ohren und ihre Finger seinen Weg in den Ton gebahnt.
Sie würde ihn nicht mehr wegkriegen, nie mehr, das wusste sie …
Henrietta wandte sich abrupt ab. Vielleicht war es Einbildung. Ja, es war bestimmt nur Einbildung. Morgen sah sie das bestimmt ganz anders. Verzagt dachte sie: Wie verwundbar man doch ist …
Stirnrunzelnd ging sie in eine Ecke ihres Ateliers und blieb vor einer Skulptur stehen, die »Die Anbeterin« hieß.
Die war tatsächlich gelungen – aus einem wunderbaren Birnbaumstück. Es hatte genau die richtige Maserung – sie hatte es jahrelang aufbewahrt, regelrecht gehortet.
Jetzt musterte sie die Skulptur kritisch. Doch, sie war gelungen. Ohne jeden Zweifel. Das beste Werk, das sie seit langem geschaffen hatte – es war für die Ausstellung der International Group bestimmt. Doch, es war einer prestigeträchtigen Schau würdig.
Alles hatte sie getroffen: die Demut, die Kraft der Halsmuskeln, die heruntergezogenen Schultern, das leicht nach oben gerichtete Gesicht – ein Gesicht ohne eigene Züge, denn Anbetung treibt alle Persönlichkeit aus.
Ja, Unterwerfung, Anbetung – und diese endgültige Hingabe, die irgendwie jenseitig ist, nicht mehr von dieser Welt …
Henrietta seufzte. Wenn nur John, dachte sie, nicht so wütend geworden wäre.
Sie war verdutzt gewesen wegen seiner Wut. Die hatte etwas zu bedeuten, dachte sie, von dem er selbst nichts wusste.
Er hatte rundweg verfügt: »Die stellst du nicht aus!«
Und sie hatte ebenso rundweg verfügt: »Doch, tue ich.«
Langsam ging sie zurück zu Nausikaa. Da war nichts dran, beschloss sie, das sie nicht hinkriegen würde. Sie besprühte den Kopf und wickelte ihn in feuchte Tücher. Er konnte bis Montag oder Dienstag warten. Jetzt war keine Eile mehr. Die Dringlichkeit war weg – die Grundstruktur war ja da. Jetzt brauchte sie einfach Geduld.
Vor ihr lagen drei glückliche Tage mit Lucy und Henry und Midge – und John!
Sie gähnte, reckte sich, wie Katzen sich recken – wohlig und ungezwungen und jeden einzelnen Muskel total dehnend. Plötzlich merkte sie wieder, wie müde sie war.
Sie nahm ein heißes Bad und ging ins Bett. Auf dem Rücken liegend, betrachtete sie durch das Oberlicht ein, zwei Sterne, bevor ihr Blick von da zu dem einzigen Licht wanderte, das immer brannte. Eine gläserne Maske, erleuchtet von einer kleinen Birne, eins ihres frühesten Werke. Ein ziemlich geheimnisloses Stück, fand sie jetzt. Sehr konventionell im Ausdruck.
Was für ein Glück, dass man aus so etwas herauswächst, dachte Henrietta …
Und jetzt wird geschlafen! Starker schwarzer Kaffee konnte sie, auch wenn sie ihn gerade getrunken hatte, nicht wach halten, wenn sie das nicht wollte. Sie hatte sich schon vor langer Zeit einen Rhythmus antrainiert, mit dem man auf Kommando alles vergessen konnte.
Man nahm ein paar Gedanken aus seinem Speicher und ließ sie, ohne auf ihnen zu verweilen, durch seine Bewusstseinsfinger gleiten – nur nach keinem greifen, nur bei keinem verweilen, auf keinen konzentrieren … sondern sie einfach sachte vorbeischweifen lassen.
Draußen auf der Straße heulte ein Motor auf, irgendwo wurde heiser gelacht und gerufen. Henrietta nahm alle Geräusche nur halb bewusst wahr.
Der Wagen, beschloss sie, war ein röhrender Tiger … gelb und schwarz … gestreift wie manche Blätter – Blätter und Schatten – ein heißer Dschungel … dann einen Fluss hinab, einen breiten Tropenfluss … bis ans Meer, wo der Ozeanriese ablegte … heisere Abschiedsrufe … und John neben ihr an Deck … sie und John bei der Abfahrt … das blaue Meer, dann unten der Speisesaal … ein Lächeln für ihn über den Tisch, wie beim Dinner in der »Maison Dorée« … der arme John, so wütend! … Hinaus in die Abendluft – und der Wagen, wie sich das anfühlt, wenn man die Gänge wechselt … mühelos, sanft, rasch hinaus aus London … über den Shovel Down … vorbei an den Bäumen, den anbetungswürdigen … das »Eulenhaus« … Lucy … John … John … der Morbus Ridgeway … lieber John …
Und jetzt hinüber und hinein in die Bewusstlosigkeit, die sorglose Glückseligkeit.
Doch da, plötzlich, irgendein beißendes Unwohlsein, ein quälendes Schuldgefühl, das sie zurückriss. Irgendetwas, das sie hätte tun müssen. Irgendwas, vor dem sie sich gedrückt hatte.
Nausikaa?
Langsam und widerwillig stand Henrietta auf, schaltete das Licht an, ging hinüber zur Arbeitsplatte und wickelte die feuchten Tücher auf.
Sie atmete tief durch.
Es war nicht Nausikaa – es war Doris Saunders!
Henrietta durchzuckte ein stechender Schmerz. Sie beschwor sich selbst: »Doch, das kriege ich hin – ich kriege das wieder hin …«
»Unfug«, entgegnete sie sich gleich danach, »du weißt genau, was du zu tun hast.«
Und zwar jetzt – denn morgen hätte sie nicht mehr den Mut dazu. Es war ja, wie wenn man sein eigen Fleisch und Blut vernichtet. Es tat weh – o ja, es tat weh.
Bestimmt, überlegte sie, fühlen sich Katzen so, wenn eins aus ihrem Wurf nicht in Ordnung ist und sie es töten.
Sie holte kurz und heftig Luft, dann packte sie den Kopf, drehte ihn aus der Halterung, schleppte den großen schweren Klumpen zur Wanne mit dem Lehm und warf ihn hinein.
Eine Weile stand sie da, schwer atmend, betrachtete ihre lehmverschmierten Hände und spürte dem Schmerz nach, der sie körperlich und geistig zerriss. Ganz langsam wischte sie sich den Lehm von den Händen.
Dann ging sie mit einem seltsam leeren und doch friedvollen Gefühl wieder ins Bett.
Nausikaa, dachte sie traurig, kam nie mehr wieder. Sie war geboren und besudelt worden, und jetzt war sie tot.
Komisch, dachte Henrietta, wie manchmal etwas in einen einsickert, ohne dass man es merkt.
Sie hatte doch gar nicht zugehört – jedenfalls nicht wirklich –, und trotzdem war etwas von Doris’ billigem, gehässigen kleinen Geist ihr in die Finger gesickert und hatte ihr unbewusst die Hand geführt.
Jetzt war das Ding, das Nausikaa – nein, Doris – gewesen war, nur noch ein Klumpen Lehm – einfach ein Rohstoff, aus dem bald etwas anderes gestaltet werden würde.
Schon halb im Traum überlegte Henrietta: Ist das vielleicht die Bedeutung von Tod? Ist das, was wir Persönlichkeit nennen, nur die Gestaltung – die Prägung durch jemandes Denken? Und wessen Denken? Gottes?
War das nicht das Peer-Gynt-Motiv? Zurück in die Schöpfkelle des Knopfgießers, wo er noch er selbst gewesen war?
War das auch Johns Lebensgefühl? Er war so müde gewesen neulich Abend – so entmutigt. Morbus Ridgeway … In keinem von all den Büchern stand, wer Ridgeway war! Zu dumm, dachte Henrietta, sie würde es so gern wissen … Morbus Ridgeway.
3
John Christow saß mit der vorletzten Patientin für diesen Freitagvormittag in seinem Sprechzimmer. Er beobachtete sie mit einem mitfühlenden, ermutigenden Blick, während sie ihm Einzelheiten beschrieb und erklärte. Hin und wieder nickte er verständnisvoll, stellte Fragen, gab Anweisungen. Die Patientin war bald durchglüht von so viel Wärme. Dr. Christow war einfach wunderbar! So Anteil nehmend – so wahrhaft besorgt. Man fühlte sich schon kräftiger, wenn man nur mit ihm redete.
John Christow zog ein Blatt Papier zu sich und fing an zu schreiben. Der verordnete er am besten ein Laxativ, dachte er. Diese neue amerikanische Marke, hübsch in Cellophan verpackte Pillen von einem ungewöhnlichen Lachsrosa. Und schön teuer und umständlich in der Beschaffung – das hatte noch lange nicht jeder Apotheker da. Wahrscheinlich musste sie extra in die kleine Apotheke in der Wardour Street dafür. Und das war bestens – damit war sie vermutlich ein, zwei Monate vollauf bedient, und er musste sich erst danach etwas Neues einfallen lassen. Mehr konnte er nicht für sie tun. Ihre Konstitution war nicht die beste, aber das ließ sich nun mal nicht ändern! Da war nichts, woran er sich hätte festbeißen können. Ganz im Gegensatz zur alten Mutter Crabtree …
Langweilig, der Vormittag. Lukrativ ja – aber sonst auch nichts. Gott, war er müde! Er hatte all die kränkelnden Frauen und ihre Zipperlein so satt. Lindern, dämpfen – das war alles, was er zu tun hatte. Manchmal fragte er sich, ob sich das alles lohnte. Aber dann fiel ihm immer das St.-Christopher-Krankenhaus ein, vor allem die Margaret-Russell-Station mit der langen Bettreihe und in einem davon Mrs Crabtree, die ihn aus ihrem zahnlosen Mund angrinste.
Mit ihr verstand er sich gut! Sie war eine Kämpfernatur, ganz anders als die träge schlaffe Kuh im Bett nebenan. Mrs Crabtree war auf seiner Seite, sie wollte leben, obwohl Gott allein wusste, wieso, wenn man bedachte, in was für einem Slum sie lebte, mitsamt einem Alkoholiker als Mann und einem Rudel ungezogener Gören, und in was für endlosen Korridoren von endlosen Bürogebäuden sie tagaus, tagein zu putzen gezwungen war. All die erbarmungslose Schinderei und kaum Vergnügen! Aber Mrs Crabtree wollte leben, sie lebte gern – genau wie er, John Christow, gern lebte! Nicht wegen der Umstände –, sondern einfach wegen des Lebens selbst, der Lust am Dasein. Es war etwas Merkwürdiges, das man nicht erklären konnte. Er beschloss, mit Henrietta darüber zu reden.
Er stand auf und geleitete seine Patientin zur Tür. Er drückte ihr freundlich und aufmunternd die Hand. Auch seine Stimme war aufmunternd, voller Anteilnahme und Mitgefühl. Sie fühlte sich wie neugeboren, beinahe glücklich. Dr. Christow nahm so viel Anteil!
Als die Tür hinter ihr ins Schloss fiel, hatte John Christow sie schon vergessen. Er hatte sie auch vorher, als sie noch im Sprechzimmer gewesen war, kaum wahrgenommen. Er hatte seine Sachen abgespult. Der reine Automatismus. Und obwohl sein Hirn höchstens oberflächlich berührt war, hatte er doch Kraft ausgestrahlt. Er hatte automatisch reagiert, wie der Heiler zu reagieren hat, und er merkte, was für einen Energieverlust das bedeutete.
Gott, dachte er wieder, bin ich müde.
Nur noch eine weitere Patientin und dann die klare Weite des Wochenendes. Bei diesem Gedanken verweilte er. Das goldene Laub, das schon rot und braun gefärbt war, der feuchte, linde Herbstgeruch – die Straßen durch den Wald –, die kleinen Feuer, Lucy, das einzigartige, reizende Geschöpf mit dem irrlichternden, nicht zu greifenden Geist. Henry und Lucy waren ihm die liebsten Gastgeber. Und das »Eulenhaus« war das entzückendste Haus, das er kannte. Sonntag würde er mit Henrietta einen Waldspaziergang machen, den Hügel hoch und dann weiter die Kammlinie entlang. Beim Spazierengehen mit Henrietta würde er vergessen, dass es überhaupt kranke Menschen auf der Welt gab. Gott sei Dank fehlt ihr nie irgendwas, dachte er.
Dann fiel ihm etwas ein, das ihm in Sekundenschnelle die Laune verdarb: Mir gegenüber würde sie das aber auch nie durchblicken lassen!
Eine Patientin noch. Er musste die Klingel auf seinem Schreibtisch drücken. Er schob es auf, ohne selbst zu verstehen, warum. Er kam doch jetzt schon zu spät. Das Essen stand längst auf dem Tisch oben. Gerda und die Kinder warteten schon. Er musste weitermachen.
Aber er blieb regungslos sitzen. Er war so müde – so furchtbar müde.
Die Müdigkeit hatte zugenommen in letzter Zeit. Sie war die Ursache seiner ständig wachsenden Gereiztheit, die er an sich bemerkte, aber nicht abstellen konnte. Die arme Gerda, dachte er, sie muss einiges aushalten. Wenn sie nur nicht so unterwürfig wäre, so bereitwillig alles auf sich nähme, obwohl er selbst doch mindestens halb so oft selber Schuld hatte! Es gab Tage, an denen sich alles, was Gerda tat oder sagte, verschwor, um ihm lästig zu sein. Und es waren vor allem, wie er reumütig zugab, ihre Tugenden, die ihn so reizten. Ihre Geduld, die Selbstlosigkeit, mit der sie ihre Wünsche den seinen immer unterordnete – all das machte ihm schlechte Laune. Und nie nahm sie seine Wutausbrüche übel, nie beharrte sie auf ihrer eigenen Meinung, nie versuchte sie auch nur, etwas im eigenen Namen durchzusetzen.
Na, aber deshalb hast du sie doch geheiratet, dachte er, oder etwa nicht? Worüber beklagst du dich eigentlich? Nach dem Sommer damals in San Miguel …
Eigenartig, wenn man mal darüber nachdachte – genau die Eigenschaften, die ihn bei Gerda ärgerten, vermisste er bei Henrietta schmerzlich. Und was ihn bei Henrietta ärgerte – nein, ärgern war das falsche Wort: was ihn zornig machte bei Henrietta, das war ihre unkorrumpierbare Aufrichtigkeit ihm gegenüber. Sie entsprach so gar nicht ihrer sonstigen Haltung gegenüber der Welt. Einmal hatte er zu ihr gesagt: »Ich glaube, ich kenne niemanden, der so lügt wie du.«
»Kann schon sein.«
»Dir ist völlig egal, was du sagst, wenn es die Leute nur gern hören.«
»Das finde ich auch wichtiger.«
»Wichtiger, als die Wahrheit zu sagen?«
»Viel wichtiger.«
»Und warum kannst du dann in Gottes Namen nicht mir gegenüber ein bisschen öfter lügen?«
»Soll ich das?«
»Ja.«
»Tut mir leid, John, das kann ich nicht.«
»Du musst doch ganz oft genau wissen, was ich gern hören würde.«
Schluss damit. Jetzt bloß nicht an Henrietta denken. Er würde sie heute Nachmittag sehen. Jetzt musste erst mal die Arbeit erledigt werden! Geklingelt und die letzte verdammte Ziege behandelt. Noch so eine kränkelnde Kreatur! Zu einem Zehntel wirklich krank, die restlichen neun hypochondrisch! Gott ja, warum sollte sie eigentlich nicht genießen, dass sie nicht die beste Gesundheit hatte, wenn sie anständig bezahlte? Das finanzierte schließlich die Mrs Crabtrees dieser Welt.
Er saß noch immer regungslos da.
Er war müde – er war so furchtbar müde. Es kam ihm vor, als sei er schon sehr lange so müde. Und irgendetwas suchte er – wollte er ganz dringend.
Plötzlich schoss ihm durch den Kopf: Ich will nach Hause!
Er war verblüfft. Woher kam denn dieser Gedanke? Und was sollte das heißen? Nach Hause? Er hatte nie ein Zuhause, eine Heimat gehabt. Seine Eltern hatten in Indien gelebt, er war bei wechselnden Verwandten aufgewachsen und hatte die Ferien mal bei diesem, mal bei jenem verbracht. Das erste feste Zuhause, das er je gehabt hatte, stellte er fest, war dieses Haus in der Harley Street.
Aber empfand er das als Heimat? Er schüttelte den Kopf. Er wusste, dass es nicht stimmte.
Aber jetzt war seine medizinische Neugier geweckt. Was hatte er gemeint mit diesem Satz, der ihm einfach plötzlich durch den Kopf geschossen war?
Ich will nach Hause.
Daran musste etwas sein – irgendein Bild.
Er schloss halb die Augen – irgendetwas im Hintergrund.
Und plötzlich sah er es vor seinem inneren Auge ganz deutlich – das Tiefblau des Mittelmeers, die Palmen, die verschiedenen Kakteen. Er hatte wieder den heißen Sommerstaub in der Nase und das Gefühl des kühlen Wassers, wenn man länger am Strand in der Sonne gelegen hatte, auf der Haut.
San Miguel!
Er war verwirrt und unangenehm berührt. Seit Jahren hatte er nicht mehr an San Miguel gedacht. Und dahin zurück wollte er mit Sicherheit nicht. Das gehörte in ein vergangenes Kapitel seines Lebens.
Das war doch zwölf, nein vierzehn, fünfzehn Jahre her. Und er hatte es richtig gemacht! Seine Entscheidung war vollkommen richtig gewesen! Er war in Veronica wirklich rasend verliebt gewesen, aber es wäre nie gut gegangen. Veronica hätte ihn mit Haut und Haar verschlungen. Sie war total egoistisch und gab das auch ohne Umschweife zu! Veronica hatte sich fast alles, was sie wollte, einfach gegriffen – nur ihn hatte sie sich nicht greifen können! Er war ihr entwichen. Konventionell gesehen hatte er sie vermutlich schlecht behandelt. Ohne Beschönigung gesagt, er hatte sie sitzen lassen! Aber in Wahrheit hatte er einfach nur die Absicht gehabt, sein eigenes Leben zu leben, und genau das hätte Veronica nie zugelassen. Sie hatte die Absicht gehabt, ihr eigenes Leben zu leben und John wie eine Zugabe mitzunehmen.
Als er abgelehnt hatte, mit nach Hollywood zu ziehen, hatte sie ihn entgeistert angesehen und geringschätzig erklärt: »Also, wenn du unbedingt Arzt werden musst, kriegst du bestimmt drüben auch deinen Doktortitel, aber eigentlich ist das nicht nötig. Du hast genug zum Leben, und ich verdiene einen Haufen Geld.«
Er hatte das vehement zurückgewiesen: »Ich hänge aber an meinem Beruf. Und ich kann mit Radley arbeiten.«
Seine Stimme, diese jugendliche, begeisterte Stimme, hatte sehr ehrfurchtsvoll geklungen.
Veronica hatte naserümpfend gefragt: »Mit diesem alten Muffelkopf?«
»Mit diesem alten Muffelkopf, ja«, hatte John zornig geantwortet. »Der betreibt nämlich die beste Forschungsarbeit zum Morbus Pratt –«
Sie hatte ihn gar nicht ausreden lassen. Morbus Pratt, wen das denn interessiere, hatte sie gesagt, Kalifornien habe so ein wunderbares Klima, und durch die Welt gondeln mache einfach Spaß. »Ohne dich mag ich das alles überhaupt nicht«, hatte sie dazugesetzt. »Ich will dich, John – ich brauche dich doch.«
An der Stelle war er mit dem für Veronica unglaublichen Vorschlag rausgerückt, sie könne doch das Angebot aus Hollywood einfach ausschlagen, ihn heiraten und sich mit ihm in London niederlassen.
Sie hatte das komisch gefunden und weiter fest darauf beharrt, sie gehe nach Hollywood, und sie liebe John, und John müsse sie heiraten und mitkommen. Sie hatte nicht den geringsten Zweifel an ihrer Schönheit und ihrer Macht.
Er hatte festgestellt, dass ihm nur eins übrig blieb – und das dann auch getan: Er hatte per Brief die Verlobung aufgelöst.
Eine Zeit lang hatte er ziemlich gelitten, aber er hatte keinen Zweifel, dass er die klügste Richtung eingeschlagen hatte. Er war nach London zurückgekehrt, hatte mit Radley gearbeitet und ein Jahr später Gerda geheiratet. Gerda war in jeder Beziehung so anders als Veronica wie irgend möglich …
Die Tür ging auf, Beryl Collins, die Sprechstundenhilfe, erschien. »Sie haben noch den Termin mit Mrs Forrester.«
»Ich weiß«, sagte er knapp.
»Ich dachte, Sie hätten’s vielleicht vergessen.«
Sie ging quer durchs Sprechzimmer und zur anderen Tür hinaus. Christow folgte ihrem geordneten Rückzug mit den Augen. Nicht gerade eine Schönheit, dachte er, aber verdammt tüchtig. Seit sechs Jahren war Beryl bei ihm. Sie hatte nie einen Fehler gemacht und war durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Ihre Haare waren schwarz, ihre Haut unrein, ihr Kinn resolut. Ihre hellgrauen Augen hinter der dicken Brille taxierten ihn wie den Rest der Welt mit ein und derselben leidenschaftslosen Aufmerksamkeit.
Eine unscheinbare Sprechstundenhilfe, mit der nicht zu spaßen war, hatte er gewollt, und eine unscheinbare Sprechstundenhilfe, mit der nicht zu spaßen ist, hatte er bekommen, trotzdem fühlte er sich paradoxerweise manchmal gekränkt! Nach allen Regeln der Kunst hätte Beryl ihrem Arbeitgeber hoffnungslos ergeben sein müssen. Aber er hatte von Anfang an das Gefühl gehabt, bei ihr keinen Eindruck schinden zu können. Beryl zeigte weder Hingabe noch Selbstverleugnung – sie hielt ihn unverkennbar bloß für ein fehlbares Menschlein. Sie ließ sich weder von seiner Persönlichkeit beeindrucken noch von seinem Charme beeinflussen. Manchmal bezweifelte er sogar, dass sie ihn überhaupt mochte.
Einmal hatte er ein Telefongespräch von ihr mit angehört: »Nein«, sagte sie gerade, »selbstsüchtiger als vorher ist er eigentlich nicht – vielleicht gedankenloser, rücksichtsloser.«
Er hatte sofort gewusst, dass die Rede von ihm war, und sich die nächsten vierundzwanzig Stunden darüber geärgert.
Gerdas bedingungslose Begeisterung für ihn war ihm zwar wirklich lästig, aber genauso wenig passte es ihm, von Beryl so kühl eingeschätzt zu werden. Ich glaube, mir geht bald alles auf die Nerven, grübelte er …





























