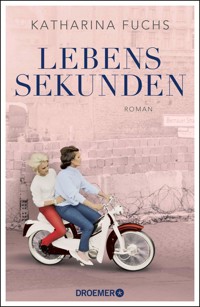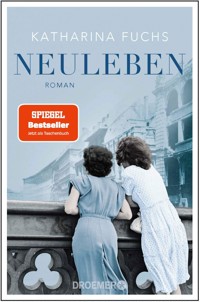9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman »Das Flüstern des Lebens« von Bestseller-Autorin Katharina Fuchs erzählt die wahre Geschichte einer späten großen Liebe Isabelle erfährt erst nach dem Tod ihrer Tante Corinna von ihrem unerwarteten Erbe - einer Kaffeeplantage in Tansania. Noch ahnt sie nicht, dass dieses Vermächtnis mehr als ein Stück Land und ein altes Farmhaus birgt, nämlich ihre zweite Chance auf ein neues, erfülltes Leben. Mitten in der atemberaubenden Natur führt das Schicksal Isabelle eines Tages mit Frank zusammen, dem Piloten einer Propellermaschine, die auf der Sandpiste ihrer Plantage landet. Und dann gibt es da noch Hannah, Corinnas 14-jährige Tochter, von der niemand in der Familie wusste. Wie eine Notlandung auf einer Kaffeeplantage zur Liebe des Lebens führte – ein berührender Roman nach einer wahren Geschichte Ein Roman voller Abenteuer, Emotionen und der Schönheit Afrikas. Katharina Fuchs schickt uns in diesem berührenden biografischen Roman auf eine Reise ins Tansania. Ein kraftvoller Frauenroman über Mutterschaft, Familiengeheimnisse und eine außergewöhnliche Liebesgeschichte in der Mitte des Lebens. Entdecken Sie auch Katharina Fuchs' historische Bestseller, die auf ihrer eigenen Familiengeschichte beruhen: - Zwei Handvoll Leben (1914–1953) - Neuleben (50er- und 60er-Jahre) - Unser kostbares Leben (70er- und 80er-Jahre)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 742
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Katharina Fuchs
Das Flüstern des Lebens
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Erst nach und nach begreift die fünfundvierzigjährige Münchnerin Isabelle, dass das Erbe ihrer Tante Corinna – eine Kaffeeplantage in Tansania – ihre zweite Chance auf ein glückliches, erfülltes Leben ist: Mitten in der atemberaubenden Natur kann sie sich jetzt für Nachhaltigkeit einsetzen. Als eines Tages eine Propellermaschine auf ihrer Sandpiste landet, lernt Isabelle den Piloten Frank kennen und zwischen ihnen entfacht eine Liebe, die ihr Leben für immer verändern wird. Doch Isabelles Glück steht die Kluft zwischen zwei Welten im Weg, die unterschiedlicher nicht sein könnten … und da ist auch noch die vierzehnjährige Hannah, deren Existenz die Tante der Familie verschwiegen hatte. Das Flüstern des Lebens ist eine kraftvolle Geschichte über Mutterschaft, Familiengeheimnisse und eine außergewöhnliche Liebe in der Mitte des Lebens.
Inhaltsübersicht
Disclaimer
Prolog
1. Buch
Isabelle
Isabelle
Moritz
Isabelle
Hannah
Doris
Isabelle
Doris
Isabelle
Moritz
Doris
Hannah
Isabelle
Moritz
Doris
Isabelle
2. Buch
Mawingu
Hannah
Isabelle
Doris
Hannah
Isabelle
Hannah
Moritz
Isabelle
Doris
Isabelle
Doris
Isabelle
Hannah
Isabelle
Doris
Isabelle
Moritz
Isabelle
Moritz
Isabelle
Moritz und Doris
Hannah
Isabelle
Moritz
Isabelle
Doris
Isabelle
Isabelle
Doris
Isabelle
Hannah
Isabelle
Moritz
Isabelle
Hannah
Doris
Moritz
Isabelle
Isabelle
Disclaimer
Im vorliegenden Roman geht es unter anderem um sensible Themen wie Kinderarbeit und postkoloniale Strukturen und es kommen Ausdrücke und Bezeichnungen wie beispielsweise »Eingeborene« vor, die heute als diskriminierend und abwertend gelten und nicht mehr gebräuchlich sind. Sie werden in indirekter und wörtlicher Rede an manchen Stellen dennoch verwendet und weder umschrieben noch vermieden oder nur angedeutet, da sie dazu beitragen, die Haltung der sprechenden Figur und die Zustände zum Ausdruck zu bringen.
Prolog
Sind wir ganz ehrlich mit uns, besteht bei uns allen die Möglichkeit, dass wir uns von Menschen ein Bild gemacht haben, von ihrem Charakter, ihrem Anstand und ihrer Aufrichtigkeit, ihren guten und schlechten Eigenschaften, und dieses Bild unsere Vorstellung und Wahrnehmung so sehr prägt, dass die Realität zuweilen nicht ganz zu uns durchdringt. Und deshalb machen wir Fehler in unserer Einschätzung. Aber Fehler sind menschlich.
Einer Studie der Columbia Business School zufolge, die im Journal of Personality and Social Psychology veröffentlicht wurde, hat jeder Mensch bis zu dreizehn Geheimnisse. Die Forscher erfuhren, dass 60 Prozent der Befragten bereits eine Lüge verschwiegen hatten, 47 Prozent wollten nicht verraten, dass sie das Vertrauen eines anderen Menschen missbraucht hatten, 33 Prozent der Studienteilnehmer gaben an, bereits etwas gestohlen sowie eine geheime Beziehung geführt zu haben.
Nicht immer müssen Geheimnisse etwas Böses bedeuten, schließlich setzt auch eine Geburtstagsüberraschung für geraume Zeit das Verschweigen von Tatsachen voraus – ihre Geheimhaltung. Manche Geheimnisse bewegen sich auch in Graubereichen zwischen Gut und Böse, die unzählige Schattierungen zulassen.
Ich möchte mir nicht anmaßen, darüber zu urteilen, was gut und was schlecht ist. Nach Genesis 2, Vers 9 des Alten Testaments ließ Gott den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse in der Mitte des Gartens Eden wachsen. Er verbot den Menschen aber, von den Früchten des Baums der Erkenntnis zu essen, da dies den Verlust des ewigen Lebens zur Folge hätte. Im Sinne Gottes ist es eine Vermessenheit der Menschen, selbst zu entscheiden, was gut und was böse ist.
Ich könnte nun alles so belassen und nicht mehr daran rühren. Wäre da nicht diese heimliche Unruhe, die mich immer wieder befällt und die mitunter in blinde, unsinnige Angst ausartet. Sie kann zum ständigen Begleiter unseres Lebens werden, wenn wir den Grund im Verborgenen lassen.
Ich vermute, dass für jeden Menschen im Leben ein Moment der Prüfung kommt, in dem er sich entscheiden muss – für oder gegen die Wahrheit. Für oder gegen sein perfektes Image, sein Bild in der Öffentlichkeit und auch seinen ganz privaten Leumund. Auch kann, was in der Gesellschaft vor Jahren als richtig erschien, von der aufgeklärten Gegenwart eingeholt werden und nun bei näherer Betrachtung falsch sein. Mancher mag sich gegen diese Veränderungen im Denken stemmen, gegen die Aufklärung. Womöglich muss er gegen seine Schwächen ankämpfen, gegen die Leichtigkeit einer Lüge, gegen den einfachen Weg der Unwahrheit, vielleicht muss er diese auch vollends überwinden. Die Prüfung kann zunächst klein und unbedeutend wirken oder von Anfang an als offensichtliche Tragödie daherkommen. Ich jedenfalls habe meine Prüfung abgelegt und genug Melodram in meiner Familie gehabt. Jetzt will ich nur noch meinen Frieden.
Seite an Seite mit dir, der Liebe meines Lebens, möchte ich die frische kalte Morgenluft im afrikanischen Hochland einatmen, über die geometrischen Formen der Felder mit jungen, grünen Kaffeepflanzen schauen, umgeben von Wildnis, Urwald und Steppe – und dabei alles vergessen, was passiert ist. Doch die Vergangenheit ist mir noch zu nah, als dass ich darüber schweigen könnte.
1. Buch
Mawingu-Farm, Tansania, Herbst 1987
Isabelle
Meine Tante hatte eine Farm in Tansania. Der Ngorongoro-Krater lag rund zehn Kilometer von dem nördlichsten Grenzstein ihres Landes entfernt. Doch konnten aus der Strecke leicht zwanzig Kilometer werden, je nachdem, ob das Wasser der Bäche in der Regenzeit über die Ufer trat und Erdrutsche die südliche Route unpassierbar machte.
Die Bewegungen der Erdkruste, die vor rund fünfundzwanzig Millionen Jahren begannen und bis heute andauern, hatten eine einmalige Landschaft hervorgebracht. Sie schufen den mächtigen Ngorongoro, der seit zweieinhalb Millionen Jahren fünftausend Meter in die Höhe ragt und dessen Hänge dichten Nebelwald tragen. Die fruchtbare Vulkanasche bildete die Grundlage für die üppigen Weiden zu Füßen des Kraterhochlands, das allem Leben in den Ebenen seinen unerbittlichen Rhythmus aufzwang.
Von Horizont zu Horizont erstreckt sich dort eine Ebene, so flach wie eine Tischplatte. Hier wachsen kaum Sträucher und Bäume und das Auge sucht vergeblich nach üppiger Vegetation und lieblichen Farben. Wo man hinsieht, nur Gras in allen Schattierungen von Oliv über Mint bis zu sattem Apfelgrün während der Regenzeit und von Strohgelb über Ocker bis Braun in der Trockenzeit. Als sei es nicht einfach nur Grasland, sondern eine tönerne Kachel, deren Farbe umso intensiver wird, je höher die Brenntemperatur, der sie ausgesetzt ist. In der Savanne ist es kein Brennofen, sondern die afrikanische Sonne, die diese tönerne Farbpalette hervorbringt.
Für die Viehhirten barg der Boden während der Regenzeit fruchtbares Weideland. Doch nur die genügsamen Schafe und Ziegen der Massai konnten in der Trockenzeit am Fuß der Vulkane gehalten werden. Als die Massai diese Weiden für sich eroberten, nannten sie den Ort »esirinket«, »weiter, offener Platz«. Über drei Jahrhunderte wurde die »esirinket« von Massai-Hirtennomaden besiedelt und für ihre Viehweidewirtschaft genutzt. Als die Europäer den Ort entdeckten, formten sie den Namen »esirinket« zu »Serengeti«.
Ich war dreizehn, als ich das erste Mal den Ngorongoro-Krater und die Serengeti sah. Im Sommer 1987 hatte meine Tante Corinna Waldeck die Mawingu-Farm nördlich von Karatu einschließlich sechshundert Hektar Land gekauft und meine Eltern flogen mit meinem Bruder und mir in den Herbstferien von München nach Tansania. Meine Vorstellung von dem, was mich erwartete, war durch Bilder aus dem Fernsehen und Kino geprägt und steckte voller Klischees. Von der damals schon etwa zwanzig Jahre alten Kultserie »Daktari« hatte ich mir den schielenden Löwen Clarence und den zahmen Schimpansen Judy ausgesucht und hoffte inständig, solchen Tieren zu begegnen. Selbstredend kannten wir alle Bernhard Grzimeks Film »Serengeti darf nicht sterben« und meine Mutter wollte mit uns das Grab des Tierforschers am Kraterrand besuchen.
Die Ankunft am Arusha Airport gestaltete sich überraschend einfach. Wir kamen die Gangway herunter und gingen direkt auf ein eingeschossiges Gebäude mit grünem Dach zu, das im Vergleich zu den Ausmaßen des Internationalen Münchner Flughafens Riem eher wie ein Busbahnhof wirkte. Ich weiß noch genau, was ich trug: eine kamelfarbene Jeans mit ausgestellten Beinen und eine Jerseybluse in Kaki, die am Ausschnitt geschnürt wurde. Unsere Mutter hatte uns vor der Reise mit tropentauglicher Kleidung in Sandtönen eingedeckt, um gegen Sonne und Insekten geschützt und kein Blickfang für wilde Tiere zu sein.
Der Himmel war blass und so hell, dass man kaum in die Höhe schauen konnte, ohne zu blinzeln. Am Horizont hinter dem niedrigen Dach des einzigen Terminals türmten sich riesige, scheinbar schwerelose Wolken auf, die rasch auf uns zusegelten. Das Atmen fiel leicht, denn die Luft war dünn, und ich sog sie tief in meine Lunge ein, als atmete ich eine wilde Hoffnung ein, die mich mit Vogelschwingen versah.
Mit einem »Welcome to Tansania« und einem offenen Lächeln gab uns der schwarze Grenzbeamte die gestempelten Pässe zurück. Ich fühlte mich von diesem Moment an willkommen. Es war ein starkes, unbezwingbares Gefühl, die mir fremden Menschen und das unbekannte Land in mein Herz und in mein Leben zu lassen. Ja, ich glaube, mit dem Herzen hat es angefangen oder mit dem, was ich im Alter von dreizehn dafür hielt.
Der Flughafen wimmelte von bunt gekleideten Reisenden und Touristen in neuer europäischer Safarikleidung, die unserer ähnelte. Hinter der Zollabfertigung standen Fahrer, die Pappschilder mit Namen hochhielten.
»Ich glaube, wir werden abgeholt«, sagte Gregor. Er legte meiner Mutter den Arm um die Schultern – eine liebevolle Geste, die wir lange nicht mehr beobachtet hatten, und Moritz stieß mir seinen Ellbogen in die Rippen. Unsere Eltern wirkten so viel lockerer als zu Hause. Sie verbreiteten eine launige Heiterkeit, seit wir afrikanischen Boden betreten hatten. Kinder haben eine feine Antenne dafür, wenn es in der Beziehung ihrer Eltern kriselt, auch wenn sie nicht die passenden Worte finden mögen. Und zwischen unserer Mutter und unserem Vater stimmte es schon seit längerer Zeit nicht mehr. Aber jetzt ruhte Gregors Arm auf Doris’ Schultern und er deutete in Richtung Ausgang. Auf uns wartete ein junger Einheimischer mit Sonnenbrille und breitkrempigem Hut. Er hob die Hand zum Gruß und rief uns ein lautes »Jambo« entgegen. Ich sehe ihn noch genau vor mir, als ob unsere Ankunft erst gestern gewesen wäre. Er stellte sich uns als Zahir vor. Er sei Wildhüter, Maschinenführer, Mechaniker, Fahrer und die gute Seele der Mawingu-Farm in einem.
»Das hier sind meine Frau Doris, meine Tochter Isabelle und mein Sohn Moritz«, sagte Vater und klopfte Zahir jovial auf die Schulter. »Wenn ihr ein Problem habt, geht zu Zahir!« Er redete so, als würde er den Angestellten meiner Tante schon lange kennen. Zahir lachte, entblößte eine Zahnlücke im Unterkiefer, schüttelte unsere Hände und übernahm unseren vollgeladenen Gepäckwagen. Wir hatten gar nicht viel Kleidung mit, sondern die Koffer waren mit allen möglichen deutschen Haushaltsgegenständen gefüllt, die Corinna auf der Farm benötigte und die sie Doris in einem Telegramm aufgelistet hatte. Dazu gehörten eine gute Schere, Nähzeug, Hansastrips in rauen Mengen, Fieberthermometer, Aspirin und das Malariamittel Chloroquin, eine große Ladung Batterien und eine neue Kaffeemaschine. Außerdem zwanzig Packungen Nudeln für den Orden der Holy-Spirit-Sisters, der evangelischen Nonnen, die offenbar auf ihrer Europareise auf den Geschmack gekommen waren, sowie Filzstifte als Geschenke für die Kinder.
Zahir schob den Gepäckwagen zügig vor uns her auf den Parkplatz zu einem Defender in Tarnfarbe, den meine Tante Corinna, wie wir wussten, gebraucht gekauft hatte.
Der Geländewagen war mit zwei knallgelben Zwanzig-Liter-Dieselkanistern, Spaten und Sandblechen auf dem Dach ausgestattet und wir Kinder fragten uns, wozu sie wohl dienten. Dabei ahnten wir nicht, wie dankbar wir noch für diese scheinbar überflüssigen Hilfsmittel sein würden. Für unsere Geländefahrten gehörte später noch ein Reifen-Reparatur-Kit, ein Kompressor und ein Kühlschrank zur Ausrüstung, die Zahir allerdings auf der Farm gelassen hatte, um Platz für unsere Koffer zu schaffen. Wir würden erst lernen müssen, wie wichtig der Kompressor war, um bei schwierigen Geländepassagen Druck aus den Reifen abzulassen und sie ohne fremde Hilfe wieder aufzupumpen, ganz gleich, wie weit die nächste Tankstelle entfernt war. Doch dies alles lag noch in einer Zukunft, von der wir nach einer unspektakulären Kindheit in München nicht den Hauch einer Vorstellung hatten. Noch war unser Denken europäisch, wie man hier sagte, und alles, was kam, ein großes Abenteuer.
Auf unserer dreistündigen Fahrt, vorbei an Bananenstauden, Kaffeeplantagen, Maisfeldern und krummen, dornenbewehrten Bäumen nahmen wir die transparente Bläue des afrikanischen Himmels wahr und sahen hoch oben den glühenden Ball der Sonne, der Leben schenkte und es unbarmherzig nahm. Die Luft über der Ebene wurde in der Mittagshitze lebendig und wogte, flimmerte hell wie eine brennende Flamme.
Fuhr man auf das Kraterhochland zu, ragte die Bruchlinie des ostafrikanischen Grabens an die fünfhundert Meter auf. Der Höhenzug erstreckte sich von Westen nach Norden und wurde von unzähligen edlen Gipfeln gekrönt, die wie Wellenkämme kobaltblau in den Himmel ragten. Über dem üppigen Wald hingen weißgraue Wolkenfetzen. Während Zahir den Wagen lenkte und manches Schlagloch umfuhr, erklärte uns unser Vater die Landschaft: Auf dieser Seite des Massivs sei das Vorland dicht besiedelt, die fruchtbaren Böden und regelmäßigen Niederschläge ließen ergiebige Landwirtschaft zu. Der Wind wehe hier monatelang aus derselben Richtung. So bringe der Südostmonsun die feuchtwarme Luft vom Indischen Ozean ins Landesinnere.
»Siehst du, Isa, das führt dazu, dass sich der Regen überwiegend auf der Südostseite der hohen Bergzüge bildet.« Mein Vater drehte sich zu mir um, denn er hatte wohl bemerkt, dass ich ihm nicht besonders aufmerksam zuhörte. »Im Nordwesten – auf der anderen Seite der Vulkane – kommt umgekehrt viele Monate im Jahr nur trockene Luft an.«
Meine Gedanken schweiften ab. »Nordosten« oder »Südwesten« – was hatten die Himmelsrichtungen schon für eine Bedeutung? »Bergzüge«? »Trockene Luft oder feuchte Luft«? Dass hiervon in Afrika das Überleben Abertausender Tiere und Menschen abhing, war für mich nicht vorstellbar. Nur als unser Vater von »herabsinkenden Föhnwinden« sprach, konnte ich mit dem Ausdruck etwas anfangen. »Föhn« kannten wir aus München zur Genüge – unser Vater bekam bei der Wetterlage fast immer Kopfschmerzen.
Was wir Kinder hier hören und vor allem sehen wollten, war die afrikanische Tierwelt, die Elefanten, Nashörner, Büffel, Leoparden und Löwen, die »Big Five«, von denen man uns erzählt hatte, außerdem Zebras, Giraffen. Bis jetzt hatten wir von der Straße aus nur Schafe und Ziegen oder Ochsen, die schwer beladene Karren zogen, entdecken können.
Zahir erklärte auf Englisch und Vater übersetzte, was wir nicht verstanden: Das Farmgelände an den Hängen des Ngorongoro-Kraters erstrecke sich über eine Fläche von sechshundert Hektar und sei so vielfältig wie die Natur, welche es umgab. Ein unvergessliches Erlebnis in einer einzigartigen Landschaft: Weite Felder aufgereihter Kaffeebäume, durch Schirmakazien und Jakarandabäumen vor zu viel Sonne geschützt, grenzten direkt an den Ngorongoro-Nationalpark an.
Wir saßen aufgereiht seitlich zur Fahrtrichtung auf den harten Bänken und nahmen Wildnis, Steppe, Busch und einige verstreute Siedlungen wahr. Vor allem entsinne ich mich noch an das Kleben der Ledersitze, ihre ausgefransten Ränder, das Gefühl, mehrere Stunden bis ins Mark durchgerüttelt zu werden, und die vielen Eselskarren, die wir überholten.
Dann bog Zahir mitten in den Busch ab und folgte einer roten Standspur, stellenweise kaum breiter als ein Fußpfad. Zu beiden Seiten ragten die Bäume wie Säulen empor und vereinigten sich über uns wie der Bogengang eines Klosters. Nicht einmal die Nachmittagssonne vermochte das eng verschlungene Laubdach zu durchdringen. Linker Hand tauchte eine niedrige Lehmhütte mit einem Grasdach auf. An den Dachfirst war ein kleines Kreuz genagelt und meine Mutter fragte, ob das eine Kirche sei. »Kein Gotteshaus«, antwortete Zahir. »Die evangelische Missionsschule.« Da weit und breit keine Siedlung zu sehen war, erkundigte sich meine Mutter, wo die Schüler herkämen. »Von überall«, lautete die Antwort.
Endlich sahen wir die Plantage. Der Anblick der geometrischen Formen dieser ebenmäßig bepflanzten Felder war eine Überraschung inmitten der wilden Landschaft. Ordentlich frisch und grün wirkten die Kaffeepflanzen, umgeben von Wildnis, Urwald und Steppe.
»Kaffeeanbau ist eine Arbeit, für die man viel Geduld braucht«, sagte Zahir. »Patience!« Das Wort wiederholte er mehrmals und ich verstand nicht, was das in dem Zusammenhang bedeuten sollte. »Nach drei Jahren trägt eine Pflanze. Bis dahin ist es schwieriger, als man sich vorstellt«, erklärte er, ohne eine genauere Erklärung abzugeben.
Als wollte eine höhere Kraft seinen Worten mehr Gewicht verleihen, fing es wie aus dem Nichts an, in Strömen zu regnen. Der Wolkenbruch war derart heftig, dass sich die Sandspur augenblicklich in einen schlammigen Bachlauf verwandelte und der Defender nur noch im Schritttempo vorankam. Mehrmals musste Zahir den Rückwärtsgang einlegen und zweimal sogar die Differenzialsperre nutzen, um einen drei Meter hohen steilen Hang hinauf- und hinunterzufahren, denn die sogenannte Straße war an einer Stelle unpassierbar.
Wir waren heilfroh, als wir endlich am Farmhaus ankamen, obwohl wir es durch den dichten Regen und die dicken Nebelschwaden kaum erkennen konnten. Zahir rannte um den Wagen herum, öffnete uns die Hecktüren, wir sprangen heraus und versanken bis zu den Knöcheln tief im gelblichen Schlamm. Dann wateten wir zu der breiten Holztreppe und stiegen die vier Stufen zum Haus hoch.
In dem alten, gemütlichen und authentischen Farmhaus von Mawingu aus den 1920er-Jahren, im Zentrum der Kaffeeplantage, schien man in vergangene Zeiten einzutauchen. Im großen Salon mit offenem Kamin brannte ein knisterndes Feuer. Es hingen Trophäen und sepiafarbene alte Fotos früherer Safaris an den Wänden und so wäre man nicht überrascht gewesen, Hemingway Pfeife rauchend und über die Jagd philosophierend in einem der tiefen Ledersessel anzutreffen. Hinter dem Salon öffnete sich die überdachte Veranda zu einem subtropischen, üppigen Garten. Gekonnt wurde der nostalgische Charme mit Annehmlichkeiten der heutigen Zeit verknüpft. Ventilatoren an der Decke, Heizung, Kühlschrank, Geschirrspülmaschine, um nur einige aufzuzählen. Das Farmhaus war das Herzstück der Kaffeeplantage.
Während wir noch triefend auf dem Teppich vor der offenen Doppeltür des Wohnzimmers standen und zusahen, wie sich um unsere Schuhe herum schlammige Pfützen bildeten, flogen beide Flügel der Eingangstür gleichzeitig auf. Ein Windstoß wehte Corinna in die Eingangshalle. Sie lachte, schüttelte die Nässe von ihrem Hemd – wie eine Jagdhündin nach ihrem Ausflug in den Ententeich – und stampfte mit den Füßen auf. Im Leben sah sie immer noch besser aus, als man sie in Erinnerung hatte. Ihr Gesicht charaktervoll, scharf gezeichnet, die blonde Strähne im struppigen Pony der ansonsten dunkelbraunen Kurzhaarfrisur wirkte wie eine gekonnte Nuance der Natur. Ich kann sie heute deutlich vor mir sehen, denn mein Gedächtnis überspannt diese vielen vergangenen Jahre wie eine Brücke. Und ich werde nie vergessen, wie unwiderstehlich meine Tante war. Keiner konnte sich ihrem Charisma entziehen.
»Willkommen auf Mawingu!«, rief sie gut gelaunt und breitete die Arme aus. »Falls ihr bisher nicht wusstet, dass Mawingu auf Swahili »Wolke« heißt … nun, dann wisst ihr es jetzt. Hattet ihr trotzdem eine gute Fahrt?«
München, Juni 2019
Isabelle
Das Taxi, in dessen Polstern sich kalter Zigarettenrauch eingenistet hatte, fuhr gemächlich durch die Münchner Straßen. Es war Ende Juni, ein herrlicher, sehr warmer Nachmittag mit einem wolkenlosen Himmel. Die Sonne stand so hoch oben, dass sie kaum Schatten warf. In der Ferne konnte man die Bayerischen Alpen sehen, in denen eine blaue Kraftquelle zu wohnen schien, die dem Himmel seine tiefe Farbe verlieh. Als der Wagen an der Eisbachwelle vorbeifuhr, kamen für einen Moment die Isar-Surfer in Sicht: junge Münchner, die mit ihren Brettern den Ritt auf der künstlichen Welle wagten. Mit Badehosen, Bikinis oder Neoprenanzügen bekleidet, zeigten sie vor vielen Schaulustigen ihre Kunstfertigkeit und ihre durchtrainierten Körper. Heute waren sie besonders zahlreich und nutzten offenbar das traumhafte Wetter aus. Unwillkürlich hielt ich Ausschau nach dem gebräunten Gesicht meines Sohnes Alex, der hier jede freie Minute verbrachte. Im Grunde war ich erleichtert, als ich ihn nicht sah. Wahrscheinlich war er in einer Vorlesung und nahm sein Studium doch ernster, als ich manchmal vermutete.
Ich beobachtete ein ebenfalls braun gebranntes Mädchen, das auf sein Board sprang und auf der Welle entlangglitt, selbstvergessen und glücklich. Die Surfer standen für Freiheit und Lebenslust – und das mitten in einer Großstadt. Obwohl ich während der Fahrt vom Hauptbahnhof einen Anruf nach dem anderen erhielt und über meine EarPods ununterbrochen mit Bauherren und Elektrikern über Kabelschächte und Beleuchtungssysteme konferierte, konnte ich mich dem betörenden Anblick nicht entziehen. Es war ein seltsamer, geradezu harter Gegensatz zwischen dem telefonischen Krisenmanagement und dem, was ich sah.
Wenige Minuten später erreichte das Taxi Bogenhausen, mit seinen golden beleuchteten Fassaden, dem Bäcker, in dem ich früher mit meinem Bruder die Sonntagssemmeln für die Familie geholt hatte, der Metzgerei, dem Zeitungsladen und dem altmodischen Gasthaus. Dann kamen wir in das Wohnviertel, in dessen gepflegten Vorgärten Clematis und Hibiskus blühten, so farbenfroh, dass ich mich noch mehr auf zu Hause freute als schon während der gesamten Bahnfahrt. Vor einem halben Jahr, nachdem unser Sohn Alex ausgezogen war, hatten Christoph und ich unser Reihenhaus renovieren lassen, einige Wände in Grafittönen gestrichen, das Bad mit Holzwaschtischen und einer ovalen Badewanne ausstatten lassen, das große Kinderzimmer in unser Schlafzimmer umgewandelt, die Küche zum Wohnzimmer geöffnet und mit einem Küchenblock aus Granit ausgestattet. Es war ein Kraftakt gewesen, auch finanziell, aber seitdem liebte ich mein kleines Häuschen fast noch mehr als in den Zeiten, in denen es das trubelige Heim meiner lauten Familie gewesen war. Es war meine Insel, in einem anstrengenden Berufsleben als Architektin, das ich, seit Alex aus dem Gröbsten raus war, wieder voller Leidenschaft führte.
Ich blickte durch das Seitenfenster und kam zu dem Schluss, dass ich München noch nie so schön gesehen hatte. Der Fahrer bremste, schaltete in den zweiten Gang und bog in eine gerade, von Hecken gesäumte Straße ein. Auf den Balkonen blühten weiße Petunien zwischen akkurat geschnittenen Buchsbaumkugeln. Die Straße machte eine Linkskurve und an der nächsten Kreuzung kam die Bernheimer Straße in Sicht. Hier in Oberföhring waren die Häuser nicht so prächtig wie in Bogenhausen, aber jedes für sich genommen hatte seinen eigenen Charme.
»Nummer neunundzwanzig?«, fragte der Taxifahrer über seine Schulter hinweg. »Ja, da vorne ist es schon.« Ich deutete auf das Haus mit der frisch getünchten Fassade, die über die Kirschlorbeerhecke ragte, dabei wurde ich von einer nervösen Vorfreude auf das Heimkommen erfasst. Im selben Moment hörte ich den Namen »Waldeck« im Radio.
»Könnten Sie das bitte lauter stellen?«, fragte ich und nahm meine EarPods aus den Ohren.
Der Fahrer nickte. »Okay.«
»… wurde die Münchner Unternehmerin Corinna Waldeck auf ihrer Farm in Afrika tot aufgefunden«, sagte die Stimme des Reporters. »Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts bestätigt, dass eine deutsche Staatsangehörige in Tansania ums Leben kam …« Ich spürte eine Mischung aus Ungläubigkeit und aufkommender Verzweiflung. War es wirklich meine Tante, über die dort gesprochen wurde? Konnte es wahr sein? Lächerliche Gedanken gingen mir durch den Kopf: dass es noch andere Münchner Unternehmerinnen gab, die eine Farm in Afrika besaßen und genauso hießen, dass sich der Journalist einen geschmacklosen Scherz erlaubte. Und viel naheliegender – dass ich mich verhört hatte. Ich spürte, wie sich das Lächeln in meinem Gesicht auflöste und meine Hände sich um den Henkel meiner Handtasche krampften.
»Ist Ihnen nicht gut?«, fragte der Taxifahrer. »Soll ich vielleicht einen Arzt rufen?«
»Danke, es geht schon.«
Wie durch einen Schleier las ich die Zahl auf der Taxiuhr, reichte zwei Zwanzigeuroscheine nach vorne, murmelte, der Rest sei für ihn, und konnte mich später nicht mehr daran erinnern, auf welche Art und Weise mein Koffer ins Haus gelangt war. Nur daran, dass ich den Freudentanz von Frida, unserer braunen Labradorhündin, heute nicht mit der gleichen Glückseligkeit erwidert hatte. Dann saß ich am Küchentisch zwischen benutztem Geschirr und leeren Joghurtbechern, und Frida, dicht an meine Beine gedrängt, blickte mich ruhig und aufmerksam an, während ich durch die Nachrichten auf meinem Smartphone scrollte. Das Netz war bereits voll von Meldungen über den Tod meiner Tante.
»Bogenhausener Geschäftsfrau stirbt auf ihrer Farm in Tansania.«
»Drama im Afrikaurlaub! Eine bekannte Münchner Unternehmerin (68) ist im südostafrikanischen Tansania ums Leben gekommen.«
»Sprecherin des Auswärtigen Amts steht mit den tansanischen Behörden und den Angehörigen in Kontakt. Sie ist zu jeder konsularischen Unterstützung bereit.«
Ich zuckte zusammen, als das Telefon in meiner Hand vibrierte und der Gitarren-Klingelton erklang. Das Foto meiner Mutter, Doris, rosiger Teint, flotter silbriger Bob, erschien auf dem Bildschirm.
»Mama …?«
Mein Zögern verriet Doris, dass ich die schreckliche Nachricht schon gehört hatte.
»Isa! Du weißt es also schon!«
»Ja, es kam gerade im Radio, als ich im Taxi saß. Ich war zwei Tage bei einem Großprojekt in Köln, da läuft beim Innenausbau leider gerade einiges schief, die Kabelschächte sind zu …« Als mir klar zu werden begann, wie unwichtig meine Probleme auf der Baustelle im Vergleich zu der Trauer waren, die meine Mutter durchlebte, schwieg ich still und es entstand eine Pause. Ich wusste, wie sehr Doris an ihrer Zwillingsschwester – meiner Tante – gehangen hatte. Sie hatte ihr wohl schon während ihrer Kindheit immer besonders nahegestanden, aber seit Doris allein war, hatte ihre Verbindung eine besondere Bedeutung für sie bekommen und war enger denn je. Und ich konnte die Anhänglichkeit meiner Mutter verstehen, denn Corinna Waldeck war etwas sehr Seltenes gewesen: Ein glücklicher Mensch, und sie hatte jeden, der ihr begegnete, mit ihrer Großzügigkeit und ihrem Charisma in ihren Bann gezogen.
»Wie ist es denn passiert?«, fragte ich.
»Ich habe nicht die leiseste Ahnung.«
»Wir sollten wohl …« Ich verstummte, weil ich selbst nicht wusste, was wir sollten.
Doris sprach leise, fast flehend: »Bitte hör nicht auf zu reden, Isa, ich muss deine Stimme hören, ich muss das Gefühl haben, da ist jemand, der mir sagt, was ich jetzt tun soll und wie alles weitergeht, wenn Corinna jetzt auch nicht mehr da ist.«
Ich hörte den Schmerz in der Stimme meiner Mutter und hatte das tiefe Bedürfnis, sie zu trösten, bloß wie?
»Hast du schon mit den anderen gesprochen?«, fragte ich und merkte selbst, dass der Satz neue Fragen aufwarf.
Wer waren »die anderen«? War Tante Corinna noch mit ihrer derzeitigen Freundin zusammen, wie hieß sie noch, Amy oder Mandy … und wenn ja, war sie bei ihr gewesen, als sie starb? Musste ich auch ihren geschiedenen Ehemann sowie Liane, Claudia, Marina und … informieren? Wie hießen noch all die Frauen, mit denen sie jeweils ein paar Jahre zusammengewohnt hatte – mit Liane sogar in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft?
»Nein«, sagte Doris. »Ich habe dich als Erste angerufen und hatte gehofft, dass du …« Sie zögerte, dann sagte sie mit festerer Stimme als zuvor: »… ich wollte dich fragen, ob du es ihnen sagen kannst oder es lieber mir überlässt.«
»Natürlich kann ich das machen!«, beeilte ich mich zu versichern. Aber als ich darüber nachdachte, wo sich Tante Corinnas Ex-Frauen und -Männer (obwohl es meines Wissens nur einen gab), ihre derzeitige Lebensgefährtin, mein Bruder, mein Sohn gerade aufhielten und wie ich alle erreichen konnte, bekam die Situation einen so nüchternen Anstrich, dass meine Kehle trocken wurde und ich schlucken musste. Hier ging es nicht darum, die Familie für ein Geburtstagsfest zusammenzutrommeln und sich ein gemeinsames Geschenk auszudenken. Hier ging es um eine Trauerfeier für meine Lieblingstante.
»Wann und wo soll denn die Beerdigung stattfinden? Corinnas …«, ich stockte, bevor ich das Wort aussprach und holte tief Luft, um es über die Lippen zu kriegen: »Corinnas Leichnam müsste ja überführt werden. Ich glaube, das wird nicht so schnell gehen.«
»Ich weiß nicht, vermutlich hätte sie ihr …« Jetzt stockte Doris’ Stimme, bevor sie das Wort »Grab« aussprechen konnte. »Ihr Grab lieber in Afrika … aber ich will das auch alles nicht so rasch entscheiden und auch nicht alleine. Können wir das nicht besprechen, wenn du hier bist?« Doris klang traurig und hilflos.
»Natürlich, Mama«, sagte ich und plötzlich verließ mich die unnatürliche Ruhe, die ich bis dahin empfunden hatte. Warum war ich nicht gleich selbst auf die Idee gekommen, sofort zu meiner Mutter zu fahren?
»Ich setze mich aufs Fahrrad und bin spätestens in einer halben Stunde da.«
»Danke!«, hörte ich meine Mutter sagen und beendete das Gespräch, bevor der Schmerz mein Herz erreichte. Ich legte das Handy auf den Tisch und ging nach oben, um mich umzuziehen. Wie automatisch bückte ich mich, um die gebrauchten Socken von Christoph aufzuheben, die auf dem Boden lagen, sein benutztes Oberhemd und die verschwitzten Joggingsachen von der Bank am Fußende des Betts zu sammeln und in den Wäschekorb zu werfen. Ich öffnete das Fenster, ließ frische Luft in den Raum, hängte sein Sakko in den Kleiderschrank. Dann tauschte ich meinen schmal geschnittenen, anthrazitfarbenen Businessanzug gegen Jeans und ein weißes T-Shirt, betrachtete unser ungemachtes Bett mit der weißen Leinenwäsche, in dem ich vor zwei Nächten neben Christoph aufgewacht war und geglaubt hatte, alles würde so weiterlaufen wie bisher. Und auch als ich den kleinen silbernen Rahmen mit dem Foto aus unserem letzten Urlaub bei Corinna in Tansania in die Hand nahm, verbannte ich die Gewissheit, dass ihr Leben ein jähes Ende gefunden hatte. Mit Tante Corinna war immer alles so leicht erschienen, so sorglos und spielerisch. Eine feine schmelzende Traurigkeit lag in dem Gedanken. Ich wusste, dass diese unbefangenen Zeiten ein Ende gefunden hatten, aber nur im Kopf, also könnte ich die Erkenntnis, sie nie wieder zu sehen, noch verdrängen, bevor sie sich in meinem gesamten Körper ausbreitete.
Tot. Corinna tot. »Tot«, flüsterte ich, ohne zu merken, dass ich das Wort wirklich aussprach.
Im Bad legte ich meinen schlichten Ehering auf die Ablage aus geölter Eiche, auf der die neuen mattweißen Waschbecken standen, nahm ein feuchtes Handtuch, wischte aus beiden Becken die Reste von Zahnpasta und Christophs Bartstoppeln – anscheinend hatte er während meiner Abwesenheit mein Becken benutzt, nachdem ihm seines zu schmutzig geworden war – warf das Handtuch in den Wäschekorb. Dann wusch ich mir die Hände, kämmte mir die Haare aus dem Gesicht und band sie mit einem Gummi zu einem kurzen Pferdeschwanz zusammen. Dabei versuchte ich mein Spiegelbild zu ignorieren, meine länglichen dunkelgrauen Augen mit den ersten Krähenfüßchen links und rechts, die rund geschwungenen Nasenflügel, den breiten Mund und die scharf umrissenen Linien von Hals und Kinn. Manche wohlmeinenden Freundinnen sagten mir, ich sei immer noch eine schöne Frau. Bei unserem letzten Mädelsabend in Schwabing hatten wir uns zum Spaß alle gegenseitig mit Komplimenten überhäuft. »Und sie kann ganz schön tough sein, wenn es drauf ankommt«, hatte meine beste Freundin Uta über mich gesagt und schnell hinzugefügt, »aber auch einfühlsam.« Vielleicht stimmte das sogar alles, auch wenn meine fünfundvierzig Jahre inzwischen ihre Spuren hinterlassen hatten. Sowohl in meinem Spiegelbild als auch in dem, was man Seele nannte. An einem Tag der Trauer sah man selbst diese kleinen Lebenslinien deutlicher als an glücklichen, erfüllten Tagen.
Zurück im Erdgeschoss, holte ich Fridas Halsband von der Garderobe und legte es ihr an. Die Hündin war hocherfreut über den zu erwartenden Spaziergang. Im Vorbeigehen fiel mir auf, dass der Wassernapf leer war. Ich füllte ihn am Hahn auf und stellte ihn zurück in den Ständer. Sofort begann Frida gierig zu trinken.
»Du Arme, hoffentlich hat Herrchen dein Wasser nicht zwei Tage lang vergessen …«, murmelte ich und strich mir eine Haarsträhne hinter das Ohr. Mein Mann Christoph war Konzertviolinist und wenn er keine Orchesterprobe hatte, übte er zu Hause oder saß im Café am Marienplatz, wohin er den Hund auch gut mitnehmen konnte. Doch heute schien er schon längere Zeit abwesend zu sein. Ich nahm mir vor, die Hündin bei der nächsten Geschäftsreise besser bei meiner Mutter unterzubringen.
»Komm, Frida, Gassi!« Es kostete die Hündin offenbar große Anstrengung, nicht vor Aufregung zu bellen. Ich konnte es am Zucken ihrer Ohren und den Muskelbewegungen sehen, die in Wellen über das glatte Fell des Rückens liefen, und musste unwillkürlich lächeln.
All die langen Wintermonate hindurch war ich mit Fellstiefeln, regendichter Jacke, Handschuhen, Schal und Wollmütze durch die Münchner Straßen zu meinem Büro geradelt. Christoph hatte sich manchmal über meinen Aufzug lustig gemacht, doch ich ließ mich bei keinem Wetter beirren. Eine Gewohnheit, die mir guttat und die ich niemals infrage stellte. Allerdings musste ich zugeben, wie sehr Frühling und Sommer meine Laune gehoben hatten, es mir neue Kraft gab, wenn ich nur mit einem Blazer über der Bluse aufs Fahrrad steigen und den Wind in meinen Haaren spüren konnte.
Doch als ich mich heute auf den Sattel setzte, fühlte ich mich sehr müde, fast erschöpft. Der Gedanke an das, was geschehen war, und die Leere, die es hinterließ, obwohl Tante Corinna in meinem Leben häufiger abwesend als anwesend gewesen war, drückte mich fast zu Boden. Ich fuhr langsam, Frida ohne Leine auf dem Trottoir neben mir, vorbei an den bescheidenen Siedlungshäusern von Oberföhring, zurück in die feine Bogenhausener Villengegend mit den prächtigen Häusern, zurück in die Welt meiner Kindheit.
Das Haus, in dem meine Mutter lebte, lag auf einem parkähnlichen Grundstück. Es war Corinnas Villa, in der ich früher häufig die Wochenenden verbracht hatte. Meine Mutter hatte auf die Bitte ihrer Schwester eines der leer stehenden Zimmer bezogen, nachdem ihre Ehe mit meinem Vater zerbrochen war, und da Corinna ständig unterwegs und mit unzähligen »Projekten« beschäftigt war, hütete sie meistens das gesamte Anwesen. Bei der Instandhaltung wurde sie von Agnieszka, der aus Polen stammenden Zugehfrau, und ihrem Mann Witec zweimal in der Woche unterstützt.
Ich schob mein Fahrrad durch das Gartentor und ging zwischen den Bäumen hindurch über den ansteigenden Weg, hinauf zum Haus. Jetzt im Juni, wenn in dem liebevoll angelegten Garten alles blühte, war es hier am schönsten. Hortensien mit blauen Köpfen, die preisverdächtig waren, Büsche, die wie Wahrzeichen wirkten, Anmut und Kultur vereinten sich in der sorgfältig geplanten Gartenanlage. Doris verbrachte viel Zeit mit der liebevollen Pflege der Blumen und Pflanzen und machte Witec, dem Gärtner, häufig seine Arbeit streitig.
Ich blieb kurz vor einem Schneeballstrauch stehen, dessen ausladende Zweige übervoll mit wunderbar nach Sommer duftenden Blüten besetzt war. Mit der festen Absicht, nun bei meiner Mutter zu klingeln, schob ich mein Fahrrad weiter, aber die Ablenkung war zu groß. Diesmal war es der Anblick, den die Villa von hier aus bot. In Sonnenschein getaucht, lag sie eingebettet in der grünen Rasenfläche. An diesem Ort hatten meine Familie und ich unzählige Geburtstage gefeiert, meine Hochzeit mit Christoph, Alexanders Taufe – niemals wäre es uns in den Sinn gekommen, Corinnas großzügiges Angebot, ihre Villa dafür zu nutzen, auszuschlagen. Sie hatte immer darauf bestanden, bei ihr zu feiern, und die Organisation dann meiner Mutter überlassen. Ich musste unwillkürlich lächeln, denn ich konnte mich nicht an ein einziges Fest erinnern, an dem das Wetter nicht mitgespielt hätte.
Das Gebäude selbst, im bayerischen Landhausstil erbaut, vermittelte den Eindruck von gepflegter Gemütlichkeit und ließ nicht vermuten, dass es mit jeglichem modernen Luxus ausgestattet war. Die Villa hatte drei Stockwerke, deren weiß geschlämmte Mauern von Sprossenfenstern durchbrochen und mit einem tief gezogenen roten Dach gekrönt wurden. Die obere Hälfte war mit Holz verkleidet. Vor jedem einzelnen der vielen Fenster hing ein Blumenkasten mit üppig blühenden pinkfarbenen und weißen Petunien. Im Inneren war es mit hochflorigen Teppichen, behaglichen, dick gepolsterten Sofas, hellem Zirbenholz und etlichen Kaminen ausgestattet, die man natürlich zu dieser Jahreszeit nicht benötigte, aber doch zur Behaglichkeit des Hauses beitrugen.
Mein Architektenauge bewertete die gelungenen Proportionen und das stimmige Gesamtbild, das niemanden kaltließ, der es zum ersten Mal sah. Auch wenn mein persönlicher Geschmack immer zu strengen Bauhauslinien und nüchternem, schnörkellosem Design tendierte, hatte ich dem Charme der Waldeck-Villa nur wenig entgegenzusetzen. Das vollkommene Ebenmaß der Mauern und die Harmonie der Lage wirkten an diesem besonderen Tag wie ein gehütetes Kleinod, das nun nie wieder seine rechtmäßige Besitzerin empfangen würde.
Ich lehnte das Fahrrad an die Hauswand.
»Hast du schon jemanden erreicht?«, fragte Doris, als sie mir die Tür öffnete, und ich erschrak über ihren Anblick. Mit der agilen Frau auf ihrem Profilbild hatte Mutters Anblick heute nichts gemein. Ihr Gesicht war aschfahl. Unter ihren freundlichen Augen lagen Schatten, die sie wie zwei dunkle Löcher wirken ließen. Den meist lächelnden Mund umgab ein angestrengter Zug. Ich schüttelte bedauernd den Kopf: »Ach Mama, dazu hatte ich doch noch gar keine Zeit. Ich konnte mich nur rasch umziehen und bin gleich hergefahren.«
»Entschuldige, ich bin unhöflich, komm erst mal her.« Meine Mutter legte die Arme um meine Schultern und drückte mich in die Wärme ihres Körpers. So standen wir einen Augenblick, nah und vertraut.
Gleich anschließend füllte Doris eine Schüssel mit Wasser und stellte sie für Frida auf den Terrakottaboden, dann holte sie eine Scheibe Putenbrust aus dem Kühlschrank.
»Kein Wunder, dass Frida dich so liebt«, kommentierte ich und sah, wie sich Doris’ Züge für einen kurzen Moment entspannten. »Selbst in deiner größten Trauer denkst du sofort an ihr Wohl.«
»Das tut mir selbst gut und der Hund wird auch ruhiger. Siehst du, was sie sich für Sorgen um uns macht?«, sagte Doris und lächelte traurig. Wirklich war der Hündin anzusehen, wie sie mit uns mitlitt.
Dann piepte der Wasserkocher, Doris goss das kochende Wasser in die Teekanne, stellte sie zu den Tassen auf ein Tablett.
Ich stand mit dem Rücken zu ihr vor dem breiten Sideboard, auf dem Corinnas Espresso- und Kaffeemaschinen aller erdenklichen Alters- und Preisklassen nebeneinander aufgebaut waren. Enduro, La Cimbali, Jura … und wie die Marken alle hießen. Fast spürte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich ausgerechnet an diesem Tag im Begriff war, mit meiner Mutter Tee zu trinken, wo ich doch wusste, dass meinte Tante nicht nur aus beruflichen Gründen eine eingefleischte Aficionada gewesen war. Angesichts des Maschinenparks konnte man leicht an eine Art Altar denken. Corinna Waldeck huldigte, seit ich mich erinnern konnte, dem Kaffeetrinken wie ein Mitglied des Kartäuserordens Gott dem Herrn. Fast konnte ich ihre Stimme hören, als sie mir auf meine Frage erklärte: »Ich trinke so viele Espressi, Isa, weil es so wahnsinnig schwer ist, diesen einen Shot zu erreichen. Diesen einen Espresso, der einfach so unglaublich gut ist, und glaube mir, das ist wirklich eine Wissenschaft.«
So wie andere Briefmarken sammelten, konnte sie sich stundenlang mit dem Finetuning aus Maschine, Sorte, Röstung, Temperatur und allen weiteren Komponenten eines perfekten Espresso beschäftigen. Und doch hatte sie mich nie dazu überreden können, jemals einen zu probieren. Ebenso wie meine Mutter blieb ich überzeugte Teetrinkerin. Nun stand ich da und bedauerte es fast.
Doris trug das Tablett nach draußen auf die Terrasse, die von steinernen Pflanztrögen mit gelber und roter Kapuzinerkresse umgeben war. In der Mitte stand ein wettergegerbter, silbrig schimmernder Teaktisch, auf dem eine große Vase mit halb verblühten rosa Rosen dekoriert war.
»Ich hätte sie längst wegwerfen sollen …«, murmelte Doris, als sie meinen Blick auf die Blumen bemerkte. »Corinna wollte immer überall Blumen im Haus und sobald sie die Köpfe hängen ließen, mussten sie sofort verschwinden. Du weißt ja, wie sie war.«
»Ja, ich weiß, wie sie war«, sagte ich.
»Aber ich habe es bei diesen hier nicht übers Herz gebracht … und jetzt passen sie eigentlich ganz gut zur Stimmung.«
Wir setzten uns in die bequemen Korbstühle und ich legte tröstend meine Hand auf die meiner Mutter, strich über ihre weiche Haut. »Ich weiß, wie sehr du deine Schwester gebraucht hast. Sie war einfach auch so …«, nach dem richtigen Ausdruck suchend, kam ich nur auf: »… ein besonderer Mensch.« Schon als ich die drei Worte aussprach, merkte ich, wie unzureichend sie waren. Meine Tante Corinna war nicht mit knappen Worten zu charakterisieren! Ich sah, dass meine Mutter sich dennoch bemühte zu lächeln, es jedoch nicht fertigbrachte, und sagte leise: »Sie wird mir auch sehr fehlen.«
Das war womöglich die Untertreibung meines Lebens!
Doris war achtundsechzig, was man ihr normalerweise nicht ansah. Mit ihrer vollschlanken Figur, den weichen Zügen und der makellosen Kleidung war sie immer noch eine recht attraktive Frau. Natürlich hatte sie nie mit ihrer extravaganten Zwillingsschwester mithalten können, hatte es letztlich auch nie versucht. Corinna war Corinna, jeder, der sie hätte nachahmen wollen, wäre kläglich gescheitert. Vor allem den Momenten mit ihrer Schwester hatte Doris – da war ich mir sicher – in den letzten Jahren ihre eigene Lebenslust zu verdanken. Mein Vater hatte sie mithilfe eines ausgeklügelten Ehevertrags nach neununddreißig Jahren mit leeren Händen sitzen lassen, weil er sein Herz an eine zwanzig Jahre jüngere Frau verschenkt hatte (von der er inzwischen längst wieder getrennt war). Ich erinnerte mich gut an den Tag, als meine Mutter von der Scheidungsverhandlung zurückkam und mir die Worte des Richters wiederholte: Sie könne lesen, sie sei der deutschen Sprache mächtig und habe diesen Ehevertrag nach Belehrung durch einen Notar eigenhändig unterschrieben, nun müsse sie auch mit den Konsequenzen aus ihrem eigenverantwortlichen Handeln zurechtkommen!
»Das Einzige, was ich richtig gemacht habe, seid ihr und dass ich meinen Mädchennamen wieder angenommen habe«, hatte meine Mutter als Fazit gezogen und leise hinzugefügt: »Wobei ich mir bei Moritz nicht ganz darüber im Klaren bin, ob ich alles richtig gemacht habe.«
Corinna hatte Doris in der Notlage aufgefangen und ihren Absturz in die soziale Bedürftigkeit verhindert, die ich natürlich auch nicht zugelassen hätte. Aber Tante Corinna verfügte über weitaus mehr finanzielle Mittel als ich. Mein eigenes Architekturbüro hatte bisher kaum Gewinn abgeworfen, obwohl ich das Gefühl hatte, nahezu rund um die Uhr zu arbeiten. Die Teilnahme an Wettbewerben und Ausschreibungen verschlang Zeit und Ressourcen, ohne dass sie automatisch zu Aufträgen führten.
Jetzt senkte meine Mutter die Lider, als wollte sie den Schmerz über den Verlust in sich verschließen.
Corinna war nicht mehr da. Für den Rest ihres Lebens würde Doris in einer Welt leben müssen, in der es ihre Zwillingsschwester nicht mehr gab.
Ich schenkte uns beiden Tee in die Tassen mit dem roten Mäandermuster ein und dabei gingen mir tausend Fragen durch den Kopf. Eine wollte ich sofort beantwortet wissen: »Weißt du, wie es passiert ist? Corinna war doch kerngesund, oder nicht?«
Doris öffnete die Augen und antwortete leise: »Isabelle, glaube mir, das wüsste ich auch gern.«
»Wer hat dich überhaupt informiert?«
»Es war eine Frau aus dem Auswärtigen Amt, die mich angerufen hat und fragte, ob ich ihre Schwester sei, sie suchten Corinnas nächste Angehörige, fragte, ob sie verheiratet sei …« Doris unterbrach sich kurz. »… hat sich wohl ein wenig gewundert, als ich ihr einen Männernamen und zwei Frauennamen genannt habe … aber über die Todesumstände hat sie entweder nichts gewusst oder mir nichts sagen wollen.«
Ich erinnerte mich plötzlich daran, wie ich früher von Schulfreundinnen gelöchert wurde, die von dem feudalen Lebensstil Corinna Waldecks gehört hatten. »Deine Tante muss unglaublich reich sein«, hatten sie voller Ehrfurcht geraunt und gefragt, ob sie einmal zum Schwimmen kommen könnten. Erst im Nachhinein wurde mir bewusst, wie sehr wohl auch die gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften meiner Tante die Neugierde der Nachbarskinder anfeuerten. Corinna hätte natürlich jederzeit erlaubt, dass sie zum Schwimmen kämen, sie liebte Kinder, auch oder gerade weil sie selbst keine hatte. Aber zu dieser Zeit war sie mit Claudia zusammen. Diese wiederum konnte Kindergeschrei um sich herum absolut nicht ertragen, erst recht nicht, wenn sie sich auf einer der zwanzig Zentimeter dicken, gelb gestreiften Matratzen am Pool sonnte, was sie im Sommer meistens tat. Wenn ich an Claudia dachte, hatte ich sofort wieder ihr cremeglänzendes Gesicht in Erinnerung, das sie mit dem Ausdruck disziplinierter Pflichterfüllung in die Sonnenstrahlen hielt.
Da ich meine Tante natürlich von klein auf kannte, war mir weder die Tatsache, dass sie mit Frauen zusammen war (die zweijährige Ehe mit einem Mann bezeichnete sie im Nachhinein als Ausrutscher), noch ihr großzügiger Lebensstil ungewöhnlich vorgekommen. Sie war die Gründerin von Corinnas Kaffee & Tee. In den Achtzigerjahren hatte sie das Konzept des »Spezialitäten-Kaffees« in Deutschland eingeführt, indem sie hochwertige Bohnen aus aller Welt importierte und diese in ihren Geschäften frisch röstete. Damit hatte sie eine neue Ära des Kaffeekonsums in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeleitet und war zu einem beträchtlichen Vermögen gekommen.
Bei uns zu Hause ging es wesentlich bescheidener zu – mein Vater war Leiter einer kleinen Sparkassenzweigstelle –, doch keiner in meiner Familie schien Corinna ihren Reichtum zu missgönnen – keiner bis auf Moritz.
»Was ist eigentlich mit Moritz?«, fragte ich und spürte, wie mir ein nervöser Schauder über den Rücken lief, wenn ich an meinen jüngeren Bruder dachte. »Meinst du, man hat ihn auch schon informiert?« Doris’ Blick verfinsterte sich und drei senkrechte Falten erschienen oberhalb ihrer Nasenwurzel. Moritz würde bestimmt sofort zur Stelle sein, wenn nach Corinnas Tod etwas für ihn heraussprang. Der Gedanke ging uns beiden durch den Kopf, ohne dass wir ihn aussprachen.
»Ich glaube nicht, aber ausschließen kann ich es auch nicht.«
Ich konzentrierte mich und versuchte daran zu denken, was jetzt zu tun war, hoffte, dass der Aufruhr in meinem Kopf nachließe – sonst wäre ich meiner Mutter keine große Hilfe. Mir wurde klar … ja, als Erstes würde ich selbst mit der Mitarbeiterin vom Auswärtigen Amt sprechen müssen. Ich fragte: »Hast du denn noch die Nummer von der Dame, die dich angerufen hat?«
Im selben Moment klingelte das Telefon auf dem Tisch laut, schrill und ließ uns beide zusammenzucken. »Soll ich rangehen?«, fragte ich und Doris nickte.
Das weiße Handgerät ihres Festnetzanschlusses lag auf dem Tablett auf dem kleinen Beistelltisch. Meine Mutter nahm das Telefon immer mit, wenn sie im Garten war, und hatte es extra laut gestellt, um es auch in der hintersten Ecke des riesigen Grundstücks zu hören. Ich stand auf und drückte auf eine Taste.
»Bei Waldeck?« meldete ich mich. »Ja, ich bin ihre Tochter, Isabelle Weiss, meine Mutter sitzt hier neben mir.« Als Doris den Kopf schüttelte, sagte ich: »Aber sie ist nicht in der Verfas...«, ich unterbrach mich, denn das interessierte diese Dame sicher gar nicht. »… gerne können Sie auch mit mir sprechen.« Ich lauschte eine Weile und hob die Augenbrauen. »Und Sie sind vom Konsulat?« Die Stimme am anderen Ende der Leitung setzte zu einer langen Erklärung an, sodass ich gar nicht mehr genau hinhörte, bis die Dame den entscheidenden Satz sagte, der mich zusammenzucken ließ. Hatte ich richtig verstanden?
»Ein Kind?«, fragte ich und sah meine Mutter an, als könnte ich in ihrem Gesicht eine Erklärung finden, doch Doris starrte mich nur an.
»Wo ist es denn … ich meine, ist es ein Junge oder ein Mädchen … oh, nein, nein, nein, nicht nötig, ich melde mich …«
Ich verdeckte die Sprechmuschel mit der Hand und flüsterte meiner Mutter zu: »Corinna hatte eine Tochter, wusstest du davon?«
Meine Mutter saß da wie erstarrt. Es summte in der Leitung, klickte, dann sagte eine Mädchenstimme: »Guten Tag, ich bin Hannah.«
»Hannah?«
»Hannah Waldeck, Corinnas Tochter.«
Ich setzte mich auf einen Korbsessel, zog die Beine an und drückte den Hörer fest ans Ohr. Ich hätte eigentlich eine Weile gebraucht, um diesen neuen Umstand zu verdauen, doch die Dame vom Konsulat hatte »Corinnas Kind« einfach den Hörer weitergereicht.
»Von wo aus sprichst du, Hannah, es hört sich an, als wärst du direkt hier nebenan.«
»Vom Frankfurter Flughafen. Ich bin heute aus Tansania gekommen.«
Etwas in ihrer Stimme ließ mich aufhorchen. Obwohl sie ein Mädchen war, hatte der Singsang ihrer Sätze fast den gleichen Klang wie Corinnas Stimme. Aber vielleicht bildete ich mir das auch nur ein.
»Ich fliege in zwanzig Minuten weiter nach München. Könnten Sie mich vielleicht abholen? Ich weiß nicht, wo ich hinsoll. Ich habe sonst niemanden in München.«
»Was … was ist denn mit deinem Vater?«, fragte ich.
»Meinen Vater kenne ich nicht.«
»Oh!« Ich biss mir auf die Lippen. Eigentlich wunderte mich das bei all den Neuigkeiten, die heute auf mich einstürmten, am wenigsten. Schließlich hatte meine Tante, soviel ich wusste, schon lange keine Beziehungen mehr zu Männern gepflegt. In wenigen Sekunden baute sich in meinem Kopf ein Bild auf. Der Erzeuger hatte für sie vermutlich keinerlei Rolle gespielt. Aber dass sie uns eine so späte Schwangerschaft und das Kind verheimlicht hatten, traf mich tief. Gleichzeitig begann ich nachzurechnen. Corinna war achtundsechzig Jahre alt. Und wie alt war ihre Tochter? War das biologisch überhaupt noch möglich?
»Also, könnten Sie mich abholen?«, fragte die Mädchenstimme am Telefon ein wenig ungeduldig. Ich überlegte schon wieder und hasste mich sogleich für mein Zögern. Doch ich konnte nichts gegen meine widersprüchlichen Gefühle tun und merkte, wie sehr sich alles in mir sträubte, dass sich jemand in meine erst vor Kurzem wiedererlangte Privatsphäre drängte. Mein neues freies Leben, nachdem Alex sein Studium begonnen hatte und ausgezogen war.
»Oder ich könnte auch einen Bus nehmen, wenn Sie mir die Adresse sagen …«
Hannahs junge verletzliche Stimme ließ mich endlich aufwachen. Es ist ein Kind und es braucht Hilfe, du entsetzliche Egoistin!
Als ob ich das Mädchen damit beruhigen konnte, lächelte ich tröstend und aufmunternd. »Natürlich hole ich dich ab«, sagte ich mit fester Stimme und legte gleichzeitig Wärme hinein. »… und du kannst auch bei mir wohnen, schließlich bin ich deine …« Ja, was eigentlich? Ich suchte einen Moment lang nach dem richtigen Verwandtschaftsgrad »… Cousine.«
Ich klärte mit der Dame vom Konsulat den Treffpunkt am Flughafen, sie erläuterte mir umständlich, dass sie Hannah nicht selbst begleiten könne, sich aber eine Stewardess um sie kümmern werde, und als ich den Hörer sinken ließ, wurde ich von meiner Mutter sofort mit unzähligen Fragen bestürmt. Doris’ Gesicht hatte plötzlich wieder einen Hauch von Farbe. Ich beantwortete ihr alles – soweit ich konnte –, setzte mich, stand direkt wieder auf, starrte über die glitzernde Wasserfläche des Swimmingpools, in der sich die Sonnenstrahlen des Nachmittags spiegelten. Hier hatte sich seit meinem letzten Besuch in Corinnas Villa nichts geändert und doch sah mit einem Mal alles anders aus.
Moritz
Wer einmal im Jahr zum Tête-à-Tête der Rückversicherungsbranche nach Monte Carlo kam, führte fünfzig bis achtzig Gespräche in drei bis vier Tagen. Moritz war schon häufig dabei gewesen und er wusste genau, worum es ging. Nämlich darum, ein Gefühl für einen Markt zu bekommen, der von Vertrauen lebte – Vertrauen darauf, dass im schlimmsten aller anzunehmenden Fälle ein Rückversicherer mit Milliarden geradestehen würde, wenn ganze Landstriche verwüstet waren und wieder aufgebaut werden mussten.
Der Morgen in Monaco begann mit einer standesgemäßen Begegnung: Eine Frau, die aussah wie ein Filmstar, in einem Sweatshirt mit auffälligem Gucci-Logo und passenden Leggings, lag hingegossen auf einer Chaiselongue in der Hotellobby. Den Pomeranian auf ihrem Schoß fütterte sie mit Stücken der Canapés, die sie von einer Etagere auf dem Beistelltisch nahm und auseinanderbrach. Als ihr eines aus der linken Hand entglitt und auf den türkisfarbenen Perserteppich fiel, war Moritz mit schnellen Schritten bei ihr, hob es auf und wollte es dem Hund mit den Worten reichen: »Vous permettez, Madame.«
»Oh, das Stück ist viel zu groß«, antwortete sie auf Englisch. »Da verschluckt sich Coco nur!« Daraufhin teilte Moritz das winzige Canapé, von dem er jetzt erst realisierte, dass es offenbar ein Hundekuchen war, in noch kleinere Stücke und fütterte das Tier damit. Die Hundenase, die eher an die einer Maus erinnerte, fühlte sich angenehm trocken an, bemerkte er erstaunt, denn er war eigentlich kein Hundefreund. Die Frau quittierte es mit einem »very charminig«, Moritz setzte sein dezentestes Lächeln auf, zog sich aber unverzüglich zurück. Dabei genoss er das Bewusstsein, damit eine seiner legendären Duftmarken gesetzt zu haben.
Es war halb neun an einem strahlenden Junitag, als er die Lobby des einst modernen, jedoch in die Jahre gekommenen Fairmont-Hotels, das aufwendig auf einem Hügel über dem Meer gebaut war, durchquerte. Dabei hatte er, wie jedes Jahr, das Gefühl, ganz Monaco bestehe aus Marmor. Von schneeweißem Naxos-Marmor in den Badezimmern über grau gebändertem Carrara in den Edel-Shopping-Malls mit Versace- und Louis-Vuitton-Waren und roséfarbenem Berkowiza in den Foyers bis hin zu smaragdgrünem Cippolino im Casino (dessen Anblick ihm auch in diesem Jahr verwehrt bleiben würde) schien die Vielfalt in Farbe, Struktur und geografischer Lage aller Marmor-Steinbrüche der Welt auf den zwei Quadratkilometern von Monaco gebündelt worden zu sein.
Im Fairmont waren es großflächige Kacheln, protzig und unbescheiden. Doch sie tarnten einen lädierten Luxus. Alles war teuer, die Zimmer schlecht in Schuss, der cremefarbene Lack ihrer Türen von Wäschewagen malträtiert. Moritz hielt es hier nicht lange aus, dabei fungierte das Fairmont zwischen den vielen Terminen während des Treffens der Rückversicherer als logistisches Zentrum. Durch den geschickten Einsatz seiner Aufzüge ließen sich locker acht bis zehn Minuten Fußweg in brütender Sonne einsparen.
Die Loungemusik aus den gut getarnten Lautsprechern säuselte ununterbrochen – passiv-aggressiv. Auf der Terrasse ahmten sechs Endzwanzigerinnen die Übungen eines Coachs nach. Moritz blieb stehen und betrachtete sie der Reihe nach. Ihre Bewegungen sahen eingeübt aus, sie trugen hochwertige Sportdresses und die Sonne strahlte gerade so, dass ihr Frühsport nicht allzu anstrengend wurde. Melancholisch vor so viel Leichtigkeit schaute Moritz auf das blaue Meer und sogar er musste plötzlich daran danken, dass dies dasselbe Meer war, über das Menschen oftmals vergeblich versuchten, nach Europa zu kommen. Fehlte es dieser ausgestellten Sorglosigkeit womöglich an Kontrast, den sich der Geist dann selbst suchte?
Einmal im Jahr reiste er jeweils für drei Tage im Sommer in das Fürstentum. Der Höhepunkt in der Saison der internationalen Rückversicherungsszene. Moritz arbeitete seit zehn Jahren in der etwas verruchten Branche voller windiger Vertriebsspezialisten und smarter Mathematiker – zu Letzteren zählte er sich. Nach seinem abgebrochenen Mathematikstudium hatte er sich einige Zeit mit Wahrscheinlichkeitsrechnung im Glücksspiel über Wasser gehalten. Poker, Blackjack und Roulette hatten sein Leben bestimmt, bis er schließlich Hausverbot in nahezu jedem Casino Deutschlands und jedem zweiten Europas erhalten hatte und auf einer schwarzen Liste stand. Darauf folgten einige Jahre in der Logistikbranche, bis er sich für die wesentlich interessantere und besser bezahlte Tätigkeit bei einer Schweizer Versicherung entschieden hatte und schließlich bei der Munichre gelandet war.
Die Versicherer der Versicherer stachen aus der Branche heraus: Sie sicherten gegen Erdbeben, Pandemien, Florida-Stürme und Frakturen von Violinisten-Fingern ab.
Er hatte im Vertrieb begonnen und war dabei auf seine gesellschaftlichen und sozialen Fähigkeiten angewiesen. Internationales Parkett, mittags Poloshirt, abends Einstecktuch, perfektes Business-Englisch, das Champagnerglas geübt in der Hand. Zum Glück hatte er hierin mehr als genug Erfahrung, nicht zuletzt durch seine Casinovergangenheit. Er war groß, wenn auch derzeit nicht ganz so schlank, wie er es sich wünschte, sehr attraktiv, mit einem symmetrisch geschnittenen Gesicht und hatte sich eine offene und verbindliche Art zugelegt, die sein Gegenüber für ihn einnahm. Er verstand es, Komplimente zu machen und meisterlich Small Talk über die Lieblingsthemen seines Gesprächspartners zu führen. Mit Geduld und Charme, vor allem aber einer Intelligenz, als sei er ein bestens ausgebildeter Doppelagent, fiel ihm der Zugang zur besseren Gesellschaft leicht. Seine Münchner Empfindungsart, die Gewissheit, überall, wo er hinkam, erwartet zu werden, zu allen Gelegenheiten Tickets zu erhalten, die begehrtesten Plätze auf den Tribünen, Logen und Parketts der sportlichen, kulturellen und geschäftlichen Ereignisse einzunehmen, war sehr ausgeprägt. Moritz stand auf der Gästeliste der angesagten Events, war bei Flagship-Store-Eröffnungen und privaten Dinnerpartys dabei, wurde zum Skilaufen nach Kitzbühel und zum Wochenende an den Tegernsee eingeladen. Seiner Ansicht nach war alles unstreitig in die richtige Richtung gelaufen – bis er wieder angefangen hatte zu spielen und seine ausgereiften Stochastik-Kenntnisse beim Online-Poker einsetzte in der Gewissheit, aus dem Glücksspiel diesmal eine berechenbare Einnahmequelle zu machen. Guten Strähnen folgten Rückschläge, es fiel Fortuna, der Göttin der Hasardeure, ein, ihn zu verlassen, und Hermes, dem Gott der Diebe und Trickser, ihn auf die Hörner zu nehmen und durch die Luft zu wirbeln. Die Versuche, seine Schulden durch Mining und die Initiierung eines Pyramidenspiels zu tilgen, wirkten sich noch verheerender auf seine finanzielle Situation aus. So wurde man zu einem anderen Menschen: nüchtern, rechnend, bedrückt, vertuschend. Verlieren fraß große Löcher in das Bankkonto und ins Leben. Er hatte einfach nicht mehr genug. Er schien nirgendwo anzukommen, machte sich Sorgen wegen der Schulden, der verlorenen Zeit, Zeit, die zu schnell vorbeigegangen war und vorbeiging. Als er ausgerechnet hier an diesem klischeehaften Ort der Sorglosen daran dachte, erschienen tiefe Sorgenfalten auf seiner Stirn und seine Hände wurden feucht vor Nervosität. Gleichzeitig erfüllte ihn eine abgründige Leere.
Unterhalb des Felsens wogte das tiefblaue Meer unaufgeregt vor sich hin, als erste Badegäste sich in das laue Wasser trauten. Kaum Wellen, weicher Sand, hundertfünfzig Meter weit im Meer ein großer viereckiger Ponton, auf dem man sich sonnen und ausruhen konnte. Moritz trank seinen Espresso aus, strich sich mit Mittel- und Zeigefinger die beiden Falten über seiner Nasenwurzel glatt und ließ die Handfläche über die zurückgegelten Haare gleiten, ohne sie wirklich zu berühren – nur um zu prüfen, ob sie richtig lagen. In zehn Minuten begann der Kongress im Hermitage-Hotel und ihm war klar, dass er souverän und vertrauenswürdig wirken musste. Er straffte sich, hob das Kinn, entspannte bewusst seine Kiefermuskeln und Mundwinkel – und fühlte sich bereit.
Von Angesicht zu Angesicht mit einem Mitarbeiter der American International Group, einem Vertreter der Assicurazioni Generali sowie einem schmächtigen Mann mit fliehendem Kinn und schwarzem Polohemd, auf dem Maibach aufgestickt war, wandte sich das Gespräch der politischen Lage zu, die Moritz, Dick Collins und Maurizio Bianchi einvernehmlich mit maßvollem Optimismus bewerteten. Allerdings mache das komplexe Zusammenspiel von menschengemachten und natürlichen Faktoren, Waldbrände und Buschfeuer zu einer schwer greifbaren und vielerorts zunehmenden Gefahr.
»Ich sage nur vierundzwanzig Milliarden US-Dollar!«, schleuderte Collins in die Runde, und als er sich kurz umdrehte, leuchtete sein rosiger Nacken auf. Bianchi nickte. Zumindest ließen sich die Gefährdungszonen ziemlich eindeutig bestimmen. Der Klimawandel trüge aber zu einer Ausweitung bei. Moritz kräuselte unmerklich die Nase. Die Zahlen waren hinlänglich bekannt in der Branche und bedurften im Grunde keiner Erwähnung. Der Klimawandel war ein äußerst unbeliebtes Wort, das nur in Notfällen beim Namen genannt wurde. Der Maibachfahrer verzog keine Miene. Welcher Versicherung jeder Teilnehmer angehörte, war aufgrund der angesteckten Namensschilder normalerweise kein Geheimnis, doch dieser Mann trug keines, vielleicht, weil es sein Luxus-Logo verdeckt hätte. Sein Gesicht war braun gebrannt, einige Pigmentflecken auf Stirn und Wangen und der zurückweichende Haaransatz ließen auf ein Alter um die fünfzig schließen. Mit einem Mal deutete er auf Moritz’ Namensschild und sagte auf Deutsch: »Waldeck? Ich glaube, den Namen habe ich heute früh in den Nachrichten gehört.«
Seine Stimme nahm dabei etwas Mitleidvolles und zugleich Werbendes an. Moritz winkte ab und sagte kühl: »Möglich, die Familie ist weit verzweigt.« Er tat desinteressiert, dabei hatte er nach der Scheidung seiner Eltern alles darangesetzt, den Mädchennamen seiner Mutter – Waldeck – anzunehmen, was nicht ganz einfach gewesen war. Aber der Name öffnete Türen, die ihm unter dem Namen Moritz Isenburg zugeschlagen worden waren.
»Nein, nein, es ging um Corinna Waldeck, die Unternehmerin, da gab es wohl einen Unfall.«
Moritz war die Situation unangenehm, doch der Mann kam näher und legte ihm jetzt sogar die Hand auf den Unterarm. Sie war von reptilienhafter Glätte und Trockenheit. »Wenn das eine engere Verwandte ist, sollte ich Ihnen wohl mein Beileid aussprechen.«
Die beiden anderen zogen sich diskret zurück unter dem Vorwand, ihre Gläser neu füllen zu lassen, und Moritz fühlte ein scheußliches Prickeln am ganzen Körper. Die Neugier zwang ihn nachzufragen, obwohl ihm der Mann jetzt suspekt war. Er schluckte und sagte: »Was soll denn passiert sein?«
Dem Gesicht des Fremden war anzusehen, wie sehr er es genoss, ihm die Neuigkeit als Erster zu präsentieren. Dabei versuchte er, dieses Gefühl unter einer Anwandlung von Melancholie und einem spürbaren Bedauern zu verstecken, die seinem Ausdruck sogar eine gewisse Wärme verliehen.
»Handelt es sich etwa um Ihre Mutter, das wäre mir sehr unange...?«
Sofort schüttelte Moritz vehement den Kopf. »Nein, Corinna Waldeck ist meine Tante.«
»War!«, verbesserte ihn der Fremde rigoros. »Es hieß, sie sei vorgestern auf ihrer Farm in Afrika ums Leben gekommen.«
Moritz war auf eine jugendliche, naive Weise von seinen Worten getroffen. Seine Tante war tot. Er vermied es, den Mann anzusehen, denn er fühlte sich dem fremden Menschen schutzlos ausgeliefert, der ihm mitten auf einem wichtigen geschäftlichen Kongress eine private Familientragödie enthüllte.
Der Gegensatz seiner widersprüchlichen Gefühle zu der Umgebung, dem Marmor, dem aufwendigen Stuck, den Gemälden des Hermitage-Hotels, der Bläue des Meers hinter den Doppeltüren, die auf die Terrasse führten, hätte nicht schärfer inszeniert werden können. Moritz fühlte sich herausgefordert. Während der Fremde, der ihm im Grunde nur eine öffentlich zugängliche Nachricht mitgeteilt hatte, ihn immer noch unverhohlen musterte, musste Moritz Contenance bewahren. Und das, obwohl sein kluges Hirn bereits begann zu arbeiten. Die Lebenserfahrungen, die er unter anderem in den Casinos Europas gesammelt hatte, wiesen eben Lücken auf, wie es mit Erfahrungen stets ist, denn sie stellen sich nicht in systematischer Reihenfolge ein.
Noch immer stand der Mann vor ihm, schien Moritz’ leise Verlegenheit zu genießen und sagte: »Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Möchten Sie sich vielleicht setzen? Brauchen Sie ein Glas Wasser, Herr Waldeck?«
Moritz fühlte einen Widerwillen gegen die Herablassung, die in seiner Stimme spürbar wurde, obwohl der Fremde Hilfsbereitschaft vorgab. Er schüttelte den Kopf und hielt sein gefülltes Glas demonstrativ in die Höhe wie eine Deckungswaffe, doch dann murmelte er: »Entschuldigen Sie mich«, drehte sich um und verließ den Saal.
Isabelle
Meine Mutter und ich trafen um zwanzig vor vier am Münchner Flughafen ein. Wir fanden einen Kurzzeitparkplatz vor dem Terminal 2 und stiegen aus dem Wagen. Es war klar, dass wir Hannah zusammen abholen würden. Zu groß war unsere Neugier auf das unbekannte Mädchen, auf die Tochter von Corinna.