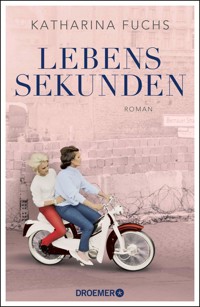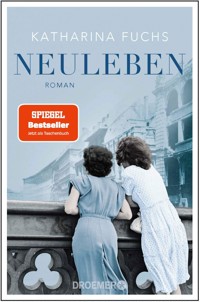9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei starke Frauen – zwei deutsche Schicksale Und die Geschichte des Berliner Kaufhauses KaDeWe in einem anrührend authentischen historischen Roman Deutschland 1914: Charlotte wächst auf dem archaischen Landgut ihres mächtigen Vaters in Sachsen auf. Die Welt scheint ihr zu Füßen zu liegen, als sie von ihrer Tante und deren jüdischem Ehemann in die Leipziger Ballsaison eingeführt werden soll. Sie begegnet ihrer ersten Liebe. Doch der Beginn des ersten Weltkriegs zerstört ihre Pläne. Und ihr Leben verändert sich für immer. Gleichzeitig gelingt es Anna, zwischen den Wasserstraßen des Spreewalds, wo Verzicht und harte Arbeit erfinderisch machen, dem Schicksal immer wieder ein Schnippchen zu schlagen. Doch sie verkennt die tiefe Liebe ihres besten Freundes, bevor er an die Westfront zieht. An einem eiskalten Tag im Februar 1919 steigt die neunzehnjährige Schneiderin alleine in den Zug nach Berlin. In den engen Hinterhöfen des Wedding prallen Hunger und Armut auf den ungezügelten Lebensdurst der beginnenden zwanziger Jahre. Und im Konsumtempel KaDeWe sucht man Verkäuferinnen … Anna und Charlotte werden sich erst 1953 in Berlin begegnen. Hinter ihnen liegen zwei Weltkriege und ihr deutsches Schicksal. Es ist die Ehe ihrer Kinder, die die beiden ungleichen Frauen zusammenführt, und eine tiefe Verbundenheit durch denselben Schmerz, den sie noch nie zuvor einem anderen Menschen anvertraut haben. »Es ist das vergessene Leben der Frauen, in dieser ganz besonderen Zeit, die bis heute nachwirkt, das ich zu Papier bringen wollte. Es wurde so lange totgeschwiegen. ›Zwei Handvoll Leben‹ lässt es uns spüren.« Katharina Fuchs Katharina Fuchs erzählt in ihrem historischen Roman nicht nur ein Stück deutsche Geschichte aus der Perspektive der Frauen – es ist die Geschichte ihrer eigenen Großmütter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 809
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Katharina Fuchs
Zwei Handvoll Leben
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Deutschland 1914: Die 15-jährige Anna beginnt im Spreewald ihre Schneiderlehre. Zur selben Zeit wird die Gutsherrentochter Charlotte von ihrer Tante und deren jüdischem Ehemann in die Leipziger Ballsaison eingeführt. Ohne es zu ahnen, begegnen beide der Liebe ihres Lebens und treffen Entscheidungen, die sie bereuen werden. Doch zwei Weltkriege schreiben ihr eigenes Drehbuch und reißen ihre Familien immer wieder auseinander. Begegnen werden sich Anna und Charlotte erst 1953 in Berlin, zusammengeführt durch die Ehe ihrer Kinder – und verbunden durch denselben Schmerz, den sie erst einander wirklich offenbaren können.
Inhaltsübersicht
Vorwort
Erstes Buch
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Zweites Buch
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna
Charlotte
Anna und Charlotte
Vorwort
Dies ist die Geschichte meiner Großmütter, die beide in der dritten Oktoberwoche des Jahres 1899 geboren wurden. Die Mutter meiner Mutter, Anna Tannenberg, in einem kleinen Ort im Spreewald, und die Mutter meines Vaters, Charlotte Feltin, auf einem Hofgut in Sachsen. Rund fünfundvierzig Jahre später sollte Deutschland in Trümmern liegen. Doch davon ahnten meine beiden Großmütter nichts, als sie heranwuchsen, zur Schule gingen, Berufe erlernten, sich verliebten, Familien gründeten. Sie folgten falschen Vorbildern, verloren alles, bauten es wieder auf und hatten Hoffnungen, Sehnsüchte, wie wir alle sie haben. Und als sie sich im Nachkriegsberlin trafen, verband sie nicht nur die Ehe ihrer Kinder, Gisela und Felix, die Wohnungsnot und Annas Hilfsbereitschaft, sondern das verblüffende gegenseitige Geständnis einer unerfüllten Liebe.
Erstes Buch
Anna
Das Eis war an dieser Stelle besonders glatt, und Anna konnte hier schneller fahren als auf den anderen Kanälen der Spree. Sie nahm Anlauf, um die maximale Geschwindigkeit zu erreichen, stellte dann einen Fuß vor den anderen und genoss das Gefühl, einfach nur bewegungslos dahinzugleiten. Die klitzekleinen Unebenheiten in der Eisfläche ließen ihre Beine kaum merklich vibrieren. Kurz bevor sie zum Stehen kam, fuhr sie einen Halbkreis, holte neuen Schwung und fuhr die gleiche Strecke zurück, wieder und wieder. Sie legte den Kopf nach hinten. Es hatte angefangen zu schneien, und die Flocken flogen Anna in die Augen, manche blieben in ihren Wimpern hängen. Einige ließ sie sich auf der Zunge zergehen und spürte ihrem Geschmack nach.
Durch den bedeckten grauen Himmel gelangte kaum Helligkeit, aber es musste längst Frühstückszeit sein. Der Gedanke an Rückkehr drang langsam in Annas Bewusstsein. Am liebsten hätte sie ihn beiseitegeschoben und wäre einfach weitergefahren. Es war der Morgen des 24. Dezember 1913, und Wilhelm hatte ausgerechnet an diesem Tag Geburtstag. Zu der morgendlichen Bescherung wurden alle sechs Kinder vollzählig erwartet. Noch in der Dunkelheit war Anna aufgebrochen, um wenigstens eine Stunde zum Eislaufen zu kommen, bevor sie den Rest des Tages im Haus würde helfen müssen.
Sie machte sich auf den Nachhauseweg über die Kanäle, die sich wie ein engmaschiges Netz durch den gesamten Spreewald zogen. An einer schmalen Stelle ragte ein im Eis festgefrorener Ast hervor. Durch die dünne Neuschneedecke bemerkte Anna ihn zu spät. Sie stolperte, konnte sich zwar noch mit den Händen abfangen, aber beim Aufstehen erklang plötzlich ein Geräusch von reißendem Stoff, und der Schreck ließ sie zusammenzucken. Mit fahrigen Bewegungen suchte sie nach dem Riss in ihrem langen Rock, um das Ausmaß des Schadens abschätzen zu können. Er reichte vom Saum bis zur Mitte der Wade und war nicht etwa an der Naht, sondern mitten im Stoff. Das sah übel aus, und es wurde ihr trotz der Kälte plötzlich heiß bei dem Gedanken an ihre Mutter. Es half aber nichts, sie musste weiter, und vielleicht würde sich die Gelegenheit ergeben, den Rock unauffällig von ihrer älteren Schwester Emma nähen zu lassen, bevor die Mutter den Riss bemerkte. Emma war schon im dritten Jahr ihrer Schneiderlehre. Wenn sie Glück hatte, könnte Anna durch ihre Geschicklichkeit einer Strafe entgehen.
Sie lief weiter. Da vorne war schon die letzte Brücke in Sicht. Am Ufer stützte sie sich mit einer Hand auf einen Baumstamm und schnallte sich keuchend die Eiskufen von ihren Stiefeln. Nun nur noch die Böschung hinauf und über die kleine Holzbrücke, an deren Geländer große Eiszapfen hingen. Anna hatte keine Zeit mehr, sonst hätte sie sich den schönsten abgebrochen und gelutscht. Als sie um die Ecke bog, vorbei an den drei großen Trauerweiden, sah sie bereits die Anhöhe, die Hasen- und Gänseställe. Dahinter das winzige Haus, ihr Elternhaus mit dem unregelmäßigen Schieferdach, jetzt von Schnee bedeckt, unter dem sich die zwei Schlafkammern befanden.
In der offenen Haustür stand ihr Vater und hielt bereits nach ihr Ausschau. Er hatte seine Taschenuhr in der Hand, auf die er so stolz war, und schüttelte langsam den Kopf. Das volle dunkle Haar war an den Schläfen schon früh grau geworden. Auffällig seine fast schwarzen, dichten Augenbrauen und die etwas zu große Nase. Philipp Tannenberg wollte sich gerade wieder umdrehen, als er Anna um die Ecke biegen sah.
»Anna, wo hast du so lange gesteckt? Alle warten auf dich! Musst du eigentlich immer die Letzte sein?«
Er legte ihr den Arm um die Schultern und zog sie in das Haus. Im Flur war bereits die gesamte Familie versammelt. Nur die Mutter fehlte.
Annas Keuchen war in der Stille deutlich zu hören. Sie stellte sich neben ihren Brüdern auf, und sofort traf sie ein Faustschlag in die Rippen. Er war so fest, dass ihr die Luft wegblieb und sie sich vor Schmerzen zusammenkrümmte.
Unterdrücktes Lachen.
Ihre kleine Schwester Dora presste sich an sie. Sie liebte und bewunderte Anna, und es machte ihr Angst, wenn ihr Bruder Otto immer auf sie losging. Ihr Vater wollte etwas sagen, doch da ging die Tür zur Küche auf, und ihre Mutter erschien, legte den Finger auf die Lippen und fing an zu singen: »Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen …«
Der Vater fiel mit seiner tiefen Bassstimme ein. Der Rest der Familie sang jetzt auch. Heimlich boxte Otto Anna noch mehrmals kräftig gegen den Oberarm, aber sie krallte ihm diesmal ihre Fingernägel tief in die Haut.
Wilhelm konnte seine Enttäuschung nur schwer verbergen, als er sein einziges Geschenk bekam: Es war eine Lederschürze, die er bei seiner Arbeit als Schlosser tragen würde. Und natürlich nicht die Trompete, die er sich so sehnlich gewünscht hatte. Aber ein Musikinstrument war für ihre Eltern unerschwinglich.
Die anderen Geschwister waren immer noch ungeduldig, denn sie warteten auf den Kuchen.
»Bekomme ich das erste Stück?«, bettelte die kleine Dora und kaute schon ungeduldig auf dem Ende von einem ihrer brünetten Zöpfe.
»Zuerst das Geburtstagskind. Aber heute gibt’s für jeden ein Stück.«
Ihre Großmutter hatte die ganze Zeit in ihrem schwarzen Kleid zusammengesunken auf der Bank an dem Kachelofen gesessen. Jetzt stand sie mit sichtbarer Mühe auf. Sie stützte sich mit einer Hand den Rücken ab und stöhnte vernehmlich, wobei sie, wie alle wussten, immer ein Stück Theatralik in ihre Gesten legte. Dann griff sie sich ein großes Messer aus der Schublade und begann, den Kuchen in gleich große Stücke zu schneiden. Die Hände der Kinder langten blitzschnell nach den abbröckelnden Stücken Zuckerguss. So schnell, dass die Hand der Großmutter sie nicht rechtzeitig erwischte, als sie, mehr spaßeshalber, nach ihnen schlug. Dann tippte sie sich mit dem Finger an ihre faltige, pergamentartige Wange. Sie wussten, was das hieß: Jedes Kind sollte ihr zuerst einen Kuss darauf geben, bevor es ein Stück des Kuchens erhielt, der sofort gierig aus der Hand gegessen wurde.
»Nun ist aber Schluss!«
Ihre Mutter klatschte in die Hände.
»Heute ist Weihnachten, und es gibt noch viel zu tun. Max, du kannst das Holz hacken. Und geh dazu am besten in den Schuppen, sonst ist es nachher zu feucht, bei dem Schnee, der gerade wieder herunterkommt. Wilhelm und Otto dürfen mit Vater im Wald den Christbaum holen.«
Und zu den drei Mädchen gewandt sagte sie: »Euch brauch ich in der Küche.«
Sie sah Anna in die Augen und hob den Zeigefinger: »Und mit dir habe ich später noch ein Hühnchen zu rupfen.«
Anna erwiderte zunächst den strengen Blick ihrer Mutter und senkte dann den Kopf, um vorsichtig nach hinten zu schielen. Hatte sie den Riss in ihrem Rock schon bemerkt, oder war sie nur über ihre Verspätung so verärgert? An Heiligabend würde es doch keine der ganz strengen Strafen geben?
Bei ihrer Mutter konnte sie sich da allerdings nicht sicher sein, und sie begann sich rasch mögliche Ausreden auszudenken. Was hätte sie unterwegs aufhalten können? Der Schäferhund des Schusters hätte sie verfolgen können, das war ihr schon mal passiert, als er sich von der Kette losgerissen hatte. Damit wäre der Riss im Kleid auch erklärt. In den meisten Fällen war Anna in dieser Beziehung sehr erfindungsreich. Nur nützte ihr das nicht viel, da ihre Mutter allem unerbittlich genau auf den Grund ging. Anna wusste das, und sie wusste auch, dass sich ihre Mutter über eine Ausrede weit mehr ärgerte – mit den entsprechenden schmerzhaften Konsequenzen – als über jegliche Verfehlung, die damit vertuscht werden sollte. Trotzdem konnte Anna der Verlockung selten widerstehen, es immer wieder mit überraschend unglaubhaften Entschuldigungen zu versuchen.
»Wann gibt es die Gänsekleinsuppe?«, fragten jetzt die Jungen.
»Geht ihr erst einmal euren Arbeiten nach, ihr habt ja gerade Kuchen bekommen«, lautete die Antwort.
Sie rannten aus der Küche. Wilhelm griff sich noch das letzte Stück und würdigte sein Geschenk keines Blickes mehr. Er setzte all seine Hoffnungen auf den Heiligen Abend. Mit dem Vater den Christbaum zu schlagen stand an, und das war sein Privileg. Zumindest den einen Vorteil hatte es, an Weihnachten Geburtstag zu haben.
Anna holte sich eine weiße Schürze vom Haken an der Küchentür. Endlich reichte sie an ihn heran, ohne hochspringen zu müssen. Sie war vierzehn Jahre alt, drei Jahre jünger als ihr ältester Bruder Wilhelm, der heute seinen Geburtstag hatte. Im letzten Jahr war sie so gewachsen, dass ihr plötzlich kein Kleid mehr passte und sie fast alle gleichaltrigen Kinder und auch ihren besten Freund Erich überragte.
Die Großmutter hatte den Küchentisch leer geräumt, und Mutter stellte einen Korb mit Kartoffeln auf den Tisch.
»Hier, Anna, schäl sie aber schön dünn, hörst du? Und die Augen sorgfältig ausstechen. Und Dorle kann dann schon mit dem Reiben anfangen.«
Mutter nahm ein großes Messer aus der Schublade.
»So, Emma, komm mit, jetzt geht’s ans Schlachten.«
Ohne ein Wort folgte Emma ihrer Mutter, die mit einer Emaille-Schüssel und dem Messer aus der Küche ging. Anna und Dora konnten nachfühlen, was in ihr vorging: Gänse zu schlachten, war für sie alle drei immer die widerwärtigste Arbeit. Beide machten sich an ihre Aufgaben, aber dann hörten sie von draußen das laute Gezeter der Gänse und pressten sich die Hände auf die Ohren.
Kurz darauf kamen die Mutter und Emma mit zwei toten Tieren in der Schüssel zurück. Wortlos nahm die Großmutter einen Kessel mit kochendem Wasser vom Herd und übergoss die Gänse damit. Dann setzte sie sich wieder auf ihren Platz am Ofen und begann eine der Gänse zu rupfen.
»Oh Mutti, bleibt dieses Jahr auch eine Gans für uns übrig?«
Anna lief bereits das Wasser im Mund zusammen, wenn sie an die knusprige Haut dachte. Der Ekel vor dem Schlachten war schnell wieder verflogen. Sobald das Tier tot war, sah Anna es nur noch als etwas Essbares – und in diesem Fall sehr Wohlschmeckendes an. Das Zwiespältige an dieser Haltung ahnte sie zwar, aber sie hätte nie freiwillig beim Schlachten geholfen. Ihre Mutter nahm darauf Rücksicht, da sie sie im Moment noch mehr der Welt der Kinder zurechnete als der der Erwachsenen.
Schon seit Tagen zog nun der Bratenduft durch das ganze Haus.
Aber die Mutter zerstörte ihre Hoffnungen.
»Ach, Anna, du weißt doch! Die Gänse sind alle bestellt. Diese hier ist für den Pfarrer. Wir behalten nur die Innereien und die Flügel. Das gibt zusammen mit den Klößen und dem eingelegten Rotkohl aber auch ein gutes Essen. Und Anna«, fuhr sie fort, »in Zukunft kommst du pünktlich nach Hause. Du weißt, dass wieder alle auf dich warten mussten. Wenn das noch einmal vorkommt, bekommst du Stubenarrest. Hast du das verstanden?«
Anna war erleichtert. Trotzdem öffnete sie den Mund, um ihre zwischenzeitlich vorbereitete Ausrede loszuwerden, aber ihre Mutter gab ihr hierzu erst gar keine Gelegenheit: »Geh fort, Anna, heute habe ich wirklich überhaupt keine Zeit für deine Geschichten. Mach jetzt deine Arbeit und bessere dich!«
In diesem Moment hörten sie Annas Vater, laut singend, aus dem Wald zurückkommen. Anna und Dora warfen Messer und Reibe auf den Tisch, stürzten zum Küchenfenster und rissen es auf: »Vati, Vati, das ist aber wirklich der schönste Christbaum, den wir je hatten. Dürfen wir beim Baumputzen mithelfen?«
»Anna, machst du wohl das Fenster zu, ich hol mir ja den Tod!«, krächzte ihre Großmutter und bekam einen ihrer ausgiebigen Hustenanfälle. Anna schloss das Fenster mit einem Krachen und rannte in den Flur, um ihren Vater zu begrüßen.
Um fünf Uhr am Nachmittag brach die Familie zur Christvesper in die Vetschauer Kirche auf. Nur Emma und Wilhelm hatten sich schon früher auf den Weg gemacht, um sich für das Krippenspiel umzuziehen, bei dem sie dieses Jahr mitspielten. Das Schneetreiben hatte aufgehört, und die Kinder freuten sich über den frischen Schnee, der allerdings so pulvrig war, dass sich daraus keine Schneebälle formen ließen. Man konnte ihn sogar deutlich riechen, fand Anna, soweit er nicht durch den Duft nach Holzkohlefeuer überdeckt wurde. Sie genoss diese herrliche Mischung aus Ungeduld und Vorfreude und dem Gefühl, jeden Augenblick festhalten zu müssen. Sie wollte eigentlich sagen: Bitte jetzt hier anhalten, das möchte ich noch ein paar Minuten oder auch ein paar Stunden ganz und gar auskosten – aber eigentlich kann ich gar nicht mehr warten, und es soll jetzt ganz schnell weitergehen!
In der Kirche waren es diese Geräusche, als die Gesangbücher zugeschlagen wurden, das Rascheln vom Stoff der Mäntel, ein kleines Kind, das laut zu heulen begann und dann, von seiner Mutter beruhigt, plötzlich wieder verstummte, als diese kurze vollkommene Stille eintrat, bevor der Pfarrer die Weihnachtsgeschichte vortrug. Anna und Dora hielten sich an den Händen, während sie den vertrauten Worten lauschten.
Wenn ich doch die Zeit stillstehen lassen könnte!, dachte Anna.
Auch der Heimweg hatte seinen ganz besonderen Zauber. In manchen Fenstern sah man bereits brennende Christbaumkerzen und dazu die Silhouetten der Menschen wie Scherenschnittfiguren.
Und dann war es endlich so weit. Wieder versammelten sich alle Kinder mit dem Vater im Flur, der diesmal ganz dunkel war. Dora und Otto, die beiden Jüngsten, hatten zusammen ein Gedicht aufgesagt, indem jeder abwechselnd eine Zeile vortrug.
Danach wurden Weihnachtslieder gesungen, bis endlich die Tür zur Küche aufging. Der Weihnachtsbaum war mit Kugeln und Lametta behängt und von Kerzen erleuchtet, die schon das Jahr über gesammelt worden waren. Darunter und daneben lagen die Geschenke: Doras alte Puppe hatte einen neuen Matrosenanzug, natürlich von Emma aus Stoffresten selbst genäht. Für die Jungen gab es eine Werkbank mit einigem Werkzeug, das der Vater nicht mehr brauchte oder eigens für sie hergestellt hatte.
Anna sah schon von Weitem, dass sie ein neues Kleid bekommen hatte, aus einem schönen, dunkelblauen Wollstoff, den sie allerdings irgendwo schon einmal gesehen hatte. Sie kam nur im Moment nicht darauf, wo. Es hatte einen kleinen weißen Kragen, den man abknöpfen konnte. Sie nahm es vorsichtig hoch und hielt es sich an. Der Stoff war ein bisschen kratzig, aber es würde ihr bestimmt gut stehen. Als sie sich umsah, bemerkte sie, dass ihre Mutter sie beobachtete. Sie sah müde aus, ihre Augen hatten keinen Glanz, aber ihre Haare waren noch genauso sattbraun und füllig wie ihre eigenen. Sie legte Anna die Hand auf die Schulter.
»Emma hat es für dich genäht. Dir passt ja nichts mehr, wirst jetzt erwachsen. Für den nächsten Herbst werde ich dir eine Lehrstelle suchen.«
Anna lächelte, aber in ihr Bewusstsein drang das schmerzliche Gefühl, dass jetzt der Höhepunkt des Glücks erreicht war und in wenigen Sekunden überschritten sein würde.
Sie sah zu ihrem Bruder Wilhelm hinüber. Er bemühte sich, Freude vorzutäuschen. Natürlich hatte er die Trompete nicht bekommen. Die Eltern hätten das Geld dafür nun einmal nicht aufbringen können, und er musste sich mit den Werkzeugen, die für alle drei Jungs gemeinsam gedacht waren, begnügen. Doch er interessierte sich für Musik und hatte kein Handwerk lernen wollen wie die anderen.
Als sich alle gemeinsam zum Essen an den Küchentisch setzten, sprang der Funke auch auf Wilhelm über, und er ließ sich von der Stimmung der anderen anstecken. Die Gänseflügel und -innereien mit Rotkraut und Klößen waren das Beste, was sie seit Langem gegessen hatten, und es gab heute genug für alle. Anna sah von ihrem Teller auf, hörte auf zu kauen und betrachtete nacheinander ihre Geschwister und ihre Eltern. Sie waren arm, ihre Mutter war streng, und ihre Brüder ärgerten sie jeden Tag. Trotzdem liebte sie jedes einzelne Familienmitglied, am meisten natürlich ihren Vater und Dora. Doch auf einmal hatte sie das Gefühl, als habe ihr jemand einen Stahlring um die Brust geschnallt. Bei jedem Atemzug zog er sich enger zusammen. In diesem Augenblick wusste sie, dass es für sie kein unbeschwertes, gemeinsames Weihnachten mehr geben würde.
Charlotte
Auch auf dem Hofgut Feltin saß die Familie am Weihnachtsabend 1913 zusammen. ›Neunerlei‹ war das traditionelle sächsische Essen an Heiligabend. Ein Salat, der aus genau neun Zutaten hergestellt wurde: Kartoffeln, Sellerie, Zwiebeln und Hering gehörten immer dazu. Die vierzehnjährige Charlotte war davon wenig begeistert. Aber um ihren Vater nicht zu verärgern, überwand sie ihre Abneigung und ließ sie sich nicht anmerken.
Sie war mit ihren Geschenken dieses Jahr sehr zufrieden und hatte jeden Grund dazu. Auch sie hatte ein neues Kleid bekommen, dazu noch zwei Paar neue Stiefel, drei Bücher, Garne und einen Stickrahmen.
Der Tisch des Speisezimmers war mit einem Damasttischtuch bedeckt, das von Charlottes Großmutter in wochenlanger Arbeit mit feiner weihnachtlicher Lochstickerei verziert worden war. Darauf waren das Meissener Service mit dem grünen Hofdrachen und das Silberbesteck gedeckt. Charlotte hatten es besonders die Messerbänkchen in Tierform angetan, die aussahen, als würden sie im langgestreckten Galopp über den Tisch springen. In der Mitte des Tisches stand die blaue Pyramide mit Holzspanbäumchen, auf der sich geschnitzte Holzengel mit Musikinstrumenten drehten. Der Weihnachtsbaum, eine Edeltanne, dicht und gleichmäßig gewachsen, kam aus dem eigenen Wald.
»Irgendetwas fehlt dieses Jahr im Neunerlei.«
Charlottes Vater verzog die Mundwinkel nach unten. Seine Frau sah alarmiert zu ihrer Mutter hinüber, die sofort aufhörte zu kauen und tief einatmete. Wenn dem Familienoberhaupt etwas nicht passte, stand meistens einer seiner berüchtigten Wutanfälle bevor.
»Was sollte da fehlen, Richard?«, fragte ihn seine Frau.
»Wir haben den Salat mit den gleichen neun Zutaten zubereitet wie zu jedem Heiligabend. Frag deine Mutter, sie hat ja mitgeholfen.«
»Frag deine Mutter, frag deine Mutter … Ich brauch nicht meine Mutter zu fragen, um zu merken, dass hier etwas nicht stimmt. Das schmecke ich, und damit basta.«
Richard warf seine Serviette auf den Teller und sprang auf. Sein Gesicht nahm eine gefährliche Röte an.
»Drei Weibsleute sind nicht in der Lage, zu Weihnachten ein Neunerlei zuzubereiten, wie es sich gehört. Da vergeht einem doch der Appetit.«
Alle wussten, dass es keinen Sinn hatte, ihn zu beschwichtigen. Jedes Wort, das jetzt fiel, würde ihn nur weiter provozieren, und was dann passieren konnte, war völlig unberechenbar.
Auch Charlotte war ihr Vater in diesem Augenblick unheimlich. Sie hatte den Hieb mit der Reitgerte, den sie bei seinem letzten cholerischen Anfall abbekommen hatte, nicht vergessen. Um ein Haar hätte er sie mit aller Wucht im Gesicht getroffen, wenn sie sich nicht blitzschnell geduckt hätte. Doch sie hatte das Zischen, mit dem die Gerte ihre Haare gestreift hatte, jetzt noch im Ohr. Und das nur, weil sie vergessen hatte, abends die Laterne im Marstall zu löschen.
Aber in diesem Moment hatte sie den vermeintlich rettenden Einfall. »Könnten wir das Neunerlei nicht einfach auslassen und gleich den Schokoladenpudding bringen? Der schmeckt dir doch immer.«
Es folgte ein bedrohlicher Augenblick der Ruhe, während dem nur das Ticken der Standuhr zu hören war. Charlotte traute sich nicht, ihren Vater anzusehen. Alle hielten den Atem an, keiner sagte ein Wort. Richard starrte seine Tochter an, die Lippen leicht geöffnet. Aber für ihn waren ihre Worte tatsächlich ein Rettungsanker, der ihm aus der Hilflosigkeit, in die der aufwallende Zorn ihn jedes Mal versetzte, heraushalf. Er ließ sich umstimmen, aber nicht ohne einen Satz zu äußern, der seine Frau verletzen sollte: »Ja, du hast recht, Lotte, den Fraß können die Schweine kriegen. Das Mädchen soll den Nachtisch bringen, vielleicht werden wir ja davon satt.«
Damit setzte er sich wieder an den Tisch und sah die anderen an, als wäre gar nichts vorgefallen.
Charlottes Mutter Lisbeth atmete tief durch, so erleichtert war sie. Sie stand auf und griff nach der Kristallschüssel. Richard schien vergessen zu haben, dass Heiligabend der einzige Tag im Jahr war, an dem das Dienstpersonal freihatte, um selbst Weihnachten zu feiern. Zuvor hatte Lisbeth jedem von ihnen, feierlich unter dem Baum, ein Geschenk überreicht, das sie mit großer Sorgfalt ausgewählt hatte. Sie ging in die Küche, um die Nachspeise zu holen. Mit einem Löffel probierte sie noch einmal den Salat und runzelte die Stirn. Ihr fiel beim besten Willen nicht ein, welche Zutat fehlen sollte, wenn überhaupt eine vergessen worden war. Aber das Klügste war gewiss, das Thema gar nicht mehr anzuschneiden. Sosehr sie unter den plötzlichen Wutanfällen ihres Mannes litt, sie hatte gelernt, damit umzugehen. Meistens vergaß er von einer Sekunde auf die andere den Grund seines Ärgers und kam auch selten noch einmal auf den Anlass zurück. Sie hatte zu Beginn ihrer Ehe stets lange darüber nachgegrübelt, was sie falsch machte. Aber ihre Schwiegermutter Wilhelmine hielt zu ihr und war eine Verbündete, wenn es darum ging, mit diesem schwierigen Charakterzug ihres Sohnes umzugehen.
»Lisbeth, am besten ist es, sich ruhig zu verhalten und zu warten, bis das Gewitter vorbeigezogen ist. Und dann ist das Ganze schnell wieder vergessen. Richard hat mit dieser Toberei angefangen, als er zwei Jahre alt war, und er hat nie mehr damit aufgehört. Du wirst ihn nicht ändern können.«
Die Familie saß wieder zusammen am Tisch und löffelte den Schokoladenpudding. Die Stimmung unter den Frauen war angespannt. Sie wussten, dass selbst ein nichtiger Anlass bei Richard einen neuen Wutanfall hervorrufen konnte. Charlotte hielt ihre Schale hoch und wollte sich noch einen Nachschlag geben lassen, als plötzlich die Tür geöffnet wurde. Lisbeth ließ vor Nervosität ihren Löffel fallen.
»Leutner, was gibt es denn?«, knurrte Richard.
Leutner war die gute Seele des Hofguts und hatte schon lange vor Charlottes Geburt in den Diensten der Feltins gestanden. Die Schultern voller Schnee, die Kappe in der Hand und so außer Atem, dass er kaum sprechen konnte, betrat er das Speisezimmer: »Herr Feltin, die Berta, sie will kalben. Ich wollt eben noch mal nach ihr sehen, und da hab ich sie schon im Hof schreien gehört. Der Schweizer ist schon bei ihr. Ich glaub, das ist so weit.«
»Ja zum Donnerwetter noch mal! Hätte die dumme Kuh nicht noch einen Tag warten können? Nicht mal am Heiligabend lassen einen die Viecher in Ruhe. Ich komm ja schon. Lotte, lass den Pudding stehen. Du wolltest doch dabei sein, wenn die Berta ihr erstes Kalb kriegt.«
Charlotte stellte ihre Schüssel wieder ab. Sie wusste, dass sich ihr Vater in Wirklichkeit auch auf die Geburt freute und ihm Weihnachten nicht allzu wichtig war. Die Geburt eines Kalbs war immer wieder etwas Besonderes.
»Wenn das Kalb noch vor Mitternacht kommt, wird es ein Christkind.«
Richard lachte auf.
»Ein Christkalb.«
»Was redet ihr denn da. Ihr Frevler!«, schimpfte Wilhelmine.
»Unsinn. Jetzt müssen wir erst mal sehen, ob das wirklich so schnell gehen wird. Vielleicht brauchen wir noch den Viehdoktor. Na, der wird sich freuen, an Heiligabend.«
Richard lief zur Tür hinaus, zog im Flur eilig Stiefel und Mantel an. Charlotte tat es ihm nach und rannte auf den Hof. Ihre Mutter rief hinter ihnen her: »Lotte, Richard, ihr könnt doch nicht in euren guten Kleidern eine Kuh entbinden!«
Keiner beachtete sie. Sie liefen über die schneebedeckten Pflastersteine des dunklen Hofs in Richtung Kuhstall und folgten Leutner, der ihnen mit seiner Karbidlampe den Weg leuchtete. Durch das dichte Schneetreiben konnten sie trotzdem kaum etwas sehen. Das laute, lang gezogene Schreien der Kuh war nicht zu überhören.
Mit glasigem Blick lief sie unruhig hin und her. Der Schweizer hatte sie von den anderen Kühen getrennt und in eine große Box gebracht, wo sie sich frei bewegen konnte. Richard näherte sich ihr langsam, sprach beruhigend auf sie ein und streichelte ihr dabei über das nass geschwitzte Fell. Als er sie vor zwei Tagen untersucht hatte, war nichts Ungewöhnliches festzustellen, das Kalb lag richtig herum, der Muttermund war noch nicht geöffnet. Aber ihr lautes, unruhiges Muhen war ungewöhnlich. Berta hielt einen Moment lang still, und Richard nutzte die Gelegenheit, um sie abzutasten. Der Druck auf den Bauch war offenbar schmerzhaft für die Kuh, sie schob sich in die andere Ecke des Stalles.
»Versuch sie um den Hals zu packen, ich muss sie mir noch mal genauer ansehen!«, gab er dem Schweizer Anweisung.
»Papa, schau mal da.«
Charlotte war ganz heiser vor Aufregung. Sie stand hinter der niedrigen Tür der Box und zeigte auf Bertas Hinterteil. Doch Richard sah schon selbst, wie das Fruchtwasser mit Teilen der Fruchtblase herauslief. Und da war auch schon ein Bein zu sehen. Richard packte den einen Vorderlauf und tastete nach dem zweiten. Dann zog er vorsichtig und langsam. Da erschien auch schon der Kopf. Das Tier stand jetzt ganz ruhig.
»Gut, Berta, du hast es ja gleich geschafft. Bist doch ein braves Mädchen.«
Der Rest des kleinen Körpers glitt heraus, und Richard versuchte, ihn ein wenig abzufangen, damit er nicht so hart auf den Boden aufschlug. Charlotte stand jetzt neben ihm. Der Anblick des neugeborenen Kalbes, dessen Fell noch ganz nass und verklebt war, dazu der Geruch des Stalls, des Strohs, vermischt mit dem von Blut und Fruchtwasser, war für sie etwas Vertrautes und Fremdes zugleich. Sie genoss diesen Augenblick und fühlte dabei mit den Händen ihre heißen, von Tränen nassen Wangen.
Das Fell war schwarz-weiß gescheckt, wie das der Mutter auch. Ein fast schwarzer Kopf mit weißer Blesse. Viele Geburten hatte Charlotte noch nicht miterlebt, da sie meistens nachts passierten. Die Tiere schienen immer auf die Ruhe und die Dunkelheit zu warten, und Charlotte durfte nie so lange aufbleiben. Ein einziges Mal hatte sie heimlich im Stall gewartet, war aber dort eingeschlafen und hatte gerade den entscheidenden Moment verpasst. Sie wunderte sich über ihren Vater, der jetzt so ruhig und ausgeglichen wirkte, und sie merkte, dass auch er von dem Ereignis berührt wurde, obwohl er sonst meistens rastlos und herrisch war.
»Hier, Lotte.«
Richard hielt ihr ein Taschentuch, auf dem die Buchstaben RF eingestickt waren, und ein Bündel Stroh hin.
»Du darfst sie trocken reiben, wenn du willst. Es ist übrigens ein Mädel.«
Natürlich wollte Charlotte. Sie wischte sich zuerst mit dem Taschentuch das Gesicht ab, griff sich das Strohbündel und fing an, das Kälbchen ganz behutsam abzurubbeln.
»Wie sollen wir sie denn nennen, hast du dir schon einen Namen ausgedacht?«
»Ja, es soll Lisa heißen.«
Das Kalb versuchte aufzustehen, während die Mutter es ableckte. Aber seine Beine knickten immer wieder ein. Erst nach mehreren Anläufen gelang es ihm, sich wackelig auf den Beinen zu halten. Es fing gleich an, nach dem Euter zu suchen, während Berta ganz ruhig dastand und wartete. Richard drehte das Kälbchen noch einmal um und lenkte seinen Kopf ein wenig in die richtige Richtung. Es suchte und leckte, zuckte wieder zurück und fand nun endlich, wonach es gesucht hatte. Zufrieden saugte es seine erste Milch.
Richard tätschelte die Kuh und lobte sie: »Gut hast du das gemacht, Berta. Hast uns wenigstens nicht mehr lange warten lassen, wo es schon unbedingt an Heiligabend sein musste.«
Und zu dem Schweizer gewandt: »Gib ihr noch mal extra Futter und frisches Wasser! Und jetzt gute Nacht und frohe Weihnachten.«
Er legte den Arm um Charlotte und zog sie mit sich aus dem Stall heraus.
Im Gutshaus war schon alles dunkel. Richard schaute auf seine goldene Taschenuhr. Schon halb eins.
»So, nun aber marsch ins Bett, Lotte. Morgen geht’s wieder ganz früh los, und es kommt die ganze Verwandtschaft.«
Charlotte zog ihren Mantel aus und nahm nebenbei wahr, dass er voller Stallmist und Blut war. Ihr Vater sah auch nicht viel besser aus. Unbekümmert warf sie den schmutzigen Mantel über den Haken und reckte sich, um ihrem Vater noch einen Kuss auf die Wange zu geben und ihm ins Ohr zu flüstern: »Das war ein schönes Weihnachtsfest, Papa, gute Nacht.«
Er zwinkerte kurz mit dem rechten Auge und erwiderte den Kuss flüchtig, aber in Gedanken war er schon wieder woanders und plante den nächsten Tag.
»Ja, ja, ist schon gut, geh jetzt schlafen!«
Charlotte bemerkte, dass seine zärtliche Stimmung verflogen war. Sie nahm es zur Kenntnis, ohne sich viele Gedanken darüber zu machen, dazu war sie auch viel zu müde. Leise schlich sie auf ihr Zimmer, zog sich aus und löschte das Licht.
Anna
Ein gutes halbes Jahr war vergangen.
Durch das kleine Fenster unter dem Dach fiel schon längst Tageslicht, als sie langsam zu sich kam und merkte, dass Emma an ihrer Schulter rüttelte.
»Anna, los doch, du kommst ja zu spät zur Schule.«
Der Holzboden der Kammer, in der alle sechs Kinder schliefen, bebte, denn bis auf die kleine Dora waren alle schon aufgestanden. Emma suchte Kleidungsstücke zusammen, kämmte dabei ihre Haare, drehte sie zu einem Dutt und steckte sich nacheinander Haarklemmen ins Haar, die sie zwischen den Lippen festhielt.
Anna blinzelte benommen und wollte sich langsam aufrichten. Da klatschte ein nasser, kalter Waschlappen in ihr Gesicht, und sie fuhr auf. Ihre Brüder lachten schadenfroh und rannten aus dem Zimmer. Ihr Gesicht brannte von dem heftigen Schlag, und die Tränen schossen ihr in die Augen. Emma strich ihr kurz tröstend über das Haar und schimpfte hinter den Jungen her:
»Ihr habt auch nur Unsinn im Kopf. Seht lieber zu, dass ihr selber fertig werdet.« Und zu Anna gewandt: »Jetzt stell dich nicht so an, du musst dich beeilen, sonst kriegst du’s gleich wieder mit dem Rohrstock.«
Anna warf einen flüchtigen Blick in den kleinen Spiegel neben dem Kleiderschrank. Dann wusch sie sich kurz das Gesicht in der Schüssel mit kaltem Wasser, die in der Ecke auf einem Stuhl stand. Das Zimmer war jetzt, von der schlafenden Dora einmal abgesehen, leer, die anderen waren schon nach unten gerannt. Ungeduldig bürstete sich Anna die langen dunkelbraunen Haare. Sonst halfen sich die Mädchen immer gegenseitig beim Frisieren, aber Emma musste um sieben Uhr bei der Schneiderin sein und hatte das Haus soeben verlassen.
In der Küche schnitt ihr ihre Großmutter eine Scheibe Brot ab. Anna machte sich widerwillig daran, ihre schwarzen Stiefel zu schnüren, die ihr bei diesem Wetter eigentlich viel zu warm waren. Sie besaß nur dieses eine Paar Schuhe, und barfuß ließ sie ihre Mutter nicht in die Schule. Die Großmutter räumte die Messer in den Spülstein und gab Anna anschließend einen freundlichen Klaps auf das Hinterteil.
»Du musst aber auch immer die Letzte sein. Morgen weck ich dich mal um sechse. Vielleicht bist du dann ein einziges Mal pünktlich!«
»Ist schon gut, Großmutter, ich kann blitzschnell rennen und komm heute auch bestimmt nicht zu spät.«
Sie gab ihr einen Kuss auf die Wange, packte ihr Bündel mit Schulbüchern und stürmte zur Tür hinaus.
Draußen schien bereits die Sonne, und es versprach ein heißer Julitag zu werden. Anna rannte den kleinen Hügel hinunter zur Brücke, an deren Ende sie ihn schon stehen sah: Erich wartete auf sie, obwohl er nun wegen ihr wahrscheinlich auch zu spät kommen würde.
»Komm schon!«
Anna sprintete, ohne anzuhalten, an ihm vorbei und riss ihn einfach am Arm mit sich. Erich taumelte, fing sich aber ab und rannte neben ihr her.
»Anna, wenn es jemals einen Tag gäbe, an dem du früher aufstehen würdest! Ich komm wegen dir noch in Teufels Küche, wenn ich immer auf dich warte!«, keuchte er.
»Bist ja selbst dran schuld«, erwiderte Anna gespielt hochnäsig, »wenn du immer unbedingt meine Gesellschaft brauchst, musst du dich eben anpassen. Ich komme fast nie zu spät, weil ich einfach unglaublich schnell bin.«
»Ha, du bist zwar schnell, aber noch lange nicht so schnell wie ich!« Erich überholte sie und rief, ohne sich umzudrehen: »Aber heute wird uns das beiden nichts nützen.«
Es stimmte. Sie hörten das Läuten der Schulklingel, und Anna beschleunigte nochmals ihr Tempo. Sie holte Erich nicht mehr ganz ein, und um eine Armeslänge hinter ihm kam sie an dem kleinen Schulgebäude an. Sie nahmen zwei Stufen der Treppe auf einmal und stemmten sich zu zweit gegen die eisenbeschlagene schwere Tür, die zum Glück noch nicht abgeschlossen war. Sie quietschte laut beim Öffnen, und Anna schlug der typische Geruch von Bohnerwachs, Kreide und Tinte entgegen. Vor der Klassentür mussten sie beide einen Moment verschnaufen. Anna hielt sich nach vorne gebeugt am Türrahmen fest und versuchte, ruhig zu atmen, aber sie spürte den schnellen Pulsschlag in den Ohren. Mit einer Hand fasste sie sich an die heißen Wangen und sah zu Erich hin.
»Du siehst aus wie eine reife Tomate.«
»Bei dir ist es auch nicht viel besser«, gab Anna zurück.
Dann richtete sie sich auf, nahm sein aufmunterndes Nicken zur Kenntnis, klopfte an die Tür und trat, ohne eine Antwort abzuwarten, ein.
Ihr Lehrer schrieb gerade eine Multiplikationsaufgabe an die Tafel, während die anderen Kinder noch ihre Schulhefte aus den Ranzen holten. Anna und Erich wollten zu ihren Plätzen gehen, aber der Lehrer ging beiden hinterher, packte sie an den Ohren und zog sie wieder nach vorne.
»So einfach kommt ihr mir nicht davon! Das ist diese Woche schon das zweite Mal, dass ihr zu spät kommt. Dieses Mal waren es vier Minuten, das gibt für jede Minute zwei Hiebe. Streckt die Hände aus.«
Die schnarrende Stimme von Lehrer Kübler hallte durch das Klassenzimmer. Anna hatte vor wenigen Menschen Angst. Aber heimlich sprachen die Schüler darüber, dass Kübler bei den Züchtigungen besonders fest zuschlug und es ihm Freude machte, den Schülern Schmerzen zuzufügen. Er drehte sich zu seinem Pult um und zog die Jacke aus. Dann krempelte er langsam und sorgfältig die Hemdsärmel hoch.
Anna presste die Lippen zusammen und sah kurz zu Erich hinüber, der ihren Blick erwiderte. Sie wussten, was jetzt kam, denn es war nicht das erste Mal, dass der Lehrer sie schlug. Sie kannte genau den Moment, in dem der Rohrstock durch die Luft zischte und auf die Finger traf. Man durfte die Hände keinesfalls wegziehen oder auch nur leicht nach unten neigen, sonst gab es noch einen Extrahieb. Insbesondere Letzteres war nicht ganz einfach, da die Wucht des Schlages und der Schmerz sie die Hände automatisch absenken ließen. Früher hatte man die Hände zur Züchtigung auf das Pult legen müssen. Aber dabei war es des Öfteren zu ernsthaften Fingerfrakturen gekommen, sodass die Schulleitung diese Vorgehensweise verboten hatte. Die Stille in der Klasse war fast vollkommen. Kein Laut war von den anderen Kindern zu hören, keine Schritte im Schulhaus. Von draußen drangen kurz Vogelstimmen herein und ebbten wieder ab. Eine Fliege summte durch den Raum und setzte sich an das geschlossene Fenster. Kübler holte weit aus. Anna spannte die Arm- und Handmuskeln so fest an, dass sie leicht zitterten. Sie blickte auf ihre Hände und bemerkte, dass der Nagel ihres rechten Ringfingers leicht eingerissen war. Wie kurz die Ärmel ihrer weißen Strickjacke schon wieder waren. Dann hielt sie die Luft an. Wie in Zeitlupe sah sie den Rohrstock auf ihren Handrücken zukommen. Als er auf ihre Finger traf, entfuhr ihr durch die fest aufeinandergepressten Lippen ein Stöhnen, für das sie sich selbst verdammte. Als sie den Mund öffnete, merkte sie, dass er voll Blut war. So fest hatte sie sich auf die Zunge gebissen. Kübler holte wieder aus.
Anna und Erich lagen nebeneinander auf dem Bauch im Ufergras eines der Kanäle und hielten ihre Hände zum Kühlen in das Wasser.
»Was glaubst du, bei wem hat er fester zugeschlagen?«, fragte Anna, ohne aufzublicken.
»Bei mir natürlich, ist doch klar, dass er bei Mädchen nicht so hart draufhaut«, antwortete Erich.
Anna zog ihre Hände aus dem Wasser und betrachtete sie. Die roten Striemen waren noch sehr deutlich zu erkennen. Beide Mittel- und Zeigefinger waren leicht angeschwollen, und an zwei Stellen hatte sich die Haut etwas gelöst, aber es blutete nicht. Bei Erich hatte es geblutet, das hatte sie gesehen, und der eine Mittelfinger war ganz blau und dick.
»Wahrscheinlich hast du recht«, sagte sie und rollte sich auf den Rücken, sodass ihre Zöpfe leicht die Wasseroberfläche berührten. Sie hob den Kopf an. Da das Ufer abschüssig war, bedeutete das eine ziemliche Kraftanstrengung der Nacken- und Bauchmuskeln. Sie bemerkte ein paar zerfetzte Schäfchenwolken am Himmel. Anna wusste, dass die Bestrafung ihre Schuld war. Ein paar einfache Worte der Entschuldigung oder Anerkennung hätten sicher gereicht, um Erich zufriedenzustellen. Aber obwohl sie ihn so mochte, brachte sie diese Worte nicht über die Lippen.
Sie ließ den Kopf wieder nach hinten hängen, sammelte Speichel in ihrem Mund und spuckte ihn plötzlich über ihre Nase und Stirn ins Wasser. Ein paar kleine Fische kamen kurz an die Wasseroberfläche und tauchten gleich wieder ab.
»Kannst du das auch, ohne dass dir die Spucke ins Gesicht fällt?«
Anna sah zu Erich hinüber. Für so was war er immer zu haben. Sofort drehte er sich auf den Rücken und machte es ihr nach. Damit waren sie einige Zeit beschäftigt, witzelten und stachelten sich gegenseitig an, bis Anna einfiel, dass sie eigentlich zu Hause erwartet wurde, um ihrer Mutter zu helfen.
Erst bei den Trauerweiden kurz vor ihrem Haus zog Anna die Stiefel wieder an. Ihre Füße waren von der Hitze so angeschwollen, dass sie kaum wieder hineinpassten. Erich hatte sie bis dorthin begleitet, drehte sich um und wollte schon in die andere Richtung zurückgehen, als Anna ihn rief: »Erich!«
Er drehte sich wieder um und sah sie erwartungsvoll an, als sie zwei Schritte auf ihn zu machte und zögernd seine Hände in ihre nahm. Ganz langsam und vorsichtig, fast ohne sie zu berühren, strich sie ihm über die Finger. Sie beugte sich nach vorne und pustete. Dann sah sie ihm in seine hellgrauen Augen. Erich wurde sofort rot. Sie drehte sich um und rannte zu ihrem Haus.
Für Anna endete 1914 ihre Schulzeit. Der Lehrer hatte ihre häufigen Verspätungen zum Glück nicht bei der Benotung berücksichtigt, und sie hatte mit einem guten Zeugnis abgeschlossen. Ihre Mutter hatte bereits vorher mit der Schneiderin in Vetschau gesprochen und einen Lehrvertrag ausgehandelt. Sie löste dort ihre Schwester ab. Zwar hätte ihre Mutter Anna auch gut selbst zu Hause als Hilfe gebrauchen können, und die Zahlung des Lehrgelds würde der Familie nicht leichtfallen, aber sie dachte so fortschrittlich, dass sie auch bei ihren Töchtern eine Berufsausbildung für wichtig hielt. Also stand es fest, dass Anna am 1. August ihre Lehrjahre beginnen sollte.
Anna war froh, die Schule hinter sich zu lassen. Das Lernen war ihr nicht schwergefallen, aber das lange Stillsitzen und die dauernde Disziplinierung. Sie war sich nur nicht darüber im Klaren, was nun auf sie zukommen würde, als die Mutter sie bei der Schneiderin Willnitz vorstellte. Sie wusste von Emma, dass sie eine strenge, berechnende Frau war, die keinem Lehrling je etwas verzieh.
Aber im Moment schob Anna diesen Gedanken beiseite. Vor ihr lag der Sommer, die Grillen zirpten, am stahlblauen Himmel waren nur kleine Wolkenfetzen zu sehen. Ihren Teil der Hausarbeit hatte sie erledigt, und sie war heute wieder mit Erich verabredet. Er wartete am Ende der Holzbrücke auf sie.
»He, Anna«, rief er schon von Weitem.
»Ich habe eine ganz neue Stelle zum Baden entdeckt, da ist das Wasser richtig tief!«
»Du weißt aber doch, dass ich nicht schwimmen kann!«, antwortete Anna zögernd, und einen kurzen Atemzug lang dachte sie an ihre Mutter, die ihr niemals erlaubt hätte, mit einem Jungen baden zu gehen.
»Dann wird es Zeit, dass du es lernst«, gab Erich zurück, zog sie an einem ihrer langen Zöpfe und lief an ihr vorbei.
Bei der Hitze war das Wasser einfach zu verlockend, und Anna war die Erste, die ihre Schuhe auszog, als sie an der Badestelle angekommen waren. Irgendjemand hatte hier das Wasser eines Kanals mit Ästen und Erde gestaut, sodass ein kleiner Teich entstanden war. Anna zog ihr Kleid aus und krempelte ihre knielangen Unterhosen hoch. Sie drehte sich noch einmal kurz zu Erich um, der noch nicht einmal richtig damit angefangen hatte, sich auszuziehen, und ging zum Ufer vor. Ein Ast, der über den Teich hinausragte, kam ihr gelegen, und während sie sich an ihm festhielt, tat sie einen Schritt in das Wasser. An ihrer Fußsohle fühlte Anna den rutschigen, schlammigen Untergrund. Das Wasser war wärmer und weniger erfrischend, als sie gehofft hatte. Vorsichtig watete sie weiter. Als sie bis über die Knie im Wasser stand und gerade noch einen Schritt nach vorn machen wollte, war dort plötzlich kein Untergrund mehr zu spüren. Sie wollte hastig zurück, kam aber ins Rutschen, und als sie Halt suchend nach hinten fasste, spürte sie schon Erichs Hand, die sie festhielt und in Richtung Ufer zog.
»Das war aber knapp!«
Erleichtert wollte Anna sich bedanken, aber dann bemerkte sie, dass Erich mit einem seltsamen Ausdruck im Gesicht auf ihre Beine starrte. Anna folgte seinem Blick und schrie auf. An ihren Beinen klebten mindestens zehn dicke schwarze Blutegel. Vor Überraschung und Ekel musste sie würgen. Aber die aufsteigende Übelkeit konnte sie gerade noch unterdrücken. Ohne lange zu überlegen, griff sie nach den herunterhängenden Ruten der Trauerweide in ihrer Nähe und fing an, hektisch auf ihre Beine einzuschlagen. Erich packte zum zweiten Mal ihre Hand, diesmal, um sie zurückzuhalten.
»Nein, tu das nicht, Anna. Du musst warten, bis sie sich richtig vollgesaugt haben. Dann fallen sie von selbst ab.«
Er hatte ja recht, das wusste Anna. Aber völlig untätig zu bleiben und ihre Abscheu so lange zu überwinden, fiel ihr in diesem Moment unendlich schwer. Trotzdem ließ sie langsam die Hand sinken. Von einigen der Blutegel hatte sie Teile abgeschlagen, die nun verstreut im Gras neben ihr und auf ihren Füßen lagen. Sie sah von ihren blutverschmierten Beinen zu Erich hin, und erst jetzt fiel ihr auf, dass er zwar bis zu den Hüften tropfnass, aber vollständig angezogen war.
Langsam verstand sie: Natürlich, er hatte sie mit Absicht zu dieser Stelle geführt und gar nicht vorgehabt, selbst ins Wasser zu gehen. Sogar seine Schuhe hatte er noch an. Jetzt wurde ihr alles klar: Das war seine Art der Rache für die Stockhiebe, die er so oft wegen ihrer Verspätung hatte einstecken müssen.
Ihr Entsetzen über die Blutegel an ihren Beinen schlug in Wut um: »Du hast genau gewusst, dass es hier diese Viecher gibt, und hast mich hierher gelockt. Und deshalb bist du auch nicht ins Wasser gegangen!« Sie hielt noch immer die Weidenrute in ihrer Hand, packte sie fester und holte aus. Aber Erich wich rechtzeitig aus.
»Du bist ja verrückt, das würde ich niemals tun. Ich habe keine Ahnung gehabt.«
Anna schlug wieder nach ihm und streifte ihn leicht am Arm. Mit einem Sprung nach vorne warf er sie zu Boden und entwand ihr die Weidengerte. Er saß auf ihrem Oberkörper und drückte Annas Arme nach hinten auf den Boden. Sie strampelte mit den Beinen und versuchte sich zu befreien. Erich war zwar kleiner als sie, hatte aber trotzdem genug Kraft, um ihr jede Gegenwehr unmöglich zu machen.
»Gib es endlich zu, du gemeiner Mistkerl! Aber dazu bist du ja viel zu feige!«
»Anna, glaub mir, ich habe ja nicht gewusst, dass es davon so viele gibt. Als ich gestern mit dem Hans hier im Wasser war, hatte ich nur einen einzigen Blutegel am Bein, und er hatte gar keinen. Ich weiß auch nicht, wo die jetzt auf einmal alle herkommen. Das wollte ich wirklich nicht … Du musst mir glauben … Es tut mir wirklich leid.«
Anna spürte seinen warmen Atem, als er sie so beschwörend um Verzeihung bat.
»Ja, das ist ja auch ganz klar, denn der Hans und du, ihr könnt beide schwimmen und seid deshalb gar nicht mit den Füßen in den Schlamm gekommen. Das weiß doch jeder, dass Blu-«, sie stockte, denn das Wort auszusprechen, so lange auch nur ein einziger der kleinen Blutsauger in ihrer Haut steckte, war ihr unerträglich, »dass die Viecher sich im Boden verstecken.«
Erich zeigte jetzt echte Reue: »Daran habe ich gar nicht gedacht … so was Dummes aber auch!«
Er ließ ihre Arme los, und blitzschnell gab Anna ihm eine kräftige Ohrfeige. Danach schüttelte sie ihn einfach ab, und ohne ihn weiter zu beachten, richtete sie sich auf, um erneut ihre Beine anzusehen.
Die meisten Blutegel waren inzwischen abgefallen und hatten kleine Wunden hinterlassen, aus denen noch Blut sickerte.
Mit einem angefeuchteten Taschentuch begann Erich, ihre Beine abzutupfen. Er blickte kurz auf und sah in ihrem Blick nichts, was ihn davon abhielt fortzufahren. Behutsam und fast schon zärtlich machte er sich weiter daran, die leicht gebräunte Haut unter den dunkelroten Schlieren sauber zu wischen.
Es kam ein wenig Wind auf, und Anna überlief ein Schauer. War es der kurze kühle Hauch, den sie spürte, oder Erichs Berührung, die ihr eine Gänsehaut verursachte? Von oben sah sie auf seine hellbraunen Haare, die durch ihre Rauferei nach allen Seiten abstanden. Ihr fiel auf, wie zartgliedrig seine Finger und wie glatt und unbehaart seine Handrücken waren. Sie spürte keine Wut mehr auf ihn, und es wunderte sie, wie wenig unangenehm oder peinlich ihr dieser Körperkontakt war, letztlich musste sie sich sogar eingestehen, dass sie ihn genoss.
Charlotte
Richard Feltin stand in seinem Arbeitszimmer über das Pult aus Nussbaumholz gebeugt und trug die neuesten Ausgaben in das Wirtschaftsbuch ein. Dann blätterte er es durch, um die bisherigen Jahresergebnisse der Milchwirtschaft und Schweinemast durchzugehen. Dabei benutzte er eine Lupe, denn seine Brille war nicht mehr scharf genug. Richard legte den Stift aus der Hand und strich sich über seinen Schnurrbart, den er so sorgfältig pflegte. Er sah aus dem Fenster und hatte von dort den Überblick über den Innenhof. Jeden Moment erwartete er die Ankunft des Notars und des Eigentümers des Nachbarhofs. Durch den Zukauf von Gut Euba würde er die Grundflächen auf über 570 Hektar ausdehnen können. Ein fabelhaftes Geschäft zu dem Kaufpreis, den er seit Wochen verhandelt hatte. In Euba war der Boden besonders fruchtbar und weniger steinig als in Feltin. Und gestern hatte er den Ankauf per Handschlag abgeschlossen. Als Nächstes würde er die Schweinemast erweitern, denn sie hatte sich in letzter Zeit als besonders rentabel erwiesen. Für das Problem der Ferkelsterblichkeit hatte er eine Lösung. Sie waren extrem kälteempfindlich, dafür würde er Wärmelampen installieren. Auch in diesem Zusammenhang plante Richard, den Hof mit selbst erzeugter Elektrizität zu versorgen, damit wäre er dann völlig autark und endgültig der weit und breit fortschrittlichste Landwirt. Zwar gab es einige Rittergüter in der Umgebung, und die alteingesessenen Familien auf diesen Gütern vererbten seit Generationen weit größere Flächen weiter. Aber selbst unter ihnen befand sich zurzeit kein Gutsbesitzer, der seinen Hof so ökonomisch erfolgreich führte und stetig vergrößerte wie er.
Richard überließ sich einen Moment lang ganz diesem warmen, wohligen Gefühl des selbst erarbeiteten Wohlstands und Erfolges und genoss das Pläneschmieden für die nahe Zukunft. Nur die Frage, wer sein Lebenswerk später fortführen sollte, bereitete ihm Sorgen. Seine Frau hatte ihm nur eine einzige Tochter geschenkt, und alle Hoffnungen auf weiteren Nachwuchs waren nicht erfüllt worden. Richard liebte Charlotte zwar sehr, doch wie jeder Mann hatte er sich einen Sohn gewünscht. Natürlich hatte er sich ausgemalt, mit ihm zusammen oben auf dem Feltinsbergturm zu stehen und ihm das Land zu zeigen, das eines Tages ihm gehören würde.
Nun blieb ihm nichts anderes übrig, als auf Charlotte als zukünftige Erbin zu setzen. Eine Gleichung mit einer Unbekannten, nämlich der Frage, wer ihr Ehemann werden würde und ob dieser zum künftigen Gutsherrn taugte. Richard verschloss sich gar nicht völlig dem Gedanken, Charlotte irgendwann die Führung des Hofs zu übertragen, sie stellte sich gar nicht einmal schlecht an, obwohl sie dem weiblichen Geschlecht angehörte. Aber letztlich würde sie die Nachkommenschaft zu sichern haben, hoffentlich in etwas zahlreicherer Form, als seine Frau ihrer Pflicht nachgekommen war. Ihm war klar, dass er weder Charlottes Ausbildung noch die Auswahl des Ehemanns dem Zufall überlassen konnte.
Als eine zweispänniges Kutsche durch den Torbogen fuhr, klappte er das in Kalbsleder gebundene Wirtschaftsbuch zu und griff nach seinem Gehrock.
Charlotte saß an einem Gartentisch im Obstgarten und half ihrer Großmutter, den Rhabarber zu schälen. Sie hatten weiße Schürzen an, die nun schon rosa gesprenkelt waren. Es war Einweckzeit, und da gab es auf dem Hofgut immer so viel zu tun, dass jede helfende Hand gebraucht wurde. Die Mutter war mit den Dienstmädchen in der Küche und überwachte das Einkochen in den riesigen Töpfen.
In Begleitung von zwei Männern kam Richard vom Haupthaus herübergeschlendert. Er lachte leise, und sein gezwirbelter Schnurrbart vibrierte dabei leicht. Es war nicht zu übersehen, dass er ausgesprochen gute Laune hatte. Er setzte sich und deutete auf die freien Gartenstühle aus grün gestrichenem Eisen. Den älteren, grauhaarigen Mann kannte Charlotte, und er begrüßte sie herzlich. Der Jüngere der beiden blieb zunächst noch stehen, deutete gegenüber Richards Mutter und Charlotte eine Verbeugung an. Dann stellte Richard ihn als den neuen Notar aus Chemnitz vor. Charlotte merkte, dass er sie ziemlich unverhohlen musterte. Er sah nicht schlecht aus. Ein gut geschnittenes Gesicht mit einer schmalen Nase, einem männlichen Kinn, aber auffallend sinnlichen Lippen. Er trug breite Koteletten, wie sie gerade in Mode kamen. Seine seitlich gescheitelten Haare waren einige Nuancen dunkler als ihre. Ihr fielen seine warmen dunkelbraunen Augen auf. Während er sich auf den freien Stuhl neben sie setzte, sah er sie immer noch an. Charlotte wunderte sich, dass ihr Vater sich an einem Wochentag so gelassen mit zwei Gästen in den Garten setzte. Normalerweise arbeitete er von früh bis spät.
»Lotte«, sagte er, »lauf schnell in die Küche und sag einem der Dienstmädchen, sie soll uns eine Flasche Birnenschnaps und Gläser nach draußen bringen. Und gib deiner Mutter Bescheid. Wir haben einen Grund zum Anstoßen.«
Charlotte stand sofort auf und lief hinüber zum Haupthaus. Sie fühlte, wie ihr die Blicke der Männer folgten. Jetzt hätte sie lieber ein schöneres Kleid angehabt, nicht das graue, ausgeblichene. Im Vorbeigehen gab sie in der Küche Bescheid und rannte in den Flur. Dort band sie ihre Schürze auf, zog sie aus und öffnete den Schrank mit dem kleinen Spiegel. Sie drehte sich zur Seite und strich sich mit den Händen von der Brust zur Taille. Sie hatte im letzten halben Jahr so an Oberweite zugelegt, dass ihr hochgeschlossenes Kleid ziemlich eng saß. Charlotte biss sich auf die Lippen und merkte, dass sie schon wieder aufgesprungen waren. Sie war so häufig im Freien, Sonne und Wind trockneten sie aus. Aber ihre Oberlippe hatte eine schöne Herzform, um die sie ihre beste Freundin schon oft beneidet hatte. Ihr Teint war durch die Sonne gebräunt, und ihr Haar hatte helle Strähnen bekommen.
»Du siehst bald aus wie ein Polenkind«, sagte ihre Mutter, als sie, gefolgt von der Dienstmagd, an ihr vorbeiging.
»Das ist nicht gerade vornehm, Lotte. Ich habe dir schon so oft gesagt, dass du nicht in die Sonne gehen sollst, oder benutze wenigstens den kleinen Schirm, den dir Tante Cäcilie geschenkt hat.«
Charlotte zog eine Grimasse. Sie hielt den Schirm für vollkommen überflüssig und albern. Erna schüttelte den Kopf und presste lächelnd die Lippen zusammen, um Charlotte zu bedeuten, dass sie lieber kein Widerwort geben solle. Das Dienstmädchen war schon seit Charlotte sich erinnern konnte auf ihrem Hof. Früher hatten sie sogar zusammen gespielt, und Erna war Charlotte manchmal wie eine ältere Schwester vorgekommen. Doch als sie heranwuchsen, wurden die Unterschiede deutlich. Charlotte war es, die den Klingelzug in ihrem Zimmer benutzen konnte, um nach ihr zu läuten. Und Erna war es, die ihr beim Ankleiden half, ihre persönlichen Dinge aufräumte, den Schmutzrand in der Badewanne entfernte und ihre Stiefel putzte. Erst als sie älter wurde, hatte sich Charlotte manchmal gefragt, wie Erna die verschiedenen Rollen, die ihnen im Leben zugefallen waren, so einfach akzeptieren konnte. Sie war die Gutsherrentochter und künftige Erbin, und Erna würde wohl für immer in Diensten stehen.
Charlotte folgte ihrer Mutter und der Magd nach draußen in den Garten.
»Ach, der Bauer Seifert!«, rief Lisbeth aus.
»Wie geht es Thea, ist sie wieder auf den Beinen?«
Die beiden tauschten sich über den Zustand seiner Frau aus, während die Großmutter Erna anwies, die Schüssel mit dem fertigen Obst und die Schalen in die Küche zu bringen. Charlotte war gespannt, was es zu feiern gab.
Richard rieb sich ungeduldig mit den Händen über die Oberschenkel. Er hatte die vollen Schnapsgläser verteilt und dabei die abwehrende Geste von Lisbeth, als er Charlotte auch eines gab, ignoriert. Nun reckte er sein Glas in die Luft und verharrte einen Moment, bis die anderen ebenfalls nach den kleinen Gläsern griffen.
»Lisbeth, Mutter, Charlotte: Ich habe Walter heute Gut Euba abgekauft. Wir haben soeben den Vertrag unterschrieben. Unser junger Notar Händel hier hat alles beurkundet. Damit ist es amtlich, und darauf wollen wir trinken, Wohl sein!«
»Wohl sein«, erwiderten alle und hoben die Gläser. Die Männer kippten den Schnaps herunter, während die Frauen nur daran nippten.
Charlotte merkte erneut, wie Herr Händel jede ihrer Bewegungen verfolgte. Ihr wurde heiß, und sie hatte das Gefühl, dass ihr der winzige Schluck Birnenschnaps sofort in den Kopf stieg. Sie fand es aufregend und peinlich zugleich. Ob es sonst jemand bemerkte?
Seifert wirkte bei Weitem nicht so zufrieden wie ihr Vater.
»Ja, leicht fällt mir das nicht«, fing er leise an zu reden, ohne aufzusehen. »Ich kann den Hof einfach nicht mehr halten. Thea ist bettlägerig und fällt bei der Arbeit vollkommen aus.«
Charlottes Mutter nickte: »Ich weiß, Walter, sag ihr bitte, dass ich sie morgen wieder besuche.«
Seiferts harte Gesichtszüge entspannten sich für einen kurzen Moment »Danke, Lisbeth, du hast dich immer um sie gekümmert.«
Sie lächelte mitfühlend, aber während er weitersprach, zeigten seine Augen wieder den trüben Ausdruck von Ausweglosigkeit.
»Genügend Knechte für die Feldarbeit kann ich nicht bezahlen, und nach dem Unfall vom Kurt hat sowieso alles keinen Sinn mehr.«
Lisbeth presste die Lippen zusammen.
»Dein Richard ist schon ein schlauer Fuchs, der weiß, wie man zu was kommt, Lisbeth. Ich hoffe, dass Gut Euba bei ihm in guten Händen ist. So und nun lasst’s gut sein. Ich mache mich auf den Weg.«
Er holte ein großes Taschentuch heraus, schnäuzte sich und hob die Hand zum Gruß. Richard war aufgestanden, um ihm zum Abschied die Hand zu schütteln, aber Seifert sah an ihm vorbei und hatte es eilig fortzukommen.
Charlotte blickte ihm nach. Konnte es wirklich sein, dass ihm Tränen die Wangen herunterliefen? Das hatte sie bei einem erwachsenen Mann noch nie gesehen. Niemals hatte sie ihren Vater, Großvater, Leutner oder einen der Knechte weinen sehen. Es berührte sie unangenehm und sie fühlte sich auf einmal unwohl. Sie hatte zwar nicht ganz genau verstanden, warum er gleich den Hof verkaufen musste, wenn seine Frau krank wurde. Und ein unbestimmtes Gefühl sagte ihr, dass ihr Vater an dem Unglück von Bauer Seifert nicht ganz unschuldig sei.
»Was ist mit ihm? Er war doch früher immer so lustig«, fragte sie.
»Was mit ihm ist?«, wiederholte Richard schroff.
Aus dem Augenwinkel bemerkte Charlotte, wie der junge Notar ihn verwundert ansah.
Richard hob die Stimme: »Schlecht gewirtschaftet hat er. Das will er sich nicht eingestehen und schiebt es auf seine Frau. Und ich würde auch nicht unbedingt von Krankheit sprechen, wenn ein Weibsbild morgens nicht aus dem Bett kommt. Früher hat man das Faulheit genannt.«
»Richard, das ist ein hartes Urteil. Seifert hat wirklich viel Pech gehabt: Es ist nicht nur Theas …«
Lisbeth suchte nach dem richtigen Ausdruck.
»… Schwermütigkeit. Die verhagelte Ernte letztes Jahr, dann sind ihm fast alle seine Schweine weggestorben, sein Sohn hat bei dem Unfall das Bein verloren, so viel Unglück kann ein Mensch kaum ertragen«, sagte Lisbeth.
»Mag sein. Hagel hatten wir aber alle, und trotzdem haben wir es geschafft. Glück hat nur der Tüchtige. Basta.«
Sie hörten die Rinder kommen, die von der Weide in den Stall getrieben wurden.
»Wie steht es mit Ihnen, Herr Händel? Schon einmal zugesehen, wenn hundertzwanzig Viecher gemolken werden?«, fragte Richard den Notar.
Herr Händel stand sofort auf und griff nach seinem Hut.
»Allerdings, Herr Feltin. Wir hatten immer Milchwirtschaft zu Hause. Aber ich würde mir gerne Ihre Stallungen ansehen. Wenn es Ihnen recht wäre, könnte Ihre Tochter mich vielleicht herumführen?«
Richards Augen verengten sich. Es war ihm anzusehen, dass er den Notar auf einmal genau unter die Lupe nahm.
»Ach so? Wie viel Vieh?«
»Achtzig Milchkühe und zehn Ochsen.«
»Schweine?«
»Keine.«
»Ackerland?«
»Zweihundertzwanzig Hektar.«
Richard spitzte die Lippen und dachte nach.
»So, so. Und Sie haben sich für die Jurisprudenz entschieden? Haben wohl einen älteren Bruder, der alles erben wird?«
»So ist es, Herr Feltin.«
»Für einen Notar sind Sie noch sehr jung. Darf ich Sie nach Ihrem werten Alter fragen?«
»Richard!«, sagte Lisbeth.
»Was denn? Er ist doch kein Weibsbild.«
Herr Händel räusperte sich.
»Sie dürfen: Dreiundzwanzig bin ich.«
Richard musterte ihn einen Moment lang stumm.
»Na, von mir aus, Charlotte. Zeig dem jungen Herrn unsere Stallungen. Aber in einer halben Stunde bist du zurück. Dann gibt es Abendbrot.«
Charlotte stand auf und wusste nicht, ob sie sich freuen sollte. Sie drehte sich nach Herrn Händel um. Er war fast einen Kopf größer als sie. Und sie merkte, dass es ihr gefiel, als er neben ihr auf das Herrenhaus zu ging.
»Ein sehr stattliches Anwesen. Wann wurde es gebaut?«, fragte er.
Charlotte sah das Gebäude in der Abendsonne liegen und beurteilte es auf einmal aus seiner Sicht. Die Fassade war strahlend weiß. Die großen Sprossenfenster mit den Sandsteineinfassungen leuchteten im goldenen Licht. Weit und breit war es eines der größten und modernsten Herrenhäuser.
»Ich glaube, 1908 wurde es fertiggestellt«, antwortete sie leise.
»Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, als wir eingezogen sind, es war mitten im Winter, und eines der Wasserrohre war eingefroren.«
Dann begann sie auf einmal zu reden. Sie erklärte Herrn Händel, dass ihr Vater es nach dem Vorbild eines Ritterguts hatte errichten lassen. Aber mit einer viel fortschrittlicheren Ausstattung: Er hatte Wasser- und Abwasserrohre verlegen lassen. Es gebe Badezimmer mit fließendem Wasser, Wasserklosetts, und elektrisches Licht. Ihr Vater könne zwar manchmal ziemlich schlimme Wutanfälle kriegen, aber sie sei stolz auf das, was er hier geschaffen habe. Charlotte blieb stehen und hielt sich die Hand vor den Mund.
»Habe ich das gerade wirklich gesagt?«
Herr Händel sah sie von der Seite an und lachte auf. Ein kehliges, sympathisches Lachen.
»Ja, das haben Sie, und Sie haben auch allen Grund dazu … ich meine, stolz auf Ihren Vater zu sein.«
Sie waren noch zehn Meter vom Viehstall entfernt, und sie wusste, dass sie dort nicht mehr alleine sein würden. »Wir müssen dort entlang, Herr Händel.«
Sie deutete zum Hintereingang des Stalls. Händel drehte sich zu ihr um und machte einen Schritt auf sie zu.
»Lesen Sie? Ich meine, gibt es einen Schriftsteller, den Sie bevorzugen?«
Charlotte wunderte sich, dass sich ein Mann dafür interessierte. Ihr Vater schien niemals in ein Buch zu schauen, in dem keine Zahlen standen.
»Ja, ich habe gerade einen Band mit Meisternovellen neuerer Erzähler ausgelesen.«
»Und hat Ihnen davon etwas besonders gefallen?«
Charlotte merkte, dass seine Stimme genau die richtige Tonlage hatte, um sympathisch zu wirken. Er hätte wahrscheinlich gut Vorträge halten können und seine Zuhörer in den Bann gezogen, ohne sich besonders anzustrengen.
»Dora Duncker, Sturm. Kennen Sie sie, Herr Händel?«