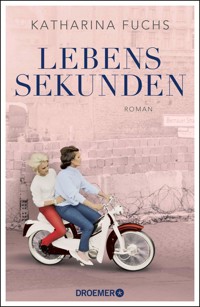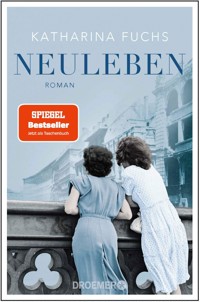
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Frauen leben ihren Traum – gegen alle Widerstände der 50er und 60er Jahre Authentisch und einfühlsam erzählt Katharina Fuchs in diesem Roman über die Nachkriegszeit die wahre Geschichte ihrer Tante, die eine der allerersten Vorsitzenden Richterinnen Deutschlands war und ihrer Mutter, einer Modemacherin. Weil sie als Tochter eines Wehrmachtoffiziers und einer Großgrundbesitzerin in der DDR nicht studieren darf, zieht Therese Trotha Anfang der fünfziger Jahre nach West-Berlin. Dort muss sie erleben, wie die wachsenden Unterschiede zwischen Ost und West ihre Familie auseinander brechen lassen. Auch ihr Studium gestaltet sich schwierig: Konservative Professoren und Kommilitonen machen Therese und ihrer Mitstudentin das Leben schwer. Die zwei einzigen Frauen an der juristischen Fakultät sind für sie Fremdkörper. Doch sie unterschätzen Thereses Begabung und ihren Willen ... Verständnis für ihre Träume scheint lediglich ihre Schwägerin Gisela zu haben, denn auch sie fällt aus der ihr zugedachten Rolle: Die Schneiderin aus einfachen Verhältnissen hat mit Thereses Bruder eine »gute Partie« gemacht und wehrt sich gegen die reine Hausfrauenehe. Wie Therese hat sie hochtrabende Pläne ... Basierend auf ihrer eigenen Familiengeschichte hat Katharina Fuchs Leben und Träume der Frauen in den 50er Jahren eingefangen und zu einem großen Roman über die Nachkriegszeit verarbeitet. Einfühlsam und mit viel Liebe zum Detail lässt sie Zeitgeschichte und zwei berührende Frauen-Schicksale lebendig werden. Die wahre Geschichte ihrer Großmütter, die zwei Weltkriege überstehen mussten, erzählt Katharina Fuchs in »Zwei Handvoll Leben«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 726
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Katharina Fuchs
Neuleben
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Weil sie als Tochter eines Wehrmachtoffiziers und einer Großgrundbesitzerin in der DDR nicht studieren darf, zieht Therese Trotha 1953 nach West-Berlin. Dort muss sie erleben, wie die wachsenden Unterschiede zwischen Ost und West auch ihre Familie auseinanderbrechen lassen. Auch ihr Studium gestaltet sich schwierig: Kommilitonen und Professoren machen Therese das Leben schwer, denn als eine von nur zwei Frauen an der juristischen Fakultät ist sie ein Fremdkörper. Dennoch geht sie unbeirrbar ihren Weg, kämpft für eine Anstellung als Richterin und taucht auf Familienfesten rauchend und im Minirock mit wechselnden »Verlobten« auf …
Verständnis für Thereses Träume scheint lediglich ihre Schwägerin Gisela zu haben: Die Schneiderin aus einfachen Verhältnissen hat mit Thereses Bruder eine »gute Partie« gemacht. Doch die Rolle als Hausfrau und Mutter allein füllt sie nicht aus.
Inhaltsübersicht
Therese
Gisela
Therese
Gisela
Therese
Gisela
Therese
Charlotte
Gisela
Therese
Gisela
Therese
Gisela
Therese
Gisela
Therese
Gisela
Therese
Gisela
Therese
Gisela
Therese
Anna
Gisela
Therese
Gisela
Felix
Therese
Gisela
Therese
Gisela
Therese
Gisela
Therese
Gisela
Felix
Therese
Charlotte
Gisela
Felix
Therese
Gisela
Therese
Charlotte
Gisela
Felix
Therese
Gisela
Therese
Gisela
Therese
Anna
Gisela
Therese
Gisela
Anna
Therese
Gisela
4. Juli 1954
Epilog
Nachlese
Danksagung
Stammbaum
Therese
Therese wusste, dass sie zu spät dran war. Die dicke Schönfelder- Gesetzessammlung mit dem signalroten Einband fest unter ihren Arm geklemmt, versuchte sie, zwei Stufen auf einmal zu nehmen. Sie musste den Hörsaal unbedingt noch vor Beginn der Vorlesung erreichen. Ihr wadenlanger, grauer Rock war allerdings nicht für große Schritte geschaffen, und deshalb war sie nicht schnell genug. Kurz bevor sie den obersten Treppenabsatz erreicht hatte, hörte sie, wie die hohen Flügeltüren mit einem satten, tiefen Ton ins Schloss fielen. Der Nachhall füllte das menschenleere Treppenhaus der Berliner Freien Universität. Sekunden später legte sie die Finger auf den runden Türknauf aus poliertem Messing, fühlte das kalte Metall in ihrer Handfläche und zögerte. Wandte ihr Gesicht nach rechts zu der hohen Fensterfront, und betrachtete den zartblauen Morgenhimmel mit den feinen weißen Wölkchen. Die kahlen Äste einer Buche bewegten sich im Märzwind, der auch die allerletzten vertrockneten Blätter fortwehte. Warum bloß war die U-Bahn am Kurfürstendamm nicht gekommen?, fragte sie sich. Mehr als zwanzig Minuten hatte sie an der Station gewartet und war schließlich wieder nach oben zur Bushaltestelle geeilt. Eine halbe Ewigkeit hatte der Autobus bis hinaus nach Dahlem benötigt. Nun kam sie schon zum zweiten Mal zu spät, und das Semester hatte gerade erst begonnen. Sie holte tief Luft, zog die schwere Tür auf und setzte einen Fuß auf den Parkettboden des Saals. Professor Wulff stand hinter dem Rednerpult und blätterte im ersten Drittel des Schönfelders. Der schlanke, hochgewachsene Hochschullehrer mit dem grau melierten Seitenscheitel schien sie nicht zu bemerken. Der Saal fiel zu seinem Pult hin steil ab, und von hier konnte sie alle Reihen gut überblicken. Dort – etwa drei Meter von ihr entfernt – war ein freier Platz am Rand, neben einem Kommilitonen, den sie flüchtig kannte. Er trug einen royalblauen Pullover, der aus dem grauen Einerlei der übrigen Männerkleidung hervorstach, und nickte ihr sogar zu. Möglichst unauffällig huschte sie herüber, er nahm seine Jacke auf den Schoß, klappte die Sitzfläche für sie herunter, und sie rutschte, ohne ihren Mantel auszuziehen, auf das glatte Buchenholz. Geschafft!, dachte sie, atmete erleichtert aus und flüsterte: »Danke!«
»Na, wieder die Bahn verpasst?«, raunte ihr Sitznachbar zurück und sah sie an. Sein Gesicht war gut geschnitten, und seine weit auseinanderstehenden braunen Augen betrachteten sie ohne diesen irritierten Ausdruck, den sie von so vielen anderen schon gewohnt war.
Sie antwortete leise: »Nein, die U-Bahn ist nicht gekommen.« Und während sie noch darüber nachgrübelte, woran es wohl liegen mochte, dass er sie so freundlich und ungezwungen behandelte, fiel die Tür mit einem weit durchdringenderen, metallischen Ton ins Schloss als vorhin, als der letzte Student sie ihr vor der Nase zugezogen hatte. Professor Wulff hob den Blick, und seine Augen wanderten suchend über die Köpfe seiner Studenten. Therese rutschte auf ihrem Sitz weiter nach unten und machte sich klein. Die Mütze!, fiel es ihr siedend heiß ein. Sie hatte vergessen, ihre dunkelgrüne Baskenmütze abzunehmen.
»Fräulein Trotha!«, hörte sie die scharfe Stimme des Professors und zuckte zusammen.
»Sie kommen zu spät!«
Sie zog die Mütze vom Kopf und strich sich über ihre braunen, streng frisierten Haare. Am liebsten hätte sie sich in Luft aufgelöst.
»Entschuldigung«, sagte sie leise.
»Entschuldigung, Herr Professor, heißt es!«, verbesserte er sie.
»Entschuldigung, Herr Professor.«
»Na, schön!«
Wulff wirkte halbwegs besänftigt, als er sich wieder dem Gesetzestext zuwandte. Therese atmete auf.
»Du hast es überstanden!«, flüsterte ihr Nachbar, und sie nickte kaum merklich. Doch auf einmal verschränkte Wulff die Arme und legte zwei Finger an die Wange. Er betrachtete sie. Nach einigen Sekunden sagte er: »Seien Sie versichert, dass es hier Studenten gibt, die etwas lernen möchten, Fräulein Trotha. Gehören Sie auch dazu?«
»Ja, Herr Professor«, antwortete sie und faltete die Hände unter der Bank.
»Ich bin etwas besorgt … wir wollen doch keinesfalls, dass Sie gleich zu Anfang des letzten Semesters examensrelevanten Stoff versäumen! Kommen Sie«, sagte er und machte mit dem rechten Arm eine Bewegung, die wohl einladend aussehen sollte.
»Hier vorne in der ersten Reihe ist noch ein Platz für Sie frei, neben Fräulein von Prignitz. Wir haben unsere beiden einzigen Damen gerne alle im Blick, nicht wahr, meine Herren?«
Ein zustimmendes Raunen ging durch den Saal. Wie so oft drehten sich die Köpfe ihrer Kommilitonen zu ihr um. In ihren Augen eine Mischung aus Gereiztheit und Sensationslust. Therese merkte, wie ihr das Blut den Hals hinauf bis in die Wangen stieg. Wie immer blieb ihr nichts anderes übrig, als der Aufforderung ihres Professors zu folgen. Langsam stand sie von ihrem Sitz auf. Aus dem Augenwinkel bemerkte sie den bedauernden Gesichtsausdruck ihres Sitznachbarn. Während sie mit hochrotem Kopf die steilen Treppenstufen nach unten lief, hörte sie das Getuschel.
»Täusche ich mich, oder ist sie seit dem letzten Semester noch hässlicher geworden«, flüsterte eine junge Männerstimme ein paar Reihen oberhalb von ihr, laut genug, dass es die meisten hören konnten. Unterdrücktes Lachen.
Therese traute sich nicht, in die Richtung zu schauen, aus der die Beleidigung kam, sondern setzte sich mit gesenktem Kopf auf den freien Platz in der ersten Reihe. Am liebsten hätte sie sich die Hände auf die Ohren gedrückt und wäre aus dem Saal gerannt.
»Nun, da auch die letzte Studentin den Weg in unseren Hörsaal und auf ihren Platz gefunden hat, können wir endlich beginnen. Das geht leider alles von Ihrer Vorlesungszeit ab, meine Herren.«
Nach einer kurzen rhetorischen Pause, um dem lauten Gemurre Raum zu geben, setzte er die Worte »… und Damen« hinzu. Dann fixierte er erneut die erste Reihe.
Therese traute sich kaum, ihn anzusehen. Womöglich rief er sie auch noch gleich als Erste auf. Professor Wulff hatte vom ersten Semester an keinen Hehl daraus gemacht, wie wenig er von Frauen in der Jurisprudenz hielt. Es war keine einzige Vorlesung vergangen, ohne dass er versucht hatte, sie oder die einzige andere Kommilitonin vorzuführen und bloßzustellen. Jetzt traf es die andere.
»Fräulein von Prignitz«, begann er und deutete mit seiner ausgestreckten Hand auf die Studentin neben ihr.
»Stellen Sie sich vor, Sie säßen in der mündlichen Prüfung des ersten Staatsexamens, was ja nun … rein theoretisch natürlich, denn dazu müssten Sie die schriftlichen Examina bestanden haben … im nächsten halben Jahr der Fall sein könnte.«
Thereses Sitznachbarin begann sofort, nervös mit dem Fuß zu wippen, der in einem plumpen Halbschuh steckte. Einerseits war Therese erleichtert, dass sie erst einmal aus der Schusslinie des Professors gelangt war.
»Was können Sie uns über das Konstrukt und die Voraussetzungen der Culpa in contrahendo erzählen«, fuhr Professor Wulff fort, »die ja eines der Randprobleme unseres Falls ist, den ich Ihnen in der letzten Vorlesung ausgeteilt habe.«
Andererseits ahnte Therese, dass Marie von Prignitz vermutlich keine besonders zufriedenstellende Antwort auf die Frage haben würde. Sie mochte Marie und hatte sich recht schnell mit ihr angefreundet. Nicht nur weil sie die einzigen weiblichen Studenten des Semesters waren. Sondern auch aufgrund ihrer ähnlichen Vergangenheit. Sie waren beide auf großen Gutshöfen aufgewachsen, die jeweils bei Kriegsende in die Hände der Roten Armee gefallen waren. Therese stammte von dem Hofgut Feltin, nicht weit von Chemnitz. Ihre Familie war kurz nach Kriegsende enteignet worden. Maries Familiengut lag im Kreis Allenstein im ehemaligen Ostpreußen. Was sie Therese über ihre Flucht über die Ostsee geschildert hatte, übertraf ihre eigenen Leiden in den letzten Kriegsjahren bei Weitem, obwohl sie selbst Schreckliches erlebt hatte. Längst war der riesige Landbesitz der Familie von Prignitz durch die Sowjetregierung annektiert worden.
Marie stand langsam auf und drehte nervös einen Bleistift zwischen ihren Fingern. Therese sah sie unauffällig von der Seite an. Ihr unförmiges Kostüm schlackerte an ihrem Körper und saß genauso unvorteilhaft wie ihr eigenes. Sie besaßen beide weder ein Gefühl für Mode noch genug Geld, um sich neue Kleidung zu kaufen. Keine von ihnen gehörte zu den Kundinnen, die sich auf die lang ersehnte Ware in den neu eröffneten Geschäften entlang des Kurfürstendamms stürzten. Das hatten sie gemeinsam. Aber eines unterschied Marie von Prignitz ganz deutlich von Therese: Sie hatte ein hübsches, ebenmäßiges Gesicht.
»Das Institut der Culpa in contrahendo, auch cic genannt …«, begann sie jetzt leise.
»Ah, sieh mal da!«, unterbrach sie Wulff schnarrend. »Sie kennen sogar die Abkürzung. Na, Donnerwetter!«
Von den hinteren Reihen tönten Lachsalven.
»Aber die Frage ist, ob uns das hier sehr viel weiterbringt! Und es sei angemerkt, dass es sich hierbei um eine reine Wiederholung handelt!«
»Also, was ich sagen wollte, war, dass das Institut des Verschuldens bei Vertragsschluss …«
»Ahhh, und die deutsche Bezeichnung kennen Sie auch!«
Jetzt lachte fast der ganze Saal. Marie strich sich eine Strähne ihrer blonden, welligen Haare hinter das Ohr und fuhr fort: »… aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen im Wege richterlicher Rechtsfortbildung hergeleitet wird. Erste Voraussetzung ist die Aufnahme von Vertragsverhandlungen …« Sie stockte und sah abwartend zu Wulff.
»Ja, was ist? Sprechen Sie weiter!«, herrschte er sie an.
Marie fuhr fort: »… und zweite Voraussetzung ist eine vorvertragliche Pflichtverletzung.«
»Wunderbar!«, rief Wulff und klatschte in die Hände: »Damit haben Sie bewiesen, dass Sie theoretisch etwa über den Wissensstand einer durchschnittlichen Rechtsanwaltsgehilfin verfügen, und das ein Semester vor dem ersten Staatsexamen.«
Wieder brachen die Kommilitonen in Lachen aus.
»Übrigens ein sehr reizvoller Beruf für eine Frau. Auch dort hat man die Gelegenheit, einen guten Ehemann mit einem mittleren Einkommen zu finden.« Wieder wurde seine Erwartung zustimmender Reaktionen aus dem Publikum nicht enttäuscht.
Therese sah ihn voller Abscheu an. Wie selbstgefällig er sich im Erfolg seiner sarkastischen Bemerkungen sonnte.
»Aber lassen wir das. Nun sind Sie ja hier, und jetzt subsumieren Sie mal, Fräulein von Prignitz.«
Marie war inzwischen kreideweiß im Gesicht. Therese konnte sich so gut in sie hineinversetzen. Sie fühlte ihre Scham, als wäre es ihre eigene. Mit leiser Stimme begann Marie, wieder zu sprechen: »Also, dadurch, dass A einen Tisch für die Feier der Firmung seiner Tochter …«
»Lauter!«, rief der Professor. »Es versteht Sie ja keiner mit Ihrem kleinen, schwachen Stimmchen. Wenn Sie später einmal in einem Gerichtssaal stehen …« Er schirmte seinen Mund mit der Hand ab und wandte sich an die Studenten, so als könnten Marie und Therese ihn dadurch nicht hören. »… was wir im Namen der Rechtspflege nicht hoffen wollen.« Er nahm die Hand wieder vom Mund und steckte sie in die Hosentasche. »… sollten Sie über eine Stimmlage verfügen, deren Schallwellen einen Radius von dreißig Zentimetern deutlich überschreiten.« Wieder brach der Saal in Gelächter aus. Doch Professor Wulff hob die Hand, um die Studenten um Ruhe zu bitten. »Bitte, fahren Sie fort, Fräulein von Prignitz!«
Marie holte tief Luft und sprach mit wesentlich lauterer, aber dafür zitternder Stimme: »Dadurch, dass A einen Tisch für die Feier seiner Tochter in dem Restaurant ›Zur letzten Instanz‹ reserviert hat, hat er …«
»Sehr gut, Fräulein von Prignitz«, unterbrach sie der Professor. »…den Restaurantnamen konnten Sie sich also auch merken!«
Wieder sorgte Wulffs ironischer Kommentar für Gekicher unter den Kommilitonen. Jetzt war Marie vollends aus dem Konzept gebracht und sah Hilfe suchend zu Therese. Diese gab vor, sich Notizen zu machen. In großen Buchstaben schrieb sie die Antwort auf einen Zettel und schob ihn so in Maries Richtung, dass sie ihn auch im Stehen lesen konnte. Marie warf einen gehetzten Blick darauf. »Das Reservieren eines Restauranttischs stellt einen Vorbereitungsakt zum nachfolgenden Abschluss eines Bewirtungsvertrags dar und dient somit seiner Anbahnung«, gab sie den Text wieder.
Doch natürlich war Wulff ihr Blick auf Thereses Zettel nicht entgangen, und er zog die Augenbrauen hoch: »Na schön, meine Damen: Ich werde wohl dafür sorgen müssen, dass Sie während des Examens sehr weit auseinander sitzen. Und nun wollen wir keine Zeit mehr verschwenden!«
Er deutete auf einen jungen Mann in der dritten Reihe: »Herr Mahler, bitte erläutern Sie uns doch Ihre Lösung.«
Therese sah sich zu Albrecht Mahler um. Er war ein blasser unscheinbarer Kommilitone mit einem Pfeffer-und-Salz-Sakko, der sich von Anfang an durch kluge, durchdachte Antworten hervorgetan hatte. Während Mahler emotionslos die Falllösung erläuterte, sank Marie mit versteinerter Miene auf ihren Sitz zurück. Therese zerknüllte langsam den Zettel und biss sich auf die Lippen. Sie wusste genau, wie sich Marie jetzt fühlte, und sie wusste auch, dass sie ihrer Freundin mit ihrer Vorschreiberei einen Bärendienst erwiesen hatte. Jetzt hatten sie sich beide komplett blamiert, und Wulff würde sie noch dazu während der Prüfungen unter besondere Beobachtung stellen.
»Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nur dringend ans Herz legen, von nun an regelmäßig die Übungsklausuren mitzuschreiben. Das Examen lässt für die meisten von Ihnen nicht mehr lange auf sich warten.«
Wieder sandte Wulff einen vielsagenden Blick in die erste Reihe zu Marie und Therese: »Und es gibt immer noch die Möglichkeit, sich das Elend zu ersparen.«
Als die Vorlesung vorbei war, packten sie Block und Stift ein, zogen sich die schäbigen Mäntel an und gingen stumm nebeneinanderher zum Ausgang.
»Es tut mir leid, ich wollte dich nicht bloßstellen«, begann Therese.
Marie schaute starr geradeaus und verlangsamte nicht einmal ihren Schritt. Sie zuckte nur mit den Schultern. »Egal, meinen Ruf als Dummchen unseres Semesters hatte ich sowieso von Anfang an weg.«
»So ein Unsinn!«, protestierte Therese und stieß sie mit dem Ellbogen an.
»Ich wünschte, ich hätte auf meine Mutter gehört und wäre Kindergärtnerin geworden, statt Jura zu studieren. Aber vielleicht mache ich das noch«, fügte Marie hinzu.
Jetzt blieb Therese stehen. Eine Handvoll Studenten drängte sich an ihnen vorbei, die Treppe hinauf. Zwei von ihnen hatten eine auffällige Narbe auf der Wange, sie waren ganz sicher Mitglieder einer schlagenden Verbindung. Die waren offiziell verboten, aber jeder wusste, dass sie längst wieder existierten. Für männliche Studenten hatten sie in Zeiten der Wohnungsnot einen unschätzbaren Vorteil: Sie boten Wohnheime mit Studentenbuden. Einer von ihnen, mit glatt zurückgestrichenen blonden Haaren, raunte Therese und Marie zu: »Na, meine Damen? Wulff hat es heute wirklich wieder auf Sie beide abgesehen. Das war sicher kein Zuckerschlecken, oder?«
»Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten, Herr Hammer«, fauchte Therese ihn an, als sie sah, wie aus Maries Gesicht der letzte Rest Farbe wich.
»Wann gehen Sie endlich einmal mit mir aus, Fräulein von Prignitz?«, fragte er, stützte sich lässig mit einer Hand auf eine Rückenlehne und tat so, als sei Therese gar nicht da.
Marie holte tief Luft, doch alles, was ihr einfiel, war: »Darauf können Sie lange warten!«
»Warum sich hier weiter abplagen? Heiraten Sie mich, dann kommen Sie viel leichter zu Ihrem Assessor.«
»Idiot!«, gab Marie zurück.
»Was müssen Sie unbedingt Jura studieren! Später werden Sie doch sowieso Hausfrauen«, bemerkte ein anderer und zog lässig eine Pfeife aus seiner Brusttasche, steckte sie sich in den Mundwinkel. Der Dritte griff ihn am Arm. »Komm schon, wir müssen weiter!«
Die meisten hatten vor ihnen den Hörsaal verlassen, um rechtzeitig zur nächsten Vorlesung zu kommen. Sie fand einige Straßen entfernt in einer der alten Dahlemer Villen statt, die zum Campus der Universität gehörten. Die Pause war knapp bemessen. Beide Frauen sahen ihren Kommilitonen hinterher, als sie auf einmal eilig die Treppen hinaufrannten. Marie wollte ebenfalls zum Ausgang gehen, doch Therese griff nach ihrem Arm und drehte sie sachte zu sich um.
»Mach dir nichts draus!«, sagte sie.
»Sieht du es nicht, oder willst du es nicht sehen? So denken die alle! Mir reicht es endgültig. Ich höre auf!«
»Das Studium abbrechen? Im sechsten Semester? Das kannst du nicht wirklich ernst meinen!«
Sie sah in das klare, blasse Gesicht ihrer Studienkollegin. Es war nahezu makellos, bis auf die ein wenig nach oben gebogene Nase. Durch Thereses Kopf rauschte der eine Gedanke: Wenn Marie aufhört, muss ich das hier ganz alleine durchstehen!
»Marie, es ist doch nicht mehr ewig! Jetzt hast du so lange durchgehalten. Du hast alle Scheine bestanden. Wenn du jetzt aufhörst, war die ganze Mühe umsonst.«
»Erstens habe ich sie nur mit deiner Hilfe bestanden, zweitens ist Wulff bei Weitem nicht der Einzige, der der Ansicht ist, ich sei hier fehl am Platz, und drittens schaffe ich das Examen sowieso nicht.«
»So ein Unsinn! Natürlich schaffst du es!«
Marie drehte sich wieder um, ging langsam weiter.
»Wulff hat ja recht. Je mehr ich darüber nachdenke, umso klarer wird mir, dass ich hier nicht hingehöre. Die Staatsrechtsvorlesung schenke ich mir jedenfalls.«
Therese suchte nach einer passenden Erwiderung, aber es fiel ihr keine ein. Je länger sie darüber nachdachte, desto mehr wurde ihr bewusst, wie wenig sie selbst an Maries Eignung für die Juristerei glaubte. Ganz im Gegensatz zu ihr, die haargenau wusste, dass Richterin der einzige Beruf war, den sie einmal ausüben wollte, hatte sie bei Marie von Anfang an gespürt, dass ihrer Studienwahl keine innere Überzeugung zugrunde lag. Und wenn sie ehrlich zu sich gewesen wäre, hätte Therese sich eingestehen müssen, dass es eine große Portion Egoismus war, die sie die folgenden Schmeicheleien aussprechen ließ: Sie sei doch sprachlich weit überdurchschnittlich begabt und könne spielend mit den anderen mithalten. Auch wenn sie vielleicht nicht das Ass im Bereich Logik sei. Und es heiße doch immer über den juristischen Beruf, man müsse nicht unbedingt beide Eigenschaften in übergroßem Ausmaß besitzen, um ein guter Jurist zu werden. Und schließlich sei sie doch sehr intelligent. Therese biss sich auf die Lippen. Marie war vielleicht gewitzt und pfiffig, und ganz gewiss nicht dumm, aber war sie wirklich ein kluger Kopf? Würde sie sich zunächst durch das Staatsexamen und später auch durch die Referendarzeit womöglich nur quälen?
Ja, so wird es sein!, sagte ihr eine innere Stimme, doch die konnte sie jetzt nicht gebrauchen.
»Und außerdem: Hast du denn gar keinen Stolz, Marie?«, beendete sie ihren Vortrag, genau in dem Moment, als sie nebeneinander die quadratischen Steinplatten des Vorplatzes überquert hatten und auf die Straße traten. Therese sah auf ihre zierliche Armbanduhr. Sie hätte längst in der nächsten Vorlesung sitzen sollen.
»Falls du zur U-Bahn willst, die fährt heute sowieso nicht!«, sagte sie.
Marie nickte: »Weiß ich! Eine Bombenentschärfung.«
Mit zusammengepressten Lippen stellten sie sich an der Bushaltestelle auf. Sofort blies ihnen der kalte Ostwind durch die Allee ungehindert ins Gesicht und fuhr unter die wollenen Röcke. Er trieb ihnen die Tränen in die Augen. Sie sahen die grau gepflasterte Straße hinunter. Einige alte Villen des Stadtteils Dahlem hatten den Krieg wie durch ein Wunder unbeschadet überstanden. Doch auf dem Grundstück, das dem Hauptgebäude gegenüberlag – dem ehemaligen Institut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft –, lag eine Brachfläche, auf der keine Häuserwand oder Mauer den eisigen Wind aufhielt. Trotz der Kälte und des aufgestellten »Betreten verboten«-Schilds spielten dort Kinder. Der Krieg war nun seit acht Jahren vorbei, und mithilfe des amerikanischen Marshall-Plans war schon Ende der Vierzigerjahre der Wiederaufbau der zerstörten Stadt begonnen worden. Die Berliner hatten fünfundsiebzig Millionen Kubikmeter Schutt fortgeräumt, daraus Baumaterial gewonnen und Trümmerberge aufgeschüttet. Und noch immer ragten Ruinen empor, mit leeren Fensterhöhlen, durch die der Wind pfiff. Viele Stadtkinder hatten nie eine intakte Straßenflucht gesehen. Ihnen dienten solche Trümmergrundstücke, die von der schrecklichen Katastrophe der vergangenen Jahre zeugten, mit ihrem Unkraut, ihren Trampelpfaden und Sträuchern als Spielplätze. Marie wandte ihr Gesicht in die Richtung, aus der sie den Bus erwartete. Jemand hatte junge Bäume in die Beete gesetzt, wo früher einmal mächtige Buchen ihre Äste ausgebreitet hatten, um in heißen Großstadtsommern Schatten zu spenden und in harten Wintern Schutz vor dem Wind zu bieten. Unmittelbar nach dem Krieg war der Hunger groß, das Brennholz knapp. Dies hinterließ noch lange Spuren in der Stadt: Der Tiergarten war verheizt worden, der Grunewald großflächig gerodet, und auch der alte Baumbestand vereinzelter Alleen war aus blanker Not in den Kohleöfen der Berliner Wohnungen gelandet. Die dünnen Stämmchen ihrer Platzhalter, die bei Weitem nicht so stabil waren wie die Pflöcke, an denen sie angebunden waren, wirkten zart und schutzbedürftig. Unbarmherzig zerrten die harten Windböen an ihren fragilen Zweigen und den versteckten Trieben. Wann endlich würde der eisige graue Winter des Jahres 1953 von der Frühlingssonne vertrieben werden?
Therese streckte eine Hand aus und ordnete Maries braunes Mantelrevers, das sich beim Anziehen nach innen geklappt hatte. Dann hauchte sie ihre Finger an. Da sie beide ihre dicken Gesetzessammlungen, die im Studentenjargon nur die »roten Ziegelsteine« genannt wurden, mit sich herumtrugen, konnten sie die Hände nicht in die Manteltaschen stecken.
»Handschuhe und ein Schal wären jetzt schön, wenn man sie nicht wieder mal in der Eile zu Hause hätte liegen lassen!«, bemerkte Marie.
»Ich habe meine Handschuhe sowieso letzte Woche in der U-Bahn verloren«, entgegnete Therese und sah ihre Freundin an: »Komm schon, Marie. Im Hörsaal ist es wenigstens warm! Die eine Vorlesung noch, und danach wird der Abschied von der provisorischen Mensa gefeiert, die alte Rostlaube wird endlich geschlossen … das können wir uns auf keinen Fall entgehen lassen.«
Gleichzeitig hatte sie klar vor Augen, wie sehr sie den Spott ihrer Kommilitonen auf sich ziehen würden, wenn sie jetzt alle beide verspätet in der Strafrechtsvorlesung auftauchten. Doch sie sagte: »Und Professor Sternberg ist doch einer der Netteren!«
Marie suchte Thereses Blick und schien darin nach ihren Hintergedanken zu forschen. Therese versuchte, einen Gesichtsausdruck aufzusetzen, der die Zweifel ihrer Freundin zerstreuen würde. Wie oft waren sie schon an diesem Punkt gewesen. Sie wusste, dass sie ihr kein aufmunterndes Lächeln schenken konnte. Dazu war ihr Gesicht zu stark entstellt. Das Einzige, was helfen konnte, war Aufrichtigkeit.
»Meinst du wirklich, dass ich weitermachen soll, Therese?«, fragte Marie zaghaft. »Oder sagst du das nur, damit du nicht das einzige Mädel in unserem Semester bist?«
Therese legte alle Bitterkeit, die der Gedanke an ein Studium und Examen ohne ihre Freundin bei ihr auslöste, in den Ausdruck ihrer tiefbraunen Augen.
»Ja, du hast recht, Marie. Ich will nicht allein sein. Aber es geht auch um dich. Du darfst jetzt nicht aufgeben, komm mit mir zurück!«, flüsterte sie.
In der Ferne sahen sie den Doppeldecker auf ihrer Straßenseite heranrollen.
»Da ist er«, sagte Therese enttäuscht. Jetzt blieb ihr keine Zeit mehr, um Marie zu überzeugen. Aber als sie die Ziffer über der Windschutzscheibe erkannte, schöpfte sie neue Hoffnung. »Das ist meine Sechzehn. Der fährt zum Ku’damm, nicht in deine Richtung.« Jetzt würde sie Marie zum Umkehren bewegen. »Du willst doch nicht noch weiter hier in der Kälte auf die Elf warten? Wer weiß, wann die kommt. Bis dahin bist du schon erfroren.«
Marie schüttelte den Kopf: »Nein, das dauert mir zu lange, ich nehme jetzt einfach den Umweg in Kauf.«
Kurz bevor Marie den Fuß auf die unterste Metallstufe setzte, hielt sie inne und drehte sich zu Therese um.
»Was soll das denn, Fräulein? Sie blockieren ja den Einstieg«, rief ein älterer Student hinter ihr entrüstet. Marie trat beiseite, um ihn passieren zu lassen, und drehte sich um. »Bis bald, Therese!«
Therese schluckte. Dann sagte sie mit fester Stimme in das Gesicht ihrer Freundin: »Bis morgen, Marie. Versprich es!« Und als Marie nicht antwortete, setzte sie nach: »Lass mich nicht alleine mit diesen Schakalen!«
Maries Augen weiteten sich. Ein kurzes Zögern, dann kam die Antwort: »Das ist nicht fair, aber ich bleibe!«
Sie sprang von dem Trittbrett herunter.
Therese musste lächeln. Sie wusste, dass ihr Gesicht sich dadurch grotesk verzog. In Maries Augen sah sie kurz das übliche Mitleid aufblitzen, wie immer, wenn sie ihre Mimik nicht im Griff hatte.
»Nur dir zuliebe!«, sagte sie.
Dann schlossen sich die Türen des Autobusses mit einem lauten Zischen, und er fuhr ruckartig an. Vermutlich war es wirklich nicht fair, dachte Therese, während sie ihm nachsah. Das helle Gelb seiner Lackierung verschwamm mit dem milchigen Himmel, als er Richtung Westen rollte. Therese drehte sich um und blickte wieder auf ihre Uhr. Schon elf Uhr dreißig!
»Jetzt müssen wir uns aber wirklich beeilen.«
Die kleine Villa in der Boltzmannstraße war einen strammen Fußmarsch von fünf Minuten entfernt. Beide zogen sich ihre Röcke etwas höher und rannten los.
Professor Sternberg hörte zwar abrupt auf zu sprechen, als sie den provisorischen Hörsaal, das ehemalige Wohnzimmer einer Jugendstilvilla, betraten. Doch dann machte er nur eine Kopfbewegung in Richtung der freien Stühle in einer der hinteren Reihen und sprach, ohne weiter von ihnen Notiz zu nehmen, seinen Satz zu Ende. Sofort fühlte Therese, wie sich eine wohltuende Wärme in ihren Gliedern ausbreitete. In einer Ecke des holzvertäfelten Raums bullerte ein Kohleofen, und die Körper der vielen jungen Männer taten ihr Übriges, um die Luft aufzuheizen. Sie spürte sogar das Bedürfnis, ihren Mantel auszuziehen. Ihr Sitznachbar streckte die Hand aus, um ihr behilflich zu sein. Erstaunt sah sie ihn an. Jetzt erst bemerkte sie das strahlende Königsblau. In dem Pullover steckte derselbe Kommilitone, den sie bereits morgens angetroffen hatte. Natürlich kannte sie schon lange seinen Namen, denn insgesamt waren sie in ihrem Semester nur achtzig Studenten. Aber er hatte sie bisher nie beachtet.
»Na, wieder die Bahn verpasst?«, flüsterte er jetzt mit einem netten Grinsen im Gesicht. Therese senkte den Kopf und klappte den winzigen Tisch aus der Armlehne. Sie war es nicht gewohnt, dass einer ihrer Kommilitonen so freundlich zu ihr war. Wie sollte sie darauf reagieren? Sie legte ihren Block auf den Klapptisch, zückte den Stift und tat so, als würde sie den Worten des Professors lauschen. Bloß nicht lächeln, befahl sie sich. Sonst sieht er mich nie wieder an.
Gisela
Engelmann sucht Schneiderinnen.«
Anna Liedke legte ihrer Tochter die Zeitung mit den Stellenanzeigen auf den Küchentisch. Als sie bemerkte, dass Gisela die Augen verdrehte, fügte sie hinzu: »Ich weiß, was du sagen willst. Aber es handelt sich um ein alteingesessenes Modeunternehmen und immer noch eine gute Adresse!«
Während Gisela die blau eingekringelte Anzeige las, schnitt Anna schweigend eine Scheibe Brot ab, bestrich sie mit Butter und legte vier Scheiben Salami darauf. Gisela sah von der Zeitung auf.
»Vier Scheiben Salami? Willst du mich bestechen?«
Anna antwortete nicht, sondern hob nur die Schultern. Dann schnitt sie die Stulle in vier Teile und schob den Teller auf der grün schraffierten Wachstuchdecke vor Giselas Platz.
»Engelmann: Der Name stand schon immer für den Inbegriff der Biederkeit«, sagte Gisela, dann las sie den Anzeigentext laut vor: »Wir stellen ein: Zwei Schneiderinnen und ein Lehrmädchen für unsere Damenkonfektion, per 1. April.«
Anna drehte sich zum Herd um und stocherte mit einer Zange in der Glut. Sie hantierte mit den Herdringen und setzte den Wasserkessel auf.
»Soll ich Kohlen hochholen?«, fragte Gisela mit einem Blick auf den fast leeren Blecheimer in der Ecke.
»Vielleicht später, im Moment habe ich noch genug Briketts oben.«
»Es wird wirklich Zeit, dass wir einen Elektroherd bekommen, Mutti«, sagte Gisela. »Sogar Frau Kalinke hat schon einen. Das macht den Alltag so viel einfacher.«
»Ich weiß ja, dass dir im Moment andere Dinge durch den Kopf gehen«, sagte Anna, ohne auf das Thema der veralteten Küchenausstattung einzugehen. »Deine Hochzeit, das Brautkleid, wo Felix’ Familie untergebracht wird … aber von irgendetwas müsst ihr doch leben!« Sie wischte sich die Hände an ihrer Schürze ab und schob eine grau melierte Strähne hinter das Ohr. »Da steht eine Telefonnummer. Am besten rufst du gleich mal an!«
Gisela nahm eine Salamischnitte vom Teller und biss hinein. Sie wusste, dass sie dringend eine neue Stelle brauchte, seit ihre Lehrmeisterin ihr angekündigt hatte, bald nach Hamburg zu ihrer Schwester zu ziehen. Sie würde die Schneiderei schließen, und dann stand Gisela auf der Straße. Felix, ihr Bräutigam, war Student. Er stand zwar kurz vor seinem Diplom, aber zum Familieneinkommen konnte er noch nichts beitragen. Und wie sollten sie eine gemeinsame Wohnung finden, wenn sie nichts verdiente? Aber ausgerechnet Engelmann! Insgeheim hatte sie schon Pläne. Sie träumte von einer Stelle bei einem der schicken Modehäuser, die nach und nach wieder in Berlin eröffnet wurden. So viele neue Ideen tanzten durch ihren Kopf. Sie wollte elegante, ja, auch extravagante Schnitte entwerfen. Pfiffige Mode! Keine hausbackenen Allerweltskleider. Es gab doch endlich wieder neue Stoffe, und was für welche!
»Du stellst dir etwas anderes vor, das ist mir schon bewusst. Ein Modehaus wie Horn oder ein Couturier wie Heinz Oestergaard«, sagte Anna, ganz so, als hätte sie Giselas Gedanken gelesen. »Und glaube mir, keine kann das besser verstehen als ich.« Sie setzte sich neben Gisela auf die Küchenbank und legte ihre Hand auf die ihrer Tochter. »Mir ging es damals genauso. Wie habe ich mich in den Zwanzigern danach gesehnt, die neue Mode mitzugestalten. Ich konnte es kaum erwarten, diese herrlichen Kleider aus fließendem Mousseline, mit Droptaille und Fransen, aus hauchdünnen Stoffen, durchwirkt mit Goldfäden, zu nähen, dazu Stirnbänder, an die wir Straußenfedern geheftet haben … das war eine unglaubliche Zeit.« Anna stand wieder auf, als der Kessel auf dem Herd anfing zu pfeifen. »Aber Stellenangebote in soliden Unternehmen gibt es nicht jeden Tag, und schon gar nicht bei den Modezaren, die dir vorschweben. Ihr beide habt ja nur dein Einkommen, Gisela, Felix verdient doch noch nichts.« Sie nahm den Kessel vom Herd und drehte sich wieder um. »Versteh mich nicht falsch, das soll kein Vorwurf an ihn sein, er studiert ja noch.« Gisela betrachtete ihre Mutter. Sie war jetzt vierundfünfzig Jahre alt. In den letzten Jahren war ihre Erscheinung immer zerbrechlicher geworden. Die Haare silbrig, das Gesicht so schmal. Ihre enorme Willenskraft und Stärke, die sie durch all die harten Jahre gebracht hatten, waren ihr nicht anzusehen. Doch ihr Äußeres täuschte, sie konnte noch immer bemerkenswert hartnäckig sein: »Es wäre doch nur eine Übergangslösung, Gisela. Deine zweite feste Stelle bei einer guten Adresse, von der aus du dich dann bald prima bei den ganz Großen bewerben könntest.«
Gisela nickte und presste die Lippen zusammen. Sie wusste, dass ihre Mutter recht hatte, aber es lockte sie so gar nichts an dem verstaubten Konfektionshaus.
»Und was, wenn du wieder anfangen würdest?«, sagte sie kaum hörbar.
Anna starrte sie nur an.
»Mutti … Liedke Couture …«, sie sprach jetzt lauter: »Was, wenn wir es zusammen zu neuem Leben erwecken würden, mit Tante Ida, Tante Emma und Tante Dora, so wie früher … was hast du damals für geniale Modelle entworfen, du, zusammen mit Tante Ida und deinen Schwestern, ihr wart doch so erfolgreich, denk nur mal an die Goldbluse!«
»Sei still!«, unterbrach Anna sie jäh, und Gisela konnte sehen, wie aufgewühlt ihre Mutter war. »Ich will nichts mehr davon hören!« Als sie sah, wie Gisela zurückzuckte, fügte sie mit weicherer Stimme hinzu: »Ida wohnt in München, bei der Familie ihres Mannes, Dora in Bremen. Emma näht schon lange nicht mehr. Das alles ist ein für alle Mal vorbei.«
Sie wandte sich abrupt ab und griff sich mit den Fingern an die Nasenwurzel. Gisela wusste, dass es sinnlos war. Bisher war jeder zaghafte Versuch, ihre Mutter zu einem Neuanfang in der Konfektion zu bewegen, so verlaufen.
Sie sah noch einmal auf die Anzeige. Gleich darunter begannen die »Vermisst wird …!«-Gesuche und Anzeigen des Deutschen Roten Kreuzes. Noch immer waren viele Menschen auf der Suche nach ihren Angehörigen, von denen sie durch die Kriegswirren getrennt worden waren. Sorgfältig faltete sie die Zeitung zusammen, strich mit der Handfläche über das Deckblatt, wollte die angespannte Stimmung vertreiben. Ihr Blick fiel auf die heutige Schlagzeile: »Oh, hast du das gesehen, Mutti? Stalin ist tot!«
Anna nickte, während sie die Lippen bewegte und Löffel mit Bohnenkaffee abzählte, die sie in einen Porzellanfilter häufte. Dennoch las Gisela den dazugehörigen Artikel der Berliner Morgenpost laut vor: »Gestern Morgen veröffentlichte die staatliche Nachrichtenagentur TASS eine Mitteilung der Regierung über die Erkrankung des Kreml-Chefs: Das ZK der KPdSU und der Ministerrat der UdSSR machen Mitteilung von dem Unglück, das unsere Partei und unser Volk getroffen hat – von einer schweren Erkrankung des Genossen Stalin.« Sie sah auf und wiederholte das Wort »Genosse« mit der Bemerkung: »Also dieser Kommunistenjargon!« Dann las sie weiter: »Demnach habe Stalin in der Nacht vom 1. auf den 2. März in seiner Moskauer Wohnung eine Hirnblutung erlitten. Zur Behandlung des Genossen Stalin wurden die besten Ärzte herangezogen, doch sie waren machtlos. Am Morgen des 5. März ist unser Staatsoberhaupt Josef Stalin friedlich entschlafen. Das gesamte russische Volk trauert.«
»Noch so ein Verbrecher, der in der Hölle schmoren wird, zusammen mit … na, du weißt schon, wem«, war Annas Kommentar, während sie das heiße Wasser in den Filter goss. Sofort breitete sich der Duft des frisch aufgebrühten Kaffees in der Küche aus. »Hmmm«, machte Gisela und sah ihrer Mutter in die grauen Augen. In stiller Übereinkunft empfanden sie den Geruch noch immer als Gipfel des lange entbehrten Luxus. Gisela sah wieder auf das Deckblatt der Zeitung. Sie überlegte, ob die Nachricht von Stalins Tod etwas in ihr berührte, doch sie verband keinerlei Empfindungen mit seiner Person. Wenn sie sein Foto betrachtete, vermischten sich seine Gesichtszüge mit ihren schemenhaften Erinnerungen an einen einzigen Sowjetsoldaten: Damals, im April 1945. Es war im Luftschutzkeller gewesen, genau drei Stockwerke unter ihren Füßen. Noch schwerer lastete auf ihr, dass ihre ältere Schwester Anita sich danach das Leben genommen hatte. Ihre Mutter und sie hatten nie mehr darüber gesprochen. Doch in diesem Augenblick konnte sie in Annas Augen deutlich das tiefe alte Leid erkennen.
Ich weiß, sie fehlt mir auch so unendlich.
Die Worte formten sich in ihrer Kehle, aber sie fanden nicht den Weg zu ihren Lippen. Schluss!, befahl sie sich. Anitas Todestag war jetzt acht Jahre her. Sie wollte nicht mehr an die schreckliche Zeit zurückdenken. Ruckartig drehte sie die Zeitung um und klatschte mit der flachen Hand auf deren Rückseite.
»Mutti«, sagte sie, »Engelmann ist einfach nichts für mich.«
Gisela war zwei Haltestellen zu früh ausgestiegen und musste ein gutes Stück zu Fuß gehen. Es war später Nachmittag, der frische Wind kündigte einen Wetterumschwung an. Aus Osten trieb er graue Wolken vor sich her. Hoffentlich würde es jetzt nicht anfangen zu regnen, dachte sie und klappte ihre Handtasche auf. Als sie darin die durchsichtige Regenhaube ertastete, war sie erleichtert. Ihre Wasserwelle konnte sich schnell in einen unansehnlichen Krauskopf verwandeln, wenn sie feucht wurde. Charlottenburg hatte sich verändert, seit sie das letzte Mal hier gewesen war. Auf dem Weg zum Tauentzien kam sie am Lichthaus Mösch vorbei und staunte über die Lampenmodelle, die aussahen wie beleuchtete gelbe Schultüten. Bei Goldpfeil Lederwaren entdeckte sie ausgefallene weiße und schwarze Lack-Handtaschen mit aufgenähten Schleifen. Vor Leiser Schuhe blieb sie kurz vor einem Paar Pumps mit hohen Pfennigabsätzen stehen und sah an sich herunter zu ihren abgetragenen alten Latschen. Wann würde sie sich wohl einen solchen schicken Abendschuh leisten können? Modische Kleidung konnte sie sich selbst schneidern, aber Schuhe? Seit der Wiedereröffnung des KaDeWe waren zahlreiche Geschäfte zurück an den Tauentzien und Kurfürstendamm gezogen. Es war, als hätten viele ehemalige Ladenbesitzer nur darauf gewartet, wie auf ein Startsignal zum Aufbruch in ein neues Zeitalter. Wie schon um die Jahrhundertwende erwies sich das ehemals so mächtige Warenhaus als Anziehungspunkt und Garant für Kundenströme. Je größer die Verkaufsfläche des KaDeWe wurde, desto mehr Läden siedelten sich wieder zwischen Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und Wittenbergplatz an.
Die Kirchenruine hatte zunächst abgerissen werden sollen, doch die Berliner hatten vehement dagegen protestiert. Das Wahrzeichen des Berliner Westens wollten sie sich nicht nehmen lassen, und nun wurde sie von einem namhaften Architekten in ein Mahnmal gegen den Krieg umgestaltet. Die Trümmerwüste der Nachkriegszeit hatte sich inzwischen in ein blühendes Geschäftsviertel verwandelt. Gisela spürte die neue Konsumlust, die zweifellos an den Ku’damm zurückgekehrt war. Sie wirkte geradezu ansteckend und hob ihre Stimmung. Vielleicht war es doch eine gute Idee von ihrer Mutter, sich bei Engelmann zu bewerben. Wenn sie nur erst einmal einen Fuß in der Tür zum neuen Modehimmel des Kurfürstendamms hätte.
Das Schaufenster war nur gute acht Meter breit, und Gisela musterte mit fachmännischem Blick die drei Gliederpuppen, die mit der neuen Frühlingskollektion bekleidet waren. Eine trug ein Kostüm aus dunkelgrünem Jersey mit einem wadenlangen Rock, der einen Tick zu lang und zu sackig saß. Die andere ein hellbraun gemustertes Kleid mit einem schlapp herunterhängenden Tellerrock, das eher an eine Kittelschürze erinnerte, und die dritte ein beiges Twinset zu plumpen Wollhosen.
Giselas hoffnungsvolle Stimmung wurde jäh zerstört. Desillusioniert sah sie von einem einfallslosen Modell zum anderen. Was hier hinter der Scheibe mit den goldenen ENGELMANN-Lettern präsentiert wurde, übertraf ihre schlimmsten Befürchtungen. Doch nun stand sie hier. Sie versuchte, ihr Spiegelbild in der Schaufensterscheibe zu überprüfen, bevor sie das Ladengeschäft betrat. Befeuchtete ihren Zeigefinger und fuhr sich über die dunklen, geschwungenen Augenbrauen. Inzwischen zupfte sie keine Frau mehr zu einem schmalen Strich, wie noch vor ein paar Jahren. Ihr breites Gesicht mit den hohen Wangenknochen trug die Züge der typischen Spreewälderin und deren slawischer Vorfahren. So hatte es jedenfalls ihr Großvater jedes Mal zu ihr gesagt, wenn sie ihn früher in Vetschau besucht hatte. Auch die hellblauen, klaren Augen stammten von diesem Zweig ihrer Familie.
Sie hängte sich die kleine Handtasche mit dem Schnappverschluss über den Arm und ordnete ihre schulterlangen Haare, die der Wind an der Kreuzung zur Schlüterstraße zerzaust hatte. Dann drückte sie die Tür auf. Es ertönte ein helles »Dingdong«. Sofort richteten sich die Augen einer Verkäuferin auf sie, die sie mit leicht reserviertem Ton begrüßte. Sie war genauso unvorteilhaft gekleidet wie die Schaufensterpuppen und schien sie innerhalb weniger Sekunden zu taxieren. Ihr Blick ruhte kurz auf Giselas schmaler Silhouette, wanderte von der taillenbetonten Kostümjacke hinunter zu dem engen, Knie bedeckenden Pencilrock über ihre hauchdünnen Feinstrümpfe zu den halbhohen Pumps und wieder nach oben. Gisela wurde sich bewusst, dass die Schuhe schäbig waren, und stellte automatisch einen Fuß hinter den anderen. Als sich ihre Blicke begegneten, hatte sich die Verkäuferin ihr Urteil bereits gebildet, und ihr war anzumerken, dass sie Gisela nicht als potenzielle Kundin betrachtete. Vielleicht hatte sie erkannt, dass Giselas Kleidung zu elegant für dieses Geschäft war, der Schnitt zwar extravagant, der Stoff allerdings billig und die Schuhe abgetragen, oder sie ging bei ihr allein aufgrund ihrer Jugend nicht als betucht genug durch. Jedenfalls fragte sie von oben herab: »Sie wünschen?«
»Ich komme zu einem Vorstellungsgespräch …« Die Miene der Verkäuferin verfinsterte sich noch weiter. Sie tat so, als wisse sie von nichts.
»Ich hatte angerufen«, setzte Gisela hinzu.
»Na gut«, sagte die Verkäuferin mit einem Tonfall, der einen Anflug von Großzügigkeit suggerierte: »Dann kommen Sie mal mit.«
Sie durchquerte den Raum, der wesentlich tiefer war, als es von außen den Anschein gehabt hatte, öffnete eine braune Tür und führte sie zum Treppenhaus.
»Erster Stock, zweite Tür rechts«, sagte sie und deutete über die grauen Travertinstufen nach oben. Dann drehte sie sich um. Bevor sie wieder in den Verkaufsraum zurückging, fügte sie noch hinzu: »Aber vorher anklopfen!«
Gisela setzte den Fuß auf die erste Stufe. Die schnippische Art der Verkäuferin hatte sie verunsichert. Aber in Wirklichkeit wollte sie die Stelle doch gar nicht, sprach sie sich selbst Mut zu. Warum also nervös sein? Als sie weiter nach oben ging, drang ein vertrautes Geräusch aus dem ersten Stockwerk an ihr Ohr. Das Rattern von Nähmaschinen hatte sie während ihrer gesamten Kindheit begleitet. Aus dem kleinen Konfektionshaus in ihrem Wohnzimmer hatte Giselas Mutter, zusammen mit ihren Schwestern, Freundinnen und einigen Angestellten, die Kaufhäuser Berlins, allen voran das berühmte Kaufhaus des Westens, beliefert. Auf Gisela hatte das gleichmäßige Stakkato ihr Leben lang eine beruhigende und anheimelnde Wirkung gehabt. Wenn die Singer-Nähmaschinen fleißig ratterten, war alles gut gewesen. Nur wenn sie anhielten, konnte Unheil drohen. Und genau in dem Moment, als sie den Flur des ersten Stockwerks betrat, stoppten alle Nähmaschinen abrupt.
»Was soll das sein?«, hörte sie jetzt eine strenge Männerstimme. Gisela ging auf Zehenspitzen in die Richtung, aus der die Stimme kam. Die Tür war nur angelehnt. Sie ließ sie links liegen und ging weiter zu einem breiten offen stehenden Fenster, durch das man in einen Saal blicken konnte. Mindestens dreißig Näherinnen saßen hinter ihren Maschinen. Sie trugen einheitliche weiße Kittel. Ihre Gesichter waren allesamt auf eine stattliche Frau mit hoch aufgetürmten Haaren gerichtet, die am schmalen Ende des Saals stand. Sie hielt den halb fertigen Ärmel einer Bluse hoch und legte die Stirn in Falten. Sogar von ihrem Platz hinter der Scheibe konnte Gisela deutlich erkennen, wie sich die Nähte an dem weißen, dünnen Stoff kräuselten.
»Das ist keine Naht, das ist ein Ungetüm!«, tadelte die Frau mit dem Auftreten einer herrischen Königin. Gisela musste ihr leider recht geben. Aber sie wunderte sich, dass die tiefe Männerstimme tatsächlich zu ihr gehörte, denn sie bildete einen Gegensatz zu der weiblichen Figur. Eine grüne Bluse umspannte einen riesigen Busen. Ihre kräftigen Arme sprengten fast die Ärmel. Eine ungewöhnliche Erscheinung.
»Fräulein Lehmann! Habe ich Ihnen nicht schon hundertmal erklärt, wie man das Kräuseln des Stoffs beim Nähen vermeidet?«
Eine Näherin, von der Gisela nur den wippenden brünetten Pferdeschwanz sehen konnte, nickte verschüchtert und sagte leise: »Ja, schon, aber es passiert einfach immer wieder. Ich habe es mindestens fünf Mal aufgetrennt, Frau Helmer.«
»Genau! So lange, bis von dem teuren Stoff nichts mehr übrig ist! Sechs Mark fünfzig der Meter!« Frau Helmer sah durchdringend von einer Näherin zur anderen: »Weiß jemand, was zu tun ist?«
Erst nach einigen Sekunden hob eine der Frauen die Hand und wartete, bis Frau Helmer sie aufrief. »Ja, bitte, Fräulein Schwan!«
Hier geht es ja schlimmer zu als in der Schule, dachte Gisela und wäre am liebsten sofort wieder umgedreht. Nein, in so einer Atmosphäre wollte sie auf keinen Fall arbeiten. Sie war schließlich fertige Schneidergesellin. Doch die Neugier auf die Antwort und auf die imposante Erscheinung der Chefin hielt sie davon ab, sogleich zu gehen.
»Man muss nachsehen, ob man den Stofftransport der Nähmaschine wirklich arbeiten lässt«, sagte die Frau mit einer blonden Wasserwelle. »Oder ob man vielleicht während des Nähens am Stoff zieht oder ihn schiebt. Beides sollte man unterlassen, sonst kann es zu diesem Kräuseln oder Wellen der Naht kommen.«
»Sehr gut!«, sagte Frau Helmer und schenkte ihr einen wohlwollenden Blick. Dann wandte sie sich wieder an Fräulein Lehmann. »Versuchen Sie es noch mal ohne Ziehen oder Schieben!«
»Ich weiß«, wandte Frau Lehmann schüchtern ein. »Aber ich habe ganz sicher nicht gezogen oder geschoben. Dieser dünne rutschige Stoff ist einfach nicht zu bändigen.«
Jetzt waren es Frau Helmers Lippen, die sich kräuselten. Widerworte schätzte sie ganz offenbar nicht.
»Man braucht eine Vlieseinlage oder Seidenpapier …«, hörte Gisela sich plötzlich sagen.
Alle Köpfe wandten sich ruckartig zu ihr um. Das blonde Fräulein Schwan, das mit seiner Antwort keinen Pluspunkt hatte sammeln können, musterte sie abschätzig. Frau Helmer betrachtete sie mit hochgezogenen Brauen. Gisela ging zu der Tür und betrat den Saal. »Verarbeitet man einen sehr feinen, dünnen Stoff, dann kann es sein, dass man ihn im Bereich der Naht durch eine Vlieseinlage stabilisieren muss. Alternativ kann man auch versuchen, Seiden- oder auch Schnittbogenpapier unterzulegen«, sagte sie mit fester Stimme.
Frau Helmer antwortete nicht gleich, aber ein mildes Lächeln überflog ihr Gesicht. Dann bemerkte sie: »Gar nicht dumm. Darf ich fragen, wer Sie sind?«
»Gisela Liedke. Ich hatte angerufen …«
Als Frau Helmer nicht reagierte, fügte sie leise hinzu: »Wegen der Stellenanzeige.«
Jetzt nickte Frau Helmer: »Na, unter mangelndem Selbstbewusstsein scheinen Sie ja nicht zu leiden.«
Sie gab den Ärmel Fräulein Lehmann zurück und sagte: »Versuchen Sie es mal mit Seidenpapier, und wenn Sie fertig sind, zeigen Sie es mir.« Dann wandte sie sich wieder an Gisela. »Und Sie kommen mit in mein Büro.«
Gisela wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Das Bewerbungsgespräch war eine reine Formsache gewesen. Nach einer kurzen Unterhaltung und der Vorlage ihres Gesellenbriefs war sie als neue Schneiderin im Konfektionshaus Engelmann angestellt worden. Im Vorbeigehen sah sie erneut durch das Fenster in den Nähsaal. Die Frauen saßen alle stumm hinter ihren Maschinen und arbeiteten emsig wie die Bienen. Das sollte also ihr neuer Arbeitsplatz sein. Dort würde sie ab dem 1. April 1953 Tag für Tag biedere Oberbekleidung für die gut situierte Frau ab vierzig nähen. Keine verlockenden Aussichten. In der kleinen Schneiderei, bei der sie ihre Lehre absolviert hatte, durfte man sich wenigstens während der Arbeit unterhalten, es hatte eine freundliche Atmosphäre geherrscht, und die Zeit war wie im Flug vergangen. Und wenn sie einfach wieder absagte? Aber was sollte sie dann ihrer Mutter erzählen? Ihr Blick fiel auf die große Wanduhr am Ende des Saals. Schon sechs Uhr! Sie und Felix waren heute bei einem seiner Studienfreunde zur Budeneinweihung eingeladen, und sie wollte nicht mit leeren Händen dort erscheinen. Sie lief den Gang entlang und rannte die Travertinstufen herunter, die ihr jetzt noch grauer als vorhin vorkamen. Die Verkäuferin bediente eine ältliche Kundin, als sie das Ladengeschäft wieder durchquerte, und tat so, als würde sie sie nicht sehen.
Gisela beeilte sich, um noch vor Geschäftsschluss in dem kleinen Lebensmittelladen, an dem sie vorhin vorbeigekommen war, eingelassen zu werden. Sie hatte Glück, der rotgesichtige Ladeninhaber holte gerade sein großflächiges Werbeschild für Moha-Eis ins Innere und ließ sie noch ein.
»Na, so ’n hübsches Fräulein wolln wa ja nich’ vahungern lassen«, sagte er freundlich. Gisela bedankte sich und besah sich die Auslagen. Sie konnte sich immer noch wie ein kleines Kind daran freuen, wie gut die Regale seit der Währungsreform gefüllt waren, obwohl das jetzt schon fünf Jahre her war. Alles, an dem es vorher gemangelt hatte, gab es seitdem ohne Anstehen für die harte D-Mark oder wahlweise auch für weitaus höhere Beträge in Ostmark zu kaufen: Butter, Fleisch, Gemüse, aber auch Kochtöpfe oder Fahrradschläuche. Waren, von denen man bis dahin nur träumen konnte. Viel hatte sie nicht in ihrem Portemonnaie, aber sie kaufte ein kleines Graubrot für fünfundneunzig Pfennig und eine Packung Kochsalz für eine Mark zehn. Sorgfältig zählte sie die Münzen ab und legte sie in die Plastikschale mit dem aufgedruckten Sarottimohren.
»Und davon wolln Se satt werden?«, fragte der Verkäufer. »Keen Wunder, dass an Ihnen nüscht dran is’.«
»Das ist doch für eine Wohnungseinweihung«, erklärte Gisela ihm. »Sie wissen schon: Brot und Salz …«
Er schüttelte nur staunend den Kopf und sah ihr hinterher, als sie die Treppen zur nächsten U-Bahn-Haltestelle herunterlief. In dem langen, schmutzig weiß gekachelten Gang stand ein Straßenhändler, dem sie für ihre letzten Pfennige noch einen Strauß mit zehn roten Tulpen abkaufte, dann hörte sie, wie die U-Bahn einfuhr, und rannte zum Bahnsteig.
Sollte sie nicht doch erst noch kurz zu Hause vorbeigehen, wo die Zwiestädter Straße doch nur einen Sprung von der Haltestelle entfernt war?, fragte sie sich, als sie die grauen Gesichter der Frauen betrachtete, die ihr gegenübersaßen. Einige Augen waren geschlossen. Sie stellte sich vor, wie ihre Mutter jetzt sicher noch in der Küche stand. Seit Tagen war sie mit nichts anderem als den Vorbereitungen für ihre, Giselas und Felix’, Hochzeitsfeier beschäftigt. Legte Heringe ein, nähte lange Stoffbahnen zu Tischdecken um, wusch und stärkte die Bettwäsche für die Übernachtungsgäste. Es schnitt ihr ins Herz, und ihr schlechtes Gewissen sagte ihr klar und deutlich: Geh wenigstens kurz nach Hause! Aber eine Überlegung hielt Gisela zurück: Wenn sie ihr von dem Verlauf des Vorstellungsgesprächs erzählte, wäre ihre Entscheidung besiegelt und nicht mehr rückgängig zu machen. Anna würde sie dazu drängen, die Stelle anzutreten, aber sie wollte sich den Entschluss wenigstens noch bis morgen offenhalten. Und morgen würde sie ihrer Mutter nach der Arbeit auch wieder bei den Vorbereitungen helfen.
Es wurde schon dunkel, als sie vor dem kleinen Mietshaus am Ende der Winterfeldstraße ankam. Soeben gingen die ersten Laternen an. Sie überquerte gerade die Straße, als sie am Rande ihres Blickfelds eine graue Limousine wahrnahm, in der zwei Männer mit Hut saßen. Vergeblich suchte sie auf den Klingelschildern nach dem Namen von Felix’ Studienfreund. Dann entdeckte sie einen kleinen handgeschriebenen Zettel: Wetzel 4. Stock, Tür ist offen! Bevor sie das Haus betrat, drehte sie sich noch einmal unauffällig um, doch die Männer machten keine Anstalten, aus dem Wagen auszusteigen.
Therese
Therese steckte den Schlüssel ins Schloss und hörte, wie auf dem Treppenabsatz gegenüber eine Tür geöffnet wurde. In dem schmalen Spalt erschien nur ein Schatten.
»Guten Abend, Frau Neumann«, sagte Therese laut.
Erst jetzt kam der Kopf der Nachbarin mit dem Haarnetz über den Wicklern zum Vorschein. Frau Neumann bedachte sie mit einem misstrauischen Blick und erwiderte den Gruß verhalten. Dann zog sie die Tür wieder zu. Therese schüttelte den Kopf, während sie ihre Wohnungstür aufschloss. Bereits am Tag ihres Einzugs, als sie mit ihrem kleinen Koffer angereist war, hatte man im Haus neugierige Fragen gestellt. Therese hatte sich der Einfachheit halber als Leonhard Händels Nichte ausgegeben. Dass er in Wahrheit ihr Vater war und sie aus einer unehelichen Beziehung zwischen ihm und ihrer Mutter Charlotte Trotha stammte, konnte sie unmöglich eingestehen. Aufgrund der unterschiedlichen Nachnamen wäre man aber sofort auf die Fährte ihrer unschicklichen Verbindung gekommen. Langsam hatte sie allerdings den Verdacht, dass Frau Neumann ihr deshalb sogar weit Schlimmeres unterstellte.
Therese setzte einen Fuß auf das alte Schiffsboden-Parkett. Wie sehr sie den tiefen knarrenden Ton liebte, den das betagte Holz von sich gab, sobald man sein Gewicht darauf verlagerte. Er erinnerte sie jedes Mal an ihr Elternhaus – an Feltin –, das jetzt auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik lag. Sie wäre gerne dort geblieben. Dort war sie geboren und aufgewachsen, nicht weit davon zur Schule gegangen. Im Frühjahr hatte das Ausbringen des Saatguts, im Sommer die Ernte ihr Leben bestimmt. Nie hatte sie sich vorstellen können, ohne den Geruch der Milchkühe beim Melken, ohne die frisch gelegten Eier ihrer unzähligen Hennen und ohne ihre Familie in einer zerbombten Großstadt zu leben. Ihre Großeltern, ihre Mutter Charlotte und zwei ihrer Geschwister wohnten noch immer auf Feltin, allerdings in einer winzigen Wohnung des Leutehauses, seit der gesamte Besitz enteignet worden war. Während sie ihren Mantel auszog und an den Garderobenhaken hängte, spürte sie ein wenig ihrer Wehmut nach. Warum befiel sie sie gerade heute? Es lag wohl an der Demütigung durch Professor Wulff in der Vormittagsvorlesung. Die Angst davor, dass Marie ihre Drohung wahr machen und das Studium hinschmeißen würde, hatte ihre melancholische Grundstimmung verstärkt. Durch die Milchglastür fiel ein Lichtschein aus dem Arbeitszimmer ihres Vaters. Sie klopfte kurz an und schob die Türen auseinander. In dem Raum roch es wie die Luft, die aus lange nicht geöffneten Kisten oder Koffern steigt. Er saß mit dem Rücken zu ihr, über den Schreibtisch gebeugt. Wie immer war die Tischplatte von Akten, aufgeschlagenen Büchern und Gesetzessammlungen übersät. Doch heute hatte er sogar den Boden und einige Stühle mit braunen Aktenmappen bedeckt.
»Guten Abend, Paps.«
Sie hatte sich angewöhnt, ihren leiblichen Vater, Leonhard Händel, mit Paps anzusprechen, als eine Art Abgrenzung zu ihrem Ziehvater, Ernst Trotha, den sie Vati genannt hatte. Erst nach ihrem achtzehnten Geburtstag hatte ihre Mutter sie über die tatsächlichen Familienverhältnisse aufgeklärt. Als der Arbeiter-und-Bauern-Staat der Deutschen Demokratischen Republik ihr eine Studienerlaubnis verweigert hatte, weil Ernst Trotha Offizier der Wehrmacht gewesen war und sie zudem aus einer Großgrundbesitzerfamilie kam, hatte sie sich kurzerhand an der Berliner Freien Universität eingeschrieben und war zu ihrem Vater in eine Seitenstraße des Kurfüstendamms gezogen. Dieser hatte schon kurz nach Kriegsende erkannt, dass er als Anwalt und Notar in der sowjetisch besetzten Zone kein Auskommen haben würde. West-Berlin war ihm passend erschienen, und die geräumige Altbauwohnung in der kaum zerstörten Fasanenstraße kam ihm für die Neugründung einer Anwaltspraxis gelegen.
Therese legte ihm den Arm um die zusammengesunkenen Schultern, strich mit der Handfläche über die kratzige Wolle seiner Strickweste. Sie drückte ihm einen Kuss auf die gealterte Wange. Leo riss umständlich ein kleines Stück Papier von einem Block ab und legte es als Lesezeichen in die Seiten des dicken Kommentars, in dem er gerade geblättert hatte. Dann klappte er ihn zu, setzte seine altmodische Lesebrille ab und tätschelte ihren Handrücken auf seiner Schulter.
»Guten Abend, Therese. Na, wie ist es dir heute in der Universität ergangen?«
Er drehte sich auf seinem hölzernen Drehstuhl zu ihr um, und das Scharnier gab einen leisen quietschenden Ton von sich. Therese rollte die Augen, dabei fiel ihr Blick auf die stuckverzierte Decke, und sie nahm die nackte Glühbirne wahr, die noch immer ohne Lampenschirm in der Fassung steckte. Sie bildete einen merkwürdigen Kontrast zu der verschnörkelten Gipsrosette, aus der das schwarze Kabel herausragte. Sie holte tief Luft und wollte damit beginnen, ihm die ganze Geschichte über Professor Wulff und ihre Freundin Marie zu erzählen, als sie ein unliebsamer Gedanke zurückhielt. Würde er sie überhaupt verstehen? Womöglich hielt er sie beide für wehleidig und schwach oder noch schlimmer, er glaubte ihr gar nicht. Im Grunde ihres Herzens wusste sie, dass ihr Vater nur Erfolgsmeldungen von ihr hören wollte.
»Ganz gut«, sagte sie und spürte sofort den Kloß im Hals, als sie ihm verschwieg, was sie den ganzen Tag beschäftigt hatte. Sie suchte nach einem unverfänglichen Thema. »Morgen wird die neue Mensa eröffnet, ein ganz modernes Gebäude, und hoffentlich nicht mehr so überfüllt wie die alte Rostlaube, in der sie bisher untergebracht war.«
»Schön, schön!«, sagte Leo. »Hauptsache, es wird dort ordentlich gekocht.«
Therese wusste, wie er das meinte. Äußerlichkeiten interessierten ihn schon lange nicht mehr. Architektur, Einrichtung, Kleidung waren ihm einerlei. Das war nicht immer so gewesen, wie sie aus den Erzählungen ihrer Mutter Charlotte wusste. Früher war er stets nach der neuesten Herrenmode gekleidet und als einer der ersten Männer in Charlottes Bekanntenkreis, die ein gutes Eau de Toilette benutzten, allzeit akkurat frisiert bei ihnen auf Feltin erschienen. Und schließlich hatte er damals eine der schönsten Frauen Leipzigs geheiratet, Thereses halbjüdische Tante Edith, Cousine ihrer Mutter Charlotte. Thereses Blick wanderte jetzt zu seinen Fingern, die einen dunkelgrünen Bleistift jonglierten. Die Haut der Handflächen weiß und weich. Niemals hatten diese Hände körperliche Arbeit ausgeführt, ganz im Gegensatz zu denen ihrer Mutter, die während zwei Kriegen gelernt hatte, auf dem Hof mit anzupacken.
»Hast du ein neues Mandat?«, fragte sie.
Ihr Vater runzelte die Stirn und lehnte sich zurück. Es war ihm anzusehen, wie er sich gedanklich in seinen aktuellen Fall versetzte. In Berlin musste man drei Jahre als Rechtsanwalt tätig sein, bevor man die dortige Notarzulassung erhalten konnte. Während dieser Wartezeit hatte er nahezu jedes Mandat angenommen, das ihm angetragen worden war. Wo er sich in Chemnitz und Leipzig hauptsächlich mit Immobilienrecht beschäftigt hatte, verlagerte sich sein Tätigkeitsschwerpunkt in West-Berlin mehr und mehr in den Bereich des Strafrechts. Anfangs hatte er sich damit schwergetan. Die Gepflogenheiten vor den Strafgerichten waren ihm fremd, seine Mandanten, wie auch die Staatsanwälte, teils grobschlächtig, und es hatte Rückschläge gegeben. Aber durch seine akribische Arbeit war es ihm einige Male gelungen, scheinbar aussichtslose Fälle für seine Mandanten zum Guten zu wenden. Nach und nach hatte er sich einen Namen als Strafverteidiger gemacht. Als ihm im letzten Jahr die Zulassung zum Notar zustand, hatte er sie nur pro forma beantragt.
»Das wird dich interessieren: ein Tötungsdelikt und ein widerrufenes Geständnis«, sagte er und hielt ihr eine orangefarbene Akte entgegen. »Du bist ja nicht zartbesaitet, sonst würde ich dir dies hier nicht zeigen.«
»Obduktionsbericht«, las Therese laut, als sie den Pappdeckel aufklappte. Überscharfe Schwarz-Weiß-Fotos zeigten Schusswunden in Großaufnahme. Sie blätterte weiter und sah nur kurz auf die Aufnahmen der männlichen Leiche, die zahlreiche rot geränderte Einschussstellen und ausgefranste Austrittslöcher aufwies. Die Bilder waren schwer zu ertragen, deshalb sah sie nicht genauer hin. Sie verstand nicht, warum ihr Vater sie ihr zeigte, klappte den Deckel wieder zu und gab sie ihm zurück. Wie wenig er sie doch kannte, wenn er glaubte, derartige Abbildungen gingen ihr nicht an die Nieren. Ob sie jemals die fehlenden Jahre ihrer Kindheit, die sie getrennt voneinander verbracht hatten, aufholen konnten? Therese sehnte sich gerade heute nach ein wenig Wärme und Trost, stattdessen zeigte er ihr Leichenbilder.
»Er ist buchstäblich durchsiebt worden«, erläuterte Leo nüchtern, ohne ihre Abscheu im Geringsten zu registrieren. Sie gab sich allerdings auch keine Blöße.
»Dass du dich freiwillig nur noch mit Kapitalverbrechen beschäftigst. Ist das nicht etwas …« Sie suchte nach dem richtigen Ausdruck, der ihn nicht verletzte, »… unter deinem Anspruch?«
Er zog die Augenbrauen hoch. Therese stand noch immer neben seinem Stuhl. Ihr Magen knurrte leise, aber Leo schien es nicht zu hören.
»Tut mir leid«, sagte er, ohne sie anzusehen. »Ich dachte, ein Blick in die Praxis kann nicht schaden, denn du wirst ja spätestens im Referendariat auch mal in die Pathologie müssen.«
Er suchte nach einem freien Platz auf dem Schreibtisch, und als er keinen fand, legte er die Akte einfach auf einen der Stapel. Dann drehte er sich zu ihr um und wies auf den mit Gobelinstoff bezogenen Sessel, der in der Ecke zwischen zwei übervollen Bücherregalen stand.
»Du kannst die alten Schwarten dort herunternehmen, wenn du dich setzen willst.«
Therese wäre gerne in die Küche gegangen, um das Abendbrot vorzubereiten. Denn sie musste sich dringend noch über ihre Bücher setzen. Aber es beschlich sie ein Gefühl, als habe ihr Vater etwas auf dem Herzen. Sie schob den Stapel auf der Sitzfläche nach hinten und setzte sich auf die vordere Kante.
»Wusstest du, dass deine Mutter nach Berlin kommt?«, fragte er unvermittelt.
Das war es also.
»Ja, natürlich kommt sie zu Felix’ Hochzeit. Ich meine, immerhin heiratet ihr ältester Sohn!«
»Das meine ich nicht. Sie kommt nach Berlin, um zu bleiben.«
Therese bemerkte eine Veränderung an ihrem Vater. Bisher hatte er mit hängenden Schultern auf seinem unbequemen Schreibtischstuhl gesessen. Jetzt drückte er auf einmal den Rücken durch und hob das Kinn. Seine Augen hatten wieder Glanz. »Und sie hat mich um ein Treffen gebeten«, ergänzte er leise.
Therese musterte ihn. Machte er sich etwa Hoffnungen, dass Charlotte zu ihm zurückkehrte?
»Es wäre ja auch seltsam, wenn sie dich nicht sehen wollte, wo ich nun schon bei dir wohne«, meinte sie.
Leo schien das nicht hören zu wollen. Er schüttelte den Kopf und holte einen Brief aus grauem Papier aus seiner Jackentasche. Als er ihn auseinanderfaltete, war deutlich zu sehen, dass er ihn schon häufiger gelesen hatte. »Eine Schande, was sie dort in der Zone für minderwertige Papierqualitäten haben. Früher hat Lotte für ihre Briefe immer nur feinstes Bütten verwendet.«
»Ach, Paps, das sagst gerade du! Als würden dir Äußerlichkeiten, wie die Beschaffenheit eines Blattes Papier, noch irgendetwas bedeuten.«
Therese konnte ein kleines Lächeln nicht unterdrücken, wurde aber sofort wieder ernst, als sie in seinen Augen das Befremden über ihr schiefes Gesicht erkannte. Obwohl er ihr Vater war, konnte er seine Befangenheit nicht ablegen.
»Wolltest du mir aus dem Brief vorlesen?«, fragte Therese, als hätte sie seinen irritierten Blick nicht bemerkt. Sie hatte von klein auf gelernt, die Verlegenheit anderer Menschen angesichts ihrer Entstellung zu überspielen. Er hob den Brief vor seine Augen und sah sich sogleich nach seiner Brille um. Inzwischen war es draußen stockdunkel. Die Glühbirne an der Decke und die kleine Schreibtischlampe beleuchteten den Raum nur unzureichend. Therese stand auf und gab ihm seine Lesebrille.
»Zuerst erkundigt sie sich natürlich nach dir und wie deine Fortschritte beim Studium sind.«
Er setzte sich umständlich mit einer Hand die Brille auf.
»Dann schreibt sie, dass sie nicht viel aus Feltin mitnehmen kann, obwohl ihr Aufenthalt in Berlin wohl länger dauern wird.« Er hielt sich den Brief trotz der Brille dicht vor die Augen und las laut vor: »… wird eine Rückkehr in meine über alles geliebte Heimat wohl auf absehbare Zeit nicht möglich sein.« Jetzt sah er wieder Therese an: »Was für ein trauriger Abschied. Für mich war er um vieles leichter, ich hatte ja nie eigenes Land.«