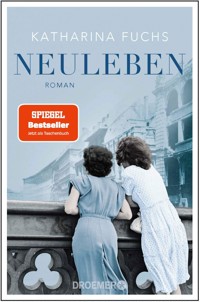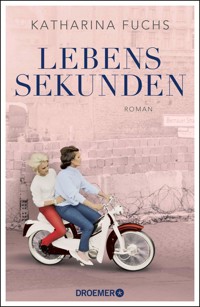
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Frauen, zwei Leben, eine Fotografie Die Geschichte der ersten deutschen Foto-Journalistin und einer Leistungsturnerin aus der DDR – ein bewegendes Stück Zeitgeschichte Der große Traum von Angelika Stein scheint geplatzt, als sie mit 15 von der Schule fliegt: Kein Fotograf in Kassel will einem Mädchen, noch dazu ohne Schulabschluss, eine Lehrstelle geben. Doch Angelika gibt nicht auf – und bekommt schließlich eine Chance von einem Fotografen, der vor Kurzem aus der DDR gekommen ist. Zur selben Zeit wird in Ostberlin die junge Leistungsturnerin Christine Magold darauf gedrillt, die DDR bei den Olympischen Spielen zu vertreten. Doch ist das wirklich ihr Traum? Beim Bau der Berliner Mauer 1961 treffen die beiden jungen Frauen unter dramatischen Umständen aufeinander. Mit viel Liebe zum Detail und großem Einfühlungsvermögen erzählt Katharina Fuchs die Geschichte zweier ebenso eigensinniger wie mutiger junger Frauen in Westdeutschland und der DDR. Zeitgeschichte wird dabei ebenso lebendig wie zwei bewegende Frauen-Schicksale.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Katharina Fuchs
Lebenssekunden
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Zwei Frauen, zwei Leben, eine Fotografie
Die Geschichte der ersten deutschen Foto-Journalistin und einer Leistungsturnerin aus der DDR – ein bewegendes Stück Zeitgeschichte
Der große Traum von Angelika Stein scheint geplatzt, als sie mit 15 von der Schule fliegt: Kein Fotograf in Kassel will einem Mädchen, noch dazu ohne Schulabschluss, eine Lehrstelle geben. Doch Angelika gibt nicht auf – und bekommt schließlich eine Chance von einem Fotografen, der vor Kurzem aus der DDR gekommen ist. Zur selben Zeit wird in Ostberlin die junge Leistungsturnerin Christine Magold darauf gedrillt, die DDR bei den Olympischen Spielen zu vertreten. Doch ist das wirklich ihr Traum? Beim Bau der Berliner Mauer 1961 treffen die beiden jungen Frauen unter dramatischen Umständen aufeinander.
Inhaltsübersicht
Erstes Buch
Angelika
Christine
Angelika
Christine
Angelika
Christine
Angelika
Christine
Angelika
Christine
Angelika
Christine
Angelika
Christine
Angelika
Christine
Angelika
Christine
Angelika
Christine
Zweites Buch
Angelika
Christine
Angelika
Christine
Angelika
Christine
Angelika
Christine
Joachim
Angelika
Kerstin
Angelika
Christine
Angelika
Christine
Angelika
Christine
Angelika
Christine
Angelika
Christine
Angelika
Nachlese
Erstes Buch
Angelika
Die Abendsonne stand genau zwischen der Kuppel des Pavillons und der hohen Baumgruppe im Westen. Ein paar diffuse Wolkenbänder hatten sich rechts und links von ihr an den Himmel geheftet. Nur noch wenige Minuten, dann würde die Sonnenkugel hinter dem halb zerstörten Westflügel der Orangerie untergehen.
»Warum erscheint die Sonne abends so viel größer und der Erde näher als am Tag?«, fragte Angelika. Sie lag neben ihrer Freundin im Gras, ihre Jacke zusammengefaltet unter dem Kopf, streckte die Hände in die Luft und formte mit ihren Fingern ein Viereck. Vor ihnen breitete sich die Symmetrie der Parkanlage aus. Sie kniff ein Auge zu und verharrte bewegungslos, als würde sie auf etwas warten.
»Das ist eine optische Täuschung«, sagte Irmgard, ohne von der Zeitschrift hochzusehen, in der sie blätterte. Sie lag auf dem Bauch, mit angewinkelten Beinen. »Herr Pfeiffer hat erklärt, es kommt durch den Bezug zu Objekten am Horizont, denn das Auge orientiert sich an ihnen. Durch den direkten Vergleich mit Bäumen oder Häusern erscheint uns die Sonne größer, aber das ist nur …« Mitten im Satz hörte sie auf zu sprechen, denn sie hatte gemerkt, dass Angelika erstarrte. Irmgard klappte die Illustrierte zu und drehte sich auf den Rücken.
Herr Pfeiffer war der Direktor des Gymnasiums, gleichzeitig ihr Physiklehrer und erklärter Feind. Ihm schrieben sie jegliche schlechten Eigenschaften zu, die sie aus Romanen und ihren Groschenheften kannten. Alles, was er bei ihnen auslöste, waren Angst und Ohnmachtsgefühle. Bei Angelika waren diese Empfindungen noch ausgeprägter als bei ihrer Freundin. Irmgard war um einiges besser in der Schule, und was die beiden Mädchen vor allem unterschied: Sie war weniger aufmüpfig und nahm regelmäßig am Unterricht teil.
»Vergiss es einfach!«, sagte Angelika, bemüht sorglos.
Irmgard schlug die Constanze wieder auf und tippte mit dem Finger auf ein Foto, das eine junge Frau in engen Caprihosen und einer gepunkteten weiten Bluse zeigte. »Hier, sieh mal, das wäre was für dich!«
Angelika beugte sich darüber und betrachtete das Mannequin, das vor einem roten Sportwagen posierte. »Irgendetwas stimmt nicht mit der Perspektive«, murmelte sie. »Ich glaube, das ist nur eine Kulisse, vor der sie da steht, der Wagen ist gar nicht echt.«
»Das Mädel sieht dir sogar ähnlich«, setzte Irmgard hinzu, ohne auf ihre letzte Bemerkung einzugehen. »Sie hat die gleiche Haarfarbe und Figur, und du trägst doch auch am liebsten Hosen.«
»Du meinst, sie ist genauso eine dürre und flache Bohnenstange wie ich!«, ergänzte Angelika. »Gib dir keine Mühe, die Jungs werden sich nie nach mir umdrehen, sondern immer nur nach dir.« Dabei warf sie Irmgard einen bewundernden Blick zu.
Ihre Freundin war kleiner und kompakter als sie, betonte bereits seit einiger Zeit ihre schmale Taille mit einem breiten Gürtel aus Lackleder, was ihre fast schon frauliche Oberweite besonders gut zur Geltung brachte. Mit ihren schräg stehenden Katzenaugen und den geschwungenen Brauen entsprach sie ziemlich genau dem derzeitigen Schönheitsideal.
»Das bildest du dir ein!«, sagte Irmgard und legte die flache Hand auf das Foto. »Wir könnten uns die Sachen selbst nähen«, schlug sie vor. »Hinten im Heft sind die Schnittmuster drin.«
»Das kannst du vielleicht! Aber du weißt doch, dass ich das niemals hinbekäme.«
Der gleichmäßige Vogelgesang setzte plötzlich aus.
»Warte kurz!«, sagte Angelika. Sie konzentrierte sich wieder voll auf das Bild am Himmel und formte erneut das Viereck mit den Fingern. Dann hörten sie das laute unverwechselbare Schackern einer Elster, und im nächsten Augenblick sahen sie schon ihre Silhouette mit weit ausgebreiteten Flügeln, als sie sich von dem obersten Wipfel einer Eiche löste.
»Klick«, sagte Angelika leise.
Langsam ließ sie ihre Hände sinken und lächelte zufrieden. Sie wusste, dass sie mit einer Kamera genau den Moment eingefangen hätte, in dem sich der schwarz-weiße Vogel im Zentrum des roten Sonnenballs befand. Es fühlte sich an, als wäre die Zeit durch ihr Zutun für den Bruchteil einer Sekunde stehen geblieben.
»Ich hab es!«, murmelte sie vergnügt und stand auf. »Ich hätte es gehabt!«, verbesserte sie sich.
»Was hättest du gehabt?«, fragte Irmgard.
»Das perfekte Bild.«
Im nächsten Augenblick verdunkelte sich der Rasen, als habe jemand das Licht ausgeknipst. Die Sonne war hinter der notdürftig abgestützten Fassade der Orangerie verschwunden, und die langen, dunklen Schatten der Bäume legten sich über die kurz gemähten Rasenflächen der Kasseler Karlsaue. Die Stimmung war plötzlich eine andere. Mit gedeckteren Farben, violettem Licht über dem blaugrauen Erdschattenbogen. Der laue Frühlingsnachmittag war einer kühlen und melancholischen Abendstimmung gewichen.
Angelika und Irmgard schüttelten ihre Strickjacken aus und schlüpften in die Ärmel, klopften sich Hose und Rock ab, zogen sich die Strümpfe hoch. Es war schon längst Zeit gewesen, nach Hause zu gehen, doch sie hatten herumgetrödelt, zusammen in der neuen Constanze geblättert, sich nicht trennen können, und nun brach bereits die Dunkelheit herein.
»Woher hast du gewusst, dass die Elster in diese Richtung fliegen würde?«, fragte Irmgard, als sie nebeneinander über den Rasen gingen.
»Ich wusste es nicht, das war nur so eine Ahnung. Irgendwo hatte ich dieses Bild schon einmal gesehen.«
»Es wird wirklich Zeit, dass du einen Fotoapparat bekommst! Dann nähe ich die Kleider nach, und du knipst mich darin.«
»Und du wirst ein berühmtes Mannequin, ich eine weltbekannte Modefotografin, und zusammen gehen wir ganz weit weg, nach Berlin oder Paris …« Angelika schloss kurz die Augen und legte träumerisch den Kopf in den Nacken. »Das wäre zu schön, um wahr zu sein!«
Irmgard sah ihre beste Freundin von der Seite an. Sie hätte nicht sagen können, was sie an Angelika so sehr anzog, seit sie zusammen am Lyzeum eingeschult worden waren. Vom ersten Tag an waren sie unzertrennlich gewesen. Angelika unterschied sich in so vielen Dingen von den anderen Mädchen ihrer Klasse. Sie gehorchte nicht, sie ließ sich nicht einschüchtern, und früher war sie damit durchgekommen, als ihr blitzgescheiter Verstand und ihr Gedächtnis die Lehrkräfte der Mädchenschule beeindruckt hatten.
»Kommst du morgen wieder in die Schule?«, fragte Irmgard, wie jeden Tag, wenn sie sich verabschiedeten, weil ihre Elternhäuser in verschiedenen Richtungen lagen.
Angelika zuckte mit den Schultern und antwortete wie immer: »Mal sehen!«
Dann tat Irmgard etwas, was sie noch nie gemacht hatte. Sie blieb stehen und griff nach Angelikas Hand. Ihre warme Haut fühlte sich ein wenig klebrig an.
»Bitte komm doch wieder. Es ist alles so …«, sie suchte nach den richtigen Worten, »… farblos und langweilig ohne dich.«
Angelika sah nach unten auf die Spitzen ihrer Ballerinas. Das abgestoßene Leder war schon unzählige Male mit blauer Schuhcreme behandelt worden und davon ganz hart. In ihrem Kopf spielte sich eine Unterrichtsstunde im Schnelldurchlauf ab. Seit Beginn des letzten Schuljahrs gab es kaum noch ein Fach, das sie gerne mochte. Der Stoff erschien ihr trocken, jegliche neue Idee, alle Zeichen von Fantasie wurden im Keim erstickt. Angelika machte den neuen Direktor dafür verantwortlich. Nachdem ihr Mädchenlyzeum mit dem Jungengymnasium zusammengelegt worden war, hatte er die Leitung übernommen, und er machte keinen Hehl daraus, wie wenig er für die neuen Schülerinnen übrighatte, vor allem für Ungehorsame, die aus der Reihe tanzten. Seine drakonischen Strafen waren schon seit jeher berüchtigt gewesen. Die Mädchen fasste er keinen Deut sanfter an. Einmal hatte sie die Hälfte des Physikunterrichts auf Erbsen kniend verbringen müssen, weil sie Zweifel an einer Anwendung des Gesetzes zur Trägheit der Masse geäußert hatte. Irgendwann hatte sie begonnen, die Schule zu schwänzen. Was Irmgard da von ihr verlangte, bedeutete ein großes Opfer für sie.
»Du willst doch nicht am Ende noch sitzen bleiben und mich in der Klasse allein lassen?«, sagte Irmgard, und als Angelika den Kopf hob, sah sie direkt in die beschwörenden dunkelgrünen Augen ihrer Freundin, und ihr fiel auf, dass sie immer noch ihre Hand hielt. Auf einmal weiteten sich Irmgards Augen: »Oder legst du es etwa darauf an?«
Angelika wusste in diesem Moment nicht, ob das womöglich sogar der Wirklichkeit am nächsten kam.
»Versprich mir, dass du wieder kommst und dich anstrengst!«, flüsterte Irmgard beschwörend. Angelika nickte langsam.
»Na gut, ich komme, aber nur morgen und nur dir zuliebe!«
Dann rannte sie los, so schnell sie konnte, durch die dunkle Parklandschaft. Mit einem Mal war es dort menschenleer, nur an den Wegen gingen elektrische Laternen an, die schmale Lichtkegel auf den Kies warfen. Sie überquerte den Küchengraben auf einer kleinen Brücke, um auf die Stadtseite zu gelangen. Nun führte ihr Weg noch einige Hundert Meter an der dicht überwucherten Böschung dieses schwarzen Kanals entlang, in dessen Schatten lauter Unwägbarkeiten zu lauern schienen. Sie hörte das träge Plätschern des Wassers, das ihr tagsüber kein bisschen unheimlich vorkam. Als sie noch jünger gewesen waren, hatte sie mit Irmgard stundenlang unter der Brücke gespielt, Dämme gebaut und alles an Unrat gesammelt, was in dem stehenden Gewässer herantrieb. Noch nicht einmal die großen Bisamratten, die an ihnen vorbeischwammen und gelegentlich an das befestigte Ufer kletterten, um ihren Damm zu umgehen, hatten ihnen Angst eingejagt. Zeitvergessen hatten sie täglich Äste, alte Schuhe, Topfdeckel und was sie sonst fanden, aufeinandergetürmt, Schicht um Schicht.
Ihre größte Trophäe war der abgebrochene Arm einer Schaufensterpuppe gewesen, daran musste sie jetzt denken. Damals war alles anders gewesen. Letztes Jahr zur Bundesgartenschau und Documenta 1955 hatte man die Karlsaue herausgeputzt, den schwarzen Kanal gesäubert, und das Material ihres selbst gebauten Damms war von einem Müllcontainer verschluckt worden. Das dichte Gestrüpp aus Brennnesseln, hinter dem sie früher ungestört gespielt oder ihre Heftchen gelesen hatten, war den Sensen der Heerscharen von Gärtnern zum Opfer gefallen. Angelika und Irmgard waren froh, die Karlsaue in diesem Jahr endlich wieder für sich zu haben, ohne die Besucherfluten der beiden Großereignisse. Aber die Zeit des Dämmebauens war ein für alle Mal vorbei.
Endlich näherten sich die Lichter der Stadt. Und sie hörte nicht mehr nur das Kanalwasser und ihr eigenes Keuchen, sondern das Bimmeln einer Straßenbahn. Als sie in die Menzelstraße einbog, die vertraute Häuserlinie sah, in der noch immer die Lücken der Kriegsruinen klafften, ließ ihre Furcht nach. Da unter dem grauen Schieferdach lag ihr Elternhaus, dessen Anblick Geborgenheit und Schutz ausstrahlte.
Durch die unverschlossene hohe Haustür trat sie in den Flur der kleinen Gründerzeitvilla und lehnte sich an die Wand mit dem verblichenen Anstrich. Sie hörte Töpfeklappern und erregte Stimmen aus der Küche, während sie darauf wartete, dass sich ihr Herzschlag beruhigte und sie wieder zu Atem kam. Erst dann ging sie über den abgetretenen Läufer in den hinteren Teil des Hauses. Von ihrer Mutter sah sie nur den Rücken. Die zierliche Gestalt, die ganz anders gekleidet war als die meisten Frauen, die in den neuen Stoffen schwelgten. Ihre weißen und taubenblauen A-Linien-Kleider aus Leinen umhüllten den zierlichen Körper wie einen Kokon. Wo doch sonst jede Frau in ihrem Alter, die es sich leisten konnte, sogar in einer so modefernen Stadt wie Kassel ihre Taille besonders betonte und die neuen synthetischen Stoffe und bunten Drucke ausprobierte. Angelika hatte erst als Heranwachsende verstanden, dass ihre Eltern nicht wie andere waren. Es gab so viele Äußerlichkeiten, aber auch Ansichten, die sich von denen der Eltern ihrer Klassenkameradinnen unterschieden. Je älter sie wurde, umso deutlicher ließen die anderen Schülerinnen sie die Unterschiede spüren. Irmgard war ihre Verbindung zu dieser anderen Welt.
Unbemerkt an der Küche vorbeihuschen und zu ihrem Vater ins Atelier schlüpfen, das war ihr Plan. Durch die offen stehende Tür sah sie ihre älteren Brüder, ein Zwillingspaar, und ihre jüngere Schwester auf der Eckbank am Küchentisch knien und spielen. Clara war so eifrig und konzentriert damit beschäftigt, die winzigen Pappfische mit ihren kleinen Angeln, an deren Fäden jeweils ein Magnet befestigt war, aus dem aufgeklappten Aquarium zu holen, dass sie sie nicht bemerkte. Wie bei allem, was sie tat, legte sie auch hier einen überbordenden Ehrgeiz an den Tag, jeden, vor allem aber ihre älteren Geschwister, zu überflügeln. Mit ihren siebzehn Jahren waren ihre Brüder schon längst zu alt für ein albernes Kinderspiel, aber Clara und vor allem ihrer Mutter zuliebe spielten sie ab und zu mit und gaben sogar vor, Spaß daran zu haben.
Angelika hielt den Atem an, machte einen großen Schritt, und schon war sie an der Tür vorbei. Sie legte ihre Hand auf den Knauf des Treppengeländers, der in Form einer Artischocke geschnitzt war, dann stieg sie auf Zehenspitzen die Treppe hoch, darauf bedacht, kein Geräusch zu verursachen. Ihre Schulter streifte die Wand mit dem abblätternden Putz. Sie konnte sich nicht erinnern, dass ihr Haus jemals renoviert worden wäre. Lieber hängte man sich zeitgenössische Kunst an die Wände, als sie zu tapezieren. Einmal hatte sie ihre Eltern darüber sprechen hören. Sie zahlten kaum Miete, denn ihr Vater bekam die Unterkunft von der Staatlichen Kunsthochschule, an der er als Professor tätig war, zur Verfügung gestellt. Keiner fühlte sich für die Instandhaltung verantwortlich.
Ganz am Ende des Gangs im dritten Stock lag sein Atelier nach Osten zu, in das er größere bogenförmige Fenster hatte einbauen lassen. Es war das einzige Mal, von dem Angelika mit Bestimmtheit wusste, dass er selbst Geld in das Haus gesteckt hatte.
Normalerweise durfte ihn niemand bei der Arbeit stören, noch nicht einmal ihre Mutter. Angelika war die Einzige, die er nicht wegschicken würde. Und ohnehin konnte er bei nachlassendem Tageslicht nicht mehr weitermalen und würde jetzt bestimmt Leinwände grundieren oder seine Pinsel reinigen. Ganz vorsichtig drückte sie die Türklinke herunter, um ihn nicht zu erschrecken, und musste sofort die Augen mit der Hand abschirmen. Gleißendes, strahlend helles Licht traf so unvorbereitet auf ihre Netzhaut, dass sie einige Sekunden lang geblendet war und nur noch zuckende Blitze und Sternchen sah.
»Moment!«, hörte sie die tiefe Baritonstimme ihres Vaters. Dann war das Licht plötzlich aus, und sie öffnete die Augen. Langsam konnte sie wieder Umrisse erkennen und sah ihren Vater neben einem riesigen Strahler stehen, dessen Metallummantelung jetzt, nachdem er ausgeschaltet war, zu knacken begann.
»Alles in Ordnung, Geli, kannst du wieder richtig sehen?«, fragte ihr Vater besorgt und kam in seinem Kittel voller Farbkleckse, den er immer zum Arbeiten trug, auf sie zu.
»Was ist das?«, fragte sie, ohne auf seine Frage einzugehen. Neugierig musterte sie die drei gespreizten Metallbeine und die rauchende Glasscheibe.
»Mein neuer Scheinwerfer. Ich habe ihn aus einem Katalog bestellt. Man darf allerdings auf keinen Fall direkt in das Licht schauen, das ist sehr schädlich für die Augen.«
Als sie die Hand ausstreckte und das Metall berühren wollte, hielt er sie zurück. »Vorsicht! Es wird glühend heiß. Die Lampe ist eigentlich für Filmaufnahmen vorgesehen, aber ich habe mir gedacht, sie wäre durchaus auch für meine Zwecke geeignet.« Er schob die Hände in die Taschen seines Kittels. »Sonst musste ich bei Anbruch der Dunkelheit immer mit dem Malen und Zeichnen aufhören, und vor allem an den kurzen Wintertagen hat mich das stark eingeschränkt.« Er sah seine Tochter an, die immer noch wie gebannt den riesigen Scheinwerfer musterte. »Aber das weißt du ja.«
Sachte strich er ihr über die glatten schulterlangen Haare, die daraufhin sofort elektrisiert in alle Richtungen abstanden.
»An was hast du heute gearbeitet, Papa?«, fragte sie und sah sich in seinem Atelier um. Sog den Geruch aus Ölfarbe und Terpentin ein, der sie schon ihr Leben lang begleitet hatte und den sie so liebte. Unzählige Leinwände in Keilrahmen standen nach Größen geordnet an die Wände gelehnt und engten den Platz zum Arbeiten immer mehr ein. Der Raum wuchs langsam, aber sicher zu, und das Viereck, das ihrem Vater vor dem Fenster verblieben war, hatte nur noch die Ausmaße von zwei mal zwei Metern. Er hatte den Boden an dieser Stelle mit einem Bettlaken abgedeckt, das mit Farbsprenkeln nur so übersät war, noch weit mehr als sein Kittel, den er ab und zu austauschte.
Sie entdeckte eine großformatige Leinwand, auf der eine eigenwillige Komposition zu sehen war, und als Angelika näher trat und das Motiv genauer betrachtete, riss sie die Augen auf. Ein tieforangefarbener Kreis schwebte zwischen einem Dreieck und in die Höhe ragenden Pfeilen. Allerdings erschloss sich Angelika die Szene nur, weil sie im Betrachten der Bilder ihres Vaters geschult war. Denn seine abstrakten, flügelartigen Kalligrafien, kombiniert mit Piktogrammen, die anmuteten, als seien sie Teil von Höhlenzeichnungen, ließen für den Betrachter immer verschiedene Deutungen zu.
Für Angelika handelte es sich ganz klar um die schwarze Silhouette eines Vogels, der mit ausgebreiteten Flügeln vor der Sonne entlangzuschweben und sich über eine Baumgruppe zu erheben schien. Für den ungeübten Betrachter wäre es wahrscheinlich lediglich eine Ansammlung von Strichen gewesen. Außer der Sonnenkugel war auf dem Bild alles in Schwarz-Weiß gehalten. Angelika sah darin genau die Situation, die sie vor einer halben Stunde draußen beobachtet und mit ihrer imaginären Kamera festgehalten hatte.
»Hast du das heute gemalt?«, fragte sie.
»Ach, das!«
Ihr Vater kam näher. Er war hochgewachsen, hatte in den letzten Jahren an Gewicht zugelegt. Angelika konnte sich nur noch schemenhaft an die magere, sehnige Gestalt mit Stoppelbart erinnern, die aus dem Krieg zurückgekehrt war. Damals war sie sieben Jahre alt gewesen. Doch wie ihre Mutter seitdem mindestens einmal wöchentlich wiederholte, hatte er Glück gehabt. Er war nur zwei Jahre in französische Gefangenschaft geraten und auf dem Weingut nahe Straßburg gut behandelt worden. Im Herbst 1947 hatte er plötzlich wieder vor ihrer Tür gestanden, und seine Kinder hatten ihn nicht wiedererkannt.
Ihr Vater legte Angelika seinen schweren, kräftigen Malerarm um die Schulter. »Nein, Geli, erinnerst du dich nicht? Ich habe es schon vor einigen Wochen gemalt, aber jetzt erst den Firnis aufgetragen. Die Ölfarbe musste so lange trocknen.«
Angelika beugte sich ganz dicht nach vorne, sodass sie jedes Detail der dick aufgetragenen Ölfarbe, die sich aus dem Bild hervorhob, erkennen konnte. Sie betrachtete die Striche des stilisierten Vogels, an dessen Brust sie einige weiße Pinseltupfer ausmachte.
»Eine Elster?«
»Ja, genau. Sie sitzt doch immer in der mittleren von den drei Eichen. Ich denke, sie hat dort gebrütet.«
Er drückte liebevoll ihre Schulter. »Ein schöner Anblick, nicht wahr?«
Deshalb war ihr das Bild vorhin so seltsam vertraut erschienen, als sie es in natura gesehen hatte. Sie wusste, dass ihr Vater im Sommer häufiger mit seiner Staffelei im Park saß und malte. Nicht nur mit seinen Studentengruppen, sondern auch mit Künstlerkollegen oder alleine. Schon manches Mal hatte sie ihn begleitet. Aber was war es für ein Zufall, dass die Elster für ihn und für sie zur gleichen Stunde in dieselbe Richtung geflogen war und sie beide das Bild, jeder auf andere Weise, für so bemerkenswert gehalten hatten?
Angelika drehte sich zu ihrem Vater um. »Weißt du was? Genau die gleiche Szene habe ich vorhin beobachtet, als ich unten auf der Karlsaue gesessen habe. Und ich hätte sie fotografiert, wenn ich deine Kamera hätte benutzen dürfen.«
Ihr Vater hatte sich eine der ersten Kleinbildkameras angeschafft, eine Kodak. Die Kataloge über die technischen Daten der verschiedenen Kameras, die er sich zuvor hatte schicken lassen, war Angelika Seite für Seite, Zeile für Zeile durchgegangen. Sie hatte die Abbildungen, auf denen jedes einzelne Detail am Ende eines langen Strichs mit einer winzigen Zahl versehen und auf einer Liste bezeichnet war, immer wieder betrachtet, mit den anderen Modellen verglichen und schließlich seine Kaufentscheidung maßgeblich beeinflusst. Nach dem Kauf der Kamera hatte sie ihrem Vater zugeredet, sich eine eigene Dunkelkammer einzurichten. Wie bei allem, was er tat, hatte er Angelika in die neuen Techniken einweihen wollen, die er sich nach und nach selbst erarbeitete, stieß jedoch immer wieder auf die überraschende Erkenntnis, wie viel sie bereits darüber wusste. Das neue Medium schien auf sie eine größere Faszination auszuüben als auf ihn selbst.
»Fotografiert!«, wiederholte er leise. »Dabei muss man die Belichtungszeit berücksichtigen, denn es wäre eine Aufnahme gegen die Sonne, aber im Prinzip hast du recht: Die Szene eignet sich besser für eine Fotografie, denn es läuft alles nur auf den Augenblick hinaus … Den Malern hingegen bleiben Stunden oder Wochen, um ihr Sujet zu erfassen und eine Idee, eine Komposition, ein Bild zu finden.«
Er räusperte sich und sah sie forschend an: »Zeichnen und Malen ist die Grundlage allen künstlerischen Schaffens. Und Kunst spiegelt die Wirkkräfte der Zeit wider wie kein anderes Medium. Möchtest du es auch einmal wieder mit einem Stift oder dem Pinsel versuchen? Du hast doch wirklich Talent!«
Angelika schüttelte den Kopf. Sie hatte einige Zeit Spaß am Zeichnen und Malen gehabt. Durch die geduldige und fachkundige Anleitung ihres Vaters hatte sie gelernt, die Sujets, wie er sie nannte, aus einem besonderen Blickwinkel zu sehen. Er hatte ihr beigebracht, sich auf die Details der Natur in der Stadt, auf Kleinigkeiten, außergewöhnliche Konstellationen oder bestimmte Bildausschnitte zu konzentrieren, die man sonst leicht übersah. Rote Beeren, halb bedeckt von Raureif vor einem alten Fensterrahmen, grün gesprenkelte Vogeleierschalen auf der Parkbank, frisch aufblühende Seerosen im Springbrunnenbecken, ein Spinnennetz in der Armbeuge der Karlsstatue, in dem Tropfen von Morgentau glitzern. Er hatte ihre kleinen Arbeiten ernst genommen, sie ermuntert, gelobt und gefördert, ihr Auge für Perspektive und Proportionen geschult, als sei sie eine seiner begabten Kunststudenten.
Im Mädchenlyzeum hatte ihre Lehrerin großes Interesse an ihrer außergewöhnlichen Sichtweise gezeigt. Wenn sie ihre Werke ablieferte, erntete sie dafür nichts anderes als Lob. Die aufgeschlossene Lehrerin hatte es besonders hervorgehoben, als ihr Porträt nicht nur die Person, sondern auch die Umgebung, den Hintergrund und die persönlichen Dinge auf dem Tisch davor mit der gleichen Detailverliebtheit abbildete.
Angelika bekam auf ihre Bilder durchweg die besten Noten, so wie in Geschichte und Geografie auch. In Deutsch machte sie zu viele Rechtschreibfehler. Naturwissenschaften und Mathematik waren nur Nebenfächer, die sie achtbar meisterte. Das alles hatte sich grundlegend geändert, als das Lyzeum zu Beginn des letzten Schuljahres mit dem Jungengymnasium zusammengelegt worden war. Der konservative alte Kunstlehrer ließ kein gutes Haar an ihren abweichenden Interpretationen. In Mathematik, das nun ein Hauptfach war, wurden ihre Gedankengänge zu Algebra als absurd und lächerlich abgetan, nachdem sie sich einige Male getraut hatte, den Lösungsweg des Lehrers infrage zu stellen. Ähnlich erging es ihr in Physik, Biologie und Chemie. Fächer, die nun plötzlich wichtig sein sollten, nachdem sie auf der Mädchenschule jahrelang hauptsächlich in Hauswirtschaftslehre, Musik und Kunst unterrichtet worden waren. Sie wusste nur zu gut, dass ihre Versetzung dieses Jahr gefährdet war, und hoffte, es noch so lange wie möglich vor ihrer Mutter verbergen zu können.
»Geli?« Ihr Vater hatte aus seinen vorgefertigten Malgründen eine dünne grundierte Pressspanplatte hervorgeholt, die genau die Größe hatte, die sie eine Zeit lang so gemocht hatte. Er stellte sie ihr auf eine kleinere Staffelei neben die seine. Aber Angelika starrte das weiße Brett nur mit leeren Augen an und schüttelte langsam den Kopf. »Ich kann das nicht mehr, Papa. Mir fällt gar nichts mehr ein, was ich malen könnte.«
»Schade. Es ist eine Vergeudung deines Talents, glaube mir.«
Als er sah, wie sehr sie dieser Satz traf, strich er ihr mit der Rückseite seiner Finger über die Wange und nickte ihr aufmunternd zu. Dann zog er seinen Kittel aus, hängte ihn an den Haken hinter der Tür. Darunter kam sein schwarzer Pullunder zum Vorschein, dem man deutlich ansah, dass er ihn fast täglich trug.
»Na, komm! Lass den Kopf nicht hängen. Dann gehen wir jetzt mal in die Küche und sehen nach, ob es schon Abendbrot gibt.«
»Geli!«, hörte sie die sanfte Stimme ihrer Mutter, als sie die Treppe herunterkamen. Sie hatte sich zu ihr umgedreht und kam auf sie zu. Gerda Stein war selten streng mit ihren Kindern. Auch das unterschied sie von den meisten anderen Müttern dieser Zeit. Angelikas Klassenkameradinnen litten fast ausnahmslos unter der autoritären Erziehung ihrer Eltern und der Lehrer, allerdings – und das wunderte sie am meisten – scheinbar ohne ihre Berechtigung jemals infrage zu stellen.
An diesem Abend war in dem Gesicht ihrer Mutter, das sonst stets zufrieden aussah, obwohl sie den Haushalt mit vier Kindern nahezu alleine schulterte, überdeutlich die tiefe Sorge um ihre älteste Tochter abzulesen. Aus der aufgesetzten Tasche ihres Kleides holte sie einen Brief hervor und faltete ihn sorgfältig auseinander, so als würde ihr sogar diese Bewegung schon Mühe bereiten.
Angelika erfasste sofort, dass ihre Besorgnis allein mit diesem Schriftstück zusammenhängen musste, und ahnte auch bereits, um was es sich handelte. Kurz bevor ihre Mutter den Text vorlesen wollte, besann sie sich und realisierte, dass Angelikas Geschwister am Tisch saßen und schon gespannt die Ohren spitzten.
»Peter, geh nachsehen, ob die Kaninchen noch Wasser und Futter haben, Eberhard, schau doch einmal, ob Clara alle Hausaufgaben erledigt hat.«
Der letzte Hinweis erübrigte sich, und das wusste sie. Denn Clara war die Strebsamste unter den Kindern, und der Tag, an dem sie einmal einen Teil der Schularbeiten vergessen sollte, würde in die Geschichte der Familie eingehen. Clara sammelte derweil stumm die Fischchen ein, faltete das Pappaquarium zusammen, und ihre Brüder legten ihre Angeln in den Karton. Dann klappte Eberhard den Deckel der Küchenbank hoch, und seine Schwester verstaute das Spiel in ihrem Inneren.
»Seht euch lieber mal diesen Artikel an!« Der Vater hielt eine Zeitschrift in die Luft, die er im Flur von der kleinen Konsole genommen hatte.
»Der Spiegel ist ein linkes Blatt, sagt unser Deutschlehrer!«, warf Eberhard prompt ein.
»Das ist schon möglich, aber das bedeutet nicht unbedingt etwas Schlechtes!«, antwortete sein Vater.
Eberhard presste die Lippen zusammen, und es war ihm anzusehen, wie er überlegte, ob er es auf eine Auseinandersetzung mit seinem Vater ankommen lassen sollte. Wilfried Stein blätterte das orangefarben eingefasste Titelblatt auf und schlug mit dem Handrücken auf die Seite. »Hier: Laut einer Umfrage des Allensbach-Instituts über den Kunstgeschmack der Deutschen bevorzugen zwei Drittel echte Ölgemälde mit naturgetreuen Landschaftsdarstellungen, dicht gefolgt von religiösen Motiven.«
Angelika schüttelte den Kopf und rollte theatralisch mit den Augen. Sie war froh, der ernsten Unterhaltung über den ominösen Brief noch einmal entkommen zu sein. Ihr Vater setzte hinzu: »Und das ein Jahr nach der ersten Documenta! Habe ich damit denn gar nichts bewirkt? Man fragt sich, ob das deutsche Volk eigentlich in den elf Jahren nach der letzten Zurschaustellung entarteter Kunst durch die Nazis nichts dazugelernt hat.«
»Sag bloß nichts gegen den röhrenden Hirsch über dem Sofa der Deutschen, Wilfried!«, warf seine Frau ein, während sie einen Teller mit Aufschnitt und die Butterdose auf den Tisch stellte.
»Bei Kleves hängen neuerdings Bilder von traurigen Clowns im Wohnzimmer«, berichtete Clara und hoffte damit, alle mit dem Gipfel der Geschmacklosigkeit aus der Wohnung ihrer Klassenkameradin beeindrucken zu können. Aber Eberhard gab sich sofort alle Mühe, sie zu überbieten: »Und bei Brauns sind es feurige Zigeunerinnen mit tiefen Dekolletés über dem Ehebett!«
»Woher weißt du überhaupt, was Brauns im Schlafzimmer hängen haben?«, fragte Peter grinsend.
Eberhard errötete und beeilte sich zu erklären: »Die Tür stand offen, als wir durch den Flur in Martins Zimmer gegangen sind, um zusammen zu lernen.«
»Jetzt ist aber Schluss mit der Lästerei!«, rief ihre Mutter sie zur Ordnung und bat dann darum, sie vor dem Abendessen noch kurz mit Angelika allein zu lassen.
»Bei Lamballes hängt aber ein echter Trökes in der Bibliothek und sogar ein Baumeister im Esszimmer ihrer neuen Villa«, versuchte Peter die Unterhaltung über den Kunstgeschmack der Eltern ihrer Freunde in Gang zu halten, indem er mit den beiden bekanntesten abstrakten Künstlern der Nachkriegszeit auftrumpfte.
»Na, da hast du es! Arnaud Lamballe ist ja auch Franzose … und noch dazu Architekt!«, warf sein Vater ein und schlug mit der flachen Hand auf die Zeitschrift. »Anscheinend gehört doch ein gewisser Bildungsstand dazu, um dem geschmacklichen Analphabetentum, wie Erich Kästner es so richtig bezeichnet hat, zu entgehen.«
»Dazu gibt es ja den Kunstunterricht … damit unsere jungen Barbaren auf den richtigen Weg geleitet werden.« Gerda Stein breitete lächelnd die Arme aus, als würde sie eine Schar Gänse vertreiben, und wies ihren Kindern den Weg zur Tür. »Ihr könnt nachher beim Essen weiterdiskutieren.«
»Bestimmt geht es um ihre schlechten Noten«, flüsterte Clara mit einem Anflug von Schadenfreude, als ihre Brüder sie vor sich her aus der Küche schoben.
Peter warf Angelika einen mitfühlenden Blick zu. Er war ihr Lieblingsbruder. Äußerlich von Eberhard nur an einem Leberfleck hinter dem linken Ohrläppchen zu unterscheiden, ähnelte sein Charakter so gar nicht dem seines unberechenbaren Zwillingsbruders. Sondern er hatte das gleichmütige, stets um das Wohl seiner Mitmenschen besorgte Wesen eines Bettelmönchs. In seinem Leben, zumindest in seiner Wahrnehmung, gab es keine böswilligen Menschen. Niemand log, keiner schmiedete je hinterhältige Pläne oder wollte anderen übel. Peter sah an jedem nur die guten Seiten, und wenn ein Mensch keine besaß, fand er ihn mindestens einen »findigen Burschen« oder einen »passablen Kerl«. Er war selbst ohne jeden Ehrgeiz und hatte im Gegensatz zu Eberhard und Clara nur mittelmäßige Noten, doch das reichte ihm, und seine Empathie kannte keine Grenzen. Angelika sandte ihm ein verzagtes Lächeln, als er an ihr vorbeiging.
»Und schließt die Tür hinter euch!«, rief ihre Mutter ihnen hinterher.
»Was ist denn passiert?«, fragte Angelika und bedauerte es schon jetzt, der Anlass für den besorgten Ausdruck in ihren Augen zu sein.
Ihre Mutter holte den Umschlag wieder aus ihrer Rocktasche und redete nicht lange darum herum: »Ein Brief von deiner Schule, man schreibt uns, dass deine Versetzung gefährdet ist.«
Angelika folgte ihrem Blick zu ihrem Vater, der immer noch das Spiegel-Heft in der Hand hielt. Er konnte seine Überraschung nicht verbergen. Ganz offensichtlich wusste er noch nichts davon. Ihre Mutter sprach nun nur noch ihn an, so als sei Angelika gar nicht anwesend: »Ihre Leistungen sind in fast allen Fächern mangelhaft, außer in Turnen, und in den letzten Wochen ist sie an manchen Tagen gar nicht mehr zum Unterricht erschienen.«
Dann fixierte sie wieder Angelika, die ihrem Blick auswich. Fast verspürte sie so etwas wie Erleichterung, dass es endlich heraus war. Dass sie nicht mehr länger mit der Lüge leben musste und ihren Eltern vormachen, sie ginge gerne zur Schule, würde eifrig lernen und strenge sich an. Die Wahrheit hätte sich gut anfühlen können – wenn sie damit ihrer Mutter nicht solchen Kummer bereiten würde. Diese legte den Brief auf dem Küchentisch ab und fasste sie an beiden Armen, sah ihr in die Augen.
»Was ist bloß passiert, Geli! Letztes Jahr noch hat mich die Direktorin des Lyzeums zu sich gerufen und mir deine Zeichnungen vorgelegt. Ich solle mir das ansehen, diese Schraffierungen, dieses Talent. Du seist einfach in allem herausragend, fächerübergreifend.«
Angelika sah hilflos an ihr vorbei in Richtung der Küchentür. Fast beschwor sie sie, sich zu öffnen. Sie hatte keine Antwort darauf und war erleichtert und auch verwundert, wie schnell ihr Wunsch in Erfüllung ging, als Peter noch einmal die Tür aufriss und den Kopf in den Spalt steckte.
»Wann gibt es Abendbrot?«, fragte er, und jeder durchschaute seinen Versuch, Angelikas unangenehmes Gespräch abzukürzen.
»In einer halben Stunde«, lautete die Antwort ihrer Mutter, und als er in der halb geöffneten Tür verharrte und Angelika einen Blick zusandte, aus dem sie seinen unausgesprochenen Willen zum Beistand ablesen konnte, fügte ihre Mutter hinzu: »Du kannst ihr jetzt nicht helfen. Lass uns bitte noch einen Augenblick allein.« Mit sichtbarem Widerwillen zog er die Tür wieder zu.
Ihre Mutter sagte: »Wie soll es denn mit dir weitergehen? Du musst doch wenigstens die Mittlere Reife ablegen!«
Ihr Vater hatte sich inzwischen von seiner Frau den Brief geben lassen und ihn überflogen. »Mir scheint, das sind ein paar schlechte Noten zu viel«, murmelte er mehr zu sich als zu Angelika und ihrer Mutter. Er lehnte sich an den Küchentisch und rieb sich über das Kinn. Dann fragte er Angelika: »Glaubst du denn, dass du dich noch einmal verbessern kannst, um den Schulabschluss zu schaffen?«
Angelikas Gesicht war wie versteinert. Sie wusste nicht, was sie antworten sollte.
Zu seiner Frau gewandt, sagte ihr Vater leise: »Sie ist fünfzehn, Gerda. In drei Monaten wird sie sechzehn. Da muss man nicht unbedingt noch weiter zur Schule gehen!«
Doch seine Frau war ganz anderer Meinung. Wenn es etwas gab, wovon sie überzeugt war, dann war es die Tatsache, dass nicht nur ihre Söhne eine gute Schulbildung erhalten und einen Beruf erlernen sollten, sondern auch ihre Töchter. Von ihrem Kummer war nichts mehr zu spüren, als sie ihrem Mann fest in die dunklen Augen sah und auf ihrer Meinung beharrte.
»Kommt gar nicht infrage! Sie legt das Abitur ab!«
»Aber man kann es nicht einfach erzwingen. Sie hat sich erst derart verschlechtert, seit das Lyzeum mit dem Jungengymnasium zusammengelegt wurde. Es sind nun weit mehr Fächer und eine andere Gewichtung. Man hat den Mädchen damit nicht unbedingt einen Gefallen getan, so modern die Idee auch sein mag. Nicht jeder ist dazu geeignet, das Gymnasium zu besuchen und die Hochschulreife zu erlangen. Vielleicht sollte sie dann wenigstens auf die Realschule wechseln und die Mittlere Reife machen.«
Das Gesicht seiner Frau, das sonst oft so weich und unbedarft wirkte, zeigte in diesem Moment eine ganz ungewohnte Strenge. Sie schüttelte langsam den Kopf: »Wir dürfen nicht einfach aufgeben. Notfalls muss sie eben die Klasse wiederholen.«
Wilfried Stein wandte sich ab. Er wusste, dass jede weitere Diskussion im Augenblick zwecklos war. Sein Blick streifte seine Tochter, die die ganze Zeit kein Wort dazu gesagt hatte, obwohl es um ihre Zukunft ging. Sein Lieblingskind war im letzten Jahr in die Höhe geschossen. Lang und dünn stand sie da, überragte ihre Mutter bereits um einen halben Kopf. Ihr Körper begann sich gerade erst von dem eines Mädchens in den einer jungen Frau zu verwandeln, mit kaum sichtbaren weiblichen Rundungen. Die schulterlangen braunen Haare umrahmten ein schmales Gesicht, in dem die großen Augen auffielen. Sie ähnelten seinen, das wusste er. Tief in seinem Innersten verspürte er die Gewissheit, dass sie ihrer ältesten Tochter keinen Gefallen taten, wenn sie sie weiter auf das Gymnasium zwangen.
Er rieb sich die Hände und fragte: »Vielleicht sollten wir erst einmal zu Abend essen und dann eine Nacht darüber schlafen, wie es mit Geli weitergehen soll. Heute werden wir uns wohl nicht einigen.«
Angelika atmete tief ein und aus. Sie wusste, dass es nicht viele Eltern gab, die so verständnisvoll auf einen blauen Brief reagiert hätten und bei denen die Meinung einer Mutter genauso viel zählte wie die eines Vaters. Ihre Situation war nicht hoffnungslos, aber ihr wurde klar, dass sie erst einmal weiter zur Schule gehen musste. Allein der Gedanke an die endlosen, langweiligen und peinigenden Stunden, die sie morgen Vormittag dort absitzen würde, verursachte einen dumpfen Schmerz in ihrer Brust. Was sie während des Unterrichts vor allem empfand, war ein Gefühl der Schwäche.
Am nächsten Morgen hatten sich die traurigen Empfindungen noch verstärkt. Als ihre Mutter sie weckte, zog Angelika sich die Bettdecke über den Kopf und versuchte, nicht an den Tag zu denken, der vor ihr lag. Seit einer Woche war sie nicht in der Schule gewesen, und sie konnte sich sehr genau vorstellen, wie die Lehrer und ihre Mitschülerinnen sie empfangen würden.
»Aufstehen, Angelika! Du brauchst dich nicht zu verstellen, ich weiß, dass du wach bist.«
Ihre Mutter zog ihr die Decke weg und stemmte die Arme in ihre Taille. Bei ihrer zierlichen Statur wirkte die Geste nahezu rührend.
Sie hörten die Schritte und Stimmen ihrer Brüder, die schon aus dem Nachbarzimmer kamen und ins Badezimmer rannten. Keiner von ihnen hatte solche Schwierigkeiten in der Schule wie sie. Eberhard schüttelte die guten Leistungen mit seinem hellen Verstand aus dem Ärmel. Peter hielt sich wacker im Mittelmaß. Ihre kleine Schwester ging mehr als gerne zur Grundschule und war regelmäßig Klassenbeste, was sie sich mit emsigem Fleiß erarbeitete. Sie stand schon fertig angezogen vor dem ovalen Spiegel, der an ihrem gemeinsamen Kleiderschrank hing, und war längst dabei, sich mit geschickten kräftigen Fingern ihre langen Haare zu festen Zöpfen zu flechten. Ein zuversichtliches Lächeln umspielte ihre Mundwinkel, in dem die Vorfreude auf einen Tag voller kleiner glücklicher Momente lag.
»Heute darf ich zwei neue Schulhefte anfangen«, sagte sie und deutete mit dem Kinn in Richtung ihres Ranzens aus gewienertem braunem Leder, der auf dem Korbstuhl stand. Davor lagen zwei taubenblaue Hefte mit blütenweißen Aufklebern, auf die sie bereits mit ihrer akkuraten Kleinmädchenschrift ihren Namen geschrieben hatte: ClaraStein.
Angelika lag noch immer im Bett und schaute sie an, wie man ein exotisches Tier in einem Zoogehege betrachtet. Warum konnte sie nicht die gleiche Freude über ein neues, unberührtes Rechen- oder Schreibheft empfinden wie ihre Schwester, fragte sie sich. Alles wäre so einfach!
Clara war fertig mit dem Frisieren und machte einen Schritt auf den Stuhl zu. Ehrfürchtig nahm sie eines der Hefte in die Hand, hielt es sich vor das Gesicht und sog hörbar die Luft ein. »Es gibt keinen Geruch, den ich lieber mag!«
»Das ist der frische Leim!«, erklärte ihr ihre Mutter, und es war ihr anzusehen, wie sehr sie sich gerade selbst über die gravierenden Unterschiede zwischen ihren Kindern wunderte. Aber ein wenig gab sie auch ihrem Mann die Schuld. Er hatte Gelis Augenmerk und Interesse viel zu sehr auf die schönen Künste gelenkt. Sie als Einziges seiner Kinder für würdig befunden, in die Geheimnisse seiner Welt eingeweiht zu werden. Und das war nun das Resultat. Während Clara andächtig mit aller Vorsicht ihre Hefte in den Ranzen schob, um nur ja kein Eselsohr zu riskieren, legte sich Angelika die Hände vor das Gesicht. Der Eifer ihrer kleinen Schwester war in ihrer Situation kaum zu ertragen.
»Komm schon, Geli, jetzt wird es aber wirklich Zeit.«
Ihre Mutter griff nach ihrer Hand und zog sie von der Matratze hoch.
»Wenn du zu spät kommst, machst du es nur noch schlimmer!«
Es kam noch viel schlimmer, als sich ihre Mutter ihren avantgardistischen, glockigen Mantel anzog, der in keiner Weise der aktuellen Mode entsprach, den Hut auf den Kopf setzte, sich entgegen ihrer Gewohnheit vor dem Spiegel rosa Lippenstift auftrug wie ein kleines Mädchen, das sich zum ersten Mal schminkt, und sagte: »Ich begleite dich heute zur Schule.«
In einen Stoffbeutel packte sie eine Schachtel Pralinen und eine Flasche französischen Cognac, den ihr Vater einmal jährlich bekam, wenn er der Familie, bei der er während seiner Gefangenschaft im Elsass gelebt hatte, einen Besuch abstattete. Was hatte sie mit diesen Kostbarkeiten vor? Angelika wäre am liebsten im Erdboden versunken.
Der Weg über den Schulhof neben ihrer winzigen Mutter, deren Mantel sich im Frühlingswind weit aufblähte, glich einem Spießrutenlauf. Die Gespräche verstummten, alle drehten sich zu dem merkwürdigen Paar um, das auf den Eingang des Schulgebäudes zustrebte. Angelika konnte das Getuschel und Kichern der anderen Schülerinnen und Schüler hören. Dann wurde es von der Schulklingel übertönt. Ihre Mutter verschwand im Büro des Direktors, während sie die Treppen hinauf zu ihrem Klassenraum stieg. Heute kamen ihr die Stufen höher vor als sonst. Ihre Beine waren so schwer, als klebten Bleigewichte unter ihren Sohlen.
»Stein«, sagte Herr Riedel, kaum dass sich alle gesetzt hatten. »An die Tafel!«
Im Klassenraum breitete sich eine angespannte Stille aus. Angelika sah ihren Mathematiklehrer an und versuchte, ihm ihre Angst nicht zu zeigen. Irmgard, die neben ihr saß, sah sie mitleidig an. Sie bewegte tonlos die Lippen, und Angelika konnte die Worte: »Zeig’s ihm!« ablesen. Widerstrebend stand sie auf und lief mit hölzernen Bewegungen den Gang zwischen den Bänken hindurch auf die Tafel zu.
»Das kann er sich sparen. Die weiß doch sowieso nicht die Lösung«, hörte sie eine Mädchenstimme flüstern.
»Nicht einmal ansatzweise!«, gab ein Junge zurück.
Einige kicherten.
»Ruhe!«, donnerte Riedel.
Als Angelika sich der Tafel näherte, schienen die Zahlen, Klammern, Zeichen und kleinen Potenzziffern, die er zuvor mit weißer Kreide daran geschrieben hatte, vor ihren Augen zu verschwimmen. Von ihrem Platz aus hatte sie die Gleichung wenigstens lesen können. Jetzt, wo sie so dicht davorstand, gelang ihr selbst das nicht mehr. Herr Riedel gab ihr die Kreide. Er sagte: »Fang an zu rechnen! Schreib die Lösung hin.«
Als Angelika nicht reagierte, holte er genüsslich sein Notizbuch aus der Westentasche und zückte einen Stift. Gleich würde er ihr eine Sechs notieren, und damit wäre ihr Schicksal besiegelt, durchfuhr es sie. War es nicht genau das, was sie wollte? Einfach nicht mehr zur Schule gehen müssen? Alle Sorgen los sein? Doch dann meldete sich ihr Stolz. Was wäre das für ein kläglicher Abgang. Fieberhaft suchten ihre Gedanken nach einem Ausweg, einer Lösung, mit der sie sich nicht vollkommen blamieren würde. Die Minute, die sie die Gleichung von ihrem Platz aus an der Tafel gesehen hatte, war lang genug gewesen, um sie im Gedächtnis zu behalten. Und mit einem Mal wusste sie, dass es nicht das erste Mal war, dass ihnen diese Aufgabe gestellt wurde.
Sie nahm allen Mut zusammen, hob langsam den Arm und berührte mit dem weißen Kreidestück die dunkelgrüne Tafelfarbe. Mit zitternder Schrift schrieb sie eine Zahlenfolge hinter die Aufgabe, manche Ziffer nicht ganz auf Höhe der anderen, manche schief, und setzte sie in Klammern. Aus dem Augenwinkel konnte sie die Überraschung im Gesicht von Herrn Riedel sehen. Er sagte kein Wort, stand mit verschränkten Armen in gebührendem Abstand neben ihr und beobachtete, wie sie hoch konzentriert schrieb und schrieb. Sie fügte Plus- und Minuszeichen hinzu, setzte das x für die Unbekannte immer wieder an eine andere Stelle. Zwischendurch hielt sie nur kurz inne, wenn sie überlegen musste. Die Spannung in der Klasse stieg. Nun weiß sie nicht mehr weiter, dachten die anderen gewiss. Doch die Unterbrechungen dauerten nicht lange. Ihre Schrift wurde sicherer, die Zahlen akkurater. Keine ihrer Mitschülerinnen sagte etwas, sie hatte ihre volle Aufmerksamkeit, nicht einmal ein Flüstern war zu hören. Nur das leise Quietschen der Kreide, als Angelika die Tafel nach und nach mit unzähligen Zeichen bedeckte. Der Platz auf den äußeren Flügeln reichte nicht mehr aus, und sie klappte sie auf. Es mussten einige Minuten vergangen sein. Schließlich schrieb sie in die unterste rechte Ecke ein Gleichheitszeichen und dahinter eine große Null. Sie richtete sich auf, legte den Kreidestummel in die Metallrinne unter der Tafel und strich sich den weißen Staub von den Händen.
Herr Riedel blieb einige Sekunden unbeweglich stehen und betrachtete ihre Arbeit. Dann machte er einen Schritt nach vorn, nahm ein neues Stück Kreide aus der Ablage. Er tauschte eine Drei gegen eine Sechs, wischte mit dem Finger eine Klammer weg. Durch eine Zeile ihrer Rechnung machte er einen dicken weißen Strich, hinter das Ergebnis unten rechts schrieb er einen Haken.
Er sagte: »Erstaunlich … wirklich erstaunlich.«
Danach schrieb er etwas in sein kleines Notizbuch.
»Note Drei. Setzen.«
Angelika hätte aufjauchzen können, doch sie schluckte jeden Anflug von Triumph herunter. Mit durchgedrücktem Rückgrat ging sie zurück zu ihrem Platz. Sie begegnete den Blicken der Mädchen aus ihrer Klasse und konnte das ungläubige Staunen in ihren Augen ablesen. In manchen Gesichtern stand Neid, in manchen glaubte sie echte Anerkennung zu sehen.
Als sie zu ihrer Bank am Ende des Klassenzimmers kam, nickte ihr Irmgard zu. Sie war die Einzige, die zu ihr hielt, obwohl sie dadurch unter den anderen Schülerinnen einen schweren Stand hatte. Auch sie war überrascht über Angelikas Auftritt, aber ihr war deutlich anzusehen, wie sehr sie sich darüber freute.
Erst als die Mathematikstunde zu Ende war und sie ihre Pausenbrote unter den Pulten hervorholten, traute Irmgard sich nachzufragen.
»Wie hast du das gemacht? Du warst doch wochenlang nicht im Unterricht, und das war eine richtig schwierige Gleichung.«
Angelika wartete erst, bis sie alleine auf dem Gang vor ihrer Klasse waren. Dabei überlegte sie, ob sie ihrer Freundin ihr Geheimnis offenbaren oder sich lieber weiter in ihrer Bewunderung sonnen sollte. Sie entschied sich für Ersteres, denn sie mochte sie zu gerne, um unehrlich ihr gegenüber zu sein.
»Es war ganz einfach. Riedel hat fast genau diese Aufgabe bereits vor zwei Wochen gestellt. Es war das letzte Mal, dass ich im Mathematikunterricht war. Und die Streberin Mathilde hat den Lösungsweg an die Tafel geschrieben.«
Irmgard war gerade im Begriff, in ihr Leberwurstbrot zu beißen, ließ es aber sinken und machte große Augen. »Heißt das, du hast gar nicht gerechnet?«
Angelika schüttelte den Kopf: »Du weißt doch, dass ich dazu nicht in der Lage bin.«
»Aber das bedeutet ja, dass du dir alles genau gemerkt hast, was da stand.«
Angelika zuckte mit den Schultern. »Ja, fast!«
Sie wickelte langsam ihr Graubrot aus dem Pergamentpapier und klappte es auseinander, um nachzusehen, aus was der Belag bestand. »Offenbar bis auf die beiden Zahlen und die Zeile, die er durchgestrichen hat.«
Mit einer energischen Bewegung hielt sie Irmgard ihr Brot entgegen. Möchtest du tauschen? Ich habe Blutwurst drauf.«
Bereitwillig gab Irmgard ihr das Leberwurstbrot und sah sie dabei unverwandt an. »Weißt du eigentlich, wie außergewöhnlich das ist? Wer kann sich so eine lange Zahlenfolge schon merken, und das nach der langen Zeit?«
Angelika hatte darüber nie nachgedacht, denn was ihrer Freundin so bemerkenswert erschien, war für sie ganz selbstverständlich. Einen Satz, mehrere Sätze, eine Zahlenfolge, ein Bild, ein Arrangement sehen und sich alles merken, war ein und derselbe Prozess. Kein zweiter Schritt lag dazwischen. Da war kein zeitlicher Abstand, es war keine Wiederholung erforderlich. Das einmal Gelesene, einmal Gesehene, brannte sich ohne jede Anstrengung in ihr Gedächtnis ein, und meistens wusste sie deshalb auch, was als Nächstes kommen würde.
»Aber es ist kein Wunder! Deshalb bist du auch in Geschichte und Erdkunde so gut.« Irmgard presste die Mundwinkel zusammen und setzte bedauernd hinzu: »Wenn du denn mal regelmäßig in den Unterricht kommst. Würdest du das tun, hättest du nur die allerbesten Noten!«
Angelika betrachtete ihre Freundin. Was sie an Irmgard so beeindruckte, war ihre Art, immer das Beste in den meisten Menschen zu sehen, mit ganz wenigen Ausnahmen. Ein Charakterzug, in dem sie ihrem Bruder Peter glich und den Angelika noch dazu sehr häufig zu spüren bekam. Manchmal hatte sie geradezu den Eindruck, dass Irmgard sie anhimmelte.
»Für dich ist es eine Kleinigkeit, dir alle Namen, Zahlen und Bilder zu behalten!« Irmgard klang so begeistert, als habe sie gerade eine bahnbrechende Entdeckung gemacht.
»Das ist ja auch nicht weiter schwer«, wollte Angelika gerade antworten, aber sie merkte, wie hochmütig der Satz klingen konnte. Während sie nach einer unverfänglicheren Erwiderung suchte, hörten sie Schritte und sahen dann beide, wie jemand die Treppe heraufkam. Als sie erkannten, um wen es sich handelte, verschluckte Angelika ihre Antwort. Es war der gefürchtete Direktor persönlich. Seine harten Sohlen hallten in dem langen Gang, von dem die Klassenräume abgingen, als er im Stechschritt auf sie zukam. Erstens durften sich die Schülerinnen während der großen Pause nicht im Gebäude aufhalten. Zweitens sah sein scharf geschnittenes Gesicht sie so streng an, dass Angelika sofort Bedenken kamen. Hatte Riedel ihren einfachen Trick durchschaut, als Täuschungsversuch angesehen und gemeldet?
Sie schluckte hastig den Bissen Leberwurstbrot herunter, wischte sich den Mund mit dem Handrücken ab und stand stramm wie ein Soldat.
»Guten Morgen, Herr Direktor«, grüßten beide Mädchen die Respektsperson, so synchron und monoton, wie es ihnen beigebracht worden war. In seiner Anwesenheit gab sich jeder Schüler des Gutenberg-Gymnasiums die größte Mühe, alle Verhaltensregeln aufs Peinlichste zu beachten, denn er war für seine Härte berüchtigt. Und heute bemühte sich sogar Angelika, nicht aus der Reihe zu tanzen.
»Stein«, sagte er, und seine kalten Augen sahen von einem Mädchen zum anderen.
»Das bin ich«, antwortete Angelika, als hätte er eine Frage gestellt.
»Das weiß ich natürlich! Mitkommen!«
Angelika drückte ihrer Freundin das angebissene Brot in die Hand, und alles, was sie noch wahrnahm, war deren mitleidiger Blick, bevor sie hinter dem Direktor herging. Sie betrachtete die Rückseite seines grauen Anzugs, sah von oben die Schuppen auf seinen Schultern, als sie die Treppenstufen hinunterstiegen, und durch ihren Kopf rauschten die verschiedenen Varianten dessen, was sie jetzt erwartete. Von draußen drangen die Geräusche der Schüler aus der großen Pause an ihr Ohr. Als der Direktor die Tür zu seinem Büro öffnete, vor dem die Schulsekretärin saß, fragte Angelika sich, weshalb er nicht sie geschickt hatte, um sie zu holen, sondern selbst gekommen war.
Auf seinem Schreibtisch stand noch die staubige Flasche Cognac, daneben lagen die Sarotti-Pralinen, und Angelika empfand den Bestechungsversuch ihrer Mutter als ausgesprochen peinlich, während Pfeiffer um den Tisch herumging und sich auf seinen Stuhl setzte. Er bot ihr nicht einmal einen Platz an, sondern ließ sie vor seinem Schreibtisch stehen.
Angelika hatte gleich gewusst, wie verheerend es sich auswirken konnte, ihn mit derartigen Geschenken milde stimmen zu wollen. Es würde bei einem Mann, der bekannt für seine strengen Grundsätze war, genau das Gegenteil bewirken. Pfeiffer blätterte in einer Mappe, und fast eine Minute lang tat er so, als sei sie gar nicht anwesend. Angelika betrachtete, wie schon so oft zusammen mit Irmgard während des Physikunterrichts, fasziniert die schwarzen Haare, die aus seinen Nasenlöchern sprossen. Als er endlich aufsah, lag in seinem Blick eine kalte Verachtung, deren Ausmaß Angelika überraschte. Ihr Mund wurde trocken.
Dann begann er zu sprechen: »Du hast an mehreren Tagen die Schule geschwänzt. Du stehst in fast allen Fächern auf der Note ungenügend. Du versuchst, deinen Lehrer darüber hinwegzutäuschen, dass du im Fach Mathematik den Anschluss völlig verloren hast, indem du eine auswendig gelernte Lösung an die Tafel schreibst, ohne auch nur ansatzweise zu rechnen, und als sei das Maß nicht längst voll, kommt deine Mutter mit Geschenken in mein Büro, ohne sich darüber im Klaren zu sein, was die Vorteilsannahme für den Direktor eines Gymnasiums bedeutet.«
Angelika sah auf ihre Fingernägel. Ihr fiel auf, dass sie sie heute früh nicht sauber geschrubbt hatte, wie sie es sonst jeden Morgen tat. Aber ihr hatte die Zeit gefehlt, und ihre Mutter hatte wohl in der Aufregung selbst vergessen, sie darauf hinzuweisen. Jetzt hatten sie einen hässlichen schwarzen Rand von ihrem gestrigen Tag auf der Karlsaue. Was würde er nun bloß von ihr denken? Beschämt verschränkte sie sie vor ihrem Schoß. Und warum hatte ihr Mathematiklehrer erst die Note Drei für sie aufgeschrieben, wenn er danach zu Pfeiffer lief und sie anschwärzte? Etwas musste ihn an ihrer Lösung doch beeindruckt haben.
Angelika war nicht bewusst, dass diese Nebensächlichkeiten für die Entscheidung des Direktors nicht mehr die geringste Rolle spielten. Er hatte seinen Entschluss schon lange gefasst.
Schuldirektor Pfeiffer war seit dem Tag nicht mehr glücklich, an dem sein Knabengymnasium zum Schuljahresbeginn 1952/53 mit dem benachbarten Lyzeum zusammengelegt worden war. Bis dahin war er ein zufriedener Zigarrenraucher mit einer Vorliebe für gute Hausmannskost und ausgefallene physikalische Experimente gewesen. Selbst verheiratet, aber kinderlos, hatte er die Gymnasiasten alle als seine Kinder betrachtet. »Meine Buben« hatte er sie immer gerne genannt. Aber als die Mädchen kamen, hatte er ihnen nicht die gleichen positiven Gefühle entgegenbringen können. Im Mädchenlyzeum hatte der Schwerpunkt der Bildung auf Zeichnen, Handarbeit, Religion und Hauswirtschaft gelegen. Naturwissenschaften, Mathematik und Latein galten als zu schwierig für die Schülerinnen und wurden nur am Rande unterrichtet. Pfeiffer war ein eifriger Verfechter der Theorie, dass durch allzu viel Bildung die eigentliche Aufgabe der Frau als Hausfrau, Gattin und Mutter zu sehr in den Hintergrund trat und die weibliche Demut Schaden nehmen könne. Und ausgerechnet ihm wurde die Aufgabe übertragen, das Lyzeum im Rahmen der neuerdings befürworteten Koedukation in sein geliebtes Jungengymnasium zu integrieren.
Er hielt die unscheinbare Schülerin mit den glatten braunen Haaren und dem schmalen Gesicht, die vor ihm stand und ihre Hände versteckte, gar nicht für dümmer als die anderen. Angelika Stein war in seinem Unterricht sogar mit überraschenden und fantasiereichen Ansätzen zur Erklärung physikalischer Phänomene aufgefallen. Doch sie hatte etwas an sich, das sie von den anderen Mädchen unterschied. Es war ein Funke des Aufbegehrens und Hinterfragens in ihrem Blick, den er nicht gutheißen konnte, schon gar nicht bei einer Angehörigen des weiblichen Geschlechts.
»Du kannst jetzt gehen«, sagte Pfeiffer, jede Silbe betonend.
Als sie den Kopf hob, ihn mit ihren großen Augen ansah und überlegte, ob er »zurück in die Klasse« meinte, setzte er von selbst hinzu: »Nach Hause.« Während sie sich schon umdrehte, stellte er klar: »Und du brauchst auch nicht wiederzukommen!«
Sie hätte sich freuen sollen, denn das war es doch, was sie gewollt hatte: nie wieder in die Schule gehen müssen! Aber ein Gefühl der Zufriedenheit stellte sich in diesem Moment nicht ein. Angelika drehte sich um und ging zur Tür, drückte die Klinke herunter, und gerade als sie sie öffnete und ihr der Geruch von Bohnerwachs entgegenschlug, fiel ihr etwas ein. Warum sollte sie die guten Sachen dort auf dem Schreibtisch lassen, wenn der Direktor sie ohnehin nicht haben wollte? Sie wusste doch, wie sehr ihr Vater den Cognac schätzte, den er jedes Jahr von der elsässischen Familie geschenkt bekam, bei der er als Kriegsgefangener gearbeitet hatte.
»Ich darf doch?«, sagte sie und merkte selbst ein wenig erschrocken, wie vorlaut ihre Stimme klang. Sie streckte die Hand aus, griff nach dem Cognac und der Pralinenpackung. Spürte das kalte Glas des Flaschenhalses in ihrer Handfläche und sah, wie Pfeiffer Luft holte und dazu ansetzte, sie zurückzuhalten, aber den Mund wieder schloss. Sah, wie sich seine Augen verengten, wie er die Lippen zusammenpresste, bis sie zu einem missbilligenden geraden Strich wurden. Diesen Blick spürte sie in ihrem Rücken, als sie mit den beiden Geschenken ihrer Mutter sein Büro verließ. Jetzt gab es endgültig kein Zurück mehr.
Angelika trat auf den Gang, atmete tief durch. Die von dem Geruch nach Bohnerwachs, Kreide und Tinte durchsetzte Luft füllte ihre Nasenflügel, verbreitete sich in ihren Bronchien.
Nie wieder Schule!, sagte sie sich und versuchte, sich damit Mut zu machen.
Bevor sie endgültig ihren Fuß in die Freiheit setzen konnte, stand ihr noch ein unangenehmer Weg bevor. Sie würde vor den Augen aller Schüler ihren Ranzen und ihre Jacke aus der Klasse holen müssen. Cognac und Pralinen stellte sie neben der Tür ab, bevor sie, ohne zu klopfen, den Klassenraum betrat. Die nächste Stunde hatte längst begonnen. Sie musste sich zusammenreißen, als ihre Deutschlehrerin mitten im Satz aufhörte zu sprechen, sich die Gesichter ihrer Mitschülerinnen mit fragendem Blick zu ihr umwandten. Nur Irmgard flüsterte sie die Worte zu: »Ich erkläre es dir später«, während sie ihre Ledertasche aus dem Fach unter der Bank zog, das Mathematikbuch einpackte, die beiden Messingschnallen schloss, ihre Strickjacke von der Stuhllehne nahm. Irmgard nickte ihr zu. Sie wussten in diesem Moment beide, dass ihre Kameradschaft das Einzige war, was Angelika an der Schule vermissen würde.
In den kommenden Jahren sollte sie noch oft an den Augenblick zurückdenken, als die hohe schwere Tür des Schulgebäudes das letzte Mal mit einem tiefen satten Poltern hinter ihr ins Schloss fiel, ohne zu ahnen, dass sie ausgerechnet ihre Versäumnisse im Physikunterricht einige Male bedauern würde. Sie hatte nun Zeit, Zeit, die es auszufüllen galt, und dennoch fiel es ihr schwer, langsam zu gehen. Die bange Frage, wie die Reaktion ihrer Eltern ausfallen mochte, vermengte sich mit dem Wegfall einer Last und ungeheurer Erleichterung. Angelika rannte über den Schulhof zum Haupttor heraus. Fast wäre sie mit einem Mann zusammengestoßen, der auf dem Bürgersteig seinen Dackel ausführte. Angelika murmelte eine Entschuldigung und rannte weiter. Sogar die Sorge und die Angst, die sie bei dem Gedanken an das Bedauern ihrer Mutter überkamen, konnten das Vergnügen nicht verdrängen, das unbeschreibliche Glücksgefühl, das sich in ihrem gesamten Körper auszubreiten schien. Es gab ein Wort, das alles ausdrückte, das sie spürte, und zudem erklärte, warum sie später, im Rückblick, diesen Tag stets als so bedeutungsvoll für ihr Leben ansehen sollte: Freiheit.
Ostberlin, 24. April 1956
Christine
Ihre Bluse war aus dickem königsblauen Stoff, und sie kratzte. Christine hatte sie feierlich überreicht bekommen, als sie vierzehn Jahre alt geworden und von den Thälmann-Pionieren zur Freien Deutschen Jugend gewechselt war. Um zwölf Uhr mittags stand sie mit durchgedrücktem Rückgrat neben den anderen Mädchen ihres Jahrgangs, exakt in Reih und Glied, beim Fahnenappell anlässlich der Einweihung des neuen Schulgebäudes.
»Pioniere und FDJ-Mitglieder: Augen geradeaus«, kommandierte eine harte weibliche Stimme. »Linksum … stillgestanden!«
Der Schulhof der neu gebauten Polytechnischen Oberschule Berlin-Mitte lag ruhig im Sonnenschein, und Christine musste blinzeln, als sie die Augen der Flagge zuwandte, die vom Fahnenkommando herausgetragen worden war und nun am Mast in den Himmel emporgezogen wurde. Der Stoff im gleichen Blau wie ihre Bluse hing so träge herunter, dass das Emblem der aufgehenden Sonne darauf nicht erkennbar war. Auch die schwarz-rot-goldene Fahne flatterte heute nicht im Wind. Ein Junge trat nach vorne, streckte die Hand aus und sagte: »Ich grüße die Direktorin, Lehrer und Schüler der zukünftigen POS, das Volk der Pioniere und Freien Deutschen Jugend. Für Frieden und Sozialismus, seid bereit!«
Dann betrat die Direktorin das Podium und begann ihre Rede: »Wir dürfen bereits heute das Gebäude der POS einweihen, was eine besondere Ehre ist. In Kürze werden alle achtklassigen Grundschulen in die zehnklassige Polytechnische Oberschule umgewandelt. Wir sind also Vorreiter. Der unabdingbare Wille, unserem sozialistischen Vaterland zu dienen, ist das, was uns alle eint. Wer nicht bereit ist, in seinen Schuljahren fleißig zu lernen und sein gesamtes Streben darauf zu richten, eines Tages ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft der Deutschen Demokratischen Republik zu werden, hat in unserer POS keinen Platz …«
Christine hörte solche Worte nicht zum ersten Mal. Wie bei allen wöchentlichen Fahnenappellen lauschte sie angestrengt und versuchte, die Bedeutung der Worte zu verinnerlichen. Sie konzentrierte sich, streckte die Wirbelsäule, ballte ihre Hände zu Fäusten, presste die Pobacken zusammen, spannte jeden einzelnen Muskel ihres Körpers an und versuchte auf diese Weise, etwas zu erzwingen. Jedes Mal hoffte sie inständig, dass sich das Gemeinschaftsgefühl einstellen würde, dass der Glaube, den sie auf den verklärten Gesichtern ihrer Klassenkameradinnen sehen konnte, endlich auch von ihr Besitz ergreifen würde. Es war ihre Art, etwas zu erreichen. Der Weg, den sie von klein auf gelernt hatte: unbändige Willenskraft, die ihren Muskeln befahl, scheinbar Unmögliches zu erreichen. Ihr gesamter Körper zitterte leicht, und das Mädchen neben ihr neigte kaum merklich den Kopf, schielte zu ihr herüber. Christine atmete hörbar aus und ließ wieder locker, entspannte alle Muskeln, voller Enttäuschung. Es funktionierte einfach nicht, nichts geschah mit ihr, es gab keine Erhellung. Sie wohnte der Veranstaltung bei, als sei sie ein Fremdkörper und gehörte nicht dazu. Möglichst unauffällig sah sie auf die neue eckige Wanduhr, die an der Front über dem Haupteingang angebracht war. Es war zwanzig Minuten vor eins. Nervös trat sie von einem Bein aufs andere. Sie musste jetzt sofort nach Hause!
Als der Schulamtsleiter seine Rede beendet hatte und die Direktorin sie entließ, war sie eine der Ersten, die zum Haupttor hinausrannte. Ihr Weg führte sie über das holprige Pflaster an rußgeschwärzten Fassaden und Trümmergrundstücken des Bezirks Berlin-Mitte vorüber. Sie kam an der Versöhnungskirche vorbei, und die große Jesusfigur mit den zum Segen erhobenen Händen über der Kirchentür gab ihr jedes Mal das Gefühl, als sei er ihr wohlgesonnen. Das Schild, das vor dem Verlassen der Sektorengrenze warnte, nahm sie kaum noch zur Kenntnis. Der Haupteingang ihres Wohnhauses lag im französischen Sektor, das Haus selbst und der Hintereingang im sowjetischen. Seit zwei Jahren wohnten sie in der Bernauer Straße, direkt an der mitten durch Berlin verlaufenden Grenzlinie zwischen Ost und West. Rein geografisch war es allerdings die Südseite, die im Bezirk Mitte lag, und die Nordseite im Bezirk Wedding. Von ihrem Zimmer aus hätte sie in den französischen Sektor der Stadt spucken können. Trotz Gründung der beiden neuen deutschen Staaten wurde der besondere Berliner Vier-Mächte-Status weiter aufrechterhalten, und man konnte ohne größere Kontrollen von Ost nach West gehen. An vielen Stellen war der Übergang völlig unbewacht. Ganz im Gegensatz zu der restlichen innerdeutschen Grenze, die schon seit 1953 nahezu abgeriegelt war.