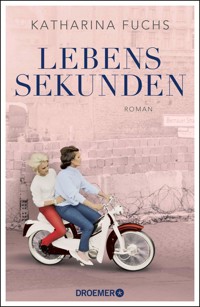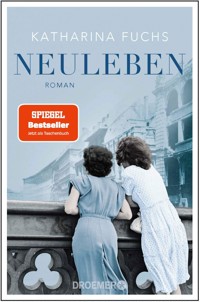9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Epoche im Umbruch - Die Geschichte zweier Jahrzehnte: Drei Frauen gehen ihren Weg Im zeitgeschichtlichen Roman »Unser kostbares Leben«erzählt Bestseller-Autorin Katharina Fuchs von ihrer eigenen Kindheit: Drei junge Frauen rebellieren gegen gesellschaftliche Missstände und die Vorstellungen ihrer Eltern. Deutschland 1972: Wer die kleine Industriestadt bei Westwind durchquert, ist bezaubert von dem süßen Schokoladenduft, der sich wie ein kakaogetränktes Gazetuch über die Siedlungshäuser und Einfamilienvillen legt. Nur an den Ostwindtagen tränen den Mainheimern von den scharfen Chemiedämpfen die Augen, längst ist das Mainwasser umgekippt. Kein Bewohner beschwert sich je, doch dann geschieht Schreckliches - und drei junge Mädchen stellen Fragen, die nicht jedem gefallen. Nach der Geschichte ihrer Großmütter sowie ihrer Mutter und Tante erzählt Katharina Fuchs nun von ihrer eigenen Kindheit und Jugend in den 70er-und 80er-Jahren. "Bestsellerautoin Katharina Fuchs geht mit den Lesern auf Zeitreise in eine rebellisch-wilde Jugend der Siebzigerjahre" Hessischer Rundfunk HR4 Die wahre Geschichte ihrer Großmütter hat die Bestseller-Autorin im historischen Roman »Zwei Handvoll Leben« (1914–1953) aufgeschrieben, die ihrer Mutter und Tante in »Neuleben« (50er und 60er Jahre).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 946
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Katharina Fuchs
UnserkostbaresLeben
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Eine Epoche im Umbruch – Die Geschichte zweier Jahrzehnte: Drei Frauen gehen ihren Weg
Mainheim, Hessen 1972: Minka und Caro eröffnen die Schwimmbadsaison, als ihr Klassenkamerad Guy vor ihren Augen verunglückt. Am selben Tag trifft das vietnamesische Waisenkind Claire der Kleinstadt ein. Das Netzwerk der Väter,eines -Bürgermeisters und eines Schokoladenfabrikdirektors beginnt zu arbeiten. Die Freundinnen realisieren, dass in der kleinen Industriestadt nichts mehr stimmt: vergiftetes Flusswasser, Tierversuche und Experimente mit Psychopharmaka. Wie kostbar ist ein Leben?
Katharina Fuchs erzählt intensiv und authentisch über den Höhepunkt der Umweltzerstörung in den 70er-Jahren und wie wir die Wende selbst beschwören mussten.
Inhaltsübersicht
Motto
I. Buch
Caro
Minka
Caro und Minka
Claire
Minka
Annette Stern
Caro
Harald Schönwetter
Claire
Doktor Lavalette
Caro
Philipp Stern
Claire
Minka und Caro
Claire
Doktor Lavalette
Minka und Caro
Skatbrüder
Caro und Minka
Claire
Schönwetters und Sterns
Caro
Claire
Claire und Caro
Marita
Claire
II. Buch
Doktor Lavalette
Minka
Claire
Helga Schönwetter
Marita
Claire
Harald Schönwetter
Minka
Habu und Claire
Caro
III. Buch
Minka
Claire
Caro
Marita
Minka
Caro
Claire
Minka und Caro
Annette und Philipp Stern
Harald Schönwetter
Claire
Rudolph Zenker
Minka
Caro
Skatbrüder
Claire
Erne
Minka
Claire
Minka
Helga und Harald Schönwetter
Caro
Claire
Caro
Minka
Claire
Minka
Caro
Minka
Claire
Nicole Rose
Minka
Claire
Marita
Claire
Caro
Claire
Caro
Karin Lavalette
Claire
Minka
Caro
Marita
Annette und Philipp Stern
Minka
Claire
Minka
Caro
Paulskirche Frankfurt am Main
Wahlabend
9. März 2021
Was ist dies doch [...]
Nachlese
Recht ist nicht immer Recht. Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bertolt Brecht
1898–1956
They say that time changes things, but you actually have to change them yourself.
Sie sagen, dass Zeit alles verändert,
doch eigentlich müssen wir sie selbst verändern.
Andy Warhol
1928–1987
I. Buch
Mainheim, 27. April 1972
Caro
Er tut es schon wieder, sieh mal!«
Mit einem Nicken deutete Minka in Richtung des mageren Jungen, der sich gerade die Kapuze seines blauen Anoraks über den Kopf zog. Es war Mittag an einem außergewöhnlich milden Frühlingstag, und das frische helle Laub der Bäume und Sträucher leuchtete im warmen Sonnenlicht.
Erst war er ihnen auf dem Schulweg gefolgt. Nun plötzlich tauchte er vor ihnen auf. Caro und Minka blieben stehen. Guy Meyfahrt senkte den Kopf, nahm Anlauf, streckte die Arme aus und sprang mit einem gekonnten Köpper mitten in das Dickicht am Wegesrand. Mit einer präzisen, schräg über den Wangenknochen verlaufenden Schramme sowie Blättern, Zweigen und roten Beeren auf den Schultern tauchte er wieder auf und strahlte über das ganze Gesicht.
»Beachte ihn gar nicht!«, flüsterte Minka und ging weiter.
Doch der Junge rannte ihnen nach und zog sich die Kapuze herunter. Sein dunkles, dichtes Haar stand in alle Richtungen, seine goldbraunen Augen blitzten sie an. Atemlos lief er neben ihnen her und fragte: »Wie war ich?«
Minka reagierte nicht, Caro zuckte mit den Schultern. Sie wollte ihrem Klassenkameraden nicht zeigen, dass er sie beeindruckt hatte, wollte ihn und ihre beste Freundin nicht merken lassen, wie sehr er ihr gefiel.
»Möchtet ihr wissen, wie eine Wasserleiche aussieht?«
Minka verzögerte ihren Schritt. »Woher weißt du das denn?«
Gruselige Details waren ihre Spezialität. Wenn es nach ihr ging, konnte es in Büchern, vor allem aber den Hörspielen ihrer Europa-LP-Sammlung niemals unheimlich und gespenstisch genug zugehen.
»Ich weiß es, weil in unserem Pool in Saigon tagelang ein Toter getrieben ist. Willst du wissen, wie so einer aussieht, der eine Woche im Wasser gelegen hat?«
»So lange? Warum habt ihr ihn nicht früher rausgeholt?«, wollte Minka unbeeindruckt wissen.
Sie kannten schon die meisten seiner Schauergeschichten und wussten, dass er der Sohn eines Generals der südvietnamesischen Armee war, die gegen den kommunistischen Norden gekämpft hatte.
»Weil wir unter Beschuss standen. Die Vietcong hätten uns durchlöchert, sobald wir auch nur einen Fuß vor die Tür gesetzt hätten.«
Als die beiden Mädchen nicht antworteten, fragte er: »Kommt ihr heute Nachmittag ins Schwimmbad?«
Minka hob den Kopf und rümpfte die Nase: »Das werde ich dir gerade sagen!«
Sie gingen weiter, doch Guy ließ nicht locker, hüpfte herum, sprang seitlich neben ihnen her, als wären seine Beine aus Gummi. An seinen zu kurzen Cordhosen war eine Borte angesetzt, die er bei seinem Sprung halb abgerissen hatte. Jetzt trat er darauf, es machte »Ratsch«, und sie war ganz ab. Rasch bückte er sich und ließ sie in seine Tasche wandern.
»Wir könnten um die Wette tauchen, Köpper vom Startblock oder vom Einer üben, oder sogar Saltos vom Dreier, wie letztes Jahr!«, wandte er sich an Caro.
Diese merkte, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg, und suchte verlegen nach einer Antwort. Im Freibad, das nur gut hundert Meter von ihrem Elternhaus entfernt lag, war sie täglich. Manchmal sogar mehrmals am Tag. Und von Kopfsprüngen und Tauchwettbewerben konnte sie nie genug kriegen. Aber im Beisein ihrer Freundin Minka konnte sie sich unmöglich mit Guy verabreden. Sie hieß den Umgang mit dem Jungen aus Vietnam nicht gut. Und was Minka Schönwetter gegen den Strich ging, das respektierte man. Schließlich war sie die Tochter des Bürgermeisters.
»Ich darf nur, wenn das Wasser über neunzehn Grad hat!«, sagte Caro und ließ die Antwort auf seine Frage salomonisch offen.
Er verstand sofort.
Das Schwimmbad hatte vor drei Tagen die Saison eröffnet. Gestern hatte die Wassertemperatur schon zwanzig Grad erreicht. Sie wurde täglich auf einem blauen Pappkarton, der Ähnlichkeit mit einer Parkuhr hatte, deutlich sichtbar im Kassenhäuschen angezeigt. Manchmal passte Bademeister Knüppel die Temperatur auch im Laufe des Tages an. Caros Antwort bedeutete also: Aller Voraussicht nach würde sie, sobald das Mittagessen mit ihrer Familie beendet war und sie ihre wenigen Hausaufgaben erledigt hatte – also um Punkt drei –, im Sprungbecken sein.
»Okidoki!«, lautete Guys Antwort.
Caro zuckte zusammen, als sie ein Quaken hörte. Alle drei bückten sich und bestaunten die Schönheit der Kreuzkröte zu ihren Füßen, die ihre bläulich schimmernde Schallblase aufpumpte und versuchte, mit ihrem Gesang ein Weibchen anzulocken.
»Sieh mal da!«
»Und da vorne auch!«
»Und dort!«
»Sie sind überall!«
Der asphaltierte Weg war übersät mit den gut getarnten, in Oliv- und Graubrauntönen marmorierten Körpern. Einige Weibchen trugen die kleineren Krötenmännchen Huckepack und streckten ihre langen Beine in unerwarteter Anmut. Das Quaken war so durchdringend, dass die Kinder sich wunderten, es nicht schon früher bemerkt zu haben. Doch auch wenn einige der Tiere nur dasaßen und ihr metallisch tönendes Rätschen von sich gaben, schien sich die Masse der Tiere insgesamt in eine Richtung zu bewegen. Hunderte, vielleicht Tausende Amphibien, auf der Suche nach einem Platz zum Laichen. Sie hüpften nicht, sondern krabbelten, krochen, in gemächlichem Tempo zielstrebig von links nach rechts.
»Ich dachte, die wandern nur nachts«, sagte Caro.
»Ist doch klar, wo die hinwollen! Zum Weiher!«, erklärte Minka in ihrer typischen belehrenden Art, die Caro manchmal ziemlich aufgesetzt fand. »Denn diese Seite hier wurde ja trockengelegt.«
Die drei sahen einander an, und schlagartig wurde ihnen klar, was das bedeutete: Der Stadtweiher lag auf der anderen Seite der Grünanlage, durch die seit einem halben Jahr die neue Straße führte, der Hessendamm. Er verband den Osten mit dem Westen der Kleinstadt, und die Pkws fuhren auf dem neuen, glatten Belag ungehindert, ohne Ampeln und Fußgängerüberwege. Dafür hatte man eigens eine Fußgängerunterführung gebaut. Und natürlich fuhren die Autos dadurch schneller, als sie sollten. Ohne dass es weiterer Worte bedurft hätte, stürmten die Kinder alle gleichzeitig los, über die Niederung, mitten durch die Neuanpflanzung aus dunkler pflegeleichter Thuja und gemeinem Schneeball, um so schnell wie möglich den höher gelegten Damm zu erreichen. Sie achteten nicht auf Zweige, die hier und da vor ihnen auftauchten und ihnen hart ins Gesicht schlugen, ihre Haut zerkratzten, sondern sahen nur auf den mit Rindenmulch bedeckten Boden, um nicht die Kröten zu zertreten. Minka schrie gellend auf, als sie mit dem Arm gegen einen Ast knallte.
Noch bis vor eineinhalb Jahren hatten sich hier, im Herzen der kleinen Stadt, die unberührten Bleichwiesen an die Ufer eines Bachlaufs geschmiegt. Sie waren voller Leben gewesen: In knorrigen bemoosten Korkeichen hatten weißbäuchige Wasseramseln und ockerfarbene Teichrohrsänger gebrütet. Blau schillernde Libellen waren unter Erlen und hellen Trauerweiden durch hohe wilde Gräser getanzt. Sogar graubraune Eidechsen und schiefergraue Ringelnattern hatten die Kinder zwischen violetten Glockenblumen und Bärlauch entdeckt. Sie hatten sie so hübsch gefunden, wie sie sich auf Steinen gesonnt hatten, dass sie versucht hatten, sie zu berühren, und niemals hätten sie es für möglich gehalten, dass die kleinen Schlangen sie beißen könnten. Kurz vor dem letzten Winter war das Projekt Hessendamm fertiggestellt worden, die Bäume gefällt, der Bachlauf künstlich angelegt, sein Bett betoniert, die Wiesen trockengelegt. Ein Mammutprojekt, das in Rekordzeit ausgeführt worden war. Von den zahlreichen alten Bäumen war als einzige eine zweihundertfünfzig Jahre alte Eiche verschont geblieben.
Das Geräusch der vorbeifahrenden Autos ließ Schlimmes ahnen: »Tschak-tschak!«, machten die Autoreifen, als sie über Krötenkörper rollten. Schließlich erklommen die Kinder die Böschung, die auf den Hessendamm führte. Atemlos blieben sie stehen, beugten sich keuchend vor, Caro fiel auf die Knie. Die Straße war übersät mit platt gefahrenen Froschleibern, aus denen die Eingeweide quollen. Dazwischen krochen einige Überlebende, manche hatten fast schon die andere Seite erreicht und kamen ihrem Ziel näher, dem smaragdgrünen Teich voller Entengrütze.
Der Erste, der handelte, war Guy. Er sprang laut schreiend mitten auf die Straße und streckte die Arme seitlich aus. »Anhalten! Ihr Mörder!«
Ein gelber Opel Kadett kam in voller Fahrt auf ihn zu und hupte, machte einen Schlenker auf die Gegenfahrbahn und lenkte um ihn herum. Der Fahrer wild gestikulierend. Der entgegenkommende VW-Bus musste scharf abbremsen und hupte ebenfalls.
»Guy, was tust du! Bist du lebensmüde?«, kreischte Caro, aber im Nachhinein betrachtet, war dies wohl der Moment, in dem ihr zehnjähriges Mädchenherz für ihn zu schlagen begann.
Da sah sie schon, wie Minka, ohne lange zu überlegen, auf die andere Seite der Straße rannte und die Arme ausbreitete. Jetzt war nur noch die Mittellinie frei, über die ein Kleinwagen einfach zwischen den beiden hindurchfuhr. Caro nahm ihren Mut zusammen und schloss die Lücke. Das nächste Auto stoppte mit quietschenden Reifen. Die drei Kinder versperrten jetzt die gesamte Breite der zwei Fahrbahnen, und die Autos mussten anhalten, stauten sich rasch zurück. Die Fahrer stiegen aus, einige waren wütend und schrien die Kinder an, ob sie verrückt geworden seien, das sei eine Frechheit. Rotzgören!
Weiter hinten hielt ein VW Käfer, eine schlanke Frau in T-Shirt, Stiefeln und Minirock stieg aus und kam mit langen wehenden Haaren auf sie zugerannt: Gabriele Narrten, ihre Klassenlehrerin.
»Kinder, was tut ihr denn?«, fragte sie. »Das ist doch lebensgefährlich!«
»Wir retten die Kröten«, sagte Caro und deutete auf all die toten Tiere, zwischen denen weiterhin Hunderte Artgenossen in Richtung Teich krochen.
Gabriele Narrten bemerkte die Tiere erst jetzt und hielt sich die Hand vor den Mund. »Wie furchtbar!«
Nun hatten sie eine Verbündete. Ihre neue Klassenlehrerin war Mitte zwanzig, sie hatte ihnen von Studentenprotesten und Hausbesetzungen erzählt, war für antiautoritäre Erziehung, legte großen Wert auf einen anschaulichen Naturkundeunterricht und opferte ihm allzu gerne die langweilige Heimatkundestunde.
Immer mehr Wagen standen im Stau, die Fahrer drückten auf die Hupen, kurbelten die Fenster herunter, manche stiegen aus, um nachzusehen, was los war.
»Wartet einen Moment!«, rief Fräulein Narrten.
Sie rannte zurück zu ihrem Auto und kam mit einem Stoß DIN-A4-Pappen und dicken Filzstiften zurück.
»Hier.« Sie teilte den dreien die Pappen aus. »Schreibt etwas drauf … Vorsicht, Kröten … oder Rettet die Frösche … Frösche hört sich vielleicht netter an.«
»Vorsicht: Frösche auf der Fahrbahn!«, schlug Caro vor.
»Stoppt das Froschsterben!«, sagte Minka.
»Das ist gut!«, stimmten Guy und Fräulein Narrten ihr zu. Rasch beschrifteten sie die Pappschilder und hielten sie hoch. Fräulein Narrten und Minka gingen von Auto zu Auto, überredeten die Fahrer, umzudrehen und einen Umweg in Kauf zu nehmen.
»Sind doch nur Kröten!«, murrten manche Fahrer, während sie einen Blick auf die langen Beine der Lehrerin warfen, aber nach und nach drehten alle um. Der Drogist und der Apotheker erboten sich sogar, ihre Autos quer zu stellen und die Fahrbahn so abzusperren, dass in der Mitte ein fünfzig Meter breiter Streifen frei blieb. Durch diese Passage konnten die restlichen Kröten ihre Wanderung unversehrt fortsetzen. Damit es schneller ging, begann Guy, sie hochzuheben und über die Straße zu tragen. Caro tat es ihm nach. Sie mochte das Gefühl des hellen, glatten Krötenbauchs auf ihrer Handfläche, spürte das Pulsieren in den graugrünen Amphibienkörpern, sah in ihre waagrechten Pupillen und bedauerte es fast, dass sie sie so schnell wieder absetzen musste. Nur diejenigen, die aufeinandersaßen, konnte sie nicht anfassen. Das machten Guy und Minka. Ihre Lehrerin hatte noch eine pragmatische Idee und holte zwei leere Holzkisten mit der Aufschrift »Vin de Languedoc« aus ihrem Auto. Sie hatte der Klasse schon ein paarmal von ihren Frankreichurlauben erzählt, hatte Muscheln aus der Bretagne, Seeschneckenhäuser und Federn aus der Camargue mitgebracht, und offenbar auch Wein. Sie legten die Kröten behutsam auf den Kistenboden und konnten dadurch etliche auf einmal zur anderen Seite tragen, was die Aktion beschleunigte.
»Wie viele noch?«, fragte Guy. »Ich glaube, wir haben bald alle.«
Es dauerte tatsächlich nicht mehr lange. Die meisten waren wohl schon in der Nacht aufgebrochen und hatten die Straße ohne Autoverkehr überqueren können. Das war jedenfalls ein tröstlicher Gedanke. Als keine Kröten mehr nachkamen, gaben die Helfer die Straße wieder frei.
»Das war mutig«, lobte sie Fräulein Narrten und strahlte, sodass ihre ebenmäßigen, gesunden Zähne sichtbar wurden. »Viele wären achtlos vorbeigegangen, man sieht ja, wie gleichgültig die Menschen sind.« Sie deutete auf die Autos, die nun wieder den Hessendamm befuhren. »Sie sind wie vernagelt, haben Scheuklappen, wissen gar nicht, was sie tun, wenn sie die Natur so wenig schätzen und schützen.«
»Hoffentlich sieht das mein Vater auch so«, sagte Minka, die auf einmal ungewohnt kleinlaut wurde, als sie an zu Hause dachte.
»Bestimmt«, sprach die Lehrerin ihr Mut zu. »Steh zu deinen Taten, Minka, und mach dich nicht kleiner, als du bist!«
»Das sagt sich so leicht.« Minka lächelte schwach.
Fräulein Narrten winkte ihnen zu und stieg in ihr Auto.
»Bei uns sagt man, die Kröte ist der Onkel des Himmelsgottes«, murmelte Guy.
Die Mädchen sahen ihn erstaunt an. So einen Satz hatten sie noch nie gehört, schon gar nicht von einem gleichaltrigen Jungen.
Er hatte es plötzlich eilig.
»Ich muss los!«, rief er ihnen zu. Schon kugelte er die gegenüberliegende Böschung herunter, stützte sich auf der Rückenlehne einer Bank ab, schwang sich über sie hinweg und verschwand im Dickicht der Anlage. Es war eine Abkürzung zur Siedlung. Guy wohnte mit seiner Mutter in den ockergelben Cassadiner-Mehrfamilienhäusern, die im Osten von Mainheim lagen und ihren Namen der Firma Cassada verdankten. Mädchen wie Caro und Minka betraten die Siedlung normalerweise nicht. Sie drehten sich um und gingen nebeneinanderher. Besprachen den Vorfall und wägten ab, ob sie ihren Eltern davon erzählen sollten. Dass ausgerechnet die selbstsichere Minka dagegen war, wunderte Caro. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie ihren Eltern sofort davon berichtet, und sie war ziemlich sicher, dass sie vor allem von ihrer Mutter eher Zuspruch als Tadel erhalten würde. Aber sie versprach ihrer Freundin, das Ganze erst einmal für sich zu behalten.
Die beiden lebten im Westen der Kleinstadt. Dort wo Jägerzäune gepflegte Tausend-Quadratmeter-Grundstücke umgaben, in deren Mitte weiß getünchte Einfamilienhäuser lagen, eine Doppelgarage daneben, mit einer Limousine und einem Kleinwagen darin. Es war die Gegend, in der auch das Freibad, die weitläufige Sportanlage und die Turnhalle gebaut worden waren. Alles großzügig von der Firma Cassada bezuschusst. Auch das Haus, in dem Caro mit ihren Eltern und Geschwistern lebte, gehörte der Cassada, denn ihr Vater war der Generaldirektor der Schokoladenfabrik. Caro wohnte in der Schwimmbadstraße und Minka im Velten-Schönwetter-Ring. Dieser war nach Minkas Großvater benannt, der ebenfalls mehr als ein Jahrzehnt Mainheimer Bürgermeister gewesen war. Minkas Wohnhaus war Eigentum der Stadt. Als einziger im Schwimmbadviertel war der Garten nicht von einem Jägerzaun, sondern von einem geradlinigen, cremefarben lackierten Zaun aus Schmiedeeisen umgeben.
Als sie sich der hohen Front aus Glasbausteinen über dem Eingang näherten, verlangsamten die Mädchen ihre Schritte. Von hier aus stach das rote Dach besonders ins Auge. Es war die Idee von Minkas Vater gewesen, das Dach mit Ziegeln in ungewöhnlich tiefem Rot decken zu lassen, als er das abgewohnte Haus vor seinem Einzug auf eigene Kosten hatte renovieren lassen. Per se ein Widerspruch, sagten manche Mainheimer hinter vorgehaltener Hand: Im Schwimmbadviertel wohnen, aber allen seine rote Gesinnung demonstrieren wollen.
Auf der Straße vor dem Haus stand ein schwarzer Opel Admiral.
»Was macht mein Vater wohl um diese Zeit zu Hause?«, murmelte Minka mehr zu sich selbst, aber dann wandte sie sich an Caro: »Übrigens, ich habe zwei neue Vampir-LPs. Die echte Dracula-Geschichte von Bram Stoker, ungekürzt. Willst du sie anhören?«
Caro hatte ein zwiespältigeres Verhältnis zu Gruselgeschichten als Minka. Sie liebte den Schauder, den sie einem über den Rücken jagten, den kalten Schweiß, den sie einem bescherten, aber sobald sie alleine in ihrem dunklen Zimmer war, konnte der Grusel nahezu übermächtig werden und manchmal sogar in regelrechter Panik enden. Natürlich wollte sie das nicht zugeben, als sie langsam nickte.
»Dann frag doch deine Mutter, ob du heute bei mir übernachten darfst«, schlug Minka vor.
Caro sah in die großen dunklen Augen ihrer Freundin und wunderte sich, wie wenig sie von der Idee begeistert war. Denn in der Regel konnte sie gar nicht genug Zeit mit Minka verbringen. Sie hätte nicht sagen mögen, warum sie von Anfang an so stark von ihr angezogen wurde, als sie zusammen eingeschult worden waren. Mit ihrem brünetten Fransenhaarschnitt, den zierlich gebogenen Nasenflügeln, dem schmalen Gesicht war sie hübsch anzusehen, und den Namen Schönwetter kannten natürlich alle in der Mainheimer Grundschule. Sie trug keine karierten Röcke und Blusen mit Puffärmeln, wie die meisten anderen Erstklässlerinnen vor dreieinhalb Jahren. Sondern ausgestellte Jeans und T-Shirts mit Schnüren am Ausschnitt und Smileys auf der Brust. Es war, als hätte Caro von Anfang an geahnt, dass Minka sich als das frechste und unerschrockenste Mädchen der Klasse herausstellen würde, und das gefiel ihr.
Aus dem Garten hörte man das wütende Kläffen von Toxy, der Boxerhündin, die in einem Zwinger gehalten wurde. Und als Minka auf den Klingelknopf drückte, drang aus dem Haus das wilde Gebell ihrer Bullterrierhündin Clara. Die geriffelte Glastür wurde geöffnet, und im Türrahmen erschien das Gesicht von Minkas zweitältestem Bruder Golo. Gleichzeitig jagte der schneeweiße Kampfhund wie ein Blitz die Treppen hinunter und sprang ungeduldig an der Gartenpforte hoch. Caro machte einen Schritt zurück, als sie das scharfe Wolfsgebiss so dicht vor sich sah, obwohl sie Minkas Hund kannte, seit er noch ein winziger Welpe war, und Nächte mit ihm gemeinsam in Minkas Bett verbracht hatte. Sie wusste, dass in der Dreißig-Kilo-Hündin im Grunde eine sanfte Seele wohnte.
»Da ist ja mein Clärchen!«, säuselte Minka und schob das Gartentor auf, als der Summer erklang. Der Bullterrier umtanzte sie, außer sich vor Wiedersehensfreude, wedelte mit seinem kupierten Schwanzstummel und sprang an ihren Beinen hoch. Seine Krallen zerkratzten ihnen die Schienbeine und Knie, bis Minka das schwere Tier mit beiden Armen aufhob und die Treppen zur Haustür hochtrug, als wäre es ein Stoffhund. Caro stand da, einen Fuß auf dem Gartenweg, den anderen auf der Stufe.
»Also kommst du heute Abend?«, fragte Minka.
»Ich ruf dich noch mal an!«
Plötzlich hob der Hund den Kopf und schnüffelte. Minka setzte Clara ab. Auch die Mädchen richteten ihre Gesichter zum Himmel, drehten sie nach Westen, bewegten sachte die Nasenflügel, um – wie so häufig – ganz vorsichtig die Luft zu testen. Ein sanfter Wind trieb die Regenwolken nach Osten und wirbelte ein rosa Blütenmeer durch die Luft, das sich auf den kurz geschnittenen Rasen im Vorgarten legte, der regelmäßig von den städtischen Gärtnern gepflegt wurde. Doch es war nicht der Duft nach Kirschblüten, auf den die beiden zehnjährigen Mädchen und der weiße Hund reagierten.
In jedem Land der Erde, in jeder Gegend auf der Welt trägt der Wind bestimmte Aromen mit sich mit. In Orten, die in der Nähe eines Meers liegen, können es die von Salz und Tang sein, oder von den wilden Rosen- und Brombeersträuchern, die entlang der Küste wachsen. In den Alpen mag es nach Bergthymian, Enzian oder Gletschereis duften. In Steppen nach wilder Kamille, Salbei, Präriegras und Heu, in Großstädten womöglich nach Benzin- und Dieselabgasen.
In der hessischen Kleinstadt Mainheim, die in der Rhein-Main-Ebene an den Ausläufern des bewaldeten Mittelgebirges Taunus lag, gab es seit Jahrzehnten nur zwei Möglichkeiten: Die Tage, an denen es süßlich roch, waren die guten. Der Duft, der entstand, wenn die Schokoladenmasse in den Conchiermaschinen erwärmt und gerieben wurde, legte sich über die Kleinstadt mit den ockerfarbenen Siedlungshäusern, den würfelförmigen Einfamilienvillen und ihren Gärten, über das flache Schulgebäude, das Freibad, die Tartanbahn, die Grünanlagen, den betonierten Bachlauf, wie ein Gazetuch, das zuvor mit Kakao getränkt worden war. Jeder kannte den Geruch. Jeder hatte eine Haltung dazu. Manche Bewohner liebten ihn, anderen war er zu zuckerig, keiner beschwerte sich je. Die Kinder atmeten ihn von klein auf ein, verbanden seine Aromen mit Präsentpäckchen zu Ostern, Nikolaus und Weihnachten. Die Älteren verknüpften ihn mit einem geregelten Einkommen, Sozialleistungen, Weihnachtsgratifikationen, mit Wohlstand, mit dem Wirtschaftswunder. Die Mütter unter ihnen mit kostenloser Säuglingsnahrung in den schwierigen Nachkriegsjahren.
Aber, wie gesagt, alle waren sich einig: Die Tage, an denen es nach conchierter Schokoladenmasse roch, waren die guten in Mainheim. Es waren die nahezu windstillen oder die des Westwinds. Die anderen waren die Tage des trockenen Ostwinds, und der trug den scharfen weißen oder gelben Qualm aus den hohen Schloten der Ruberus AG direkt in den Himmel über der Stadt. Farbstoffe, Lacke und Arzneimittel wurden in der Fabrik des Nachbarorts Neumainheim hergestellt. Der Qualm brannte in den Augen, reizte die Schleimhäute in der Nase, raubte einem den Atem. Der Schwefel trocknete die Kehle und konnte bei empfindlichen Menschen Hustenattacken auslösen. Der beißende chemische Geruch war den Bewohnern ebenfalls seit Jahrzehnten vertraut, und auch ihn verknüpften manche Ruberus-Arbeiter, die hier wohnten, mit gut bezahlten Arbeitsplätzen und sozialer Absicherung. Zum großen Glück der Mainheimer – keiner, außer womöglich Minkas Großvater Velten Schönwetter, wusste genau, ob dies bei der Errichtung der Fabrik und der Wohnsiedlungen beachtet worden war – gehörte der Wind aus östlicher Richtung in mittleren Breiten der Erde, also etwa zwischen dem vierzigsten und sechzigsten Breitengrad auf der Nord- sowie der Südhalbkugel zu den selteneren Erscheinungen. Mainheim lag in der Westwindzone, und ohne es zu wissen, profitierten seine Einwohner exorbitant von dem Luftdruckgefälle zwischen dem subtropischen Hochdruckgürtel und der subpolaren Tiefdruckrinne sowie dem daraus resultierenden meridionalen Luftmassenaustausch.
Minka grinste ihrer Freundin zu. Caro nickte. Keine musste etwas sagen. Sie verstanden sich blind, schlossen beide die Augen, holten Luft und atmeten so voller Inbrunst ein, wie man es tut, wenn man zum Boden des Schwimmbeckens tauchen möchte, saugten den öligen Kakao-Geruch tief in jede einzelne Verzweigung ihrer Bronchien ein und hielten die Luft an, als wären sie unter Wasser. Dann öffneten sie den Mund und prusteten los. Heute war ein guter Tag. Zugegeben, zu viele Kröten waren gestorben, aber ohne ihre Hilfe wären es noch mehr gewesen, sie hatten einer ganzen Menge das Leben gerettet – und es roch nach Schokolade. Ein guter Tag war es, bis sie aus dem Inneren des Hauses den voll aufgedrehten Lautsprecher des Fernsehers klappern hörten und eine missgelaunte Stimme rief: »Macht die Tür zu! Es stinkt!«
Es war Minkas Vater.
Caro fragte sich im Nachhinein oft, ob dies der Moment war, ab dem alles so furchtbar schieflief, wer daran Schuld hatte und ob es den Preis wert war.
In der Schokoladenstadt galt die ungeschriebene Übereinkunft, den Geruch, der während des Conchierens der Kakaomasse in die Luft entlassen wurde, entweder zu ignorieren oder zu genießen. Aber niemand kam auf die Idee, ihn als Gestank zu bezeichnen. Und schließlich war Harald Schönwetter der Bürgermeister.
»Er hat schlechte Laune!«, raunte Golo ihnen zu, machte einen Schritt vor die Haustür und zog sie weiter zu.
»Warum kommst du eigentlich so spät? Und wie seht ihr überhaupt aus?«, fragte er seine Schwester und ihre beste Freundin, die er gut genug kannte, weil sie bei ihnen seit vier Jahren fast täglich ein und aus ging. Caro sah Minka an, die einige Schrammen auf der Wange hatte und ziemlich zerzaust war, Blättchen und Zweige hingen in ihren dunklen Haaren. Das lag wohl an ihrem Sprint durch die Büsche, und vermutlich sah sie selbst kaum besser aus. Als Minka zu einer Erklärung ansetzte, winkte Golo schon ab: »Na ja, egal! Heute stimmt der Bundestag über das konstruktive Misstrauensvotum gegen Willy Brandt ab.«
Keine von beiden hatte die geringste Ahnung davon, was ein Misstrauensvotum war. Und was hieß konstruktiv? Aber es hörte sich nicht gerade nett an, und sogar Caro wusste, dass Minkas Vater, wenn es um Willy Brandt ging, keinen Spaß verstand. Er war SPD-Mitglied, Sozialdemokrat durch und durch, wie es auch schon sein Vater gewesen war. Brandt war der Held, das Idol, auf das er nichts kommen ließ, und diese Einstellung galt in der gesamten Familie Schönwetter als heilig.
»Ich geh dann besser mal«, sagte Caro und hatte es plötzlich eilig. Minkas Vater war ihr sowieso nicht ganz geheuer, weil er so eine unerschütterliche Autorität ausstrahlte und nie über einen knappen Gruß hinaus mit ihr sprach.
»Tschüs!«, rief ihr Minka hinterher. »Und vergiss nicht, deine Mutter zu fragen, ob du bei uns übernachten kannst.«
Das werde sie tun, antwortete Caro, als sie das Gartentor hinter sich zuzog, und wusste bereits im selben Augenblick, dass sie das schön bleiben lassen würde. Dracula und ein schlecht gelaunter Bürgermeister verursachten einfach zu viel Grusel auf einmal.
Sie ging die Straße entlang, an den vielen Jägerzäunen in unterschiedlichen Höhen und Holzfarben entlang, bog nach rechts ab, noch einmal nach rechts und stand vor ihrem eigenen Elternhaus, das haargenau auf gleicher Höhe wie das des Bürgermeisters lag, nur eben in der Parallelstraße. Die beiden üppig eingewachsenen Grundstücke hatten eine gemeinsame Grenze.
Caro stand vor der weiß getünchten Vorderseite ihres Elternhauses. Es hatte ebenfalls eine Front aus Glasbausteinen über dem Eingang. Links davon lag die extralange Garage, in der sogar drei Autos hintereinander Platz fanden. Das gab es nur einmal im Schwimmbadviertel. Heute stand der weiße Mercedes ihres Vaters davor. Komisch, dachte sie. Dass auch ihr Vater heute zum Mittagessen nach Hause gekommen war, ausgerechnet am selben Tag wie Herr Schönwetter? War das ein Zufall? Normalerweise aß er fast immer im Casino der Cassada zu Mittag.
Als sie auf den Klingelknopf drückte, bellte kein Hund, was sie täglich bedauerte. Aber ihre Eltern betonten immer wieder, sobald sie den Wunsch nach einem Haustier äußerte, die Familie sei bereits groß genug. Caro hüpfte die Treppen zur Tür hoch, zog ihren Ranzen vom Rücken und fragte ihren zweitältesten Bruder Hartmut, genannt Habu, was es zu essen gebe. Sie war das zweitjüngste von fünf Kindern.
»Tini hat Hawaiitoast gemacht«, sagte er. »Wo warst du so lange?«
Tini war ihre sechzehnjährige Schwester. Eigentlich hieß sie Christine, Caro hieß Carola. Keines der Kinder wurde bei seinem Taufnamen gerufen. Nur die Eltern nannten einander bei ihren richtigen Vornamen.
»Ach, ich war noch kurz bei Minka!«
»Und was ist das hier?«
Er deutete auf ihr Gesicht, und sie warf einen Blick in den Garderobenspiegel, der von einer lindgrünen Makramee-Arbeit umrahmt wurde. Auf ihrer Stirn war eine fünf Zentimeter lange, leuchtend rote Schramme. Die musste sie sich in der Grünanlage geholt haben.
»Ach, das ist auf dem Schulhof passiert«, sagte sie. Doch Habu hörte gar nicht mehr zu.
»Caro ist da!«, rief er und rannte die Kellertreppe hinunter. Anscheinend hatten alle mit dem Essen auf sie gewartet.
Irgendwann, als die Familie immer größer geworden war, hatten ihre Eltern den Entschluss gefasst, die beengte Küche aus dem schmalen schlauchartigen Raum im Erdgeschoss nach unten in das Souterrain, wie sie es nannten, zu verlegen. Wenn man es genau nahm, war es der Keller. Aber sie hatten extra einen Innenarchitekten des Küchenhauses bestellt, und der hatte ihnen eine riesige Wohnküche mit gelben Kunststofffronten und braun gekachelter Arbeitsplatte in U-Form, einer Theke und hohen Barhockern entworfen, die im Schwimmbadviertel ihresgleichen suchte. Damit das Souterrain seinen Kellercharakter verlor, hatte der Innenarchitekt helle Deckenspots montieren lassen, die den Raum in gleißendes Licht tauchten, so hell wie in einem Kaufhaus. Sogar Minka beneidete sie um diese Küche, dabei war das Haus der Schönwetters viel moderner eingerichtet. Schließlich hatten sie ein Bad mit orangefarbenen Einbauschränken, und Minka besaß schon als Zehnjährige zwei Knautschsäcke, einen aus schwarzem und einen aus weißem Lackleder.
Um den riesigen achteckigen Tisch, der wie die Arbeitsplatte braun gekachelt war, saßen sechs Familienmitglieder auf gelben Freischwingerstühlen und warteten darauf, dass die Familie vollzählig wurde. Der Duft von geschmolzenem Käse erfüllte den gesamten Raum.
»Wo warst du denn so lange?«, fragte Caro ihre Mutter, die natürlich sofort die Schramme bemerkte. Bei Ma fiel Caro die Notlüge schon weitaus schwerer, Ma beschwindelte man nicht, sie war einfach zu gut.
»Ich war noch bei Minka«, sagte sie und errötete. Ihre Mutter sah sie mit ihren hellblauen Augen nur zwei Sekunden lang an und wusste Bescheid. Doch sie sagte nichts, so war Ma eben. Tini holte das heiße Blech aus dem Ofen und legte jedem mit dem Pfannenheber einen Toast auf den Teller. Als Erstem Pa.
Der hob die Ananas mit skeptischem Blick mit der Gabel an, starrte auf die langen gelben Fäden, die die Käsescheiblette zog, und seufzte. Seine brünetten Koteletten umrahmten ein rundes offenes Gesicht mit Eulenaugen hinter den dicken Brillengläsern. »Da komme ich einmal aus der Firma zum Essen nach Hause, warte und warte – und dann gibt es das?«
Ma warf ihm einen warnenden Blick zu und schüttelte stumm den Kopf. Sie wollte ihm zu verstehen geben, sich nicht zu beschweren, sondern ihre ältere Tochter zu loben.
»Wunderbar, Tini«, sagte sie betont gut gelaunt. »Wusstest du, dass ich noch heute Morgen gedacht habe, wir müssten unbedingt mal wieder Hawaiitoast essen? Ich hatte einen richtigen Heißhunger darauf.«
Caro musste lächeln. Sie warf Fitzi einen Blick zu, und der grinste sie an. Mit dem Jüngsten und mit Tini verstand sie sich. Seine streichholzkurzen blonden Haare betonten sein schmales Gesicht mit der allzu hellen empfindlichen Haut, der gleichen, wie sie und ihre Mutter sie hatten. Es würde nicht lange dauern, und sie bekamen ihren ersten Frühjahrssonnenbrand. Vielleicht schon heute. Der Rest der Familie war brünett, rundlich wie ihr Vater und weit weniger sonnenempfindlich.
»Im Moment kann ich mir nichts Köstlicheres vorstellen als genau dieses Mittagessen«, schwärmte Annette Stern weiter.
Typisch Ma! Das war ihre Haltung. Alles, was eines ihrer Kinder freiwillig tat, führte bei ihr zu Begeisterungsstürmen und Lobeshymnen. Keiner in der Familie nahm solche Sätze wirklich ernst, doch alle wuchsen in dem Klima ihres andauernden Wohlwollens auf, und es fruchtete. Manchmal wetteiferten sie sogar darum, wer ihre Mutter zu dem ersten, dem ausführlichsten oder letzten Lob des Tages animieren konnte, indem sie Schuhe putzten, den Müll hinausbrachten oder einem anderen Geschwisterkind bei den Hausaufgaben halfen. Ihr Vater ging sparsam mit Lob um, verteilte stattdessen Extra-Taschengeld oder in Sonderfällen sogar Stundenlohn.
Jetzt falteten alle die Hände, und ihr Vater sagte das Tischgebet: »Lieber Herr Jesus, wir danken dir für fünf gesunde Kinder, einen allzeit gedeckten Tisch und einen wunderbaren Toast mit Ananas, Schinken und Scheibletten, den meine talentierte Tochter Christine zubereitet hat.«
»Philipp!«, stöhnte seine Frau auf. »Du vergisst dich!«
»Am-en«, sagten alle Kinder grinsend im Chor und stürzten sich auf ihre Toasts.
Caro war das alles zu schnell gegangen. Über ihre Krötenrettung durfte sie nicht reden, das hatte sie Minka versprochen, obwohl ihr das Thema auf der Seele lag. Lustlos stach sie die Gabel durch den geschmolzenen Käse, beobachtete ohne jeden Appetit, wie der Saft der Dosenananas herausspritzte, und bekam keinen Bissen runter. Sie hatte vorgehabt, noch rasch vor dem Mittagessen in das Arbeitszimmer ihres Vaters zu schlüpfen. In seiner Regalwand aus schwerem dunklen Holz befand sich eine fünfundzwanzigbändige Ausgabe des Brockhaus. Sie wusste auswendig, dass sie nach Krötenwanderung im elften Band zwischen Korrektur und Leben suchen musste. Und im zwölften zwischen Mai und Mos würde sie die neuen Wörter nachschlagen. So oft hatte sie schon in jedem einzelnen ledergefassten Buch der Enzyklopädie nachgelesen.
Da waren diese zwei Wörter, die ihr nicht mehr aus dem Kopf gingen, seit sie Golos Lippen verlassen hatten.
Kon-struk-ti-ves Miss-trau-ens-vo-tum.
Auf ihrem Weg vom Haus des Bürgermeisters zu ihrem hatte sie sie im Geist bereits in alle Silben zerlegt, mehrfach aufgesagt, als zusammengesetztes Hauptwort identifiziert und sowohl das Adjektiv Misstrauen als auch das Substantiv Votum gewendet und gedreht. Konstruktiv sagte ihr gar nichts. Natürlich wusste sie, was Misstrauen hieß. Sie misstraute ihren Brüdern, insbesondere Habu im Hinblick auf ihr Tagebuch und ihr Notizbuch. Sie verwahrte beides getrennt. Das mit einer Schließe gesicherte Tagebuch in einem verborgenen Schubfach ihres Kleiderschranks. Ihr Notizbuch beschrieb sie nur mit selbst erdachten Codes, zu denen sie die Lektüre von Arsène Lupin inspiriert hatte, und klebte das marmorierte Büchlein mit Paketband unter ihren Lattenrost. Ihrer Spardose diente eine als Buch getarnte Kassette als Versteck, von der sie ahnte, dass sie längst einige Familienmitglieder entdeckt hatten.
Geheimniskrämerei nannten ihre Brüder ihren Argwohn – gesundes Misstrauen nannte sie es. Die Bedeutung von Misstrauen im Zusammenhang mit Bundeskanzler Willy Brandt, den Wörtern Votum und Konstruktiv erschloss sich ihr allerdings nicht.
»Habt ihr schon gehört, dass der Bundestag heute über das konstruktive Misstrauensvotum gegen Willy Brandt abstimmt?«, fragte sie.
Die Gesichter ihrer Familie wandten sich ihr zu. Die Teller waren bereits fast leer. Tini war aufgestanden, um eine zweite Runde zu verteilen. Man hatte gerade über die Qualität der neuen Waschstraße neben der Esso-Tankstelle gesprochen. Ihr Vater mutmaßte, der Lack des Mercedes sei durch die Bürsten zerkratzt worden, man solle besser wieder per Hand waschen, versprach seinen Söhnen ein gutes Taschengeld dafür, unterbrach sich nun aber mitten im Satz und sah Caro an.
»Typische Caro-Frage!«, sagte Habu. »Das hat die bestimmt bei Schönwetters aufgeschnappt.«
»Die steht im Stall und sagt Muh«, tadelte ihn seine Mutter.
»Sie«, verbesserte sich Habu.
»Na, ich kann mir bildlich vorstellen, wie das den Schönwetter wurmt!«, sagte Stern und ließ sich genüsslich in den Freischwinger zurückfallen, dessen Lehne sich unter seinem Gewicht so weit nach hinten bog, dass seine Kinder für einen Moment die Luft anhielten, weil man befürchten musste, das Stahlgestell werde unter seinem massigen Körper nachgeben. Es knarrte ein wenig, federte einige Male zurück und hielt seinen achtundneunzig Kilogramm stand.
»Die Chancen stehen gut, dass Brandt heute den Hut nehmen muss!«, fügte er hinzu und rieb sich die Hände. Seine Laune steigerte sich, je länger er darüber nachdachte. »Wenn Barzel gewinnt, weht in Deutschland endlich wieder ein anderer Wind!«
Als er merkte, was er gesagt hatte, verbesserte er sich: »Ich meinte, dann geht es in Deutschland wieder aufwärts!«
Die Windrichtung im buchstäblichen Sinn war für alle Mainheimer stets ein Thema, und keiner wollte, dass sie sich dauerhaft änderte. Caro nutzte den kurzen Moment der Stille, um das zweite Thema anzuschneiden, das ihr auf der Seele lag: »Würde Barzel auch dafür sorgen, dass der Hessendamm wieder abgerissen wird und wir unsere Bleichwiesen zurückbekommen? Wir haben heute Hunderte von Kröten über die Straße getragen, aber vorher wurden schon so viele tot gefahren.«
»Was habt ihr?« Erne, ihr achtzehnjähriger Bruder, gab den übertrieben Entsetzten. Mas gefühlvolle Sanftheit war beiden älteren Jungen nicht zu eigen, im Übrigen auch nicht Pas angenehme, frohmütige Erscheinung. Habu rekelte sich auf seinem Stuhl, vollkommen zufrieden, dass seine kleine Schwester nun unweigerlich in die Schusslinie geriet. Doch Caro hob den Kopf, machte ein wichtiges Gesicht und fuhr fort: »Und das alles nur, weil man nicht berücksichtigt hat, dass die Kröten zur Laichzeit zum Stadtweiher wandern, ganz egal, ob sie dazu über eine befahrene Straße müssen. Fräulein Narrten sagt, das ist ein Naturgesetz, sie können nicht anders.«
»Mich wundert es, dass es dort überhaupt noch Kröten gibt«, meinte Tine, »nachdem sie den Bach einbetoniert und alles trockengelegt haben.« Sie schloss träumerisch die Lider. »Erinnert ihr euch noch an die Sommer, wenn wir mit dem Bibelkreis bei sanftem Wind auf Eichenwurzeln saßen und in den tiefen Schatten über der Wiese voller blühender Gräser die Pfauenaugen tanzten.«
»Und weißt du noch, wie wir nach Schlüsselblumen gesucht haben, wie zauberisch sie zwischen den Gräsern geleuchtet haben?«
Caro erinnerte sich genau an das Gefühl, das ihr Anblick auslöste.
»Und wenn man eine gefunden hatte, kam man sich den ganzen Tag besonders vor, wie ein auserkorenes Wesen.«
Die Geräusche, die gleichzeitig von Erne und Habu kamen, klangen nach unterdrücktem Prusten. »Und an moosigen Bachufern hingen sechsfingrige Wunderfarne in dichten Büscheln.« Erne sprach im gleichen Tonfall wie Tini, doch bei ihm hörte es sich sarkastisch an. Erst wenn man Erne näher kannte, konnte man eine Kraft und Wärme spüren, die von ihm ausging, und eine unantastbare Ehrlichkeit. Doch nach außen hin gab er sich überlegen.
»Und an den Heuschnupfen kann ich mich auch noch gut erinnern«, bemerkte Habu. Ein kurzer Blick von Ma, der noch nicht einmal streng war, reichte, um die beiden Jungs zum Schweigen zu bringen.
Annette Stern sah von einer ihrer Töchter zur anderen, studierte ihre wohlgeratenen Gesichter und genoss ihre, wie sie fand, wohlformulierten Sätze.
»Anscheinend ist es ihnen mit ihren Baggern nicht gelungen, die Kröten alle auf einmal auszurotten. Fräulein Narrten sagt, wir sind mutig gewesen und die meisten Menschen wüssten gar nicht, wie wichtig der Schutz der Natur ist.« Als niemand etwas antwortete, schob sich Caro eine blonde Haarsträhne hinters Ohr, ignorierte die gelangweilten Blicke ihrer Brüder, die ihr schräg gegenübersaßen, und sah ihren Vater erwartungsvoll an. »Also? Würde dein Barzel den Hessendamm abreißen, und alles würde wieder wie früher werden?«
Stern räusperte sich: »Mein Barzel, mein Barzel … vermutlich nicht … vielleicht könnte man einen Zaun bauen, für deine Kröten.« Erst jetzt fiel ihm die passende Antwort ein: »Das ist Sache der Kommunalpolitik. Da musst du dich direkt an den Vater deiner besten Freundin wenden. Es wird Zeit, dass endlich wieder die CDU ans Ruder kommt. Die SPD hat schon genug Schaden angerichtet. Und außerdem würde der Schönwetter seine Nase dann nicht mehr so hoch tragen.«
»Philipp! Bitte!«, flüsterte seine Frau, deren Sehnsucht nach Harmonie und respektvollem Umgang, den ihr christlicher Glaube ihr vorgab, schon durch die kleinste Lästerei über Nachbarn Schaden nahm.
»Kommunalpolitik«, notierte Caro innerlich.
»Na, wenn er sich so dermaßen stur dem Neubau unserer Produktionshalle widersetzt und die Baugenehmigung torpediert, kannst du mir nicht übel nehmen, dass ich so über ihn rede, Annette. Er versteht schlicht nichts von Marktwirtschaft und ist dermaßen vernagelt in seiner Ideologie. Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, immer dieselbe Leier … keiner dieser Sozialdemokraten hat auch nur den Hauch einer Ahnung, dass der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit über Rationalisierung führt.«
Seine Kinder ahnten nicht nur, sondern wussten bereits ganz genau, was jetzt kommen würde. Tini sah Hilfe suchend zu ihrem großen Bruder, der nicht ganz uneigennützig einen Geistesblitz teilte, um den Vater von seinem drohenden Monolog abzuhalten: »Die Abstimmung über das Misstrauensvotum wird sicher im Fernsehen übertragen.« Als seinem Vater anzusehen war, dass er darauf ansprang, fügte er hinzu: »Wir könnten sie zusammen ansehen.«
Die anderen Kinder waren sofort wie elektrisiert. Normalerweise kam donnerstags als erste Sendung des Tages um 18 Uhr Der rosarote Panther. Die Aussicht, tagsüber fernzusehen, war so unvorstellbar, so ungeheuerlich, selbst wenn es um so etwas Langweiliges wie Politik ging. Auf jeden Fall war sie weitaus besser, als den unweigerlich folgenden Vortrag ihres Vaters über die wirtschaftliche Entwicklung der Cassada anhören zu müssen.
»Das kommt gar nicht infrage!« Annette Stern sprach ein Machtwort. »Wir essen jetzt in Ruhe auf, und dann geht ihr alle an eure Hausaufgaben.«
Caro legte das Besteck auf den Tellerrand und schloss die Augen. Habu sah sehnsüchtig zu den Puddingschälchen auf dem Küchentresen hinüber. Doch keiner traute sich, ihren Vater zu unterbrechen, der jetzt die Arme verschränkte und tief Luft holte, noch nicht einmal seine Frau. Nun folgte unweigerlich ein Monolog von mindestens zehn Minuten. Ohne die Aufmerksamkeit seiner Familie auch nur im Geringsten infrage zu stellen, sprach er davon, wie die Produktion zu verbilligen, zu rationalisieren sei. Tini, die schon aufgestanden war, um die Teller abzuräumen, wurde durch einen Blick ihrer Mutter zurück an ihren Platz beordert und fügte sich wie alle anderen in ihr Schicksal.
Für die Cassada seien schon seit Ende der Sechzigerjahre, wie für alle Schokoladenhersteller, schwierige Zeiten angebrochen, begann Stern seine Ausführungen. Dabei sah er keinen seiner Zuhörer direkt an, sondern fixierte die tiefblaue Taube des Dekors Acapulco von Villeroy & Boch auf seinem Teller. Das Geschirr hatten sie sich zur Einweihung der neuen Küche angeschafft.
Nach der Aufholjagd der Nachkriegsperiode sei der Markt zum ersten Mal gesättigt. Der Umsatz sei um neun Prozent zurückgegangen, und noch immer nehme der Wettbewerbsdruck zu. Deutsche und ausländische Süßwarenfirmen versuchten nun alle, ein Stück des kleiner werdenden Kuchens zu ergattern. Die Preise für Rohkakao seien dagegen noch immer hoch, gleichzeitig drücke der Handel auf die Abgabepreise.
Er nahm sein Messer und kratzte sorgfältig einen Faden der geschmolzenen Scheiblette vom Flügel der Unterglasur-Taube.
Caro war vermutlich die Einzige, die ihrem Vater zuhörte. Innerlich machte sie sich Notizen, viele Ausdrücke kannte sie nicht. Sie würde versuchen, sie sich zu merken, um sie später nachzuschlagen. Dennoch hätte sie ihren Vater zu gerne beiseitegenommen und ihn gefragt, was es mit diesem Misstrauensvotum auf sich hatte, da es offenbar sogar geeignet war, Willy Brandt zu stürzen. Ihr Vater war erstaunlich geduldig, wenn eines seiner Kinder eine Frage stellte, und hätte es ihr sicher ganz genau erklärt. Doch vor ihren Geschwistern war es zu beschämend, ihre Ahnungslosigkeit einzugestehen. Und keinesfalls durfte man Sterns Monolog unterbrechen.
In Halle 1 sei man nun auf die Herstellung von Schokoladentafeln und Hohlfiguren spezialisiert. In Halle 2 hingegen auf Pralinen, außerdem Dragees, Saisonartikel und Pfefferkuchen. Und nun komme er zum entscheidenden Punkt. Er hob das erste Mal den Blick und fixierte jedes einzelne seiner fünf Kinder. Aus seinen Augen sprach der unbeirrbare Glaube, seine Söhne und Töchter im Alter von sieben bis achtzehn seien jedem einzelnen seiner Worte aufmerksam gefolgt und hätten alles genau verstanden.
Mithilfe der neuen Maschinen könne man im Mainheimer Werk innerhalb von einer Minute tausendsechshundert Tafeln Schokolade in Stanniolpapier verpacken, mit Pergamentpapier und dem Außenumschlag versehen.
»Ist das nicht sensationell?«
Als keines von ihnen eine Reaktion zeigte, nahm er seine Brille ab und begann, mit der Serviette sorgfältig die Gläser zu putzen. Dabei stellte er ihnen eine Rechenaufgabe: »Wer von euch kann am schnellsten ausrechnen, wie viele Tafeln wir dann in einer Acht-Stunden-Schicht schaffen?«
Nach wenigen Sekunden hoben Habu und Erne die Finger.
Mit dem Hinweis »Der Ältere zuerst!« wurde Erne, von dem es hieß, er gleiche seinem Vater, als dieser im selben Alter war, am meisten, er sei sozusagen sein Ebenbild, von seinem Vater drangenommen.
Er sagte: »Siebenhundertachtundsechzigtausend.«
Stern rieb sich das Kinn. »Und was sagst du, Hartmut?«
»Siebenhundertzwanzigtausend.«
»Und wie kommst du darauf?«
»Ich gehe davon aus, dass die neue Maschine zwischendurch eine Panne hat, dass es einen Papierstau oder Ähnliches gibt und es mindestens eine halbe Stunde dauert, bis der Defekt behoben ist. Deshalb habe ich achtundvierzigtausend Stück abgezogen.«
Sein Vater sprang so plötzlich auf, dass der Freischwinger vibrierte, und deutete mit der ausgestreckten Handfläche auf seinen zweiten Sohn.
»Das ist ein echter Stern. Aus dir wird einmal ein Kaufmann!«
Der stämmige Habu wusste gar nicht, wie ihm geschah, strich sich über seinen frischen Sternschen Stoppelhaarschnitt und wurde rot. Sonst war Erne derjenige, der hin und wieder ein Lob abbekam und die besten Noten schrieb.
»Christine, du kannst den Nachtisch auftragen!«
Tini, Caro und ihre Mutter standen ebenfalls auf, obwohl Tini heute Küchendienst hatte. Alle hofften, dass der Vortrag ihres Vaters nun beendet war und alle ihrer Wege gehen konnten.
»Habt ihr heute wieder neue Sorten probiert?«, fragte Tini. Caro betrachtete sie. Tini wurde oft unterschätzt, als die gutmütige, ein wenig pummelige, immer hilfsbereite große Schwester. Aber ihre Frage war klug gewählt. Sie hatte immer noch etwas mit der Schokoladenfabrik zu tun, über die ihr Vater heute offenbar ein besonderes Mitteilungsbedürfnis hatte, aber ihr Thema verband sich mit etwas Positivem. Alle wussten, dass donnerstags in der Cassada die regelmäßigen Verkostungen stattfanden, an denen ihr Vater als Generaldirektor zwar nicht zwingend teilnehmen musste, es aber meistens so einrichtete, dass er zufällig doch dabei war.
»Und was war die beste, Pa?«
Ihr Vater legte den Kopf schief und sah an die Decke mit den hellen Strahlern. Auf seinem runden Gesicht mit dem Doppelkinn spiegelte sich der Genuss, den er jedes Mal aufs Neue empfand, wenn sich der zarte Schmelz auf seine Zunge legte.
»Lass mich nachdenken … da war was ganz Frisches dabei. Es hat nach einer Mischung aus Zitrone und Orange geschmeckt, ein Hauch Zimt, eine knusprige Waffel und alles umhüllt von allerfeinster, zarter Vollmilchschokolade.«
»Ich mag lieber klassisches Nougat oder Nuss«, sagte Fitzi.
»Kleiner Langweiler!«
»Oder Genießer!«, versuchte die Mutter die Beleidigung ihres Jüngsten durch den Ältesten sogleich abzumildern, bevor sie allzu scharf auf sein Gemüt treffen konnte. Gleichzeitig nutzte sie die Gelegenheit, um endlich auf ein Thema zu kommen, das sie niemals aus den Augen verlor, und in ihrer Stimme schwang eine Art Sorge darum mit, das schöne Wetter könne die Oberhand gewinnen. »Wer geht eigentlich heute Nachmittag in die Jungschar?«
»Alle! Mutti, sei unbesorgt«, beschwichtigte Tini sie gleich. Sie leitete die wöchentliche Jugendstunde und den Bibelkreis der evangelischen Kirche, nahm regelmäßig ihre Gitarre, Geschwister, und möglichst auch noch alle Nachbarskinder mit. Durch ihr empathisches Wesen, ihr hübsches Gesicht und die klare Altstimme war Tini der Liebling aller Konfirmanden. Ihrem unermüdlichen Einsatz und Mas fester Verwurzelung im protestantischen Glauben war es neben den sozialen Wohltaten der Firma Cassada und Pas Beliebtheit zu verdanken, dass die Mainheimer fast nur gut über die Familie Stern sprachen.
»Ich habe viel zu viele Hausaufgaben auf«, suchte Caro verzweifelt nach Ausreden. Sie hatte ganz vergessen, dass heute Jungschar war. »Und wir schreiben übermorgen einen Aufsatz.«
Die Vorstellung, den sonnigen Nachmittag in dem stickigen Gemeindesaal zu verbringen und Bibelverse zu interpretieren, statt ins Freibad zu gehen, verursachte ihr ein flaues, fast melancholisches Gefühl im Magen. Da ihr bewusst war, wie genau sie in diesem Moment alle beobachteten, setzte sie eine Miene beflissener Streberhaftigkeit auf und merkte doch, wie gut jedes einzelne Familienmitglied sie durchschaute.
»Ein Aufsatz sollte doch für dich kein Problem sein, bei deiner blühenden Fantasie!«, sagte Habu.
Alle in der Familie wussten, dass sie bereits im Alter von acht Jahren ihre erste Geschichte geschrieben hatte – ein naives, diverse Pferdemädchenbücher imitierendes Stück, dem es, wie sie erst später begriff, an jedem eigenständigen Stil mangelte, der den Lesern eine gewisse Achtung hätte abnötigen können.
Caro vermochte ihre Miene beizubehalten, als sie erwiderte, sie habe schließlich einen hohen literarischen Anspruch und müsse zuvor noch einige Arbeitsblätter studieren.
Habu bekam einen Lachkrampf.
»Meine Güte, du bist in der vierten Klasse der Grundschule!«, stöhnte Erne und rollte mit den Augen. Er fing einen tadelnden Blick seiner Mutter auf, während sein Vater aufstand, kurz die Küche verließ und mit einer unbedruckten Plastiktüte zurückkehrte. Natürlich hatte er wieder Deputate mitgebracht, wie jeden Donnerstag. Es waren Schokoladentafeln, die zwar wie gewohnt in Stanniol verpackt waren, damit sie das Aroma, die Geschmacks- und Rohstoffe behielten. Doch der glänzende Papierumschlag, auf dem üblicherweise die Marke und die Sorte standen, war schlicht weiß, ohne jeden Aufdruck.
Caro sah zu, wie sich ihre Geschwister auf die neuen Sorten stürzten, und das, obwohl die Regale im Vorratsraum niemals leer zu werden schienen. Sie und ihre Mutter waren die Einzigen in der Familie, die keine Schokolade mochten.
Alle anderen – Erne, Tini, Habu, Fitzi und ihr Vater konnten der Versuchung selten widerstehen. Während zehn Hände nach den weißen Packungen griffen, sorgfältig das knisternde Stanniol auseinanderschlugen, sich über den Braunton austauschten – dunkelsamten musste er sein, mit einem matten, seidigen Glanz –, vorsichtig mit den Fingerspitzen über die Oberfläche fuhren, den Satz ihres Vaters wiederholten, Schokolade müsse sich anfühlen wie ein guter Stoff, wie Samt oder Seide, stand Caro ganz langsam auf.
Jeder brach sich von jeder Sorte eine Rippe ab, hielt sie ans Ohr, brach ein kleineres Stück ab, um die Reinheit des Knack-Tons zu beurteilen, betrachtete die Bruchkante – war sie sauber und glatt? Dann kam der Geruchssinn zum Einsatz, eifrige Stimmen tauschten sich über die Kakaosorte und -menge aus, den Milchanteil, die Konsistenz der Füllung, und mutmaßten darüber, welche Geschmacksrichtung diese haben könne: »Himbeer-Zitrone, Caramel, Crunch oder Marzipan? Ihh, Likör!«
Caro schob vorsichtig und darauf bedacht, jegliches Geräusch zu vermeiden, in dem Moment ihren Stuhl an den Tisch, als sich ihre Geschwister die Stücke in den Mund steckten, sie ordentlich durchkauten, wie sie es von ihrem Vater gelernt hatten, warteten, bis sich das Aroma im Mund verbreitete, die Augen schlossen und tief durchatmeten. Nun würden sich alle Geschmacks- und Geruchsstoffe im Mund und im Körper ausbreiten. So aß man Schokolade richtig! Das Ritual war ihnen allen in Fleisch und Blut übergegangen, seit ihr Vater vor vier Jahren die Leitung der Cassada übernommen hatte.
Caro suchte den Blick ihrer Mutter, und nach einem Nicken verließ sie auf Zehenspitzen die Stern’sche Wohnküche.
Minka
Zur selben Zeit saß Familie Schönwetter gut achtzig Meter Luftlinie entfernt in ihrem Wohnzimmer und sah fern. Heute war ein Ausnahmetag. In der Durchreiche zur Küche hatte ihre Mutter ein kleines Büfett mit halben gegrillten Hähnchen und Pommes frites vom neu eröffneten Wienerwald aufgebaut. Marc und Golo fläzten auf den orange-gelb-braun gestreiften Drehsesseln und aßen ihre Hähnchenschenkel aus der Hand. Minka kuschelte mit der Bullterrierhündin Clara auf dem Schoß in dem weißen Ei-Sessel, um dessen Besetzung es seit seiner Anschaffung regelmäßig Zoff gegeben hatte. Nur durch ein strenges Rotationsverfahren war es ihrer Mutter gelungen, den Streit zu schlichten. Schönwetter belegte seinen Stammplatz, den alten Sessel seines Vaters, gegen dessen Ausrangierung er sich erfolgreich zur Wehr gesetzt hatte und der in der modernen Einrichtung wie ein Fremdkörper wirkte. Normalerweise thronte er darauf, meistens in seinem braunen Pullover mit Rombenmuster, souverän und despotisch, wie er es von seinem Amtssitz gewohnt war, nur dass er in seinem Wohnzimmer die Füße auf einen Hocker legte, der mit dem gleichen Gobelinstoff bezogen war. Niemals hätte er erlaubt, vor dem Fernseher zu essen. Heute war wirklich ein Ausnahmetag!
Unruhig saß er auf der vorderen Kante des schweren Sessels, rauchte Kette und übersah das schlechte Benehmen seiner Kinder.
»Die Opposition tritt geschlossen zur Abstimmung an!«, tönte die Stimme des Reporters aus dem Lautsprecher. Man sah, wie zwei Abgeordnete im Rollstuhl zur Wahlurne geschoben wurden.
»Sogar aus dem Krankenzimmer werden sie herbeigeholt«, kommentierte der Reporter.
»Die Union schreckt auch vor nichts zurück!«, lautete Schönwetters Kommentar. Mit einem nervösen Stakkato drückte er die Zigarette in dem Glasaschenbecher aus, fingerte die nächste aus der offenen HB-Schachtel und schnickte mehrfach hintereinander vergeblich das Rädchen des Wegwerffeuerzeugs. Schweißperlen standen ihm auf der Stirn, sein Gesicht nahm eine gefährliche Röte an, ihm war anzusehen, dass er kurz vor einem Wutanfall oder Nervenzusammenbruch stand.
»Gib deinem Vater mal Feuer!«, sagte Helga Schönwetter zu ihrem Ältesten Golo und zeigte auf die zitternde Hand, die immer wieder das Rädchen am Feuerzeug betätigte, worauf es zwar Funken sprühte, aber keine Flamme entstand. Golo legte den nahezu vollständig abgenagten Hähnchenschenkel auf seinen Teller, wischte sich die Hände an der Papierserviette ab und ging hinüber zur Anrichte.
»Aber mach schnell!«, sagte seine Mutter, die die vergeblichen Versuche Schönwetters nicht mehr ertragen konnte.
Die Kamera schwenkte auf die Abgeordneten der Sozialdemokraten im Plenarsaal, die scheinbar unbeteiligt auf ihren Plätzen sitzen blieben.
»Hingegen hat SPD-Fraktionschef Wehner den eigenen Leuten wohl geraten, sich nicht an der Abstimmung zu beteiligen«, sagte die Stimme des Fernsehreporters.
»Richtig so!«, rief der Bürgermeister viel zu laut.
»Es sieht schlecht aus für die Regierung. Es heißt sogar, im Kanzleramt bereitet man sich schon auf den Abgang vor.«
Schönwetter warf das Feuerzeug auf den Tisch und strich sich mit der Handfläche über seine breiten Koteletten. Inzwischen hatte Golo die Schublade durchwühlt und eine Packung Streichhölzer gefunden.
Er stellte sich neben seinen Vater und gab ihm Feuer. Als sein Vater den ersten tiefen Zug nahm, wiederholte Marc den Werbeslogan, den sie jeden Abend vor den Nachrichten im Ersten sahen: »Wer wird denn gleich in die Luft gehen … greife lieber zur HB!«
Seine Mutter zog die schwarz nachgezeichneten Augenbrauen hoch und schüttelte warnend den Kopf. Golo unterdrückte ein Lachen.
»Gleich ist es so weit! Dann werden alle Abgeordneten abgestimmt haben und die Auszählung kann beginnen!«, kam wieder die Stimme aus dem Fernsehlautsprecher. Schönwetter hielt es nicht mehr auf dem Sessel. Er sprang auf und lief im Wohnzimmer auf und ab.
Minka hatte keine Ahnung, um was es wirklich ging, dazu war sie mit ihren zehn Jahren noch zu jung. Aber natürlich wusste sie, wie sehr ihr Vater Willy Brandt verehrte und wie leicht dessen Sturz sich zu einem Feuerwerk der schlechten Laune ausweiten konnte, das mehr als nur einen Tag anhalten würde.
Die Familie Schönwetter war nach 1945 aus Siebenbürgen eingewandert, und Haralds Vater Velten war kurz darauf in die Partei eingetreten. Bereits in der zweiten Wahlperiode war er 1950 über die Landesliste der SPD in den Hessischen Landtag gewählt worden und 1952 zum Bürgermeister von Mainheim, ein Amt, das er mit Herzblut bis zu seinem Tod ausübte. Sozialpolitik hatte er sich auf die Fahnen geschrieben. Aber gleichzeitig hatte er es verstanden, mit Geschick und Zugeständnissen Unternehmer und Fabrikanten von den Vorteilen des Wirtschaftsstandorts Mainheim zu überzeugen. Die gute Bahnanbindung, die nahe Schifffahrtslinie, der stets Wasser führende Bach und der weitverbreitete Zuckerrübenanbau in der Mainebene hatten bereits lange vor seiner Amtszeit zur Gründung einer Zuckerfabrik geführt. Damit hatte das industrielle Zeitalter Mainheims begonnen, das zuvor ein Dörfchen gewesen war, allenfalls bekannt für Rosenzucht, Kirschplantagen und Zuckerrüben.
Aber erst mit dem Erwerb der Anlage durch die Cassada GmbH, die sie zu einer Schokoladenfabrik umbaute, wurde Mainheim zu einem bedeutenden Industriestandort. Es siedelten sich andere Unternehmen an, eine Kartonagefabrik, eine Großbäckerei, auch die Farbenfabrik im Nachbarort streckte ihre Fühler aus, suchte nach Land für Erweiterungen, warf ein Auge auf die Brachflächen am anderen Ufer. Velten Schönwetter war klug genug, sie auf das Gemeindegebiet jenseits des Mains zu verweisen und die beißenden Dämpfe, die aus ihren Schloten kamen, von Mainheim größtenteils fernzuhalten. Was genau der Handel war, wie er die Bauern, die Grundeigentümer, dazu brachte, nicht an die Farbenfabrik zu verkaufen, wusste keiner so genau. Er favorisierte die Cassada, und diese entwickelte sich zum wichtigsten Arbeitgeber der Gemeinde. 1960 war das Werk mit zweitausend Beschäftigten das größte Unternehmen im Kreis. Der Arbeitskräftebedarf ließ die Mainheimer Bevölkerung rasch ansteigen und gab in den 1960er-Jahren den ersten Gastarbeitern in Mainheim eine zweite Heimat.
Mit Zustimmung von Velten Schönwetter wurden neue Wohngebiete mit mehrgeschossigen Gebäuden erschlossen, die das Bild der Gemeinde nachhaltig veränderten. Gleichzeitig dehnte sich die Stadt nach Westen aus. Es war sein Lebenswerk, sein Mainheim. Velten Schönwetter und seiner Fähigkeit, die Industrie anzulocken und zu halten, hatte die Kleinstadt ihren Wohlstand zu verdanken. Als Harald Schönwetter nach dem Herzinfarkt seines Vaters 1965 dessen Nachfolge antrat, mit einer Mehrheit von 67 Prozent der Stimmen, übernahm er ein gut bestelltes Haus, mit sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen und einem Füllhorn voller Wohltaten durch die Cassada. Was er nicht übernahm, denn sein Vater hatte es versäumt, ihn rechtzeitig einzuweihen, war das komplizierte Netz von Kontakten. Als er das Amt antrat, wusste er kaum etwas von den unzähligen Absprachen, Tauschbeziehungen, Gefallen, Vermittlungsgeschäften und offenen Rechnungen, die Velten Schönwetter über Jahre aufgebaut und gepflegt hatte, so wie es ihm sein Vater schon in Siebenbürgen vorgemacht hatte. Hier wie da hatte man seine eigenen Gesetze, keine auf Papier gedruckten, sondern viel tiefer gehende, eingepflanzt in die Gedächtnisse.
Schönwetter hatte das Gymnasium in der Nachbarstadt besucht, in Frankfurt am Main Jura studiert, war nebenher Taxi gefahren, um sich ein paar Mark zu verdienen, den Jusos beigetreten, bei denen er seine spätere Ehefrau kennengelernt hatte, und hatte in dem Glauben gelebt, sein Vater habe über Jahre ausschließlich sozialdemokratische Ideale verfolgt. Er war ein verschlossener Mann. Selten gab er seine Gedanken preis, außer es waren sozialdemokratische bis hin zu sozialistischen Überlegungen reinster Güte. Selbst nach sieben Jahren Amtszeit wollte er nicht wahrhaben, dass er ohne Zugeständnisse an die Unternehmer, ohne ein positives Investitionsklima, in seiner Stadt nicht weiterkam. Die Kartonagefabrik war zuerst abgewandert, dann die Großbäckerei, nur die Cassada AG war geblieben.
»Die Liberalen schicken da offenbar einige sichere Kandidaten ins Rennen«, erklärte der Reporter gerade, als die Kamera zwei ältere Abgeordnete in Großaufnahme zeigte, die nacheinander ihre Wahlbriefe in den Schlitz der Urne warfen. »Wohl um eventuellen Abweichlern aus den Reihen der CDU/CSU bessere Tarnungsmöglichkeiten zu bieten.«
»Was redet der da? Ist der verrückt geworden!«, rief Schönwetter und gab dem leeren Drehsessel einen Schubs mit dem Fuß, sodass er Karussell fuhr. »Woher will der das wissen?«
Dann begann die Auszählung. Die Luft im Wohnzimmer war zum Schneiden, nicht nur wegen der unzähligen Zigaretten, die Schönwetter geraucht hatte, sondern weil seine Anspannung sich zur Unerträglichkeit steigerte. Wenn die Sozialdemokraten scheiterten, würde es sich für ihn anfühlen wie seine eigene Niederlage. Er tigerte auf dem braun melierten Teppichboden auf und ab und ärgerte sich an diesem Tag noch mehr darüber, sich nicht gegen Annette durchgesetzt und der in seinen Augen viel zu extravaganten Einrichtung zugestimmt zu haben. Golo und Marc begannen, sich um den Nachtisch zu kabbeln. Die Bullterrierhündin Clara sprang von Minkas Schoß, schnappte sich ein abgenagtes Hühnerbein von Marcs Teller und rannte damit zur Tür hinaus.
»Um Gottes willen!«, rief ihre Mutter. »Sie darf keine Geflügelknochen fressen! Nimm ihn ihr ab!« Obwohl sie den Hund nicht besonders ins Herz geschlossen hatte, mochte sie sich nicht ausmalen, was die Splitter in der Speiseröhre anrichten konnten. Minka bekam es mit der Angst zu tun und raste hinter dem weißen Hund her, der sofort die Treppe hinauf in das obere Stockwerk flüchtete, sich in ihrem Zimmer unter dem Bett verkroch.
Während Minka bäuchlings auf ihrem Flokati lag und vergeblich versuchte, Clara mit guten Worten und Streicheleinheiten herauszulocken, gab der Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel um 13.22 Uhr das Wahlergebnis bekannt. Aus dem Wohnzimmer ertönte ein Jubelschrei. Von vierhundertsechsundneunzig Abgeordneten, die stimmberechtigt waren, hatten zweihundertsechzig ihre Stimme abgegeben. Zweihundertsiebenundvierzig waren für das Misstrauensvotum gewesen und zehn dagegen. Es gab drei Enthaltungen. Damit fehlten Barzel genau zwei Stimmen zum Sieg.
»Ab-ge-schmet-tert, Steeeern!«, rief Schönwetter, die Vokale in jeder einzelnen Silbe betonend, aus der nun endlich weit geöffneten Terrassentür. Er legte alle Kraft in seine Stimme, damit es sogar Stern in seiner Kellerküche hören sollte.
Ob es durch das Geschrei seines Herrchens kam, oder weil Minka sie beim Verschlingen ihrer Beute störte, jedenfalls schnappte Clara in diesem Moment nach Minkas Hand. Der Hund war wohl selbst so erschrocken darüber, dass er sofort wieder losließ, was gegen sein Naturell war. Wenn sich ein Bullterrier einmal festbiss, brachte ihn kaum etwas dazu, wieder abzulassen, schließlich waren seine Vorfahren für englische Hundekämpfe gezüchtet worden. Und mit ihren starken Kiefern wäre es für Clärchen ein Leichtes gewesen, das zarte Handgelenk eines zehnjährigen Mädchens zu knacken. Doch der kleine Schnapper war harmlos, eher ein Ausrutscher. Trotzdem: Minka hatte zwei Wunden, am Handrücken und am Daumen, in denen deutlich die Abdrücke von Clärchens Reißzähnen zu sehen waren, und ein bisschen blutete es.