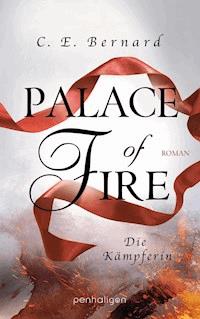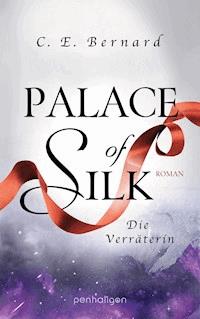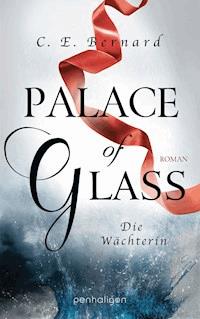9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Wayfarer-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Nach »Das Lied der Nacht« der zweite Band der epischen Wayfarer-Saga: Wird der Wanderer Weyd die Türme des Lichts finden?
»Ich erzähle euch eine Geschichte. Sie beginnt an einer alten Straße, im schwindenden Zwielicht. Sie beginnt in der Dämmerung, wenn die Geschichten locken, wenn die Lieder rufen, wenn ein Raunen in der Luft liegt, ohne dass man wüsste, wer dort spricht. Hört genau hin. Wer ist es, der dort wispert?«
Wanderer Weyd begibt sich mit seinen Gefährten auf die Reise zu den legendären Türmen des Lichts. Seine Waffe gegen die monströsen Schatten ist keine Armee, sondern ein uraltes Lied – doch wird es die Helden schützen? Denn diesmal kann die Bardin Caer ihre Stimme nicht gegen ihre Feinde erheben. Dabei lauert ihnen ein Gegner auf, der finsterer ist als jeder Schatten ... Nach »Das Lied der Nacht« der zweite Band der dreibändigen »Wayfarer«-Saga aus der Feder einer umwerfenden deutschen Autorin!
Die Printfassung enthält exklusives digitales Bonusmaterial (Augmented Reality, AR) zum Entdecken.
Alle Bände der »Wayfarer«-Saga:
Das Lied der Nacht
Das Flüstern des Zwielichts
Der Klang des Feuers
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Ähnliche
Buch
Wanderer Weyd begibt sich mit seinen Gefährten auf die Reise zu den legendären Türmen des Lichts. Seine Waffe gegen die monströsen Schatten ist keine Armee, sondern ein uraltes Lied – doch wird es die Helden schützen? Denn diesmal kann die Bardin Caer ihre Stimme nicht gegen ihre Feinde erheben. Dabei lauert ihnen ein Gegner auf, der finsterer ist als jeder Schatten … Nach »Das Lied der Nacht« der zweite Band der dreibändigen Wayfarer-Saga aus der Feder einer umwerfenden deutschen Autorin!
Autorin
C. E. Bernard ist das Pseudonym von Christine Lehnen, die 1990 im Ruhrgebiet geboren wurde und seitdem in Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien und Paris gelebt hat. Sie studierte die Fächer English Literatures and Cultures und Politikwissenschaft, seit 2014 lehrt sie Literarisches Schreiben an der Universität Bonn. Daneben promoviert sie an der University of Manchester über Neuerzählungen des Trojanisches Krieges, erwandert das Siebengebirge und mentoriert zukünftige Talente für PAN e. V. Ihre Kurzgeschichten wurden mit den Literaturpreisen der Jungen Akademien Europas und der Ruhrfestspiele Recklinghausen ausgezeichnet, ihre Romane waren für den RPC Fantasy Award und den Lovelybooks-Leseraward nominiert. Christine Lehnen schreibt auf Englisch – ihre auf Deutsch erschienenen Werke, darunter die Palace-Saga und zuletzt die Wayfarer-Saga, werden ins Deutsche zurückübersetzt.
Weitere Informationen unter: http://de.cebernard.eu/
Von C. E. Bernard bereits erschienen:
Palace of Glass
Palace of Silk
Palace of Fire
Palace of Blood
Das Lied der Nacht
Das Flüstern des Zwielichts
Der Klang des Feuers
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
C. E. Bernard
DASFLÜSTERNDESZWIELICHTS
Roman
Deutsch von Charlotte Lungstrass-Kapfer
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Copyright der Originalausgabe © 2021 by Christine LehnenCopyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Redaktion: Jennifer JägerKarte: Annika WalterUmschlaggestaltung und -illustration: Isabelle Hirtz, Inkcraft, unter Verwendung eines 3D-Models von ZB3D (turbosquid)BL · Herstellung: MRSatz: Mediengestaltung Vornehm GmbH, MünchenISBN 978-3-641-26895-4V001www.penhaligon.de
Für Bernd Lau, Peter Steinbach und Peter Zwetkoff
Ihr seid an mein Feuer zurückgekehrt.
Hell und warm brennt es, während die Abenddämmerung den Himmel mit tiefem Blau überzieht und die Bäume und den Pfad schwärzt, auf dem ihr zu mir gekommen seid. Ihr habt euch nicht in den Tiefen der Wälder verirrt. Ihr habt euch nicht schrecken lassen von den Narben in meinem Gesicht und den Blutflecken auf meinem Mantel. Ihr sitzt wieder an meinem Feuer, hier in der Abenddämmerung.
Seid ihr im Zwielicht gekommen, weil ihr befürchtet habt, ihr könntet euch des Nachts zwischen den Bäumen verirren?
Denn das geschieht nur allzu leicht. Ihr verlasst den Pfad, eure Füße tragen euch fort von eurem Weg, einen Moment lang gebt ihr nicht Acht und bemerkt euren Fehler erst, wenn ihr schon tief im Wald steht.
Oder seid ihr im Zwielicht gekommen, weil ihr es gehört habt?
Habt ihr mein Lied gehört?
Denn die Abenddämmerung ist die Stunde, in der die Geschichten erwachen.
Wenn der erste Stern am Himmel erscheint, hell und silbern schimmernd, beginnen sie zu flüstern.
Sie wispern.
Sie singen.
Sie erwarten euch.
Rückt dichter ans Feuer heran. Schert euch nicht um meine Tränen, um mein Lächeln. Rückt dichter heran, dann singe ich euch ein Lied, erzähle euch eine Geschichte. Sie beginnt an einer alten Straße, im schwindenden Zwielicht. Sie beginnt in der Stadt, die der Finsternis der Nacht anheimfällt, der Finsternis des Krieges. Sie beginnt mit Reisenden, leise singenden Reisenden, guten Freunden, denen noch nicht bewusst ist, wie leicht man vom Weg abkommen kann. Vor allem in der Dämmerung, wenn die Geschichten locken, wenn die Lieder rufen, wenn ein Raunen in der Luft liegt, ohne dass man wüsste, wer dort spricht.
Rückt dichter heran.
Und hört genau hin.
Wer ist das?
Wer ist es, der dort wispert?
1 – Reiter
Reiter
Ein Fremder kam den Grauen Pfad entlang.
Es war ein Mann, entschieden die meisten, die ihn vorbeiziehen sahen. Heutzutage wagte sich niemand mehr nach Anbruch der Dämmerung auf die Straße, denn eigentümlich waren die Tage und schrecklich die Nächte, seit die Schatten sich erhoben hatten. Des Nachts waren sie erschienen, mit ihren Schwertern aus Feuer, grellweiß und so kalt. Abgeschlachtet hatten sie alles, was lebte oder einst gelebt hatte – kleine Kinder, alte Frauen, stolze Rösser. Die Ziegen, die den Menschen brav ihre Milch gaben. Manche behaupteten, man könne sich schützen gegen die Schatten, indem man sich hinter Mauern aus Stein und Toren aus Eisen verschanzte. Wieder andere erzählten, es gäbe ein Lied, das als Schild diene, aber wer hatte schon jemals gesehen, dass ein Lied gegen eine Klinge schützte, eine strahlende, tödliche Klinge?
Lieber machten sich die Menschen hinter steinernen Mauern und eisernen Toren zu Gefangenen, in den Städten, Dörfern und Burgen, und so waren die Tage eigentümlich und die Nächte finster. Denn des Nachts wisperte die Furcht, kroch in ihre Häuser und Hütten, schob ihre langen, dürren Tentakel in jede Schlafkammer. Sie raunte und flüsterte, wie sie es schon immer getan hatte in den finsteren Nächten, die weder Mond noch Sterne erhellten. Legenden besagten, dass die Nächte einst hell gewesen waren, erleuchtet vom Mond und den Sternen, als die Feuer noch brannten in den Türmen des Lichts, als die Glocken noch sangen. Als Feuer und Glockenklang die Finsternis und die Stille vertrieben, überall auf dem Kontinent Erebu.
Aber niemand wusste, ob man diesen Legenden Glauben schenken sollte, wo die Nächte seit sie denken konnten doch so finster waren und die Schatten so tödlich.
Deshalb war es umso merkwürdiger, nun diesen Fremden auf der Straße zu sehen. Einst hatte man sie den Westlichen Weg genannt, als sie sich noch breit und stolz durch die Lande erstreckt hatte, als ihr weißer Stein noch gepflegt und instand gehalten worden war. Heute nannte man sie den Grauen Pfad, oder einfach nur den Pfad, denn es war kaum noch etwas geblieben von den vielen Wegen und Handelsrouten, die früher den ganzen Kontinent durchzogen hatten.
Nahe der kleinen Stadt Ricoldinchuson sah man den Fremden zum ersten Mal, bei einem Bauernhof, dessen Bewohner hinausgingen aufs Feld, sobald das erste Licht durch den Morgennebel drang. Sie beackerten die Scholle, hofften eine Ernte einfahren zu können, auch wenn Nacht für Nacht die Schatten über sie herfielen. Jemand musste ja das Land bestellen und Nahrung für Ricoldinchuson anbauen, hinter dessen Stadtmauern sich auch die Bewohner jenes Hofes versteckten, nachts, wenn die Schatten erschienen. Sie mussten es zumindest versuchen, sonst würde der Hunger sie während der Belagerung durch die Schatten ebenso sicher töten wie die Klingen aus Feuer, so weiß und kalt.
Der älteste und der jüngste Bewohner des Hofes waren im Obstgarten und spazierten zwischen den Apfelbäumen einher. Großvater und Enkelsohn waren sie, und sie unterhielten sich in der Sprache des südlichen Königreiches Sapaudia, aus dem der Großvater als Kind mit seinen Eltern geflohen war, die auf der Suche nach Arbeit mit ihm nach Norden zogen.
Der Enkel sah den Fremden als Erster.
»Guarda, nonnus!«
Er zeigte zur Straße, und sein Großvater hob den Kopf und erblickte ihn. Sah den Fremden, der in der Morgendämmerung unterwegs war.
Zu Pferde reiste er. Einen Mantel trug er, einen langen grauen Mantel. Sein Pferd war groß und prächtig.
Und er schien zu singen.
Sofort atmeten die beiden auf, denn das war keine Armee. Die Eiserne Armee sei auf dem Vormarsch aus Schur im Süden, erzählten die Leute, doch das hier war nicht die Eiserne Armee, unter deren Ansturm Ricoldinchuson innerhalb eines halben Tages fallen würde. Nicht die Armee von Lurin, dem Eisernen Baron.
Nein, das war sie nicht.
Nur ein einzelner Reiter. Ein Reiter, der sang. Auch wenn der Großvater die Worte des Liedes nicht ausmachen konnte. Sein Enkelsohn ebenfalls nicht. Leise schlichen sie bis zu der Hecke, die den Obstgarten von der Straße trennte. Traurig klang das Lied. Als würde der Reisende von längst vergangenen Zeiten singen, einer längst verlorenen Liebe, einer Heimat, die nicht mehr aufzufinden war. Und während sie heranschlichen, um dem Lied des einsamen Reiters zu lauschen, marschierte viele Meilen weiter südlich eine Armee über den Grauen Pfad.
Eine Armee, ganz in Eisen gewandet, die Rüstungen geschmiedet aus schwarzem, starkem Metall. Fackeln trugen die Männer, und wenn sie abends ihr Lager aufschlugen, sangen sie das Lied der Nacht. Im Licht des Tages marschierten sie über die Straße, brannten die Felder nieder, die von den Schatten verschont worden waren, überließen Gärten und Höfe und Mühlen den Flammen. Den Kopf der Königin von Allaith hatten sie auf einen Spieß gesteckt, und gelacht hatten sie, als sie durch ihr Königreich marschierten, denn für sie war es so klein, dass es nicht einmal als richtiges Land zählte. Im Winter wären sie wieder daheim, glaubten diese Soldaten, die dort über den Grauen Pfad marschierten. Eine Frau war unter ihnen, eine Frau, die am lautesten von allen gelacht hatte, als sie den Kopf der Königin auf den Spieß steckte. Lauter als alle anderen hatte sie gelacht, denn sie glaubte, dass sie stark erscheinen musste, sollte ihr Kopf nicht der nächste sein. Bigna war ihr Name. Bis sie den Kopf einer Königin aufgespießt hatte, war sie einfacher Soldat gewesen, doch als der Baron das sah, befahl er, ihr ein Pferd und einen Rang zu geben, der ihrem Eifer entsprach. Und so ritt nun Leutnant Bigna über den Grauen Pfad, den Blick starr nach vorne gerichtet, wo der Baron und sein Hauptmann mit ihren eisernen Helmen ritten. Eine lange graue Feder trug der Hauptmann an ihrem Helm, und diese Feder wollte Bigna unbedingt haben. Denn eines stand für sie fest: Niemand würde es wagen, den Hauptmann der Eisernen gegen ihren Willen anzufassen. Die Armee steuerte auf ein Dorf zu. Hell leuchteten ihre Fackeln in der Dämmerung. Bigna reckte ihre in die Höhe, während sie das Tempo beschleunigte. Während sie auf das Dorf zu galoppierte.
Sie würde dafür sorgen, dass Schur stolz auf sie war.
Viele Meilen weiter nördlich lauschten Großvater und Enkel darauf, wie der Fremde sich auf dem Grauen Pfad näherte. Vielleicht brachte er Neuigkeiten. Neuigkeiten, die von Frieden kündeten. Von dem Lied, das ein Schutzschild sein sollte. Neuigkeiten aus der Stadt Briva. Briva der Blauen, so stolz und so schön. Briva, der Stadt der Brücken. Briva, der Stadt der Schiffe. Briva, der Stadt des Brotes, des köstlichsten Brotes, das je gebacken wurde. Der Großvater kannte ein Lied darüber. Eine Bardin hatte es in Ricoldinchuson zum Besten gegeben, mit dieser wundervollen Stimme, als sein Enkel noch ein kleiner Wurm gewesen war. Nun zählte der Junge bereits fünf Lenze, und er kannte das Lied auswendig, weil sein Großvater es ihm so oft vorgesungen hatte.
Der Reiter allerdings sang ein anderes Lied.
Warum dröhnt der Hufschlag laut, so laut
aus dem Tale zu mir herauf?
Das sind nur die Bauern und Tölpel, mein Kind,
nur die Bauern kommen herauf.
Es klang wie ein Klagelied.
»Nonnus«, sagte der Enkel und zeigte auf seine Füße. Dünn und fahl klang seine Stimme, so fahl wie der Umhang des Reiters. Der Großvater blickte zu Boden.
Unzählige Spinnen krochen über die Erde, mit langen, dünnen Beinen, und graue, zuckende Kellerasseln. Über ihre Schuhspitzen krochen sie, über ihre Füße.
Durch die Hecke kamen sie.
In den Garten hinein liefen sie.
Warum dringt Lärmen laut, so laut
Über die Straße zu mir heran?
Das sind nur die Boten und Herolde, Kind,
nur die Herolde kommen heran.
Und dann hörten sie das Rauschen unzähliger Flügel, ein lautes Tosen, als wäre auf einmal ein Sturm losgebrochen. Großvater und Enkel hoben den Kopf. Überall stiegen Vögel aus den Bäumen auf und schwangen sich in die Lüfte. Hektisch flatterten sie, flogen davon so schnell sie konnten, schossen über den Garten hinweg.
»Sind das die Schatten, nonnus?«, fragte der Enkel.
Der Großvater sah sich um. Der Morgen war angebrochen. Es konnten nicht die Schatten sein, die erhoben sich nur des Nachts.
Welch Gestalt seh’ ich vor mir, klar, so klar,
welch Gestalt kommt im Zwielicht heran?
Das ist nur ein einsamer Reiter, mein Kind,
ein grauer Reiter trabet heran.
»Komm.« Der Großvater nahm seinen Enkelsohn an die Hand. »Komm, wir müssen nach Ricoldinchuson zurück.«
Und auch dem Fremden auf dem Grauen Pfad rief er es zu. In der Gemeinen Sprache rief er: »Guter Mann! Komm mit uns, zurück in die Stadt!«
Und der Fremde hielt an.
Tief in seinem Inneren begann der Großvater zu zittern.
Der Reiter sang noch immer.
Warum fühl’ ich in mir die Furcht so stark,
wenn im Zwielicht er trabet heran?
Schließ die Augen nun, schließ die Augen, mein Kind,
der Fahle Reiter trabet heran.
Sehr lange schon lebte der Großvater in dieser Welt. Sehr lange war er selbst ein Fremder gewesen, hatte viel Freundlichkeit erfahren von Menschen, die ihn aufgenommen hatten, auch hier in Ricoldinchuson, wo er zunächst in den Minen gearbeitet hatte, bevor er sein eigenes Gehöft bezog. Fremdes machte ihm keine Angst.
Aber nun, nun regte sich Furcht in ihm, ohne dass er gewusst hätte warum. Denn dieser Reiter, er klang doch nur traurig. Falls es ein Er war. Die Stimme hätte ebenso zu einem Mann wie zu einer Frau gehören können, und sie klang schrecklich einsam.
Viele Meilen weiter südlich trieb Bigna ihr Pferd voran. Sie überholte ihre Kameraden. Sie wollte die Erste sein. Selbst den Hauptmann und den Baron überholte sie.
»Für Schur!«, brüllte sie, als sie in das Dorf preschte. In das Dorf, in dem noch Menschen waren.
Sie zog ihren Pallasch.
Viele Meilen weiter im Norden packte der Großvater seinen Enkelsohn an den Schultern. »Komm, guter Reisender! Es könnten die Schatten sein, von denen du gewiss schon gehört hast. Komm mit nach Ricoldinchuson! Der Bürgermeister wird dich sicher dort aufnehmen.«
Der Reiter setzte sich wieder in Bewegung. Langsam und schweigend ritt er zu dem Tor in der Hecke.
Und als der Reiter sich dem Tor näherte, sahen sie ihn zum ersten Mal ganz deutlich.
Der Großvater wich einen Schritt zurück, hätte beinahe das Gleichgewicht verloren.
Das war kein Reiter. Es hatte den Anschein, aber nun sah er keinen Mann vor sich. Auch keine Frau verbarg sich in dem fahlen grauen Mantel. Nein, er sah seinen Enkel vor sich.
Seinen Enkel, mit leerem Blick, mit getrocknetem Blut im Gesicht, das Genick gebrochen wie ein trockener Zweig.
Er sah seinen Enkel vor sich, und sein Enkel war tot.
Und dann sah er nicht mehr seinen Enkelsohn vor sich, sondern seine Enkeltochter.
Seine Älteste, deren Haar so dunkel war, deren Blick so grimmig. Und dann die Zweitälteste mit dem kräftigen Kinn und der Vorliebe für Äpfel.
Und dann kamen die dritte, die vierte, die fünfte Enkeltochter, dann die sechste und die siebte.
Und dann sah er sich selbst.
Sich selbst, wie er tot und leblos lag.
Er stieß ein ersticktes Geräusch aus, ein Keuchen, bevor er sich abwandte und floh, seinen Enkel hinter sich herschleifend. Seinen Enkel, in dessen weit aufgerissenen Augen die blanke Furcht flackerte. Denn er hatte eine Gestalt gesehen
so finster
so entsetzlich
dass der bloße Anblick
ihm das Augenlicht geraubt hatte.
»Lauft!«
In der Gemeinen Sprache rief der Großvater es, damit alle Menschen auf dem Hof – von denen einige zu seiner Familie gehörten, andere seine Freunde waren – es verstehen konnten. Retten, er wollte sie alle retten. Und in der Sprache seiner Kindheit rief er es, laut und schrill: »Correre!«
Auf den Feldern hörten sie ihn. Sie legten ihre Hacken und Gabeln und Harken und Schaufeln weg. Sie blickten hoch und sahen die Vögel. Sie sahen, wie die Vögel die Flucht ergriffen.
Die älteste Enkeltochter mit dem dunklen Haar und dem grimmigen Blick ließ alles fallen und rannte los, rief den anderen zu, dass sie ihr folgen sollten. Zurück in die Stadt.
Die Zweitälteste mit dem kräftigen Kinn und der Vorliebe für Äpfel blickte zum Garten hinüber, wandte sich um und lief zu ihrem Großvater und ihrem kleinen veter.
Wie gejagt stürmte sie los und rief: »Veter! Ahn!«
Der Großvater hatte seinen Enkelsohn hinter sich hergezogen. Nun hörte der Junge die Stimme und antwortete: »Muhme!«
Hufschlag dröhnte hinter dem Großvater. Hufschlag, der näher und näher kam.
Hastig schob er seinen Enkel vor sich her.
»Lauf, mein Junge!«
Aber der Junge konnte nicht weglaufen. Ängstlich klammerte er sich an die Hand des Großvaters. »Ich kann nicht, ahn! Ich kann nichts sehen!«
Nun erreichte die Enkeltochter den Garten.
Sah es.
Sah, wie ahn und veter auf sie zu rannten.
Sah, wie hinter ihnen ein Reiter auftauchte.
Zumindest für einen Moment.
Dann sah sie keinen Reiter mehr. Sie sah einen Mann mit übermütigem Grinsen und Augen, die Alkohol und Lust mit einem glasigen Film überzogen hatten. Einen Mann mit einem eleganten Hut und ach so weichen Handschuhen.
Diesen Mann hatte sie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen.
Sie wusste, dass er tot war. Sie selbst hatte den Stein genommen und damit auf seinen Schädel eingeschlagen, bis er aufgeplatzt war.
Und nun war er zurück, der Mann mit den starken Händen, die doch so weich waren. Er war zurück, und er wollte sie holen.
Wollte sich noch mehr von ihr holen.
Also hob sie noch einmal einen Stein vom Boden auf. Ging damit auf ihn zu.
Ahn und veter hielten weiter auf sie zu. Der Mann hatte sie fast eingeholt. Und trotzdem war sein Blick starr auf sie gerichtet. Gier brannte in seinen Augen. Nun hörte sie auch seine Stimme. Ganz leise flüsterte sie, dicht an ihrem Ohr.
Wenn du schreist, wenn du nur einen Mucks machst, werde ich dich töten.
Ja, sie hörte ihn. Neben sich, über sich. Spürte ihn in sich, wie er ihr Innerstes zu zerfetzen drohte.
Er lächelte.
Du kannst mir nicht entkommen.
Sie warf den Stein nach ihm.
Er blieb stehen. Stöhnte. Als er den Kopf hob, zog sich eine große Platzwunde über sein Gesicht.
Jetzt grinste er nicht mehr. Jetzt war er wütend. So wütend wie damals, als er beide Hände um ihre Kehle geschlungen und sie gewürgt hatte. Als er sie erst vergewaltigt und ihr anschließend ins Gesicht gespuckt hatte.
Als wollte er sie umbringen.
Die Furcht durchfuhr sie so heftig, dass sie zurückwich.
»Lauf!«, rief ihr Großvater. »Kein Stein wird uns retten!«
Sie gehorchte.
Sie alle flohen.
Und hinter ihnen dröhnte der Hufschlag.
Der Reiter war schneller als sie.
Schnell war der Reiter, und schnell war die Armee, die viele, viele Meilen weiter südlich über den Grauen Pfad marschierte. Die Armee, in der Bigna, einst Fußsoldat und nun Leutnant, ritt. Singend ließ sie vom Pferderücken herab ihren Pallasch tanzen. Direkt vor ihr rannte ein Mann auf den Dorfplatz. Sie ritt ihn einfach nieder. »Für Schur!«, brüllte sie, unterstützt von vielen Stimmen. So vielen Stimmen. Und nun gellten auch die drimbas. Viele, viele drimbas erklangen laut und schrill in der Morgendämmerung.
Und während die Armee das Dorf stürmte und alles niedermachte, was noch nicht geflohen war, hielt der Reiter auf den Großvater zu, den Enkelsohn, die Enkeltochter. In donnerndem Galopp verfolgte er die Bauern von Ricoldinchuson.
Furcht packte den Großvater. Eine so schreckliche Furcht, dass sie sein Herz erzittern ließ. Erzittern, dann innehalten. Sein Körper verkrampfte sich.
Er stürzte.
Stürzte und zog seinen Enkelsohn mit sich.
Fünf Jahre war sein Enkelsohn alt. Der Junge beugte sich über den Großvater. Zerrte an ihm. Schüttelte ihn. »Komm, ahn! Wir müssen weiterlaufen!« Mit aller Kraft zog der Junge an seinem Ohr. Diesem zerbrechlichen Ohr, aus dem weiße Haare sprossen. Er versuchte, sich den Alten auf die Schultern zu laden, aber er war nicht stark genug. Schließlich drehte er sich um.
Der Reiter kam heran.
Wieder spürte der Junge diese schreckliche Gestalt vor sich. Diese vollkommen unbegreifliche Gestalt.
So
unfassbar
schrecklich.
Der Junge brach zusammen. Auch sein Herz hörte auf zu schlagen.
Und die Enkeltochter sah es voller Grauen.
Nun wandte sich der Reiter ihr zu. Nun kam der Reiter zu ihr hinüber.
Er kam zu ihr.
Hastig wich sie zurück, wirbelte herum und rannte weiter.
Dreh dich nicht um, befahl sie sich.
Dreh dich nicht um!
Schnell rannte sie, und schnell galoppierte viele Meilen südlich Bigna, der Eiserne Leutnant, durch das Dorf. Im gestreckten Galopp schwang sie ihren Pallasch, tötete, setzte mit ihrer Fackel jedes Haus in Brand, das sie passierte.
»Verschont die Bäume!«, rief Lurin, der Eiserne Baron. »Denkt daran: Wir lieben unsere Bäume in Schur, wir lieben unsere Erde. Also verschont die Bäume!«
Und sie verschonte die Bäume. Stattdessen hielt sie ihre brennende Fackel an einen Mann, der sich keuchend auf der Erde wand und versuchte, vor ihr davonzukriechen.
Sie lachte, als die Flammen ihn verzehrten.
Sie lachte und sorgte dafür, dass der Baron es sah.
Im Norden, viele Meilen weiter im Norden, hatte der Reiter die Enkeltochter fast eingeholt. Und als sie seinen Atem im Nacken spürte, konnte sie nicht anders.
Sie drehte sich um.
Und wieder sah sie den Mann mit dem eleganten Hut und den feinen Handschuhen.
Mörderische Wut spiegelte sich in seinen Zügen.
Geilheit und Gier spiegelten sich in seinen Augen.
Ihr Herz raste
raste
und dann blieb es stehen.
Und auch sie stürzte.
Und der Reiter zügelte sein Pferd.
Der Reiter in dem grauen, fahlen Mantel. Der Reiter, der keine Waffe bei sich trug.
Nur dieses Lied.
Das Lied, das er mit so trauriger Stimme gesungen hatte.
Ganz allein stand der Reiter da.
Ganz allein stand er da und sah zu, wie die verbliebenen Bauern vor ihm flohen. Ganz allein stand er da und musterte die drei Toten auf der Erde.
Der Fahle Reiter trabet heran, heran,
der Fahle Reiter, er kommt zu dir.
Nun ist es bald vorüber, mein Kind,
denn der Tod, er trabet heran.
Der Tod, er kommt zu dir.
Reglos sah der Reiter zu, wie die Bauern sich nach Ricoldinchuson flüchteten.
Er folgte ihnen. Jeder einzelne von ihnen fiel leblos zu Boden, noch bevor sie das Stadttor erreichten.
Der Reiter kehrte zurück auf den Grauen Pfad und setzte seinen Weg nach Süden fort.
Nach Süden, wo die Armee des Eisernen Barons die letzte noch lebende Frau des Dorfes abschlachtete. Bigna sah sich nicht an, was sie mit ihr machten. Sie half dabei, die Leichen zu verbrennen und die wenigen Nahrungsmittel und Wertgüter wegzuschaffen, die es hier noch gab. Und während sie das Feuer entzündete, rief sie laut und klar: »Für Schur!«
Laut und klar wurde ihr geantwortet:
Für Schur!
Für Schur!
Für Schur!
Für Schur!
Eine ganze Armee antwortete ihr.
»Weiter!«, rief der Baron. »Weiter nach Briva! Briva die Schöne! Briva die Blaue! Briva mit der verräterischen Bürgermeisterin! Für Schur!«
Bigna war die Erste, die seinen Ruf aufgriff. Erst sie, dann die gesamte Armee.
Für Schur!
Für Schur!
Für Schur!
Für Schur!
Worte, die sich verbreiteten. Die nach Norden reisten, durch das graue, fahle Zwielicht.
Worte, die bis nach Briva reisten. Briva die Schöne. Briva die Blaue. Belagertes Briva.
Sie wussten, dass die Eiserne Armee kommen würde. Und sie bereiteten sich vor. Tore und Mauern wurden verstärkt, es wurde so viel Nahrung in die Stadt gebracht, wie sich noch finden ließ. Und überwacht wurde das alles von Bürgermeisterin Reys, deren Bruder Weyd der Wanderer war. Bürgermeisterin Reys, die dabei half, die Tore zu verstärken, während ihr Blick wieder und wieder nach Westen ging.
Sie hörte die Worte ihrer Bürger. Denn die Bewohner ihrer Stadt und die vielen Flüchtlinge aus Brakbant und Allaith, sie tuschelten.
»Schur wird kommen.«
»Ihre Armee ist größer als jede andere, die jemals durch Erebu zog.«
»Sie haben der Königin von Allaith den Kopf abgeschlagen.«
»Mit zehntausend Soldaten rücken sie an! Noch schrecklicher wird es als der letzte große Krieg vor hundert Jahren!«
»Und dann haben sie den Kopf auf einen Spieß gesteckt.«
»Mit zwanzigtausend Soldaten!«
»Wir können ihnen nicht standhalten. Die Mauern werden fallen.«
»Das Tor. Das Tor wird zuerst brechen, wenn sie angreifen.«
»Fünfzigtausend Soldaten!«
So tuschelten sie. Dachten, sie würde es nicht hören.
Aber Bürgermeisterin Reys hörte es. Und sie wusste, dass sie zu den Menschen sprechen musste, um sie aufzumuntern. Neuen Mut musste man ihnen einflößen. Und Hoffnung brauchten sie, vor allem Hoffnung.
Doch die Meldungen ihrer Späher gaben wenig Anlass zur Hoffnung.
Sie blickte in all die vielen, unterschiedlichen Gesichter. »Ihr könnt hoffen«, sagte sie den Menschen. »Denn das Willkommenslicht brennt noch.«
Und ich habe es geschworen, dachte sie. Ich habe Weyd geschworen, dass er immer hierher zurückfinden wird, solange das Willkommenslicht brennt.
Bürgermeisterin Reys nahm einen Schwur nicht auf die leichte Schulter.
Sie wusste, dass die Gefährten den Weg zurückfinden würden, solange das Willkommenslicht brannte.
Sie wusste, dass sie verloren waren, wenn es erlosch.
Ebenso wie die Stadt.
Also blickte sie hoch zum Willkommenslicht, und das Raunen in der Stadt bekam einen neuen Klang.
»Habt Hoffnung.«
»Das Willkommenslicht brennt noch.«
»Wir dürfen hoffen, solange das Willkommenslicht erstrahlt!«
»Habt Hoffnung«, sagte sie ihnen. »Der Wanderer und seine Gefährten werden die Türme des Lichts entzünden. Bald werden die finsteren Nächte ein Ende haben.«
Jemand tippte ihr auf die Schulter, und als Reys sich umdrehte, stand eine Botin vor ihr, fertig angetan für die Reise, mit einem großen, schnellen Pferd neben sich. »Ich werde nun aufbrechen, Frau Bürgermeisterin.«
Reys nickte. »Möge die Hoffnung dich begleiten. Halte stets Ausschau nach dem Willkommenslicht. Kehre sicher zu uns zurück, und schnell. Richte Turis Wort für Wort aus, was ich dir gesagt habe. Fürchte nicht die Dunkelheit, und ergib dich nicht der Furcht.«
Die Botin nickte, dann bestieg sie ihr Pferd. Und so reisten die Worte, reisten über den Grauen Pfad.
Hoffnung.
Solange das Willkommenslicht erstrahlt, können wir hoffen.
Bald werden die finsteren Nächte ein Ende haben.
Und einige Meilen östlich, einen Tagesmarsch von Briva entfernt, auf einer Lichtung zwischen hohen Bäumen, wurde der Wanderer aus dem Schlaf aufgeschreckt, geweckt durch eine Hand auf seiner Schulter.
»Weyd. Wir müssen los.«
Er setzte sich auf, sah sich blinzelnd um. Es wurde bereits hell.
Unwillkürlich tastete er nach der Brosche auf seiner Brust. Der Stern schien in der Dämmerung sanft zu glühen. Jeder, der diese Brosche sah, hätte ihren Träger daran erkannt: Dies war der Wanderer, der so viele Wege und Straßen beschritten hatte, durch Wälder und über Berge gereist war, ja sogar über das Meer. Viele geheime Pfade hatte er erkundet und war dabei nur selten vom Weg abgekommen, egal ob bei Tag, bei Nacht oder im Zwielicht. Manche nannten ihn einen Vagabunden, und der Wanderer wusste, dass die meisten ihn lediglich aus Geschichten, Liedern und Legenden kannten. Weyd war sein Name. Und in dieser Nacht hatte er von einem Reiter geträumt. Von seiner Schwester. Von Hufgetrappel und einem Lied voller Traurigkeit.
»Habe ich etwa so lange geschlafen?«, fragte er mit schlaftrunkener Stimme und sah hoch zu der Frau, die ihn geweckt hatte.
Es war Caer, die Bardin. Caer mit dem goldenen Verband an ihrem Hals. Caer, deren Stimme nun so rau und kratzig klang.
Caer, die er so sehr liebte, auch wenn er es ihr niemals gesagt hatte.
Nun lächelte sie ihn an, und obwohl das Sprechen ihr Schmerzen bereitete, antwortete sie: »Mein lieber Wanderer, zerbrich dir nicht den Kopf. Deine Gefährten haben es mit Mühe geschafft, auch ohne dich ein Frühstück zuzubereiten. Ich gebe zu, es war eine echte Herausforderung, aber wie durch ein Wunder ist es uns gelungen.«
Sie zeigte zu dem fröhlich flackernden Feuer hinüber, das keine zwei Meter von ihm entzündet worden war. Bahr die Seefahrerin beugte sich über die Flammen und raunte ihnen ermutigende Worte in ihrer Sprache zu. Ihre grauen Locken waren mit einem roten Tuch zurückgebunden. Neben ihr stand der weiße Fuchs Bellitas, in dessen Augen die Vorfreude auf das Mahl leuchtete. Hinter ihnen saß der alte Jori auf einem Baumstumpf. Älter als die Sterne sei er, scherzten sie oft, der Mann mit der wundervollen blauen Feder am Hut, der nun leise vor sich hin summte. Der junge Andrin aus Festra in Schur half ihm dabei, sich zu rasieren. Voller Sorgfalt führte er die Klinge, so wie er alles mit großer Sorgfalt tat, die blauen Augen fest auf sein Ziel gerichtet. Und am Rand des Lagers entdeckte Weyd Andrins Schwester, Jelscha aus Festra. Mit grimmiger Miene und in voller Rüstung stand sie da, die Armbrust in der Hand, und hielt Wache.
Über ihnen erklang der Schrei einer Krähe, hinter ihnen wurden Schritte laut. Jelscha hob die Armbrust. Noch während Weyd sich umdrehte, stieß die Krähe Urth vom Himmel herab. Mit funkelnden schwarzen Augen landete sie auf der Schulter des Mannes, der sich dem Lager näherte. Groß war er, und in einen goldenen Mantel gehüllt. Ein Heiler war er, doch kein Mensch, sondern ein Albitz, das hatten sie erfahren, ein Geschöpf aus einer Legende, dessen Leben ewig währte.
»Ealdre!« Weyd sprang auf die Füße. »Wie gut, dass du deinen Mantel trägst, der immer ein wenig Licht abgibt. Sonst hätte Jelscha dich vielleicht für einen Schatten gehalten und auf der Stelle erschossen.«
Jelscha brummte etwas, während Ealdre ans Feuer trat. »Die Schatten erscheinen nur bei Nacht«, antwortete er sanft. »Wohingegen eine erfrischende Körperwäsche in der Morgendämmerung etwas Herrliches ist. Ganz in der Nähe gibt es einen Bach.«
Caer richtete sich ebenfalls auf und reckte übertrieben schnüffelnd die Nase.
Weyd versetzte ihr einen spielerischen Stoß. »Ich gehe ja schon.«
Ealdre reichte ihm das Seifenstück, das sie so gewissenhaft hüteten wie einen Schatz. Weyd dankte ihm mit einem Lächeln.
»Beeil dich!«, rief Bahr zu ihm herüber. »Frühstück ist gleich fertig.«
»Bitte nicht schon wieder Kastanien!«, erwiderte Weyd.
Bahr die Seefahrerin griff in ihre Tasche und warf etwas nach ihm. Eine getrocknete Kastanie kollidierte ziemlich schmerzhaft mit seiner Stirn.
Weyd hob die noch in ihrer Schale steckende Frucht auf und schleuderte sie zurück. Dann verzog er sich eilig in Richtung Bach. Caer lachte. »Er liebt deine Kastanien, das weißt du ganz genau!« Ihr Lachen verlor sich in einem Hustenanfall, der ihren gesamten Körper erfasste. Schnell lief Ealdre zu ihr hinüber. Weyd blieb unter den Bäumen am Rand der Lichtung stehen und blickte zu ihr zurück. Er beobachtete, wie Ealdre leise auf die Bardin einsprach und dabei den Verband überprüfte, den er aus seinem goldenen Mantel herausgeschnitten hatte. Den Verband, der ihr das Leben gerettet hatte und den sie nie wieder abnehmen konnte. Ihr Leben gerettet, nachdem sie das des Wanderers gerettet und dafür selbst tödlich verletzt worden war.
Wie eine Löwin hatte sie einst gebrüllt. Von herzergreifender Schönheit war einst ihr Gesang gewesen. Nun war kaum etwas geblieben von ihrer Stimme. Gerade mal flüstern konnte sie noch.
Weyd wandte sich ab und folgte Ealdres Fußspuren und dem Plätschern des Wassers, bis er zum Bach kam. Dort zog er Hemd und Hose aus, um sich zu waschen, legte sein Schwert Mundian zu seiner Kleidung ans Ufer. Das Wasser war so kalt, dass er sofort eine Gänsehaut bekam. Schaudernd stand er einen Moment reglos im Bach, drückte die Arme an den Körper und ließ das Wasser über seine Beine strömen, spürte die kalten Tropfen im Gesicht, am Hals, auf der Brust. Er schloss die Augen.
Hinter den geschlossenen Lidern tauchte sie wieder auf, jene Erinnerung, die er nicht abschütteln konnte: Caer in seinen Armen, Blut, viel zu viel Blut an ihrem Hals. Ihr entsetzter Blick, die weit aufgerissenen Augen. Und dann … dann schwand das Licht aus ihren Augen. Nie wieder wollte er sie so sehen. Lieber würde er sich als Erster aus dieser Welt verabschieden, als noch einmal ihr Gesicht so sehen zu müssen – bleich, kalt und leblos.
Und was würde er nicht darum geben, ihre Stimme zurückholen zu können. Nicht, um sie singen zu hören.
Um sie lachen zu hören.
Was würde er nicht darum geben, wieder dieses raue, ungehemmte Lachen zu hören, sie wieder mit ihrer Oud im Schoß dasitzen zu sehen, den Kopf zurückgeworfen, die Zöpfe halb gelöst, geschickt gelockert durch ihre flinken Finger.
Oder seine.
Er lächelte.
Plötzlich zuckte er zusammen.
Hinter ihm erklang ein Geräusch.
Hufschlag.
Hastig sprang Weyd ans Ufer und griff nach Mundian. Mit dem Schwert in der Hand fuhr er herum.
Und erblickte seine Stute Raud.
Kopfschüttelnd legte er die Waffe weg. »Du solltest wissen, dass man sich besser nicht so an mich heranschleicht, altes Mädchen.«
Sie schnaubte nur.
»Ich wünsche dir ebenfalls einen guten Morgen.« Weyd sammelte seine Sachen ein und zog sich an. Dann ging er zu der Stute hinüber und streichelte ihren Hals. »Habe ich dich vernachlässigt? Bitte verzeih.«
Sie schüttelte den Kopf, drückte sanft die Nase gegen seinen Arm und leckte kurz seine Hand.
»Oder bist du etwa meinetwegen besorgt?«, fragte Weyd weiter. »Ich mache mir auch Sorgen, weißt du? Dieser Weg, den wir hier beschreiten, Raud … Diesmal führt er uns nicht an magische, unbekannte Orte.«
Wieder leckte sie seine Hand.
Er legte die Stirn an ihren breiten Kopf und streichelte immer weiter, während er leise und beruhigend auf sie einredete: »Ich weiß, wie es in dem Lied heißt. Sie wissen es nicht, aber ich schon. Der Weg zu den Türmen wird Hand in Hand mit dem Tod beschritten.«
Ihr Fell war schwarz wie die Nacht, mit einem leichten Rotstich. Warm und weich spürte er es an seiner Stirn und unter seinen Händen. »Du musst ihn nicht mit mir gehen«, flüsterte er. Langsam lehnte er sich zurück, um der Stute in die Augen zu sehen. »Du hast mich überallhin begleitet, aber diesen Weg musst du nicht mit mir gehen. Dazu will ich dich nicht zwingen. Von den anderen hätte ich ja auch keinen mitgenommen, wenn sie nicht darauf bestanden hätten.«
Er hob den Blick. »Und mit ›darauf bestehen‹ meine ich eigentlich ›auflauern‹. Sie haben uns ganz hinterhältig aufgelauert.«
Raud wieherte leise. Dann leckte sie ihm das Gesicht ab. Weyd lachte. »Und trotzdem bin ich froh, dass du bei mir bist. Dass sie alle bei uns sind.« Er schluckte schwer. Dann nahm er Raud am Zügel und führte sie zurück zum Lager. Auf dem Weg dorthin sprach er leise weiter: »Nur meine Gedanken muss ich unter Kontrolle halten. Meine Fantasien zügeln. Mich in meinen Wünschen mäßigen.«
Die Stute rammte ihm von hinten den Kopf in den Rücken.
Er drehte sich zu ihr um. »Nein.«
Wieder schubste sie ihn. Dann wandte sie den Kopf und legte ihn vorsichtig auf Caers Oud, die an ihrem Sattel befestigt war.
»Nein!« Weyd blieb stehen. »Nein.«
Raud sah ihn an.
Er starrte zurück.
»Nein! Mag sein, dass ich nicht allein sein will, aber wenn ich den Weg, der vor mir liegt, Hand in Hand mit dem Tod beschreiten muss, werde ich jetzt ganz sicher nicht vor Caer auf die Knie sinken und ihr meine Liebe gestehen. Auf gar keinen Fall.«
Die Stute starrte ihn noch einen Moment an, dann schnaubte sie und schob sich an ihm vorbei.
Weyd rief ihr eines seiner Lieblingsschimpfwörter hinterher: »Blędĭ!«
Ein paar Schritte hinter seiner Stute zurückbleibend, ging er widerstrebend ins Lager zurück. Dort gab er die Seife an Caer weiter, die sich damit auf den Weg zum Bach machte.
»Ich bin die Letzte«, sagte sie noch. »Lasst mir gefälligst was vom Frühstück übrig, ihr verfressenen Schweine!«
Damit ging sie, und Urth begleitete sie.
Caer achtete sorgfältig darauf, beschwingt auszuschreiten, bis sie außer Sichtweite war.
Erst dann erlaubte sie sich, die Schultern hängen zu lassen.
Urth krächzte leise und ließ die Flügelspitze über Caers Wange gleiten.
Die lächelte kurz. »Ist schon gut, du Schatz«, flüsterte sie. »Wer weiß, vielleicht kehrt meine Stimme ja noch zurück.«
Wieder stieß Urth ein Krächzen aus.
»Damit magst du recht haben«, gab Caer zu. »Vermutlich mache ich wirklich nur gute Miene zum bösen Spiel. Aber das mache ich doch wirklich hervorragend!«
Sie breitete in einer großen Geste die Arme aus. Urth spreizte die Flügel und flog zu einem großen Felsen, der direkt am Flussufer aufragte. Dort angekommen, neigte sie voller Skepsis den Kopf.
Caer seufzte schwer, dann zog sie sich aus – erst den Fingerschutz, dann das burgunderrote Cape, schließlich ihr Gambeson. Leise und sanft rief sie dabei nach den Klängen.
Bat sie, sich zu verstärken.
Und wie schon am Abend zuvor
erhielt sie keine Antwort.
Schmerzhaft zog sich ihr Magen zusammen.
Caer glaubte zu wissen, woran es lag. Wenn sie sprach, geschah das nun ohne Stimme. Sie konnte nur flüstern, was kaum mehr war als atmen. Die Klänge hörten sie einfach nicht mehr.
Urth krächzte. Sie nahm mit dem Schnabel den Fingerschutz entgegen und legte ihn vorsichtig auf dem Felsen ab. Dann warf die Krähe der Bardin einen prüfenden Blick zu.
Caer zog ihre Hose aus. »Ich werde trotzdem ein Lied darüber schreiben«, sagte sie trotzig.
Urth flatterte kurz mit den Flügeln.
»Darüber, wie wir die Türme wieder zum Leuchten gebracht haben«, fuhr Caer fort, »und es wird eine Geschichte voller Tapferkeit werden, eine wahre Geschichte, eine große Geschichte!«
Damit stieg sie in den Bach. Sie beugte sich vor und wusch ihr Gesicht.
Denn nicht einmal die Krähe sollte ihre Tränen sehen.
»Weißt du«, wandte sie sich dann wieder an Urth, »ich habe immer geglaubt, ich wüsste, wer ich bin. Zuallererst eine Bardin, eine Geschichtenerzählerin, alles andere kam danach – Liebe, Geld, Wahrheit.«
Urth reichte ihr die Seife. Caer bedankte sich und wusch ihre Achseln. Sie sah zu der Krähe hinüber. »Und mit dem Bogen bin ich ja nach wie vor nicht schlecht.«
Urth versuchte zu nicken. So ganz beherrschte sie diese Geste noch nicht, aber Bellitas gab sich alle Mühe, sie ihr beizubringen.
»Trotzdem ist es beinahe komisch«, fuhr Caer fort. »Weißt du eigentlich, wie es kam, dass ich anfing, mit Weyd herumzureisen?«
Diesmal probierte Urth es mit einem Kopfschütteln. Auch da brauchte sie noch ein wenig Übung.
»Der Wanderer war auf der Suche nach jemandem, der ein ganz spezielles Lied für ihn schreiben sollte, und ich habe ihm erklärt, dass ich nur dann ein Lied über eine Wandersfrau schreiben könne, wenn ich ihn begleite und selbst sehe, wie er lebt und wie die Wanderer und Wandersfrauen das tun, was sie eben so tun.« Der Gedanke daran zauberte ein Lächeln auf ihr Gesicht. Wie viele Jahre doch seitdem vergangen waren. »Dieses spezielle Lied ist bis heute nicht fertig geworden.«
Und dann kam der Schmerz.
Einfach so kam er.
Einfach so stiegen ihr Tränen in die Augen. »Und nun wird es niemals fertig werden.«
Und dann setzte sie sich auf einen Stein, und sie weinte. Sie weinte, und es war ihr vollkommen gleichgültig, wer ihre Tränen sah.
Urth flog zu ihr hinüber und schlang einen Flügel um ihre Schultern. Warm glitten ihre Federn über Caers nackte Haut. Immer heißer brannten die Tränen, immer stärker flossen sie.
So blieben sie eine Weile sitzen, die Bardin und die Krähe, und Caer verbarg ihr Gesicht in dem schwarzen Flügel.
Bis sie plötzlich Stimmen hörten.
Es war Weyd. Er rief nach ihr.
Schnell wischte Caer sich das Gesicht ab. »Urth?« Wie froh sie in diesem Moment doch war, dass die Krähe die Sprache der Menschen verstand. »Wärst du so lieb, sie noch ein Weilchen von hier fernzuhalten?«
Urth versuchte sich noch einmal recht erfolglos an einem Nicken, dann hob sie ab und flog Richtung Lager.
Caer blieb auf dem Stein sitzen und ließ das Wasser über ihre Füße strömen. Während sie auf das fröhlich plätschernde Nass hinabblickte, wurde ihr plötzlich bewusst, wie schwer sich ihre Beine anfühlten. Und ihre Augen waren müde, schienen jede Farbe verloren zu haben. Sie wollte nicht aufstehen. Wollte nicht zu den anderen zurückgehen. Wollte nirgendwohin.
»So ein Quatsch«, flüsterte sie und schüttelte entschlossen den Kopf. Dann stemmte sie sich hoch. »Jetzt wasch dich gefälligst und hör auf zu heulen.«
Also griff sie wieder zur Seife und säuberte sich hastig. Und während sie dort im Bach stand, musste sie unwillkürlich daran denken, was sie Weyd alles nicht gesagt hatte.
Was sie ihm nicht gestanden hatte.
Dass die Klänge ihr nicht mehr antworteten.
Dass sie nun nicht mehr zusammen auch in der finsteren Nacht kämpfen konnten. Denn sie war die Einzige in ihrer Gruppe gewesen, die die Sprache der Klänge beherrschte, und sie war der Grund dafür gewesen, warum in allen Ländern bekannt war, dass der Wanderer auch in absoluter Finsternis so mühelos kämpfte, als wäre heller Tag.
Caer schluckte, dann wusch sie sich zwischen den Beinen, ohne dabei das geringste Zucken zu spüren. Seit sie ihre Stimme verloren hatte, war ihr dieses Vergnügen verwehrt geblieben, egal ob sie selbst Hand anlegte oder jemand anders.
Und sie hatte es versucht. In Briva hatte sie sich während einer einsamen Nacht davongestohlen und war in den Ijsvôgel gegangen, jene Taverne der Poeten, wo kein Barde – nicht einmal einer ohne Stimme – Schwierigkeiten hatte, Gesellschaft zu finden.
Dort hatte es mehrere Frauen und Männer gegeben, die ihr nur zu gerne behilflich waren.
Und doch …
Obwohl sie mit ihnen hinaufgegangen war, diesem Mann und dieser Frau, die so wunderschön und überwältigend kühn war, hatte Caer keine Erleichterung bei ihnen gefunden.
Sie stieg aus dem Bach, trocknete sich so gut es ging ab und zog sich an. Anschließend kehrte sie ins Lager zurück. Dort gab sie Ealdre die Seife, der sie stets sorgsam in seiner Tasche aufbewahrte, zwischen seinen Kräutern und Salben und ihrer aller Lieblingszaubertrank, dem Whiskey. Die anderen saßen bereits am Feuer und ließen sich ihr Frühstück aus Brot, gerösteten Kastanien und kalten Kartoffeln schmecken, außerdem hatten sie noch Karotten aus Briva und Beeren, die Weyd und Caer auf dem Weg zur Lichtung gepflückt hatten. Die Karotten fanden vor allem bei Raud, Demar und Blíkna großen Anklang, der Schwarzen, der Weißen und dem Grauen, ihren Pferden.
Es war ein gutes Mahl, und als sie sich zum Aufbruch rüsteten, fühlten sie sich stark genug, um den Marsch zu den Türmen noch vor Sonnenuntergang zu bewältigen – zumindest behauptete das Jori, nachdem er sich ausgiebig gestreckt und mit Andrins Hilfe auf Blíknas gestiegen war. Bellitas sprang auf Raud und rollte sich zu einem Schläfchen zusammen.
»Wohl eher nicht, Jori«, meinte Weyd und warf einen Blick auf die wundersame Karte, die sie in Briva von seiner Schwester Reys bekommen hatten – die Karte der Wanderer. »Vom Lewkraitaz sind es fünfzig Tage bis nach Hewsos im Norden, und erst jenseits davon liegt irgendwo der verschollene Graue Turm. Nach Balarm im Süden, wo der Weiße steht, sind es vom Lewkraitaz aus ungefähr vierzig Tage, und das auch nur, wenn man ein Schiff findet, das einen durch den Feuersund bringt. Selbst zum Schwarzen im Osten braucht man sechsundzwanzig Tage, auf dem kürzesten Weg des Wanderers; zehn für die Strecke, die die Krähe fliegt.« Urth krächzte. Weyd sah erst sie an, dann Jori und Bellitas. »War das eine Bestätigung?«
»Jawohl, mein Junge«, antwortete Jori, während Bellitas schläfrig den Kopf hob und nickte. »Und ich habe das nicht wirklich ernst gemeint. Eigentlich wollte ich damit lediglich zum Ausdruck bringen, dass meine alten Knochen heute Morgen nicht ganz so laut knacken wie sonst.«
»Wie weit ist es bis zum Lewkraitaz?«, fragte Andrin, der nach Blíknas Zügeln griff und fragend zu Ealdre hinüberblickte. Der Heiler nickte zustimmend.
»Du darfst ihn führen, wenn er es dir gestattet.«
Blíkna wieherte.
»Er gestattet es«, übersetzte Jori.
Andrin dankte ihm in der Sprache der Pferde, deren erste Worte Jori ihm beigebracht hatte.
»Wie weit?«, wiederholte Jelscha ungeduldig die Frage ihres Bruders. »Wie lange dauert es, bis wir die Kreuzung des Lichts erreichen?«
»Drei Tagesmärsche durch den Wavart und das Tal des Lichts bis zum Kloster von Bonnifatia, und von dort aus noch einmal ein halber Tagesmarsch zum Lewkraitaz in den Sieben Buckeln«, erklärte Weyd. »Es ist eher eine Art Hochland, kein richtiges Gebirge, aber die Wegscheide befindet sich in ihrem Zentrum.«
»Der Wavart?«, hakte Ealdre nach.
Weyd nickte. »Das ist die schnellste Route.«
Der Heiler zögerte. »Ein finsterer Ort«, sagte er dann leise.
»In diesem Wald wurden schreckliche Taten begangen«, gab Weyd zu, »aber das ist viele Jahre her.«
»Die Bäume haben es nicht vergessen. Die Erde hat es nicht vergessen«, erwiderte Ealdre. »Sie erinnern sich an das Blut, an die Knochen. Sie erinnern sich an die Schreie und den Gestank.«
Weyd packte die Karte ein und hob sich seinen Sack auf die Schultern. »Ich bin oft durch diesen Wald gereist, und mir ist dort nie ein Leid geschehen. Das ist der kürzeste Weg nach Bonnifatia, wo ich jemanden anzutreffen hoffe, der uns vielleicht Genaueres darüber sagen kann, wo sich der Graue Turm befindet. Denn niemand ist je weiter gereist als sie.«
»Eine ehemalige Geliebte von dir?«, erkundigte sich Jori.
Caer begann zu husten, als sie ihre Oud nahm und sich den Brustgurt überstreifte. Rau klang das, so rau.
»Nein, alter Freund«, antwortete Weyd, »Sameea ist nichts dergleichen, und die Vorstellung würde ihr auch sicher nicht gefallen. Wenn alles gut geht, wirst du sie in ein paar Tagen persönlich kennenlernen. Lasst uns aufbrechen und das Tageslicht nutzen.«
So ruhig klang er, so sicher.
Und doch hatten Ealdres Worte auch den Wanderer beunruhigt.
Alt und dunkel war der Wavart. Weyd war in diesem Wald noch nie vom Weg abgekommen, er kannte ihn gut.
Aber die Wege hatten sich verändert, die Nächte waren finster, und die Schatten kannten keine Gnade.
Sie nahmen ihr Gepäck und verließen die Lichtung. Der Wanderer führte sie durch das Unterholz zügig zurück zum Grauen Pfad, der sich im fahlen, bleichen Zwielicht silbrig vor ihnen in die Ferne wand. Caer spielte leise auf ihrer Oud, und Weyd warf immer wieder kurze Blicke zu ihr hinüber, musterte den Verband an ihrem Hals, während er ihr lauschte.
»Wie geht es deiner Stimme heute Morgen?«, fragte er schließlich.
»Unverändert«, flüsterte sie. »Die reinste Ironie, nicht? Da haben wir so viele Mühen auf uns genommen, um aus dem Tal von Schur herauszukommen, damit ich endlich meine Stimme erheben und auch nachts singen kann, wann immer mir der Sinn danach steht, und jetzt bringt meine Kehle nicht mehr hervor als ein Hauchen.«
»Gäbe es irgendeine Möglichkeit, sie dir wiederzugeben …«, setzte Weyd an.
Caer zupfte weiter die Saiten. »Ich weiß.« Sie schenkte ihm ein Lächeln.
Er kannte sie so gut.
Er wusste sogar, wie lange sie brauchte, um sich zu waschen.
Und als sie an diesem Morgen zum Bach gegangen war, war sie um einiges länger weggeblieben.
Weyd vermutete, dass sie dort geweint hatte, weil sie nicht wollte, dass er es sah.
»Ich werde dir niemals genügend danken können«, fuhr er fort. »Du hast es getan, um mich zu retten.«
»Du hättest dasselbe für mich getan.«
»Aber ich brauche meine Stimme wesentlich weniger als du deine.«
»Mir bleibt ja meine Oud.« Caer unterbrach ihr Spiel, um das Instrument hochzuhalten, fast so, als müsste sie es sich selbst ebenso beweisen wie ihm. »Aber für Sameea tut es mir leid. Wir haben ihr gesagt, ihr Lied würde fertig sein, wenn wir uns das nächste Mal sehen.«
Weyd schüttelte den Kopf. »Mir tut es für dich leid.«
Ganz kurz berührte sie seine Hand. »Warum? Willst du etwa behaupten, ich wäre jetzt weniger umwerfend als vorher?«
Ihre Augen funkelten, ein freches Grinsen umspielte ihre Lippen. Weyd hätte sich gewünscht, sie wäre ernst geblieben, denn er wusste, dass der Schmerz in ihrem Inneren erdrückend sein musste. Mehr als manch anderer hätte ertragen können.
Aber sie wollte nicht darüber sprechen.
Oder zumindest nicht mit ihm.
»Stets die Umwerfendste von allen«, versicherte er ihr und ging auf ihren scherzhaften Ton ein.
Caer lachte, es klang furchtbar kratzig. Voller Dramatik schleuderte sie ihren Zopf nach hinten. »Siehst du? Dann gibt es nichts, was auch nur eine Träne wert wäre!«
Weyd starrte auf ihren Zopf, stellte sich vor, wie er die Finger in ihr Haar schob, die so streng geflochtenen Stränge löste, es offen über ihre Schultern fallen ließ.
Raud rammte ihm den Kopf in den Rücken.
Er fuhr herum und warf ihr einen bösen Blick zu.
Oben auf dem Rücken der Stute hob Bellitas den Kopf und stieß einen kurzen Laut aus.
»Belle möchte gerne wissen, warum du ihn so böse anstarrst, mein Junge«, rief Jori von hinten.
Caer drehte sich zu Weyd um. »Stimmt etwas nicht?«
Der Wanderer spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. »Ich bin nur vorsichtig«, behauptete er schnell. »Man weiß ja nie, wer uns vielleicht folgt.«
Raud schnaubte.
Der alte Jori zog die Augenbrauen hoch, grinste, sagte aber nichts.
Und sie wussten nicht, dass ihnen tatsächlich jemand folgte.
Eine Nacht und ein Tag lagen zwischen ihnen und Briva der Blauen.
Nicht einmal mehr das Willkommenslicht sahen sie hinter sich, aber sie wussten, dass es noch immer brannte.
Und sie wussten, dass sie stets den Weg nach Hause finden würden, solange es weiterbrannte.
Denn Weyd wusste, dass seine Schwester einen Schwur nicht auf die leichte Schulter nahm. Ja, er hatte gespürt, dass es genau so war: Solange das Licht brannte, würden sie zurückkehren.
Sollte das Licht erlöschen, würden sie vom Weg abkommen.
Und auch Reys hatte es gespürt. Während sie die Tore der Stadt verstärkte, deren Bürgermeisterin sie war, wusste sie, dass sie das Licht nicht ausgehen lassen durfte.
Sie reichte eine Holzplanke weiter. Gemeinsam mit Piroska, dem jüngsten Ratsmitglied von Briva, reichte sie das Holz weiter durch bis zum Tor.
Die junge Piroska quoll normalerweise über vor Energie, hatte stets einen scharfen, aber fröhlichen Blick, war für ein spontanes Tänzchen ebenso zu haben wie für eine feurige Ansprache in der Burgekamer. An diesem Morgen hatte sie das lange, dunkle Haar nachlässig geflochten, trug aber wie immer ihre Halskette mit dem Anhänger unter der Bluse, außerdem Hosen und feste Stiefel. Sie war für ihr leidenschaftliches Temperament bekannt. Selbst Daìpu, der Vorsitzende der Burgekamer, hatte ihr schon sein Lob aussprechen müssen für die unermüdliche Energie, die sie für die Regierung dieser Stadt und die Schaffung ihrer Gesetze aufbrachte.
An diesem Morgen schien sie allerdings abgelenkt zu sein.
Sie alle waren abgelenkt.