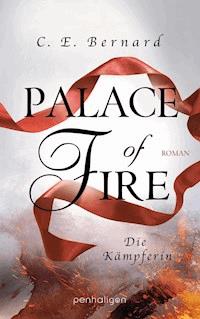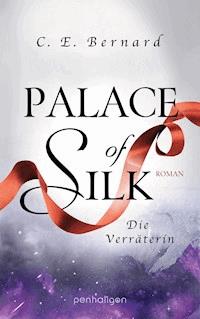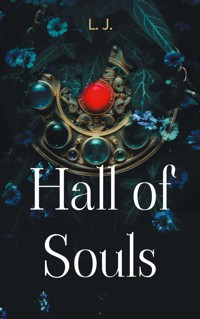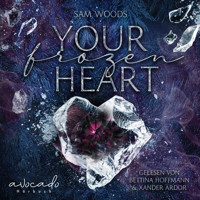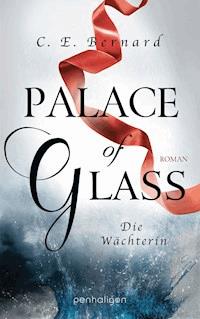
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Palace-Saga
- Sprache: Deutsch
Sie muss das Leben des englischen Kronprinzen retten - doch sie ist sein größter Feind ...
Stellen Sie sich vor…
London wäre ein Ort, an dem Tugend und Angst regieren. Ein hartes Gesetz untersagt den Menschen, die Haut eines anderen zu berühren. Denn die Bevölkerung und insbesondere das Königshaus fürchten die Gefahr, die von den sogenannten Magdalenen ausgeht – Menschen, deren Gabe es ist, die Gedanken anderer durch Berührung zu manipulieren. Die junge Rea zeigt so wenig Haut wie möglich. Einzig während illegaler Faustkämpfe streift sie ihre Handschuhe ab. Doch wie kommt es, dass die zierliche Kämpferin ihre körperlich überlegenen Gegner stets besiegt? Und warum entführt sie der britische Geheimdienst? Bald erfährt Rea, dass sie das Leben des Kronprinzen beschützen muss. Doch am Hof ahnt niemand, dass sie selbst sein größter Feind ist.
Alle Bücher der »Palace-Saga«:
Palace of Glass. Die Wächterin
Palace of Silk. Die Verräterin
Palace of Fire. Die Kämpferin
Palace of Blood. Die Königin
- Eine Kämpferin, die eine verbotene Gabe besitzt. Ein Prinz, dessen Leben auf dem Spiel steht. Ein gläserner Palast, in dem eine tödliche Intrige gesponnen wird.
- Diese hinreißende Tetralogie werden die Fans von Sarah J. Maas, Kiera Cass und Erin Watt lieben.
- Alle Bände im Zwei-Monats-Takt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Stellen Sie sich vor, London wäre ein Ort, an dem Tugend und Angst regieren. Während das Königshaus sich im verglasten Buckingham Palace verbarrikadiert, bringt die Bevölkerung ein gewaltiges Opfer: Die Berührung von Haut ist verboten – wer sich nicht an das Gesetz hält, muss die Einweisung in eine Anstalt fürchten. Die junge Rea zeigt so wenig Haut wie möglich. Einzig während illegaler Faustkämpfe streift sie ihre Handschuhe ab. Doch wie kommt es, dass die zierliche Kämpferin ihre körperlich überlegenen Gegner stets besiegt? Und warum entführt sie der britische Geheimdienst? Bald erfährt Rea, dass sie das Leben des Kronprinzen beschützen muss. Doch am Hof ahnt niemand, dass sie selbst sein größter Feind ist.
Autorin
C.E. Bernard ist das Pseudonym von Christine Lehnen, die 1990 im Ruhrgebiet geboren wurde und seitdem in Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien und Paris gelebt hat. Ihre Kurzgeschichten wurden mit den Literaturpreisen der Jungen Akademien Europas und der Ruhrfestspiele Recklinghausen ausgezeichnet; seit 2014 lehrt sie Literarisches Schreiben an der Universität Bonn. Daneben studiert Christine Lehnen Englische Literatur und Politikwissenschaft, forscht zum Thema Kreatives Schreiben und inszeniert Theaterstücke mit der Bonn University Shakespeare Company.
Weitere Informationen unter: http://de.cebernard.eu
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/penhaligonverlag.
C. E. Bernard
PALACE
ofGLASS
Die Wächterin
Deutsch von
Charlotte Lungstrass-Kapfer
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2018 by Christine Lehnen
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe
© 2018 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung: © Isabelle Hirtz, Inkcraft
BL · Herstellung: sam
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-21596-5V002
www.penhaligon-verlag.de
Für alle, die an ihre Träume glauben.
Teil I
Kampf oder Flucht
Tiger, Tiger, gleißend hell,
in dem nächtlich’ Wald so schnell.
Welch Meerestiefe, Himmelszelt,
deiner Augen Glut erhellt?
WILLIAM BLAKE
Kapitel 1
Keinerlei Berührung. So lautet das oberste Gebot, das uns von Kindesbeinen an eingebläut wird, die einzige Regel, die wirklich von Bedeutung ist. Trage stets deine Handschuhe.
Ich werde diese Regel jetzt brechen.
Obwohl ich es nicht möchte. Noch während sich der erste Schlag meinem Gesicht nähert, wünschte ich, ich könnte eine andere sein, irgendjemand, ganz egal, wer. Jemand, der sich nicht so quält, nicht so kaputt ist.
Der Lärmpegel ringsum steigt an, das Gejohle und die Pfiffe werden lauter und lauter. Das Untergeschoss des Lovely Molly ist voller Menschen. Die Männer tragen Wollmäntel und Filzhüte, die Frauen Hosenträger und typisch englische Melonen auf den Köpfen. Genau wie ich haben sie sich die Brust abgebunden, denn eigentlich dürften wir gar nicht hier sein. Natürlich erkennt uns trotzdem jeder, aber solange der Schein gewahrt bleibt, drückt man gern mal ein Auge zu.
Die Menge stinkt nach Bier und harter Arbeit, aber das ist noch harmlos gegen den Geruch, den ich bald verströmen werde. Schließlich kämpfen die nicht gegen Mister Zwei-Meter-Zehn – so lautet der Kampfname meines heutigen Gegners, ein Mann mit flauschig weichem Bart und Armen, die mir ohne die geringste Anstrengung das Genick brechen könnten. Der blonde Hüne ist ungefähr in meinem Alter, also noch keine zwanzig, und wäre ich ihm auf der Straße begegnet, hätte ich ihn vermutlich ganz attraktiv gefunden. Aber ich bin nicht hier, um ihm einen Antrag zu machen. Ich bin hier, um zu kämpfen.
Zwei-Meter-Zehn versucht erneut, mich zu erwischen. Schnell ducke ich mich weg und weiche nach hinten aus. Lautstarkes Buhen zeugt vom Unmut der Menge, aber insgeheim sind die Zuschauer erfreut. Niemand hat sein Geld auf mich gesetzt, auf das blasse, schmale Ding, das nichts vorzuweisen hat außer seinem Mut. Wieder schlägt Zwei-Meter-Zehn zu. Diesmal beuge ich mich seitlich weg. Zwei-Meter-Zehn setzt mir nach. Ich weiche so hastig zurück, dass ich aus dem Tritt gerate und mit dem Rücken gegen den Ring stoße, der hier aus einem hölzernen Geländer besteht. Spitze Splitter bohren sich in meine Haut. Dann werde ich von hinten gepackt, mehr und mehr Hände umklammern meine Schultern. Sofort fallen die Erinnerungen über mich her: vergilbte Fliesen, Lederhandschuhe, der scharfe Knall einer Peitsche. Die Menge schubst mich so heftig zurück in den Ring, dass ich fast das Gleichgewicht verliere. Zwei-Meter-Zehn lacht kurz auf, dann, als ich an ihm vorbeitaumele, verpasst er mir einen Klaps auf den Hintern.
Die Menge jubelt. Gedemütigt bleibe ich stehen. Ich hätte nicht herkommen sollen. Trotzdem fahre ich herum, um mich meinem Gegner zu stellen. Der nähert sich langsam, leckt sich mit der Zunge über die Lippen. Seine Hände sind nackt, genau wie meine. Ich spüre, wie sich mir die Kehle zuschnürt. Er kommt immer näher. Ich müsste nur die Hand ausstrecken.
Doch ich zögere. Ich darf dem dunklen Verlangen nicht nachgeben.
Es ist jetzt sechsundzwanzig Jahre her, dass die Berührung nackter Haut in Großbritannien für gesetzeswidrig erklärt wurde. Denn vor sechsundzwanzig Jahren hat man Menschen wie mich entdeckt, woraufhin unser König den NPA, den National Protection Act, ratifiziert hat: Körperliche Berührungen sind nur noch verheirateten Paaren gestattet, und auch das nur zum Zwecke der Fortpflanzung. Aber selbst diese Angelegenheit wird mit so wenig Körperkontakt wie möglich erledigt. Alles wegen der Menschen, die so sind wie ich.
Zwei-Meter-Zehn stößt ein leises Knurren aus. Dann rennt er los, streckt die Arme aus, will mich am Hals packen. Der Anblick seiner nackten Finger ist faszinierend – etwas zu faszinierend. Er erwischt mich an der Schulter, schleudert mich einmal quer durch den Ring. Der Aufprall schürft mir die Haut auf, lähmender Schmerz schießt durch meinen Rücken. Wieder grölt die Menge begeistert. Und schon ist Zwei-Meter-Zehn über mir, tritt mich in den Bauch. Ich muss würgen. Der nächste Tritt drückt mir die Luft aus der Lunge. Der Mann trägt Stiefel mit schweren, scharfkantigen Sohlen. Hustend versuche ich, seinen Tritten auszuweichen. Wegzukriechen. Aber er ist schneller als ich.
Eine große Hand packt meine Haare, bis die schwarzen Strähnen zwischen den Fingern hervorquellen. Als er mich hochzieht, schreie ich laut auf, schreie immer weiter, während er mich durch den Ring schleift. Lachend feuern die Zuschauer ihn an. Für sie ist es das perfekte Spektakel, und Zwei-Meter-Zehn ist sich dessen bewusst. Als er mich auf die Füße stellt und anfängt, meinen Brustkorb mit Fäusten zu bearbeiten, wird mir kurz schwarz vor Augen. Da weiß ich, dass ich nicht länger warten darf.
Für das Publikum muss es so aussehen, als wäre ich einmal mehr gestolpert. Ich ducke mich kurz, sodass der nächste Schlag nicht auf meiner Brust, sondern am Unterkiefer landet.
Sobald seine nackte Haut auf meine trifft, spüre ich die Explosion in meinem Bewusstsein. Sein Geist breitet sich wie auf einer mächtigen Welle in mir aus, ich fühle seine erstaunliche Kraft, atme ihn, nehme ihn in mich auf wie das reine Leben. Und ich kann ihn sehen: sein gesamtes Bewusstsein, sämtliche Gedanken, die ihm durch den Kopf schießen. Er ist voll auf den Kampf konzentriert, plant den nächsten Angriff. Will mit der linken Hand meinen schmalen Hals packen und zudrücken, bis ich keine Luft mehr bekomme, ihn anflehe, bis mein Gesicht so blau wird wie meine Augen …
Aber beim Kämpfen geht es nicht um Kraft. Es geht darum, dem Gegner immer einen Schritt voraus zu sein.
Zwei-Meter-Zehn hat rechts seine Deckung vernachlässigt, was ich mir nun zunutze mache. Ich ramme ihm die Faust gegen den Kiefer. Das Publikum quittiert meinen Angriff mit Pfiffen. Der Hüne taumelt kurz, geht aber sofort wieder auf mich los. Ich lasse ihn ein Stück weit herankommen, dann springe ich vor und ziele auf seinen Solarplexus. Auch jetzt muss es so aussehen, als hätte ich ihn verfehlt, deshalb erwische ich nur sein Schlüsselbein, aber sobald ich ihn berühre, erkenne ich, dass er mein Bein anvisiert.
Mit einem Schritt weiche ich seitlich aus und trete ihm mit voller Kraft gegen die Kniescheibe, was ihn von den Füßen holt. Das laute Knacken begeistert die Menge.
Dafür bin ich hergekommen, habe mich als Mann verkleidet, riskiere mein Leben, breche einem anderen Menschen die Knochen: um ein fremdes Bewusstsein zu spüren. Ich umklammere den Hals meines Gegners, setze mich auf seinen Rücken und drücke sein Gesicht in den Staub. Zwei-Meter-Zehn wehrt sich heftig, schlägt um sich. Jetzt berühren wir uns richtig. Es ist berauschend. Wie ein sanftes Streicheln rinnt der Schweiß über meine Haut. Unerbittlich halte ich den Hünen fest, spüre, wie er schwitzt, rieche ihn, fühle jede seiner Blessuren und höre seine Gedanken: Wie kann das sein, dass ich gegen diese mickrige Makrele verliere? Ich brauche das Geld unbedingt. Er stellt sich vor, wie wir wohl gerade aussehen, die kleine, schmale Gestalt auf seinem Rücken, die schlanken Beine, die seine Hüften umklammern, die bloßen Hände an seinem nackten Hals. Mich überfällt so heftige Scham, dass ich fast losgelassen hätte. Stattdessen verdränge ich das Gefühl mit aller Macht, was mich fast mehr Kraft kostet als der Klammergriff um Zwei-Meter-Zehns Hals.
Sobald ich zum Sieger erklärt werde, lasse ich ihn los. Einen Moment lang herrscht drückendes Schweigen, dann bricht jemand in Jubelrufe aus und skandiert meinen Kampfnamen: Roter Kardinal. Niemand hier kennt mich als Rea Emris, und das muss auch so bleiben.
So schnell ich kann, klettere ich von Zwei-Meter-Zehn herunter. Das Triumphgefühl verfliegt sofort. Am liebsten wäre ich ganz woanders, aber ich muss warten, bis Zwei-Meter-Zehn aufgestanden ist, damit wir uns die Hände reichen können. Betreten starre ich auf meine Füße, blicke überall hin, nur nicht an die Wände dieses düsteren, feuchten Lagerhauses am Fluss oder gar in die aufgeheizte Menge, die sich fast schon geifernd einen Kick verschafft, indem sie uns dabei beobachtet, wie wir gegen das Gesetz verstoßen. Und ganz sicher nicht auf Mister Zwei-Meter-Zehn, dessen Geist mir selbst aus dieser Entfernung noch verstohlen zuzuflüstern scheint.
Das Getöse der Menge brandet erneut auf, als Zwei-Meter-Zehn sich erhebt und ich ihm die Hand hinstrecke. Sobald unsere Finger sich berühren, hämmern noch einmal seine Gedanken auf mich ein: Ich habe verloren. Wie konnte ich nur verlieren? Sieh sie dir doch an. Wiegt keine fünfzig Kilo, die Kleine. Er kneift die Augen zusammen, und ich sehe den Schmerz, der sich in seine Gedanken schleicht. Sein Stolz ist am Boden. Von einem Mädchen geschlagen. Schon jetzt weiß ich, was er als Nächstes denken wird. Denn jemand wie er kann nur auf diese eine Idee kommen. Und was, wenn … was, wenn sie eine Magdalena ist? Nur so kann sie mich überhaupt besiegt haben. Sie muss eine Magdalena sein.
Panik steigt in mir auf, und während ich verstohlen nach Luft ringe, verstärkt sich mein Griff um seine Finger. Er will seinen Arm zurückziehen, aber ich klammere mich weiter an seine Hand, strecke meine geistigen Fühler aus und dringe in seine Gedanken ein. Hektisch radiere ich das eine Wort aus, verwische es, bis Magdalena nicht mehr zu erkennen ist. Doch das reicht nicht. Ich muss ihm einen neuen Gedanken eingeben, ihn in eine andere Richtung lenken.
Also schiebe ich ihm den einen Begriff unter, der nah genug dran ist.
Schlampe.
Ich kann sehen, wie seine Gedanken sich umformen. Wie konnte ich gegen die verlieren? Sie ist eine Frau, das sieht doch jeder. Ich wette, sie ist eine richtige Schlampe. Seht sie euch doch an. Nur Schlampen zeigen ihre nackten Hände.
Ruckartig entzieht er mir seine Hand, und die Verbindung zu seinen Gedanken reißt ab. Als er mir anschließend vor die Füße spuckt, bin ich nur froh, dass er nicht auf mein Gesicht gezielt hat.
Wie immer ziehe ich mich schnellstmöglich aus dem Ring zurück, weiche den Schulterklopfern aus, will keine Anerkennung. Nicht für das, was ich gerade getan habe. Es war ein Risiko, das ist mir bewusst. Nachdem ich meine Verkleidung in den Rucksack gestopft habe, ziehe ich mich an. Dabei achte ich vor allem darauf, meine Gladiés korrekt anzulegen, die festen Handschuhe, die bis zu den Ellbogen reichen. Anschließend folgt der hohe gestärkte Kragen, der meine Wangen bis zu den Augen hinauf schützt. Marienkragen wird er genannt. Zu guter Letzt schlinge ich mir den Kummerbund, einen breiten Ledergürtel, um die Taille und schiebe hinten am Rücken die Hände hinein. Dieses Kleidungsstück soll dafür sorgen, dass unsere Hände immer schön dort bleiben, wo sie hingehören, und ist damit der wichtigste Teil eines jeden Outfits.
Kummerbund und Gladiés,
trage sie, wohin du gehst,
ob bei Arbeit oder Spiel,
unser Schutz sei stets dein Ziel.
Schließlich verlasse ich das Gebäude über eine Treppe, die zu einer Falltür im Hinterhof hinaufführt. Vollkommen respektabel gekleidet, trete ich auf die Straße hinaus. Ich zittere am ganzen Körper. Deshalb lehne ich mich für einen Moment gegen den Rahmen der Tür, stehe reglos da, mit dem Rucksack über der Schulter. Versuche, mich nicht an den Empfindungen zu berauschen, die noch in mir nachschwingen. An dem Gefühl, in Zwei-Meter-Zehns Bewusstsein zu dringen. Als würde jemand ganz sanft über meine Nerven streicheln, meinen Verstand in eine feste, friedliche Umarmung hüllen, zärtlich und doch voller Halt. Für mich ist dies das überwältigendste und gleichzeitig natürlichste Gefühl der Welt. Nur so kann ich ganz ich selbst sein.
Ja, wegen Menschen wie mir wurde damals der National Protection Act verabschiedet. Wenn ich die nackte Haut eines anderen berühre, kann ich ihm nicht nur in den Kopf schauen und seine Gedanken lesen, ich kann sie sogar verändern.
Ich bin eine Magdalena.
Etwas Weiches streicht um meine Beine, verräterisch sanft. Es ist die Kreatur, die wie immer aus dem Nichts aufzutauchen scheint. Grau ist sie, pelzig, ein bisschen so wie ein Hund, aber größer. Das ist nicht real, hat mein Vater gesagt. Sie existiert nur in deinem Kopf. Meine Mutter umklammerte bei diesen Worten ihr Küchenmesser so fest, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. Und sie erwiderte, dass die Kreatur in meinem Kopf existiere, müsse noch lange nicht heißen, dass sie nicht real sei.
Abgrundtiefe Müdigkeit überkommt mich, und ich stoße mich von dem Türrahmen ab. Die Kreatur drückt von hinten die Schnauze in meine Kniekehlen. Sie ruft mir die tiefe Finsternis in Erinnerung, die in meinem Inneren herrscht. Drängt mich auf die vielen Brücken zu, beschreibt mir flüsternd die Schönheit des eisigen Wassers. Ich versuche, ihr nicht zuzuhören. Erschöpft ziehe ich eine Hand aus dem Kummerbund und hole mein Handy hervor, um auf die Uhr zu sehen. Liam wird bald nach Hause kommen. Ich muss zurück. Außerdem wäre es nicht sonderlich klug, noch länger hierzubleiben. Man weiß schließlich nie, welche Straßen gerade überwacht werden.
Ich wende mich vom Fluss ab und tauche in das dunkle Gewirr der vielen kleinen Gassen ein, die wir Heilige Höfe nennen. Keine Ahnung, warum dieses Viertel so heißt. Zwar gibt es einige Hinterhöfe, aber ein Heiliger würde sich bestimmt nicht dorthin verirren.
Ich hole eine Maske aus meinem Rucksack, eine Colombina, mit der ich meine obere Gesichtshälfte bedecke. Spätestens seit dem Anschlag auf den Kronprinzen in der vergangenen Woche maskiert sich wirklich jeder, der die Heiligen Höfe besucht. Dem Thronfolger ist nichts passiert, aber sein Bodyguard wurde getötet. Die Attentäterin war eine Magdalena. Sie wurde an Ort und Stelle erschossen. Ich habe immer noch das Bild ihrer langen blonden Haare auf dem blutverklebten Straßenpflaster vor Augen. Seitdem haben die Presse und die GVK – die Guard of Virtuous Knights – eine brutale Hetzjagd auf sämtliche Rechtsbrecher eröffnet. Überall sonst wären Masken vollkommen undenkbar, aber die Heiligen Höfe bilden eine Ausnahme. Natürlich würde das nie jemand offen zugeben, aber es ist eine unausgesprochene Tatsache, dass so viele Adelige in dieses Viertel kommen, um im Schutz ihrer Masken gewisse Bedürfnisse zu befriedigen, dass selbst die GVK angehalten ist, diese Art der Verkleidung nicht vollständig zu verbieten. Und doch wurden ungeschriebene Gesetze wie dieses in letzter Zeit öfter ausgehebelt. Seit dem Attentatsversuch auf den Prinzen hat sich die Zahl der Razzien spürbar erhöht. Der Anschlag hat die Ängste unzähliger Bürger geschürt, war aber auch eine Blamage für die Königliche Garde. Vor allem, da nur wenige Monate zuvor, nach einem ähnlichen Angriff auf die Königin, ein neuer Captain angeheuert wurde, dessen Ernennung lautstarken Protest hervorrief: der Weiße Ritter, ein Elitekämpfer aus Frankreich. Er nennt sich selbst Blanc und ist eine Art Legende in den schäbigen, vor Dreck starrenden Arenen und unter uns heimlichen Straßenkämpfern. Mit siebzehn galt er als unangefochtener Meister der illegalen Faustkämpfe in Paris und wurde dann bei den Mousquetaires aufgenommen, der Königlichen Garde Frankreichs. Im Gegensatz zu mir hat er seine Kämpfe stets fair gewonnen.
Während ich am Flussufer entlanglaufe, zupfe ich immer wieder nervös an meiner Maske, um ihren Sitz zu überprüfen. Ich trage das Ding nur ungern, genau wie meine Handschuhe. Unter ehrbaren Leuten verhüllt man seine Hände ab einem Alter von drei Jahren. Eine meiner frühesten Erinnerungen dreht sich genau darum: Mein Vater schenkt mir ein Paar Handschuhe zum Geburtstag, nur wenige Monate bevor ich in die Vorschule komme. Es ist ein sonniger, aber kalter Tag, und wir stehen mit einigen aufgeregt schnatternden Kindern auf unserer Veranda, wo ich meine Geschenke auspacke … Damals lebten wir noch in den USA, wo ich auch geboren wurde. Mein Vater hatte wirklich schöne Handschuhe aus Lammfell für mich ausgesucht. Anfangs glitten sie wie Wasser über meine Haut, aber dann schloss er sie mit einem Druckknopf. Meine Finger waren noch nicht kräftig genug, um ihn wieder aufzumachen. Ich fing an zu weinen. Mein Vater sagte, ich solle mir keine Sorgen machen, er würde sie mir abends aus- und am Morgen wieder anziehen, und dann nahm er mich ganz fest in den Arm. Ich weiß noch, wie mein großer Bruder Liam mir die Hand auf die Schulter legte. Und wie meine Mutter uns beobachtete. Sie war eine große, elegante und starke Frau. Da sie Engländerin war, hatten wir einen kuriosen Akzent, der nirgendwo so richtig reinpasste. An jenem Tag trug sie ebenfalls Handschuhe, die sie von meinem Vater bekommen hatte – rotes Leder, sehr hübsch. Aber vor allem ist mir der Ausdruck auf ihrem Gesicht in Erinnerung geblieben. Eigentlich hätte ich es damals schon wissen müssen. Vielleicht hätte ich sie dann beschützen können …
Ich spüre es erst, als ich um die Ecke biege. Eine Art Schauer. Als würde mir jemand mit den Fingerspitzen über das Genick fahren. Hastig drehe ich mich um, aber die Gasse hinter mir ist leer – nichts als schwarzes Kopfsteinpflaster und dunkle Ziegelmauern, die von einer einzigen Straßenlaterne angestrahlt werden. Dann tauchen die Scheinwerfer einer Luftkissenbahn auf, die schnell und beinahe lautlos vorüberzieht. Ich lausche angestrengt, höre aber nur leise Geigenklänge, die vom Fluss heraufwehen. Und selbst dieses Geräusch klingt durch den Nebel irgendwie dumpf. Ganz langsam setze ich meine Kapuze auf. Es muss wohl die Kälte gewesen sein, oder ich habe mir die Berührung eingebildet. In ganz London gibt es niemanden, der mich anfassen würde.
Erst als ich den Kopf hebe, um weiterzugehen, entdecke ich die Gestalt.
Gute fünfzig Meter entfernt steht jemand auf dem Bürgersteig. Ich kann lediglich eine große, dunkle Silhouette erkennen. Sie rührt sich nicht. Während ich langsam weitergehe, versuche ich mich möglichst selbstbewusst zu geben. Falls es sich um einen Ritter der GVK handelt, könnte dies mein letzter Tag in Freiheit gewesen sein. Bereits am Tag der Ratifizierung des NPA wurde auch die Guard of Virtuous Knights gegründet. Die Königliche Garde wurde diesen tugendhaften Rittern unterstellt. Beide Institutionen werden gefürchtet, vor allem von meinesgleichen.
Ich gehe an dunkel gestrichenen Häusern vorbei, deren steile Dächer an die strenge Miene einer Anstandsdame gemahnen. Die schwarzen Vorhänge lassen kein Licht durch. Lediglich die Haustüren unterscheiden sich voneinander: rot, grün, gelb, alles ziemlich grell wie zu dick aufgetragenes Make-up. Auch das erinnert mich an Anstandsdamen. Angespannt zupfe ich an meinen Handschuhen, während ich die Silhouette vor mir nicht aus den Augen lasse. Kein Millimeter nackter Haut darf zu sehen sein. Seit es den NPA gibt, ist man im Vereinigten Königreich zum sittsamen Kleidungsstil des neunzehnten Jahrhunderts zurückgekehrt, obwohl wir bereits das Jahr 2054 schreiben. Genau wie in Amerika sieht man überall hypermoderne Handys und Tablets, doch diese Gerätschaften werden in altmodischen Ledertaschen oder absurd voluminösen Unterröcken verborgen.
Inzwischen habe ich die Gestalt fast erreicht. Ich kann sie nur aus den Augenwinkeln beobachten, da es Frauen nicht gestattet ist, Männer offen zu mustern. Und das hier muss ein Mann sein, auch wenn er einen weiten Mantel mit Kapuze trägt, sodass ich nichts Genaues erkennen kann. Fünf Meter noch. Augen geradeaus. Vier. Drei. Zwei. Eins.
Während ich an ihm vorbeigehe, bemerke ich einen leichten Duft: Bergamotte, vermischt mit einer rauchigen Holznote. Irgendwie berauschend. Er zeigt keine Reaktion, als ich meinen Weg fortsetze und befreit Luft hole. Mir war nicht einmal bewusst, dass ich den Atem angehalten habe.
Erst nachdem ich fünfzig Schritt Distanz zwischen uns gebracht habe, drehe ich unauffällig den Kopf. Und bemerke hinter mir eine Bewegung.
Er folgt mir.
Ich warte nicht, zögere keine Sekunde, sondern renne um mein Leben.
Bloß weg von der Gestalt, immer tiefer hinein in die verwirrenden Gassen der Heiligen Höfe. Ich hetze auf eine Reihe hoher Häuser zu, die sich verzweifelt an vergangener Größe festklammern, während ringsum der Verfall herrscht. Finster ragen ihre Portale vor mir auf. Ich biege um eine Ecke, sehe mich hastig um. Falls er mich verfolgt, hat er es noch nicht bis zur Ecke geschafft. Ich kann es also riskieren. Ich springe über einen niedrigen Zaun und laufe auf die nächste Tür zu. Meine Faust knallt schneller gegen das nasse Holz, als ich mitzählen kann. Zwei, zwei, eins.
Die Tür öffnet sich. Ich stürme an dem blassen Jungen vorbei, Mollys Sohn Meram, der hinter mir sofort wieder zumacht.
»Lass niemanden rein«, zische ich noch, bevor ich weiterlaufe. Durch den Flur, zur Hintertür hinaus, in einen großen Hof, der voller Dampf ist. Da er durch ein Glasdach am Abziehen gehindert wird, kann ich im ersten Moment nichts sehen. Entgeistigter Dampf noch mal! Der weiße Nebel steigt aus den Trögen der Weber auf, die überall auf dem Hof ihrer Arbeit nachgehen. Mit ihm werden die Raupen abgetötet, die zuvor sorgsam mit Maulbeer- und Eichenlaub aufgepäppelt wurden, um das eine Material zu produzieren, nach dem wir uns alle verzehren: Seide. Die Droge der Magdalenen, die einzige Medizin gegen unser Verlangen. Jeder Magdalene hungert nach menschlichem Kontakt – körperlich wie auch mental. Wir nennen es Hautgier und Geistgier. Seide kann zwar den Geist nicht befriedigen, aber in ihrer Ursprungsform lindert sie das Bedürfnis nach Hautkontakt. Deshalb ist in der Öffentlichkeit nur verarbeitete Seide gestattet: Brokat, Chiffon, Satin. Aber hier auf diesem Hof trägt jeder Seide, entweder als weiches Band direkt am Körper, als Umhang oder in Form einer Maske.
Ich drossele mein Tempo gerade so weit, dass ich weder mit den Webern noch mit ihren Trögen oder den Seidenbändern zusammenpralle, die überall in der Luft flattern. Einen Herzschlag lang lasse ich den Blick schweifen. Dies ist Babylon. Hier verscherbeln Magdalenen ihren Geist an den Meistbietenden.
Nachdem ich mich an den Dampf gewöhnt habe, kann ich den Hof besser überblicken, mustere die hölzernen Buden und den großen Pfahl im Zentrum. Der steht schon seit Menschengedenken dort, geschnitzt aus dem Stamm eines uralten Baumes. Ganz oben sind vier verschiedene Seidenbänder angebracht, für jede Kaste der Magdalenen ein Band und eine Farbe: ganz unten Violett für die Schnüffler. Darüber das Grün der Maltoren. An zweiter Stelle von oben weht das gelbe Band der Memextratoren. Und ganz oben das Blau der Mensatoren. Früher wehte darüber noch ein fünftes, ein in stolzem Rot leuchtendes Band aus Feuerseide, aber das ist verschwunden.
Ich halte auf den Pfahl zu, schiebe mich an altbekannten Buden und diskret versteckten Touchdisplay-Telefonzellen vorbei. Neben wundervollen Seidenstoffen liegen hier auch Romane und Theaterstücke in der Auslage, gut getarnt durch Koch- oder Gebetbuchumschläge. An den Ständen sind ebenfalls bunte Seidenbänder angebracht, anhand derer man erkennen kann, welche Magdalenenkaste hier ihre Dienste anbietet. Zuerst komme ich bei den Maltoren vorbei, deren grüne Bänder an duftende Nadelwälder erinnern. Einer von ihnen ist gerade mit einem Kunden beschäftigt. Sein langer Kapuzenmantel hüllt ihn vollständig ein, nur für einen Moment sehe ich seine bloße Hand aufblitzen, bevor sie die Stirn des Kunden berührt. Dieser stöhnt leise. Schnell gehe ich weiter. Maltoren sind die Meister der Emotionen und des Schmerzes. Wenn sie nackte Haut berühren, können sie Leid von den Menschen nehmen, es ihnen aber auch zufügen. Was von beidem hier gerade der Fall ist, weiß ich nicht, aber in Babylon sollte man nie zu viele Fragen stellen.
Als Nächstes kommen die Buden mit den gelben Bändern der Memextratoren, kurz Memexe genannt. Sie können tief in das Bewusstsein eintauchen und Erinnerungen hervorholen, damit man sie ungetrübt betrachten kann. Das dient sowohl dem Vergnügen als auch therapeutischen Zwecken. An dem Stand, an dem ich gerade vorbeilaufe, drückt der Memex – eine Frau, würde ich sagen – lediglich die Fingerspitzen auf einen schmalen Streifen nackter Haut am Handgelenk seines Kunden, auf dessen Gesicht sich daraufhin die reinste Wonne abzeichnet. Was auch immer vor seinem geistigen Auge abläuft, es muss besseren Zeiten entstammen.
Mit einem prüfenden Blick versuche ich herauszufinden, ob ich die Memex kenne. In Babylon nennt man keine Namen, es sei denn, man hängt nicht gerade an seinem Leben. Aber ich habe hier früher einmal mit einer Memex und einer Maltorin zusammengearbeitet. Manchmal wirken ein Mensator und ein Memex im Team, um den Kunden vergessen zu lassen, woran er sich nicht mehr erinnern will. Ich hingegen werde niemals die vielen Gesichter vergessen, die an unserem Stand auftauchten. Die Soldaten, die uns anflehten, ihnen die grausamen Erinnerungen zu nehmen. Die meisten von ihnen konnten sich unsere Dienste nicht leisten, trotzdem taten wir für sie, was wir konnten. Einmal halfen wir sogar einer Adeligen. Sie war ungefähr sechzig und versuchte mit feinstem Make-up und funkelndem Schmuck die Wunden auf ihrer Seele zu verbergen. Einer ihrer blaublütigen Freunde hatte sie in ihrem eigenen Haus vergewaltigt. Es gab niemanden, an den sie sich damit wenden konnte – niemanden außer uns. Also berührten wir ihre nackte Hand, und die Maltorin linderte den Schmerz, während die Memex die entsprechenden Erinnerungen aufspürte und ich sie veränderte. Es gelang uns, die Frau den Großteil ihres Leids vergessen zu lassen, was zur Folge hatte, dass sie uns wüst beschimpfte, als sie wieder zu sich kam. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, warum sie überhaupt hergekommen war.
Und trotzdem genoss ich jede Sekunde davon. Als die Memex mich berührte, erfasste mich eine wahre Flut von Erinnerungen. Während die Maltorin meine Hand nahm, wurden meine Emotionen so viel lebendiger. Und wenn ich die Gedanken der Menschen las, die Gedanken dieser Frau … oh, Maria, es gibt für mich keinen größeren Genuss, als in den Geist eines anderen einzutauchen. Doch wenn ich es tue, ist mir stets bewusst, was das zur Folge haben kann – das Knallen der Peitsche, die Hände auf meinem Körper, das leise Flüstern: Schlampe.
Ruckartig setze ich mich wieder in Bewegung, laufe hastig an den grünen und gelben Buden vorbei. Als die Stände mit den violetten Bändern auftauchen, zwinge ich mich, ein normales Lauftempo einzuschlagen. Hier arbeiten die Schnüffler. Diese Magdalenen fürchten wir anderen fast noch mehr als die GVK, denn sie spüren es, wenn jemand in ihr Bewusstsein eindringt. Berührt man ihre nackte Haut, um ihre Gedanken, Erinnerungen oder Gefühle zu durchleuchten, erkennen sie, was man ist. Sie erschnüffeln es regelrecht. Wir anderen verfügen nicht über diese Fähigkeit. Falls mich ein Maltor oder ein Memex berühren würde, wäre ich vollkommen ahnungslos.
Blaue Bänder sehe ich an diesem Abend keine, anscheinend bin ich heute der einzige Mensator in Babylon. Wir sind sozusagen aktive Beobachter: Wann immer wir nackte Haut berühren, erleben wir alles mit, was sich in dem jeweiligen Bewusstsein abspielt: Gedanken, Bilder, Geräusche, Gerüche … Zu Erinnerungen und Emotionen habe ich keinen direkten Zugang, aber zu den Gedanken, die sich mit ihnen befassen. Zu sämtlichen Gedanken. Dabei ist jeder Geist anders, sie sehen alle vollkommen unterschiedlich aus. Manche Menschen denken in Bildern, andere in Worten. Meistens setzt sich das Bewusstsein aus einer Mischung verschiedener Sinneseindrücke zusammen. Doch vor allem sind wir Mensatoren die Einzigen, die in den Geist eingreifen und Gedanken manipulieren können – der Name ist eigentlich eine Kurzform des Begriffs Mensipulator. Diese Form unserer Erbsünde ist die seltenste und gleichzeitig die tückischste. Wird ein Magdalene aufgegriffen, ist das allein schon ein Festtag für das ganze Königreich. Doch erwischen sie einen Mensator, ist das ein Riesentriumph, fast so als hätten sie einen Krieg gewonnen.
Inzwischen habe ich die dunkelste Ecke von Babylon erreicht. Hier ist der Dampf nahezu undurchdringlich, der Geruch von heißer Seifenlauge und Schwefeldioxid hängt über allem. Ich beschleunige meine Schritte wieder, als ich an den Magdalenen mit den silbernen Masken vorbeikomme, an Marias Megären. Sie warten hier darauf, für die Menschenjagd engagiert zu werden: Berühre den Feind, dringe in seinen Geist ein, manipuliere ihn, lasse ihn leiden, malträtiere sein Bewusstsein, bis er sich in den Wahnsinn flüchtet. Auch sie tragen die bunten Bänder ihrer jeweiligen Kaste, aber ich schaue vorsichtshalber nicht allzu genau hin.
Es juckt mich in den Fingern, als ich mit langen Schritten auf die Mauer zulaufe, die Babylon nach hinten hin abgrenzt. Am liebsten würde ich bleiben, aber das Risiko ist zu groß. Die Magdalenen sind nicht wirklich organisiert, dieser Innenhof ist nicht geschützt. Hier kämpft jeder für sich allein. Jeder einzelne Augenblick in Babylon ist ein Wagnis. Jede Minute, in der man Seide am Körper trägt, erhöht das Risiko, entdeckt zu werden. Jeder Atemzug könnte dein letzter sein. Deshalb laufe ich weiter, ziehe mich an den Efeuranken der Mauer hoch, lasse mich auf der anderen Seite fallen und federe mit schmerzenden Knien den Sturz ab. Dann renne ich weiter, immer weiter. Als ich schließlich die Rückseite des Gebäudes erreiche, in dem die Wohnung meines Bruders liegt, haben das Adrenalin und die Schuldgefühle mich schon fast untergekriegt. Über die Feuerleiter klettere ich zu meinem Fenster hoch und schiebe mich möglichst lautlos hindurch.
Mein Zimmer ist klein und beherbergt eigentlich nur ein einfaches weißes Bett, einen Kleiderschrank und einen Schminktisch mit Spiegel. Letzterer ist heutzutage Standard, damit wir alle sorgfältig darauf achten können, wie wir uns kleiden. Ich verstecke mein Kostüm unter den Stoffballen in meinem Kleiderschrank – weicher Chiffon, festes Leder, raue Wolle. Was zu meinem Beruf als Schneiderin passt, allerdings bewahre ich diese Stoffe hier auf, um sie berühren zu können, wenn die Hautgier unerträglich wird. Es ist nicht vergleichbar mit dem Gefühl, in einen Geist einzutauchen, nicht einmal mit Seide auf der Haut, aber in meinen dunkelsten Momenten ist es besser als gar nichts.
Nun schiebe ich eine Hand unter die schweren Ballen und taste nach meinem Seidenband. Eigentlich müsste es blau sein, die Farbe der Mensatoren, aber dieses Band habe ich nicht in Babylon erstanden. Nein, die Seide gehörte früher meiner Mutter und davor meiner Großmutter. Sie stammt noch aus einer Zeit, als Seide von allen Menschen getragen wurde, nicht nur von Magdalenen. Damals hatte meine Großmutter ihr eigenes Geschäft und webte die schönste Seide, die man sich vorstellen konnte. Überall auf der Welt waren ihre Stoffe gefragt. Feuerseide wurde sie genannt, da das Licht wie eine Flamme über das Gewebe zu tanzen schien. Doch das war natürlich vor der Seidenrebellion. Bevor die Magdalenen in den Untergrund verbannt wurden.
Vorsichtig hole ich das Band hervor. Die rote Seide schimmert zwischen meinen Fingern. So ein Band zierte früher die oberste Spitze des Pfahles in Babylon, bevor die Feuerseide so selten und wertvoll wurde, dass sie jemand stahl. Sanft gleitet mein Finger über das weiche Material, das sich herrlich glatt und kühl anfühlt. Bevor ich schlafen gehe, binde ich es mir immer um den Hals, damit der Drang morgens beim Aufwachen nicht schon so stark ist, dass ich es nicht bis abends aushalte. Aber das funktioniert nicht immer. Heute war einer dieser Tage.
Ich hole mir eine Schüssel mit Wasser, stelle sie auf meinen Schminktisch und wasche mir hastig den Dreck und den Schweiß ab. Liam darf nicht erfahren, wo ich gewesen bin. Er weiß über meinen Zustand Bescheid, und er hat alles aufgegeben, um mein Geheimnis zu bewahren. Es wäre ein weiterer Punkt in meinem langen Sündenregister, würde ich ihm das verdanken, indem ich mich bei meinen Ausflügen von der GVK oder von der Presse erwischen ließ. Ich ziehe mein Hauskleid an, richte den hohen Kragen, streiche die Schleppe und den bodenlangen Saum glatt. Dann stecke ich das Seidenband in die eine Rocktasche, die Handschuhe in die andere. Hier in der Wohnung muss ich sie nicht tragen. Anschließend lege ich mein Handy neben das Tablet auf meinem Nachttisch und gehe in die Küche hinüber. Es ist still in der Wohnung. Ich gönne mir einen Moment mit dem Brotteig, den ich auf dem Fensterbrett stehen gelassen habe. So tief wie möglich vergrabe ich meine Finger in der weichen Masse. Das wird ein hervorragendes Brot werden. Wie gerne würde ich mich selbst verformen wie diesen Teig. Jemand anderen aus mir machen. Es ist unfassbar – dieselben Finger, die jetzt mit pudrigem Mehl bedeckt sind, haben sich vor nicht einmal einer Stunde so fest in Zwei-Meter-Zehns Hals gebohrt, dass sie bestimmt Spuren hinterlassen haben. Nur eine Stunde, schon widert mich der Gedanke daran an. Und zugleich wünschte ich, ich könnte es wieder tun.
Während ich noch mit mir hadere, höre ich leise Schritte im Treppenhaus. Dann klickt das elektronische Türschloss.
»Rea, ich bin zu Hause.«
Sekunden später betritt mein Bruder die Küche. Er ist drei Jahre älter als ich, hat leuchtend rote Haare und unglaublich lange, schlanke Finger. Gedankenverloren zupft er an den Saiten seiner Violine. Die Kälte hat sein Gesicht gerötet, seine Nägel schimmern bläulich. Weil er weiß, dass er mir damit eine Freude macht, schenkt er mir ein Lächeln, doch seine Miene bleibt ernst, während er Schal, Mütze und Mantel ablegt. Er stellt eine Papiertüte mit Weißbrot, Eiern und Milch auf den Küchentisch. »Heute hatte niemand besondere Lust auf Musik«, entschuldigt er sich. »Morgen werde ich mir einen anderen Platz suchen müssen.« Nachdem er die Violine vorsichtig weggelegt hat, geht er zum Herd und nimmt eine der Pfannen, die an Haken an der Decke hängen. »Arme Ritter?«
»Mein Leibgericht«, versichere ich ihm und sehe zu, wie er mit ruckartigen Bewegungen das Brot aufschneidet. Liam erinnert mich an unsere Mutter – ruhig, aber stark. Seit sie verschwunden ist und seit dem Tod unseres Vaters vor vier Jahren hat er sich um mich gekümmert. Er hat keinem von beiden verziehen, dass sie uns verlassen haben. Doch er hat mich bis hierher nach London mitgenommen, um einen ganzen Ozean zwischen uns und unsere Vergangenheit zu bringen, und hat seitdem die kältesten vier Jahre seines Lebens durchlitten.
Aber nun wird sich wieder alles ändern. Liam hat sich um ein Stipendium an der Königlichen Musikhochschule von Paris beworben, um dort Konzertgeige zu studieren. Und ich will ihn in die Stadt der Lichter begleiten. In Nordamerika und dem Vereinigten Königreich stehen Berührungen aller Art unter Strafe, aber auf dem Kontinent nicht. Wir hätten schon längst die Insel verlassen und wären nach Irland oder Frankreich gegangen, irgendwohin, wo ich nicht verfolgt würde, aber eine Auswanderung ist heutzutage nahezu unmöglich. Alle, die es versucht haben – auf schäbigen Flößen oder auf dem Dach der wenigen Züge, die noch durch den Tunnel fahren –, sind nie wieder aufgetaucht. Oben im Norden ist es sogar noch schlimmer, am ehemaligen Hadrianswall. Der heißt jetzt Marienwall, benannt nach dem einzigen Kind von Katharina von Aragon und der meistverehrten Monarchin aller Zeiten, Königin Maria I. Sie ist die jungfräuliche Herrscherin, das makellose Vorbild aller Frauen. Ihr Porträt hängt in jedem Haushalt, immer direkt neben dem ihrer Namenspatronin, der Heiligen Jungfrau.
Aber wenn Liam nach Paris gehen würde, könnten wir vielleicht auch ein Visum für mich bekommen. Ich habe mich sogar schon nach Arbeit umgesehen, träume von einer Anstellung in der Grande Bibliothèque oder dem Théâtre Odéon. Bücher waren schon immer mein größter Trostspender und das Theater die reinste Erlösung. Noch heute sehe ich unser Schultheater vor mir, spüre den schweren roten Vorhangstoff zwischen den Fingern, rieche die Schminke, erinnere mich an die weichen Knie kurz vor dem ersten Auftritt. An die Freude, den Adrenalinkick, die befreiende Möglichkeit, jemand anders zu sein – mein größter Wunsch von allen.
Doch ich erinnere mich auch an harte Fliesen und die kalte Luft auf meiner nackten Haut, wenngleich ich das lieber vergessen würde.
Mein Bruder schaltet das Radio ein. Er ist kein besonders visueller Mensch, das grelle Licht von Bildschirmen und Neonröhren irritiert ihn. Deshalb besitzen wir auch keinen Fernseher. Im Radio läuft gerade ein Werbespot der Regierung. »Denkt immer daran, ihr Jungen und Männer dort draußen«, ertönt die umwerfende Stimme von Thea Mallory. »No skin, no sin.« Die Adelige vermietet ihr klangvolles Organ regelmäßig an die Regierung – um des Ruhmes willen. Und damit ist sie tatsächlich sehr berühmt geworden. Inzwischen spitzt jeder brav die Ohren, wenn sie spricht. »Der Weg zur Hölle führt über die Haut.«
Liam switcht durch die Sender, bis er ein klassisches Konzert findet – ein Pianist spielt eine wehmütige, leichte Melodie. Automatisch passt Liam seine Bewegungen an, er schneidet jetzt langsamer, rhythmischer, mit weniger Druck. Der Magie der Musik kann er sich nie entziehen. Es dauert nicht lange, bis er sich hin- und herwiegt. Ich muss grinsen. Er ist ein grauenvoller Tänzer. Ich nehme die Hände aus der Teigschüssel, halte sie hoch und ahme Liams Bewegungen nach. Sobald er es bemerkt, steigern wir uns beide rapide, bis wir nur noch wild mit den Armen zucken. Falls einer der Nachbarn jetzt zu uns hereinsieht, glaubt er wahrscheinlich, wir hätten einen simultanen Krampfanfall. Liam lacht laut auf, als ich ein paar selbst erfundene Ballettschritte aufführe und dabei fast das Gleichgewicht verliere.
»Oh, Maria, haben sie dir in der Schule denn gar nichts beigebracht?«
»Nichts Nennenswertes. Außer natürlich, dass man das Abendessen nicht anbrennen lassen darf«, schieße ich zurück. Schon hat Liam sich ein Küchentuch geschnappt und schlägt damit nach mir. Ich setze mich mit der langen Schleppe meines Hauskleides zur Wehr. Über den Küchentisch hinweg fechten wir es aus, laut lachend, nur unterbrochen von überraschtem Quietschen, wenn einer von uns einen unvermutet heftigen Treffer landet. Der Kampf findet erst ein Ende, als Liam tief Luft holt und die Nasenflügel bläht. Er beugt sich weit über die Tischplatte. »Riecht es hier etwa verbrannt?«
Wieder lachen wir los. Während Liam zum Herd stürzt, um das Essen zu retten, widme ich mich weiter meinem Teig. Er ist fast so weich wie die Seide, die ich in Babylon gesehen habe. Ob es in Paris wohl auch ein Babylon gibt? Bestimmt. Früher war das schließlich kein Schwarzmarkt, sondern ein Ort des Wissens, der Forschung und der Andacht. In ganz alter Zeit gab es sogar eine ganze Stadt mit diesem Namen; schließlich existierten die Magdalenen schon immer. Unser Babylon ist nur noch ein Schatten seiner selbst, nichts als ein schäbiger Hinterhof, in dem Kriminelle ihre lasterhaften Dienste an alle verscherbeln, die es sich leisten können. Niemand weiß, wer den Markt leitet und die Genehmigungen für die Buden und Webertröge erteilt. Meram dient als Sprachrohr, und Molly zieht am Ende des Geschäftstages siebzig Prozent der Einkünfte ein, aber es weiß niemand, an wen sie das Geld weitergibt. Das alles ist natürlich absolut illegal. Der alte Holzpfahl, die vier Farben – nichts als dürftige Überreste einer Zeit, in der Magdalenen noch nicht als Abschaum galten. Als ihre Existenz allgemein bekannt war und die Menschen wussten, dass man sich hilfesuchend an sie wenden konnte. Doch die Zeit der Hexenverfolgung hat dem ein Ende gemacht. Um den gnadenlosen Hinrichtungen, den Scheiterhaufen und dem nassen Tod in Seen und Flüssen zu entgehen, tauchten die Magdalenen unter, bis sich keine Menschenseele mehr daran erinnern konnte, dass sie existierten.
Bis wir erneut entdeckt wurden. Bis zur Seidenrebellion. Bis vor sechsundzwanzig Jahren.
Aber in Paris wird alles anders sein. Ganz bestimmt.
Als ich später ins Bett gehe, kreisen meine Gedanken noch immer um Paris. Ich knipse meine Nachttischlampe aus und stelle mir vor, wie ich Arm in Arm mit meinem Bruder am Ufer der Seine entlangspaziere, während der Fluss im Licht der Sterne fröhlich funkelt. Da summt plötzlich der Vibrationsalarm meines Handys. Seufzend nehme ich das Gerät in die Hand. Wahrscheinlich ist es eine Nachricht von Róisín, die mich früher zur Arbeit bestellt.
Es ist nicht Róisín.
Es ist eine Nachricht, aber mit unterdrückter Nummer.
Träum schön.
Dich erwische ich noch.
Ruckartig setze ich mich auf. Meine Finger schließen sich krampfhaft um die Bettdecke, während mein Blick zum Fenster huscht. Der Boden ist eiskalt, als ich aufstehe. Schaudernd schleiche ich zum Fenster, gehe tief in die Hocke und schiebe dann vorsichtig die weißen Vorhänge auseinander, nur einen kleinen Spalt weit.
Und sehe gerade noch, wie die Gestalt in dem weiten Mantel die Straße hinuntergeht.
Kapitel 2
Als am Morgen der Wecker klingelt, bin ich bereits hellwach und starre aus dem Fenster. Nachdem ich endlich eingeschlafen war, habe ich von den Irrenhäusern geträumt, den sogenannten Geistigen Korrektiven, in die Magdalenen gebracht werden, wenn man sie findet. Ich habe im Körperschutzunterricht in der Schule das erste Mal davon gehört, kurz nachdem ich mit Liam nach London kam. Dort versuchen sie, einen zu therapieren. Sie baden dich in Eiswasser, bis die Haut dauerhaft empfindungslos wird. Verbrennen deine Hände, sodass jede Berührung schmerzt. Schicken dich zu einem abtrünnigen Maltoren, der deinen Geist so lange quält, bis du wahnsinnig wirst. Einmal haben wir so eine Einrichtung in East London besucht, Pflichtexkursion in der fünften Klasse.
Ich schließe die Augen, versuche die Erinnerungen zu verdrängen. Es war unfassbar dumm von mir, gestern Abend loszuziehen. Alles aufs Spiel zu setzen, nur um die widerwärtige Finsternis in mir mit Brutalität und Blut zu füttern. Was nicht einmal geholfen hat. Mit zitternden Fingern löse ich das Seidenband von meinem Hals und verstecke es wieder im Kleiderschrank.
Bevor ich das Zimmer verlasse, blicke ich noch einmal vorsichtig auf die Straße hinunter. Alles ruhig. Es ist noch früh, gerade mal fünf Uhr. Róisín lässt uns immer schon im Morgengrauen antreten, aber bei der momentanen Wirtschaftslage darf man nicht wählerisch sein. Ich suche die dunklen Winkel der Gasse nach verdächtigen Bewegungen ab, nach einer Gestalt. Wartet dort jemand und beobachtet mich? Ich beiße mir so fest auf die Lippe, dass sie blutet. Plötzlich kriecht auch die Kreatur wieder heran und leckt an meinen tauben Fingerspitzen.
So leise wie möglich schleiche ich ins Bad und ziehe mich an. Liam schläft noch. Bei den morgendlichen Pendlern hofft man vergeblich auf Großzügigkeit. Um diese Uhrzeit sind alle noch viel zu mies gelaunt, um einem Geiger ein paar Münzen zukommen zu lassen. Ich streife ein Paar Gladiés über, lege einen weißen Marienkragen an und schlüpfe in einen langen Mantel, dann gehe ich in den Flur hinüber. Erst jetzt suche ich mir einen Kummerbund aus, diesmal einen aus hellblauem Kordsamt, und schlinge ihn mehrmals um meine Taille – nicht zu fest, aber auch nicht zu locker. Ich befestige ihn mit einer hübschen Schleife, die ich so positioniere, dass ich ungehindert die Hände am Rücken unter das Band schieben kann, sobald ich die Wohnung verlassen habe. So bleibt der Rücken aufrecht, und die Hände sind sicher verwahrt; aber ich kann sie auch mühelos wieder hervorziehen, wenn es nötig ist. Wer aus unserer Gegend kommt, kann schlecht darauf verzichten, denn wir müssen unsere Hände noch benutzen – etwa um Türen zu öffnen, die Vorhänge zu waschen oder zu arbeiten. Die Superreichen hingegen tragen »richtige« Kummerbünde, bei denen die Hände auf dem Rücken festgebunden werden. Früher galt das als Zeichen immensen Reichtums, denn nur wer genug Dienstboten hatte, um weder arbeiten noch selbst Türen öffnen zu müssen, konnte sich so etwas leisten. Inzwischen sind diese Kummerbünde etwas weiter verbreitet, zumindest in der Öffentlichkeit. Ich hasse jede Art von Kummerbund, obwohl der, den ich heute trage, mir ganz gut gefällt, vor allem die Farbe und die Struktur des Stoffes. Ich habe ihn Róisín heimlich gemopst. Wenn sie es rausfindet, wird sie mir vermutlich mit einem Messer einen bleibenden Kummerbund verpassen. Falls sie irgendwann einmal nüchtern genug ist, um überhaupt etwas zu bemerken.
Das elektronische Türschloss unserer Wohnung und die Haustür öffnen sich automatisch, sobald ich mich nähere, damit ich meine Hände im Kummerbund lassen kann. Diesen Luxus hat Ihre Majestät die Königin den Bürgern von London anlässlich ihrer Silberhochzeit zum Geschenk gemacht. Der ach so angenehme Nebeneffekt ist, dass die GVK und die Königliche Garde nun mit einem Fingerschnippen sämtliche Gebäude betreten können. Als ich das Haus verlasse, ist es auf der Straße schon ein wenig belebter geworden, aber noch nicht so voll, dass wir uns an die markierten Gehspuren auf dem Bürgersteig halten müssen. Die drei Bahnen sollen verhindern, dass man sich versehentlich anrempelt; die langsameren Fußgänger halten sich an die linke Spur, die schnellsten gehen ganz rechts.
Dieser Stadtteil nennt sich Little Justus und ist etwas respektabler als die Heiligen Höfe. Eine ärmere Ausgabe von normal. Die Leute hier halten sich an die Sitten, soweit sie können. Wenn eine unverheiratete Frau sich ein Zimmer mietet, werden die Fensterrahmen weiß gestrichen, und die dunklen Vorhänge werden durch weiße ersetzt. Man achtet sorgsam darauf, sie jede Woche zu waschen. Und wenn ein Mann heiratet, streicht seine Familie das Haus in einem möglichst hellen Grauton. Weiß ist in der Pflege zu kostspielig, stattdessen bepflanzt man die Blumenkästen mit Sauerklee und Schneeglöckchen, in der Hoffnung, diesen Mangel etwas auszugleichen. Außerdem kommt es vor allem auf die Vorhänge an. Die dürfen nicht zu schwer sein, denn von der Straße aus müssen zumindest noch schemenhafte Gestalten zu erkennen sein. Weiße Vorhänge zeigen, dass man nichts zu verbergen hat.
Ich gehe die Straße hinunter und zupfe nervös an meinem Marienkragen. Dich erwische ich noch. Vielleicht war es ja nur ein Missverständnis. Falsche Nummer, weiter nichts.
Doch dann sehe ich aus den Augenwinkeln eine Bewegung, gerade als ich die Rolltreppe zur U-Bahn betrete. Hastig drehe ich mich um, aber da sind zu viele Menschen, einer auf jeder Stufe, damit alle Abstand halten. Die asphaltgrauen Gesichter mit den leeren Augen verstellen mir die Sicht. Trotzdem hätte ich schwören können, dass dort etwas war – eine Gestalt, die sich in meine Richtung bewegte.
Mein Hals wird ganz trocken. Ich will zurück nach oben und nachsehen, um nicht länger von nächtlichen Albträumen und Schatten in der Dämmerung verfolgt zu werden. Aber wenn Róisín herausfindet, dass ich zu spät gekommen bin, bin ich meinen Job auf der Stelle los. Also fahre ich weiter nach unten. Von der Rolltreppe wechsele ich auf ein Laufband, das mich zur John Line Richtung Westen bringt. Auf dem Band sind grellgelbe Quadrate aufgemalt, und ich achte darauf, immer in der Mitte meines Vierecks stehen zu bleiben. So läuft man nicht Gefahr, jemanden zu berühren. Das Laufband endet am Bahnsteig, wo ebenfalls Quadrate warten, diese allerdings mit Nummern. Die Felder eins bis vierundfünfzig sind bereits besetzt. Wenn alle Quadrate voll sind, werden Rolltreppe und Laufband automatisch angehalten, damit es zu keinem Stau kommt. Ich stelle mich in das Feld mit der Nummer fünfundfünfzig. Solange alle auf ihren Plätzen bleiben, gibt es kein Geschubse oder Gedrängel, vor allem da jeder hier einen Kummerbund trägt. Selbst die Hafenarbeiter binden sich für die Fahrt zur Arbeit einen breiten Ledergurt um die Hüfte.
Bis die Luftkissenbahn einfährt, behalte ich starr den Eingang im Auge. Nacheinander betreten alle den Wagen, suchen sich ein freies Feld, stellen sich auf die Markierung und schlingen ihren Kummerbund um den entsprechenden Teil der Haltestange. Breitbeinig und durch den Kummerbund zusätzlich gehalten, hat jeder einen festen Stand, sodass man nicht versehentlich mit seinem Nachbarn in Kontakt kommt. Bis nach St. Joseph sind es vier Stationen; dort sind die meisten Handwerksbetriebe angesiedelt. Als die Luftkissenbahn hält, starre ich sämtliche Aussteigenden prüfend an, so paranoid bin ich schon. Dann senke ich hastig den Blick und schiebe meine Hände tiefer in den Kummerbund. Anstarren gehört sich nicht. Ich spüre heiße Röte auf meinen Wangen, als wir aus dem U-Bahnhof auf die Straßen von St. Joseph hinaustreten. Hier, näher am Stadtzentrum, sind die Häuser nicht nur größer und werden weniger vom Nebel des Flusses heimgesucht, sie erstrahlen auch alle in makellosem Weiß. Die wenigen jungen Männer, die auf den Straßen unterwegs sind, tragen alle Schwarz. Sie weichen meinem Blick aus, trotzdem kommt es mir so vor, als starrten sie mir hinterher. Was natürlich nicht sein kann, denn an mir gibt es nichts Interessantes zu sehen. Schon auf den ersten Blick erkennt man in mir das Mädchen vom Stadtrand. Wir tragen nicht nur Weiß. Immerhin haben wir auch noch anderes zu tun, als ständig unsere Klamotten zu waschen.
Róisíns Geschäft liegt nicht weit von der U-Bahn entfernt. In dem großen Schaufenster vorne sind schicke Kummerbünde und lange Gladiés ausgestellt. Ein weißer Vorhang hinter dem Tresen trennt die Schneiderwerkstatt vom Verkaufsraum. Noch hat der Laden nicht geöffnet, doch ich sehe eine Bewegung hinter dem Vorhang. Das muss Zadie sein. Ich ziehe meine Hände hervor, schließe die Ladentür auf und gehe als Erstes zur Kasse, wo der Schichtplan hängt. Am Vormittag bin ich mit Zadie allein. Später wird Marcus zu uns stoßen, um die Lieferungen auszutragen. Alle bis auf eine.
Ich stöhne gequält. Eine Lieferung geht an das Stadthaus des Duke of Buckingham, und in dieses Feld hat Róisín meinen Namen gekrakelt. Wahrscheinlich war das gestern Abend, sie war zu betrunken, um noch aufrecht zu stehen, und hat sich halb auf den Schichtplan gelegt, um mich mit einem fiesen Kichern einzutragen. Sie weiß ganz genau, wie der Mann uns Mädchen behandelt und wie demütigend es für uns ist, dort hingehen zu müssen.
Der Vorhang in meinem Rücken wird aufgezogen. Zadie hat gehört, wie ich reingekommen bin. Ihre wundervollen dunklen Locken rahmen ihr Gesicht perfekt ein, als sie zur Kasse geht. Anstatt mich zu begrüßen, zieht sie jedoch nur eine Augenbraue hoch und deutet auf meinen Kummerbund. »Wir sind heute Morgen wohl besonders wagemutig, wie?«
Verlegen hebe ich die Hände vor den Bauch. Damit meint sie natürlich die Farbwahl. Anständige Leute tragen nur Weiß und Schwarz. Farben bleiben denen überlassen, die ganz unten angekommen sind und sich selbst verkaufen: Schauspielerinnen, Musiker, Huren. Auch eine Nachwirkung der Seidenrebellion. Als die Magdalenen begriffen, dass ihre Existenz wieder publik geworden war und dass jegliche Form körperlicher Berührung verboten werden sollte, gingen sie auf die Straße. Dabei trugen sie ihre Farben, Violett, Blau, Gelb und Grün. Mit ihnen protestierten auch einige Nicht-Magdalenen wie zum Beispiel die Seidenweber. Auch meine Großmutter war dabei. Sie fertigte für alle rote Bänder aus Feuerseide, für die Magdalenen ebenso wie für die anderen, bis es so aussah, als zöge ein Flammenmeer durch die Straßen. Deshalb nennt man die Proteste heute die Seidenrebellion. Und deshalb habe ich meine Großmutter nie kennengelernt. Die GVK hat sie alle getötet, elf Tage nach ihrem ersten Marsch, am zweiten Februar. Ihr Blut durchtränkte die Seidenbänder, und von da an waren sowohl Seide als auch bunte Farben in der Öffentlichkeit verpönt.
Aber das alles liegt weit zurück, und ein helles Blau kann meiner Meinung nach die Gemüter nicht wirklich erhitzen. »Du musst zugeben, dass es mir hervorragend steht.«
Grinsend arrangiert Zadie die Stoffmuster auf dem Tresen, verschiedenste Abstufungen von Weiß, Creme und Elfenbein. »Dem Duke wird er sicher noch um einiges besser gefallen als mir.«
Wieder stöhne ich auf. »Ich kann nicht glauben, dass sie mich da hinschickt.«
»Ich schon«, erwidert Zadie trocken. »Er mag dich.«
»Er begafft mich.«
»Wenn sie deinen Kummerbund sehen könnte, würde sie wohl sagen, dass du nichts anderes verdient hast.« Zadie beugt sich zu der Auslage mit den Handschuhen hinunter, die im verschlossenen Tresen liegen. Hinter der Kasse ist es eng, sodass nur wenige Zentimeter Raum zwischen uns bleiben. Schon oft hätte ich Zadie gerne berührt, vor allem hinten in der Werkstatt, wenn wir beide ohne Handschuhe arbeiten. Bestimmt ist ihr Geist genauso ausdrucksvoll wie ihre Augen. Aber durch den hellen Vorhang sind unsere Silhouetten immer zu erkennen, außerdem würde sie mich wahrscheinlich verraten. Ihr bliebe kaum etwas anderes übrig. Zadie hat mich immer mit Respekt behandelt, obwohl sie es nicht gemusst hätte. Sie in eine derartige Lage zu bringen wäre für mich unerträglich.
Also trete ich einen Schritt zur Seite, als sie in die Werkstatt zurückgeht. »Ich werde die Vorhänge des Dukes genauso schlampig besticken, wie Róisín schreibt«, ruft sie über die Schulter, was mir ein lautes Lachen entlockt. Das ist nett gemeint, aber wir wissen beide, dass sie es nicht tun wird. Sie braucht diese Arbeit genauso dringend wie ich. Auf der Schwelle zur Werkstatt bleibt sie kurz stehen und dreht sich noch einmal ganz zu mir um. Als sie plötzlich die Augen zusammenkneift, läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Aber sie sieht gar nicht mich an, sondern blickt über meine Schulter hinweg. »Sag mal, erwartest du einen Kunden, Rea?«
Ich prüfe noch einmal den Schichtplan. »Miss Delacourt kommt erst um halb neun. Wieso?«
Stirnrunzelnd zuckt Zadie mit den Schultern und wendet sich ab. »Sah irgendwie so aus, als würde jemand durch das Schaufenster starren.«
Ich drehe mich hastig um und blicke nach draußen. Eine Frau mit einem weißen Hündchen geht vorbei, gefolgt von zwei Männern, die sich mit dicken Mänteln gegen die erste Winterkälte schützen. Keiner von ihnen bleibt stehen. »Wann? Wo?«
»Gerade eben, während wir hier aufgeräumt haben. Wahrscheinlich habe ich mich geirrt. Der hat sich wohl nur die Auslage angesehen.«
So viel Glück habe ich nicht, nie und nimmer.
Den restlichen Vormittag über behalte ich die Straße vor dem Laden im Auge. Nur wenige Leute bleiben stehen, und das sind samt und sonders Stammkunden. Sie alle rümpfen verächtlich die Nase, wenn ich meine Hand aus dem Kummerbund ziehe, um ihr Geld entgegenzunehmen oder Róisíns neue Vorhangdesigns für den Winter zu präsentieren, aber bei ihnen bin ich mir wenigstens sicher, dass sie keine Ahnung haben, welches Geheimnis sich hinter meinen zitternden Fingern und dem nervösen Gefummel verbirgt.
Gegen Mittag taucht dann Róisín Carter auf. Sie ist untadelig gekleidet, mit einem Unterrock, der fast so breit ist wie die Tür, und blass geschminkten Lippen. Dazu trägt sie eine weiße Sonnenbrille mit runden Gläsern. Sie hat also wieder getrunken. Ihre geknöpften Handschuhe sind an den Ärmeln festgenäht – der letzte Schrei bei den Damen der Gesellschaft. Zuerst begrüßt sie die beiden Kunden im Laden, dann wendet sie sich uns zu.
»Guten Tag, Mädchen.«
Zadie und ich kreuzen die Hände auf dem Rücken, knicksen und deuten dabei eine Verbeugung an – eine abgeschwächte Form des heutzutage üblichen Devotionsknickses. Róisíns Lippen verziehen sich zu einem schmalen, bitteren Lächeln, das alles andere als freundlich wirkt. Keine Ahnung, warum sie das immer für uns aufhebt. Mit einem schnellen Blick mustert sie unsere Kleidung und zieht prompt eine Augenbraue hoch, als sie meinen Kummerbund bemerkt. Kurz frage ich mich, ob sie ihn vielleicht doch wiedererkennt. Aber offenbar irritiert sie lediglich die Farbe, denn sonst hätte sie es niemals durchgehen lassen. »Musst du nicht noch eine Lieferung austragen, ReaSchätzchen?« Damit wendet sie sich wieder den beiden mit Perlen behangenen Damen zu und stimmt in ihr Gelächter mit ein. Es klingt wie Musselin, der über Haut gleitet, sanft und leise. So ein Lachen schenkt Róisín den Leuten immer dann, wenn sie ihnen Geld abknüpfen will.
Zadie legt meine Lieferung auf den Tresen. Ich ziehe meinen Mantel an, nehme das Päckchen und gehe zur Tür. Nein, ich werde mir nicht noch länger anhören, wie Róisín ihre Kunden bezirzt. Ihr Lachen ist wirklich betörend. Vielleicht habe ich deshalb die Stelle bei ihr angenommen. Denn wenn Róisín Carter sich etwas in den Kopf gesetzt hat, kann ihr niemand widerstehen.
Zehn Minuten später steige ich in die U-Bahn. Das Stadthaus der Familie Buckingham befindet sich mitten im Zentrum, in Eden’s Garden. Dort gibt es ausgedehnte Rasenflächen und Parks mit ordentlich gestutzten, weiß angesprühten Bäumen.
Der U-Bahnhof besteht komplett aus Glas, sodass ich schon beim Aussteigen in milchiges Licht getaucht werde. Die Häuser sind ebenfalls reine Glasbauten – nobler geht es kaum –, deren Wände mit weißen oder cremefarbenen Vorhängen versehen sind. Lediglich die Badezimmer und die Schlafzimmer sind blickdicht gebaut. Im Vergleich dazu ist sogar St. Joseph schäbig. In den Fenstern der Häuser, an denen ich vorbeikomme, hängen die feinsten Musselingardinen, die man für Geld nur kaufen kann. Je nach Geschmack des Eigentümers sind sie gerüscht, bestickt oder beides.
Hier geht eigentlich niemand zu Fuß. Fast lautlos gleiten die Limousinen aus transparenter Karbonfaser an mir vorbei. In ihnen sitzen vor allem Frauen, deren Köpfe mit ausladenden weißen Federn geschmückt sind. Ich war bisher nur ab und an in diesem Viertel, um Lieferungen abzugeben, und Gladiés hin oder her – ich komme mir dabei jedes Mal vor wie ein Schmutzfleck auf dem breiten weißen Marmorgehweg.
Als ich mich dem Stadthaus der Buckinghams nähere, taucht die Kreatur neben mir auf und hechelt in meine Kniekehle. Ich versuche, sie zu ignorieren. Rund um das Haus sind kleine Teiche verteilt, in denen Seerosen schwimmen. Mit einem unguten Gefühl im Bauch drücke ich auf den Klingelknopf. Da ich noch immer das Päckchen trage, kann ich die Hände nicht in den Kummerbund schieben. Mein Gesicht wird ganz heiß.
Ein Dienstbote bittet mich herein. Der Duke hat gerade Gäste. Was auch sonst? Geld spielt bei ihm wohl keine Rolle, auch wenn er seine Rechnungen bei uns nicht bezahlt. Bevor man mich in einen langen Korridor führt, sehe ich mich noch einmal um. Die vorherrschende Dekoration besteht hier aus gläsernen Wasserschalen, in denen Seerosenblüten schwimmen, aber an den Wänden hängen auch einige Schwarz-Weiß-Fotografien von Models in vom Duke persönlich entworfenen Designerroben. Die Luft ist so stark aromatisiert, dass ich das Gefühl habe, in einer Parfümerie gelandet zu sein. Auf dem dicken weißen Teppich stehen mehrere Zweisitzer und dazwischen Stühle mit extrem gerader Lehne.
Am Ende des Korridors wartet ein Raum von der Größe einer Lagerhalle auf uns. Hier haben sich mehrere junge Leute zu einem Rendezgroupe versammelt. So lernt man sich heutzutage kennen. Ganz egal, ob in der Turnhalle der Gesamtschule von Little Justus, in einem zugigen Raum in der Größe von Róisíns Laden oder in einem adeligen Stadthaus wie diesem hier – Rendezgroupes nehmen immer denselben deprimierenden Verlauf.
Die Hände aller Beteiligten sind mit echten Kummerbünden auf den Rücken geschnürt. An der Wand sind Anstandsdamen aufgereiht, Frauen, die ähnlich herausgeputzt sind wie Róisín, nur etwas langweiliger, ganz in Grau, mit angenähten Handschuhen und unerbittlichem Blick. Sie sind äußerst stolz auf ihre Arbeit. Ich hätte bei einer von ihnen in die Lehre gehen können, bei Madam Sarah, der Oberaufsicht unseres Schulballs in St. Justus. Doch neben einem solchen Los schien mir selbst die Arbeit für Róisín Carter erstrebenswert.
Sobald ich den Raum betrete, wenden sich mir sämtliche Köpfe zu. Hier drin ist der Geruch sogar noch intensiver. Gespanntes Raunen geht durch die Gruppe. Ein ungefähr sechzehnjähriges Mädchen starrt vollkommen fasziniert auf meine Arme. Natürlich sehen sie die Arme ihrer Anstandsdamen ständig, aber ich bin um einiges jünger als die. Als eine der Anstandsdamen sich hörbar räuspert, verstummt das Gemurmel. Jeder wendet sich wieder seinem Partner zu. Die Mädchen stehen mit ausreichend Abstand nebeneinander; sie tragen alle lange weiße Kleider mit einer schmalen Schleppe am Rücken. Ihnen gegenüber haben die schwarz gekleideten Jungen in einer Reihe Aufstellung genommen. Oder eher Männer. Ihnen lässt man etwas mehr Zeit als uns. Manche von ihnen könnten glatt die Väter dieser Mädchen sein. Die beiden Reihen stehen fünf Meter voneinander entfernt. Zu Beginn bekommen sie dreißig Sekunden Zeit, um sich gegenseitig zu mustern, dann folgen drei Minuten Konversation, angereichert mit schrillem Gekicher. Danach machen die Mädchen einen Schritt zur Seite und landen beim nächsten Partner. Am Ende des Rendezgroupes bleiben die Mädchen in ihrer Reihe stehen, während die Männer ungestört umherwandern dürfen. Hat einer von ihnen Interesse an einem Mädchen, nimmt er die Schleppe seines Kleides in die Hand und zieht einmal kurz daran. Daraufhin dreht sich das Mädchen um, und die beiden dürfen gemeinsam durch den Raum gehen, natürlich getrennt durch die Schleppe, die stets straff gespannt zu sein hat.
Näher bin ich einer körperlichen Berührung außerhalb der Kampfarena nie gekommen.