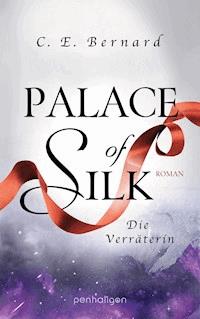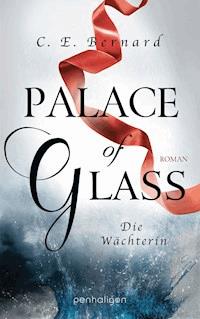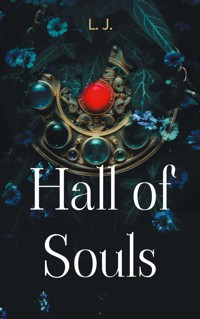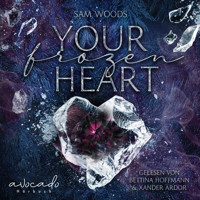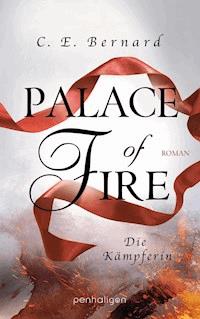
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Palace-Saga
- Sprache: Deutsch
Sie ist eine Magdalena, und sie ist bereit für den finalen Kampf: um ihre Freiheit und ihre Liebe ...
Rea wagt das Unmögliche: Sie kehrt an der Seite von Prinz Robin nach London zurück – in das Land, in dem Magdalenen wie sie gefürchtet, gejagt und ausgelöscht werden. Doch Rea hat Robins Antrag, seine Frau und damit Königin von England zu werden, abgelehnt: Eine Zukunft mit ihm ist für sie undenkbar, wenn sie ihre wahre Identität geheimhalten muss. Außerdem hat Madame Hiver, die zwielichtige Verschwörerin am französischen Hof, Rea zu einem unheilvollen Pakt gezwungen. Doch dann taucht Robin unter und wird zum Gesetzlosen. Wird er sein Reich, seine Macht und seine Krone aufs Spiel setzen, um für Rea und die Freiheit zu kämpfen?
Alle Bücher der »Palace-Saga«:
Palace of Glass. Die Wächterin
Palace of Silk. Die Verräterin
Palace of Fire. Die Kämpferin
Palace of Blood. Die Königin
- Eine Kämpferin, die eine verbotene Gabe besitzt. Ein Prinz, dessen Leben auf dem Spiel steht. Ein gläserner Palast, in dem eine tödliche Intrige gesponnen wird.
- Diese hinreißende Tetralogie werden die Fans von Sarah J. Maas, Kiera Cass und Erin Watt lieben.
- Das Debüt einer hochbegabten deutschen Autorin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 683
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Rea wagt das Unmögliche: Sie kehrt an der Seite von Prinz Robin nach London zurück – in das Land, in dem Magdalenen wie sie gefürchtet, gejagt und ausgelöscht werden. Doch Rea hat Robins Antrag, seine Frau und damit Königin von England zu werden, abgelehnt: Eine Zukunft mit ihm ist für sie undenkbar, wenn sie ihre wahre Identität geheim halten muss. Außerdem hat Madame Hiver, die zwielichtige Verschwörerin am französischen Hof, Rea zu einem unheilvollen Pakt gezwungen. Doch dann taucht Robin unter und wird zum Gesetzlosen. Wird er sein Reich, seine Macht und seine Krone aufs Spiel setzen, um für Rea und die Freiheit zu kämpfen?
Autorin
C. E. Bernard ist das Pseudonym von Christine Lehnen, die 1990 im Ruhrgebiet geboren wurde und seitdem in Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien und Paris gelebt hat. Ihre Kurzgeschichten wurden mit den Literaturpreisen der Jungen Akademien Europas und der Ruhrfestspiele Recklinghausen ausgezeichnet; seit 2014 lehrt sie Literarisches Schreiben an der Universität Bonn. Daneben studiert Christine Lehnen Englische Literaturen und Politikwissenschaft, forscht zum Thema Kreatives Schreiben und inszeniert Theaterstücke mit der Bonn University Shakespeare Company.
Weitere Informationen unter: http://de.cebernard.eu/
Von C. E. Bernard bereits erschienen
Palace of Glass – Die Wächterin
Palace of Silk – Die Verräterin
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/penhaligonverlag.
C. E. Bernard
PALACEofFIRE
Die Kämpferin
Deutsch von Charlotte Lungstrass-Kapfer
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2018 by Christine Lehnen
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2018 by Penhaligon in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Angela Kuepper
Covergestaltung: © Isabelle Hirtz, Inkcraft
JaB · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München ISBN 978-3-641-21752-5 V002 www.penhaligon.de
Für alle, die mit mir geträumt haben
Teil I Die Rückkehr
Solch wilde Freude nimmt ein wildes Ende.
WILLIAMSHAKESPEARE, Romeo und Julia
Kapitel 1
Lasst London brennen.
Die Straßen stehen in Flammen. Dass eine Stadt so brennen kann, eine Stadt aus Glas und Stein.
Dass Glas so brennen kann. Es schmilzt vor meinen Augen. Dieser grauenhafte, brüchige Ort.
Lasst London brennen.
Ich höre Schreie.
Lasst sie alle brennen.
*
Kämpfe enden nie mit einem Schrei. Sie enden mit einem Wimmern. Meine Gegnerin presst den Arm gegen meine Kehle, drückt mich hinunter. Sie ist klein und schmal, aber ihre Hände sind ebenso nackt wie meine. Um ihren Oberkörper ist ein violettes Seidenband gewickelt. Aus der Nähe kann ich die goldenen Flecken in ihren braunen Augen sehen. Ihre Nase ist wie gemeißelt, Locken hängen ihr ins Gesicht. Und in meines. Weich wie in der Werbung.
Sie zerquetscht mir die Kehle, und ich muss würgen.
Warum konnte ich es nicht sein lassen?
Weil diese Arena einfach fantastisch ist. Natürlich sind Kämpfe dieser Art hier ebenso illegal wie dort, wo ich herkomme, aber das scheint niemanden zu interessieren. Mein Gehirn registriert den Sauerstoffmangel, und plötzlich fühle ich mich ganz leicht. Der dichte Zigarettenqualm, die glitzernden Kleider, Anzüge und Hüte des Publikums, der Geruch von Champagner … Es kommt mir so vor, als würde ich schweben. Fliegen. Absolut berauschend.
Und natürlich ihr Geist. Mit meinem Bewusstsein in ihn einzutauchen lässt mich noch höher fliegen. Er besteht aus bunten Glasperlen, die wie funkelnde Sterne vom Himmel fallen, auf glänzenden Steinfliesen landen. Sie rollen durch meinen Geist, sodass ich auf ihnen ausrutsche. Es ist eine Falle. Sie ist ein Schnüffler, und Fallen sind deren Spezialität. Immer wenn ich glaube, sicheren Boden unter den Füßen zu haben, trete ich auf eine neue Lage grüner Perlen, die unbemerkt herangerollt sind. Sie wogen hin und her wie das Meer, wie ein großes wildes Lebewesen. Sie lassen mir keine Chance zur Flucht, lassen mich nicht gehen. Mir schwirrt der Kopf. Die Welt vor meinen Augen verdunkelt sich. Ich höre nur noch mein eigenes Wimmern, mein verzweifeltes Ringen um Luft. Und das leise Klicken der Glasperlen, klick, klick, klick …
Und dann: Applaus.
Sie lässt mich los. Hustend und würgend setze ich mich auf. Meine Brust krampft, meine Lunge zieht sich zusammen, dehnt sich wieder aus. Sauerstoff schießt in meine Adern. Eine heftige Bruchlandung beendet meinen Höhenrausch – ohne abzubremsen, ohne sanften Sinkflug. Es ist eher so, als würde Blanc mir einen Schlag ins Gesicht verpassen. Und mir dann in den Bauch treten. Während ich bereits am Boden liege. Ich spüre den dunklen Teppich des Rings unter mir, sämtliche Nerven schicken Schmerzsignale durch meinen Körper. Ich spüre die Prellungen in meinem Geist. Die Kratzwunden. Mein rechter Ellbogen wird nicht gebrochen sein, aber es fühlt sich so an. Als bohrten sich die gesplitterten Knochen von innen in das Fleisch meines Oberarmes. Und mir platzt gleich der Schädel.
Das war es wert.
Ich bekomme nur ganz am Rande mit, dass der Ringsprecher meine Gegnerin zum Sieger erklärt. Das Publikum skandiert ihren Namen. Silberpfeil nennt sie sich. Als sie mir auf die Beine hilft, trägt sie bereits wieder Handschuhe. Der Schiedsrichter reicht mir mein Paar. Silberpfeil lächelt, und ich erwidere es gerne, als wir uns die Hände reichen – trotz der Schmerzen. Das Adrenalin rauscht noch durch meine Adern. Mein Geist dehnt sich genüsslich. Auch wenn ich verloren habe: Ihr Geist war die reinste Wonne. Hätte ich gewusst, dass es so etwas gibt, wäre ich schon viel früher nach Berlin gekommen.
Kampfarenen für Magdalenen.
Hier spielt es keine Rolle, wie man aussieht. Muskelmasse, Größe, Gewicht, alles unwichtig. Hier zählt nur dein Geist.
Die Menge bejubelt uns. Langsam bekommen die verwaschenen Konturen wieder Schärfe. Das Publikum sitzt an kleinen Tischen, die rings um den Ring aufgestellt sind. Man raucht Zigaretten im Halter, trägt Perlen und Federn. Direkt vor mir ist eine Frau in Schwarz gerade dabei, in aller Ruhe die obersten drei Hemdknöpfe ihres Begleiters zu öffnen. Sie legt ihm eine Hand auf die nackte Brust. Ihr Gesicht ist weiß geschminkt, seines ebenfalls. Augen und Lippen sind blau. Er trägt einen schwarzen Hut und ein leuchtend blaues Einstecktuch. Gelassen schiebt er ihr einen Träger ihres Kleides von der Schulter. Dann küsst er ihren Hals. Ganz langsam legt sie den Kopf in den Nacken. Die beiden beobachten mich, auch jetzt noch. Ihr Tisch war der einzige, an dem auf mich gesetzt wurde.
Silberpfeil und ich bedanken uns für den Kampf, dann taumele ich aus dem Ring. Der Schweißgeruch lässt nach, wird verdrängt von Zigarettenrauch und einem Potpourri aus scharfem Rasierwasser und feinen Parfüms. Hier drin gibt es neben dem Parkett noch zwei Ränge: Auf dem ersten trägt man statt Weste Jackett, auf dem zweiten komplette Dreiteiler. Die Band setzt wieder ein, Klavier, Saxofon und Schlagzeug vereinen sich zu wilden Jazzklängen. Schaumwein fließt, Feuerzeuge zischen, der schwere Duft von gebratener Ente zieht vorbei. Ich nicke dem Pärchen am Tisch zu, als ich an ihnen vorbeigehe. Sie streckt die Hand aus, stützt mich. Erst da wird mir klar, dass ich torkele.
»Schön langsam«, sagt sie mit leichtem Akzent. Ihr Begleiter hat die Füße auf den letzten freien Stuhl am Tisch gelegt. »Das schien nicht gerade vergnüglich zu sein.«
Ich mustere die Frau. Im ersten Moment nehme ich nur ihre schimmernden Perlen wahr. Wie die Glasperlen. In dem Aschenbecher auf ihrem Tisch liegen drei Zigarettenstummel. Ich habe gar nicht bemerkt, dass sie geraucht hätten. Allerdings war ich auch ziemlich beschäftigt.
»Nein, es war großartig.«
Als ich an die Bar trete, hat mir die Barfrau bereits Champagner eingeschenkt. »Kämpfer kriegen einen aufs Haus«, erklärt sie mir. Ihre Haare sind ebenso dunkel wie ihre Haut. Mir gefällt die Art, wie sie sich bewegt, so geschmeidig. Und routiniert. Sie schenkt ein, mixt Cocktails. Bei einem sehe ich genauer hin: Wermut, Gin, eine klare grüne Flüssigkeit, ein Blatt Minze. Ganz zum Schluss lässt sie eine Perle hineinfallen. Offenbar ist sie essbar. Ich bin wie gebannt.
»Was ist das für ein Drink?«, frage ich.
»Wir nennen ihn den Fascinator«, erklärt sie grinsend. »Ziemlich wilder Kampf war das. Du lässt dich doch hoffentlich verarzten, wenn du nach Hause kommst, oder?«
Dass sie mich ausgerechnet jetzt daran erinnern muss.
An Robin. Allein zurückgelassen in unserem Bett, während ich mich rausgeschlichen habe wie eine heimliche Geliebte, wie ein Dieb in der Nacht. Der Gedanke daran löst den nächsten Adrenalinschub aus. Ein albernes Kichern steigt in mir auf. »Es weiß niemand, dass ich hier bin.« Mein Champagnerglas ist schon leer. Wann ist das denn passiert?
»Oh je. Lass mich raten: Rechtschaffener Freund?«
Ich muss schon wieder kichern. Die Barfrau grinst breit. Dann mixt sie einen frischen Fascinator. »Also noch einen Drink aufs Haus.«
Letzten Endes zahle ich auch für einen Drink – nein, zwei, weil ich ihr ebenfalls einen Fascinator spendiere. Als ich mich endlich losreiße, kann ich kaum noch geradeaus laufen. Irgendjemand hilft mir die Treppe hinauf – es könnte Silberpfeil gewesen sein, aber eigentlich auch jeder andere. Im Erdgeschoss sieht alles so aus wie in einem ganz normalen Berliner Stadthaus: eine lang gezogene Eingangshalle mit Mosaikfliesen, grüne Jugendstillampen aus Glas an der Decke. Nichts Ungewöhnliches, mal abgesehen von ein paar Champagnergläsern, die jemand auf den Briefkästen abgestellt hat. Und der Spur aus glitzerndem Konfetti, die sich von der Eingangstür bis zur Kellertreppe zieht. Oder dem Geruch nach Wein, Zigaretten und teurem Parfüm. Ziemlich eindeutige Hinweise, wenn ich so darüber nachdenke.
Draußen hat die Nacht offenbar vergessen, dass sie dunkel sein sollte. Straßenlaternen brennen, Neonreklame blinkt, Schaufenster und Cafés sind hell erleuchtet. Aus jedem offenen Fenster, jeder offenen Tür dringt Musik auf die Straße. Hauptsächlich Elektro-Swing oder Elektro-Jazz. Elektro eben.
Es hat aufgehört zu regnen. Der Duft von Frühling liegt in der Luft, heiß ersehnt nach einem langen Winter. An der ersten Straßenecke, die ich erreiche, steht ein Drehorgelspieler. Da wird mir klar, dass ich in die falsche Richtung laufe, und ich drehe um. In der anderen Richtung stoße ich an einer Kreuzung auf eine Frau mit weißem Kopfhörer, die sich über ein Mischpult beugt. Ihre Musik ist faszinierend, im einen Moment aufputschend, im nächsten melancholisch. Ich schiebe mich durch die Menge der Zuschauer vor ihrem Pult. Die Leute trinken, tanzen, schubsen sich. Lachen und rauchen, sehen schweigend zu. Ich will bleiben, will tanzen, aber ich war schon zu lange hier draußen.
Umgeben von Musik, Gelächter und grellen Lichtern gehe ich zur U-Bahn. Leuchtende Schilder mit einem großen »U« darauf kennzeichnen die Haltestellen. Diese hier heißt Ku’damm. Hüpfend gehe ich die Treppe hinunter. Der Alkohol hat die Schmerzen vertrieben. Jetzt könnte ich wieder fliegen. Wieder in Silberpfeils faszinierenden Geist eintauchen, die klimpernden Glasperlen spüren, Sterne, die vom Himmel fallen. Den Rausch des Kampfes genießen, ohne mich verstecken zu müssen, ohne um mein Leben zu fürchten, jeder Schlag ganz ich selbst. Den Rausch von Schmerz, Adrenalin, Alkohol, Musik, dem Publikum, dem Pärchen, das mich angefeuert hat. Ihre Hand auf seiner Brust, seine Lippen an ihrem Ohr … meine Faust, die gegen Silberpfeils Kiefer kracht. Ihr Geist. Ihre Lippen, so dicht an meinen, als sie mir aufgeholfen hat.
Oh, Maria! Hoffentlich ist Robin nicht aufgewacht, während ich weg war.
Als ich in der altmodischen, ratternden Bahn sitze, versuche ich mich daran zu erinnern, wann ich am Morgen aufstehen muss. Doch selbst als es mir wieder einfällt, tut das meinen Glücksgefühlen keinen Abbruch. Morgen müssen wir uns mit dem Repräsentanten des Weißen Hofes treffen – um unsere Rückkehr nach London zu besprechen. Und in einer Woche werde ich wieder dort sein. In einer Woche werde ich Berlin verlassen und wieder Handschuhe tragen, Devotionsknickse machen und nicht an das Fallbeil denken, das ständig über meinem Kopf schwebt. In einer Woche bin ich wieder im Gläsernen Turm.
Ich lehne den Kopf ans Fenster und drücke die Finger an die Scheibe. Dann sollte ich die Zeit besser nutzen.
Am Bahnhof Französische Straße steige ich aus. Hier ist es ruhiger, ein respektables Viertel. Ich gehe die Friedrichstraße hinauf, bis ich Unter den Linden ankomme, auf dem größten Boulevard von Berlin. Groß und grau ragen die Bäume in den Nachthimmel auf. Inzwischen ist es so spät, dass sogar die Beleuchtung am Brandenburger Tor ausgeschaltet ist. Links davon befindet sich unser Nobelhotel, das Altair. Ich gehe über den roten Teppich, unter einem ebenfalls roten Baldachin hindurch und trete ein. Die Hotelhalle erstrahlt in goldenem Licht. Hohe Decken, Marmorboden, geschmackvolle Blumenarrangements an den Wänden. Eine Galerie zieht sich um die gesamte Halle, in der Lobby warten ausladende Sessel auf die Gäste. Normalerweise sitzen dort immer Besucher und trinken nepalesischen Tee, blättern in amerikanischen Zeitungen oder essen Gebäck aus Rom, aber um diese Uhrzeit ist nur der Nachtportier zu sehen. Er zeigt keinerlei Reaktion, als ich das Hotel betrete. Ein äußerst diskreter Mensch.
Der Fahrstuhl klingelt leise, als er das oberste Stockwerk erreicht. Die Königssuite. Ich schleiche hinein, ohne das Licht anzumachen. Brauche ich auch nicht, denn von draußen fällt genug Helligkeit ein: Unter mir breitet sich die gesamte Stadt aus mit ihren funkelnden Wolkenkratzern, beleuchteten Häusern und grellen Werbetafeln. Und das alles scheint durch die riesige Fensterfront im Wohnzimmer. Ich schiebe mich an dem Flügel vorbei, auf dem Robin vor dem Schlafengehen gespielt hat.
Na ja. Zumindest bevor er schlafen ging.
Ich habe jahrelange Erfahrung darin, mich irgendwo rein und raus zu schleichen. Allerdings nicht, wenn ich so betrunken bin. Betrunken und berauscht. Trotzdem schaffe ich es wohl, mich einigermaßen leise zu waschen, meine Kleidung zu verstecken und sämtliche sichtbaren Verletzungen zu versorgen. Als ich aus dem Bad komme und mich auf die Matratze sinken lasse, rührt sich Robin nicht einmal. Er atmet nur. Atmet leise und gleichmäßig weiter.
Nachdem ich unter die Decke geschlüpft bin, drehe ich mich zu ihm. Im Schlaf sieht er so friedlich aus. Selbst sein markantes Kinn scheint weicher zu sein. Sein schlanker Körper ist von der weißen Decke verhüllt, die sogar noch bleicher ist als seine Haut. An einer Seite ist sie verrutscht, sodass ich das Muttermal an seinem Brustkorb erkennen kann. Das habe ich in unserer ersten Nacht hier in der Stadt entdeckt. Ein starker Kontrast zu all der Blässe.
Am liebsten würde ich jetzt über seine Wange streichen, über seinen Hals. Über die weiche Haut an seiner Hüfte.
Noch vor wenigen Stunden lag ich ebenfalls hier, spürte seine Lippen an meinen. Ließ die Fingerspitzen über seine Rippen gleiten. Holte Luft und ließ sie tiefer wandern. Ein wohliger Schauer lief über seinen Körper.
Und dann haben wir es nicht getan. Wir sind nicht weitergegangen. Das haben wir noch nie getan, nicht in London und nicht in Paris, und ich weiß gar nicht, warum ich jedes Mal zögere. Warum er zögert. Es fühlt sich an, als liefe uns die Zeit davon, was mich unter Druck setzt. Mich jedes Mal erstarren lässt, wenn ich die Decke ganz herunterziehen könnte. Sollte es ganz spontan geschehen, wäre es in Ordnung, aber wenn ich vorher darüber nachdenke, vermassele ich es einfach.
Außerdem … Was, wenn ich etwas falsch mache? Ich habe keinerlei Erfahrung auf diesem Gebiet und auch nur eine vage Vorstellung davon, wie es sein sollte: eine eheliche Pflicht, die durchlitten wird, nichts Erfreuliches.
Und wenn es das wirklich nicht ist? Erfreulich, meine ich.
Heute Abend war ich sowieso zu rastlos. In meinem Kopf drehte sich alles um London und den Weißen König. Um Erinnerungen an die vergangenen Monate, an die unumkehrbaren Veränderungen in meinem Leben. Ist es tatsächlich noch nicht einmal ein halbes Jahr her, dass ich in London zum Undercover-Bodyguard des Prinzen berufen wurde? Anfang Januar kam ich das erste Mal an den Weißen Hof; im März bin ich nach Paris geflohen. Jetzt haben wir Mai, und es sollte eigentlich bald Sommer sein, allerdings wurden wir bisher fast nur mit Regen und schweren, tief hängenden Wolken beglückt. Kein halbes Jahr ist vergangen, seit ich Ninon und Blanc kennengelernt und mich in Robin verliebt habe. Und trotzdem kommt es mir so vor, als würde ich sie alle schon mein Leben lang kennen. Noch immer überläuft es mich eiskalt, wenn ich an den Moment zurückdenke, als ich herausfand, dass der König nicht Robins leiblicher Vater ist und dass er deshalb Robins Tod wollte. Oder daran, wie Ninon und ich dafür gesorgt haben, dass der König das alles vergisst, was uns beide fast das Leben gekostet hätte. Als ich anschließend mit ihr, Blanc, René, dem Comte und Liam nach Paris ging, hoffte ich, endlich Frieden zu finden. Welch eine Ironie, dass ich dort ausgerechnet von meiner eigenen Mutter gejagt wurde. Die mich dann dazu brachte, nach London zurückzukehren, um im Palast für sie zu spionieren – alles unter dem Vorwand einer angeblichen Verlobung mit Robin. Wer hätte gedacht, dass Robin einem solchen Wahnsinnsplan zustimmen würde? Dass ich zustimmen würde?
Ja, vor wenigen Stunden lag ich hier und schlug mich mit Gedanken an Robin, an Aufruhr, Rebellion und Magdalenen herum. Dabei konnte ich hören, wie die Kreatur schnüffelnd unter unserem Bett herumkroch. Irgendwann schlief ich ein und hatte diesen furchtbaren Traum, in dem London in Flammen stand, so heiß brannte, dass sogar das ganze Glas schmolz. Die Schreie rissen mich aus dem Schlaf, Schreie von Menschen, die in ihren gläsernen Häusern eingeschlossen waren. Danach warf ich mich nur noch im Bett herum. Ich konnte einfach nicht bleiben.
Jetzt bin ich nicht mehr rastlos. Meine Angst ist verflogen. Mein Geist erstrahlt in Glückseligkeit. Heute war ich das Kind einer Nacht ohne Dunkelheit. Heute habe ich mich einem Kampf ausgeliefert, der schmerzhaft sein sollte, es aber nicht war. Ich habe Fremden ein Lächeln geschenkt, das sie mir zurückgaben, habe mich von berührender Musik verzaubern lassen und wurde von dieser Stadt willkommen geheißen, die so hell erstrahlt, so brutal kämpft, den Rhythmus im Blut hat.
Diese Nacht gehörte allein mir. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemals etwas gegeben hat, das so voll und ganz mir gehört hat.
»Rea?«
Ich erstarre.
Robins Augen sind offen, wenn seine Lider auch schwer erscheinen. Mit rauer Stimme fragt er: »Wie spät ist es?«
»Noch nicht Zeit aufzustehen«, antworte ich so leise wie möglich, damit er das Zittern in meiner Stimme nicht hört.
»Gut.« Er tastet nach meiner Hand. Die Seidenstränge in seinem Geist sind angespannt, fest um das Bild eines Mannes geschlungen: den Repräsentanten des Weißen Hofes. Ich bin ihm nie begegnet, aber Robin erinnert sich an ihn, den Count Vaisey von Nottingham und Hannover. Da er gerade daran denkt, kann ich Robins Erinnerung deutlich sehen: ein großer Mann von beeindruckender Statur mit einem verschlagenen Lächeln. So lächeln die Ritter der GVK, wenn sie den Befehl erteilen, einem Hautstreicher die Handschuhe an der Haut festzunähen.
»Ist alles in Ordnung?«, fragt Robin, als er merkt, wie ich erschauere.
»Ja«, sage ich. Er verschränkt unsere Finger miteinander, bevor er wieder die Augen schließt. »Gut. Das ist gut.«
Unter dem Bett höre ich die Kreatur winseln. Sie existiert nur in meinem Kopf, halte ich mir vor Augen. Ein Symptom des Geistesfiebers, der Krankheit, gegen die ich tagtäglich ankämpfe. Schon seit ich denken kann, leide ich darunter: Die Kreatur war immer an meiner Seite, groß, grau, pelzig. Manchmal schnüffelt sie nur an meinen Beinen, manchmal ist sie so stark, dass sie schwer auf meine Brust drückt, bis ich mich nicht mehr rühren kann. In Paris war ich deswegen bei einer Ärztin, die mir erklärte, dass ich bisher Glück gehabt hätte, denn wenn Geistesfieber nicht behandelt wird, kann es katastrophale Ausmaße annehmen. Manche Patienten hat es in den Wahnsinn getrieben: Bei ihnen wurde die Kreatur so groß und mächtig, dass sie irgendwann nicht einmal mehr wussten, wer sie sind. Oder sie verfielen in eine Art Blutrausch, bekamen rot glühende Augen und endeten in einem Koma, aus dem sie nicht wieder aufwachten. Niemals wieder. Magdalenen können durch die Krankheit sogar ihre besonderen Fähigkeiten verlieren: Maltoren können nicht länger Gefühle erkennen und Schmerzen nehmen oder geben, wenn sie jemanden berühren; Memexe sind nicht mehr dazu in der Lage, bei Hautkontakt in den Erinnerungen eines anderen zu lesen; und Mensatoren wie ich verlieren die Fähigkeit, Gedanken zu lesen und zu verändern. Sogar Schnüffler erkennen keine anderen Magdalenen mehr. In Fällen des Blutrausches haben die Patienten sowohl Angehörige als auch Fremde angefallen und verstümmelt, jeden, der ihnen zu nahe kam. Eine beängstigende Vorstellung.
Aber seit Paris nehme ich Medikamente dagegen, war bei einem Therapeuten. Und es wird besser. Auch wenn ich glaube, dass das nicht nur an den Medikamenten liegt, sondern ebenso an Paris, an Berlin. Daran, dass ich endlich frei sein kann. In diesen Städten fühlt es sich so an, als könnte die Kreatur mir nichts anhaben.
Das wird sich in London ändern. Ich weiß, dass ich dort keine Therapiesitzungen mehr bekommen werde, nicht einmal übers Internet. Meine Ärztin in Paris hat mir davon abgeraten, zurückzugehen. Aber ich kann es schaffen. Wie all die Jahre zuvor. Ich kann nach London zurückkehren, dort für meine Freiheit kämpfen und irgendwann diese grässliche Kreatur ganz loswerden.
Das wäre wirklich zu schön, um wahr zu sein.
Lasst London brennen.
Das Feuer ist so heiß. Weiß glühend wie Schneequarz. »Feuerschwester!«, rufen sie. Überall Feuerseide. Rot wie die Flammen. Rot wie das Blut.
Lasst sie brennen.
Am nächsten Morgen fühlt es sich an, als wäre mein Kopf explodiert. So habe ich noch nie gelitten. Eine eiserne Faust scheint meinen Ellbogen zu zerquetschen. Und meine Oberschenkel. Mein Sprunggelenk. Und mein Kopf … Oh, Maria! Was ist mit meinem Kopf passiert? Warum bohrt der Ball aus Eis seine pulsierenden Splitter in die Wände meines Geistes? Warum hat sich das Feuer in meinen Hals ausgebreitet, in meine Adern, und trocknet sie aus?
Aber am schlimmsten ist es, so tun zu müssen, als wäre alles in bester Ordnung, während Robin mich mit einem Kuss auf die Wange weckt. »Das ist wohl das erste Mal, dass ich vor dir auf bin. Raus aus dem Bett, zwielichtige Fremde, bevor meine Anstandsdamen dich hier finden!«
Ich presse einen nicht identifizierbaren Laut aus meiner Kehle. Seine Finger gleiten herrlich kühl über meine Schläfen und meine Stirn.
»Geht es dir wirklich gut, Rea?«
»Hab schlecht geschlafen«, murmele ich und schmiege mich noch fester an seine Hand. Er beugt sich über mich und nimmt mich einen Moment lang in den Arm. »Ich würde dich ja weiterschlafen lassen«, flüstert er mir ins Ohr, »aber wir müssen heute beim Count of Nottingham Eindruck schinden. Er darf keinen Verdacht schöpfen.«
Mein Mund wird noch trockener. Mühsam stehe ich auf und ziehe an, was Robin mir gibt: ein weißes Kleid und einen Marienkragen, beides aus Spitze, ebenso wie die Handschuhe. Sogar eine alberne kleine Kappe gehört dazu und hohe Schnürstiefel. Robin legt mir eine Perlenkette um den Hals. Spiritus apertus! Ich schwöre mir, für den Rest des Tages in keinen Spiegel mehr zu blicken. Und auch nicht darauf zu achten, dass die stählerne Faust weitergewandert ist zu meinem Magen, wo sie für leichte Übelkeit sorgt. Oder auch schwere.
Als wir in die Lobby hinunterkommen, steht unsere Entourage schon bereit: vier Kaiserliche Wachen, geschickt von Kaiserin Dana. Dann natürlich Mister Galahad, sogar noch korrekter gekleidet als sonst mit einer Brokatjacke und einem Marienkragen, wie er höher nicht sein könnte. Sein Gesicht ist weiß geschminkt. Neben ihm wirkt René nur noch mehr wie ein Freigeist. Er trägt Hemd und Hose, beides mit vielen bunten manchettes geschmückt. Sein taillierter Mantel ist mit breiten Streifen in Grün, Gelb, Blau und Violett verziert, die sich zu eleganten Mustern verbinden. Sein Gehstock ist so grün wie die Nadelwälder an der Ostküste der Vereinigten Staaten und in Kanada. Dazu bietet der Hemdausschnitt nicht nur einen freien Blick auf Hals und Schlüsselbeine, sondern lässt sogar den Ansatz seiner Brustmuskeln erahnen. Er trägt Eyeliner und natürlich keine Handschuhe.
»Bonjour«, begrüßt er mich und ergreift meine Hand. »Oder sollte ich besser Guten Morgen sagen?« Er haucht einen Kuss auf meinen Handrücken. Als seine Lippen die feinen Löcher in meinen Spitzenhandschuhen streifen, verkrampfe ich mich. Falls noch geistige Wunden von letzter Nacht geblieben sind, wird er sie bemerken.
Doch ihm scheint nichts aufzufallen, denn er lässt kommentarlos meine Hand los und begrüßt mit einem Kopfnicken den Prinzen. Sobald René aus dem Krankenhaus entlassen wurde, zwang Capitaine Jean René dazu, Urlaub zu nehmen, weshalb er spontan beschlossen hat, mit uns nach Berlin zu kommen. »Wer könnte ein besserer Fremdenführer sein als ich, wenn es um meine erste und einzig wahre Liebe Berlin geht?«, lautete sein Argument. Während er sprach, hielt ich gerade seine Hand, und so sah ich in seinen Gedanken seine Eltern vor mir und diese Stadt, deren Straßen er besser kennt als die Pfade seines eigenen Geistes. Und die er schon so lange nicht mehr besucht hatte.
Der Comte und Blanc haben versprochen, am Wochenende zu uns zu stoßen. Liam ist bereits mit seinem Kater Beethoven nach London weitergereist, um uns eine Wohnung zu suchen und ein paar Kontakte von Madame Hiver aufleben zu lassen – gegen meinen ausdrücklichen Protest.
Kaum war Liam wieder auf der Insel, wurde er auch schon am Weißen Hof vorgeladen. »An ein zukünftiges Familienmitglied«, stand auf der Einladung, die von Ihrer Majestät der Königin unterzeichnet war. Fast hätte er sie zerrissen. Aber nur fast.
Mister Galahad verbeugt sich vor uns. Er wirkt immer noch ziemlich mitgenommen. Die Gedankenkontrolle durch meine Mutter hat ihre Spuren in seinem Geist hinterlassen. Er sieht uns nicht direkt an. »Guten Morgen, Miss Emris, Königliche Hoheit. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Nachtruhe?«
»Recht angenehm, ja«, antwortet der Prinz. Er hat sich ebenfalls herausgeputzt, schwarzer Brokat mit silbernen Samtaufschlägen, dazu das königliche Diadem. Und das alles für den Count of Nottingham.
»Ja, danke«, sage auch ich. Ohne mir ins Gesicht zu sehen, führt Mister Galahad uns zum Frühstücksraum. Er geht dicht neben Robin her. Lächelnd bietet René mir seinen freien Arm an. Seine Beine zittern noch immer leicht, wenn er steht. Als ich mich einhake, drückt er seine nackte Hand auf meinen durchlässigen Handschuh.
»Obwohl du nicht sonderlich viel geschlafen hast, würde ich wetten«, stellt er sachlich fest.
Eine Glasmurmel rollt durch meinen Geist. Klickend prallt sie gegen den Eisball. Ich zucke zusammen. Dann verschwindet sie. Fast so, als wäre sie von einer heilenden Hand entfernt worden.
Entgeistigte Maltoren.
René lacht nur, als ich diesen Gedanken laut ausspreche. »Um ganz ehrlich zu sein – es waren die eindeutigen Anzeichen eines Katers, die mich auf die richtige Spur gebracht haben. Warst du in der Schnellen Faust oder in der Seidenhöhle?«
»In der Seidenhöhle. Woher kennst du diese Läden?«
»Oh, das sind einfach die Hot Spots, wenn man jung ist, in Berlin lebt und seine ersten Schritte auf dem Gebiet der Geistesheilung macht. Ich muss dich allerdings warnen.«
Ich seufze. Natürlich muss er das. »Es wird nicht wieder vorkommen.«
Mit leidgeprüfter Miene sieht er mich an. »Es verletzt mich, dass du mir immer noch nicht ausreichend zu vertrauen scheinst, da du eine so absurde Lüge für notwendig hältst.« Ich will protestieren, während wir zwischen den Lobby-Sesseln hindurchgehen. Mister Galahad und der Prinz sind uns ein ganzes Stück voraus. René sorgt dafür, dass wir langsamer werden und der Abstand sich noch vergrößert. »Ich wollte dich gar nicht davor warnen, dort wieder hinzugehen. Ich wollte dich davor warnen, nicht zurückzukommen.«
Das entlockt mir ein Schnauben. »Natürlich komme ich zurück. Ich kann schließlich schlecht in der Seidenhöhle einziehen, oder?«
»Das meine ich nicht.« Er senkt die Stimme. »Gewalt ist eine Falle, Rea. Sie verschafft dir einen Höhenflug, durch den man leicht die Bodenhaftung verliert. Glaub mir, ich weiß das.«
Plötzlich fällt mir wieder ein, was der Comte einmal gesagt hat. Wenn es eines gibt, was man einem Heiler nicht begreiflich machen kann, dann ist es das Bedürfnis nach Schmerz.
»Außerdem kann ich mir kaum vorstellen, dass Seine Königliche Hoheit sonderlich begeistert davon ist«, fügt René hinzu.
Wie gut, dass er damit die Stimmung wieder etwas auflockert. »Deshalb soll es ja auch ein Geheimnis bleiben.«
Nun bleibt René ganz stehen. »Rea. Wie soll er dich je richtig kennenlernen, wenn du ihn belügst?«
Prüfend sehe ich ihn an. Weiß er es? Weiß er, dass der Comte und Blanc sich draußen im Hof gegenseitig verprügeln, wenn sie es nicht mehr aushalten, so zu tun, als wären sie unversehrt? Nicht einmal um seinetwillen?
»Wie könnte er mich lieben, wenn ich es nicht tue?«
René macht Anstalten, etwas darauf zu sagen, aber da ruft der Prinz nach mir.
»Rea? Kommt ihr?«
Er steht an der Tür zum Frühstücksraum, die Mister Galahad bereits für ihn aufhält.
Drinnen sind noch mehr Kaiserliche Wachen an den Wänden aufgereiht. Das überrascht mich nicht. Immerhin müssen sie nicht nur den Kronprinzen von England und Wales beschützen, sondern auch seine Geschwister, Prinz William und Prinzessin Victoria. Die Zwillinge sitzen bereits an einem runden Tisch im hinteren Teil des Saals. Als wir eintreten, steht Victoria auf und winkt uns zu. Mit wild wedelnden Armen zieht sie Robin an sich. Dabei ist sie um einiges kleiner als er, nur ungefähr so groß wie ich. In jeder anderen Hinsicht ist sie allerdings das komplette Gegenteil von mir: Sie hat die Augen ihres Vaters, und ihre Haare wurden so stark gebleicht, dass sie bläulich schimmern. Schockiert muss ich feststellen, dass sie Nagellack trägt.
»Herzlichen Glückwunsch«, begrüßt sie ihren Bruder. »Du hast es eine ganze Nacht lang geschafft, weder umgebracht noch entführt zu werden. Ich führe da genau Buch drüber, weißt du?«
»Guten Morgen, Nerverl«, murmelt Robin peinlich berührt. Er hat mir bereits erzählt, dass William und er die Schwester Nerverl nennen, weil … nun ja. Manchmal kann sie einem wohl ein wenig auf die Nerven gehen. Mister Galahad räuspert sich, aber sie lässt einfach nicht los. Seufzend erwidert Robin die Umarmung, bis sie ihn schließlich freigibt. Vermutlich bin ich die Einzige, die das selige Grinsen bemerkt, das über sein Gesicht huscht. Prinz William ist ebenfalls aufgestanden. Auch er hat große Ähnlichkeit mit dem Vater, wirkt wie eine ruhigere, schüchterne Version von ihm. Die gebleichten Haare fallen ihm in die Stirn.
»Guten Morgen, Miss Emris«, sagt er förmlich, greift nach meiner Schleppe statt meiner Hand und haucht einen Kuss darauf. Ich sinke in einen Devotionsknicks. Leichte Übelkeit breitet sich in mir aus.
»Oh, bitte, Will, lass uns mit diesem Schleppenquatsch erst anfangen, wenn wir wieder im öden England sind«, protestiert Victoria und drückt mich an sich. Obwohl ihre Arme ziemlich kurz sind, ist das die stürmischste Umarmung, die ich je genießen durfte. Sie lässt Erinnerungen an ein Holzhaus an der Ostküste in mir aufsteigen, an ein kleines Kind, das vor vielen Jahren mit Bruder und Mutter im Garten spielte. »Wir sind doch schließlich so etwas wie Schwestern, oder?«, sagt sie.
»Hoheit«, rügt Mister Galahad.
»Das reicht jetzt, Nerverl«, meint auch Robin und sieht sich verstohlen um. Schon jetzt haben wir die allgemeine Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Er beugt sich zu seiner Schwester. Da Victoria mich noch immer festhält, kann ich hören, wie er ihr zuraunt: »Wenn wir uns heute mit Count Nottingham treffen, dürfen wir uns keinerlei Indiskretion erlauben.«
Während Victoria sich auf ihren Platz setzt, wirft er mir einen besorgten Blick zu, sagt aber nichts. Wir haben bereits über Count Nottingham gesprochen; Robin kennt ihn nicht gut, weiß aber, dass Nottingham nachgesagt wird, sich vor allen Dingen in Geheimdienst- und Militärkreisen zu bewegen. Grund genug, ihm gründlich zu misstrauen, da sind wir uns beide einig.
Denn wir sind zwar unter dem Vorwand nach Berlin gekommen, hier seine Geschwister zu treffen, um dann mit ihnen gemeinsam nach England zu reisen. Aber das ist nicht der wahre Grund unseres Besuches.
Sondern der Seidene Hof.
»Dort kann man uns helfen«, erklärte Robin flüsternd, als wir, noch in Paris, gemeinsam im Bett lagen. Angespannt ließ er die Finger über meine Handfläche gleiten. »Der Seidene Hof könnte uns dabei helfen, den Umsturz auf unsere Weise herbeizuführen, und nicht so, wie sie ihn gerne hätte.«
Sie hat sich bei mir gemeldet. Das tut sie ständig. Mein Telefon vibriert, als gerade der Tee eingeschenkt wird. (Der gnadenvolle René bestellt sich eine Riesenportion Pfannkuchen und eine Kanne Kaffee und teilt beides mit mir.) Ich werfe nur einen kurzen Blick auf das Display.
Verschlüsselte Nachricht. Der Absender ist klar.
Viel Glück heute.
Madame Hiver.
Am liebsten würde ich ihr als Antwort einen Kraftausdruck schicken, den ich in der Seidenhöhle gelernt habe: Leck mich. Doch bevor ich es ernsthaft in Erwägung ziehen kann, kommt schon die nächste Nachricht.
Seid vorsichtig. Sehr vorsichtig.
Ich runzele die Stirn. Robin wirft mir einen fragenden Blick zu, aber ich schüttele nur den Kopf, will ihn nicht beunruhigen. Wenn allerdings Madame Hiver wegen Count Nottingham ebenfalls besorgt ist, ist es doppelt angebracht, keine Indiskretion zu riskieren. Sie kennt sich in Geheimdienstkreisen noch besser aus als wir. Schnell beuge ich mich zu René hinüber und bitte ihn, mir nachher mit meinem Make-up zu helfen. Und als Victoria das nächste Mal etwas zu laut wird, muss ich mich zurückhalten, um ihr nicht ebenfalls über den Mund zu fahren.
Sobald das Frühstück beendet ist – das mit einer fantastischen Speisenfolge aufwartet, unter anderem Crêpe-ähnlichen Pfannkuchen mit eingebackenen Apfelstückchen und Zimt oder verschiedenen dunklen Brotsorten, auf die man erst Butter streicht, bevor man den Käse darauflegt (es ist auch diverses Fleisch im Angebot, das ich allerdings meide) – , kehren wir kurz auf unsere Zimmer zurück. René geht mir beim Make-up zur Hand. Robin hält es ungefähr fünf Sekunden lang aus, dann greift er ein. Die beiden diskutieren eine ganze Weile über Grundierung, Highlighter und Ähnliches, bis ich mich hörbar räuspere. Letzten Endes übernimmt Robin die Feinarbeit. »Woher kannst du das?«
Leichte Röte steigt in seine Wangen. »Die Verbannten haben es mir gezeigt.«
Er meint die Theatertruppe, deren Vorstellung wir in den Heiligen Höfen von London besucht haben. Sie sind momentan auch in Berlin und geben ihr letztes Gastspiel, bevor sie wie wir nach London zurückkehren. Dass wir sie hier noch einmal auf der Bühne erleben werden, ist nur ein schwacher Trost. Ich beobachte Robins Gesicht im Spiegel – so konzentriert, eifrig. Seine Augen funkeln richtig. »Irgendwann musst du mir mal verraten, was das ist mit dir und dem Theater.«
»Da habe ich eine bessere Idee. Irgendwann könnten wir unsere eigene Truppe gründen.«
Ich lache laut auf. »Zunächst einmal hat das nackte Überleben für mich Priorität.«
Seine Miene bleibt ernst. »Und doch wär’s ein Wunderding.«
Wieder lache ich darüber, trotzdem bleibt die Idee hängen, während wir in die Lobby hinuntergehen und in die bereitstehende Limousine steigen. Unsere eigene Schauspieltruppe.
Oh, Maria! Was würde meine Mutter sagen, wenn sie mich hören könnte?
Nicht meine Mutter, rüge ich mich. Madame Hiver.
René kommt nicht mit. Blanc und der Comte haben ihm vor seiner Abreise eindringlich klargemacht, dass er sich in nichts verwickeln lassen darf, was auch nur annähernd gefährlich sein könnte. So sitze ich nun allein mit Robin auf unserer Seite der Limousine. Wir haben die Finger ineinander verschränkt, tragen aber Handschuhe. Gegenüber sitzen Prinzessin Victoria, Prinz William und Mister Galahad. Wir sind alle angespannt, aber bei Mister Galahad ist es am schlimmsten. Immer wieder rutscht er auf seinem Sitz herum, entschuldigt sich dann murmelnd bei den Hoheiten, wirft mir verstohlene Blicke zu, wenn er denkt, dass ich es nicht bemerke. Seit der Gedankenkontrolle ist er nicht mehr derselbe. Manchmal frage ich mich, ob er noch unter Folgeerscheinungen leidet, obwohl er danach von äußerst fähigen Maltorologen behandelt wurde – Maltoren, die auch Medizin studiert haben. Sie haben ihm versichert, dass sein Geist vollkommen wiederhergestellt sei, als wäre nie etwas passiert. Das hat mich sehr erleichtert, da es bedeutet, dass auch Ninon und ich damals in der Stahlkammer keine bleibenden Schäden in seinem Geist hinterlassen haben.
Aber ich habe auch gehört, wie die Maltorologen miteinander getuschelt haben, dass diese Gedankenkontrolle einfach perfekt gewesen sei, fast schon kunstvoll. Um sie aufzuheben, mussten sie das gedankliche Gewebe zerstören, von dem sie umgeben war, inklusive der verknüpften Erinnerungen, weshalb es hinterher unmöglich war, den Schuldigen zu identifizieren. Madame Hiver überlässt eben nichts dem Zufall. Während der Fahrt wird mir bewusst, wie sehr ich Paris vermisse, obwohl ich mich auch in Berlin bereits verliebt habe. Diese Stadt hier ist so … anders. Selbst ihre breiten Boulevards unterscheiden sich von denen anderer Hauptstädte. Hier gibt es mehr Schatten, mehr schummrige Ecken. Wie aus dem Nichts tauchen immer wieder Gebäude auf, die gar nicht zu ihren Nachbarn passen. Die einem zuzuzwinkern scheinen, klein und schmal und heruntergekommen, wie sie sind. Überall stehen Litfaßsäulen herum, auf denen offizielle Ankündigungen in einer Flut von Aufklebern und Pamphleten untergehen. Während wir vorüberfahren, grinsen sie mich an, fast so, als wüssten sie, dass ich mir am liebsten die Nase an der Scheibe platt drücken würde, um das alles zu lesen – Konzerte im Untergrund. Dichterlesungen. Öffentliche Wochenmärkte. Illegale Wettkämpfe. (Auch im Fechten, was ich sofort dem Comte schreibe. Dabei finde ich eine Nachricht von Liam: Wünschte, du wärst hier. Dazu ein Foto des viel zu weißen St. James’s Parks.) Es gibt so viel zu sehen, so viel zu tun.
Irgendwie kann ich noch nicht wirklich glauben, dass wir nicht hierbleiben werden. Dass Robin und ich nicht einfach die nächsten zwei Jahre in der Welt herumreisen werden. Oder dass ich nicht mal eben mit Liam einen Wochenendausflug nach Salzburg machen kann. Dass Ninon und ich nicht ein Jahr lang ziellos von einer Stadt zur nächsten gondeln dürfen.
Stattdessen kehren wir in den Gläsernen Turm zurück.
Ich verflechte meine Finger mit Robins. Das englische Königshaus hat keine Ahnung, was auf sie zukommt.
Bis zum Palast der Kaiserin ist es nicht weit. Robin hat ihn mir beinahe ehrfürchtig beschrieben. Er war das letzte Mal dort, als die neue englische Botschaft eingeweiht wurde. Früher war sie in direkter Nachbarschaft des Altair, ist dann aber auf der Prachtstraße ein Stück aufgerückt, als Räumlichkeiten direkt im Palast bereitgestellt wurden. Nun befindet sie sich in dem opulenten Stadtschloss: drei Stockwerke mit hohen Fenstern, einer mittig in der Front gelegenen Kuppel und wie von Grünspan eingefärbtem Dach. In gewisser Weise sieht es aus wie das genaue Gegenteil der grellen, frechen Litfaßsäulen: Sie arbeiten, während das Schloss über ihnen thront. Sie spotten, wo das Schloss majestätischen Glanz verströmt.
Wir werden bis vor den Eingang gefahren. Dort warten bereits acht Ritter der Garde Ihrer Majestät auf uns. Sie tragen die gleichen Abzeichen wie die Mousquetaires in Paris: einen geöffneten Kreis in allen Farben des Regenbogens. Es tut gut, ihn zu sehen.
Mister Galahad geht vorweg. Drinnen sind Wände und Teppich überraschenderweise komplett schwarz. Trotzdem ist es nicht dunkel, denn überall sind funkelnde Lichter angebracht worden, nicht nur an der Decke, sondern auch an den Wänden und im Boden. Es fühlt sich an, als wandere man umgeben von Sternen durch den Nachthimmel. Sie bilden Muster und Konstellationen, dichte Kreise wie die Andromeda-Galaxie, Bänder wie die Milchstraße, breite Fächer wie der Schweif eines Kometen. Rechts und links fließt Wasser durch zwei schmale Kanäle. Es ist silbern, als wäre es mit feinem Glitzerstaub versehen. Doch alles ist lautlos. Es herrscht absolute Stille. Oder dringt da ein Pulsschlag durch den Boden? Pulsiert das Wasser? Die Wände?
Es hat etwas Magisches an sich, so durch die Nacht zu schreiten. Magisch, aber auch verstörend. Ich verliere völlig die Orientierung, weshalb ich erschrocken zusammenzucke, als wir plötzlich stehen bleiben. Einer der Ritter streckt die Hand aus. Wenn ich die Augen zusammenkneife, kann ich den Umriss einer Tür erahnen. Ist der Korridor hier zu Ende?
»Vorsicht«, murmelt Robin, als er ein letztes Mal meine Hand drückt. Ich will ihn gerade fragen, was er damit meint, als der Ritter plötzlich die Tür öffnet.
Das Licht trifft mich wie ein Schlag in den Magen. Ich weiche einen Schritt zurück, hebe abwehrend die Hände. Robin rückt etwas näher an mich heran, wohl um mich abzuschirmen, aber er hat selbst zu kämpfen. Licht und Musik, laute Musik. Im ersten Moment klingt es bloß wie Lärm, doch dann erkenne ich ein Saxofon, ein Klavier, alles abgemischt. Elektro-Swing. Vor uns befindet sich ein prachtvoller Saal voller wild tanzender Menschen. Sie werfen sich gegenseitig in die Luft, lassen sich über den Boden gleiten, wirbeln herum. Artisten hängen, nur von Stoffbahnen gehalten, unter der Decke, in zehn Metern Höhe spazieren Seiltänzer herum oder gleiten an Stangen auf und ab wie Mensch gewordenes Wasser. Das helle Licht ist weiß wie das eines blendenden Mondes. Es stammt von großen Kugeln, die scheinbar schwerelos in der Luft hängen. Sie sind so dick, dass nicht einmal zehn Männer sie mit ausgebreiteten Armen umfassen könnten. In diesem Saal haben sich die unterschiedlichsten Menschen versammelt, eine solche Vielfalt habe ich noch nie gesehen.
Mister Galahad geht als Erster hinein, gefolgt von Prinzessin Victoria, die ein leises Quietschen ausstößt. Noch immer leicht desorientiert trete ich hinter Robin über die Schwelle. Die Kanäle an den Seiten markieren auch hier einen Weg, der sich mitten durch den Saal zieht. Rechts und links sehe ich Tänzer, Künstler und Wachen, aber auch Höflinge. Manche sitzen an leuchtenden, kugelförmigen Tischen und beobachten das Spektakel. Alle tragen glitzernde Kleider und Anzüge, dazu ausladenden Federschmuck – Frauen wie Männer. Wobei einige auch einen Teil ihrer Kleidung eingebüßt haben, ähnlich wie das Publikum in der vergangenen Nacht. Ich kann einfach nicht den Blick von ihnen abwenden. Doch der spektakulärste Anblick wartet am Ende des Saals: ein Thron. Ein Thron, der komplett aus Diamanten besteht und über mehreren Wasserbecken aufragt, umgeben von Lichtkugeln.
Auf diesem Thron sitzt Kaiserin Dana. Erst als wir dicht vor ihr stehen, bemerke ich, dass sie uns anlächelt. »Willkommen, meine Enkel, Miss Emris, Mister Galahad«, begrüßt sie uns auf Englisch. Ich hatte ganz vergessen, wie tief ihre Stimme ist. Sie ähnelt sehr der ihres Enkels, des Kronprinzen. »Willkommen am Neuen Hof.«
Sie trägt eine Krone aus Diamanten, die wie ein Sternbild auf ihrem alten Kopf schimmert. Kleid und Mantel sind gerade geschnitten und umspielen sie wie ein silberner Kometenschweif. Diener sorgen mit großen Federfächern für Kühlung, reichen ihr Trauben und Wein. Ihre braune Haut schimmert, weil eine Dienerin ihr gerade eine klare Lotion auf Arme, Hände und Gesicht schmiert. »Ich hoffe, dir gefällt es in Berlin, Robin? Und Ihnen ebenfalls, Fräulein Emris?«
»Es ist fantastisch«, bringe ich stammelnd hervor. Sie ist eine wirklich beeindruckende Frau. Als sie sich ein kleines Lächeln gestattet, bekomme ich einen Eindruck davon, wie eine grinsende Raubkatze aussehen muss. »Etwas Derartiges haben Sie sicherlich noch nie gesehen, oder?«
Ich blicke mich noch einmal im Saal um. Ganz sicher nicht. Diese Vielfalt an Menschen, von den Höflingen über die Tänzer und Artisten bis zur Kaiserin selbst … »Nein, nicht einmal annähernd, Eure Kaiserliche Hoheit.«
»Wir danken Euch für Eure Gastfreundschaft«, ergänzt Robin, was die Kaiserin mit einem Nicken zur Kenntnis nimmt. »Uns und unseren Geschwistern gegenüber. Wir würden unseren Aufenthalt hier nur zu gerne noch weiter ausdehnen, in Eurer Stadt ebenso wie in Eurem Palast. Und natürlich wären wir gerne nur zum Vergnügen gekommen, ohne einen protokollarischen Anlass.«
Ich bemerke, wie William seinem Bruder einen beeindruckten Blick zuwirft. Die Kaiserin lächelt noch immer. »Du bist ungeduldig, Robin. Das gefällt mir. Ganz wie deine Mutter, würde ich sagen. Und auch wie dein Bruder.«
William lässt den Kopf hängen, während die Kaiserin den Blick durch den Saal schweifen lässt und dann die Hand hebt. »Dann also zum protokollarischen Teil. Begrüßt mit mir einen weiteren Freund in der Runde: Sir Vaisey, den Count von Nottingham und Hannover.«
Meine Muskeln spannen sich an. Vorsichtig sehe ich mich um, suche nach einer großen, Furcht einflößenden Gestalt. Nach einem Lächeln, das kein Lächeln ist. Ich bin bereit, meinem Feind ins Gesicht zu sehen und mit freundlicher Miene seinen Untergang zu planen.
Aber es erscheint niemand auf dem Weg in die Mitte des Saals. Und es dauert einen Moment, bis mir bewusst wird, dass Mister Galahad und Robin sich zur Seite gedreht haben. Dass sie gar nicht auf den Weg schauen.
Sondern auf die Tanzfläche.
Da, ziemlich weit in der Mitte. Ein großer Mann. Gerade schleudert er eine Frau in die Luft, rutscht über den Boden, fängt sie wieder auf. Beide wirbeln herum, er wirft sie, fängt sie, läuft rückwärts. Dann stürmen sie aufeinander zu, sie springt, er hebt sie hoch über den Kopf. Ohrenbetäubender Applaus setzt ein. Er dreht sich im Kreis, genießt ihren Triumph.
Erst als die Musik aufhört, setzt er seine Partnerin ab. Die beiden verbeugen sich voreinander, und unter dem Jubel der Menge verlässt er die Tanzfläche. Er kommt auf uns zu. Er ist groß, er lächelt. Helles Haar, dunkle Augen. Überraschenderweise ist er nicht völlig glatt rasiert, sondern trägt einen schmalen Bart, der sich in einer sorgsam gestutzten Linie über den Bogen des Unterkiefers und das Kinn zieht. Er verleiht seinem Gesicht eine maskuline Eleganz, die ich bei einem solchen Mann nicht erwartet hätte.
»Kaiserliche Hoheit, Hoheiten! Welch eine Ehre! Welch eine Freude!«
Robin will etwas erwidern, aber der Mann wendet sich schon wieder von ihm ab. Und mir zu. Seine Wangen sind gerötet, und seine Augen funkeln, als er sich vor mir verbeugt. »Miss Emris. Das ist wohl die größte Ehre von allen.« Der Count of Nottingham, Mister Galahads Cousin, ignoriert sie alle, jeden einzelnen von ihnen, und streckt mir die Hand entgegen.
»Darf ich bitten?«
Seine Hand ist nackt.
Kapitel 2
Die Kaiserin lacht, Robin ringt sich ein gequältes Lächeln ab. Mister Galahad starrt mit finsterer Miene zu Boden. Betont langsam drehe ich mich zu Nottingham um. Meine heutige Aufgabe besteht allein darin, diesen Mann zu beeindrucken, ihn von unserer Arglosigkeit zu überzeugen, damit wir heimlich unseren Widerstand planen können. Also lächele ich. Freundlich. »Nach dem, was ich gerade gesehen habe, wäre das wohl eher enttäuschend für Euch, Eure Lordschaft.«
»Bitte, nennen Sie mich Vaisey. Oder wenigstens Nottingham, wenn Sie unbedingt auf derlei Förmlichkeiten bestehen wollen.« Er zieht die Hand zurück, doch sein Lächeln bleibt. »Wie ich sehe, muss man sich diese Ehre hart erkämpfen, Miss Emris. Doch ich kann Ihnen versichern: Ich liebe Herausforderungen.«
»Also wirklich, Vaisey, Sie sind unmöglich«, stellt die Kaiserin schmunzelnd fest.
»Ich weiß wirklich nicht, wovon Ihr sprecht, Kaiserliche Hoheit«, erwidert er mit einer allgemeinen Verbeugung. »Cousin, wie schön, dich wiederzusehen«, fährt er dann an Mister Galahad gewandt fort. »Ich hoffe, deinem Vater geht es gut?«
Mister Galahads Blick klebt weiter am Boden. »Ich denke, du bist am besten über seine Lage im Bilde.«
Nottingham legt ihm eine Hand auf die Schulter. »Ich weiß, die Lage ist heikel, aber es gibt nichts, wofür du dich schämen müsstest, mein lieber Freund. Immerhin ist es nicht deine Schuld.«
Mister Galahad presst die Lippen zusammen. Mich überrascht es kaum, dass er nicht über die peinliche Situation seines Vaters sprechen will. Immerhin hat der Duke of Buckingham das gesamte Familienvermögen verspielt, sodass dem Count of Nottingham die Verwaltung ihrer Finanzen übertragen wurde. Letzterer nimmt nun die Hand von Galahads Schulter und wendet sich den Geschwistern zu. »Hoheiten, ich war begeistert, als ich erfahren habe, dass Ihr nach London zurückkehrt. Und ebenso begeistert es mich, dass ich Euch dorthin begleiten werde. Gesetzt den Fall, Ihre Kaiserliche Hoheit kann hier auf mich verzichten.«
Die Kaiserin winkt gelassen ab. Nottingham nimmt von einer Dienerin im glitzernden Kleid eine Champagnerflöte entgegen. Ich folge seinem Beispiel. Die Kälte des Glases dringt durch meinen dünnen Handschuh, gleichzeitig spüre ich die Wärme der Lichter ringsum im Gesicht. »Euer Vater hat mich mit der ehrenvollen Aufgabe betraut, Eure Heimkehr zu organisieren«, erklärt Nottingham Robin und seinen Geschwistern, »und dafür zu sorgen, dass sie mit der angemessenen Grandeur vollzogen wird. Immerhin werdet Ihr, Königliche Hoheit, gleichzeitig auch vor den entzückten Londonern Eure Verlobung bekanntgeben – und Miss Emris der Öffentlichkeit vorstellen.«
Anscheinend merkt man mir an, wie wenig begeistert ich davon bin, denn Nottingham sagt sofort: »Oh nein, machen Sie sich keine Sorgen, Miss Emris.« Und da ist es plötzlich, dieses Lächeln. Das Lächeln aus Robins Erinnerung. »Sie sind genau das, was England jetzt braucht. Ein frischer Wind.«
Er sieht mich durchdringend an, und ich weiche seinem Blick nicht aus. Noch immer lächelnd erhebt er sein Glas: »Auf eine glückliche Rückkehr nach London.« Er zwinkert mir zu. »Und auf einen Tanz mit Miss Emris.«
»Vorsicht, Nottingham«, sagt Robin gedehnt. »Sonst muss ich Sie noch zum Duell fordern.«
Nottingham lacht fröhlich. »Wäre es nicht vielleicht besser, diesen Teil Miss Emris zu überlassen?«
Robin wird kreidebleich. Ich überspiele die Situation mit einem Lachen, spüre aber, wie es in meinen Fäusten kribbelt. Er weiß, dass ich Robins heimlicher Bodyguard war. Nachdem ich dem Kronprinzen zum zweiten Mal das Leben gerettet hatte, ließ sich das nur noch schwer geheim halten. »Nehmt Euch in Acht, Eure Lordschaft. Ich könnte Eurer Bitte nachkommen.«
»Genau darauf baue ich. Sie wissen ja sicher, dass die GVK gerade neues Personal sucht?«
»Auch Frauen?« Mister Galahad ist entsetzt. »Seit wann denn das?«
Nottingham hebt das Glas an die Lippen. »Das war nur ein Scherz, Cousin. Obwohl ich es anfangs in Erwägung gezogen habe. Immerhin erwartet Seine Majestät von mir, dass ich gewisse Neuerungen einführe. Er hat mir die Leitung übertragen. Jemand musste den Posten übernehmen, nachdem der Weiße Ritter uns verlassen hatte.«
»Blanc war aber nicht Captain der GVK, sondern der Palastwache«, stelle ich richtig. Mister Galahad zuckt kurz, doch Nottingham ist ganz auf mich konzentriert, während er antwortet: »Nachdem die Palastwache nicht in der Lage war, einen Angriff auf den König zu verhindern, der noch dazu direkt in der Stahlkammer stattfand, wurde sie mit der GVK zusammengelegt, sodass nun beide unter meinem Kommando stehen.« Wieder dieses Zwinkern. »Falls jemals Frauen zugelassen werden, würde es mich sehr freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen, Miss Emris.«
Robin räuspert sich laut. »Das wäre wohl kaum eine angemessene Beschäftigung für eine Prinzessin, Eure Lordschaft.«
»Sie können auf mich zählen«, sage ich. Nottingham will Spielchen spielen? Es wird ihm noch leidtun, mich herausgefordert zu haben. Diese Art von Spiel spiele ich schon mein ganzes Leben lang.
»Rea«, mahnt Robin. Möglichst unauffällig funkele ich ihn an. Das erwidert er mit einem Stirnrunzeln, ist aber schlau genug, die Klappe zu halten. Schließlich plaudern Nottingham und ich nur ein wenig. Testen einander.
Nottingham schlägt vor, das Gespräch in etwas privaterem Rahmen fortzuführen, und so begeben wir uns in einen Salon neben dem Thronsaal. Auch hier gibt es die großen Leuchtkugeln, und ein Grammofon spielt leise Jazz. Drei funkelnde Sofas bieten Sitzplätze vor drei großen Leinwänden, auf denen eine Videoinstallation läuft: eine endlose Reihe von Tänzern in körnigem Schwarz-Weiß. Ihre Bewegungen ähneln denen von marschierenden Soldaten. Während Nottingham den Herren Drinks kredenzt, nimmt Robin mich kurz beiseite. »Dich als Supersoldaten anzubieten war eigentlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe, als ich dir sagte, er dürfe keinen Verdacht schöpfen«, zischt er.
»Er hat doch nur mit mir geflirtet, Robin.« Am liebsten würde ich die Augen verdrehen. »Außerdem, überleg doch mal, in was für einer fabelhaften Position ich wäre, wenn ich der Wache angehören würde«, scherze ich.
Irritiert runzelt er die Stirn. »Fabelhafte Position wofür?«
Jetzt ist er es, der scherzt, oder? Lächelnd erkläre ich: »Für alles, wobei es von Vorteil ist, wenn man am Weißen Hof eine Waffe tragen darf.«
Robin öffnet den Mund, kommt aber nicht mehr dazu, etwas zu sagen. »Eure Hoheit? Miss Emris?« Nottingham ruft uns. Ich setze mich mit Victoria zusammen auf ein Sofa, Robin und Mister Galahad teilen sich ein zweites. Bleibt das letzte für William und Nottingham. »Ich danke für Ihre Gesellschaft.« Er hat noch immer seine Champagnerflöte in der Hand. Und wieder richtet er das Wort an mich.
»An diesem Hof muss Ihnen vieles merkwürdig vorkommen, Miss Emris.«
»Es ist sicherlich sehr beeindruckend«, antworte ich nach kurzem Zögern. »Die Kaiserin ist eine … eindrucksvolle Persönlichkeit.«
»Allerdings.« Nottingham nippt an seinem Glas. Die freie Hand hat er in die Tasche geschoben. »Dies ist die Hauptstadt eines Kaiserreiches, Miss Emris. Der Kaiser oder die Kaiserin wird von den Königinnen und Königen aller Staaten gewählt, die in diesem Reich vereint sind. Kaiserin Dana ist ebenfalls die Königin von Byzanz. In der Kunst des Herrschens kann sie also auf einige Erfahrung zurückgreifen.«
Ich lächele ihn an, was er erwidert, bevor er sein Glas leert und es auf einem Tischchen abstellt. »Es gibt so viel zu besprechen«, sagt er, an alle gewandt. »Einiges muss ich für mich behalten – nein, nein, Seine Majestät hat darauf bestanden, dass ich Euch nichts von dem Verlobungsgeschenk erzählen darf, das er für Euch plant. Doch eine Sache würde ich gerne sofort aus der Welt schaffen, da sie von eher delikater Natur ist.«
Ein Verlobungsgeschenk vom König? Danke, aber nein danke, denke ich. Nottingham fährt fort: »Wissen Sie, Miss Emris, jede zukünftige Königin von England und Wales muss sich einer bestimmten Zeremonie unterziehen.«
Erstaunt hebe ich die Brauen. Victoria hingegen verdreht die Augen. »Oh, bitte. Nicht dieses langweilige alte Gedöns.«
»Victoria«, weist Robin sie zurecht.
»Robin«, schießt sie im gleichen Tonfall zurück.
»Bitte«, schalte ich mich ein. »Ich möchte das hören.«
»Darüber musst du dir jetzt noch keine Gedanken machen«, versichert mir Robin. »Diese Zeremonie findet erst am Vorabend der Hochzeit statt.«
»Normalerweise schon«, nickt Nottingham, um dann mit einem leutseligen Lächeln fortzufahren: »Aber Euer Vater hat entschieden, dass sie diesmal vorverlegt wird.«
Robin ist so schockiert, dass er zu stottern beginnt. »E-er hat was?«
»Oh ja. Aber es gibt ja keinen Grund zur Sorge, nicht wahr?«
»Natürlich nicht.« Robin hat sich wieder im Griff, er setzt eine gelangweilte Miene auf.
»Doch, allerdings«, widerspricht Victoria. »Willst du ihr das wirklich zumuten, Robin? Du wirst sie noch verscheuchen.«
»Das glaube ich kaum«, versichere ich so gelassen wie möglich. »Würde mir freundlicherweise jemand erklären, was diese Zeremonie beinhaltet?«
Nottingham räuspert sich. »Nun ja, Zeremonie ist wohl etwas euphemistisch ausgedrückt. Die korrektere Bezeichnung wäre wohl ›peinliche Befragung‹.«
»Peinliche … was?« Diesen Ausdruck habe ich das letzte Mal im Zusammenhang mit der Hexenverfolgung gehört. Da war es die Befragung unter der Folter. Ich werfe Robin einen Blick zu. »Das soll wohl ein Scherz sein.«
»Es ist nicht das, was Sie denken«, erklärt Nottingham. »Obwohl es für eine Dame wie Sie tatsächlich … peinlich ist. Man nennt es die Glasbläser-Zeremonie. Weil Sie dadurch transparent gemacht werden«, betont er.
»Sie fesseln dich an einen Stuhl und lassen dich von einem Schnüffler betatschen«, sagt Robins Schwester.
»Victoria«, sagt William.
»Was denn, erinnerst du dich etwa nicht mehr daran, Bruderherz?«, fragt sie. »Es ist ja nicht so, als müssten da nur Königsgemahlinnen durch. Auch Königskinder haben das Vergnügen. Wie alt waren wir da … sechs?«
»Das reicht jetzt, Victoria«, befiehlt Robin mit ganz und gar neutraler Miene. »Dieser Brauch dient allein unserer Sicherheit.«
Victoria schnaubt, sagt aber nichts mehr. Ich setze ein erleichtertes Lächeln auf.
»Ach, Robin, das hast du nie erwähnt. Nun ja, es ist sicher unangenehm, aber ich habe ja nichts zu verbergen. Wann möchte Seine Majestät die Zeremonie denn abhalten?«
Lächelnd erklärt Nottingham: »Am Tag Ihrer Rückkehr. Sie soll Teil des öffentlichen Auftritts werden.«
Es kostet mich meine gesamte Selbstbeherrschung, nicht aufzuspringen und davonzulaufen. Einfach gelassen sitzen zu bleiben. »Seine Majestät hat offenbar einen Hang zur Dramatik. Ich hätte nicht gedacht, dass er die zukünftige Frau seines ältesten Sohnes auf eine solche Art und Weise bloßstellen würde.«
»Dann kennst du ihn aber schlecht«, murmelt Victoria.
»Bedauerlicherweise zeigte er sich unerbittlich«, entschuldigt sich Nottingham.
»Aber …« Ich denke fieberhaft nach. »In der Öffentlichkeit? Das ist doch wirklich unangemessen, oder etwa nicht?«
»Wie gesagt, Miss Emris«, betont Nottingham gedehnt, »Sie sind ein frischer Wind.«
»Und wer wird der Glasbläser sein, der diese Aufgabe übernehmen soll? Man kann doch keinen verurteilten Kriminellen dafür abstellen, oder?«
Nottingham verzieht das Gesicht. »Äh … nein. Es wird sogar jemand sein, dem Sie ebenso viel Vertrauen entgegenbringen können wie Seiner Majestät.« Er dreht sich um. »Cousin.«
Mister Galahad hebt ruckartig den Kopf. »Wie … wie bitte?«
Nottingham zögert. »Seine Majestät ist der Meinung, dass es Zeit wird, an die Öffentlichkeit zu gehen.«
Mühsam kleistere ich mir einen schockierten Ausdruck ins Gesicht. Offiziell weiß ich nicht, dass Mister Galahad ein Schnüffler ist. Doch auch wenn ich als Schauspielerin vielleicht nicht ganz unbegabt bin – im Vergleich zu Mister Galahad ist meine Miene harmlos. Er ist so weiß geworden wie der Schleier der Königin. Sein Unterkiefer bebt. Gehetzt huscht sein Blick durch den Raum.
»Seine Majestät kann nicht …« Für einen kurzen Moment sieht Mister Galahad mich an, dann wendet er sich an seinen Cousin: »Du. Du hast ihm das eingeredet.«
»Aber Cousin, sei doch vernünftig.«
»Meinen Vater entehrt zu sehen hat dir nicht gereicht.« Nun erhebt Mister Galahad sogar die Stimme: »Es hat dir nicht gereicht, ihn damit zu demütigen, dass du die Verwaltung unserer Finanzen übernommen hast. Du, nicht ich. Du willst uns vollständig vernichten!«
»Ich schwöre dir, Cousin, ich hatte rein gar nichts damit zu tun, dass …«
»Es gibt doch sicher eine andere Möglichkeit«, schalte ich mich ein – leicht pikiert, auf keinen Fall panisch. Ich darf nicht panisch wirken. »Ich bin nicht sonderlich begeistert von der Vorstellung, mich einer solchen Behandlung unterziehen zu müssen.«
William räuspert sich, weicht aber meinem Blick aus. So ist es Nottingham, der mir – noch immer lächelnd – erklärt: »Nun ja, Miss Emris, verzeihen Sie mir, wenn ich das so sage, aber es ist kein Geheimnis, dass Sie eine äußerst fähige Kämpferin sind. Und die Zeremonie kann doch wohl kaum peinlicher für Sie sein, als halb nackt in einem Ring zu stehen, oder?«
Bevor sich meine Panik Bahn brechen kann, springt Mister Galahad so plötzlich auf, dass wir alle zusammenfahren. Sein Gesicht ist feuerrot. Er schafft es nicht, mir in die Augen zu sehen. »Das ist unerhört! Ich werde mit Seiner Majestät sprechen und diesem Wahnsinn ein Ende bereiten.«
Er wartet gerade noch Robins knappes Nicken ab, dann stürmt er hinaus.
Einen Moment lang sehen wir ihm alle nach, und ein drückendes Schweigen senkt sich über den Raum. Am liebsten würde ich ihm hinterherlaufen, aber ich könnte ihm nicht den Trost spenden, den er jetzt braucht, könnte es ihm nicht zuflüstern: Sie sind nicht allein. Ich bin wie Sie. Und ich werde die Lage für uns ändern. Nottingham zuckt die Achseln und meint: »Der arme Mann. Er hat so viel durchmachen müssen.«
»Ich werde mit Vater sprechen«, beschließt Robin. »Wir werden eine andere Lösung finden.«
Er wirkt vollkommen überzeugt. Bin ich die Einzige, die merkt, dass er ein wenig zu hektisch atmet? Er sieht mir nicht in die Augen. Was auch besser für ihn ist. Denn ich bin wirklich wütend, dass er nie etwas davon erwähnt hat.
»Selbstverständlich, Hoheit«, sagt Nottingham. Wieder wandert sein Blick zu mir, allerdings nur für einen Moment. Dann schenkt er sich aus der Flasche auf der Anrichte Champagner nach, nippt daran und fügt hinzu: »Sollen wir fortfahren?«
Wir besprechen noch einige andere Punkte bezüglich unserer Anreise und der Wohnarrangements, Protokollfragen und zeremonielle Details. Aber das bietet keine ausreichende Ablenkung. Robin und auch mir zuliebe halte ich mich zurück, bis wir uns verabschiedet haben. Bis die Wachen uns hinausbegleitet haben. Bis Robin und ich allein im Wagen sitzen. Bis ich sicher bin, dass die Schallschutzscheibe zwischen uns und dem Fahrer vollständig hochgefahren ist. Aber keine Sekunde länger.
»Maria Magdalena, Robin!«
Er nimmt Diadem und Marienkragen ab, ohne mich anzusehen. »Hör zu, Rea, wir werden eine Möglichkeit finden …«
»Warum hast du nie etwas von dieser Glasbläser-Zeremonie gesagt?« Wütend reiße ich meinen Kragen herunter. Wenigstens haben wir die Musterung durch Nottingham hinter uns gebracht und können uns jetzt wieder um die Planung unseres Widerstandes kümmern. Aber wenn diese Zeremonie tatsächlich stattfindet, werde ich wohl kaum noch eine Chance bekommen, mich der Bewegung anzuschließen. Ich muss Madame Hiver informieren. Auch wenn sich alles in mir dagegen sträubt – davon muss sie wissen. Also hole ich mein Handy aus der Tasche. »Ist dir nie der Gedanke gekommen, dass dieses kleine Detail für mich interessant sein könnte?«
Mit fahrigen Bewegungen streift er seinen Mantel ab. Die Schneiderin in mir sieht mit blutendem Herzen zu, wie er ihn gedankenlos hinter sich auf den Sitz fallen lässt, wo er sogleich verknittert. »Das war alles noch so weit weg, Rea. Normalerweise findet die Zeremonie erst am Vorabend der Hochzeit statt, und wir hatten dringendere Probleme zu lösen …«
Hastig schreibe ich eine Nachricht an Madame Hiver und schicke sie ab. Dann ziehe ich den Mantel hinter Robins Rücken hervor. Sorgfältig lege ich ihn auf der Sitzbank gegenüber ab, bevor ich meinen Marienkragen folgen lasse. Als Nächstes nehme ich die dämliche Kappe ab. »Dringender als die eine idiotensichere Methode, mich auffliegen zu lassen?«
Robin hat sich zur Tür gedreht, wo eine Packung Feuchttücher verstaut ist. »Wir werden schon einen Weg finden.«
»Und wann? Wenn du es mir gesagt hättest, hätten wir uns längst etwas überlegen können!«