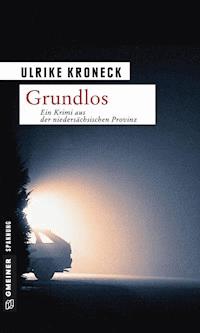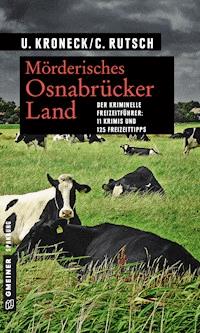Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Frauenromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Die Berliner Kunsthistorikerin Karoline Brauer und ihre frisch geschiedene Cousine Ruth verbindet eine tiefe Freundschaft. Während sich jedoch Karoline auf ihrer Suche nach dem „richtigen“ Mann ständig selbst im Wege steht, ist Ruth ihren langweiligen Ehemann endlich los. Als nach der Scheidung deutlich wird, dass Ruth keinen Cent von dem gemeinsam erwirtschafteten Vermögen sehen wird, gehen die beiden Freundinnen gemeinsam mit ihrer Bekannten Mari, die in Beziehungsdingen ihre ganz eigene Kosten-Nutzen-Rechnung durchzusetzen weiß, zum Angriff über …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulrike Kroneck
Das Frauenkomplott
Roman
Ausgewählt von
Claudia Senghaas
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2012 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2012
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Christoph Neubert
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
1. Kapitel
Es gibt Tage, an denen man morgens schon merkt, dass daraus nichts wird. Ich hatte heute solch einen Tag hinter mir. Ehrlich gesagt, waren in der letzten Zeit fast alle meine Tage so. Den letzten wirklich guten Tag hatte ich vor mehr als einem Jahr. Für einen Aufsatz in einer Kunstzeitschrift war gerade ein akzeptables Honorar auf meinem Konto eingegangen, ich war auf dem Land bei Ruth, saß auf der Bank vor ihrer Küche, trank ein Glas trockenen Weißwein und fand mich ganz passabel, weil ich gerade drei Kilogramm schlanker war als normalerweise. Es gab nichts, was meine Stimmung störte, sogar das Wetter spielte mit. 25 Grad, nicht zu heiß, nicht zu kalt, nicht zu feucht. Ich hasse feucht-heißes Wetter – vor allem in Berlin.
Der Tag, den ich heute hinter mir hatte, gehörte wieder nicht zu diesen goldenen Tagen. Ich war morgens schon mit Bauchschmerzen aufgestanden und sah aus wie ein Hammerhai. Ich hatte schlecht geschlafen, mich die halbe Nacht im Bett gewälzt. Meine Regel kündigte sich an, die mich normalerweise für mindestens eine Woche lahmlegte: drei Tage vorher, drei Tage hinterher. Wofür nur?
Ich habe keine Kinder und wenn mein Leben so weitergeht, wird sich das auch nicht ändern. Ich bin 37 und habe im Moment ohnehin keine Ahnung, wie ich ein Kind aufziehen sollte. Ich schaffe es kaum, mich selbst einigermaßen über Wasser zu halten. Wer wie ich von einem freien Auftrag zum nächsten hangelt, um zu überleben, hat keine Zeit, in Ruhe über die Zukunft nachzudenken. Die Zukunft findet bei mir in der nächsten Minute statt. Alles entscheidet sich immer heute.
Und heute hatte sich für mich gerade entschieden, dass meine Zukunft erst einmal ein Ende gefunden hatte. Der Kustos Jerôme Kramer, der seit fast drei Jahren an meinem Untergang mitwirkt, kam mittags an meinen Schreibtisch. Ich war gerade dabei, die Korrekturen für einen Katalog zusammenzutragen, der die Ende des Sommers startende Ausstellung »Grafik der Moderne zwischen Kitsch und Kunst« begleitet, für deren Vorbereitung ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin auf Honorarbasis eingestellt war. Mein Spezialgebiet.
Jerôme hockte sich ungeniert mit einer Gesäßbacke auf meinen Schreibtisch und schob den Ausdruck mit meinen Korrekturen lässig zur Seite.
»Carolin …«
Wenn ich höre, wie Jerôme, weil ihn seine Mutter unglücklicherweise in einem Anfall von Frankophilie Jerôme genannt hatte, meinen wunderbaren Namen Karoline französisch intoniert, muss ich mich immer zusammennehmen und tief durchatmen, um mich nicht zu irgendetwas hinreißen zu lassen. Heute aber mischte sich in seine eitle Affektiertheit noch ein gewisser Ton von Bösartigkeit – die andere Seite seines Charakters.
»Bedauerlischerweise at die Museumsleitung deinen Vertrag nischt verlängert.«
Jerôme hatte mehrere Jahre in Frankreich studiert und dort auch gearbeitet, und dieser Aufenthalt hatte ihn so nachhaltig geprägt, dass er den französischen Akzent nicht mehr ablegen mochte. Er hoffte damit besonders bei den Praktikantinnen zu reüssieren. Die letzten Jahre hatte ich seine nasalen Dummheiten mit der Langmut einer auf den Job angewiesenen Honorarkraft über mich ergehen lassen. Das konnte ich nun nicht mehr. Seit mehr als drei Jahren hatte ich regelmäßig um ein halbes Jahr verlängerte Honorarverträge erhalten. Ich hatte dafür die unterschiedlichsten Finanzierungstöpfe aufgetan, immer in der Hoffnung, dadurch möglicherweise eines Tages eine feste Stelle zu bekommen. Ich kam mir bei dieser Suche vor wie ein Hund, dem man immer wieder die Ahnung einer Wurst vor die Nase hält.
Jerôme hatte als Kustos auf der letzten Sitzung des Senats die Verlängerung darstellen und mich für ein Folgeprojekt vorschlagen sollen. Mir war schon vorher mulmig gewesen, da er ja nur mein zehntbester Freund ist.
»Es tut mir wirklisch leid. Aber es konnte nur eine Stelle verlängert werden, und da at sisch die Konferenz dafür ausgesprochen, Melanies 10-Stunden-Vertrag zu verlängern. Das ist für das Museum günstiger.«
Meine Wurst war also von einem anderen Hund gefressen worden. Ich hatte eigentlich nichts gegen Melanie. Jerôme allerdings auch nicht. Vor einem halben Jahr war sie mit eingestiegen in das Projekt und letzten Sonnabend, als mein Blick im Vorbeigehen durch die Fenster im Café Einstein fiel, hatte ich Jerôme und sie dort sitzen sehen.
Ich sah zu Jerôme auf, wie er lässig und selbstgefällig mit seinem Hinterteil meinen Schreibtisch besetzte. Und in diesem Moment wurde mir klar, dass er alles getan hatte, damit ich den Vertrag nicht bekam. Mehr im Zorn auf mich selbst, auf meine hilflose Gutgläubigkeit, dass ich allen Ernstes angenommen hatte, dieser Mann würde sich für mich einsetzen, stand ich mit einem Ruck auf, warf dabei den Schreibtischstuhl um und all meine Vorsicht über den Haufen.
»Glücklischerweise muss isch disch dann auch nisch mär sehn!« Ich blickte ihn finster an und trat unvermittelt gegen den zu Boden gegangenen Stuhl, lief an ihm vorbei zur Tür, drehte mich um und wollte noch etwas Ehrabschneidendes draufsetzen. Aber aufgrund mangelnder französischer Sprachkenntnisse spuckte ich ihm nur ein »Mon Dieu« vor die Füße und wackelte dazu blasiert mit dem Kopf. Zur Bekräftigung knallte ich die Tür.
Und stand daraufhin hinter der Tür meines eigenen Büros mit klopfendem Herzen, aufgelöst im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Haarspange war mir herausgefallen. Wahrscheinlich hob er sie gerade auf und legte sie ordentlich neben die Korrekturen auf den Schreibtisch. Ich spürte geradezu körperlich, wie er süffisant grinste. Während ich über den hallenden Flur ging, riss ich mir die andere Hornspange aus den Haaren. Als meine Kollegin Beate mir entgegenkam, richtete ich mir mit gesenktem Kopf weiter meine desolaten Locken und schaffte es gerade noch bis zur Tür der Damentoilette.
Ich schloss mich auf einem Klo ein und heulte eine halbe Stunde. Zuerst heulte ich über meinen Abgang und verwünschte mich. Wünschte, ich hätte gelassen, kühl und herablassend reagiert. Dann heulte ich über meine Dummheit, denn wie ich es auch drehen und wenden würde: Ich würde diesem Gockel in der Kunst- und Museumsszene Berlins wieder und wieder über den Weg laufen – und da stünde es schlecht um mich und meine Hoffnungen auf eine Festanstellung. Anschließend heulte ich darüber, dass mir das nicht egal war. Schließlich war ich ganz erschöpft, weil ich nicht mehr wusste, was das Schlimmste war: Dass ich so abhängig war oder dass es niemanden außer mir selbst gab, der mich bedauerte? Oder beides zusammen. Am Ende war ich völlig leer und weinte nur noch leise vor mich hin.
*
Danach war ich im Bus durch den schwül-heißen Spätnachmittag gefahren, hatte mich die vielen Treppenstufen in meine Wohnung am Gierckeplatz in Charlottenburg hochgeschleppt und hörte schon vor meiner Wohnungstür das Telefon klingeln. Ich wollte nicht telefonieren und machte absichtlich langsam. Das Klingeln hörte auf, als ich meine Tasche an die Garderobe hängte. Gott sei Dank. Und setzte abermals ein. 20 Mal.
»Ja, bitte?«, zischte ich lauernd, gespannt, wer mir jetzt wieder etwas antun wollte.
»Karoline?« Das war Ruth, die da ins Telefon hauchte.
»Ja!« Ich versuchte, sachlich zu bleiben.
»Karoline, ich …« Ruth stöhnte auf, schluchzte und fing offensichtlich an zu weinen, denn sie bekam kein Wort heraus. Ich hörte nur noch ein Rascheln und Knarzen, das an die Anfangszeiten des Telefons erinnern konnte. Nach einem Moment schien Ruth sich gefasst zu haben und setzte erneut an: »Karoline, ich bin 47!« Und dann fing sie doch wieder an zu weinen und schluchzte in den Hörer.
»Ach was! Das ist ja eine Neuigkeit! Aber kein Grund zur Panik. Was ist passiert?« Ich bin, was die Katastrophen anderer angeht, ganz pragmatisch und werde immer besonnener, je dramatischer die Szenerie wird.
»Karoline, ich habe den Prozess verloren!«
»Nein!«
»Doch!«
»Diese miese Ratte!«
»Das habe ich vorhin auch schon gesagt!«
»Ich habe das schon immer gesagt!«
Ich hatte Friedbert, seit ich ihn kenne, für einen langweiligen und selbstgerechten Hohlkopf gehalten, den ich nur ertragen hatte, weil meine Cousine Ruth nun einmal mit ihm verheiratet war. Ich hatte es schon mit zwölf Jahren nicht begriffen, dass die schöne und intelligente Ruth sich an einen solchen Simpel vergeuden konnte, und fand es nicht schade, dass ich an der Hochzeit nicht teilnehmen konnte, weil meine Eltern mich aus pädagogischen Gründen auf einen lange geplanten Urlaub auf einen Reiterhof geschickt hatten, obwohl – oder weil – ich Reiten hasste, und Mädchen, die reiten wollten, mochte ich auch nicht besonders.
»Ach, Karoline!« Ruth schluchzte wieder. Ruth ist zehn Jahre älter als ich, aber sie ist meine beste Freundin. Ruth ist der Meinung, ich manage alles souverän und gehe mit starken, selbstbewussten Schritten durch mein eigenes Leben. »Quäl mich doch jetzt nicht!«
Ich hatte meine Cousine Ruth immer bewundert, weil sie elegant, schlank und zierlich ist und dazu noch künstlerisch begabt! So viele Dinge! Sie war auf eine unaufdringliche Weise klug, besonnen und natürlich schön. Sie war mein Vorbild. Bis sie Friedbert heiratete. Das konnte ich einfach nicht begreifen.
»Ist denn nichts mehr zu machen?«, fragte ich, während ich die Kühlschranktür öffnete, um mir ein Mineralwasser zu holen. Ruth konnte mir offenbar nicht mehr antworten. Ich hörte nur Gläserklappern und leises Gluckern.
»Jetzt bringt der mich noch zum Saufen, dieses Miststück!« Ruths Heulen wurde von einem fernen metallischen Kratzen und Geknatter untermalt. Offensichtlich hatte sie den Hörer unter ihren Arm geklemmt.
»Ruth, was ist los?« Ich rief lauter, bekam aber keine Antwort. Dann hörte ich ein Schlürfen.
»Ich musste erst mal was trinken!«, sagte Ruth und schien sich den Mund abzuwischen.
»Ruth, nun erzähl doch mal vernünftig und der Reihe nach!«
»Wie denn? Der Richter ist der Ansicht, dass Friedbert allein die Entwürfe für die Stühle gemacht hat, dass er allein die Firma aufgebaut hat. Ich tauche ja in den Firmenunterlagen gar nicht auf, es wäre – meinte damals Friedberts Steuerberater Dr. Bruno Baltz, der Widerling – günstiger, wenn wir Gütertrennung vereinbaren würden, angeblich zu meinen Gunsten, wegen meines Häuschens, und dass ich in der Firma gar nicht auftauchte, nicht einmal als mitarbeitende Sekretärin.« Ruth lachte auf. »Das war in der Tat günstiger – für Friedbert. Ich war offiziell nur Hausfrau und für die Kinder zuständig … die Kinder … ach, wie konnte ich nur …«
Ich spürte, wie ich wieder unter der Achsel eingeklemmt wurde. Sollte sie sich erst mal ordnen. Währenddessen ging ich mit meinem Wasser zum Fenster und sah auf den Spielplatz, auf dem die Kinder immer zu viel Lärm machen, und auf die kleine, von Bäumen beschattete Luisenkirche im Zentrum des Platzes. Ich bin gern allein in dieser Wohnung. Sie ist unordentlich, die Papiere sind auf meinem Schreibtisch verteilt. Aber keiner sagt mir, ich müsse aufräumen. Ich kann nackt durch die Wohnung laufen, wann immer ich will, muss nicht abwaschen am Abend, und ich kann meine schmutzige Wäsche im Badezimmer liegenlassen. Ich muss nicht weinen um einen verlorenen Prozess gegen einen Mann, den ich einmal geliebt habe, ich habe keinen Zorn auf mich selbst wegen der Versäumnisse von gestern. Ich habe eine schöne, unordentliche Wohnung für mich allein. Habe keinen großen Kummer, nur den alltäglichen, geregelten Ärger einer Werkvertragsexistenz beim Museum. Und der hatte ja nun auch ein Ende. So schlecht, wie ich heute Mittag dachte, ging es mir offenbar nicht. Ich versuchte mich bei Ruth bemerkbar zu machen.
»Ruth!« Ich hatte das dumpfe Gefühl, noch immer zwischen ihrem Arm und ihrem Oberkörper eingeklemmt zu sein. »Ruth, verdammt! Hör auf zu saufen, das hilft auch nicht. Ich komme zu dir, morgen früh fahr ich los. Ruth, hörst du, hörst du?«
Ruth hörte nicht, sie schien sich nur erneut etwas einzugießen.
»Und guck dir doch mal an, wie ich aussehe, 47 bin ich. 47!« Sie schien in ihrer Diele zu stehen, vor dem alten meterhohen Kirschbaumspiegel, und sich vor ihm zu drehen.
Sie nahm den Hörer wieder zum Ohr: »Entschuldigung. Aber … dieses Miststück von Friedbert meinte in Einklang mit seinem Freund, dem Richter, ich sei durchaus in der Lage, für meinen Lebensunterhalt selbst zu sorgen. Ich soll jetzt aus der halben Stelle in der Apotheke eine ganze machen. Damit würde es mir doch gut gehen.« Sie spuckte aus, kam ins Husten und würgte: »Ich könnte kotzen, ich würde ihn am liebsten erschlagen, dieses Aas. Und er hockt auf dem ganzen Geld, das ich geholfen habe zu verdienen, er selbst war eigentlich viel zu dumm.«
Ich musste mich zurückhalten, um nicht mit einzustimmen in diesen Schmähgesang. Das würde jetzt auch nichts bringen. Ruth hatte schon genug Ärger, ich würde mit wiederholten Kommentaren wie ›Habe ich doch immer schon gesagt!‹ nicht zur Hebung ihrer Stimmung beitragen. Ruth wusste, dass ich Friedbert nicht nur für banal und schlicht, sondern auch für berechnend und kalt hielt.
Friedbert, der erfolgreiche Möbelfabrikant. Als Möbelverkäufer hatte er angefangen und war deshalb so erfolgreich gewesen, weil er genau den gleichen Geschmack hatte wie die meisten Kunden, die er bediente – nämlich gar keinen. Gelsenkirchener Barock hielt er für die Krönung der Tischlerkunst und Antiquitäten nannte er »antike« Möbel. Mit Such-Annoncen hatte er nebenher begonnen, ein selbstständiges Geschäft aufzubauen. Er sammelte »antike« Möbel und vertickte sie wieder – zunächst ohne großen Erfolg. Aber dann wurden ältere Möbel langsam teurer. Abgebeizte alte Küchenschränke und -buffets aus Fichtenholz trafen den Geschmack der Leute, die mit einem Mal alles, was älter war, für wertvoll hielten und bereit waren, die überteuerten Preise zu zahlen.
Ruth verknallte sich sofort in ihn, als er in der Tür stand und die zwei alten Kiefernstühle mitnahm, die sie angeboten hatte. Sie musste damals das Häuschen ihrer Großmutter auflösen, das sie geerbt hatte. Sie schwärmte noch später, als er längst schon dünne Haare hatte, anderen gegenüber von dem athletischen blonden Kerl mit den langen Wimpern, der er einmal gewesen sei. Bei diesem fragwürdigen Kompliment schaute ich den mit den Jahren umfangreicher gewordenen Friedbert meist unverhohlen an. Er versuchte nämlich schon bald, seine dünn gewordenen Haare mit Haarspray fülliger wirken zu lassen.
Die kurzzeitige Pracht der blonden Haare und die blauen Augen waren schuld daran, dass Ruth kurz vor ihrem Abschluss mit Freuden ihr nur widerwillig betriebenes Pharmaziestudium hinschmiss und Tobias, heute 22 Jahre alt, zur Welt brachte. In der Zeit ihrer Schwangerschaft zeichnete sie einen schönen Stuhl, in Anlehnung an ein »antikes« Modell, aber mit modernen Formen, und ließ ihn von einem befreundeten Tischler bauen. Ich war wie fast jedes Jahr auch in jenem Sommer in den Schulferien bei ihr. Friedbert hatte damals über Ruth gelacht und gesagt, sie solle die Finger von Dingen lassen, die sie nicht verstehe.
Ich konzentrierte mich wieder auf das Gespräch mit meiner Cousine. Ich verstand ihren Zorn und konnte ihren Hass, nach meinem Ausbruch heute Morgen, umso besser verstehen. Innerlich gierte ich mit ihr nach Rache. Eine von uns musste jetzt aber ruhig bleiben. »Lass jetzt dieses Gezeter, du hast ja recht, aber es hilft doch nicht, du zermürbst dich nur. Wenn ich morgen komme, können wir in Ruhe sehen, was wir machen können.«
»Was, du kommst morgen?« Ruth hatte mich also vorhin wirklich eingeklemmt und nicht gehört, dass ich sofort losfahren wollte. Die Vorstellung, Jerôme morgen wiederzusehen, nach dem heutigen Auftritt, war nicht besonders verlockend und so kam es mir eigentlich gelegen, zu Ruth zu fahren.
»Ja, ich komme morgen früh!« Jerôme könnte die Korrekturen allein zusammenführen. Ich würde mich für Freitag krankmelden. Über das Wochenende musste ich mich nicht in meiner Wohnung vergraben – mit der trüben Aussicht auf die knapp drei weiteren und letzten Monate, die ich mit Jerôme noch gemeinsam arbeiten musste, bis der Vertrag beendet war.
Ruth fing vor Begeisterung gleich wieder an zu weinen, und ich fühlte mich abermals ein wenig stärker als noch heute Mittag. Wenn es jemandem noch schlechter geht als einem selbst, kann das auch helfen. Ruth versprach mir, nicht mehr als diese eine Flasche zu trinken und sich mit ihrem Glas Rotwein vor die Glotze zu setzen.
*
Meine Nacht war nicht gerade ruhig. Jerôme verfolgte mich mit einem alten Stuhl und schlug ihn in Stücke, die sich wie beim Zauberlehrling rasend schnell vermehrten. Diese türmte er übereinander und setzte sich im Schneidersitz mit hämischer Miene oben drauf. Als er mich in der nächsten Traumphase küssen wollte, erwachte ich, gerade in dem Moment, als er seine feuchten Lippen auf meine Stirn drückte. Es war fünf Uhr, und ich konnte nicht mehr einschlafen. Ich starrte in den grauen Morgen hinter den Vorhängen meines Schlafzimmers und beschäftigte mich bis sieben damit, darüber zu grübeln, warum ich in der Endphase des Traums so gute Gefühle gehabt hatte. Ich hatte meiner Therapeutin versprochen, offen mit mir umzugehen, und versuchte mich an dem Gedanken, dass ich Jerôme möglicherweise irgendwie mochte und nur zu neurotisch war, um mir das bei Tageslicht einzugestehen. Aber ein Blick auf den letzten Newsletter unseres Projektes, dessen Kopf er zierte, ließ mich von diesem Gedanken Abstand nehmen. Ich hatte guten Grund, ihn nicht zu mögen, oder anders gesagt, bleibe ich dann doch lieber neurotisch, als mich von meiner Antipathie abbringen zu lassen.
Unausgeschlafen sammelte ich meine Sachen in den Reiserucksack und war im ersten Zug, der den Hauptbahnhof in Berlin verließ. Selbst wenn ich gewusst hätte, dass ich heute fahren würde, hätte ich keine Platzkarte genommen. Das mache ich aus Prinzip nicht, erst wenn ich gehbehindert bin.
Heute wäre ich gern planvoller gewesen und vor allem auch bieder, spießig und gehbehindert, denn der Zug war völlig überfüllt. Alle Plätze waren reserviert und zu meinem Leidwesen auch besetzt. Der Tag sollte wahrscheinlich genau so werden wie der gestrige. Ich hatte wirklich eine unglaubliche Glückssträhne.
Ich stieg über die Rucksäcke der anderen unkonventionell Reisenden und boxte mich – der Zug war mittlerweile schon über Spandau hinaus – durch sämtliche Wagen der zweiten Klasse in Richtung Bordbistro, um dort einen Kaffee im Sitzen zu trinken. Der Wagen war knallvoll, obwohl das Bistro geschlossen war. Ein Glück für den Zugbegleiter, dass er nicht da war. Ich hätte Gift spucken können. So lächelte ich nur verbissen einen Geschäftsmann an, der von der anderen Seite seinen Weg in das Bistro gefunden hatte. Verschwörerisch, um unser gemeinsames Leiden zu unterstreichen, schüttelte ich herablassend den Kopf und signalisierte damit das, was ich normalerweise an meiner Tante Hedwig nicht ausstehen kann: ›Typisch, ich hab’s ja gleich gesagt! Das sind doch katastrophale Zustände! Die Bahn! Welche Unfähigkeit sich doch überall breitmacht!‹ Vielleicht hatte Tante Hedwig ja doch recht. Demonstrativ suchte ich irgendeinen Hinweis, warum das Bistro geschlossen war, wann es möglicherweise geöffnet würde und ob überhaupt.
Ich tat meine Verärgerung mit einem Fußtritt gegen die Verkleidung des geschlossenen Verkaufstresens kund und ärgerte mich außerdem, dass ich immer nur Männer im Zug treffe, die keine Frau treffen möchte. Der freundliche Geschäftsmann wog höchstens 60 Kilo bei einer Länge von mindestens 1,88 Meter und hatte die entsprechende Körperhaltung. Ich war 20 Zentimeter kleiner und mindestens fünf Kilo schwerer. Vielleicht sogar sechs!
Er war nicht nur mager, sondern auch blass und hatte für seine knapp – oder doch mehr? – 50 Jahre ziemlich schütteres Haar. Sein Anzug allerdings war aus hochwertigem Stoff gefertigt. Aber bevor ich noch weitere Beobachtungen abspeicherte, brachte er mich aus der Fassung:
»Haben Sie keinen Sitzplatz?« Diese Stimme konnte einem unter die Haut gehen und passte überhaupt nicht zu dem unterernährten Asketen. Als er mich fragte, ob ich nicht mit in sein Abteil kommen wolle, dort gäbe es noch einen Platz, schloss ich die Augen und versuchte mir einen Moment vorzustellen, dass seine erotische Stimme zu dem Rest passen würde.
»Ja, aber … ich fahre zweiter Klasse!«, stotterte ich und es war mir plötzlich peinlich, kein Geld zu haben und nicht mit den Menschen des mittleren Managements, Angestellten nach BAT II und erfolgreichen Selbstständigen mithalten zu können.
»Das ist sicherlich kein Problem«, surrte seine verführerische Stimme, »sollte der Schaffner irgendetwas dagegen haben, dass Sie bei uns sitzen, werde ich das sicherlich in Ihrem Sinne regeln!«
Erotische Stimme und entschiedene Schärfe – aber mit Frau. ›Uns‹ hatte er gesagt, ›bei uns sitzen‹! Er befand sich also nicht allein in seinem Erste-Klasse-Coupé. Ich zog die Luft durch die Nase. »Wenn Sie meinen«, sagte ich laut und burschikos, wie ich das immer mache, wenn etwas zu kompliziert wird.
Ich folgte ihm in den nächsten Wagen, jenseits des Bistros, auf die Seite der Gutbetuchten und derjenigen mit festen Stellen, die nur privat zweiter Klasse fahren. Hätte ich diese feste Projektstelle bekommen, wäre ich nur erster Klasse gefahren. Aber ich wollte jetzt nicht mehr an Jerôme denken.
Mein Begleiter öffnete mir die Tür des Abteils, kein Großraumwagen. Sie hatte aus dem Fenster gesehen, wandte uns nun das Gesicht zu und lächelte. Ich weiß nicht, aber manchmal formuliere ich Gedanken unmittelbar in triviale Sätze, sie drängen sich mir in Sekundenschnelle auf. Trivialitäten sagen es oft knapp und bündig: ›Sie war wirklich eine Frau von beeindruckender Schönheit.‹ Diesen Satz dachte ich, weil es einfach stimmte. Und ich sage so etwas nicht so schnell. Meist schaue ich eine schöne Frau ganz genau an, bis ich entweder sehe, dass sie irgendwo ein bisschen zu dick oder zu dünn ist, oder – wenn da nichts zu machen ist – warte ich mindestens so lange mit meinem Urteil, bis sie mir Anlass gibt zu vermuten, dass sie wahrscheinlich ziemlich doof ist. Diese Frau war aber wirklich umwerfend schön. Dieser zweite Satz platzte direkt in meinem Kopf.
Und sie war nicht nur schön, sondern auch freundlich. Sie schaute mich neugierig, offen und liebenswürdig an.
»Ich habe der jungen Dame einen Platz bei uns angeboten«, sagte der Asket und sie nickte daraufhin zustimmend, begrüßte mich und reichte mir überraschenderweise über den kleinen Laptoptisch hinweg ihre Hand. Noch nicht einmal über den Handschlag konnte ich meckern. Ich mag nämlich nicht, wenn man mir bei der Begrüßung die feuchtwarme Hand über die Handinnenfläche zieht, bevor ich sie greifen kann. Sie hatte einen festen Händedruck und beneidenswert energische und schlanke Finger. Ich war sprachlos.
In dem komfortablen 6-Personen-Abteil saßen doch tatsächlich nur die beiden und ein weiterer Mann, der die neue ZEIT las. Der Asket setzte sich lächelnd seiner Begleitung gegenüber, nahm sofort seine Zeitung, nickte mir zu und begann zu lesen. Konversation war also nicht geplant. Das war mir recht. Außer »Guten Tag« hatte ich bis jetzt in diesem Abteil nichts gesagt.
Nun ergänzte ich »Vielen Dank«, setzte mich auf den Platz am Gang neben der Tür und legte den Rucksack zu meinen Füßen nieder. Umständlich kramte ich einen Krimi aus dem Sack und versuchte mich erneut in die Handlung einzufädeln. Da ich das letzte Kapitel vor drei Wochen gelesen hatte, stieg ich einfach irgendwo ein, und starrte ein wenig zerstreut auf die Zeilen. Ich konnte den Faden nicht wiederaufnehmen.
Also schaute ich aus dem Fenster meines Ganges und ab und zu interessiert auch durch das andere Fenster in die Landschaft. Denn ich war einfach neugierig auf dieses seltsame Paar. Sie saß mir schräg gegenüber und hatte ihre Füße auf seinen edlen Beinzwirn gelegt. Gelegentlich kraulte sie ihn mit ihren Zehen an der Innenseite seiner Weberknechtbeine, schaute kurz von ihrem Buch auf und lächelte ihn an. Mit einer beiläufigen Bewegung strich sie sich ab und zu ihre goldbraunen, seidigen Haare hinter das rechte Ohr. Sie las einen französischen Krimi im Original, den ich schon auf Deutsch zu verwirrend gefunden hatte. Meine Bewunderung und auch mein Neid wuchsen schlagartig. Was konnte diese Frau noch alles? Ich habe mich zwangsweise während des Studiums mit Sprachen herumgeschlagen, kann einige lesen, aber sprechen kann ich nur Deutsch. Das dafür aber richtig.
Sie schien mir immer perfekter zu werden. Was hatte dieser schöne Schwan mit dem hageren Hahn? Aber irgendwas war es wohl. Mir offenbarte sich das jedenfalls nicht bis Hannover. Er las die ganze Zeit ein Finanzblatt und auf der Ablage lag ein Fachbuch über Ratingverfahren – er schien wirklich richtig in seine Lektüre vertieft. Er war sich seiner Freundin sehr sicher. Oder war es seine Frau? Ich warf einen Blick auf die Hände, aber viele Menschen halten es ja für modern, sich nicht mit Eheringen zu outen. Dass sie keine Ringe hatten, musste also nichts bedeuten.
Ab Stendal grübelte ich über ihr Alter und den Altersunterschied der beiden. Sie war höchstens Ende 20, möglicherweise noch jünger, ihn hatte ich vorhin auf Ende 50 taxiert. Weil mir als emanzipierter Frau dieser Altersunterschied so unverschämt abwegig vorkam, versuchte ich ihm nun aufgrund glatter Haut Pluspunkte zu geben, musste zudem meine persönliche Aversion gegen Weberknechte in Rechnung stellen, die mich ihn vielleicht so alt schätzen ließ und zog ihm zwei weitere Jahre ab. Aber ich konnte mich nicht wirklich überzeugen und so schätzte ich ihn zu guter Letzt mit viel Wohlwollen auf 56 Jahre. Um die 25 Jahre Altersunterschied gehört ja für manche Männer zum guten Ton, aber eine so schöne und klug wirkende Frau, was hatte sie von ihm? Vielleicht lag es doch an der erotischen Stimme, die für sie alles rausriss. Außerdem war er ja ein sehr höflicher und freundlicher Mensch.
Sie legte ihren Krimi beiseite und stützte ihre Hände auf die Armlehne, um sich zu erheben. Sofort stand er senkrecht, sah sie an. Sie lächelte und nickte leicht, er hob ihr die kleine Lederreisetasche von der Ablage und zog sogar noch den Griff des Trollis raus. Mit dem gleichen angedeuteten Kopfnicken hauchte sie: »Danke«, und reichte ihm den französischen Krimi, den er ordentlich in die vordere Reißverschlusstasche packte.
Das ist doch was: Sofort strammstehen, wenn eine Frau was will. Bei mir tut das niemand. Ich schaute an mir herunter. Aber ich habe mich schon oft gemustert, und ich weiß, dass es nicht daran liegt, was ich anhabe. Es liegt auch nicht daran, dass ich nicht so schlank bin wie dieses Wesen. Ich bin nicht gerade unterernährt, und ab und zu kokettiere ich auch mit meinen guten Pfunden. Nein, darin waren die Gründe nicht zu finden. Diese Frau nahm das Verhalten des Mannes so gelassen und beiläufig, ohne zu fordern. Sie war bewandert, sie tat das mit der gleichen Selbstverständlichkeit, wie sie ihren Kaffee getrunken hatte. Wäre ich an ihrer Stelle gewesen, hätte ich das Geschehen mit dem Gedanken begleitet: ›Oh, er holt mir den Koffer aus dem Gepäcknetz, oh, oh!‹ Und ich hätte vor Begeisterung vergessen, mich zu bedanken und ganz verzückt gegrinst. Diese Frau aber registrierte das Besondere nicht, weil das für sie alles ganz selbstverständlich war. Sie hätte es wahrscheinlich auch ohne Erstaunen zur Kenntnis genommen, wenn er sich auf die Knie geworfen hätte, um seine Stirn auf ihren Handrücken zu drücken.
Sie wollte offenbar, wie auch ich, in Hannover aussteigen. Ich machte mich also fertig, bedankte mich bei den beiden für die angenehme Fahrt, die noch nicht einmal vom Schaffner gestört wurde, und machte mich auf den Weg zur Waggontür.
Sie küsste ihn doch tatsächlich, wie ich gerade noch sehen konnte.
Als ich den Bahnsteig entlanglief und es mir nicht verkneifen konnte, mich noch einmal umzudrehen, sah ich ihn im Abteil sitzen. Sie war allein ausgestiegen und ging einige Schritte hinter mir her.
»Ach, Sie steigen hier auch um!«, stellte ich überflüssigerweise das Offenkundige fest. Ich war stehen geblieben, um mit ihr gemeinsam auf die Treppe zuzugehen.
»Ja, ich habe hier einen Termin und fahre morgen früh übers Wochenende aufs Land.« Sie lächelte entgegenkommend.
»Ja, wie schön! Ich bin auch auf dem Weg in ein kleines Kaff zu meiner Cousine.« Ich sah sie an und sie schien nichts dagegen zu haben, mit mir gemeinsam die Treppe herunterzusteigen. »Aber ich fürchte, für mich wird es ein anstrengendes Wochenende, denn ich muss meine Cousine aufrichten, der es so richtig mies geht.« Dass es mir auch nicht viel besser ging, wollte ich jetzt nicht so kurzatmig durch den Bahnhof eilend ausführen. Ich wusste ohnehin nicht, warum ich ausgerechnet über Ruths Malaise Konversation mit einer Wildfremden machte. Aber ich hatte seit gestern, seit ich mich auf dem Klo ausgeheult hatte, kein Gefühl mehr gehabt. Als ich diese Frau sah, bei der alles passte, spürte ich wieder, dass es mir gar nicht gut ging. Und mich überkam Traurigkeit. Ich hielt den Mund und musterte sie. Sie war mir sympathisch.
»Ich heiße Karoline«, sagte ich und reichte ihr die Hand.
»Marianne.«
Eva – so hätte sie heißen können, oder Maja, Nora oder auch meinetwegen Anna. Aber doch nicht Marianne! Sie musste mir diese Gedanken angesehen haben. Oder sie kannte diese Reaktion, denn schließlich musste diese Frau wissen, dass sie eigentlich nicht so eine Frau war, die einfach Marianne heißen konnte. Aber sie hatte schon abwehrend den Kopf geschüttelt.
»Unsinn – ich nenne mich Mari.«
Das fand ich nun schon passender. Ich hielt diese Erläuterung außerdem für das Angebot, sie auch so zu nennen. »Vielen Dank, Mari, für die nette und ruhige Fahrt. Ich muss hier hoch zu meinem Zug.« Ich zeigte auf die Treppe zum Gleis 11 und schwankte einen Moment, ob ich hochgehen sollte, und auch sie schien zu zögern. Doch dann drehten wir uns beide mit einem verabschiedenden Lächeln um und gingen jede in ihre Richtung. Ich ärgerte mich noch über eine halbe Stunde, die ich auf den verspäteten Regionalexpress warten musste, dass ich sie nicht nach ihren ›Kontaktdaten‹, wie man das heute nennt, gefragt hatte. Ich hätte sie gern kennengelernt.
2. Kapitel
Für die acht Kilometer von Nomburgshausen nach Eickdorf nahm ich mir ein Taxi, da ich ja jetzt ohnehin kein Geld mehr hatte.
Ich fuhr gern diesen Weg zu Ruths Haus. Sie wohnte hier erst seit vier Jahren, seit sie sich von Friedbert getrennt hatte. Geerbt hatte sie das Haus bereits vor mehr als 25 Jahren von ihrer Großmutter väterlicherseits. Wir sind über unsere Mütter Cousinen. Sie war in ihrer Kindheit fast jeden Nachmittag bei ihrer Oma, die außerhalb des Dorfes am Rande des Waldes wohnte. Die Großmutter galt als verschroben, da sie in den 60er-Jahren nicht mitmachte, als alle nach und nach ihre Häuser modernisierten, das Fachwerk verkleideten und große tote Augen in die alten Wände bohrten. Ruths Oma blieb in ihrem Fachwerkkotten mit den Sprossenfenstern wohnen, ließ ihn so, wie er war, und bestellte ihren Garten mit Gemüse und Kräutern. Die Diele behielt ihren Lehmboden und Oma blieb in den kleinen Zimmern im hinteren Bereich des Kottens wohnen. Ruth erzählte, dass die anderen Kinder ihre Großmutter immer etwas ängstlich beäugten, wenn sie auf ihrem altertümlichen Fahrrad ins Dorf radelte, um einzukaufen. Als Ruth klein war, hätte sie gern eine andere Oma gehabt, wünschte sich weniger aufzufallen. Sie hätte es gern gesehen, wenn ihre Großmutter auch zum Friseur gegangen wäre, um sich Dauerwellen machen zu lassen und nicht mit schulterlangen grauen Haaren und einem weiten Blumenkleid auf einem alten Fahrrad durch die Gegend gefahren wäre. Außerdem wussten die Leute nicht so genau, wovon Ruths Großmutter eigentlich lebte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!