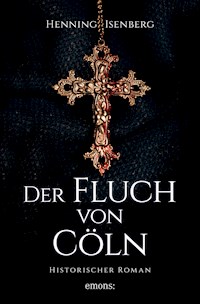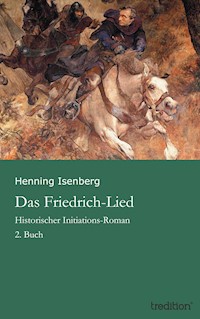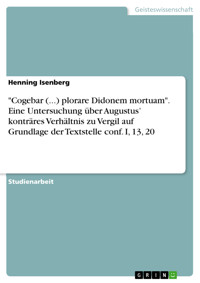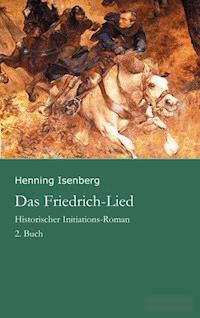Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zu Beginn des 13. Jahrhunderts liegt das Reich im Königsstreit zwischen Welfen und Staufern darnieder. Während die Völker südlich und nördlich der Alpen unter den Verheerungen ächzen, erkennt der Papst die Chance, sich über die weltlichen Fürsten zu stellen. Friedrich ist ein Novize im mittelalterlichen Köln. Eigentlich soll er als Zweitgeborener eben diesem Papst dienen. Doch durch den Tod seines Vaters und seines Bruders muss er das weltliche Erbe antreten. Als der Welfe Otto im Thronstreit obsiegt, folgt ihm Friedrich mit seinem Oheim nach Rom. Otto will Kaiser werden. Und Friedrich? Friedrich will mit dem Kaiser ins Heilige Land ziehen und glanzvolle Siege erringen. Wie es das Schicksal will, kommt alles anders. Statt Kreuzzug und großer Siege, lernt er die Schrecken des Eroberungskrieges in Italien kennen. Doch neben der augenscheinlichen Gewalt, begegnen ihm auch die hintergründigen Seiten des Lebens. Bei Hofe hat er eine Begegnung mit Rainald von Toulouse, dem Vetter Ottos. In Rainalds Heimat wütet die Inquisition gegen die Häresie. Durch Gespräche mit Toulouse und eine Reihe anderer Geschehnisse, entwickelt Friedrich Sympathie für die Reinheit der häretischen Lehre; zunehmend zweifelt er an der Integrität der Christenkirche. Mehr und mehr wird seine Ritterfahrt zu einem initiatischen Reifungsprozess. Nach der ersten Zeit in Italien, überwirft sich Kaiser Otto mit dem Papst, der seinerseits bereits mit dem König von Frankreich und deutschen Fürsten eine Intrige gegen den Welfen anzettelt. Der Kaiser, und mit ihm Friedrich, eilt zurück nach deutschen Landen. Dort hält bereits ein Gegenkönig Hof - Friedrich von Staufen. Die Welfen-Allianz beginnt zu bröckeln und ein zähes Ringen um den Thron beginnt. Friedrich bleibt den Welfen treu. Doch nach den Wander- und Reifejahren, muss er sich um seine verwaiste Grafschaft kümmern; mit Fleiß und Geschick lässt Friedrich seine Lande erblühen. Er verdient sich Ansehen bei Adel und Volk - doch auch Neid.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 757
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henning Isenberg
Das Friedrich-Lied - 1. Buch
Historischer Initiations-Roman aus dem 13. Jahrhundert
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Widmung
Prolog
Geleitwort
1. Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
Anhang
Impressum neobooks
Widmung
Meinen Eltern
und
Prolog
Limbourgh an der Lenne
– 1289 –
Die Schlacht bei Worringen hat die alten Regeln auf den Kopf gestellt. Aus dem Jahre und Jahrzehnte andauernden Kampf zwischen dem Adel, der heiligen Kirche und den Städten sind letztlich die Städte als Sieger hervorgegangen. Dennoch wird der Klerus weiterhin seine Partie spielen.
Diese Schlacht war im Jahre des Herrn 1288, am 5. Juni...
Doch beginnen möchte ich meine Erzählung mit meinem Vater, Friedrich dem ersten Grafen von Isenberghe.
Mein Vater, Friedrich, war ein Kind seiner Zeit. Nicht schlechter und nicht besser als die, unter denen es üblich geworden war, stets nach Besitz und Macht zu streben. Und wie seines gleichen, war er ein Übriggebliebener einer verblassenden Zeit. Dabei lebte er das Leben frei und impulsiv und wusste nie, was ihn im nächsten Moment erwartete. Wie die Adligen seiner Zeit hätte er wahrscheinlich gern die ritterliche Tradition aufrechterhalten. Doch etwas unterschied ihn von seinesgleichen und besonders von seinem Großonkel Engelbert von Berghe - er hatte nicht nur sich und seinen Besitz im Sinn, sondern strebte nach Freiheit für sich und die, die er zu vertreten hatte – sein Volk.
Dank seiner Statur, seines Geschicks und seiner Gedanken, die dem naturgegebenen Instinkt und der Fähigkeit zur Entfaltung seiner Kraft Raum gab, hielt er unbeirrbar an seiner Kriegerethik, die sich in den Worten Heldenmut, Freigebigkeit und Treue manifestierte, fest. Mir schien, als lebte in diesem schier unverwüstlichen Körper die Epoche der Heldentaten, der Leidenschaft und des stürmischen Überschwangs fort. Doch eine seiner vornehmlichen Eigenschaften, die Wut, war sein Gedeih und Verderb. Im Kampf von unschätzbarem Wert, stellte sie ihm in der entscheidenden Verhandlung ein Bein. Und scheinbar mit seinem Tod, wandelte sich dieses von ihm gelebte Rittertum zu einem Schleier vor der rauen Wirklichkeit, der ebenso zu täuschen wie zur tröstlichen Einbildung zu verhelfen wusste.
Oder täusche ich mich vielleicht und werde, während ich erzähle, meinen Vater in einem anderen Licht sehen?
Sein Leben - jedenfalls - hat seine Wirkung auf das meine nicht verfehlt. Und so erzähle ich die Geschichte meines Vaters und meine eigene heute, da ich im Jahre des Herrn 1289 angelangt bin. Fast dreihundert Jahre, nachdem die Menschen dachten, die Welt würde einstürzen.
Schaue ich jedoch nur zurück auf die Jahre dieses Jahrhunderts, so hätte die Welt für mich schon oft vergehen können.
Es war die Zeit, die den großen Herrschern und strahlenden Helden des zwölften Jahrhunderts nachfolgte. Die Zeit nach Kaiser Friedrich Barbarossa, Heinrich dem Löwen oder Kaiser Heinrich VI., Richard Löwenherz von England. Und sogar Eleonore von Aquitanien gab es nicht mehr.
Wer hätte gedacht, dass die alte Königin ihren Nachkommen, die sie fast alle überlebt hatte, irgendwann einmal ihren Platz räumen würde.
Viele der Mächtigen dieser neu anbrechenden Zeit, in der die Kreuzzüge in das Morgenland aus der Mode zu kommen schienen, waren in vielfältiger Weise mit den glänzenden Namen ihrer Vorgänger auf der öffentlichen Bühne verbunden. Zwar war es nach wie vor der hohe Adel, wie im Heiligen römischen Reich Welfen und Staufer, die Capetinger in Frankreich oder die Plantagnets in England, der die Geschicke der Menschen im Abendland bestimmte. Doch das alte Gleichgewicht war durch das schwache Kaisertum der Deutschen ins Wanken geraten.
Innozenz III., ein in der Juristerei gebildeter, intelligenter doch durchtriebener Papst, hatte die Schwäche des Kaisertums erkannt und griff nun nach der Macht über die Welt. In Frankreich hatte König Phillip Auguste den Jahrhundertwechsel überdauert und ahnte, dass er englische Gebiete nun von der französischen Landkarte tilgen konnte. In England hatte Johann, genannt „Ohne Land”, seinen Bruder Richard beerbt und hielt sich mehr schlecht als recht auf seinem wackeligen Thron. Doch während die Weltenlenker ihre Machtspiele trieben, merkten sie kaum, dass das Geld immer wichtiger wurde und die Städte an Einfluss und Geltung gewannen.
Geleitwort
Ein Mensch kann nur dann sein Leben recht bestehen, wenn er sich bewußt ist, wie in seiner Seele Licht und Schatten beieinanderwohnen
- gleich dem Schwarz und Weiß im Federkleid der Elster. Mutvolle Gedanken und innere Festigkeit braucht der, der den Streit zwischen Schwarz und Weiß zugunsten des himmlischen Lichtes entscheiden will.
1. Buch
1. Kapitel
„Glaube mir, hier wurde vor langer Zeit Blut an dem Stein vergossen,wenn ich mich übel verhalte, straft er."Inschrift auf der Blutsäule von St. Gereon
Sankt Gereon, Cölln
– 1207 –
An dem Tag, als sich Friedrichs Leben änderte, roch es nach Schnee. Der junge Mönch stand im Klosterhof von Sankt Gereon und ließ die kühle Novemberluft sein erhitztes Gesicht erfrischen. Er ärgerte sich. Sechs Jahre undimmer noch muss ich die Drecksarbeit machen!
Gleichzeitig tadelte er sich, dass er Ärger empfand und ihm die Christentugend des Gleichmutes schwerer fiel als den anderen Brüdern des Ordens. Am meisten aber ärgerte ihn die herablassende Art, mit der ihn sein Großonkel Engelbert, der Propst-Elekt von Sankt Gereon, behandelte. Immerhin waren sie verwandt und Engelbert war nur neun Jahre älter als er selbst. Verwandt oder nicht, älter oder nicht – man behandelte keinen Menschen so, wie ihn Engelbert behandelte.Irgendwann werde ich diesem Zwinger schon zeigen, wer wen herumschubst!
Doch in diesem Moment fühlte er sich ohnmächtig und gedemütigt. Wieder stieg Zornesröte in sein Gesicht, das er den bleiernen Schneewolken entgegen reckte.
Friedrich straffte sich, richtete die grobe Kutte aus Sackleinen und ging durch den Kreuzgang in das Scriptorium des Klosters und dort durch die Reihen der Pulte, die säuberlich links und rechts des Mittelgangs aufgestellt waren. Zu gerne hätte er an einem dieser Pulte gestanden und die schönen Lettern und vor allem, die welche man eher malen als schreiben musste, fabriziert. Aber nein, er musste im hintersten, tiefsten, dreckigsten Gewölbe die schwarze Tinte mischen. Diese dicke, schwarze Flüssigkeit, die ihn immer an das dicke, dunkle Blut erinnerte, das den feisten Mönchen, die sich regelmäßig und selbstverliebt zur Ader ließen, aus dem Arm quoll. Ihn schauderte, wenn er nur an diesen Akt der Selbsterleichterung dachte.
Er litt unter der Enge in seinem Kopf, die ihm die Pein über die narzisstische Unaufrichtigkeit seiner Mitbrüder bereitete. Naja, wenigstens war Notger, der Cancellarius des Scriptoriums noch da.
„
Da bist du ja endlich, Friedrich. Wo warst du denn?“, murrte der alte Notger ihn an, als Friedrich in das Gewölbe hinab stieg.
„
Entschuldigt, Vater. Er hat mich wieder aufgehalten mit seinen Tiraden.“
„
Wer hat dich wieder aufgehalten?“, wollte Notger wissen.
„
Mein Onkel“, erwiderte Friedrich missmutig. Notger legte eine sorgenvolle Miene auf.
„
Nimm es hin, Bruder. So schwer es dir fallen mag. Er ist der Mächtigere von euch beiden. Und wenn es ein Mächtiger mit einem Unteren nicht gut meint – aus welchem Grund auch immer – dann ist es besser, sein Glück anderswo zu suchen, wenn die Möglichkeit besteht.“
Wenn die Möglichkeit besteht, dachte Friedrich, nickte betreten und machte sich an die Arbeit, während der Ältere den jungen Bruder nachdenklich musterte.
Dann schlug er die halbfertige Arbeit auf, mit der er gerade beschäftigt war und unterbrach Friedrich in seinem monotonen Rühren, indem er anfing, in übertrieben lehrmeisterlicher Sprache zu dozieren.
„
Wenn du wissen willst, welche Farben sich vertragen: Hör her!“
Friedrich blickte Notger an und sah in dem gütigen Lächeln des sehnigen Mönchs, dass dieser heute ein Einsehen mit ihm haben würde.
„
Menge zu Rubeum in mäßigem Quantum Schwarz bei, welche Farbe Exedra genannt wird. Damit mache die Züge um die Pupillen der Augen, die Mitte im Ohr und die feinen Linien zwischen Mund und Kinn. Mit einfachem Rubeum mache die Brauen und die feinen Züge zwischen den Augen und den Brauen, die Augen unten, in der vollen Ansicht des Gesichts, die Nase über den Nasenlöchern auf jeder Seite.“
Mit jedem Satz, den er langsam sprach, führte er die Striche und Linien aus.
„
Wenn das Antlitz rechts blickend ist, auf der rechten Seite; wenn links, dann auf der linken Seite. Ferner unter dem Mund und der Stirn und innen in den Wangen der Greise und an den Fingern der Hände und den Gelenken der Füße innen und bei einem gewendeten Gesicht in den Nasenlöchern vorne.“
Friedrich schaute dem Mönche wissbegierig über die Schulter.
„
Die Brauen aber der Greise und Hinfälligen machst du mit Veneda, mit der du die Augäpfel angefüllt hast. Hierauf vollende mit einfachem Schwung die Brauen der Jünglinge, so dass darüber ein wenig von Rubeum sichtbar werde. Verfahre ebenso bei dem oberen Teil der Augen, der Nase und den Ohrläppchen, den Hände und Fingern an der Außenseite, den Gelenken und übrigen Linien des Körpers. Alle Umrisse des nackten Körpers aber mache mit Rubeum und die Nägel auf der Außenseite mit Rosa. Schau, … so.“
Lange waren Schüler und Lehrer in den Rhythmus aus Erläutern, Zeigen und Aufnehmen vertieft, so dass sie das Erscheinen Bruder Heinrichs gar nicht bemerkten.
Heinrich schaute einen Moment eifersüchtig auf die Harmonie von Lehrer und Schüler. Dann zischelte er leise, als wolle er einen Schlafenden nicht zu wirsch wecken: „Friedrich, pssst, Friedrich.“ Die beiden schauten auf.
„
Er schickt nach dir“, vollendete Heinrich.
„
Wer?“
„
Dompropst Engelbert.“
„
Oh nein, nicht schon wieder“, rief Friedrich und warf Notger dabei einen gequälten Blick zu.
Dann band er seine Schürze ab, warf sie auf die schartige, fleckige Eichenplatte und putzte sich die tintenschwarzen Finger an einem Lumpen ab. Er tauschte einen letzten Blick mit Notger und ging vorbei an Bruder Heinrich, der ihm auf dem Fuße folgte, in Richtung der Propstei.
Sie gingen über den schlammigen Klosterhof; die Köpfe zu Boden gesenkt. Sie wussten beide, was jetzt folgen würde. Friedrich schaute an Heinrichs Profil vorbei zum Reinebächlein, dessen Wasser munter durch sein kaltes Bett plätscherte.
Der Anblick erinnerte ihn an seine erfrorenen, blutigen Hände, die er fast genau vor einem Jahr immer und immer wieder in das frostige Gewässer eingetaucht hatte, bis er gemerkt hatte, dass sich die Laken des Dormitoriums, die er zu waschen hatte, rot statt rein und weiß färbten. „So wird das nie etwas“, hatte Bruder Lappenhard, der Haushofmeister, ihm zugerufen.
„
Bruder Lappenhard, meine Hände sind derart erfroren, dass ich nicht merke, wenn sie über das Waschbrett schrappen.“ Dabei hatte Friedrich ein gequältes Gesicht gemacht.
„
Dein Problem, Bruder Friedrich. Du musst es auch selbst lösen. Ich bin doch nicht deine Amme“, hatte Lappenhard geantwortet.
Und Friedrich hatte das Problem gelöst.
„
Heinrich, ich brauche deine Hilfe“, hatte er Heinrich in einer ruhigen Minute angesprochen.
„
Worum geht es, Friedrich?“, hatte dieser mit offener Miene gefragt.
Friedrich hatte einen Plan ausgerollt, auf den er sein Werk aufgemalt hatte.
„
Schau meine Hände an!“
Friedrich hatte Heinrich die gerade verschorften Knöchel entgegengestreckt.
„
Oh, Friedrich!“
Heinrich hatte besorgt auf die Wunden geschaut.
„
Ist das vom Waschen im Bach?“
Friedrich hatte genickt.
„
Ja, ich merke nie, wenn ich an das Waschbrett stoße. Es ist so viel zu waschen und das kalte Wasser lässt meine Hände erstarren.“
Heinrich hatte Friedrich fragend angeschaut und gefragt: „Warum machst du es denn alleine?“
„
Propst Engelbert hat es so angeordnet. Aber Lappenhard hat gesagt, ich soll die Aufgabe erledigen und das Problem lösen.“
Heinrich hatte wieder fragend dreingeschaut, aber dieses Mal so, als wolle er sagen: und was soll ich dabei tun?
„
Nun, Heinrich, um es zu lösen, so wie mir gesagt, brauche ich deine Hilfe.“
Heinrichs Miene hatte sich bei Friedrichs Worten ein wenig verschlossen. Doch Friedrich hatte den Plan, der sich wieder zusammengerollt hatte, erneut vor Heinrichs Augen ausgebreitet.
„
Sieh, ich will Wasser aus dem Bach in eine Rinne leiten“, dabei hatte er auf ein mittelgroßes Wasserrad auf dem Plan gezeigt. „Über die Rinne läuft es in einen Zuber, der von unten erhitzt wird.“
Er zeigte auf das kleine Feuer, welches er unter eine Wanne gezeichnet hatte.
„
Von da läuft das Wasser über das Waschbrett, das auf einem Rahmen fest angebracht ist. Dort schrubbst du die Wäsche und kannst sie in die Lauge im unteren Zuber tauchen.“ Dabei hatte er auf die untere Konstruktion gezeigt.
„
Was ist das?“
Heinrich hatte den Rahmen gemeint, der das ganze Bild umfing.
„
Damit die Kälte einem nicht so viel anhat und das Feuer nicht erlischt, wird das Ganze von einem Häuschen umgeben. Einer einfachen Holzhütte.“
„
Du willst ein Haus bauen?! … Wo willst du das ganze Material hernehmen?! Du bist ja verrückt! Das bekommst du nie hin!“
Friedrich hatte kurz überlegt, ob Heinrich recht hatte, dann jedoch an seinem Plan festgehalten.
„
Bruder Notger“, hatte er zu sich gestanden, „findet, dass das eine gute Idee ist. Er hat mir Farben und Pergament für die Zeichnung überlassen. Und Lappenhard hat gesagt, ich soll das Problem lösen. Nichts anderes mache ich…. Bleibt nur die Frage, ob du mir hilfst.“
„
Dein Brief an deinen Vater, dass du zu niedrigen Arbeiten eingeteilt wirst, darüber kaum zum Studieren kommst und der Propst-Elekt dir die Würden des Domherrn vorenthält, hat Bruder Engelbert wenig gefallen. Dass er dich für die Wäsche im Winter einteilt, hat also einen Grund…“
„
Ach, daher weht der Wind! Du hast Angst, dich bei ihm in die Nesseln zu setzen.“
Heinrich hatte betreten zu Boden geschaut.
„
Ist deine Angst vor Engelbert größer, als deine Freundschaft zu mir?!“
„
Friedrich!“, Heinrich war zornig geworden, „erpress mich nicht! Auch ohne dies helfe ich dir.“
In den folgenden Tagen hatten Friedrich und Heinrich mit Lappenhards und Notgers Hilfe alles Bauholz und sogar zwei hohle Sandsteine, die als Becken dienten, zusammengetragen. Es waren zerbrochene Steine von der Dombaustelle, die die Steinmetze für sie zu Becken ausgehöhlt hatten.
Nach einer Woche war das Bauwerk fertig gestellt, während sich die Wäsche auf dem Karren, mit dem sie die Steine herübergeschafft hatten, vor dem Lager der Küchengebäude stapelte. Bruder Leibhard, den die dreckige Wäsche vor seinen Räumen gestört hatte, hatte sich bei Propst-Elekt Engelbert beschwerte.
Doch der Wäscheberg war durch Friedrichs Erfindung in kurzer Zeit abgebaut. Schnell hatte sich die Neuerung herumgesprochen. Einige Mönche hatten sich um das kleine Bauwerk, durch dessen Mitte nun der Bach floss, versammelt, hatten gestaunt und die beiden findigen Novizen gelobt.
Mit stolzgeschwellter Brust war Friedrich dagestanden, als Engelbert in ihre Mitte getreten war. Augenblicklich war die freudige Menge verstummt. In Gedanken trat das Bild des kantigen, hochmütigen Profils seines Großonkels vor sein Auge.
„
Ein Mönch, der zum Domherrn aufsteigen will, muss zunächst lernen, eitlen Stolz hinter sich zu lassen.“
Nun war jede Freude auch aus Friedrichs Gesicht gewichen.
„
Geh zur Blutsäule und verbring dort den Rest des Tages kniend und übe dich in Demut. Dann baust du“, dabei hatte er mit einer verächtlichen Handbewegung auf das neue Waschhaus gewiesen, „das hier ab! Ist das erledigt, kommst du zu mir. Hast du mich verstanden, Novize?!“
Friedrich erwachte erst aus seinen quälenden Erinnerungen von damals, als Heinrich die Tür zu Engelberts Arbeitsgemach in der Propstei öffnete.
„
Friedrich“, sprach Engelbert, der Dompropst-Elekt, überlegen im wuchtigen Lehnstuhl seines Wohngemaches thronend, „dein Oheim, Dietrich von Cleve, wird morgen kommen, um dich abzuholen“,
„
Warum das, Hochwürden?!“, rief Friedrich halb erstaunt, halb entsetzt aus.
„
Deine Laufbahn im Dienste der heiligen Mutter Kirche neigt sich wohl dem Ende zu“, schnurrte Engelbert sonor.
„
Aber Hochwürden, ich habe doch nichts verbrochen, was so schlimm ist, dass Ihr mich aus dem Konvent ausschließen müsst. Was kann ich tun, um...“, doch weiter kam Friedrich nicht.
Engelbert schüttelte langsam und genüsslich lächelnd den Kopf. „Es hat nichts damit zu tun…“, er schwieg eine kurze Weile, bevor er fortfuhr. Friedrichs Körper nutzte die Zeit, um einen Klos in seinem Halse zu formen.
„
Dein Halbbruder, Everhard, ist tot. Du musst seinen Platz einnehmen.“
Friedrich starrte, während Engelberts Mund die Worte formten, auf die genussüchtigen Lippen seines Großonkels.
„
Deshalb holt Cleve dich ab.“
Er spürte, als er die Todesbotschaft vernahm, wie sich ein weiterer Klos in seinem Hals bildete, bevor sich der erste hätte lösen können. Selbst diese Botschaft bereitet diesem Blutsauger Genuss, schoss ihm ein grimmiger Gedanke durch den Kopf. Dem Ersticken nahe, sah er seinen Großonkel, wie er auf ihn einredete und vernahm die restlichen Demütigungen. Wie ein Ertrinkender an die Oberfläche des Wassers dringt, rannte er ins Freie, sobald er die schwere Tür des Arbeitszimmers hinter sich geschlossen hatte. Auf Knien rang er nach Luft.
Wie meist geschah es, wie es Engelbert gesagt hatte. Friedrichs Leben änderte sich an diesem Tag von Grund auf. Mit Everhards Beisetzung endeten Friedrichs Kirchenjahre und die Zeit der Knappschaft unter Dietrich von Cleve, seinem Mutterbruder, begann.
2. Kapitel
Das Lager der
deutschen Kreuzfahrer im Languedoc
– 1209 –
"Er atmet nicht mehr, Exzellenz“.
Aelred, der Knappe des Toten, erhob sich von der Bettstatt, vor der er bis zuletzt hoffend, dass sein Herr sich wider Erwarten erholte, ausgeharrt hatte. Adolf von Altena, dem ehemaligen oder besser abgesetzten Erzbischof von Cölln, war der Kummer über den Tod seines Bruders und die Sorge über das, was nun folgen würde, tief ins Gesicht geschrieben, als er das Kreuz über dem Verstorbenen schlug.Es ist meine Schuld. Er ist für mich mit ins Midi gereist, damit mich Papst Innozenz wieder in Amt und Würden bringt.Adolf trat aus dem Zelt und rang sich die Hände.Wie erkläre ich das nur Mathilde?
„
Exzellenz, wir können ihn nicht überführen…“, begann Aelred, der für gewöhnlich nicht viele Worte machte, als sie vor das Zelt traten, an den Bruder seines verstorbenen Herrn gerichtet.
Aufgebracht fauchte der so Angesprochene zurück.
„
Natürlich können wir ihn nicht so überführen, wie er ist! Veranlass die Aussegnung und das Leichenamt!“
Aelred schaute auf in das klare Blau des spätwinterlichen Himmels und atmete die wohltuende, kühle Luft ein. Es half ein wenig, die scharfen Worte seines Herrn Bruders zu bewältigen. Dann ging er in das Zelt zurück, in dem sein toter Herr in butterfarbenem Leinen auf seinem Feldbett lag. Friedlich und würdevoll. Er trank einen Schluck Wasser aus der silbernen Schale, aus der er seinem Herrn bis zuletzt Wasser zum Trinken und zur Kühlung gegen das Fieber gespendet hatte. Erst jetzt bemerkte er, dass seine Kehle vollkommen ausgedörrt war.
Er begann seinen Herrn zu entkleiden, woraufhin er die kalte, leblose Haut wusch. Die Totenstarre zog bereits in den Grafen und entrückte ihn Stück um Stück dieser Welt. Als Aelred seine Arbeit verrichtet und seinen Herrn in Rüstung und Surkot gekleidet hatte, betrachtete er die mit Ketten bewehrten Beine, den roten Surkot, in den unzählige mit Silberfäden gewirkte achtblättrige Rosen eingearbeitet waren. Dann wanderte sein Blick nach oben, zu dem braunen Bart, der mittlerweile von weißen Haaren durchzogen war, und darüber zu dem wachsgelben Gesicht, das nicht mehr so recht zu dem wehrhaften Aufzug der Kleidung passen wollte.
Die Aussegnungsmesse wurde noch am gleichen Abend gelesen. Viele Ritter im Heer des Albigenser-Kreuzzuges drängten sich um das Zelt.
Die Nacht über musste der Leichnam Arnolds von Altena so in dem Zelt verbleiben, wie er war, denn erst am Morgen würde er, Aelred, mit dem Leichenamt beginnen können.
Als die Messe vorüber war, richtete Aelred sich mit seiner Decke am Fuße seines toten Herrn das Nachtlager und begann die Totenwache, indem er mit untergezogenen Beinen auf seiner Decke Platz nahm. Um Mitternacht versuchte er ein wenig zu schlafen. Jedoch war in dieser Nacht an Schlaf kaum zu denken.
Mit dem ersten Hahnenschrei begann er, völlig übernächtigt, sein Totenhandwerk. Aelred setzt sein am Stein geschärftes Messer unterhalb des Brustkorbes des Toten an. Für den kurzen Moment, in dem er mit einem kräftigen Ruck durch die Haut seines Herrn drang, schloss er die Augen. Dann teilte er die Haut in Richtung des Bauches ein stückweit. Nicht zu weit. Nur so weit, dass er mit einem kleinen Messer und den Händen ins Innere gelangen konnte. Ein bitterer Gestank schlug ihm entgegen. Aelred verzog das Gesicht. Er tastete sich mit den Händen in das Innere des Bauchraumes vor und suchte nach den Organen, fand den Magen, griff ihn, zog ihn vorsichtig heraus und schnitt ihn mit dem kleinen Messer am Übergang zur Speiseröhre ab. Dunkle Masse und unverdaute Essensreste quollen ihm stinkend entgegen. Aelred wich zurück; angeekelt wandte er sich einen Moment lang ab, bevor er weitermachen konnte. Er nahm den Magen wieder und legte ihn auf das Leinentuch, das er auf dem Tisch neben sich ausgebreitet hatte. Dann tastete er sich wieder in den eingefallenen und nun verschmierten Körper hinein. Weiter und weiter tastete er nach den Organen und zog, ohne dass er wusste, um welches Organ es sich nun handelte – schließlich wusste nicht einmal ein Arzt, geschweige denn ein Bader, über das Innere des menschlichen Körpers Bescheid – Leber, Milz, die Gedärme und die Blase heraus und schnitt sie jeweils ab, um sie auf das Tuch zu den übrigen Eingeweiden zu legen. Zuletzt, als der Körper leer und gänzlich eingefallen war, durchstieß er das Zwerchfell in Richtung des Brustkorbes. Dabei traf er einen Lungenflügel, woraufhin der Brustkorb gänzlich zusammensank und die bitter riechende Atemluft mit einem Zischen in den Raum entwich. Aelred sprang erschrocken zurück. Doch es war nichts außer dem Gestank. Er wischte sich mit dem Unterarm den Schweiß von der in Falten gelegten Stirn. Er musste die Arbeit unterbrechen, damit er nicht in lautes Geschrei ausbrach. Er trat aus dem Zelt und ging zu einem Bach, wo er sich die blut- und exkrementverschmierten Arme wusch. Dann schnitt er von einem Strauch am Bach einen Ast ab, den er in zwei kurze Hölzer teilte und ging zurück in das Zelt. Nachdem er auch die Lungenflügel abgeschnitten hatte, stellte er den Brustkorb mit Hilfe der Hölzer auf. Nun begann der letzte Akt seines grauenhaften Werks. Seine Leinenkappe berührte die Wundränder, als er stöhnend und ächzend in der Höhle des Brustkorbes nach dem Herz seines toten Herrn suchte. Dann endlich fand er es in dem blutverschmierten Inneren. Mit unzähligen Schnitten trennte er es von den Adern und der Aorta ab und zog es heraus und ließ alles Blut in einen Eimer am Boden laufen. Dann hob er es vor sein Auge. Er betrachtete es andächtig und erstaunt, als es wie ein feiner Kristall in seinen Händen lag. Vorsichtig wie etwas Zerbrechliches, legte er es schließlich in ein kleines, kunstvoll gearbeitetes Kästchen, das ihm der Erzbischof gegeben hatte, verschloss es und schob den zierlichen Riegel vor. Mit einem feuchten Tuch wusch er das Blut von dem Kästchen und dessen Schloss.
Dann goss er Unmengen von Wasser in die Körperhöhle, bis es auf das Feldbett und von dort auf den Boden lief. Nun richtete er den Körper, der sich jetzt leicht anheben ließ, so lange auf, bis der blutig wässrige Strom versichte. Als nächstes schüttete er Salz in den Leichnam und rieb ihn mit Bündeln von Myrrhen aus. Mit Stroh, das Wiebold herbeigebracht hatte, füllte er das Innere, bis der Körper seine alte Fülle zurück gewonnen hatte. Nachdem er sich abermals gereinigt hatte, begann er die Öffnung bei den Wundrändern mit einem feinen Garn zu vernähen. Als der Körper gänzlich verschlossen war, wusch er ihn bis kein Blut und keine Blutkruste mehr an dem Leib zu sehen war. Mit Hilfe Wiebolds zog er dem Herrn nun das kurze Leinenhemd und die Beinlinge über, dann das Kettenhemd und den roten Surkot mit den silbernen Rosen sowie das Gehenk mit den Waffen des Verstorbenen.
Sie legten den Herrn von Altena in einen hölzernen Sarg und verluden ihn mit dem kleinen Schrein, der das Herz barg, auf einen Transportwagen. Dazu legten sie die persönlichen Dinge des Grafen und auf den Sarg den schartigen Schild mit der achtblättrigen Rose. Als dieses getan war, ging Aelred zum Zelt Erzbischof Adolfs.
Dieser lag auf seinem Feldbett. Fahrig schnellte er hoch, als er Aelreds Stimme vernahm, die um Einlass bat.
„
Herr, das letzte Werk kann nun beginnen“, sprach der Knappe einsilbig.
„
Ich komme“, gab Adolf mit gebrochener Stimme zurück.
Aelred ging zurück zum Zelt seines Herrn.
Es war nun fast leer. Nur die Eingeweide lagen noch auf dem Leinentuch in seiner Mitte. Aelred raffte es an den Enden zusammen und lud das schwere, rote Bündel auf einen kleinen Handkarren. Als Wiebold ihn aus dem Zelt kommen sah, war ihm, als sei Aelred in den letzten Stunden von einem jungen Mann zu einem Greis gealtert. Und tatsächlich hatten die Stunden dieses Tages etwas tief im Inneren des Knappen verändert.
Gemeinsam schoben sie den schweren Karren eine Anhöhe hinauf. Gefolgt vom Bruder des Toten, Adolf von Altena.
Dort, auf der Anhöhe unter einem freistehenden Baum, hatte Wiebold eine tiefe Mulde gegraben. Von hier aus konnte man die im Sommer grünen, hügeligen, von lila Lavendelfeldern gespickten Lande des Languedoc überblicken. Es war ein guter Platz, den Wiebold ausgewählt hatte. Unter den bangen Augen Erzbischof Adolfs ließ Aereld das Bündel in die Grube sinken.
Als Aelred zurück zu dem Zelt kam, war es gänzlich ausgeräumt. Er nahm eine Fackel und setzte das Zelt in Brand. Noch lange blieb er an dem Ort stehen und dachte an die Zeit, die er dem Grafen treu und ergeben gedient hatte.
Cölln – 1209 –
Es war der gleiche kummervolle Anlass wie vor zwei Jahren, der ihn dieses Mal nach Cölln geführt hatte. Dietrich von Cleve schaute durch die bleigefassten, milchig bunten Butzenscheiben seiner Kammer auf den Alten Markt, wo der Nachtwächter gerade die Lichter der Stadt löschte. Dann sandte er einen sorgenvollen Blick zur Decke seiner Kammer, als könne er die beiden Jungen sehen, die über ihm im Giebel seines Stadthauses schliefen.
Ortliv, ein Bote des Grafen von Altena, war am Mittag vor zwei Tagen von der Isenburg zur Schwanenburg herübergeeilt und hatte die schreckliche Kunde vom Tod des Grafen von Altena, seines Schwagers und Vaters der beiden Jungen, überbracht.Sofort hatte sich Dietrich von Cleve mit seinem Mündel Friedrich von seiner Heimatburg auf den Weg nach Cölln gemacht, um dessen jüngeren Bruder Dietrich aus St. Gereon abzuholen.Als sich der kleine Tross in Bewegung setzte, hatten die Marktleute schon begonnen, Kisten und Fässer von ihren Wagen zu heben, die Stände aufzubauen, die Kisten und Fässer zu öffnen, um glitschigen Flussfisch, rotes Fleisch, bunte Kapaune oder grünes Gemüse auf den Auslagen ihrer Stände für die Augen der Städter herzurichten.Aus einem Stall kehrte ein Bursche Pferdemist in die Gasse, während er einen Jüngeren fluchend anschickte, Wasser vom Stadtbrunnen herbeizuschaffen. Stinkender Dampf quoll über das Basaltsteinpflaster der Gassen, das von Weibern stammte, die volle Nachttöpfe in die Gossen kippten, unterdessen sie sich gegenseitig heiter einen guten Morgen wünschten. Als die Reitergruppe sich der Ehrenpforte näherte, holperten ihnen die Ochsenfuhrwerke der Landbevölkerung entgegen. Die Wachsoldaten an dem großen Stadttor schenkten dem stattlichen Ritter und seinem wehrhaften Gefolge wenig Aufmerksamkeit. Die Erhebung der Zölle von den in die Stadt strömenden Marktleuten war ihnen wichtiger. Denn der Herr der Stadt, der Erzbischof, war pleite. Genau genommen, gab es derzeit gar keinen Stadtherrn. Denn der Papst und die Majores der Stadt hatten Erzbischof Adolf von Altena, der nun mit seinem Widersacher Bruno von Sayn um sein Amt rang, suspendiert.Gierig und grob durchwühlten die Wachen die Wagen und Karren, während ihre Besitzer heftig auf sie einredeten, dass sie keine hochwertigeren Waren als die, die sie vor ihren Augen sähen, verbergen würden.Dietrich von Cleve kommentierte die Szene mit einem abschätzigen Blick. Friedrich kannte seines Herrn und Oheims Meinung über Cölln, die Majores, den Erzbischof und die Cöllner Politik; und doch unterhielt er hier innerhalb der Mauern das Haus, wo sie die Nacht verbracht hatten. In Cölln schien er trotz seiner abschätzigen Meinung über die Stadt und seine Leute nicht fehlen zu dürfen.„Das hat er von seinem Hin und Her. Gegen den Papst Politik zu machen!"Dietrich schüttelte verständnislos den Kopf.Doch Friedrich hatte eher Mitleid mit dem Erzbischof, denn er kannte ihn genauso gut, wie seinen Herrn und Oheim. Erzbischof Adolf war der Bruder seines toten Vaters und sein zweiter Pate.Und anders als viele Adlige im Lager der Welfen, war Friedrich davon überzeugt, dass Adolf nicht der Verursacher der Schulden war, sondern durch seinen Parteiwechsel gegen Staufisches Geld versucht hatte, die Schulden seiner Vorgänger zu tilgen. Sein Amt hatte ihn dieses Hin und Her, wie es Dietrich bezeichnet hatte, gekostet. Aber was verstand er schon davon. Selbst seine Familie hatte Adolf zu so etwas wie dem schwarzen Schaf gebrandmarkt, als er nach dem Tod Philips von Schwaben, einem Staufer, wieder zu den Welfen übergelaufen war.Auch wenn er nun wieder im Lager des vom Papst und der Stadt gestützten Welfen, König Otto, stand, war seine Glaubwürdigkeit stark beschädigt.Zusätzlich galt Adolf als geizig, starrsinnig und hart. So wollte er sich nicht so einfach mit einer Rente abspeisen; und hartnäckig stritt er um die Rückkehr ins Erzbistum. Nicht die besten Voraussetzungen, um das Amt aus freiem päpstlichen Willen zurückzugewinnen.Das Geld, dachte Friedrich, als sie die große Rheinbrücke hinter sich gelassen hatten, wird immer wichtiger und hat Adolf den Rücken verbogen.
~
Auf einer der ansteigenden Höhen des Bergischen Landes erspähte die kleine Reisegesellschaft die Burg Altenberghe. Doch der Weg dorthin war noch weit. Dietrich, Friedrichs kleiner Bruder, der das Reiten nicht gewöhnt war, rutschte bereits jetzt im Sattel von der einen auf die andere Seite.„Du musst auf dem Hintern sitzen bleiben und nur den Oberkörper hin- und herbewegen, sonst ist dir der Arsch gleich wund, Dietrich!"„Aber, es juckt und zwickt so!", gab Dietrich verzweifelt zurück.Friedrich zog die Brauen hoch, als wollte er Dietrich sagen: Tue besser, wie ich es dir sage.Doch Dietrich schaute nur noch unglücklicher zu ihm herüber, denn er wusste, dass er noch einen ganzen Reittag vor sich hatte. Er beneidete seinen älteren Bruder, der das Reiten, wie er das Niederknien zum Gebet, zu beherrschen schien. Wie aber sollte er es können? Schließlich hatte er seit er in St. Gereon Dienst tat, keinen Pferderücken mehr gesehen. Gegenüber Friedrich kam er sich unendlich klein vor. Während ihm die pieksige Kutte nur so um den Leib flatterte, füllten Friedrichs für sein junges Alter kräftige Schultern und Brust den blauen, Clevischen Surkot bestens aus. Der kurze lederne Wams darunter gab den Blick auf die sehnigen Muskeln seiner Arme, mit denen er die Zügel seines Pferde festhielt, bis zu den ledernen Armschützern seiner Unterarme frei. Doch Dietrich wollte lernen und versuchte, trotzt seiner Schmerzen nicht den Blick für die Bewegungen im Sattel zu verlieren, die ihm die anderen vormachten. Tapfer kämpfte er sich mit jedem Schritt seines Pferdes in Richtung seiner Heimat vor. Aber diese würde er erst in ein oder zwei Tagen wiedersehen. Er freute sich – zumindest für eine Weile – wieder in den Schoß seiner Mutter zurückzukehren. Bei dem Gedanken schossen dem kleinen Novizen die Tränen in die Augen, doch er gab ihm die Kraft weiterzureiten. In seinem kindlichen Bewusstsein war die Traurigkeit des Anlasses ihrer Reise bis dahin noch nicht angekommen.Vor ihnen begann sich, je näher sie kamen, langsam der Turm der Altenbergher Klosterkirche aus seiner idyllischen Talmulde zu erheben. Nun hatten sie Cöllnisches Land verlassen und waren auf dem Gebiet von Friedrichs Großcousine, Irmgard von Berghe zu Altenberghe.
Friedrich war schon einmal hier gewesen – vor zwei Jahren. In einem großen Festakt hatte damals die Gräfin Heinrich von Limbourgh-Monjoi geheiratet und gleichzeitig ihr Erbe in Altenberghe bezogen. Sehr zum Leidwesen ihres Onkels und Prior von St. Gereon, Engelbert, des jüngeren Bruders ihres Vaters, Adolf von Berghe, hütete sie mit der Grablege derer von Berghe, so zu sagen die heilige Stätte und Seele der Familie. Und das auch noch zusammen mit Heinrich von Limbourgh, einem Welfen, während Vizegraf Engelbert damals als Angehöriger des Cöllner Domkapitels im Staufischen Lager gestanden hatte.
Friedrich bereitete der Gedanken, dass seinem Peiniger aus Kirchentagen dieser feine Stachel stetig im Fleische eiterte, größte Genugtuung.
Friedrich hingegen achtete, ja verehrte die Limbourgher. Und das nicht ohne ein beachtliches Eigeninteresse. Denn er war unsterblich verliebt!
Es ereignete sich damals auf der Hochzeit vor zwei Jahren. Friedrich selbst steckte noch ungelenk und schlaksig in seiner kratzigen Mönchskutte und saß bei seiner Familie, als die stattliche Hochzeitsgesellschaft in den Altenbergher Dom einzog. Im gelben Sonnenschein zogen die Limbourgher durch den Mittelgang vor den Altar. Und wie zum Schutze seiner wertvollsten Zierde, umringte die Familie das lieblichste Kind, das Friedrichs Augen je erblickt hatten. Die Limbourgher bargen ihren Schatz gut. Und hätte er nicht den einen Blick, wie sich das Tuch des Mädchens Tunika bei jedem ihrer Schritte in ihren Schoß schmiegte, erhascht, er hätte gedacht, dass sie von einer Feenschar getragen wurde. Derart elfengleich waren ihre Bewegungen.
An diesem Tage waren Friedrichs Liebe zu und sein Verlangen nach Sophie von Limbourgh hoffnungslos entbrannt; unbeholfen, aber grell wie Blitze. Friedrich wusste nicht, ob Sophie ihn überhaupt wahrgenommen hatte; jedenfalls hatte sie ihn keines Blickes gewürdigt. Doch diese immer wiederkehrende Ungewissheit entfachte sein inneres Feuer so wie ein Windstoß Flammen anzufachen vermochte umso mehr und immer wieder aufs Neue – Tag für Tag. Seither liebte er sie aus der Ferne; mutig und voller glücklicher Erwartungen an die Zukunft.
Gesehen hatte er sie seither nicht mehr. Doch seit diesem Tag war kein Tag vergangen, an dem er Sophie nicht angebetet hatte.
Friedrich war derart vertieft in seine Gedanken, dass er nicht bemerkte, dass sie Altenberghe schon lange hinter sich gelassen hatten. Der schlechte Zustand der Straße, auf der sie nun ritten, hatte ihn aus seinem Traum erwachen lassen, da sein Pferd einige Male zu straucheln drohte.
Adolf von Berghe senkte sein Haupt in aufrichtiger Trauer, als er bei ihrer Ankunft auf Neuenberghe vom Tod des Vetters erfuhr. „So viel haben wir im großen Kreuzzug zusammen gewagt und gelitten. Sein Leiden hat nun ein Ende, mein Junge.“
Versonnen und doch väterlich legte er seine Hand auf Friedrichs knochige Schulter.
„
Nun wird er vielleicht das Himmelreich Jerusalem schauen, während es ihm und mir bisher auf Erden nicht vergönnt war.“
„
Verzeiht, lieber Adolf“, nahm Dietrich den Faden auf, „auch wenn Ihr nicht Parteigänger im Welfenlager seid, ruft der neue König alle Edlen zum Kreuzzug ins Heilige Land. Es ist nicht zu spät, es noch einmal zu versuchen.“
Als Adolf seine Hand von Friedrichs Schulter nahm, musterte dieser den Großonkel. Adolf war ein angenehmer, wenn auch bestimmender Mensch. Und obwohl Adolf und Dietrich in unterschiedlichen Lagern standen, versicherten sich diese beiden Mächtigen ihrer gegenseitigen Wertschätzung.
„
Nein, Dietrich. Berghe hat mit Barbarossa gekämpft und steht den Staufern treu zur Seite. Für mich gibt es keinen Wechsel zu den Welfen.“
Seit den Zeiten Barbarossas zog sich diese Welfisch-Staufische Fehde durch alle Familien und Bünde im Reich. Zuletzt hatte der zehnjährige Königsstreit zwischen Philip von Schwaben und Otto von Braunschweig die Lande mit stetigen Unruhen überzogen. Ohne dass Friedrich es selbst ahnte, waren er und seine Sippe Teile genau dieses Streits, der sein Schicksal lenken sollte.
Doch hiervon ahnte Friedrich nichts, als er erstmals seit Jahren in seiner eigenen Kammer, in einem eigens für ihn hergerichteten Federbett auf Neuenberghe einschlief.
Heimat
Nach einem tiefen, wohltuenden Schlaf setzten sie früh ihren Weg nach Osten fort. Der Winter begann Auszug zu halten und die zarte Frühjahressonne schob sich bereits vor das Nachtdunkel. Durch dichte Nebel ritten sie durch das Bergische Land in Richtung des fruchtbaren Tales der Wupper nach Norden.
Der Tag näherte sich bereits dem Mittag, als sie das fruchtbare Wuppertal vor sich sahen und sie über die weiten Bergkämme des Bergischen Landes blickten.
Aus dem noch wintermatten Grau der Berge glitt ein junger Adler in das von jungen Blättern und zarten Tannenkleidern erhellte Tal hinab und zog unter dem klaren, blauen Frühjahrshimmel seinen Kreis. Er ließ den frischen Frühjahrshauch durch seine Schwingen streichen. Die Sträucher und Bäume schlugen ihre ersten Knospen und die von Obstbäumen gespickten Wiesen begannen sich, nun nicht mehr von der Last des Schnees gedrückt, zu erheben. Langsam gewannen sie noch zart ihr Grün zurück, damit es mit der Zeit satt werde.
Beiläufig, tief unter sich erblickte der Greif den langsamen Zug einer Gruppe Reisender zu Pferd. Direkt unter ihm aber im Übergang der Wiesenflächen in einen Wald, sah er eine Bewegung, die seinen Instinkt regte. Er veränderte seine Flugbahn in Richtung des dunklen Waldrandes.
Friedrich blickte zum blauen Himmel auf und sog die Luft seiner Heimat in sich auf. Die kalte Höhenluft mischte sich bereits mit warmen Luftschichten.
Über sich sah er einen jungen Adler, wie er zum Sturzflug über einem Wald ansetzte – wohl auf der Suche nach Beute.
Wenig später erreichten sie die Wupper. Reiher fischten darin oder kauerten an den Ufern, den steinernen Figuren gleich, wie sie Friedrich von der gerade im Bau befindlichen Kathedrale in Cölln kannte. An einer flachen Stelle überquerten sie den Fluss und ritten der Ruhr nordwärts zu. Nun dauerte es keinen halben Tag mehr, bis sie Isenberghe erreichen würden.
Dietrich atmete auf. Friedrich sah die Erleichterung in Dietrichs Blick und lachte still zu ihm herüber. Er war stolz auf seinen kleinen Bruder, der zäh und unnachgiebig den Kampf mit dem Sattel für sich zu entscheiden schien. Schritt um Schritt näherten sie sich den Heimatlanden.
Dann endlich strahlten der kleinen Reisegesellschaft am späten Nachmittag des zweiten Tages die weißen Mauern auf dem Bergkamm des Isenberghes entgegen. Friedrich hatte lange nicht mehr an diesen majestätischen Bau gedacht, wie er auf dem Rücken des Isenberghs thronte – ruhig und sicher. Hier fühlte er Heimat.
3. Kapitel
Es war still. Kein Mensch war auf der Burg zu sehen. Nur die Wachtposten auf den Wehren ließen regungslos ihre Blicke das Tal der Ruhr schweifen. Stille lag über der Weite jenseits des Flusses. Ein Bauer hatte seinen Ochsen vor den Pflug gespannt und versuchte den noch winterharten Boden für die neue Saat aufzubrechen.
Im Dorf am Fuße der Burg empfingen die unsicheren Blicke der Bewohner die Ankömmlinge, als sie auf dem Nierenhoferweg vorbei an der Vogelschlacht in den kleinen Ort einritten.
Oheim Dietrich grüßte die scheuen Gestalten, um ihnen die Furcht zu nehmen.
„Geht Eurem Tagewerk nach. Wir kommen in guter Absicht“, rief er ihnen zu.Der Ort bestand aus einer Straße, die entlang der Ruhr verlief und einem Weg aus Richtung des Nierenhofes, über den sie gekommen waren, der auf eben diese größere Straße traf. Der Verbindungspunkt der beiden Straßen bildete so etwas wie den Dorfplatz, denn in dem Dreieck stand eine Eiche, die den Dorfkern markierte. Der Weg entlang der Ruhr war die Durchgangsstraße, die zum Fährhof über die Ruhr führte. Sie ritten um den Fuß der Burgberges in Richtung des Fährhofes. Auf dieser Seite befand sich der gewundene Aufstieg zur Burg. Im Vorbeireiten heftete Friedrich seine Augen an den vernachlässigten Übergang über den breiten Strom. Die Fähre war nicht mehr als ein ärmliches Floß und der Fährhofe eine morsche Hütte.Warum sind die Fähre und der Hof derart kümmerlich?wunderte sich Friedrich.
Gräfin Mathilde kniete in der kleinen Burgkapelle und blickte in Richtung des Lichtes, welches durch den ochsenblutrot getünchten romanischen Fensterbogen eine gewisse Wärme erhielt. Noch zeichnete das spärliche Astwerk des Buchenwaldes, der den Burgberg hinauf wuchs, ein filigranes dem Himmel zustrebendes Liniengewirr auf den fahlen Pergamenthimmel. Sie wusste nicht, was mehr schmerzte, ihr Nacken und die Schultern oder ihr von Gedanken gequältes Haupt. Während sie ihren Blick zum Deckengewölbe hob, fasste sie sich an die Schulter und begann sie zu kneten. Sie war der Beileidsbekundungen der Ministerialen müde. Sie schütteten ihre eigene Trauer zu. Dem gemeinen Volk hatte sie den Zugang zur Burg bereits untersagen lassen. Die Untertanen kamen doch nur um einen ledernen Gürtel oder einen samtenen Umhang zu ergattern. In dieser Welt gab es keine echte Anteilnahme. Jeder war auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Ihr Kopf war leer und doch schmerzten ihre Schläfen, nach all den Tagen der Trauer und Verunsicherung.
Ihre Augen folgten den zierlichen tiefgrünen Linien, um die sich Blattwerk im Wechselspiel mit kleinen Blüten rankte. Ja, auch draußen erwacht die Welt, dachte sie. Aber wie soll ich dieses Jahr nur überstehen?
Der Tote, der den Altarraum der Kapelle füllte, war ihr fremd geworden. Die Haut in seinem Gesicht war grau und vom Salz gedörrt, wie ein Stockfisch. Dabei lag dort der Mann mit dem sie fünf Kinder hatte. Doch Arnold hatte sie verlassen!„Herrin“, einer der Eichenflügel der Kapellenpforte hatte sich einen Spalt weit geöffnet und Isabella die Kammerfrau der Gräfin wisperte vorsichtig durch den Spalt, „Reiter kommen. Es könnte Euer Bruder mit den Jungen sein.“Von draußen drangen Rufe an ihr Ohr. Mathilde straffte sich. Friedrich, endlich. Du wirst mir beistehen, mir die Bürde von den Schultern nehmen.„Einen Augenblick noch, Isabella. Ich komme.“Nimm dich zusammen, Mathilde. Nimm dich zusammen, wie du es immer gemacht hast.Eilig wechselte sie die Position und kniete vor dem Aufgebarten nieder. Flüchtig bete sie das Vaterunser herunter. Dann stand sie auf. Zum Abschied lies sie einen Blick über die sterblichen Überreste ihres Mannes schweifen. Dann verließ sie das Gotteshaus.Die Wachen hatten auf den Wehrgängen Aufstellung genommen und beobachteten die Reiter. Unruhe kam auf dem Wehrgang auf. Offensichtlich hatten die Wachen die Ankömmlinge erkannt.Als sie durch das hölzerne Torhaus in die Unterburg einritten, hatten sich die Wachsoldaten in einer Mischung aus Neugierde und grüßendem Anstand zu einem Spalier aufgebaut. Wild aussehende Kriegsknechte, schmutzige Laufburschen und füllige Mägde mischten sich dahinter zu einem bunten Gewirr. Zur linken Hand sah Friedrich die Zehntscheuer. Durch die geöffneten Türen und Fenster zwängten sich Menschen und riefen und winkten. Freuten sie sich etwa oder war es die schiere Schaulust nach einem öden Winter?Friedrich blickte nach rechts und sah Dietrich. Dieser schien ebenso ungläubig wie er selbst umher zu blicken. Über Dietrichs Profil hinweg sah er den Wachturm mit den Unterkünften der Mannschaften. Von den hölzernen Wehrgängen winkten, riefen und glotzen die, die keinen Blick aus dem Hof zu erheischen glaubten.Gestiefelte, kettenbewährte, barfüssige oder mit Holzpantinen gesegnete Füße zertraten den Boden im halb gefrorenen Schlamm der Unterburg. Lederne Hauben oder solche aus einfachem Leinen wippten auf und ab, wohl, dass ihre Träger einen Blick auf die jungen Herren von Altena zu Isenberghe erhaschten. Schließlich war irgendeiner der Reiter ihr neuer Herr.Keines der Gesichter, in das Friedrich blickte, kam ihm bekannt vor. Er fühlte sich verloren im Angesicht der gaffenden Menge. Furcht stieg in ihm auf.Oheim Dietrich hingegen schien das Gesinde völlig ungerührt zu lassen. Unsicher, als wünschte er sich dort hin, richtete Friedrich seinen Blick dem weißen Palas, unter dem ein Torbogen die Verbindung zwischen Unter- und Oberburg bildete, entgegen. Endlich hatten sie das Spalier verlassen und den Torbogen erreicht. Friedrich und auch Dietrich atmeten auf. Sie schauten sich an und lächelten einander erleichtert an.Im Hof der Oberburg waren ebenfalls Menschen, wenn auch wenige, versammelt. Endlich erkannte er die Gesichter. Da waren Aelred, der Knappe seines Vaters, Gundalf und Gerulf, die Zwillinge, Wilbold und Ortliv, der Augen wie ein Falke besaß. Daran erinnerte er sich, seit ihn der Vater, kurz bevor er nach Sankt Gereon gekommen war, mit auf die Jagd genommen hatte. Das einzige Mal und doch eine feste Größe in der Erinnerung an die Zeit mit seinem Vater.„Friedrich,… Dietrich“, hörten sie Kinderstimmen rufen, und schon hängten sich Kinderhände an die Steigbügel und Stiefel. Es waren Wilhelm und Gottfried, ihre kleinen Brüder, die versuchten, sie vom Pferde zu zerren.Dietrich sprang vom Pferd. „Ihr beiden!“Vor Freude umarmten sich die fünf Brüder.Wo ist die Mutter?, dachte Friedrich. Warum ist sie nicht da?Gerade als er sich umschauen wollte, öffnete sich die Pforte zu Freitreppe des Palas. Er erkannte Isabella die Zofe seiner Mutter. Den Moment, den ein Pfau benötigte sein Rad zu schlagen, später, trat seine Mutter ins Freie und verweilte eine kurze Weile auf dem kleinen Plateau, um den Hof mit prüfendem Blick abzusuchen. Seine Mutter war eine große, stämmige Frau mit einem hübschen Gesicht. Als sie die Jungen erblickte, meinte er ein Lächeln über ihren Mund und ihre Augen huschen zu sehen.In würdiger Haltung stieg sie durch das Gehäuse der Freitreppe herab. Sie hatte die Vierzig noch nicht erreicht – doch war sie jetzt älter, als er sie von vor zwei Jahren in seiner Erinnerung hatte. Zwei Jahre war ich nicht mehr hier.Mathilde betrat den Burghof und näherte sich ihrem Sohn. Friedrich erschrak. Ihr blondbraunes, dichtes Haar war matter geworden und von einzelnen grauen Haaren durchzogen. Die Trauer und die Not hatten tiefe Gräben und schwarze Augenringe in ihr Antlitz gezeichnet. Aber das sah nur der, der sie genau anschaute. Doch diesen Blick gewährte sie nur wenigen, die sie ihrerseits nicht durch einen durchdringenden Blick in ihre geziemlichen Schranken wies. Immer schon, so lange sich Friedrich seiner Mutter erinnern konnte, ermahnte sie ihre Familie und sich selbst am meisten, Haltung zu bewahren. So kannte Friedrich sie. So hatte sie diesen zurückhaltenden Zug in ihre Familie eingepflanzt und so war er, Friedrich, nun selbst voll dieser äußeren Beherrschtheit, während er den inneren Sturm kaum im Zaume halten konnte. Dies war es, was er oft genug in sich verspürte, wenn er zurück schreckte, obwohl er voran gehen wollte. Die Kirchenjahre hatten dem mütterlichen Erbe seiner ersten sieben Lebensjahre noch das ihre hinzugefügt.Ahnungsvoll bemerkte Mathilde das Zögern ihres ältesten Sohnes und mutmaßte, dass es wohl den von ihr gesäten Gedankenschatten, geschuldet war. Ihre Strenge hielt sie für angebracht, so wusste sie nicht, dass eine liebende Hand eine Änderung im Wesen Friedrichs hätte hervorbringen können.Dabei war er ihr erster Sohn, ihr erstes Kind mit Arnold überhaupt. Everhard, der älteste Sohn ihres Mannes war nicht ihr Sohn gewesen. Und, wäre Friedrich vor zwei Jahren an seiner Stelle gestorben, sie hätte sich das Leben genommen. In ihn, Friedrich, legte sie all ihre Hoffnung und Wünsche. Ihn hatte sie täglich in ihre Gebete eingeschlossen. Für ihn hatte sie Gott beschworen, dass er es zu hohen kirchlichen Würden bringen sollte. Umso stärker hatte sie ihre Not verbergen müssen, als Friedrich nach Everhards Tod aus der Kirche ausschied und in den Waffendienst ihres Bruders aufgenommen worden war. Sie hatte die männlichen Ränkespiele satt. Sie hasste das Waffengeklirre, das derbe Schuhwerk, den Krieg, den Geruch von Blut und Eisen und die ungelenken Bewegungen der verkrüppelten Heimkehrer, die fortan die Vergänglichkeit ins Tagesbild einpflanzten. Die Männer, Väter und Brüder, die nie heimkehrten, und die im Laufe ihres Lebens wie eine schwere Last die Frauen und Kinder drückten, ohne dass sie es unter den Anstrengungen des Tages merkten. Auch in ihre Familie, in die sie ohne Ahnung eingeheiratet hatte, hatten die Kriege und Kreuzzüge bereits einen traurigen Zug geprägt. Der Tod ihres Mannes konnte sie keines Besseren belehren: War es nicht der Krieg gegen die Ketzer im Süden, der ihr nun den Mann genommen hatte? Ein dunkler Schatten legte sich wieder über ihre Miene.Als erster bemerkte Dietrich das Zögern der beiden und nutzte die Gelegenheit auf seine Mutter zuzustürmen. Wie ein Hungriger sich auf einen Schinken stürzte, umklammerte er den Mutterschoß. Doch anstatt den Jungen willkommen zu heißen, wie es eine Mutter tut, schloss sie kurz die Hände um Dietrichs Kopf, um ihn im nächsten Moment an den Schultern zu fassen und ihn mit den traurig klingenden Worten, „sei gegrüßt, mein kleiner Dietrich“, auf Distanz zu bringen. Wenigstens strich sie ihm über das Haar, als Dietrich sich verstört abwendete. Die Begrüßung hatte er sich anders ausgemalt in den Tagen der Reise.„Seid gegrüßt, Mutter!“Friedrich, der vom Pferd gestiegen war, sah sich genötigt den peinlichen Moment der Stille zu füllen. Seine Mutter kam auf ihn zu und drückte ihn an sich. Doch er konnte die Umarmung nicht erwidern.Er wollte seinem Vorbehalt gegen die Mutter gerade neue Nahrung geben, doch bemerkte er, dass Mathilde Halt bei ihm suchte. Wie selbstsüchtig ihn die Schatten seiner Mutter doch machten. Der Vater, ihr Mann, war tot. Sie hatte wahrlich einen Grund Halt zu suchen. Der Vorwurf gegen sich selbst, ließ Friedrich dann doch seine Arme heben und seiner Mutter Halt geben.
In den letzen Tagen hatten die Lehensleute der Umgebung dem Toten einen letzten Besuch abgestattet und auch die Handwerksleute aus dem Dorf Hattingen und der Burgsiedlung hatten ihrem Herrn die letzte Ehre erwiesen. In großen Gesten hatten sie alle den Tod beklagt und die Gerechtigkeit des Grafen als Landesherrn gepriesen.
Gräfin Mathilde hatte in den vergangenen zwei Wochen, die Verteilung der materiellen Hinterlassenschaft des Grafen von Altena zu Isenberghe übernommen – eine Aufgabe, die sonst dem Sterbenden vor seinem Tod selbst zukam.
Doch im Falle des Grafen von Isenberghe war der Tod plötzlich und im Fernen Languedoc gekommen. Wie hätte der Graf da den Getreuen und Armen selbst seine Kleider spenden und seinen hinterbliebenen Kindern seine Besitzungen und Gerätschaften zuteilen können?
In all ihrer Trauer gab Mathilde allein der Gedanke Kraft, dass sie ihren Mann im Kreise der Familie besetzen konnte.
Schon bei seinem Kreuzzug ins Heilige Land im Jahr des Herrn zwölfhundertvier hatte sie im Traum gesehen, dass er, wie viele andere Kreuzfahrer, einfach fort blieb – ohne einen Abschied. Nun war der Tag, den sie im Stillen gefürchtet hatte, gekommen.
Sie konnte Abschied nehmen. Das war das Tröstliche an diesem Tod. Unendlich dankbar war sie Aelred, obwohl er ohne Rang war, dass er sich auf das Totenamt derart gut verstand.
Das Salz hatte der Haut jegliche Flüssigkeit entzogen, so dass das Gesicht eingefallen war und die Haut grau-grün und ledern glänzte. Doch Spuren der Verwesung – schließlich musste sein Vater eingedenk des Transportes aus dem Languedoc nun mehr als vier Wochen tot sein – konnte Friedrich nicht ausmachen, als er den Toten in dem freundlich hergerichteten Kirchenraum betrachtete.
Die Sorgfalt, mit der seine Mutter die Kapelle hergerichtet hatte, die Blumen und Kränze, die achtsam um den toten Vater gelegt waren, das Licht, das der kleinen Halle durch die Reflexion der bordeauxfarben getünchten Erker eine weiche Wärme verlieh, versöhnten Friedrich ein Stück weit mit der schroffen Mutter. Denn sie war es, die die Kapelle nach ihren Vorstellungen hatte gestalten lassen. Und diese Tage waren ihre Tage. Waren die Tage, in denen sie von ihrem Mann Abschied nahm. Eine Ahnung für das Leid der Mutter legte sich auf seine Abneigung und Wut. Doch warum sollte er an den Tod denken?
Er war jung. Er lebte, er würde noch lange leben. Er hatte mit dem Tod nichts zu tun. Vor zwei Jahren hatte der Vater einfach verfügt, dass Friedrich in die Obhut Dietrichs von Cleve kam, wo er auf ein weltliches, ritterliches Leben vorbereitet wurde. Zwei Jahre – nie war er gekommen, um nach seinem Thronfolger zu sehen. Nie hatte er ein Wort für ihn. Zwei Jahre. Dieser Vater hatte ihn schon damals verlassen, ohne ein Wort, ohne dass sie sich kannten, ohne dass er ihm weisen Rat mit auf den Weg geben hatte. In Friedrichs Kindheit hatte er sich um seine Geschäfte, um den Bau der neuen Burg gekümmert. Er war auf Feldzügen mit dem großen Barbarossa gegangen. Und wenn er sich um seine Kinder gekümmert hatte, dann nie um ihn, Friedrich, sondern stets um Everhard, der ihm nachfolgen sollte. Dachte er an den Vater, so war da nicht viel mehr als diese Taten. Nein, wäre dieser Vater eine wirklich wichtige, mächtige, gar beherrschende Figur in seinem Leben gewesen, so wäre ihm doch mehr dazu eingefallen. Eine Insignie von Macht und Herrschaft hat er hinterlassen. Einen ehedem sicheren Platz, der nun verwaist war, der gefüllt werden musste. Durch ihn. Auf keinen Fall wollte er das. Nicht jetzt.
Um das Wohl der Familie machte Friedrich sich keine Sorgen, denn die Grafschaft erhielt Einnahmen aus wohlhabenden Reichsstifte Essen, anderen Vogteien und dem Erbland.
Doch die Verantwortung für die Verwaltung und den Schutz der riesigen Ländereien bereitete ihm Kopfzerbrechen. Immerhin handelte es sich um nichts weniger als die Ländereien, Burgen und Höfe im Norden und Westen sowie die Grafschaft Bochum. Dies allein stellte schon eine erhebliche Verantwortung dar. Doch damit nicht genug. Aus dem Besitz seines Vaters im Osten ging die Burg Nienbrügge mit der Stadt, dem Fährhof über die Lippe und den Grafschaften Hœvel und Heesen an ihn über.
Sollte das etwa eine Gnade sein?! Gott bewahre. Nein, eine Last war dieses Erbe!
Vor zwei Jahren den Kirchenmauern entronnen und jetzt die ritterliche Welt in sich aufzusaugend, waren es andere Dinge als das Ausfertigen von Privilegien, das Abhalten von Gerichten oder die Bemessung des Wegezolls für die Straßen und Furten der Grafschaft, die ihn interessierten. Er wusste nicht, was zu tun wäre. Und nun sollte er eine Grafschaft regieren? Unmöglich! Dies hätte Everhard, sein älterer Halbbruder übernehmen sollen. Nicht er! Aber Everhard tot. Nicht sein Problem.
Er wehrte sich gegen die Aussicht, sich von nun an bis an das Ende seiner Tage um die Geschicke seiner Grafschaft zu kümmern. Und es machte ihm Angst, was ihm in den nächsten Tagen bevorstand.
Er wollte auf Ritterfahrt gehen. Wie er ein Schwert zu führen hatte, das wusste er nun. Er würde es tun. Auch gegen den Willen der Mutter.
~
Friedrich konnte dem Tod nicht ausweichen – zumindest nicht in diesen Tagen. Er war allgegenwärtig, der Tod. Die Burg und scheinbar die gesamte Grafschaft waren von ihm in ihren Bann gezogen. Selbst die allmählich eintreffenden Trauergäste schienen, sobald sie ihr Lager, sei es am Fuße der Burg oder in den Mauern derselben, bezogen hatten, in dieselbe Lethargie wie der gesamte anwesende Hof zu verfallen.Es war die Ironie des Umstandes und wie er zu wissen glaubte, sein Glück, dass er, Friedrich, mit dem Tod im Gepäck dem Kummerort entfliehen konnte.Von seiner Mutter war ihm aufgetragen worden, die sterblichen Überreste des toten Vogts des Stifts Essen-Werden zu überführen.Es hatte eine besondere Bedeutung, dass Arnold, wie sein Vater und dessen Vater, in Essen beigesetzt wurden. Die reiche Vogtei war eine leibliche Vogtei. Die Grafen von Altena unterstrichen ihren Anspruch auf die Erbvogtei, indem sie das Stift, seit dem es ihnen vor mehr als hundert Jahren übertragen worden war, als Grablege der Familie gewählt hatten. Damit war die Familie durch ihre Toten untrennbar mit dem Stift verbunden.Friedrich nahm Wiebold und Aelred, die beiden Knappen seines Vaters, sowie Gerulf und Gundalf, die beiden Zwillinge, mit auf den Zug nach Essen.Sie setzten am kleinen Fährhof über die Ruhr und reisten über freies Ackerland Richtung Norden.Auf der Reise begegneten ihnen viele Bauersleute, die unverzüglich stehen blieben oder von ihrer Arbeit abließen und sich vor dem Sarg verneigten.
Scheinbar, so dachte Friedrich,haben sie den Vater geachtet. Aber warum muss ich ihn so entwerten, den Vater? Ist es die Angst vor dem eigenen Verderben, die ich fort schieben will? Ist es das Gefühl der Einsamkeit, das sein Tod hinterlassen hat? Oder ist es die Last, die ich seit der Nachricht von seinem Tod auf meinen Schultern spüre?
Ihm wurde bewusst: Nicht den Vater beklagte er. Nein, er selbst war es, den er betrauerte. Er schämte sich seiner selbstsüchtigen Gedanken. Doch es zog ihn hinaus in die Welt. Er konnte und wollte dies nicht vor sich leugnen.
Als sie den Hellweg erreichten, wendeten sie sich nach Westen und reisten auf der komfortablen Heer- und Handelsstraße weiter.
Von Bochum aus schickte Friedrich Gundalf zum Essener Stift, welches aus dem Essener und dem Werdener Kloster bestand, um ihr Kommen anzukündigen.
Gulda von Gerresheim, die Äbtissin, und ihre Mitschwestern, empfingen den Tross, als er gegen Abend in den Klosterhof einzog.
„
Seid gegrüßt, Herr.“
„
Seid gegrüßt, Schwester.“
„
Wir haben die Tumba in der Kirche“, dabei deutete sie die rechte aus der linken Hand lösend in Richtung des Gotteshauses, „hergerichtet. Dort könnt Ihr Euren Vater umbetten.“
„
Ich danke Euch, Schwester Gulda.“
„
Ihr könnt das Vogteizimmer Eures Vaters bewohnen, Herr Graf. Wollt Ihr es gleich oder später sehen?“
„
Nein, danke, später. Wir werden erst den Toten umbetten.“
„
Gut, dann sehen wir uns später.“ Gulda verbeugte sich und mit ihr die anderen Schwestern.
„
Ladet ihn ab und bringt ihn in die Kirche“, wieß Friedrich Aelred und die anderen an.
Als das Werk der Umbettung vollbracht war, richteten sie sich wie ihnen geheißen im Kloster ein.
Der Klosterbezirk bot einigen Komfort. Aelred, Wiebold, Gerulf und Gundalf konnten in der Unterkunft der Wachmannschaft nächtigen. Friedrich legte seine Habe in der Vogtei ab. Allerdings würde er hier kaum Zeit verbringen. Ihm allein Friedrich war es vorbehalten, die nächtliche Totenwache am steinernen Sarg in der Stiftskirche von Werden zu halten.
Erstmals, als er allein auf die steinerne Tumba, die seinen Vater barg, blickte, ließ er den Gedanken zu, dass der Tod auch zu ihm kommen konnte. Schneller als erwartet. So, wie er zu Everhard in dessen achtzehnten Jahr gekommen war. Er war jung. Doch, ... würde einst der Tod unweigerlich auch zu ihm kommen. Furcht ergriff ihn, ebenso wie ihn die Kraft verließ, die er stets allein dadurch gespürt hatte, dass der Vater da war. Sein Fall führte ihm die eigene Aussicht vor Augen. Wohin gehen wir, Vater? Wohin?
Kann ich mich des Lebens nicht einfach erfreuen!?“, er ließ beide Hände auf den Sandstein niedersausen, dass es nur so klatschte. Doch der große Sarg schwieg. Das dämmrige Licht, welches durch die Fenster drang, färbte sich silbrig und blau wie kalter Stahl, als der Mond aufging. Er kletterte hinauf und legte sich der Länge nach mit dem ganzen Körper, die Arme ausgebreitet, auf die große Truhe. So, als wolle er den Vater umarmen. Doch Friedrich spürte, dass weder der Sarg noch der gesamte Ort Leben verströmte. Nur unendliche Leere füllte die kalte Halle. Der Vater hatte ihn verlassen. Er, nur er, barg das Leben an diesem Ort.
Er wusste nun nicht mehr, ob er seinen Vater liebte. Natürlich liebte man seinen Vater. Aber Friedrich wusste nicht, ob ihm dieser Mann, über den er nun wachte, – ob ihm dieser Mann wirklich vertraut war.
„
Wer warst du, Vater, dass ich so traurig bin?“, flüsterte er zu sich. Er schwankte zwischen Hass darüber, dass Arnold ihn ohne einen Rat und Förderung, ohne ein Anliegen an ihn verlassen hatte, und Trauer, deren tieferen Anlass er nicht zu ergründen wusste.
Missmutig und schweigsam erwartete er am nächsten Tag am Tor des Klosters stehend – es war der letzte Sonntag im März des Jahres zwölfhundertneun, der Tag der Heiligen Cornelia – den Zug der Trauergemeinschaft, der ihnen von Isenberghe nachfolgte.
„Jeder Tod macht das Leben feiner und zarter“, begann Friedrichs Oheim, Adolf von Altena, der nun ebenfalls aus Neuss herbeigekommen war, die Totenmesse. Es waren viele erschienen – natürlich Dietrich von Cleve, der Friedrich und Dietrich hergebracht hatte, die Herren von Berghe, Altena, Arnsberghe, Tecklenbourg, zur Lippe und viele andere Grafen des Umlandes. Je nach Rang und Zugehörigkeit zu dem Toten ordneten sich die Reihen bis auf den letzten Platz der Kirche. Friedrich stand nahe bei dem Sarg, auf dem sich das Lichtspiel einer Birke traf. Wie von heiterer Melancholie angetrieben, warf sie durch die bunten Fenster des Querschiffes von draußen ihre eigentümlich munteren Schatten in das Innere. Die Darstellung des christlichen Kreuzes, der Weltesche Yggdrasil sowie das Wappen der Rose, das Zeichen der Gralslinie, verzierten den Ruhrsandstein der übermächtigen Tumba in vollendeter Handwerksarbeit.Während Adolf die Totenmesse hielt, entrannen Friedrichs Gedanken beim Betrachten der feinen, kunstvoll verwobenen Formen immer wieder der eigentliche Zweck seines Hierseins. Trauer umfing ihn lediglich durch den getragenen Ton, in dem sein Oheim die Worte der Andacht sprach. Er schmiedete Pläne für seine Zukunft.Als die Messe vorüber war, versammelte sich die Trauergemeinde im Innenhof des Konvents. Ein leichter Wind strich über den kleinen Platz, doch die ersten Sonnenstrahlen des Jahres wärmten die Gemeinschaft. Der Totenschmaus wurde gereicht und die verbliebene Gesellschaft verteilte sich in kleinen Grüppchen im Hofe. Die Menschen vertieften sich ins Gespräch, während August, der Spielmann, mit angemessen trauriger Miene die Harfe anschlug.Friedrich betrachtete die Szenerie. Die Nähe zu dem Anlass ihres Hierseins fehlt ihnen, dachte er verächtlich, stattdessen wetteiferten sie um die trefflichste Neuigkeit aus der hohen Politik.