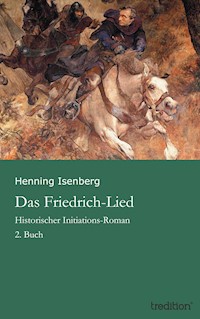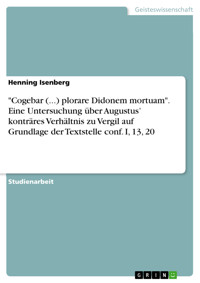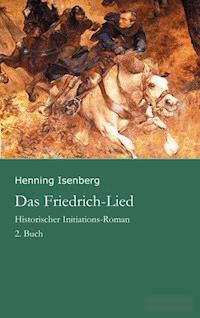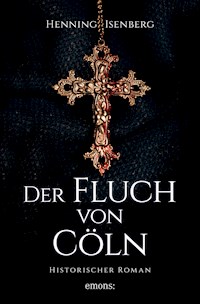
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historischer Roman
- Sprache: Deutsch
Glänzend recherchiert, mitreißend geschrieben - ein packender Roman über einen historischen Machtkampf zwischen Rhein und Ruhr. Cöln 1228: Theos Eltern sind tot, sein Vater wurde gerichtet, nachdem er sich an der Spitze eines Adelsbündnisses gegen den Erzbischof der Stadt erhoben hatte. Sein Land ist verloren, geraubt von seinem machtbesessenen Onkel. Theo schwört Rache, und noch bevor er seine Ausbildung zum Krieger beendet hat, muss er sich seinem Schicksal stellen und seinen übermächtigen Widersachern gegenübertreten. Ein schier aussichtsloser Kampf entbrennt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henning Isenberg, Jahrgang 1966, wuchs im Sauerland auf. Heute lebt und arbeitet er als Coach und Autor bei Stuttgart. Bereits früh war er entschlossen, mit gut recherchierter Geschichte unserer modernen Welt seelenvolle Geschichten gegenüberzustellen.
Dieses Buch ist ein Roman. Dennoch sind viele Personen nicht frei erfunden, sondern existierten wirklich. Ihre Handlungen beruhen auf einem historischen Hintergrund. Im Anhang befinden sich ein Glossar und ein Personenverzeichnis. Glossar, Personen- und Literaturverzeichnis, der liturgische Kalender ebenso wie die Karten sind im Internet abrufbar unter:www.henning-isenberg.de/coeln
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
©2019 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Nik Keevil/Arcangel Images Umschlaggestaltung: Nina Schäfer eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-530-5 Historischer Roman Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unterwww.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literaturagentur Rose Bienia, Tübingen.
wirst du mir nachfolgen und
unser Land wieder in Besitz nehmen.«
»Aber du wirst doch zurückkommen!«
»Ich sage ja nur, für den Fall.
Wir sehen uns wieder, ganz bestimmt.«
aus: »Das Friedrich-Lied«, 2.
PROLOG
Winter 1226
Theos Vater starb– langsam und unausweichlich. Das rote Rosenbanner an Theos Lanze flatterte in der Winterkälte.
»Steig endlich vom Pferd!«, befahl ihm sein Vaterbruder, Wilhelm, vom Warten zermürbt. »Herzog Heinrich wird Cöln nicht angreifen. Und falls doch, wirst du nicht dabei sein. Du musst leben. Außerdem bist du viel zu jung.«
Doch Theo beachtete Wilhelms Worte nicht. Voll ahnungsvoller Verzweiflung fuhr er in seiner Suche nach Rettung für seinen Vater fort. Lediglich leere wintergraue Felder breiteten sich auf dem Vorfeld von Cöln vor ihm aus. Hinter den Mauern der Stadt sah er die im Novemberlicht matt schimmernden Ziegeldächer, während die Severinstorburg wie ein feindlicher Koloss in den südlichen Wehren drohte. Daneben, rheinseitig, schälte sich der Bayenturm vor den Masten der Handelskoggen aus dem winterlichen Dunst. Landseitig wehte das erzbischöfliche Banner mit dem schwarzen Kreuz auf weißem Grund über der Ulrepforte und den übrigen Stadttoren. Von Theos Auge kaum fassbar, deuteten die vielen Torburgen und Turmpforten das Ausmaß der größten Metropole nördlich der Alpen an. Hinter ihnen schlummerte die Stadt– wohlhabend, empfindlich, fast behütet, wären da nicht die ständigen Unruhen, die die fordernde Herrschaft der jeweiligen Erzbischöfe ihren Bürgern durch immer neue Abgaben aufzwang.
Nun aber lag die Heilige in einem selbst verordneten Dämmerzustand da. Die Krawalle der letzten Tage, nein, des letzten Jahres seit dem Tod Erzbischof Engelbert von Bergs verlangten ihr diese Ruhepause ab. Der neue Erzbischof, Heinrich von Molenark, hatte sich in seinem Stadtpalast verschanzt, während die Bürger und Patrizier sich beschämt in ihre herausgeputzten Fachwerkhäuser mit den steinernen Sockeln verkrochen hatten.
So lange sein Blick auch hin und her schweifte, nichts– weder auf Land- noch auf Rheinseite– berechtigte Theo zu irgendeiner Hoffnung. Er spürte, wie brodelnde Wut nach seinem Herzen griff. Ein Mann, sein Vater, der sich in ihren Dienst gestellt hatte, starb gerade auch für sie, die freien Bürger Cölns, vor ihren Toren; und sie hatten es geschehen lassen.
Allein die verkohlten Häuser der Familie Overstolz und einiger anderer Patrizier in der Rheingasse, deren Anblick Theo an die geschleifte Isenburg erinnerte, störten das Friedensbild. Sie waren der selbstherrlichen Sühne des neuen Stadtherrn Erzbischof Molenark zum Opfer gefallen.
Theos Blick fand den Steinhaufen auf dem gerodeten Vorfeld der Stadt. Daraus ragte ein Pfahl empor, auf dessen Ende ein Rad ruhte, fast unverdächtig, gerade so, als sei die eine Seite eines überbreiten Fuhrwerkes unter dem Steinhaufen begraben, während die andere ein wenig schräg in den schneeschwangeren Himmel wies. Doch Theo wusste es besser. Zwischen den Speichen des Rads formte sich ein dunkler Körper. Der Körper seines Vaters. Niemand durfte zu ihm, außer den schwarzen Raben, die krächzend auf reiche Mahlzeit warteten. Kriegsknechte bewachten die Marterstätte, als hätte ihr Befehlshaber Angst, der Todgeweihte könnte zu alter Kraft erwachen, während er sterbend über ihnen thronte. Zwei Tage und eine Nacht lang hatten die Soldaten die Familie nicht vorgelassen. Dabei drohte ihnen und der Stadt am Horizont ein riesiges Heer.
Doch die Allianz der Vögte war nicht vorgerückt. Weder Theos Oheim, Herzog Heinrich von Limburg-Berg, noch der Bruder seiner Großmutter, Dietrich von Kleve, noch des Vaters engster Vertrauter, Otto von Tecklenburg– sie alle hatten seinen Vater aufgegeben. Dabei hatten sie selbst ihn einst an die Spitze des Vögteaufstands gegen den erzbischöflichen Entvogtungserlass gestellt. Nun ließen sie ihn fallen. Theo barst bald vor tobender Wut.
Am Abend des zweiten Tages ritt der Stadtvogt, Endrich von Eppendorf, gerüstet und mit einem weißen Tuch am Arm, vor die Heeresfront und sprach mit dem Herzog. Es war kaum noch Leben in dem Sterbenden, und der Stadtvogt beschloss, seine Mutter Mathilde sowie seine Söhne, Theo und Friedrich, zu ihm vorzulassen.
Wie in einem wunden Fiebertraum ritt Theo mit nahem Gefolge dem Ort des Martyriums entgegen. Ehrfürchtig wichen uniformierte Stadtbüttel und grobe Brabanter Kriegsknechte trotzig wie zum Spalier vor der kleinen Gruppe zurück. Durch die Speichen des Rades suchte Friedrich Theos Blick. Wie ein junger Adler, der um Fraß aus dem Schnabel der Alten fleht, klammerte sich Theo an Friedrichs sterbendes Augenlicht. Ein unbändiges Drängen, zu seinem Vater hinaufzusteigen und ihn im Leben zu halten, kämpfte in ihm. Ein letztes Schließen und Öffnen der Lider sagte ihm, dass sein Vater jetzt ging, und obwohl Theo keine Bewegung der Lippen sah, war es ihm, als hörte er die Worte: »Wisst, meine Kinder, ich segne euch mit meiner Liebe. Lebt, lebt. Ich werde bei euch sein, auch wenn ich nicht mehr lebe. Immer, immer…«
In Theo schrie es: Geh nicht! Aber er wusste, dies war der letzte Blick. Trotz der zwanzig Ellen, die ihn von seinem Vater trennten, fühlte er sich ihm so nahe wie nie; nicht einmal als er auf seinem Schoß gesessen hatte, hatte er diese Nähe gespürt. Und in diesem letzten Blick verstand Theo alles so, als hätte Friedrich zu ihm gesprochen. So schmiedete er das Band, das ihn stets mit seinem Vater verbinden würde; ein Band, das nur er allein sehen konnte. Damals schwor Theo seinem Vater, das Land um den Isenberg und allen anderen Besitz zurückzugewinnen, wenn er erst erwachsen sei.
Dann starb Friedrich, Graf von Isenberg, Erbvogt des Essener Stifts.
ERSTER TEIL
1. KAPITEL
Februar 1227
Theo schaute zum Himmel. Erdrückend. Den ganzen Tag schon hatte er gespürt, dass heute etwas passieren würde. Für ihn war das nichts Ungewöhnliches. Seine Gabe, Dinge vorherzusehen, war ein Geschenk wie ein Fluch. Ahnung beschlich ihn, und dann geschah es; auch jetzt hatte er Gewissheit. Der Findling hatte den Fuß des Altbauern zerschmettert, Theo hatte ihn abgebunden.
Der Wald schimmerte grün und geheimnisvoll, ganz so, als riefe er nach ihm. Weiden, bemerkte Theo und verstand. Er raffte seinen Habit, lief hinüber und schnitt fingerdicke Rindenstreifen vom Stamm. Weiß schimmerte der Bast darunter– wie Knochen. Er blickte sich um und sah den Bauern wimmernd zwischen den erdigen Schollen. Theo stolperte über den Acker zurück zu dem Alten. Er kniete neben ihm nieder, hob das ergraute Haupt an und schob dem Mann einen der Rindenstreifen zwischen die spärlich vorhandenen Zähne. »Kau!«, sagte Theo, und einen Lidschlag lang traf sein kristallklarer Blick den matten Blick des Bauern. Theo bemerkte Ehrfurcht in den Augen des Greises; auch das kannte er. Beruhigend sagte er: »Der Saft der Weide hilft dir gegen die Schmerzen«, und dachte dabei: ein wenig.
Während Theo den Pressverband über dem zerstörten Knöchel, den er aus seiner Kordel und dem Leinen seines Unterkleides hergestellt hatte, lockerte, schenkte er dem Alten ein Lächeln. Neues Blut pulsierte hervor, dort, wo der Knochen zertrümmert war und das Schienbein weiß hervorragte. Der Alte stöhnte auf. Theo ließ ihn.
Die Gedanken an den zerschundenen Leib seines Vaters holten ihn ein, die aus dem Körper getretenen Knochen, das sterbende Fleisch, das fahle, blutige Gesicht, damals vor zwei Wintern, als Friedrich vor dem Severinstor auf seinen Tod gewartet hatte. Theo spürte sie wieder, die Enge in seiner Kehle und den Abschiedsschmerz, bitter, trauervoll und endgültig. Oh Gott… oh mein Gott. Er verzog das Gesicht. Vor seinem geistigen Auge holperte der Käfigwagen, in dem sein Vater wie ein Tier gefangen saß, während der dumme Pöbel ihn verhöhnte und mit Unrat bewarf, durch die Straßen von Cöln, dann sah er wieder die Szenen der Belagerung, die Flucht, die Nachricht von der Ergreifung seines Vaters und, und, und.
In Theos Kopf dröhnte es. Er musste sich wieder besinnen. Dabei half es ihm, an das Band zu denken– das unzertrennbare Band zwischen ihm und seinem Vater, das sie damals mit Blicken gesponnen hatten. Keiner, kein Einziger, konnte es durchschneiden wie er die Rinde der Weide, wie der Henker die Sehnen und Muskeln seines Vaters.
Mit seinem Vater war aller Besitz, das Land um den Isenberg, die reiche Vogtei Essen, die Burg Nienbrügge mit den Grafschaften Heesen und Hœvel, gegangen. Als willfähriger Scherge des neuen Erzbischofs hatte sein Großonkel Ado von der Mark das Land besetzt.
Trauer und Wut über erfahrenes Unrecht stiegen in Theo auf. Er wischte sich eine Träne von der Wange. Er wollte sich alles zurückholen, so wie er es Vater versprochen hatte. Andererseits wog der Schatten der Schuld schwer. Wenn nicht mehr beim Papst in Rom, so galt seine Familie im Erzbistum immer noch als geächtet– dafür trug Erzbischof Molenark Sorge. Und wie sollte Theo gegen diese Übermacht einen Anspruch erheben?
Er zog die Binde wieder fest und fragte sich, wo nur der Jungbauer blieb. Er schaute in die Ferne. Vor Stunden war der Bauer auf einem schweren Ackergaul davongeritten, um Hilfe zu holen. Theo rieb sich die klammen Hände.
Hermann von Balk war kein Herr, der zu ungnädiger Bestrafung neigte. Doch der Landkomtur über die Ballei an Rhein und Ruhr musste etwas tun. Der Deutschorden war in eine Sinnkrise gerutscht und spaltete sich in engstirnige Glaubensbewahrer und dunkle Schwertbrüder. Einzig bei den Spitalbrüdern herrschte Frieden. Über sie, die Glaubens-, Ritter- und Spitalbrüder, herrschte er– nicht über Land, sondern über ein dicht gewobenes Netz klosterähnlicher Komtureien, gestifteter Rittergüter und Klöster, in denen ein frommes und arbeitsames Miteinander herrschte. Nun, herrschen sollte.
Die Stimme Hermann von Balks hallte im länglichen Kreuzgewölbe von Sankt Katharinen wider. »Name und Herkunft des Limburger Mündels in Euren Reihen müssen im Geheimen bleiben.« Er nahm seine Stimme etwas zurück. »Hört Ihr? Man würde ihm sonst nach dem Leben trachten.«
Über Balks mächtigem Oberkörper, geformt in Dutzenden von Schlachten, und seinem breiten Nacken thronte ein herrisches Antlitz– insgesamt eine gebieterische Erscheinung, geboren für den Kampf im Sattel.
Im Gegensatz dazu war Bruder Paracelsius, der blassgesichtige Vorsteher des Spitals, eher hager. Er musterte den Landmeister einen Moment lang. Theos Haus war dem Niedergang geweiht, seit sein Oberhaupt, Graf Friedrich, für den Mord an Erzbischof Engelbert wegen der Vogtei Essen zur Rechenschaft gezogen worden war. Das wusste jedermann im deutschen Norden. Der Junge hatte Talent, und einen so an den Rand der Gesellschaft Gedrängten konnte man dem Weltlichen leicht gänzlich entwenden. Ein kühler Luftzug ließ die Kerzen wie zum Zeichen, einen Vorstoß zu wagen, aufflackern. Außerdem wartete Hermann von Balk bereits mit hochgezogenen Augenbrauen auf eine Antwort. »Gewiss, Herr, der Junge, von dem Ihr sprecht, legt an Cornelia die Prüfung der Heiler ab.«
»Wie macht er sich?«
»Oh, er ist ein Junge mit wachem Verstand. Er würde sich durchaus zu einem guten Heiler eignen– einem sehr guten sogar.« Hoffnung, den Jungen doch halten zu können, keimte in Paracelsius auf, und schnell ergänzte er: »Im Feld hat er, ohne dass er es vorher hätte üben können, das Blut an einem Bein gestillt. Hätte der junge Bruder nicht abgebunden, geduldig bei dem Verletzten ausgeharrt und die Binde an dem Unterschenkel gelockert und wieder angezogen, wer weiß, mindestens der Unterschenkel wäre verloren gewesen.«
»Gut, gut«, sprach Hermann von Balk, »trotzdem gebt Ihr ihn an die Priesterbrüder ab. Wir haben anderes mit ihm vor.«
In Paracelsius’ erneutem Zögern lag dieses Mal Bedauern. Nach kurzem Abwägen gab er den Kampf um den talentierten Jungen auf. »Warum nicht nach Welheim zu Komtur Gerald wie die anderen, Herr?« Konnte er den Jungen schon nicht haben, wollte er doch wenigstens etwas über das Spiel der Mächtigen erfahren. Ihm war zu Ohren gekommen, dass Heinrich von Limburg den Kreuzzug des Kaisers anführen würde, und er fragte sich, ob Balk auf Weisung des Herzogs handelte. Balk schwieg, also hakte Paracelsius nach: »Hat diese Sonderbehandlung mit der Nähe zur Burg Deutz und dem Herzog vom Limburg zu tun?«
Hermann von Balk runzelte die Stirn. »Das lasst mal meine Sorge sein, Bruder. Ich traue Komtur Gerald nicht. Hier, in Cöln, im Schatten des Erzbischofes hingegen, ist der Junge sicherer als in Welheim, oder etwa nicht?«
»Aber ja, Herr, niemand außerhalb unserer Mauern bekommt auch nur einen Novizen zu Gesicht.«
»Außerdem«, gab Hermann nun etwas vertrauensseliger preis, »kommt die Order vom Deutschmeister selbst.«
»Von Hermann von Salza?« Paracelsius konnte sein Erstaunen nicht verbergen. Der Großmeister des Deutschordens war einer der einflussreichsten Männer im Reich, und Heinrich von Limburg schien mit ihm im Bunde.
»Salza vermittelt zwischen Papst und Kaiser, immerhin ist der Kirchenbann gegen Kaiser Friedrich noch nicht wieder aufgehoben. Der Limburger Herzog wurde zum Heerführer der Kreuzfahrer auserwählt.«
»Limburg, der Orden und der Kaiser«, sprach Paracelsius mehr zu sich selbst.
Hermann ging nicht weiter darauf ein. »Lasst uns jetzt über unseren eigenen Disput sprechen. Für Plaudereien bin ich nicht nach Cöln gekommen. Als sei der Rauswurf des Deutschordens aus Ungarn nicht genug, muss ich mich mit den ständigen Querelen zwischen den Ordenspriestern und Ordensrittern herumschlagen.«
2. KAPITEL
Frühjahr 1227
Ungläubig schaute Aleidis von Wildenberg, die Fürstäbtissin des Essener Stifts, auf das Pergament, das auf dem großen Schreibpult ihres Arbeitsgemaches lag und die Auflistungen der Einnahmen aus dem Handel sowie die Abgaben an den neuen Vogt Ado von der Mark zeigte.
Ihr Blick schweifte ab in ein unbestimmtes Nichts. Seit er Vogt Friedrich von Isenberg nachgefolgt ist, hat er den Tribut dreimal erhöht… Getan hat er dafür nichts, und ich habe um meinen Neffen gebeten, nicht um Ado, diesen Vielfraß, dachte sie und gebot ihrer Schmähung mit einem »Heilige Mutter Gottes, vergib mir meine Flüche« Einhalt. Und trotzdem, dachte sie, Vogt Friedrich hatte wenigstens den Anstand, es beim zehnten Teil unserer Einnahmen zu belassen. Wie kann ich Graf Ado nur loswerden…?
Mit einem erkennenden Blick fuhr ihr Kopf in die Höhe.
Der Märker macht es völlig offen und ohne Scham, ganz so, als fürchte er niemanden– nicht einmal Seine Exzellenz den Erzbischof. Und der ignoriert mein Recht auf Einsetzung eines eigenen Vogtes genau wie Engelbert, der Herr hab ihn selig.
Schnell bekreuzigte sie sich.
»Wie leicht wäre es, wenn ich meinen Neffen einsetzen könnte«, sagte sie laut und seufzte. Wieder flogen ihre Gedanken davon– zu Vogt Friedrich. Die Sünde ihres Lebens kam ihr in den Sinn. Allein um ihren Neffen zum Vogt zu machen, hatte sie sich in die Intrigen des Erzbischofes mit seinem Entvogtungserlass gegen ihren Vogt hineinziehen lassen.
Weil ich die Urkunden habe fälschen lassen, musste Vogt Friedrich sterben. Herr, vergib mir!
Wieder bekreuzigte sie sich.
Nein, so war es nicht, beruhigte sie sich. Das Erzbistum wusste immer, dass mein Stift eine Erbvogtei ist, also hätte Engelbert sie auch nicht einziehen können. Erst als Vogt Friedrich des Verbrechens bezichtigt wurde, konnte der Familie das Kirchenerbe entrissen werden. Mit oder ohne meine Urkundenfälschung. Seine Überfälle, seine falschen Anschuldigungen– Erzbischof Engelbert hat die Anlässe geschaffen, wie er sie brauchte.
Nun war sie wieder in der Gegenwart angekommen und konnte die Spinnweben der Vergangenheit fortwischen.
Wenn das Essener Stift nun also eine normale Vogtei ist, kann ich als Fürstäbtissin auch den Vogt benennen. Das ist mein gutes Recht… Was hätte Mutter gemacht?
Die Fürstin von Wildenberg, ihre Mutter, hätte ihr Anliegen von ihrem Fürstgatten eingefordert. Ein Selbstverständnis, in dem auch Aleidis aufgewachsen war. Sie hatte keinen hohen Gatten. Ihr Gatte war der Herr im Himmel. Doch auf der Erde war König Heinrich für sie verantwortlich und nicht der Erzbischof. Sollte sie zu ihm gehen? Aber an Seiner Exzellenz dem Erzbischof von Cöln konnte sie nicht einfach vorbeiagieren. An ihm hing der ganze Handel, und den setzte sie um keinen Preis aufs Spiel. Ein neuer Gedanke kam ihr.
Seine Exzellenz hat den Cölnern alle Rechte, Freiheiten und guten Gewohnheiten wiedergegeben, die sie vor Erzbischof Engelbert hatten. Er schmiedet Bündnisse, und dafür muss er den Seinen etwas anbieten. Vielleicht ist gerade jetzt sogar eine gute Zeit, Forderungen zu stellen…
Doch erneut kamen ihr Zweifel, ob der Erzbischof Graf Ado auswechseln würde. Immerhin hatte der die Drecksarbeit gemacht, und der Erzbischof hatte ihn dafür aus den Steinen der geschleiften Isenburg Blankenstein bauen lassen und ihn mit den Isenberger Gütern belehnt.
Ach was, ich gehe zu ihm… und zwar bei der Ankunft König Heinrichs und seiner Gemahlin, Margarethe von Österreich, in Cöln.
Einen besseren Zeitpunkt konnte sie kaum wählen, denn die Anwesenheit König Heinrichs, ihres Lehnsherrn, musste Erzbischof Molenark vor Augen führen, dass er nicht ihr Gebieter war.
Aleidis ballte ihre Faust. Augenblicklich jedoch bemerkte sie ihren kämpferischen Gestus. Schnell verbarg sie ihre Rechte in einer Falte des schwarzen Skapuliers, während ihr Blick im Raum umherschweifte. Wie kindisch, dachte sie. Keiner kann mich hier sehen. Sie erhob sich, ließ die Fingerspitzen über die Tischplatte aus Rotbuche gleiten, ging zum Fenster und öffnete es.
Draußen kämpfte der Frühling noch gegen die winterliche Kälte an, und vom Hof zog der Geruch eines vor Kurzem niedergegangenen Frühjahrsschauers zu ihr herauf. Die Eichenbalken der überdachten Umgänge an den Wirtschaftsgebäuden glänzten noch nass vom Regen. Die Pfützen im Hof hingegen waren fast verschwunden. Der Wind trieb weiter dichte graue Wolkenmeere über den Himmel.
Aleidis zog den feinen grauen Wollschal enger um den Hals. Mit Unbehagen sah sie Barthel auf dem Hof, den Medicus des Deutschordens, den ihr Bruder Paracelsius mit einem Novizen gesandt hatte. Sie zog den Kopf zurück, um nicht von ihm entdeckt zu werden. Es war ihr peinlich, dass ihr Stift dem Fieber, das sich unter den Schwestern ausgebreitet hatte, nicht selbst Herr wurde und sie die Deutschherren hatte um Hilfe bitten müssen.
Der Gestank übler Ausdünstungen verätzte seine Nasenschleimhäute. Werden wir das Fieber besiegen? Bruder Barthel sprach ein stilles Gebet, während er der kranken Nonne die Hand auf die glühende Stirn legte. Er bemerkte, dass der Novize neben ihm in dem stickigen Raum kaum zu atmen wagte. Der ständige prüfende Blick der beaufsichtigenden Nonne namens Gulda trug zu weiterem Unbehagen bei. Können sie uns nicht einfach unsere Arbeit tun lassen?, fragte sich Barthel und erschrak im selben Moment, denn sein junger Gehilfe schnellte plötzlich nach vorn, riss das Fenster auf und schnappte hastig nach Luft. Schwester Gulda wich empört zurück. Augenblicklich, noch bevor sie den Vorwitz maßregeln konnte, befahl ihm Barthel: »Bruder Theo, hol mir Wasser und Wickel. Lauf, sofort!«
Eilig griff der Novize nach der Schale mit dem trüben Wasser und wirbelte nur so aus dem Raum, die Treppen hinunter in den Hof des Klosters. Unten angekommen, prustete er so heftig aus, dass Barthel und Gulda es durch das geöffnete Fenster hören konnten. Nachsichtig ließ Barthel den Blick zur Decke schweifen, während Schwester Gulda nur bärbeißig das Haupt schüttelte.
Mit dem Eimer des Brunnens schöpfte Theo frisches Wasser. Am liebsten hätte er die lästige Nonne mit der ihr eigenen Inbrunst aus dem Fenster geworfen.
Er goss das Wasser in die Schale und stieg vorsichtig, aber zügig die Treppe wieder hinauf in die Krankenstube.
Das dicke Hinterteil der Schwester versperrte ihm den Weg. Zu gern hätte er sie einfach unsanft zur Seite gerempelt. Stattdessen entschied er sich für ein kaum hörbares »Verzeihung«, worauf Schwester Gulda ungelenk Platz machte.
Sie nahm wohl gar nicht wahr, wie ungeschickt sie war. Bei dem Gedanken verflog auch der letzte Rest seiner Bereitschaft, ihr höflich zu begegnen. Theo stellte die Schale auf dem Schemel neben dem Bett ab.
»Wo bekomme ich Wickel, Schwester?«, fragte er, während er den Blick fordernd, aber unbestimmt hob.
Die Nonne fuhr erbost auf und zeigte wieder die Treppe hinunter. »Beim Trappierer«, blaffte sie.
Ein frecher Unterton wollte Theo die Zunge verdrehen. Irgendwie schaffte er es jedoch, ein nur halbwegs leidliches Leiern anzuschlagen. »Wo finde ich ihn?«
»Über den Hof in das erste Gewölbe hinunter«, zischte die Nonne wie eine Viper.
Wortlos lief er wieder in den Hof und kam nach einer kurzen Weile mit dem Mull zurück.
»Du musst aufpassen, Theo«, sprach Barthel durch seinen leinenen Mundschutz, »es ist weithin bekannt, dass die Fürstäbtissin es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Glauben vor dem Verfall zu bewahren. Sie meldet dem Erzbischof jeden auch noch so kleinen Anschein von Hochmut. Für einen Adligen nicht das beste Empfehlungsschreiben.«
Theo ließ den Blick zu Boden wandern, nickte und nuschelte eine Entschuldigung. Den Rest der Arbeit verrichteten sie ohne weitere Worte.
Nach der Behandlung streiften Barthel und Theo ihre Leinengewänder ab und hängten sie zusammen mit dem Mundschutz an hölzerne Bolzen in der Rückwand der Remise, wo sie ihr Hab und Gut aufbewahrten und schliefen. Dann machten sie sich auf den Weg zum Stundengebet in die Stiftskirche.
Im Innern des nur spärlich von Kerzen erhellten Gotteshauses rückten sie in eine der freien Bänke, knieten nieder, senkten die Häupter und hielten Einkehr, bis eine Frauenstimme anhob.
Theo merkte auf. Heute las Äbtissin Aleidis selbst die Messe. Er musterte die Nonne. Dies war also die Frau, die seinem Vater das Leben schwer gemacht hatte. Er suchte nach etwas Bösem, Gehässigem oder Gütigem– etwas, das sie von den anderen Schwestern unterschied. Doch so lange er auch forschte, es gelang ihm nicht, irgendetwas zu finden.
Der Gegenstand ihrer Predigt war die christliche Tugend der Demut. Abwesend wanderte Theos Blick mal hierhin, mal dorthin. Es war die Zeit der Vesper.
Wieder eine Nacht in diesem fiebrigen Haus, dachte er. Wie viele würden es noch werden? Hoffentlich werde ich nicht krank bis zur Prüfung.
In der Kirche roch es angenehm– nach kalten Mauerblöcken, Kalk und Mörtel–, doch es war kühl. Die Kälte kroch an ihm herauf. Eine steinerne Grabplatte fesselte Theos Aufmerksamkeit. Etwas ging aus von dieser Platte, das spürte er. Nur ein»A« und ein»I« konnte er im Kerzenlicht entziffern. Er beugte sich weit vor, so weit, dass Barthel ihm fest in die Rippen knuffte. Theo beschloss, am Morgen zurückzukommen, um die Steinplatte genauer zu begutachten.
»Was machst du hier, Novize? Habt ihr draußen nicht genug zu tun?«
Theo erschrak. In der Nähe des Altars stand die Fürstäbtissin. »D-Doch, hochwürdige Mutter Oberin. Ich… ich wollte nur wissen, wer hier ruht.«
»Was interessiert es dich, wer hier seine letzte Ruhe fand? Komm mal her.«
Theo ging ein paar Schritte auf sie zu, blieb dann stehen.
»Komm her, sagte ich!«
Er machte noch einen Schritt und sprach zögerlich: »Die Inschrift zog mich in einer eigentümlichen Weise an, und ich beschloss, sie mir bei Tageslicht anzusehen.«
»Aha. Wie ist dein Name?«
»Theo.«
»Theo. Und wie weiter?«
Er musste an die Warnung seines Oheims denken, nicht einmal jemandem, dem er vertraute, seinen Namen preiszugeben. Und einem Beutelschneider auf dem Cölner Heumarkt hätte er eher vertraut als dieser Stiftsdame, die bereits bewiesen hatte, dass sie gegen seine Sippe stand. Zu gern hätte er sie am Kragen ihres Habits gepackt und ihr die Schmach seiner Familie, an der sie Schuld trug, ins Gedächtnis gerufen.
Doch Theo versuchte, sich zusammenzureißen, und unterdrückte seinen Gram. »Bruder Theo, weiter nichts, hochwürdigste Äbtissin.«
»Weiter nichts?«
Er wusste, dass Kinder häufig vor Klosterpforten abgelegt wurden, damit sie bei den Geistlichen aufwuchsen. Arglos dreinschauend, hob er die Schultern. Er spürte die Genugtuung, die ihm die Täuschung der Äbtissin bereiten würde, käme er mit seiner Lüge durch. »Meine Eltern sind tot. Ich bin Waise. Ich wurde dem Orden übergeben. Einen weiteren Namen als den genannten kenne ich nicht, ehrwürdigste Äbtissin.«
Theo bemerkte die prüfenden Blicke und wähnte sich schon durchschaut. Er spürte Angst in sich aufkeimen.
Plötzlich herrschte Aleidis ihn an: »Mach, dass du rauskommst, und geh zurück an die Arbeit! Ich habe anderes zu tun. Und es heißt Fürstäbtissin!«
»Sehr wohl, durchlauchtigste Fürstäbtissin.« Er verbeugte sich kurz und suchte, so schnell er konnte, das Weite.
Als er auf den hellen Klosterhof trat, blendete die tief stehende Sonne sein Auge. Drei Namen hatte er, trotz der jähen Unterbrechung, lesen können: EberhardI., Arnold und Friedrich. Alle entstammten sie dem Geschlecht derer von Altena.
Dies ist unsere Grablege. Hier liegen alle Erbvögte, mein Großvater und dessen Vater und Großvater. Nur Vater nicht.
Theo vermied es nach der Begegnung mit der Fürstäbtissin zwei weitere Wochen lang, erneut unangenehm aufzufallen, und auch Aleidis vergaß, sich nach dem neugierigen Novizen aus der Kirche zu erkundigen.
Dann war es Bruder Barthels Heilkünsten zu verdanken, dass das Fieber zurückging und der Abschied aus Essen-Werden in greifbare Nähe rückte. Theo trug die schmutzigen Leinengewänder und sonstige verwendete Stoffe zu einem Haufen zusammen. Zur Laudes hatte er sämtliches Tuch zu einem beachtlichen Berg aufgehäuft. Von der steten Arbeit müde, streifte er sein eigenes Leinenhemd ab und warf es zu guter Letzt ebenfalls auf den Haufen. Dann machte er sich auf, die Dankesmesse des Essener Stifts zu empfangen.
Wieder hielt die Fürstäbtissin die Andacht. Mehrere Male war es Theo, als blicke sie zu ihm herüber. Er wollte sich ihrer erneuten Aufmerksamkeit entziehen, verbarg sich hinter den vor ihm Knieenden und linste nur hervor, wenn ihr Blick zur anderen Seite wanderte.
Als sich endlich die Tore des Stifts hinter Barthel und ihm schlossen, drehte sich Theo ein letztes Mal um. Er sah die Fürstäbtissin, wie sie vor dem brennenden Haufen stand und ihnen nachschaute, als wolle sie mit ihren Blicken einer offengebliebenen Frage Antwort erhaschen, bevor es zu spät war.
Theo war, als hörte er die Oberin Barthels Namen rufen. Er trieb den Medicus an, schneller zu gehen. Dann lag das Kloster weit hinter ihnen. Der Geruch fiebrigen Schweißes, verbrannter Kleidung und Haare haftete noch lange in ihren Nasen; die misstrauische Oberin hingegen war Theo fürs Erste los.
»Seit der Hinrichtung der Verschwörer hat sich die Stadt kaum beruhigt, Herr.« Stadtvogt Endrich von Eppendorf lehnte sich an einen der Fenstersimse im Arbeitsgemach der erzbischöflichen Residenz gegenüber dem Hildebold-Dom aus karolingischer Zeit. »Der Pöbel gebärdet sich nicht weniger frech und aufmüpfig als die hochnäsigen Patrizier.«
»Was meint Ihr?«, fragte Erzbischof Heinrich von Molenark.
»Die von der Mühlengasse, Erenpfortens und die Overstolzen, haben bei mir vorgesprochen und Wiedergutmachung für die Häuser, die wir angezündet haben, gefordert. Andernfalls, so drohen sie, bringen sie die Sache vor den Reichstag.«
»Undankbares Pack. War nicht ich es, der die alten Räte wiedereingesetzt und den Zünften alle Rechte verliehen hat, die ihnen Engelbert genommen hatte?«
»Diesen Herren aber nicht, Herr.«
»Sie gehörten ja auch diesem Verschwörerbündnis Sapientis an. Die Weisen, dass ich nicht lache, das wäre ja noch schöner… Und, was ist mit dem Pöbel?«
»Meine Büttel berichten mir von ihren Zuträgern, welcher Art das Laster, der Zerfall und die Verwahrlosung sind und dass sie wie hungrige Wölfe an dem guten Ruf unserer Stadt zehren. Das bringt allerlei Gesindel nach Cöln, nur die ehrenwerten Kaufleute ziehen mittlerweile Lüttich oder Gent uns vor.«
»Das muss aufhören!« Molenark geriet aus der Fassung. Beim Handel und beim Geld war er empfindlich. »Was gedenkt Ihr zu tun, Eppendorf?«
Der Stadtvogt mit den Gesichtszügen eines Bluthundes und seinem geschorenen Haar räusperte sich. Er wusste, dass der eingesessene Adel auf den Erzbischof, der aus dem niedrigen Ritteradel kam, herabschaute und ihn überheblich Erzbischof Leinenhose nannte. »Mit dem Abschaum werde ich fertig. Allerdings nur, wenn ich mehr Büttel bekomme und mehr Zuträger bezahlen kann.« Erzbischof Molenark wand sich beklommen auf seinem goldenen Lehnstuhl, doch der derbe Stadtvogt sprach weiter: »Schüchtert den Stadtadel ein. Statuiert ein Exempel an den Vögten, Euer Exzellenz. Der Krieg gegen Engelbert hat sie geschwächt, und ihr Anführer ist tot.«
Mit den Vögten meinte der Stadtvogt die Herren von Limburg-Berg, Jülich, Kleve, Brabant und eine Reihe weiterer Adeliger.
»Der Entvogtungserlass besteht weiterhin. Jeder Vogt, der sich erhebt, erhebt sich gegen die Kirche. Engelbert hat Euch förmlich das Instrument der Inquisition hinterlassen, Durchlaucht.«
»Engelbert, Engelbert, Engelbert!«, kreischte der Erzbischof. »Ich kann es nicht mehr hören. Wollt Ihr mir jetzt auch noch weismachen, dass er im Jenseits Gutes tut? Während Ihr, das Domkapitel und sonst jedermann ihn zum Märtyrer macht, muss ich hier seinen Mist aufkehren. Ich bin es, der seine Schulden wettmachen und den widerständigen Adel niederhalten muss! Und glaubt mir, der Schuldenstand übertrifft den Betrag, der in Cöln kursiert, um ein Vielfaches. Allein die Garden aufzustellen und den Zehnten von den eingezogenen Vogteien einzuziehen, kostet mich ein Vermögen. Engelbert hat sich mit seinen Krediten eine starke Stellung im Reich erkauft und das Erzbistum erst in die Krise gestürzt.«
Molenark unterließ nichts, um Engelbert als Schuldigen an der Misere des Erzbistums hinzustellen und dessen untadeligen Nimbus zu schmälern.
»Wie, meint Ihr«, fuhr der Erzbischof mit hochrotem Kopf fort, »soll ich da eine Inquisition betreiben? Ich brauche Truppen. Und Truppen kosten Geld, viel Geld, Stadtvogt!« Er hob den Blick zum hölzernen Himmel der Kassettendecke und rief: »Ein schönes Erbe hast du mir da hinterlassen!«
»Wurde unter Engelbert nicht die Domerweiterung beschlossen, um der Pilgerei zum Schrein der Heiligen Drei Könige mehr Raum zu geben?«
»Eppendorf, jetzt fangt nicht das Spinnen an. Erstens verschlingt der Umbau Unmengen an Geld, und meint Ihr etwa, hätten wir es zusammen, ginge es von jetzt auf gleich?«
Eppendorf blickte über dem großen Platz, auf dem heute nur wenig Treiben zu sehen war, zur Dombauzeche. »Kann nicht Euer Vetter, Henrik von Sayn, aushelfen?«, sprach der Stadtvogt, den Blick nach draußen gewandt. Molenark schwieg und widersprach zumindest nicht, was Eppendorf fortzufahren ermutigte. Er wandte sich wieder seinem Dienstherrn zu: »Wenn Ihr nur einen Vogt niederwerfen könnt, schlagt Ihr zwei Fliegen auf einmal. Der Adel würde Euch Respekt zollen, und Ihr hättet genug Einnahmen, um Truppen zu bezahlen. Nehmt Limburg oder Tecklenburg!«
Eppendorf hatte diese beiden Namen mit Bedacht gewählt, denn sie waren die engsten Vertrauten des Grafen Friedrich, dem Mörder Erzbischof Engelbert von Bergs, gewesen.
»Heinrich von Limburg-Berg wird den Kreuzzug des Kaisers anführen. Bis er zurück ist, kann ich keine seiner Vogteien angreifen. Der Papst würde mich vierteilen«, wiegelte Molenark ab. »Tecklenburg sitzt zu weit in Westfalen, das würde hier niemand mitbekommen. Außerdem zermürbt ihn der Bischof von Osnabrück nach allen Regeln der Kunst… Aber ich könnte mit Jülich beginnen.« Ein Lächeln huschte über sein pockennarbiges Gesicht. »Bevor ich Derartiges betreiben kann, muss ich König Heinrich von Staufen auf meiner Seite wissen. Ich lade mich nach Frankfurt ein.«
»Aber, Herr, der befindet sich mitten in den Krönungsvorbereitungen«, gab Eppendorf zu bedenken.
3. KAPITEL
Frühjahr 1227
Bei den Priesterbrüdern von Sankt Katharina zu Cöln folgten Theos Tagesabläufe nun einige Wochen dem immer gleichen Muster: vom monotonen Wechsel der Stundengebete mit der Arbeit in den Gärten und Stallungen, auf dem Feld, im Wald, in der Küche, im Skriptorium, in der Trapperie und in der Wäscherei. Vigil, Arbeit, Laudes, Arbeit, Terz, Lesungshoren in Latein oder Griechisch, Sext, Arbeit, Non, Studium der Algebra, Vesper, Arbeit, Komplet, das große Stillschweigen um Mitternacht, Schlafen, Aufstehen und so weiter und so weiter. Die vierte Stunde war meist die Zeit des ersten Gebets, die um Mitternacht die letzte des Tages.
Jegliches Verhalten war auf die Maßregelung der sieben Todsünden Hochmut, Geiz, Neid, Zorn, Wollust, Völlerei und die Trägheit des Herzens, die Melancholie, gerichtet. Hauptsächlich wurden die Novizen zur Einhaltung der Maze– der Mäßigung– als Gegenstück des Hochmutes angehalten. Alles geschah in gleichmütiger und demütiger Haltung. Geschlagen wurde hier nicht, gelacht aber auch nicht, und Ausgang in die Stadt war ebenso wenig erlaubt.
Von den Heiligen verehrte Theo Maria Magdalena am meisten, denn er vermisste die Herzenswärme und Ansprache, und auch sie– so schien es ihm– war von den Menschen an den Rand der Gemeinschaft geschoben worden. Hierin fühlte er sich ihr nahe, seit ihm der Erzbischof seine Eltern genommen hatte.
Auch den Tod seiner Mutter führte er in seinem Hassbuch gegen Erzbischof Molenark.
Sein innerer Kampf jedoch galt dem Gefühl, als Sohn eines Verurteilten und Hingerichteten von minderem Wert zu sein. Wie einen schwarzen Klumpen trug er diese innere Regung seit jenen grauenhaften Tagen im vergangenen November in seinem Gemüt.
Eines hatte die Zeit in Sankt Katharina für sich: Theo hatte von den Brüdern gelernt, obwohl ihn alle Welt etwas anderes hatte glauben machen wollen, dass auch die Sprösslinge eines Verstoßenen und Verurteilten zu den Kindern Gottes zählten.
Müde von der Arbeit ließ Theo sich nach einem arbeitsreichen Tag auf seine Pritsche fallen und schlief sofort ein. Mitten in der Nacht wachte er vom Schrei einer Eule auf, von da an suchten ihn Gedanken heim, und er wälzte sich unruhig auf der Bettstatt. Stimmen sprachen zu ihm. Er begann, mit ihnen zu streiten. Auf einmal trat Ruhe ein. Sein Atem wollte gerade wieder regelmäßig werden, und er war froh, weiterschlafen zu können, da hörte Theo vertraute Stimmen, die gleichzeitig zu ihm sprachen: »Geh und finde Einhard.« Er wachte auf. Die Nacht schimmerte noch silbrig in seine Kemenate, doch an Schlafen war nicht mehr zu denken. Diesen Satz sollte er im Laufe des nächsten Jahres immer wieder des Nachts hören, bis zum Tag, an dem er seine Glaubensprüfung ablegte.
Mit dem Empfang zu Cöln und der anschließenden Krönung Margarethes von Österreich in Aachen hoffte Erzbischof Heinrich von Molenark, ein enges Band mit dem Stauferkönig zu knüpfen. Er und König Heinrich waren sich einig: Stärkten sie die Städte, schwächte dies die Herren von Kleve, Jülich, Berg, Brabant und besonders Limburg, und sie waren es namentlich, die sein Cöln bedrohten. Zufrieden, dass sein Plan aufging, wartete er scheinbar arglos auf das Schiff mit dem königlichen Paar. Doch Fürstäbtissin Aleidis hatte ihre Augen fest an ihn geheftet.
Das Treiben an den Anlegestellen glich einem Jahrmarkt der Eitelkeiten, kaum ein Platz war am Hafen zu ergattern, so eng stand die Empfangsgesellschaft aus Adligen, Klerikern und Cölner Bürgern. Das Volk hingegen wurde von Eppendorfs Bütteln ferngehalten. Doch über allem war das laute Schreien der Möwen vernehmbar.
Jetzt, da die wimpelgeschmückte Barkasse des Königs in Sicht kam, musste Aleidis sich beeilen, durch die bunte Menge zum Erzbischof vorzudringen. Doch auch die königliche Gesandtschaft mit dem königlichen Wagen setzte sich in Bewegung und schob sich zwischen sie und den Erzbischof. Eilig drängte sie sich an einigen reich gewandeten Adligen vorbei, um auf die Seite bei den Kais zu gelangen, an der der Erzbischof wartete. Nach einigen Mühen sah sie endlich wieder Molenarks edelsteinbesetzte Mitra wie eine bunte Kogge auf hoher See hin und her wogen. Zielstrebig schlängelte sich Aleidis vor, bis sie die Mitra direkt vor sich hatte.
»Eure Erzbischöfliche Gnaden«, sprach sie in das blatterige Gesicht Erzbischof Heinrichs darunter. »Ich muss Euer Exzellenz’ Aufmerksamkeit für einen kurzen Augenblick beanspruchen.« Sie bemerkte ein nervöses Zucken in Molenarks wächsernen Zügen und vernahm ein Raunen, das so ähnlich klang wie »Gott, gütiger!« und an den neben ihm postierten Weihbischof Gerald, den Priesterkomtur von Welheim, gerichtet schien.
Gequält lächelnd, nahm Molenark ihre Hand zum Gruß entgegen und deutete eine Verbeugung an. »Liebe Schwester«, stammelte er, als verlangsamten gewichtige Gedanken seinen Redefluss, »was kann ich für Euch tun an diesem feierlichen Tage?«
»Mein Anliegen ist Euch nur zu bekannt, Exzellenz. Ich muss Euch nicht bitten, aber ich will Euch einbeziehen– zum Erhalt unserer guten Beziehungen.«
Weihbischof Gerald blickte streng. Und Aleidis bemerkte ein überlegenes Lächeln in Molenarks Augen. »Das Stift Essen braucht endlich einen gottergebenen Vogt!«, sprach sie energisch in das Grinsen. »Jetzt, nach den Isenbergern, ist der Moment gekommen, das Stift der Kirche zurückzugeben. Und ich kann Euch versichern, zwischen dem kommissarischen Vogt Ado und Vogt Friedrich von Isenberg besteht so gut wie kein Unterschied. Ich will meinen Neffen dort sehen. Wagt es also ja nicht, dem Märker die Vogtei zu bestätigen!«
Heinrich von Molenark legte seine Hand auf ihren Unterarm. »Liebste Schwester, Fürstäbtissin, droht mir nicht.« Sein Mund lächelte, doch seine braunen Augen blieben kalt. »Dies liegt nicht allein in meiner Hand, aber ich werde mich an richtiger Stelle für Euch verwenden. Und jetzt seht, das königliche Schiff legt bald an. Ich muss mich um meine Gäste kümmern.« Er trat einen Schritt nach vorn. »Ich versichere Euch, wir werden eine Lösung im Sinne der Heiligen Mutter Kirche finden«, sprach er, während er bereits auf die Holzbohlen des breiten Steges trat, wo sich die Bootsleute die Leinen zuwarfen.
Die Rufe wurden lauter. Gerald blickte zum Abschied geringschätzig auf Aleidis herab und folgte dem Erzbischof, der Aufstellung zur Flussseite nahm. Schon wurde die Kogge mit Tauen zu den Pollern herangezogen und die Landungsbohlen ausgefahren.
Aleidis schaute dem Erzbischof unsicher nach. Hatten ihre Worte ihn erreicht? In diesem Schwebezustand sollte sie den Rest des Jahres zubringen, denn Molenark ließ nichts von sich hören.
4. KAPITEL
Frühjahr 1228
Bereits am Morgen nach der Glaubensprüfung hatte sich Theo bei winterlicher Kälte mit einem Kahn nach Deutz bringen lassen. Nun saß er seinem ungeliebten Oheim Heinrich von Limburg gegenüber, der sich im Lehnstuhl seines Arbeitsgemaches in seiner Deutzer Burg zurechtrückte. Die Flammen züngelten in den Kaminen und Feuerschalen.
»Theo«, sprach Heinrich von Limburg, »der Kaiser hat den Kreuzzug auf den Frühsommer verschoben. Ich habe dich, bevor ich die Truppen ins Heilige Land führe, herrufen lassen. Ich will sehen, ob du an der Rückerlangung der Grafschaft teilhaben kannst, denn es heißt, du scheinst recht mutlos und voller Zweifel.«
Theo fühlte sich ob der Worte seines Oheims herausgefordert.
Er denkt wohl, dass er mich in irgendeiner seiner Burgen als Höfling am Leben hält, damit ich seine Ansprüche auf mein Land legitimiere, aber ich habe meinem Vater Rache geschworen.
»Wenn du mir sagst, dass du dem Kampf um deine Grafschaft gewachsen bist, schicke ich dich in die Kommende Ramersdorf.«
Erschrocken gab Theo seine Zurückhaltung auf, die er seit dem Zögern seines Oheims vor Cöln in den Novembertagen des Jahres 1226 bewahrt hatte. »Herr, ich kann noch nicht so bald nach Ramersdorf. Ich… ich… Vater und Mutter sind mir in einem Traum erschienen.« Er musterte seinen Oheim unsicher, denn er rechnete damit, umgehend des Raumes verwiesen zu werden.
»In einem Traum?«, wiederholte der Herzog ungläubig. Mit einem Nicken begehrte er, mehr zu wissen.
»Es waren nur die Worte ›Geh und finde Einhard.‹«
»Ein Traum, mehr nicht. Gib nicht zu viel darauf!«
»Herr«, wollte sich Theo rechtfertigen, »in Sankt Katharina…«
»Schon gut, schon gut! Ich will nicht gegen den Orden sprechen, aber was willst du tun?«
»Herausfinden, wer dieser Einhard ist. Wisst Ihr es, Oheim?«
Heinrich dachte kurz nach, bevor er antwortete: »Nein, einen Mann dieses Namens kenne ich nicht.«
Theo spürte verzweifelte Hilflosigkeit in sich aufsteigen.
»Warte!«, sprach der Oheim. »Wenn es um die alte Gefolgschaft Friedrichs geht, weiß ich vielleicht Rat.« Er griff eine Glocke und läutete.
Augenblicklich kam ein Knappe herein. »Ihr wünscht, Herr?«
»Hol mir Cedric.«
Der Mann verschwand ebenso schnell und demütig, wie er gekommen war.
»Es gibt nur ein Problem, mein Junge.«
Theo schaute seinen Oheim aufmerksam an.
»Der Tag für Ramersdorf ist festgeschrieben.«
»Welcher Tag ist es, Herr?«
»Mariä Heimsuchung.«
»Dann muss ich sofort gehen.«
»Ich hätte dich gern eine Zeit hier gehabt, bis ich auf den Kreuzzug gehe, Theo.«
Es klopfte an der Tür. Theo sprang auf und öffnete dem Knappen Cedric.
»Herr, Ihr schickt nach mir.«
»Kennst du einen Mann namens Einhard?«
Cedric schaute erst zu Theo, dann zum Herzog. »Er ist ein alter Einsiedler– ein wirrer Kauz, wenn Ihr mich fragt. Aber mein alter Herr, Euer Schwager, ritt des Öfteren in die Sauerlande. Dann sprach er lange Zeit mit ihm.«
Theo horchte erleichtert auf.
Dann kennt er meinen Vater gut. Ich muss diesen Einhard treffen, dachte er.
»Großartig, Cedric«, dankte der Herzog dem Knappen.
Der nickte kurz. »Herr, kann ich sonst noch etwas tun?«
»Ja, stell einen Conroi zusammen. Für die Sicherheit meines Neffen. Ihr reist in Feindesland.«
»Herr, mit Verlaub«, wandte Cedric ein, »wir müssten mit einem Heer reisen, um ihn zu schützen.« Cedric nickte zu Theo hinüber. »Die Unauffälligkeit sollte in diesem Fall unser Schild sein.«
Herzog Heinrich überlegte kurz. »Also gut. Dann bereite alles vor. Und, Cedric… du bürgst für ihn mit deinem Kopf.«
»Sehr wohl.« Der erfahrene Knappe verbeugte sich und verließ das Gemach, wobei er Theo mit einem Schmunzeln zuzwinkerte.
Am liebsten hätte Theo mit einem Lächeln geantwortet, doch er war dem Herzog zugewandt und wollte ihm seine Erleichterung nicht zeigen.
»Dieser Einhard hat Friedrich die falschen Ratschläge gegeben. Er und niemand anderes ist an unserem Unglück schuld«, empörte sich Theos Onkel Wilhelm, als ihn Herzog Heinrich zu Deutz über Theos Pläne unterrichtete.
»Auf wessen Seite steht er also? Auf der Ados?«, höhnte Heinrich voll Ironie.
Wilhelm hob die Schultern. »Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er meines Bruders Sinne in die falsche Richtung gelenkt.«
»Unsinn, hätte die Gefangennahme Engelberts geklappt, würde Einhard, oder wie er sich schimpft, jetzt als klug und weise gelten.«
»Das hat sie aber nicht. Es heißt, er sei ein böser Zauberer, der seit Jahren durch die herrenlosen Lande streift und wie ein Gograf Urteil hält.«
»Ihr meint, er erhebt sich über den Adel?«
»Ja, das sagen die Leute, und ich glaube es.«
»Er glaubt es!«, rief Heinrich. »Ihr sucht einen Schuldigen, um Euren Bruder reinzuwaschen.«
»Ich will nicht mit den falschen Leuten im Bunde sein, wenn es gilt, unsere Lande zurückzugewinnen.«
»Was wollt Ihr also tun?«
»Ich werde Theo finden und ihn aufhalten. Man sollte diesem Einhard den Garaus machen.«
Theo und Cedric hatten Burg Altena hinter sich gelassen und waren tiefer in das Land der tausend Berge geritten. Je weiter das Auge blickte, umso schemenhaft heller wurden sie. Kleine Bäche sprudelten unter Eiskristallgewölben die Höhen hinab. Erste Vögel rührten im Gehölz. Mit allen Sinnen nahmen Theo und Cedric die ruhige Stimmung wahr. Gab die Natur den Blick frei, sahen sie unberührte wintermatte Wiesen, die an finstere Tannen und kahle Eichenwälder grenzten. Sie erreichten eine weite Hochebene, auf der, einer Herrscherin über alle Bäume gleich, eine riesige Eiche stand. In ihrem Schutz errichteten sie ihr Lager für die Nacht. Während sich Cedric um das Feuer kümmerte, stellte Theo einen Windschutz aus jungen Erlen her, wie es ihm sein Vater gezeigt hatte.
»Da werden wir eine gute Nacht drin haben«, sagte der Knappe zufrieden, als Theo sein Werk an die Eiche lehnte.
Im Dämmerlicht kauerten sie sich vor das Feuer und aßen das, was sie an Proviant mit sich führten.
»Meinst du, das Feuer verrät uns?«, fragte Theo.
»Wollen wir das nicht– von Einhard gefunden werden?«
»Und wenn es Räuber sind?«
»Hier sind wir sicher. Wahrscheinlich weiß der alte Rabe schon längst, dass wir hier sind, und sieht nach uns. Trotzdem werden wir abwechselnd schlafen und wachen. Ich schlafe so oder so auf meiner Liebsten.« Cedric tippte auf das Heft seines Kurzschwertes.
Pierre entriegelte die Tür und trat ein. Mit dem jungen Mann im Mönchsgewand strich ein kalter Hauch in die warme Stube.
Einhard schaute unwillig von seinem Folianten auf und grummelte: »Pierre.«
Pierre hängte seinen Mantel an einen der hölzernen Zapfen an der Wand und kam näher. Während er die Hände dem warmen Feuer entgegenreckte, sagte er: »Bei der alten Eiche am Hegenscheid habe ich einen jungen Reiter mit seinem Knappen gesehen.«
»Von der Sorte gibt es viele.«
»Sie hätten über die Wolfsegge reiten können. Stattdessen nahmen sie die steinerne Brücke und ritten den Born hinauf. Mir war, als mieden sie die Gegend um die Burg und hielten sich im Verborgenen.«
»Immer noch nichts Besonderes«, befand Einhard, die kantige Nase unbeirrt in die Seiten vertieft.
Pierre lächelte. Dieses Spiel, den Älteren zu überzeugen und dabei Spannung aufzubauen, hatten sie über die Jahre eingeübt, unter anderem, damit die Zweisamkeit gegenüber der Einsamkeit den höheren Wert behielt.
»Ich bin ihnen bis zum Hegenscheid gefolgt, wo sie an der hohen Eiche ihr Nachtlager aufgeschlagen haben.«
Einhard wurde aufmerksam und schlug das Buch zu. »Dummköpfe. Wenn sie wollen, dass ihnen die Kehlen durchgeschnitten werden… Und, was war jetzt besonders an ihnen?«
Pierre hätte Namen nennen können, denn er kannte Cedric aus alten Tagen. Er tat es nicht. »Die Satteldecken.«
»Wie?«
»Das Wappen.«
Einhard zog die Brauen hoch und schaute auffordernd zu dem Jüngeren herüber.
»Sie trugen den Limburger Löwen.«
Einhard schien kurz nachzudenken, dann beugte er sich vor. »Theo! Das ist Theo! Friedrich hat ihn mir gesandt!« Der Alte bekreuzigte sich und flüsterte: »Nun wird das letzte Lied gesungen.«
»Sollen wir ihn jetzt noch holen?«, erkundigte sich Pierre.
»Wir gehen heute Nacht raus und treffen ihn morgen früh, wenn er ausgeruht ist. Lass uns zu Bett gehen und ein paar Stunden Schlaf nehmen.«
Die Glocke schlug zur Laudes. Wilhelm rüstete sich im Halbdunkel und verließ Burg Deutz. Schweigend grüßte er die Wachen, während die Hufe seines Schlachtrosses auf dem Pflasterstein unter dem Torbogen widerhallten.
Ab dem Helinkiweg, der alten Heerstraße, die sein Bruder Friedrich einst wiederhergerichtet hatte, folgte er der Ennepe bis zur Volme, diese durchritt er, und zwischen Sext und Non sah er Kloster Elsey vor sich liegen. Die Lenne riss träge an seinem Sattel, als er sie durchquerte. Die Mauerzinnen des Klosters waren von Efeu berankt, und anders als vor zwei Jahren reichte das Blätterwerk bis in den Torbogen. Wilhelm ritt durch die Klosterpforte. Er musste schlucken. Hier lagen die Gebeine seines Bruders, hier war seine gestrenge Mutter Herrin. Eine Glocke wurde geschlagen. Die Nonnen im Hof verbeugten sich.
»Als ob ich das nicht selbst wüsste! Wofür bezahle ich Euch? Damit Ihr mir Sachen sagt, die ich längst weiß?«
»Wie Ihr meint, Eure hochwürdigste Exzellenz.« Der bullige Stadtvogt von Cöln, Endrich von Eppendorf, ließ sich seinen Ärger nicht ansehen.
»Was habe ich mir da nur eingebrockt! Ohne Geld keine Macht! Ohne Macht kein Geld!«, presste Erzbischof Heinrich von Molenark mit rot äderigen hervortretenden Augen heraus.
Abgestoßen von dem ewigen Jammern seines Herrn, wandte Endrich von Eppendorf den Blick ab. Er dachte an die Gelder, die er einzutreiben hatte. Zur Verbesserung der Finanzlage überlegten sich das Kapitel und der Rat immer neue Strafen und Gebühren, um die Bürger, Bauern und Reisenden zur Kasse zu bitten. Falschmünzer wurden zur Abschreckung geschmökert. Für das Umgehen des Torgelds setzte es zwölf Taler und zwei Tage Käfig. Mundraub kostete ein Ohr. Ein Gartendieb wurde ins Wasser getaucht. Ruhestörer oder Flucher verbrachten einen Tag im Halseisen vor dem Rathaus. Kurz, die Menschen fürchteten die Obrigkeit und zahlten.
Doch Geld- und Leibesstrafen waren die eine Sache, die andere Sache blieb die Frage, wie stark Endrich die Daumenschrauben noch anziehen konnte, ohne einen weiteren Aufstand zu riskieren. Mit Schrecken erinnerte er sich der brennenden Häuser und des brandschatzenden Pöbels vor zwei Jahren, als Erzbischof Molenark Friedrich von Isenberg hatte aufs Rad flechten lassen. Endrich hatte die Gassenhauer geschickt, und dann war alles über ihn hereingebrochen. Mit Mühe und Not hatte er den Aufstand niedergeprügelt und wusste doch, welch ein Unrecht er da angeordnet hatte.
Wilhelm klopfte sich den Staub vom Wams, als eine Nonne in den Hof trat.
»Junger Herr!«, rief sie.
Wilhelm staunte über die Freude der Kammerfrau seiner Mutter, als er den Blick von seinen nassen Beinlingen zu ihr hob. Auch er hatte sie immer sehr gemocht, damals, als die Familie noch auf dem Isenberg lebte.
»Isabelle«, antwortete er wie aus fernen Tagen.
Schon hatte sie ihn erreicht, kniete vor ihm nieder und hob die Hände zu ihm hinauf. »Wilhelm, mein kleiner Wilhelm.«
Er zog sie auf die Füße. Am liebsten hätte er die Nonne umarmt; doch das ging nicht.
»Wie groß und stattlich du geworden bist. Und ganz nass bist du. Komm, wir trocknen dir die Kleider, dann bringe ich dich zu deiner Mutter.«
Trotz der vergangenen Zeit stand seine Mutter vor ihm wie eh und je. Er konnte kein Altern in dem vom Schleier und Gebende umrahmten Gesicht erkennen. Auch war Wilhelm, als hätte die Mutter ihre würdevolle, unnahbare Haltung seit ebendem Tag, als sie aus Isenberg ausgezogen war, unverändert beibehalten. Er sah sie noch vor sich, wie sie den langen Zug aus Familie, Besatzung und Gesinde aus der Burg führte. Dank ihr hatte er sein Schwert, sein Pferd und seine Rüstung behalten dürfen– und seine Würde. Seitdem lebte sie mit einigen Frauen in dem Prämonstratenserinnenkloster, ihrer Leibzucht.
Seine drei älteren Brüder bekleideten auskömmliche Kirchenämter. Dafür hatten Dietrich und Engelbert noch in ihrer Zeit als Bischöfe von Münster und Osnabrück sorgen können. Nun, nachdem die Isenburg in Trümmern lag und Erzbischof Heinrich von Molenark die Sippe auszulöschen suchte, hatten sie für ihren jüngsten Bruder Wilhelm kein Kirchenamt mehr finden können. So war er an den Deutschorden gekommen und hätte in Bornhöved fast sein Leben gelassen.
»Mutter.« Wilhelm trat näher.
Mathilde hielt ihrem Sohn die Hand mit dem Ordensring zum Kuss hin. An der anderen sah er den goldenen Ring, den Vater ihr zu ihrer Vermählung angesteckt hatte. Es beruhigte Wilhelm. Immerhin hat sie ihre Wurzeln nicht vergessen, dachte er, nahm die vor ihm schwebende Hand und beugte das Haupt zum Kuss.
»Mein Junge«, sagte sie milde lächelnd, trat einen Schritt zurück und betrachtete ihn von oben bis unten. »Wie geht es dir? Gut siehst du aus.«
»Bis auf ein paar Blessuren im Dänenkrieg ganz gut. Der Orden bekommt mir. Ich genieße viele Freiheiten unter Hermann von Balk. Und dir? Wie geht es dir, Mutter?«
»Es herrscht Frieden hier in Elsey. Ich glaube, das erste Mal in meinem Leben. Um endlich dieses Leben führen zu dürfen, musste ich wohl erst alles verlieren.«
»Du hast ja noch uns, Mutter«, erwiderte Wilhelm gekränkt.
Doch auch wenn Mathilde ihr Ungeschick bemerkt hatte, überging sie seine Bemerkung. »Was führt dich zu mir?«
»Theo ist von Burg Deutz fortgegangen. Heinrich sagt, er hatte eine Eingebung, diesen Einsiedler aufzusuchen.«
»Einhard, diese Unglückskrähe?« In Mathildes Miene zeichnete sich Sorge ab. »Will Theo denn die Lande zurückholen?«
»Es ist dir doch klar, dass wir unseren Besitz zurückfordern müssen, Mutter!«
»Das Blutvergießen muss doch einmal aufhören.«
»Molenark ist ein grober Klotz und eine ritterbürtige Leinenhose dazu. Er ist ein Emporkömmling, der den Adel im Rheinland und in Westfalen demütigen will. Mit Sicherheit ist er kein Kirchenfürst, unter dem an Blut gespart wird. Und auf unsere Sippe hat er es ohnehin abgesehen.«
Mathilde senkte den Kopf, und Wilhelm hatte beinahe den Eindruck, als weine sie stumme Tränen.
»Mutter«, fragte er vorsichtig, »wo finde ich diesen dunklen Gesellen?«
»Was willst du denn von ihm?«, entgegnete sie, als wollte sie ihn abhalten, den alten Einsiedler zu suchen.
»Theo holen, natürlich! Ich muss Theo vor seinen Einflüstereien bewahren. Vor ein Inquisitionsgericht gehört Einhard.«
»Aber ich weiß nicht, wo er zu finden ist… Doch, warte…« Ihre Stirn lag in Sorgenfalten. Sie dachte nach, dann hellten sich ihre Züge auf. »Oben, auf der anderen Seite der Lenne, haben ein paar von Friedrichs Knappen ein Haus errichtet. Reite dorthin! Sie wissen sicher, wie du Einhard findest.«
»Cedric, sieh dort!« Theo zeigte auf einen riesenhaften Wolf, der auf sie zugestürmt kam.
Augenblicklich schnellte Cedric aus der Hocke empor und versuchte, seinen Bogen zu erreichen.
»Fenrir, halt!«, donnerte eine gewaltige Stimme vom anderen Waldsaum.
Dann sahen Theo und Cedric zwei wie Mönche gewandete Gestalten herüberkommen.
Der Knappe atmete tief durch und warf den Bogen zurück auf sein Bündel. »Die Suche hat ein Ende, junger Herr. Er hat uns gefunden.« Mit seinem stoppelgrauen Kinn deutete Cedric über die Wiese.
»Ist das Einhard?«, fragte Theo.
»Das ist Einhard. Er hatte schon immer eine Vorliebe für eindrucksvolle Auftritte. Früher umschwirrte ihn ein riesiger Uhu. Außerdem sprach er mit Vögeln und streichelte Rehe, ganz so wie der heilige Franz. Aber so einen«, damit zeigte er auf den Wolf, der auf zehn Schritt Entfernung verharrte und sie nicht aus den Augen ließ, »habe ich auch noch nicht erlebt.«
Als Einhard und Pierre den Wolf erreicht hatten, tippte Einhard ihn leicht am Schulterblatt an, und das Tier folgte ihm.
»Cedric, sei gegrüßt!«, rief Einhard. »Ich hoffe, ihr wolltet gefunden werden und habt diesen Platz nicht aus reiner Unbedachtheit gewählt.«
»Einhard, Pierre, ich grüße euch ebenfalls«, erwiderte Cedric leichthin, als hätte ihn der Wolf nicht weiter beeindruckt, und wandte sich wieder dem Ausbessern eines Lederriemens zu. Einhards Bemerkung ließ er unbeantwortet.
»Theo, mein Junge. Du bist fast schon ein Mann.«
»Was erschreckt Ihr uns so mit diesem grauenhaften Viech?«, fauchte Theo als Antwort.
»Du meinst Fenrir?«, antwortete der Greis ungerührt. »Weil er Teil der Geschichte ist, wollte ich ihn euch gleich einmal vorstellen. Seit den schrecklichen Tagen vor dem Severinstor ist er uns gefolgt. Damals war mir danach, ihn Fenrir zu nennen.«
Theo blickte ihn unverständig an.
»Nach dem germanischen Endzeitwolf. Das alte Wissen scheint völlig an dir vorbeizugehen… Als er zu uns kam, hatte er vielleicht zwei oder drei Winter erlebt. Schau ihn dir jetzt an.« Stolz wies er auf den Wolf. »Muskeln wie ein Bär. Zahm wie ein Lamm gegen uns.« Einhard ließ seine Hand auf den riesigen Kopf des Tieres gleiten und streichelte es, wie man einen Hund streichelt.
»Auch gegen mich?«, fragte Theo.
»Das hängt davon ab, wie ihr euch versteht. Gut wäre es schon, wenn ihr zueinanderfindet.«
Cedric und Theo schauten sich fragend an. Kopfschüttelnd machte sich Cedric sodann daran, die restlichen Sachen auf dem Packpferd fest zu verzurren.
Einhard aber führte den Wolf zu Theo. »Knie dich hin und beuge dein Haupt. Tue dabei so, als interessiere Fenrir dich nicht, schau einfach zu Boden– bloß nicht in seine Augen.«
»Das tue ich bestimmt nicht!«, entrüstete sich Theo.
»Hab Vertrauen.«
Zögernd ging Theo in die Hocke. Einhard kniete sich daneben und legte dem Wolf den Arm über die Schultern. Mit der freien Hand nestelte er einen dreckigen Stofffetzen von seinem Gürtel. Dann flüsterte er dem Tier beschwörende Formeln zu. Das Stück Stoff hielt er ihm vor die Schnauze. Nach einer Weile stand er auf und hob Theo auf die Beine. »Es wird schneller gehen, als du denkst«, sagte er nur.
Der Wolf setzte sich auf die Hinterläufe und winselte.
»Jetzt sieh ihn an.«
Einhard gab Theo den Stoff und bedeutete ihm, sich langsam zu nähern.
Theo hielt dem Wolf den Fetzen entgegen. »So?«, fragte er unsicher.
»Ja, das ist gut.« Wieder sprach Einhard eine seiner Formeln. Bald robbte der Wolf zu Theo herüber.
»Streichle ihn am Kopf.«
Theo tat abermals, wie ihm geheißen, und das Tier ließ ihn gewähren.
»Fenrir wird dich beschützen, wenn ich nicht bei dir sein kann.«
»Warum willst du mich beschützen?«
»Das ist meine Aufgabe.« Einhard schaute Theo in die Augen.
»Ich brauche keinen Schutz.«
»Das sehe ich anders. Es gibt viele Dinge, die auch ich nicht gesehen habe, als ich jung war.«
»Und du hast es bis hierher geschafft«, spottete Theo, doch Einhard ging nicht darauf ein.
»Ja, nur dein Stern steht unter anderen Vorzeichen. Du hast eine große Aufgabe vor dir und noch größere Feinde gegen dich. Fenrir, Pierre, ich und deine Verwandten sind dein einziger Rückhalt. Und glaube mir, du wirst ihn brauchen.«
Einhard saß am knisternden Kamin, der den Duft brennender Buche verströmte. Eine große Eule kauerte still auf dem Sims des Kamins. Ab und an schlug sie die Augenlider auf und zu, so als sei sie über irgendetwas empört. Theo betrachtete das Stück Stoff in seiner Hand.
»Was ist das für ein alter Fetzen, Einsiedler?«
Einhard sah kurz auf und raunte: »Das? Ach, das ist nur ein Stück vom letzten Gewand deines Vaters.«
Theo erschrak und betrachtete den Fetzen nun mit Andacht. Er hob ihn vors Gesicht und roch. Dem menschlichen Sinn jedoch entzog sich jeglicher Geruch. Achtsam faltete Theo das Tuch und steckte es in den ledernen Beutel an seinem Gürtel, als wäre es ein Schatz. Sie schwiegen eine Weile, und Theo machte sich daran, in dem Zimmer, welches Pierre und er sich teilen würden, heimisch zu werden. Seine wenigen Habseligkeiten legte er auf ein Brett über seiner Schlafstelle. Als er wieder in die Wohnstube trat, fiel sein Blick auf den ledernen Rücken eines mächtigen Folianten, der zuvor durch die große Eule verdeckt gewesen war.
Einhard war Theos Blick gefolgt. »Das, mein Junge, ist die Aufzeichnung vom Wirken deines Vaters, damit seine Taten und sein Andenken niemals in Vergessenheit geraten mögen.«
»Darf ich sie lesen?«
»Sie ist für dich geschrieben.«
»Oh, so viel Ehre für mich«, sagte Theo staunend. »Hast du es aufgeschrieben?«
Die Tür knarrte, und Cedric kam herein.
»Ich habe sehr viel mit deinem Vater gesprochen. Er hat mir über seine Begegnungen im Südreich erzählt, über den Papst, den Kaiser, seinen Vetter, die Heilslehren der Häretiker, über Franz von Assisi, über Zarastro, über Benoit. Alle diese großen oder weisen Menschen hat er selbst getroffen, und wir haben viele Abende damit verbracht zu disputieren, welche Erfahrungen daraus zu ziehen waren. Er war ein sehr kluger Mann, dein Vater– nicht nur im Geiste, sondern auch im Herzen, weil er die Welt gesehen und gelernt hat, sie bewusst und mit offenen Augen in sich aufzunehmen.«
»Und das alles steht hier drinnen?« Theo ließ die Hand auf den Deckel des ledernen Einbandes fallen. Muffiger Staub stob hervor.
»Das, und das, was ich selbst mit ihm erlebte oder was er mir bis zu seinem Tod berichtete.«
Theo machte große Augen. »Einhard, damit machst du mir das größte Geschenk, das ich mir erdenken kann.«
»Ich bezeuge das Schicksal deiner Familie seit vielen Jahren. Ich war schon mit deinen Großvätern auf dem Kreuzzug–«
»Auf welchem?«, unterbrach ihn Theo. »Dem dritten von 1198?«
»Ja, der muss es wohl gewesen sein. Als ich wiederkam, legte ich das Schwert aus der Hand und begann, diesen Stab zu schnitzen.« Einhard zeigte auf seinen an der Wand lehnenden Wanderstab mit dem Wolfskopf.
Die Eule darüber blinkte mit ihren großen runden Augen.
»Warum der Wolfskopf?«
»Die Einsiedelei steht auf dem Gebiet der Wulfsegge.«
Theo schaute auf die funkelnden grünen Gemmen, die die Augen des Wolfes darstellten. Plötzlich, so als hätten die Gemmen einen tiefen Blick in seine Seele getan, schreckte er zurück. Dann fiel sein staunender Blick auf die unzähligen in den Stab geschnitzten Tiere und Runen. »Was bedeuten die Drachen, Schlangen und Ungeheuer?«
»Jedes Tier steht für eine gewonnene oder verlorene innere Schlacht. Schau, diese hier steht für den Kampf und den Tod deines Vaters.« Einhard zeigte auf die Rose, die in den Trümmern einer Burg blühte.
»Und die Runen?«
»Sie stehen für eine Erkenntnis aus den inneren Schlachten, die ich zu schlagen habe.«
»Viel Platz ist nicht mehr auf dem Stab, Einhard.«
»Genug für das, was ich noch zu erledigen habe.«
»Was wird dort stehen?«
Einhard zuckte mit den Schultern. »Das hängt von uns beiden und vielen anderen Dingen ab.«
Theo schwieg eine kurze Zeit des Nachdenkens. Dann meinte er: »Zu gern würde ich Vater und Mutter wiedersehen… Im Traum oder mitten am helllichten Tage, wenn ich nicht damit rechne, oft aber, wenn Hilfe geboten ist, erscheinen sie mir seit Kurzem und sprechen mit mir.«
»Das ist mehr, als ein anderer erwarten kann, Junge. Die Träume sind die Pforten zu unserem Unbewussten. Folge deinen Träumen und Eingebungen, statt dich von Menschen abhängig zu machen. Dann erkennst du, dass du imstande bist, Dinge von wirklicher Bedeutung zu schaffen.«
»Aber es ist so viel Wissen abgelegt in einem Kloster, in einer Burg oder in einem anderen Menschen«, entgegnete Theo.
»Richtig! Und Macht, Interessen und vieles mehr auch. Vergiss das nicht. Wer sagt dir, dass das, was dir ein Erzbischof, dein Oheim, ich oder deine Liebste erzählt, nicht durch ihr eigenes kleines Spiel verdreht ist?«
»Da hast du recht.«
»Also, glaube an deine eigene Größe. Niemals ausschließlich an die eines anderen. Denn nicht ein anderer lebt dein Leben, sondern nur du selbst.«
Theo schlug die Augen nieder.
»Was ist?«, begehrte der Alte zu wissen.