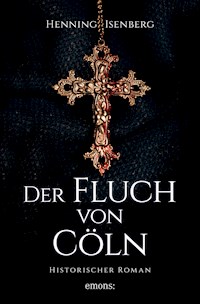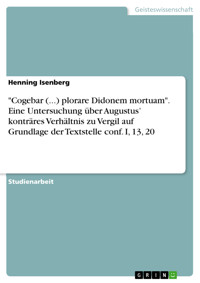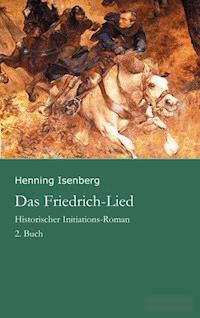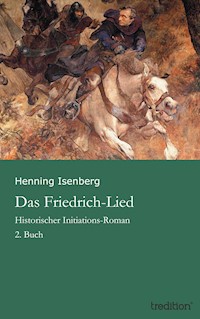
6,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dem Machtwechsel folgen heftige Unruhen. Engelbert, Friedrichs Großonkel, wird der neue Erzbischof von Köln. Kaum in Amt und Würden, zieht er alle Vogteien ein, um das verschuldete Erzbistum zu sanieren. Friedrich schließt sich mit anderen Vögten in einem Bündnis zusammen. Ado, Friedrichs neidischer Cousin, biedert sich beim Erzbischof an. Als Engelbert sowohl Friedrichs Oheim als auch Sophies Vater niederringt, wird Friedrich ungewollt zum Anführer des Bündnisses. Ein Wettlauf um Treueschwüre und Intrigen beginnt. Als ein Meister der Intrige kommt der päpstliche Legat, Leo von San Croce, ins Erzbistum. Gegen Engelbert und Leo muss Friedrich nun alle Kräfte aufbieten, den zauderhaften Adel hinter sich zu bringen. Aber anders als die meisten Vögte, kämpft Friedrich nicht nur für sein eigenes Wohl; er sorgt sich um das Wohlergehen seines Volkes. Der Adel rümpft die Nase. In einer Mischung aus Dünkel und Feigheit, folgen sie Friedrich nicht in eine offene Schlacht gegen dessen Verwandte. Sie blockieren und warten ab, ob sich das Blatt zu ihren Gunsten wendet. Kostbare Zeit verstreicht, bis es im Jahr 1225 zu spät ist. Die Ereignisse überschlagen sich. Leo hält ein Pfand in der Hand, mit dem er Sophie ohne Wissen Friedrichs erpresst. Sophie ist verzweifelt. Sie will ihrem Herzen Luft machen und erzählt Friedrich, dass sie befleckt von Engelbert in die Ehe mit ihm gegangen war. Friedrich ist außer sich. In jeden Winkel seines Lebens hat sich Engelbert gedrängt. Voll von Hass beschließt Friedrich, Engelbert gefangen zu setzen, um ihn vor das Königsgericht zu bringen. Nun senden sogar die Vögte ihre Häscher. In ihrer Verzweifelung beschwört Sophie Friedrichs Männer Engelbert zu töten. In letzter Sekunde erkennt sie ihren Fehler und versucht, ihren Auftrag zurückzunehmen. Doch zu spät; es kommt wie es kommen muss. Engelbert stirbt. Die Kirche schreit auf und schickt ihre Heere aus, die Mörder zu fangen. Adelsnester werden belagert, Bistümer brennen. Friedrich flieht nach Rom, um dort die Lösung vom päpstlichen Bann zu erwirken. Doch der neue Erzbischof, Molenark, stellt ihm nach. Auf dem Rückweg von Rom wird Friedrich gefangen und in Köln eingekerkert. Friedrichs Mutter reist ebenfalls nach Rom, um den Papst umzustimmen. Während Köln belagert wird, tobt in den Straßen der Aufruhr. Friedrich wird abgeurteilt und soll hingerichtet werden. In letzter Sekunde erreicht der päpstliche Freispruch Köln. Hektisch treibt Molenark die Hinrichtung...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Henning Isenberg wurde 1966 in Dortmund geboren und wuchs in Iserlohn im Sauerland auf. Heute lebt und arbeitet er in Stuttgart. Nach Schule, Ausbildung und Studium, arbeitet er seit 1996 als Organisationsberater und Projektleiter. 1996 begann er mit den Recherchen zu seinem historischen Roman „Das Friedrich-Lied“. Er nahm an mehreren Schreibwerkstätten, unter anderem bei dem Autor der Wilsberg-Romane, Jürgen Kehrer, teil und ließ sich von 1999 bis 2006 zum Coach und systemischen Berater ausbilden; so finden sich viele psychologische und archetypische Details in seinem Erstlingswerk.
Die Motivation zum „Friedrich-Lied“ bekam er zunächst durch die Verunglimpfung seines Namens im Zusammenhang mit dem Mord im Hohlweg zu Gevelsberg. Schnell jedoch zeigten sich die Möglichkeiten, die die Geschichte darüber hinaus bot: Nämlich, dem Land, in dem sie passierte, ein Gesicht zu geben und die Umstände der Zeit sowie die Werdung des jungen Friedrich zum besseren Verständnis der Geschehnisse zu zeigen. Denn Friedrich hatte in seiner Zeit im Weltengetriebe, in dem die unerbittliche Mechanik der Macht regierte, zu bestehen. Auch dies zeigt die Geschichte und regt damit zum Nachdenken und Verstehen der Mechaniken unserer heutigen Zeit an.
Henning Isenberg
Das Friedrich-Lied
Historischer Initiations-Roman
2. Buch
www.tredition.de
© 2014 Henning Isenberg
Titelbild/Umschlaggestaltung:
aliaz | werbeagentur gmbh, Hagen
tredition GmbH, Hamburg
Wissenschaftliche Beratung:
Dr. Wilhelm Bleicher, Bernd Schuster, Gerhard Schwätzer
Korrektorat: Anke Schneider, e.a.
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
2. überarbeitete Auflage
ISBN: 978-3-8495-8318-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Ein Glossar, ein Personenverzeichnis, Bild- und Kartenmaterial befinden sich im Anhang.
2. Buch
In gewissem Sinne wäre also die Seele jenes wunderbare Gefäß, dem die Suche gilt und die lebenspendende Kraft innewohnt, dessen letztes Geheimnis aber nicht enthüllt werden kann, sondern stets verborgen bleiben muss, weil sein Wesen Geheims ist.
aus: Perceval (nach Chrétien de Troyes)
44. Kapitel
Wann brecht Ihr wieder auf, Herr?“
Friedrich vernahm Stimmen.
„Morgen in der Früh reiten wir zum zweiten Treffpunkt.“
„Wo ist Tibald?“
„Tibald von Dortmund ist tot.“
„Und dein Herr?“
War das Waleran?
„Auch.“
Das war Cedrics Stimme – ganz klar. Sein flämischer Akzent war unverkennbar.
Nein, nein, ich bin nicht tot. Friedrich versuchte zu sprechen. Er versuchte, die Augen zu öffnen. Es ging nicht.
„Um Himmels Willen. Wo ist er?“
„Dahinten, Herr.“
„Meine arme Sophie. Wie soll ich ihr das erklären?!“
Er spürte, dass jemand näher kam. Doch er hörte nichts. Er spürte dass jemand bei ihm war. Er versuchte aufzuwachen, die Augen zu öffnen. Sich zu bewegen oder irgendetwas zu tun. Zwecklos. Die Kräfte verließen ihn und es wurde wieder still.
In der Nacht erwachte Friedrich endlich. Von dort vorne, wo seine Fußspitzen sein mussten, drang ein Licht durch seine geschlossenen Augenlieder. Er versuchte die Augen zu öffnen. Als er es endlich geschafft hatte, blickte er auf ein Leinentuch, welches sich ungefähr um die Länge eines Mannes über ihm spannte. Er lag in einem Zelt – erhellt durch das schwache, flackernde Licht, dass von flackernden Fackeln im Zelteingang herkam, die er jetzt über seinen Fußspitzen sehen konnte. Er konnte den Kopf nicht bewegen. Er suchte den Raum, so gut es ging, mit den Bewegungen der Augen ab. Sie schmerzten. Etwas lag rechts neben ihm. Ein Mann? Mit letzter Anstrengung wandte er den Blick dort hin. Beine in Ketten. Ein gelb schwarzer Surkot. Bestickt mit kleinen schwarzen Adlern. Dortmund!, schoss es ihm in den Kopf. Seine Augen wanderten über den verschmutzten Surkot über die Brust, hinauf zum Kopf des reglosen Körpers. Bleiche Haut, wie der Talg einer Kerze. Bartstoppeln. Schwarzes Haar. Die Nase mit einem kleinen Buckel. Tibald. Das war Tibald von Dortmund. Regungslos und tot. Tibald war tot….
Bin ich es selbst auch?! Liege ich hier neben einem Toten in der Vorhölle? Wird der tote Tibald gleich wie ich die Augen aufschlagen und zu mir herüberglotzen? Ihn ängstigte.
Doch nein. Warum sollte er Angst haben? Er fühlte keinen Schmerz. Es war kein Gefühl von Angst in ihm. Alles, was die Angst auszumachen schien, war der Geburt seines Kopfes entsprungen. Es war der Gedanke an die Hölle und daran, dass der Tod ja schlimm sei, so wie es ihm immer und immer wieder versichert wurde, und dass ihn ein Toter aus toten Augen anglotzen könnte. Einzig echt war die Trauer in ihm, dass sein kraftvoller, junger, nun verfaulender Körper eines geschossenen, aber nicht gefundenen Rehs im Walde gleich, von seinem Geiste gehen und von Maden zerfressen würde.
In einem nahen Dorf wurden alle Arten von Karren, die von Pferden gezogen werden konnten, beschlagnahmt. Friedrichs Getreue betten ihren Herrn und Tibald auf jeweils einen der Karren. Und so setzte sich der stöhnende und matte Tross in Richtung Limbourgh in Bewegung, jeder mit dem Gedanken beschäftigt, was für ihn nun folgen würde. Conrad hatte den Blick gedankenverloren auf den kräftigen Nacken seines Schlachtrosses gerichtet und nahm nur das Auf und Ab des Pferdekopfes über dem grasbewachsenen Weg wahr. Dann schaute er auf den Karren vor ihm. Über Agravains Rücken hinweg sah er Friedrichs blasses Gesicht.
Er wunderte sich, Tibald ist blasser als Friedrich. Nun, drängte die augenscheinliche Logik seinen Zweifel hinfort, er ist wahrscheinlich früher gestorben.
Den ganzen Tag über ritt das geschlagene Limbourghische Heer gen Osten.
Am Abend fing es an zu regnen und sie mussten einen halben Tagesritt vor Limbourgh das Lager aufschlagen. Missmutig schickte Waleran einen Boten zur Burg, der ihr Kommen für den nächsten Tag ankündigen sollte.
Aus Ästen hatten sich die Mannschaften kleine Schutzzelte gebaut, über die sie ihre Mäntel gelegt hatten. In diesen saßen sie um die Feuer, die in der Mitte solcher kleinen Plätze entzündet wurden und unterhielten sich gedämpft. Die Vorräte beschränkten sich auf die Feldnahrung, die sie mit sich geführt hatten. Allen knurrten die Mägen, doch am schlimmsten war der Durst, der sie nach den Strapazen des Tages überkommen hatte.
Die Knappen des Herzogs von Limbourgh hatten das Feldzelt für Waleran gerichtet. Waleran hatte seine Feldführer hier versammelt. Nicht weniger niedergeschlagen als die Mannschaften, saßen sie im Kreis. „Damit ist das Ende der Welfen wohl besiegelt“, sagte Conrad niedergeschlagen, „der Kaiser wird wohl ungeschoren in deutsche Lande zurückkehren, doch wird Friedrich von Staufen seinen Siegeszug nun ungestört fortsetzen können. Es ist wohl nur eine Frage kürzester Zeit, wann er in Aachen Einzug hält, um sich dort zum König krönen zu lassen. Nun steht ihm ja auch der Niederrhein nicht mehr im Wege oder werdet Ihr dem Staufer nicht huldigen, Herzog?“
„Es ist wohl unklug, den Widerstand länger aufrecht zu halten. So wie ich es sehe, wurden in Bouvines viele Gefangene gemacht. Außer dem Lösegeld wird sicherlich eine Bedingung sein, dem neuen König die Treue zu schwören.“
Heinrich setzte hinzu, „die Fürsten im Rheinland müssen auf Veränderungen im Erzbistum Cölln achten. Denn der Papst wird sich dieser Frage sicherlich persönlich annehmen.
„Der Staufer erwartet den Ausgang der Schlacht in Hagenau bis er ein Zeichen bekommt, um nach Aachen zu seiner Krönung zu ziehen.“
Und so ergingen sich die Geschlagenen in banger Hoffnung und Ermutigung bis tief in die Nacht in Spekulationen über die Zukunft des Adels nach Bouvines.
Als Conrad sich verabschiedete und aus dem Zelt Walrans trat, suchte mit schwerem Kopfe den Weg zu dem großen Turnierzelt Walerans, wo die beiden Toten aufgebahrt lagen.
Cedric hielt Wache vor dem Zelt.
„Sei gegrüßt, lieber Cedric.“
Cedric nickte trübsinnig. Doch er folgte Condard ins Innere des Zeltes. Eine Weile standen sie still vor den Toten, bis Cedric die Stille durchbrach.
„Herr, ich denke es jedes Mal, wenn ich nach meinem Herrn sehe. Mir ist, als sei Leben in ihm. Mir ist, als lebe er.“
„Meinst du, Cedric?!“
„Ja, schaut Euch den Herrn von Dortmund und dann meinen Herrn an. Er welkt nicht wie ein abgeschnittener Strauch. Seine Haut, schaut! Sie ist blass, aber ihr fehlt das Wachsige.“
„Cedric, ich hatte denselben Gedanken heute auch schon.“
Conrad machte einen Schritt nach vorne, legte die rechte Hand auf Friedrichs Brustkorb und beugte seinen Kopf so nahe an Friedrichs Gesicht, dass er den Atem hätte spüren müssen, „aber, … ich vernehme keinen Atem.“
„Ja…“, sagte Cedric zögerlich und traurig zugleich, als wolle er, das, was er als gegeben hinnehmen musste, durch das Vorenthalten seiner Zustimmung außerhalb der Welt halten.
Conrad schaute den Knappen an und sah das Flehen in seinem Blick.
„Wir versuchen etwas, Cedric. Vielleicht hat es Erfolg. Ab jetzt träufelst du ihm jede Stunde etwas Wasser auf die Lippen. Ich wecke Wibold. Jetzt soll er endlich seine Kräuterkunst anwenden, anstatt immer nur davon zu reden.“
Die Nacht verging und Wibold nutzte den Mondenschein, um die notwendigen Heilkräuter zu finden, die seinen Trank ergeben sollten.
„Sophie!“
Die dunkle Gestalt erschrak, als sie ihren Namen hörte.
„Ach, Gilbert. Erschreck mich doch nicht so!“
Der gerüstete Mann löste sich aus dem Schatten des Stalles.
„Geht nicht allein, mein Kind.“
„Woher weißt du…?!“
„Wenn ein gesatteltes Pferd im Stall steht und dann noch Eueres, dann ist nicht schwer zu erraten, was Ihr vorhabt. … Ich werde Euch begleiten.“
Sophie atmete erleichtert auf.
„Weißt du denn, wo sie lagern?“
Der Alte nickte nur und ging zu einem der nächsten Ferche, wo er sein Pferd, das schon gesattelt bereitstand, losband und aus dem Stall führte. Sophie folgte ihm.
Der Innenhof der Limburg war silbrig erhellt vom vollen Mond, als sie vorbei an den Wachen das mächtige Tor passierten.
Wärme drang in seinen Körper und sein Kopf wurde von zwei kräftigen Händen leicht gewogen.
Über ein zu einer kleinen Rinne geformtes Holz, das er zwischen Friedrichs Zähne geschoben hatte, ließ Wibold seinen Kräutersud in Friedrichs Mund strömen, während Cedric den Kopf seines Herrn barg.
Grün sah er die warme Schlange, die ins Inneren seiner Brust drang. Doch es war kein Schreckenstier, sondern die Schlange des Äskulap. Es war ihm, als schwemmte ein nahrhaftes Nass auf ausgedörrten Boden und erweckte die darin geborgene Welt zu neuem Leben. Helles Licht durchflutete seine Sinne. Fahre ich jetzt doch zum Himmel auf - obwohl das Urteil des Herrn das welfischangivinische Bündnis zur Hölle geschickt hat?!
Doch was wollte sein Verstand? Was war wahr? Wer konnte das sagen? Niemand! Erschöpfung machte sich breit und er ließ jede angestrengte Kopfgeburt fahren. Schlafen, schlafen. Nur schlafen. Nur der Körper konnte das Wahre erfahren, und auch er konnte nicht in die Zukunft schauen. Auch er musste alles erfahren in dem Moment, in dem es geschah. Stille umfing ihn wieder. Stunde um Stunde.
Wo bin ich jetzt, fragte er sich, als sein Verstand wieder erwachte. Denn er vernahm ein neues Wesen in seiner Nähe. Es war ihm als wärmte eine kleine Hand seine Stirn und abwechselnd seine Schläfen. Diese neue Lebensquelle nahm die Spannung von seinem Nacken und aus seinen Schultern. Es war ihm, als sei diese neue Aura schon lange Zeit bei ihm. Auch war keine Schwere mehr in diesem neuen Raum, wie in der Nacht als er Tibald gesehen hatte. Vielmehr fuhr ein frischer Duft durch diese Aue. Er spürte nach diesem Wesen, das ihn umsorgte. Licht fuhr in seinen geschundenen Torso und umspielte eine wunde Stelle, deren Schacht sich wie ein tiefer Brunnen den Weg durch sein Schulterblatt gesucht hatte. Da erst spürte er einen unendlichen Schmerz, genau an dem Punkt, wo das Licht keine Macht hatte.
Er vernahm eine Stimme.
„Wie geht es?“
„Er röchelt kein Blut. Er hat die Nacht überstanden. Was der Tag bringt, müssen wir dann sehen…. Wenn er die Rippen gebrochen hat, kann Knochenmark ins Blut kommen. Dann bekommt er Fieber und er stirbt. Wenn das Mark zu Knochen wird, schafft er es.“
Da war sie wieder die Hand, die ihn in diesem wunderlichen Zwischenhades hielt.
Doch was tat sie? Sein Körper wurde bewegt. Er flog, er flog.
Und in dem Flug benetzte ein kühler Zug seine Haut.
Nun berührten ihn diese heilenden Hände an dem Brunnenrand. Schmerz! Er wollte schreien. Doch stattdessen sah er einen kleinen Jungen, der fassungslos schrie. Was war dieser Schmerz?
Er sah die inneren Wände des Schmerzenbrunnens und flog langsam, wie eine Hummel, die nach Nektar sucht, an ihnen entlang, bis er zu einem funkelnden Gewässer kam. Doch was schaute er? Dort unten sah er eine Gestalt; umspielt von gleißendem Gewässer. Wer ist dieses Wesen? Ich kenne es! Die Gestalt begann ihm zu winken. Vater? Bist du das?
„Ja, Junge, ich bin es.“
Schmerz, unendlicher Schmerz umfing ihn. Da war er, der kleine Junge und schrie und weinte vor Schmerz und Einsamkeit. Doch nun hörte das Animuswesen auf zu winken. Angst umfing ihn, und er begann noch tiefer und ängstlicher zu weinen. Doch das Wesen streckte ihm seine Hand entgegen und rief ihn. „Komm, komm. Du bist nicht allein. Ich bin da und ich war immer da…. Du hast mich nur nicht gesehen.“
Da lief der kleine Junge zu dem Wesen und sie fassten sich an den Händen, während die Spiegel des Wassers sich zu einem hellen Licht zusammenfügten. Und der Animus barg den Kinds-körper solang, bis selbiger keinen Schmerz und kein Weinen mehr vernahm. Da verlies die tiefe Wut, die Friedrich ein Leben lang begleitet hatte, seinen Körper. Er wusste, dass er nie wieder die Verwirrung des Wütenden fürchten musste und er jederzeit das Schwert des entschiedenen Kriegers ziehen konnte.
Nach dieser Ewigkeit des Schmerzes und der inneren Heilung schwebte er wieder der Oberfläche zu, von der er gekommen war. Dort oben sah er, dass der Stein des Schachtes und des wunden Brunnenrandes demselben warmen Licht, das seinen ganzen Körper bereits umsponnen hatte, gewichen war. Auch der Brunnen heilte. In Gedanken fragte er sich, was nun als nächstes folgte. Fahre ich nun bald auf in die Ewigkeit? Angst umfing ihn erneut.
45. Kapitel
Der König von Frankreich war schlau, listiger noch als ein Fuchs.
Gleich rief er einen seiner Meister und gab ihm die Reliquien, derer man bedarf, um mit Erfolg voranzukommen
(Chanson de Guillaume le Maréchal)
Der Tag, an dem das Heer Limbourgh erreichen würde, erwachte mit einem windlosen und trüben Morgen. Die warme Luft war drückend und der Waldbogen dampfte, als sie die Habe auf die Pferde packten. Die zugeschütteten Feuer qualmten. Im Umkreis des Lagers hallte der kleine Wald, der ihnen in der Nacht Schutz geboten hatte, von den dumpfen Geräuschen der aufgenommenen Waffen, der Riemen, die festgezurrt, der Rüstungen, die übergezogen wurden, vom Husten der Menschen und Schnaufen der Pferde, wider.
Den ganzen Tag ritten sie im immer gleichen, ermüdenden Trott nach Osten. Der Regen versprühte sich nur noch von Zeit zu Zeit über die Lande. Weiße und graue Wolkeninseln, die hier und da den blauen Himmel freigaben, zogen über sie hinweg und ein leichter Westwind trieb den Trupp, wie von den Franzosen befohlen, aus Frankreich heraus.
Es war Friedrich, als gehe er wieder auf eine Reise. Wie in einem großen Kahn geborgen, war es ihm, als werde sein Körper aufund abwogen. Er wollte nicht gehen. Er wollte doch seine junge Braut wiedersehen. Er wollte ihr doch seine Heimat zeigen. Die Heimat, die er gerade erst wiedergewonnen hatte, deren Herr er in Wirklichkeit noch gar nicht war. Er wollte so bald als möglich dem Westen den Rücken kehren und die Gedanken an die Niederlage verdrängen. Leben und mit ihr dort glücklich sein. Angst ergriff sein Herz. Ihm war, als bliebe es stehen. Nicht einschlafen. Nicht einschlafen, mein Herz. Er durfte nicht einschlafen, sonst würde es vollends zum Erliegen kommen. So sehr er sich des Schlafes erwehren wollte, er fiel doch in einen angstvollen Traum.
Von weitem erblickte Sophie das Heer ihres Vaters. Selbst aus dieser Entfernung war ihm die Niedergeschlagenheit anzusehen. Sie gab ihrem Pferd die Sporen. Cedric erblickte sie als erster und rief, „dort, seht, Herr!“
Waleran gab ihm einen Wink, seiner Tochter entgegenzureiten, woraufhin Cedric den langgezogenen Hügel hinaufsprengte.
„Herrin, kommt!“, rief er Sophie entgegen, als sie in Hörweite waren. „Er ist dort unten. Ich bringe Euch hin.“
Wenig später stieg Sophie von ihrem Pferd, um auf den Wagen, in dem Friedrich lag, zu klettern. Sie kniete nieder und betrachtete den Geliebten. Dann legte sie sich zu ihm – ihr linkes Bein über seinen linken Oberschenkel und die linke Hand auf seinen rechten Beckenknochen gestützt.
Friedrich erwachte. Er war von Grenze zu Grenze gegangen. Er hatte bereits einen langen Weg hinter sich gelassen. Über ihm war helles Licht und an seiner Seite spürte er das Wesen, dem er Urzeiten zurück begegnet war oder war es gerade gewesen? Er wusste es nicht mehr. Er spürte.
Da war sie wieder diese zauberhafte, weibliche Aura. Diese tiefe Berührung. Ihm war, als öffneten sich ihre Körper und das eine Wesen ging in den Körper des anderen Wesens. Eine so tiefe Berührung hatte er nie zuvor erfahren. Nicht mit Giovindamur, nicht mit Zarastro, Sibert, Benoit, Einhard, geschweige denn mit seiner Mutter oder seinem Vater, vielleicht mit seinen Brüdern.
Er wollte dieses Wesen mit auf seine Himmelsreise nehmen. Dieses Wesen? Und was ist mit Sophie? Bin ich ihr untreu?
Erneut wollte er sich in tiefe Not stürzen. Doch er tat es nicht. Er kehrte um. Denn dieses Gefühl war so richtig. Es war tiefe Liebe. Es konnte nicht falsch sein.
“Seit dieser Zeit sank der Name der Deutschen bei den Welschen”
Der Chronist Innozenz III.
Mit dem Sieg der Franzosen über das angevinisch-welfische Bündnis bei Bouvines und Chinon hatte auch Friedrich II. einen großen Sieg errungen. Der König von Paris wurde seiner Kronvasallen wieder Herr und richtete seine Vorherrschaft über Flandern, das Elsass und Lothringen erneut auf. Mit Hilfe der gefangenen Krieger von Bouvines konnte Philipp Auguste seine gebeutelte Staatskasse wieder auffüllen.
Das Angevinische Reich verlor endgültig seine festländischen Besitzungen. Im Innern war Johann auf einem Tiefpunkt angelangt. Er hatte seinem Land über Jahre die Saat genommen, um seinen Krieg gegen die Capetinger zu führen. Nun forderte der englische Adel ein Zwangsedikt, das unter dem Namen „Magna Charta“ bekannt werden sollte.
Der geschlagene Welfenkaiser seinerseits hatte sich nach Cölln geflüchtet und harrte dessen, was ihm bevorstand.
Während die geschlagenen Heere nach Osten flohen und die Mannen um Waleran Limbourgh erreichten, schickte der siegreiche Philipp August den zerbrochenen Reichsadler, der vor kurzem noch die kaiserliche Standarte gezierte hatte, in die staufische Pfalz Hagenau. In den folgenden Tagen brachten mehrere Boten die Kunde, dass die Franzosen nach der gewonnenen Schlacht in einem einmaligen Siegeszug nach Paris gezogen seinen. Mit sich führten sie an die einhundertzwanzig gefangene Adelige des geschlagenen deutschen Heeres, unter welchen sich unter anderem Ferrand von Flandern, Rainald von Dasseln, Bernhard von Horstmar und Conrad von Dortmund sowie ein unbekannter Ritter namens Balduin von Gennep, von dem noch zu reden sein wird, befanden.
„Da haben wir es!“, brauste Waleran auf.
„All die Grafen werden diesem Kind aus Apulien, diesem Gewächs des Papstes ihre Aufwartung machen. Und wir werden es auch. Dieser Starrkopf von Otto. Hätte er sich mit dem Papst nicht überworfen, könnten wir unsere Gebietsgewinne der letzten Jahre sichern. …So müssen wir uns auf eine neue Partie einstellen.“
Er drehte sich zum Fenster und blickte eine Weile hinaus. Dann sagte er – nun gefährlich ruhig, „der Niederrhein mit Cölln und Holland muss beieinander gehalten werden. Koste es, was es wolle.“
Friedrich spürte den frischen Luftzug auf seinem Gesicht. Ernte, dachte er. So riecht es, wenn das Korn gedroschen und das Heu gewendet wird. Mauern, dachte er. Er liebte diesen kühlen, modrigen Duft und dessen Mischung mit dem Atem der Felder. Er musste auf irgendeiner Burg sein. In welchem Himmel mag ich angekommen sein, dachte er. Zeit zu erwachen. Ist das Wesen noch da? Aufmerksam spürte er nach. Ja, sie ist hier. Er spürte die Aura direkt neben sich. Und er wollte das Wesen, das ihn durch alle Zeitebenen, die er durchschritten, begleitet hatte, endlich sehen. Doch er konnte die Augen ja nicht öffnen. Versuch es, sprach seine innere Stimme zu ihm.
Und plötzlich war es so hell um ihn, dass er die Augen augenblicklich wieder schließen musste.
Mit einem ruckartigen Atem schreckte Sophie auf.
„Mh!“
Ein Freudenschrei entfuhr ihr.
Friedrich spürte die Hand wieder auf seiner Stirn. Dann spürte er Lippen, die seine Lippen berührten. Dann kam ein feuchtes Tuch, das seine Lippen beträufelte. Wieder die Lippen. Weich und voll Liebe. Er wollte sie nicht gehen lassen. Er wollte die Schönheit dieses Augenblicks behalten. Er erwiderte den Kuss. Er küsste und wurde geküsst. Er öffnete die Augen und sah; sah braune Augen, die er kannte, das schwarze Haar, dessen Duft er so oft herbeigewünscht hatte, Lippen, die er seit der ersten Begegnung begehrte.
Seine Lippen wollen das Gesehene in Worte fassen. Doch seine Stimmbänder versagten ihm ihren Dienst.
Tränen fielen auf seine Wangen und wurden sogleich von freudigen Küssen wieder aufgenommen. Über und über übersäte Sophie sein Gesicht mit ihrer Liebe.
Die Lage in deutschen Landen wurde von Tag zu Tag bedrohlicher. Von Süden her zogen die Heerscharen der staufischen Vasallen nach Norden. Doch noch war die Zeit nicht reif. Zu viele Welfenanhänger hatten noch zu viele Krieger unter Waffen. Noch war kein Durchkommen im welfischen Norden. Die Staufer mussten sich in Geduld üben, so wie auch Friedrich. Drei Wochen waren seit Bouvines vergangen und Friedrich hatte das Krankenlager verlassen. So gut er konnte, bereitete er die Abreise aus Limbourgh vor.
Der Weg sollte Waleran nach Cölln führen. Sophie und er wollten die Reise in die Grafschaft Isenberghe nur gemeinsam antreten. Heinrich, der nach Altenberghe zu seiner Frau und seinen Söhnen zurückreisen wollte, würde sie ebenfalls begleiten.
In den letzten Augusttagen des Jahres zwölfhundertvierzehn setzte sich die Reisegesellschaft um Waleran, Heinrich und Friedrich von Limbourgh aus in östlicher Richtung in Marsch.
Endlich saß er wieder im Sattel. Er schaute auf glänzendes Fell und sog den würzigen Duft der Rösser ein. Er spürte den leichten Zug, den der warme Wind auf seine Wangen legte. Glücklich schaute er zu Sophie hinüber. Sie lachte und er streckte seine Hand aus, um die ihre kurz zu drücken.
Zum ersten Mal beobachtete Friedrich bei Waleran einen menschlichen Zug, als er bei seinem Abschied vor Cölln, Friedrich seine geliebte Tochter übergab. Schweren Herzens bog Walram auf der alten Römerstraße in nördlicher Richtung nach Cölln ab. Und wenig später, bei Altenberghe, verabschiedeten sie sich von Heinrich. Friedrich und Sophie setzten ihren Weg über den Helinki-Weg fort.
Nun war Sophie von keinem Wesen ihrer eigenen Familie mehr umgeben. Augenblicklich wurde sie dieses unbekannten Verlassenseins gewahr. Hilflos und traurig weinte sie stumm den Trennungsschmerz in sich hinein. Friedrich verstand ihre Trauer und wich nicht von ihrer Seite. Er berührte sie liebevoll, wann immer sich die Gelegenheit bot.
Die Gruppe von etwa sechzig Rittern und Gefolge wuchs zu einer stattlichen Karawanserei an, als sich eine fünfzehnköpfige Gruppe von flandrischen Tuchhändlern, die auf dem Weg nach Münster war, dem kleinen Heer anschloss. Sophies Trauer verflog schnell, ob der vielen Stoffe und Farben, die die Händler mit sich führten.
Die Reise durch das bergische Land begann Sophie sogar zu gefallen, zumal sie die Sonne wärmte und Grillen in den Wiesen zirpten, Vögel zwitscherten und große Vögel über den Auen ihre Kreise flogen.
Die Fürsten einen … – gar nicht so leicht, jeder wird wohl sehen müssen, dass ihm seine Reichslehn und Privilegien bestätigt werden, dachte Friedrich, und die Vogteien… Zu Hause werde ich wohl als erste die Dokumente zu durchforsten haben, um sie später durch wen auch immer bestätigen … – was ist das?
Er schlug mit seinem Lederhandschuh nach dem, was ihn im Nacken und an den Ohren zu kitzeln begonnen hatte.
„Ach, Sophie“, brummte er halbverärgert als er den Unhold ausgemacht hatte, der ihn aus den Gedanken aufgeschreckt hatte und blitzte sie aus den Augenwinkeln an. Doch hatte sie bemerkt, dass seiner Stimmung nur noch wenig fehlte, um sie aus finsterer Versunkenheit in ungeteilt geltende Aufmerksamkeit für sie zu verwandeln.
„Friedrich, erzähl mir ein bisschen von deiner Mutter“, bettelte sie kokett.
„Oh, ich hoffe, sie wird dir gefallen. Viele Menschen haben zunächst Respekt vor ihrem herrscherischen Wesen. Doch das sind ihre strengen religiösen Wurzeln. Ich wette, dir fällt es leicht dieses Eis zu brechen.“
„Ich sollte vielleicht etwas Nettes zum Anziehen haben, wenn ich ihr vor die Augen trete, meinst du nicht, Friedrich?!“
Friedrich schaute sich verdutzt zu den zwei Wagen um, die neben ein paar Möbeln überwiegend mit Sophies Kleidungsstücken beladen waren.
„Oh, das…!“, wollte Friedrich einsetzen. Doch Sophie wartete seine Ausführungen nicht ab.
„Begleitest du mich zu den Händlern?“, fragte sie und ließ sich, ohne seine Antwort abzuwarten, an das Ende des Zuges zurückfallen.
Mit hochgezogenen Augenbrauen schaute Friedrich zu Cedric hinüber, der den Blick hilflos erwiderte. Dann wendete Friedrich Agravain und trottete seiner jungen Frau hinterher.
Am Abend erreichen sie Berghe. Obwohl sie Isenberghe in drei oder vier Stunden hätten erreichen können, nächtigten sie auf der Burg Adolfs von Berghe. Friedrich wollte mit seiner Braut am lichten Tage auf Isenberghe eintreffen. Mit dem Anblick des Baus, der an Größe und Herrlichkeit seinesgleichen in der Region suchte, wollte er seine Braut, die aus einer der größten Burgen im Nordreich stammte, beeindrucken.
„Herrin, sie kommen“, vernahm Mathilde das Flüstern ihrer Zofe. Isabell wusste, wie es die Herrin hasste aus dem Gebet gerissen zu werden, doch heute schien die Andacht kein Ende nehmen zu wollen und die Reisegesellschaft war schon vor einer Stunde von Ortliv, der als Bote vorausgeeilt war, angekündigt worden. Mit einem mürrischen Seitenblick, der Isabell galt, riss sich die Gräfin aus ihrer Einkehr, erhob sich langsam und schlug das Kreuz vor ihrem und dem Antlitz des Gekreuzigten. Dann verließ sie die kleine Burgkapelle, um sich auf den östlichen Wehrgang, von dem aus sie das Tor der Oberburg sehen konnte, zu begeben.
Schon erblickte sie die Reisegesellschaft. Das junge Paar ritt an der Spitze und befand sich schon auf dem Steg, der zum Tor neben dem Bergfried führte.
Ihr Sohn machte einen fröhlichen Eindruck und Sophie strahlte vor Schönheit und Frische. Wenigstens kann sie reiten und lässt sich nicht wie eine Prinzessin in einem Wagen fahren, wog Mathilde ab. Ach, wie lange war es bei ihr selbst her, dass der seelige Arnold sie aus Cleve hergeholt hatte. Damals hatte sie ebenfalls gestrahlt, so wie das junge Ding da unten jetzt. Doch da hatte sie noch nichts geahnt von der rauen Männerwelt, die sie hier erwarten sollte. Sie hatte sich ihre Freiräume geschaffen. Ihre Kapelle, die sie mit Erzbischof Adolfs Hilfe durchgesetzt hatte, strahlte die Wärme und Freude aus, die ihr Protokoll, Politik, Waffengeklirre und vor allem die Unbeholfenheit ihres Mannes im Umgang mit den Wünschen einer Frau nie hatte geben können. Ob Friedrich da anders war? Sie sah ihrem Sohn entgegen. Zumindest machte er den Eindruck, als habe er im Moment das Glück gefunden. Er war ihr Sohn. Und auch, wenn er impulsiv war, was ihm hier und da den klaren Blick nahm, war er klug und gewandt. Aber konnte er einem Mädchen aus dem reichen Limbourgh hier eine vergleichbare Heimstatt bieten? Wälder und Wasser gab es reichlich, aber weder ihr Hof konnte es mit Limbourgh aufnehmen, noch konnte sich das Leben der Städte wie Dortmund, Soest oder Münster mit dem von Utrecht, Liège, Brügge oder Gent messen. Die Wachen in der Oberburg hatten bereits die Tore geöffnet. Mathilde rief nach Constanze und begab sich in den Burghof, um ihren Sohn und die neue Schwiegertochter zu empfangen.
Sophie saß im Damensitz und folgte Friedrich, der zuerst durch den Torbogen ritt.
Am Brunnen machte er halt, sprang vom Pferd und reichte Sophie die Hand, um ihr aus dem Sattel zu helfen.
„Mutter, seid Ihr nach der Hochzeit in Limbourgh gut daheim angekommen…?“
Aber Mathilde ging nicht auf Friedrichs Versuche von Höflichkeit ein, ließ ihn links liegen und wendete sich direkt Sophie zu.
„Seid willkommen auf Isenberghe, meine Tochter. Hattet ihr eine gute Reise? Wie ich hörte, verbrachtet ihr in Berghe die Nacht.“
„Oh, ja es war wundervoll“, strahlte Sophie.
„Eure Lande sind so schön. Und ich wollte Friedrich nicht glauben, als er einmal seine mit den Limbourgher Wäldern und Hügeln verglich.“
„Na, Isenberghe ist nicht Limbourgh, mein Kind. Das wirst du noch merken“, entgegnete sie tonlos, so dass sie mit der Schroffheit ihrer Stimme den minderen Wert ihrer Lande gegenüber Limbourgh überspielte.
„Mutter“, mahnte Friedrich Mathilde, doch verbat er sich schnell jedes weitere Wort. Bei sich jedoch dachte er, ich rang mit dem Tod und sie hat nichts anderes zu tun, als Sophie zu erschrecken! Er senkte den Blick, um einen neuen Gedanken zu fassen.
„Komm, Sophie, ich zeige dir alles.“
Er streckte ihr die Hand entgegen.
Sie griff nach ihr und schaute ihn fragend an. Dann knickste sie vor Mathilde und folgte Friedrich.
Während sich das junge Paar auf der Isenburg einrichtete, hielt sich Erzbischof Adolf im Amt. Doch sein Werben für den Staufer hatte den Kämmerer des Erzbistums über den Herbst schier in den Wahnsinn getrieben. Die Juden sperrten sich, weitere Kredite herauszugeben und der Rat des stolzen Cöllns hatte aufgehört, den Anweisungen seines Stadtherrn Folge zu leisten.
46. Kapitel
Herbst 1214
Alle Grafen waren sich einig gewesen, dass sich die Bruderschaft wieder beraten musste. Sophie war froh, als sie mit Friedrich nach den kurzen Wochen auf Isenbourgh wieder nach Limbourgh reisen durfte. Doch die Reise war nicht ohne Gefahren. Über den heraufziehenden Konflikt mit dem Erzbistum hatte Friedrich den noch schwelenden Krieg zwischen Welfen und Staufern fast vergessen. Dabei war beides nicht von einander zu trennen; doch das Erzbistum betraf ihn nun persönlich. Der Königsstreit zwischen Staufern und Welfen hingegen war fern.
Baierische Truppen waren schon hinauf bis an den Niederrhein gekommen. Über alle Lande und Straßen verteilt lagerte Kriegsvolk. Die aufsteigenden Rauchschwaden des nassen Holzes, das es verbrannte, kündete allerorten von ihren Plätzen. In den Wäldern und Fluren begegnete ihnen das heimische Volk. Nirgends war man vor ihren Schnüffeleien und Übergriffen sicher. Nicht einmal in den Flecken und Dörfern. Überall nahmen sie sich, was sie bedurften. Friedrich wollte Sophie diesem unruhigen Treiben nicht aussetzen. So entschied er, mit einem Kahn über die Ruhr zu reisen und erst bei Duisbourgh wieder den Landweg nach Limbourgh zu nutzen.
Viele Fürsten gebärdeten sich widerspenstig und sahen nicht ein, auch wenn sie in Bouvines geschlagen worden waren, warum sie zum Staufer überlaufen sollen. Sie wollten mit Münze oder Schwert überzeugt werden. Anfang August unterwarf Roger Friedrich von Staufen Heinrich von Brabant.
Die Bruderschaft war sich uneins. Heinrich von Brabant war bezwungen und damit für die Bruderschaft verloren. Doch außer ihm war keiner so weit, das Bündnis verlassen zu müssen. Im Gegenteil: Waleran, Willhelm von Jülich, Dietrich von Cleve und Heinrich von Kessel hatten beschlossen, den Herzog von Baiern gefangen zu nehmen. Doch mit der geglückten Gefangennahme hatten sie nur den Zorn der Staufer entfacht.
So hatten ihre Truppen den ganzen Sommer am Rhein zugebracht – in der immergleichen Drohgebärde gegen Geldern. Roger Friedrich hatte dem Früstenbund gedrohte und gefordert, dass der Baiernherzog freigelassen werde. Erst Ende August hatte der Staufer zu Münstermarienfeld einen Frieden zwischen Wilhelm von Geldern, Heinrich von Sayn und Waleran erzielt. Im Gegenzug sicherten die Staufer zu, die gegnerischen Besitzungen unverheert zu lassen und gegen weitere Verwüstung zu schützen. Die Fürsten im Rheinland wünschten sich den Winter herbei. Denn der Staufer hatte sich durch sein Verhandlungsgeschick im Rheinland Respekt verschafft und die Besatzungstruppen an der Standfestigkeit von Volk und Fürsten genagt. Der Winter gab ihnen Zeit, über einen Wechsel zu den Staufern nachzudenken.
An Ursula, noch bevor sich das Leichentuch des bevorstehenden Winters über die Lande legte, machte sich Friedrich wieder auf nach Cölln zu reisen. Im Gepäck hatte er das Pergament, welches er zusammen mit seinem Bruder Engelbert im letzten Jahr bezüglich seiner Besitzungen angefertigt hatte. Friedrich erreichte die erzbischöfliche Stadt im Dunkelwerden. Als er mit Cedric, Wibold, Gundalf und Berengoz zur erzbischöflichen Residenz am Rhein ritt, senkten die giebelständigen Häuser ihre dunklen Schatten bedrohlich auf das Kopfsteinpflaster des Alten Marktes. Es schien, als mieden die achttausend Seelen der sonst so lebhaften Stadt, die Straßen, aus Angst, ihr Reichtum könnte mit einem Machtwechsel vergehen. Ja, und Friedrich selbst, war von keiner anderen Furcht getrieben. Denn auch er war um den Verlust seiner kirchlichen Lehen bangend hergekommen. Froh war er, als sich ihm die Tore der Residenz öffneten und noch froher, als er die Angelegenheit mit dem Oheim erledigt hatte.
„So, mein Junge, das wäre geschafft.“
„Danke, Vater”, erwidert Friedrich.
„Ich danke und entlasse die anwesenden Zeugen.”
Während sich die Zeugen der soeben vorgenommen Bestätigung entfernten, führte Adolf seinen Neffen in seine Privatgemächer.
„Damit sind dir deine Vogteien wieder sicher. Eben gestern habe ich die Überlassung des Zehnten in Warstein zugunsten des dortigen Klosters durch den Grafen Godfried von Arnsberghe beurkundet. Außerdem will er darauf gegenüber dem Cöllner Erzbischof Verzicht leisten. Alle Fürsten sind derzeit bedacht, dem neuen König und dem Papst zu gefallen, Friedrich. Ebenso tue ich alles, um Innozenz zu gefallen. Aber weder mir noch Dietrich von Heimbach, der sich immer noch in Rom aufhält, bestätigt er die Erzbischofswürde. Das einzige, was ich derzeit machen kann, ist so viele Verpfändungen zugunsten der heiligen Kirche zu empfangen, einen tatenlosen Kaiser in der Stadt zu dulden und mich mit den feisten Cöllner Bürgern auseinanderzusetzen. Friedrich, du solltest dich im Moment auch nach der derzeitigen Großwetterlage richten und deine Erblehen und -vogteien der Kirche abtreten, um sie dann wieder zu empfangen.”
„Nein, Vater, das würde meine Position verschlechtern.“
„Ich würde dir keine Vogtei entreißen, Sohn.“
„Ja, das weiß ich doch. Aber die Zeiten sind unsicher, Herr.
Was meinst du damit, Junge?! Sprich!”, doch im gleichen Atemzug und mit einer verächtlichen Handbewegung, wischte er das eben Gesagte fort und riet Friedrich missgestimmt, „reite nach Hause und warte ab, bis die Zeit reif ist, dem Staufer zu huldigen.”
In Friedrich stieg Ablehnung auf: Jetzt hat mich der Alte. Jetzt will er mich zu den Staufern herüberziehen.
Gequält fragte er, „was denkt Ihr, Vater, wie lange soll ich warten?”
Widerwillig antwortete der Oheim, „das kann ich dir nicht sagen. Wenn der Staufer genug Wahlmänner hinter sich vereinigen kann, kann es noch vor dem Winter zur Übernahme kommen, wenn nicht, leben wir noch bis zum nächsten Jahr in diesem Schwebezustand. Noch ist dem Staufer Cölln, Aachen, Trifels und Mainz verschlossen. Auch stehen die askanischen Fürsten von Brandenburg und der Herzog von Sachsen und sein Bruder Heinrich zum Kaiser. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch einmal die Kraft aufbringen, genug Rückhalt im Reich zu gewinnen.”
Friedrich machte sich auf den Rückweg nach Isenberghe.
Am Tag schien die Stimmung in der Stadt so wie immer; emsig entspannt, die Bevölkerung ging ihren Geschäften nach – satt und träge, wie eh und je. Hatte er sich geirrt, als er durch die dunklen Gassen her ritt? Nichts deutete auf die angespannte Ruhe vor dem Sturm hin, die er erwartete. Friedrich verachtete diese Gleichgültigkeit. Oder war nur er es, den die Anspannung drückte. Er konnte nicht so untätig herumsitzen und die Dinge auf sich zu kommen lassen.
Die kalte Jahreszeit zeigte sich von ihrer strengen Seite. Zum Glück verlief der Winter in der Grafschaft ohne kriegerische oder räuberische Zwischenfälle, soweit Friedrich informiert war.
Trotz der Besetzung des Rheinlandes durch Staufer, Wittelsbacher und Baiern waren die Speisekammern der Isenburg gut gefüllt und Westfalen war nach Bouvines von den seit der Schneeschmelze heraufziehenden Scharmützeln zwischen Staufern und Welfen so gut wie verschont geblieben. Auch das Volk litt keinen Hunger. Friedrich hatte es vor dem Winter sogar geschafft, neben der Töpferei und der Kornmühle an der Ruhr, verschiedene Handwerker am Fuße der Burg anzusiedeln. Sie hatte er nun aus den Vorräten der Burg über den Winter bringen müssen. Doch dies hatte er sich, der wachsenden Kraft seines Schaffens bewusst, ohne Arg auferlegt. Seine unermüdlichen Ritte durch das Land hatten ihn bekannt gemacht. Die Bauern schätzten ihn und entrichteten ihren Zehnten fast immer pünktlich.
Im Winter und auch im Frühjahr des folgenden Jahres musste Friedrich kein Todesurteil aussprechen. Die Schulzen reichten zumeist aus, die Streitigkeiten zwischen benachbarten Bauern in den Freigerichten zu regeln. Wirklich Unangenehmes gab es in Friedrichs Landen so gut wie nicht zu entscheiden, soweit es an Friedrich herangetragen worden war.
Während seine Lande gut bestellt waren, hatte er im eigenen Haus einen schweren Stand. Der junge Ehemann durfte die Nächte nicht mehr bei Sophie verbringen. Der war ewig übel und sie hatte ständig Hunger. Friedrich konnte zunächst wenig mit ihrer Zickigkeit anfangen, bis Sophie ihm offenbarte, dass sie schwanger war. Von da an behandelte Friedrich sie wie ein rohes Ei, beschaffte Felle, schürte das Feuer und keifte jeden an, der sich in Sophies Nähe ungeschickt anstellte.
Nach einiger Zeit der Fürsorge kam der Besuch Rinkerods mit Steven wie gerufen. Friedrich ordnete eine Bärenjagd an, um für Sophie weitere warme Felle zu besorgen. Sophie meinte, das sei nicht notwendig. Schließlich seien ja genug Felle und Vorräte vorhanden. Doch ließ Friedrich sich nicht von seinem Vorhaben abbringen und ritt für ein paar Tage mit Rinkerod, Steven, Cedric, Berengoz, Wibold und Gundalf zur Bärenjagd in das alte Jagdrevier von Altena, wo Mathilde noch das Jagdrecht besaß.
Friedrich war abgestiegen und stampfte durch den kniehohen Schnee des hohen Sauerlandes. Hier hatte der Frühling noch nicht Einzug gehalten. Bis vor einer halben Stunde hatte er gedacht, den Hörnern näher gekommen zu sein, doch nun hörte er die Jagdknechte nicht mehr. Auch hatte er den Eindruck, dass er sich nur noch tiefer in das Dickicht verirrte. Da stand er nun und überlegte, wie er sich aus dieser prekären Situation wieder befreien konnte, als er unvermittelt eine Stimme hinter sich hörte.
„Hast dich wohl verlaufen, Friedrich?!”
„Einhard!”, fuhr er herum und lachte wieder, „ich dachte schon, ich müsse auf die höchste Eiche klettern, um einen Weg aus diesem Schlamassel zu finden. Aber statt der höchsten, kommt mir die weiseste Eiche zu Hilfe.”
„Schön, dass ich dich sehe, Friedrich”, entgegnete der Einsiedler, „hast du Zeit für ein kleines Schwätzchen mit einem alten Mann.”
„Aber sicher, Einhard.”
Sie gingen eine Weile, bis sie die Hütte Einhards erreichten. Einhard nahm Holz aus dem Klafter, das neben der Eingangstür trocken gestapelt war und gab es Friedrich, woraufhin er sich mit ein paar geschickten Handgriffen an der Tür zu schaffen machte, bevor er sie öffnete. Drinnen schichtete Friedrich das Holz im Kamin auf und holte weiteres von draußen, das er neben dem Kamin stapelte.
„Pelzbock und Erbsbär, wo zum Kuckuck hab ich denn den Feuersack?“
Friedrich holte sein Feuereisen und etwas Zunder aus seinem Beutel und schlug das Feuer an. Er legte Reisig dazu und das Feuer gewann an Kraft. Einhard holte aus einem der vielen Krüge, die auf einem langen Brett an der Wand standen, Kräuter und goss aus dem allmählich über dem Kamin zu kochen beginnenden Wasser einen kräftigen Sud auf.
„Das Bündnis ist zerschlagen. Was wird jetzt kommen, Einhard?“
„Wir können die Zukunft nicht voraussagen, Friedrich. Wir können uns nur gut auf sie vorbereiten.“
„Hm, was denkst du, können wir tun?“
„Es wird sich einiges ändern. Wahrscheinlich im Reich, vielleicht im Erzbistum Cölln.“
„Mein Oheim Adolf hält gegen die Buhlerei der Heimbacher Stand.“
„Ach, Adolf, der immer so ringt mit allem und jedem.“
„Sag, Einhard, du kennst Erzbischof Adolf?!“
„Er steht schon lange im Licht. Da kennt man ihn“, wiegelte er seine persönliche Bemerkung ab.
„Bleibt er, wirst du nichts zu fürchten haben. Den Staufern, sollten sie die Macht an sich reißen können, ist er gewogen. Doch der Bruch von damals…“, für einen Augenblick schienen vor Einhards geistigem Auge Bilder abzulaufen, „…mit Innozenz ist wahrscheinlich nicht verheilt.“
„Du meinst, ich muss mich darauf einstellen, was wird, wenn von Rom ein anderer Erzbischof gekoren wird?!“
„Seit jeher bestimmt das Erzbistum die Politik im Norden. Das wird auch diesmal nicht anders sein. Im Gegenteil! Innozenz will der Weltenlenker sein. Das ist sein Anspruch. Er wird versuchen, die Herrschaft der Erzbistümer über die Sprengel zu verfestigen.“
„Aber, was soll ich tun, Einhard?“
„Beobachte die Dinge, die fern und nah geschen. Die Dinge, die nah geschen, kannst du am besten beeinflussen. In letzter Zeit habe ich Stimmen vernommen, dass dein Vetter Ado Pläne schmiedet, seine Macht in Westfalen auszuweiten. Er baut Burgen an den Grenzen seiner Lande. Versuche mit ihm eure Verhältnisse zu klären. Ado ist ein machthungriger Mann. Und du dominierst mit deiner Burg und der Lage zwischen dem Rheinland und Westfalen die ganze Region. Das könnte Ado missfallen. Er musste als Kind immer schon der erste in allem…”, Einhard stoppte seine persönliche Bemerkung abrupt, während er ein winziges Zucken in Friedrichs Blicken bemerkte.
Und tatsächlich fragte sich Friedrich: Woher nimmt Einhard das Wissen über Ados Kindheitstage?
„Ich danke dir, Einhard“, sprach er ungerührt.
„Ich werde überlegen, wie ich eine Klärung erzielen kann.”
„Dann sieh zu, dass du deine Kirchengüter sicherst. Denn sie trennen das Erzbistum Cölln vom Herzogtum Westfalen, dessen Herr derzeit dein Oheim Erzbischof Adolf ist. Mehr sehe ich im Moment nicht, was du tun kannst.“
„Ja, das bin ich mit Engelbert schon vor Bouvines angegangen. Wir haben ein Verzeichnis unserer Kirchengüter angelegt und es unlängst von meinem Oheim bestätigen lassen.“
„Na, siehst du…“, sprach Einhard, während er sich ein Pfeifchen anzündete. „Gut, Junge. Sehr gut.“
Dann erzählte Friedrich Einhard die Ereignisse des letzten Jahres, von Bouvines, von Sophie, das sie mit seinem Kind schwanger ging und was er an Leistungen in der Grafschaft vollbrachte hatte.
Am späten Nachmittag brachte Einhard Friedrich hinunter zur Lenne, von wo aus er den Weg zur Burg Altena ohne Mühe finden konnte. Beim Abschied legte Einhard Friedrich anerkennend die Hand auf die Schulter und sagte, „ich danke dir für die Nachrichten. Ich wünsche dir und deiner jungen Frau alles Gute, Friedrich. Und bring das Kind, das sie trägt, alsbald zu mir, damit ich es weihen kann.”
Im Gehen rief Friedrich: „Das will ich Einhard, aber wie finde ich dich?”
Eine Antwort erhielt er nicht, und als er sich umwandte, war Einhard von der Stelle, wo er eben noch gestanden hatte, verschwunden.
Als er an das Friedrichs-Tor der alten Burg schlug, hörte er sofort Stimmen und sogleich kam die besorgte Mine Rinkerodes, der durch das Mannsloch ins Freie trat, zum Vorschein.
Die anderen Jäger hatte keinen Bären, dafür aber zwei Wildschweine erlegt. Nachdem Friedrich sich gewaschen und geruht hatte, versammelte sich die Jagdgesellschaft in der großen Halle des Palas. Friedrich musste über seinen Verbleib berichten. Doch erwähnte er nicht die Begegnung mit Einhard.
Die in Altena verbliebene Besatzung und Dienerschaft war froh über die Gesellschaft. Das gebratene Fleisch wurde hereingetragen und auf großen Platten auf der Tafel abgestellt. Jeder bediente sich, indem er mit dem Messer ein Stück einer Keule oder des Nackenteils abtrennte. Zögernd bediente sich auch Friedrich. Er mußte an die Worte Benoits denken, dass die Christliche Lehre unvollständig sei. Damals war Friedrich dieser Halbsatz erst später aufgefallen und als er nachfragte, hatte der Einsiedler geantwortet, dass im katharischen Glauben die Welt nicht unterworfen und ausgeschlachtet werden dürfe. So würden auch die Tiere verschont. Dann musste er an Rydenkasten und die Menschen denken, die jetzt in den Wäldern in jämmerlichen Hütten hausten und womöglich Hunger litten. Doch, wie er Rydenkasten einschätzte, sorgte der für seine Leute – mit dem Wild aus den hiesigen Wäldern. Da war Friedrich sich sicher.
Der Abend war nach dem Geschmack der Männer. Sie machten raue Späße, lachten laut, sangen Heldenlieder und tranken viel vom roten Wein.
Am nächsten Morgen brachen sie mit schweren Köpfen auf und ritten durch den verschneiten Wald entlang der Lenne. Die Luft war nicht mehr so kalt wie gestern. Es ging kein Wind und die Wolken hingen schwer und grau wie Blei am Himmel. Das Wasser der Lenne strömte plätschernd bergab unter den in bizarr gefrorenem Eis endenden Uferböschungen. Äste hingen von der Last des Schnees an manchen Stellen fast in den Fluss hinein. Der Schnee wurde jetzt schwerer. Noch wenige Tage, und der erste Schnee würde anfangen zu tauen. Langsam neigte sich der Winter seinem Ende zu. Endlich wurde der Fluss breiter und strömte jetzt mehr, als dass er plätscherte. Als sie die kleine Siedlung Letmathe und dann die kleine Kirche von Elsey erreichten, hatten sie den Bergwald hinter sich gelassen und die Sicht auf die Landschaft wurde weit und frei. Hier war die westliche Grenze der Grafschaft Altena und Friedrichs Land lag vor ihnen. Die Sonne gleißte nun durch Risse in den Wolken und die Felder glitzerten wie weiße, aneinander gelegte grauweiße Tücher in der hochstehenden Mittagssonne. Zur Rechten sahen sie einen Rittersitz am Lennehang. Bei der Holzbrücke von Garenfeld wollten sie auf das andere Lenne-Ufer wechseln und weiter nach Nord-Westen in Richtung des Isenbergs ziehen, als Friedrich dachte, was wird das Jahr bringen?!
47. Kapitel
Als sie die Brücke über die Lenne betraten, versperrte ihnen ein Ritter in Begleitung eines Jägers den Weg. Augenblicklich wurden sechs Schwerter blank gezogen. Doch Friedrich hob den Arm, als er den Jäger genauer betrachtete.
„Von dieser Gesellschaft drohte keine Gefahr! Sei gegrüßte, Albrecht von Hœrde.“
Albrecht nickte Friedrich freundlich mit einem, „Herr“, zu.
Friedrich musterte den Ritter neben seinem Jäger, der Albrecht sehr ähnelte, ihn aber an Jahren und Leibesfülle um einiges übertraf, „Albert von Hœrde, nehme ich an?!“
„Ja, Herr, der bin ich. Ich wollte bereits meine Aufwartung gemacht haben,…“
„Das macht nichts, Herr von Hœrde“, unterbrach Friedrich den sichtlich verlegenen Ritter, „ich bin ja noch nicht lange zurück und die wenigsten Euresgleichen wissen, wie sie mir begegnen sollen. Nun, Bouvines habt Ihr verpasst.“
Albert verstand die Anspielung seines Herrn sofort und schaute verlegen zu Boden.
„Um mich meinen Lehensleuten bekannt zu machen, werde ich an Pfingsten an meinen Hof laden“, sprach Friedrich weiter, „ich lade Euch hiermit ein, zu kommen.“
„Habt Dank, Herr, wir werden kommen.“
Friedrich nickte, „wohin seid Ihr unterwegs?“
„Wir suchen die Ritter von Berchem auf.“
„Darf ich den Grund erfahren?“, fragte Friedrich nach.
„Nun, Herr, das ist sicherlich eine Sache, die für Euch nicht von Belang ist“, antwortet Albert verlegen.
„Und ob sie das ist, Mann“, fuhr Friedrich den Ritter an.
„Verzeiht, Herr, ich meine, wir wollten es nicht verschweigen.
Wir wollen Euch lediglich von unseren Belanglosigkeiten verschonen.“
„Und, was ist nun der Grund?!“
Albrecht wollte seinem Bruder zur Hilfe kommen, „Herr, es ist so, dass…“, doch Albert wollte sich nicht die Blöße geben, von seinem jüngeren Bruder aus dieser Situation befreit werden zu müssen und Friedrich sah, dass dieser zunächst plump und ungelenk wirkende Braunbart durchaus in der Lage war, seinen Standpunkt zu vertreten, „…freche Banden nächtens in Garenfeld, Berchem und Elzey einfallen und Vieh rauben.“
Friedrich schaute Rinkerod, der aufmerksam zuhörte, an.
„Wir wollen uns mit den Herren von Berchem besprechen, wie wir mit dem Volk verfahren.“
„Und, was gedenkt Ihr zu tun?“
„Nun, Herr, sie kommen aus den Wäldern jenseits des Flusses.
Die Wälder sind unwegsam und jeder Kriegsknecht fürchtet sich dort hin zu reiten.“
„So müssen wir sie in der Nacht stellen, wenn sie kommen“, antwortete nun Albrecht.
„Habt ihr die Räuber schon einmal gesehen oder kennt ihr sie mit Namen?“, wollte Friedrich wissen.
„Nein, Herr, weder das eine noch das andere.“
„Wir wissen nur, dass die Raubzüge in dem Jahr begonnen haben, als der Junggraf von Altena, also Euer gnädiger Cousin, hochwohlgeboren, die Burg Altena gen Mark verließ.“
„Hochwohlgeboren schon, aber gnädig wohl kaum“, murmelte Friedrich. Albert und Albrecht schauten sich leicht verunsichert an. Hatte der Graf von Isenberghe gerade seinen Cousin gemeint? „Ich glaube, wir sollten gemeinsam nach Berchem reiten. Ich werde an der Beratung teilnehmen“, die Brüder schauten sich erstaunt an.
„…wenn ihr natürlich nichts dagegen habt.“
„Nein… nein, wie sollten wir, Herr Graf?!“
„Gut, dann kehrt!“, rief Friedrich an seine Männer gewandt.
„Herr“, sprach Albrecht, „Herr, wir müssen hier verweilen. Denn die Brücke ist der vereinbarte Treffpunkt mit dem Herrn von Garenfeld.“
„Dann ist es hier und heute so etwas, wie ein vorgezogener Hoftag, vermute ich“, meinte Friedrich im Hinblick auf das Eintreffen Richard Garenfelds.
„Nach Garenfeld ist es nicht weit, Herr, soll ich hinreiten und ihn holen?“, fragte Albert, aber Friedrich sagte, „Nein, nein. Lasst uns hier warten. Mein Magen knurrt schon wieder. Wir können hier ein kurzes Lager machen.“
Nach etwa einer Stunde hörten sie Geräusche im abschüssigen Wald und nach kurzer Zeit sahen sie einen stoppelbärtigen Bauern mit einem Kurzschwert am Gürtel aus dem kahlen Gestrüpp auf die Ruhrtalstraße treten. Verdutzt blieb er stehen, als er das kleine Lager erblickte.
„Komm herüber, Richard. Wir warten schon auf dich“, rief Albrecht und Albert ergänzte, „wir haben vornehme Gesellschaft!“ Friedrich musterte den Freien, der über seinem Leinenwanst eine helle, gefütterte, schafslederne Weste trug, als er sich näherte. Der Riemen des ledernen Köchers verlief quer über seiner Brust, während er seinen Bogen in der Linken hielt. Mit der anderen Hand hatte er sein braunes Arbeitspferd den Hang hinunter geführt.
„Das sehe ich“, sprach der Mann verdutzt.
Dann verbeugte er sich und stellte sich vor.
„Ich bin Richard Garenfeld, Älterster zu Garenfeld und ein freier Mann.“
„Dann, seid mir willkommen, Richard. Kommt setzt auf und folgt uns nach Berchem.“
Der Tross brach auf und ritt eine Weile die Straße zurück, so wie sie gekommen waren. Dann bogen sie ab in östliche Richtung. Nach Berchem ging es steil bergan. Das Rittergut lag auf der Kuppe einer weiten freien Fläche, von wo aus das Lennetal bis hinüber nach Elsey gut einzusehen war. Die Ruhrmündung jedoch lag auf der abgewandten Seite im Norden der Ansiedlung. Das befestigte Mauerwerk wurde von einem strahlend weißen Fachwerkbau gekrönt. Zu der Seite im Osten war der Ring nicht geschlossen, denn das Recht zum Burgenbau besaß Berchem nicht. Dennoch, der Zugang zum Sitz der Herren von Berchem, war durch zehn oder mehr geduckte, mit Stroh gedeckte Katen und ein kleines Gehöft erschwert. Mürrische Schafe scharrten in der Wintererde nach Essbarem, als sie sich der Siedlung Berchem näherten.
Kinder liefen ihnen barfuß entgegen, doch sie wurden von einem laut kreischenden Weib verfolgt, welches sie eiligst zum Schutz vor den Heranreitenden in eine Scheune scheuchte und zerrte. Im Dorf vernahmen sie nun aufgeschrecktes Treiben.
Eine Magd rannte zum Haupthaus, in welchem sie kurz darauf verschwand.
Der Matsch und Schlamm spritzt an Friedrich hoch, als er sich in dem unbefestigten Hof aus dem Sattel gleiten ließ. Über grobe Bretter gelangten sie zu der steinernen Treppe, die in das Haupthaus führte und wo eine überraschte Gesellschaft zum Empfang bereitstand.
Die Herren von Berchem waren vier kräftige Burschen. Mehr Bauern als Ritter. Allen war gemein, dass ihr kräftiger blondbrauner Schopf einem Wirbel entsprang, der das Haupthaar zu einem leuchtenden Scheitel auf die eine oder andere Seite des Kopfes zwang. Ihnen stand der Älteste, Dietrich, vor. Dieser machte eine ungelenkte Verbeugung und wies die Gefährten in die dunkle Halle des Gutes.
„Herr, was verschafft uns die Ehre Eurer Gesellschaft? Hättet Ihr einen Boten gesendet, hätten wir Euch einen gebührenden Empfang bereitet…“
„Macht euch keine Umstände, Herr Ritter, wir haben uns den Herren von Hœrde angeschlossen, als wir hörten, dass ihr eine Sache zu bereden habt, die auch für mich von Interesse ist.“
„Verzeiht, Herr, was ist an diesen Räubereien von Wert, was Eure Besorgnis verdient?“, fragte Dietrich aufrichtig überrascht.
„Ich habe die Vermutung, dass ich bereits die Bekanntschaft, dieser Herrschaft gemacht habe.“ Er schaute zu Steven, Berengoz, Wibold und Gundalf hinüber.
„Ahh“, entwich Dietrich von Berchem ein bedrücktes Stöhnen, „seid Ihr unversehrt davongekommen, Herr?“
„Fürchtet Ihr etwa dieses Räubervolk?!“
Die Männer schauten sich gegenseitig an. Keiner wollte sich ein Blöße geben, doch Dietrich antwortete, „Herr, wir alle, wie wir vor Euch stehen, sind sicherlich kein Feiglinge. Die Wolfsmänner sind grob und kalt. Keine Mannschaft wagt sich mehr, sie in die Wälder zu verfolgen und alleine ist ein Ritter gegen sie verloren.“ „Man darf sie nicht unterschätzen und wir müssen sicher sein, dass wir sie alle auf einmal erschlagen. Tun wir es nicht, kommen zehn Neue aus den Wäldern herüber, zünden unsere Häuser an und schlagen alles tot, was sich nicht wehren kann.“
„Wie in Garenfeld im letzten Jahr geschen“, sprach Richard bedrückt.
„Herr, wir müssen an unsere Leute denken. Frauen, Alte und Kinder.“
„Was denkt ihr, warum die Banden Eure Höfe heimsuchen?!“
Die Männer schauten sich wieder an, und Albrecht antwortete, „weil sie ihr Recht an der Gesellschaft verwirkt haben und sich in den Wäldern das übelste Volk gefunden hat.“
„Ich denke vielmehr“, gab Friedrich zurück, „dass diese Menschen nicht genug hatten, um über den Winter zu kommen und ihre Familien nicht mehr ernähren können.“
Entsetzen rührte sich, „Herr, das sind Mörder, wie könnt Ihr sie schützen?!“
„Nicht schützen, verstehen. Ihr seid von der Sorge um Euer Hab und Gut erfüllt und ringt nach einer Lösung, deren Findung Euch Pein und Arg bereitet.“