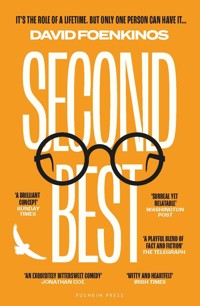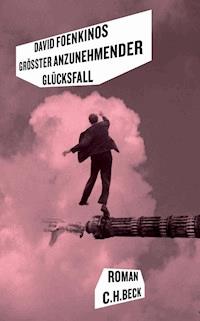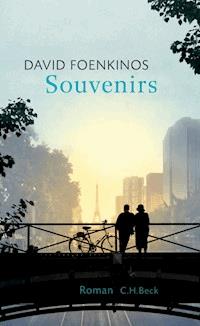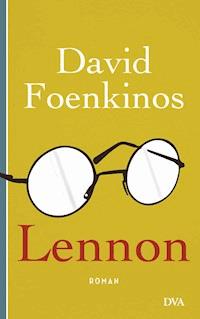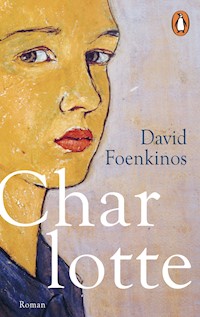9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über das Glück, vom Leben überrascht zu werden ...
Im bretonischen Finistère, am wind- und wellenumtosten »Ende der Welt«, gibt es eine ganz besondere Bibliothek. Sie sammelt Bücher, die nie erscheinen durften. Eines Tages entdeckt dort eine junge Pariser Lektorin ein Meisterwerk, und der Roman wird zum Bestseller. Der Autor, Henri Pick, war der Pizzabäcker des Ortes. Seine Witwe beteuert, er habe zeit seines Lebens kein einziges Buch gelesen und nie etwas anderes zu Papier gebracht als die Einkaufslisten – ob er ein geheimes Zweitleben führte? Diese verrückte Geschichte spornt viele Menschen an, selbst Neues zu wagen: Paare trennen sich, Liebende finden unerwartet zueinander, und so manche Gewissheit wird auf den Kopf gestellt.
Ein französisch-charmanter Roman über die Liebe, verlorene Träume und den Mut, sein Leben in die Hand zu nehmen. Leicht, beschwingt und voller Witz.
Verfilmung unter dem Titel »Der geheime Roman des Monsieur Pick« - zurzeit im Kino!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
ZUM BUCH
Im bretonischen Finistère, am wind- und wellenumtosten »Ende der Welt«, gibt es eine ganz besondere Bibliothek. Sie sammelt Bücher, die nie erscheinen durften. Eines Tages entdeckt dort eine junge Pariser Lektorin ein Meisterwerk, und der Roman wird zum Bestseller. Der Autor, Henri Pick, war der Pizzabäcker des Ortes. Seine Witwe beteuert, er habe zeit seines Lebens kein einziges Buch gelesen und nie etwas anderes zu Papier gebracht als die Einkaufslisten – ob er ein geheimes Zweitleben führte? Diese verrückte Geschichte spornt viele Menschen an, selbst Neues zu wagen: Paare trennen sich, Liebende finden unerwartet zueinander, und so manche Gewissheit wird auf den Kopf gestellt.
Ein französisch-charmanter Roman über die Liebe, verlorene Träume und den Mut, sein Leben in die Hand zu nehmen. Leicht, beschwingt und voller Witz.
ZUM AUTOR
David Foenkinos,1974 geboren, lebt als Schriftsteller und Drehbuchautor in Paris. Seit 2002 veröffentlicht er Romane, darunter den Millionenbestseller Nathalie küsst, der auch als Film mit Audrey Tautou das Publikum begeisterte, und den vielfach ausgezeichneten Roman Charlotte. Seine Bücher werden in rund vierzig Sprachen übersetzt. Das geheime Leben des Monsieur Pick war in Frankreich ein Bestseller.
DAVID FOENKINOS
Das geheime Leben des Monsieur Pick
Roman
Aus dem Französischen von Christian Kolb
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originaltitel: Le mystère Henri Pick
Originalverlag: Éditions Gallimard, Paris
Copyright © 2016 by David Foenkinos
All rights reserved
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe
2017 by Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: Designbüro Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagmotive: Frau: © Rüdiger Trebels; Haus: © raven/fotolia.com; Bücher: © pict rider/fotolia.com; Muschel: © julkapulka13/fotolia.com; Fond: © nata777_7/fotolia.com; Wellen: © Ute Lübbeke
Gestaltung und Satz: DVA / Andrea Mogwitz
Gesetzt aus der Bell MT
»Diese Bibliothek ist gefährlich.«
Ernst Cassirerüber die Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg
Erster Teil
1
1971 erschien der Roman Die Abtreibung1 des amerikanischen Schriftstellers Richard Brautigan. Er erzählt die ziemlich außergewöhnliche Liebesgeschichte zwischen einem Bibliothekar und einer sagenhaft schönen jungen Frau. Diese wird in gewisser Weise Opfer der eigenen Schönheit, als gäbe es einen Fluch der Schönheit. Wegen ihr, erzählt sie, sei ein Autofahrer tödlich verunglückt. Gebannt vom Anblick der umwerfenden Passantin, habe er schlichtweg vergessen, auf die Straße zu achten. Vida, so der Name der Figur, war nach dem Crash sofort zu dem Wagen geeilt. Blutüberströmt, im Sterben liegend, brachte der Fahrer diese letzten Worte hervor: »Sie sind wunderschön.«
Eigentlich gilt unser Interesse hier jedoch mehr dem Bibliothekar als Vida. Denn das Spezielle an diesem Buch ist, dass der Held in einer Bibliothek arbeitet, die von Verlagen abgelehnte Manuskripte annimmt. Wir begegnen etwa einem Mann, der sein Buch nach über vierhundert Ablehnungen dort abgibt. Vor den Augen des Erzählers stapeln sich Bücher jeglicher Art. Ein Essay mit dem Titel Wie man bei Kerzenschein in Hotelzimmern Blumen züchtet oder ein Kochbuch mit sämtlichen Rezepten der Dostojewski-Romane. Eine Besonderheit des Konzepts dieser Bibliothek liegt zudem darin, dass die Autoren ihren Platz in den Regalen frei wählen dürfen. Bevor man das eigene Anti-Vermächtnis einreiht, kann man noch ein wenig in den Werken der ebenfalls verstoßenen Kollegen blättern. Manuskripte mit der Post zu schicken ist allerdings nicht zulässig. Man muss die von allen verschmähte Arbeit schon persönlich abliefern und bekundet durch diesen symbolischen Akt, dass man jegliche Hoffnung auf eine Veröffentlichung hat fahren lassen.
1984 nahm sich der Autor der Abtreibung in Bolinas, Kalifornien, das Leben. Von ihm und den Umständen, die zu seinem Selbstmord führten, wird noch die Rede sein, doch bleiben wir erst einmal bei seiner der Fantasie entsprungenen Bibliothek. Anfang der 90er-Jahre wurde seine Idee Wirklichkeit. Als Hommage an Brautigan rief ein begeisterter Leser eine Bibliothek der abgelehnten Manuskripte ins Leben. In den Vereinigten Staaten entstand die Brautigan Library, deren Ziel es ist, verwaiste Texte zu beherbergen. Sie befindet sich in Vancouver im Bundesstaat Washington.2 Die Initiative seines Fans hätte Brautigan sicherlich gerührt. Andererseits, was weiß man schon über die Gefühlswelten eines Toten? Über die Einweihung der Bibliothek berichteten allerhand Zeitungen, auch in Frankreich. In der bretonischen Gemeinde Crozon stand einem Bibliothekar der Sinn danach, genau das Gleiche zu tun. Und so gründete er im Oktober 1992 die französische Version der Bibliothek der abgelehnten Manuskripte.
2
Jean-Pierre Gourvec war stolz auf das kleine Schild mit dem Aphorismus von Cioran, das über dem Eingang zu seiner Bibliothek angebracht war. Ein schelmischer Spruch für jemanden, der außer der Bretagne nicht viel von der Welt zu sehen bekam.
»Paris ist der ideale Ort, um im Leben zu scheitern.«
Gourvec gehörte zu den Leuten, die mehr an ihrer Region als an ihrem Land hingen, was aber noch keinen glühenden Nationalisten aus ihm machte. Auch wenn er durchaus einen glühenden Eindruck machte: Ein schroffer, schlaksiger Typ mit ziemlich rotem Gesicht und deutlich hervortretenden Adern am Hals – da denkt man schnell, der Mann weist sämtliche äußeren Merkmale eines cholerischen Wesens auf. Doch weit gefehlt. Gourvec war ein besonnener und überlegter Mensch, in dessen Augen Wörter einem Sinn und Zweck dienten. Es genügte, wenige Minuten in seiner Gesellschaft zu verbringen, schon ließ man den falschen ersten Eindruck hinter sich. Gourvec vermittelte das Gefühl, ganz in sich selbst zu ruhen, ähnlich einem Buch in einem Regal.
Er räumte also die Regale um und schuf in einem Winkel seiner Gemeindebücherei Platz für schutzbedürftige Manuskripte. Eine Arbeit, die ihm einen Satz von Jorge Luis Borges ins Gedächtnis rief: »Wer ein Buch aus einem Regal nimmt, um es gleich wieder zurückzustellen, strapaziert nur das Möbelstück.« Heute werden die Möbel ganz schön strapaziert, dachte Gourvec lächelnd. Er hatte den leicht angestaubten Humor eines Gelehrten, mehr noch: des einsamen Gelehrten. So sah er sich selbst, was der Wirklichkeit relativ nahekam. Sein Sinn für Geselligkeit war äußerst schwach ausgeprägt, er konnte selten über die Dinge lachen, über die die Leute aus der Gegend lachten, verstand es jedoch, sich bei dem einen oder anderen Witz dazu zu zwingen. Von Zeit zu Zeit ging er sogar in der Kneipe am Ende der Straße ein Bier trinken, redete mit anderen Männern belangloses Zeug, wie er fand, über Gott und die Welt und ließ sich bei solch großen gemeinschaftlichen Anlässen auch mal auf ein Kartenspiel ein. Ihm war nicht daran gelegen, dass man ihn für einen Sonderling hielt.
Man wusste recht wenig über ihn, nur so viel, dass er allein lebte. In den 50er-Jahren hatte er geheiratet, doch niemand hätte sagen können, weshalb ihn seine Frau schon nach wenigen Wochen wieder verlassen hatte. Es hieß, die beiden hätten sich über eine Heiratsanzeige kennengelernt. Bevor sie sich trafen, schrieben sie sich lange Zeit Briefe. Hatte das Scheitern der Beziehung damit zu tun? Vielleicht zählte Gourvec zu der Sorte von Mann, dessen flammende Liebesbekenntnisse man mit Freuden las, für den man gleich alles liegen und stehen ließ, doch die mit schönen Worten verhüllte Realität stellte dann wohl eher eine Enttäuschung dar. Andere böse Zungen behaupteten damals, seine Frau habe sich schleunigst aus dem Staub gemacht, weil Gourvec impotent war. Eine ziemlich unwahrscheinlich anmutende Theorie, doch man greift bei komplexen psychologischen Sachverhalten gern zu einfachen Erklärungen. Jedenfalls blieb dieses Liebesintermezzo ein unlösbares Rätsel.
Nachdem seine Frau das Weite gesucht hatte, war nie davon zu hören, dass er eine dauerhafte Bindung eingegangen wäre, und er hatte auch keine Kinder. Schwer zu sagen, wie sein Sexualleben aussah. Möglicherweise tat er sich ja als Liebhaber einer verlassenen Frau hervor, einer Emma Bovary seiner Zeit. So manche hielt in den Regalen bestimmt nicht nur nach der Befriedigung ihrer literarischen Träume Ausschau. Mit einem wie Gourvec, der sich aufs Lesen und dadurch auch aufs Zuhören verstand, ließ sich sicher herrlich aus dem drögen Alltag ausbrechen. Doch für diese Spekulationen fehlen die Beweise. Fest steht nur: Seine Begeisterung und Leidenschaft für seinen Beruf sind nie abgeklungen. Er bedachte jeden Nutzer der Bibliothek mit besonderer Aufmerksamkeit, bemühte sich, immer ein offenes Ohr zu haben, und gab persönliche Lektüreempfehlungen ab. Es ging ihm dabei nicht darum, ob er den jeweiligen Titel nun mochte oder nicht, das Ziel war vielmehr, für jeden Leser das passende Buch zu finden. Er vertrat die Ansicht, dass alle Leute gerne lesen, jedoch nur, wenn das Buch das richtige für sie ist, wenn es ihnen so sehr gefällt, wenn es sie so anspricht, dass sie es gar nicht mehr aus der Hand legen wollen. Um im Einzelfall zu ermitteln, welches Buch das richtige ist, hatte er eine geradezu übernatürlich wirkende Methode entwickelt: Er musterte das äußere Erscheinungsbild der Leute und konnte daraus ableiten, welches Werk für sie geeignet war.
Die nimmermüde Energie, die er in seine Arbeit steckte, ließ den Bestand der Bibliothek immer weiter anwachsen. Ein immenser Erfolg seiner Ansicht nach, als würde sich jeder neue Band in die Armee der Schwachen einreihen, die einen heroischen Kampf gegen das drohende Büchersterben führte, bei dem es auf jeden einzelnen ankam. Der Bürgermeister von Crozon erklärte sich einverstanden, noch eine Assistentin einzustellen. Man schaltete also eine Stellenanzeige. Gourvec mochte es, Bücher zu beschaffen, die Regale zu sortieren und noch vieles andere mehr, doch der Gedanke daran, eine Entscheidung fällen zu müssen, die ein menschliches Wesen betraf, flößte ihm Angst und Schrecken ein. Dabei sehnte er sich nach so etwas wie einem literarischen Spießgesellen, nach jemandem, mit dem man stundenlang über die Bedeutung der Auslassungspunkte im Werk Célines diskutieren oder sich über die Gründe für Thomas Bernhards Selbstmord austauschen konnte. Um aber eine solche Person zu finden, stand ihm etwas im Wege: Er wusste sehr wohl, er konnte zu niemandem Nein sagen. So würde ihm die Wahl nicht schwerfallen. Wer sich als Erstes bewarb, würde genommen werden. Und damit fiel die Wahl auf Magali Croze, die fraglos ein Talent dafür hatte, recht zügig auf Stellenanzeigen zu antworten.
3
Magali hatte keine besondere Schwäche für Literatur,3 doch sie war Mutter von zwei kleinen Kindern und brauchte dringend einen Job. Ihr Mann hatte nur noch eine halbe Stelle in einem Renault-Werk. Anfang der 90er-Jahre wurden in Frankreich immer weniger Autos gebaut, man richtete sich auf eine dauerhafte Krise ein. Magali hatte das Bild ihres Mannes vor Augen, das Bild seiner ölverschmierten Hände, als sie ihren Vertrag unterschrieb. Solche Unannehmlichkeiten würde sie nicht in Kauf nehmen müssen, wenn sie den ganzen Tag mit Büchern hantierte. Das würde einen riesigen Unterschied ausmachen zwischen ihr und ihrem Mann. Vom Standpunkt der Hände aus entfernten sie sich immer weiter voneinander.
Letztlich war Gourvec die Vorstellung, mit jemandem zusammenzuarbeiten, dem Bücher nicht heilig waren, recht angenehm. Er sah ein, dass man sich nicht jeden Morgen über deutsche Literatur zu unterhalten brauchte, um gut mit einer Kollegin auszukommen. Er würde die Kunden beraten, und sie sich um die Verwaltung kümmern. Die beiden entpuppten sich als perfekt aufeinander abgestimmtes Duo. Es war nicht Magalis Art, die Initiativen ihres Vorgesetzten infrage zu stellen, aber bei der Sache mit den abgelehnten Manuskripten konnte sie es sich doch nicht verkneifen, ihre Bedenken auszudrücken:
»Was hat das für einen Sinn, Manuskripte ins Regal zu stellen, die überhaupt niemand lesen will?«
»Das war die Idee eines Amerikaners.«
»Na und?«
»Zu Ehren von Brautigan.«
»Wer ist das?«
»Richard Brautigan. Träume von Babylon, haben Sie das gar nicht gelesen?«
»Nein. Ist ja auch egal, aber das ist eine komische Idee. Wollen Sie wirklich die ganzen Psychopathen aus der Umgebung hier haben? Schriftsteller sind nicht ganz richtig im Kopf, das weiß doch jeder. Und Schriftsteller, die überhaupt nichts veröffentlichen, wahrscheinlich erst recht.«
»Es wird endlich einen Ort geben, wo sie willkommen sind. Sehen Sie es als karitatives Werk an.«
»Ich verstehe: Ich soll so etwas wie die Mutter Teresa der erfolglosen Schriftsteller werden.«
»Genau, so ähnlich …«
»…«
Allmählich freundete sich Magali mit der Vorstellung an, und versuchte, sich bereitwillig auf das Abenteuer einzulassen. Jean-Pierre Gourvec gab in den einschlägigen Literaturzeitschriften, darunter Lire und LeMagazine littéraire, Anzeigen auf, in denen er gestrandeten Autoren eine Reise nach Crozon nahelegte, wo sie ihre Manuskripte in der Bibliothek der Verstoßenen abgeben könnten. Die Idee fand sogleich Anklang, und zahlreiche Leute machten sich auf den Weg. Einige durchquerten ganz Frankreich, um sich der Last ihres Scheiterns zu entledigen. Das Ganze hatte etwas von einer Wallfahrt, sozusagen die literarische Variante des Jakobswegs. Indem man Hunderte von Kilometern zurücklegte, um so mit der Enttäuschung, nicht veröffentlichen zu können, innerlich abzuschließen, vollzog man einen wichtigen symbolischen Akt. Es war eine Art, die Wörter aus dem Gedächtnis zu streichen. Und wenn man sich vor Augen hielt, in welchem französischen Departement Crozon liegt, wurde der symbolische Akt vielleicht noch bedeutender: im Finistère, am Ende der Welt.
4
Die Bibliothek nahm in rund zehn Jahren annähernd tausend Manuskripte an. In Betrachtung seines gewaltigen, sinnlosen Schatzes stand Jean-Pierre Gourvec oft fasziniert da. 2003 wurde er schwer krank und kam für lange Zeit in eine Klinik nach Brest. Er trug seiner Meinung nach doppeltes Leid, denn eigentlich belastete ihn sein Gesundheitszustand nicht so sehr wie die Tatsache, dass er nicht bei seinen Büchern sein konnte. Vom Krankenbett aus verfolgte er weiter das literarische Geschehen und wies Magali an, welche Bücher sie bestellen sollte. Man durfte nichts verpassen. Er opferte seine letzte Kraft auf für das, was ihn immer mit Leben erfüllt hatte. Die Bibliothek der abgelehnten Manuskripte schien niemanden mehr zu kümmern, und das machte ihn traurig. Nach dem vielversprechenden Anfang wurde das Projekt nur durch Mundpropaganda noch ein wenig am Leben erhalten. Auch die Brautigan Library in den Vereinigten Staaten geriet langsam in Schwierigkeiten. Kein Mensch interessierte sich mehr für unveröffentlichte Manuskripte.
Vollkommen entkräftet kehrte Gourvec zurück. Man musste kein Hellseher sein, um zu erkennen, dass er nicht mehr lange zu leben hatte. Die wohlwollenden Bürger von Crozon verspürten plötzlich den unwiderstehlichen Drang, sich Bücher aus der Bibliothek auszuleihen. Magali, die Jean-Pierre eine letzte Freude bereiten wollte, hatte die künstliche Begeisterung geschürt. Geschwächt von der Krankheit, bekam er gar nicht mehr mit, dass der unvermittelte Leseransturm im Grunde nicht normal sein konnte. Er ließ sich sogar davon überzeugen, dass seine Arbeit endlich Früchte trug. In diesem unendlich befriedigenden Gefühl würde er aus der Welt scheiden.
Um die Regale zu füllen, bat Magali zudem einige Bekannte, kurzerhand einen Roman zu schreiben. Sie redete nicht zuletzt auf ihre Mutter ein:
»Aber ich kann überhaupt nicht schreiben.«
»Trotzdem, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, es mal zu versuchen. Schreib einfach ein paar Erinnerungen auf.«
»Aber ich kann mich an überhaupt nichts erinnern, außerdem mach ich jede Menge Rechtschreibfehler.«
»Ist doch egal, Mama. Wir brauchen Bücher. Du kannst mir auch deine gesammelten Einkaufslisten bringen.«
»Echt? Meinst du, das könnte irgendjemanden interessieren?«
»…«
Am Ende zog ihre Mutter es vor, Seiten aus dem Telefonbuch abzuschreiben.
Mit eigens zum Zweck der Ablehnung produzierten Texten entfernte man sich von der ursprünglichen Idee, aber egal. Die acht Manuskripte, die Magali in wenigen Tagen zusammengetragen hatte, machten Jean-Pierre ganz glücklich. Er sah in den Neuzugängen die Boten des Aufschwungs, ein Zeichen dafür, dass noch nichts verloren war. Lange würde er die Fortschritte seiner Bibliothek nicht mehr mit ansehen können, und so rang er Magali das Versprechen ab, den in all den Jahren angehäuften Bestand zumindest zu bewahren.
»Ich versprech’s, Jean-Pierre.«
»Diese Autoren vertrauen auf uns … wir dürfen sie nicht enttäuschen.«
»Ich werde auf sie aufpassen. Sie werden hier sicher sein. Wir werden immer ein Herz für die Ausgestoßenen haben.«
»Danke.«
»Jean-Pierre …«
»Ja.«
»Ich wollte Ihnen danken …«
»Wofür?«
»Für den Liebhaber … das ist so ein schönes Buch.«
»…«
Er nahm Magalis Hand und hielt diese eine ganze Weile. Wenige Minuten später saß sie allein in ihrem Auto und musste weinen.
In der darauffolgenden Woche starb Jean-Pierre Gourvec. Viel wurde geredet über den interessanten Mann, den bestimmt alle vermissen würden. Doch zu der schlichten Trauerfeier kamen nur wenige Leute. Was würde bleiben von ihm und seiner Bibliothek der abgelehnten Manuskripte? Am Tag der Beerdigung konnte man vielleicht ein wenig ahnen, was ihn bewogen hatte, dieses Projekt ins Leben zu rufen und daran zu arbeiten. Es war ein Denkmal gegen das Vergessen. Niemand würde diese abgelehnten Bücher lesen, so wie niemand sein Grab besuchen sollte.
Magali hielt freilich ihr Versprechen und pflegte den vorhandenen Bestand, aber ihr fehlte die Zeit, ihn zu erweitern. Seit ein paar Monaten sparte die Gemeindeverwaltung, wo es nur ging; vor allem am Kulturhaushalt. Nach Gourvecs Tod war Magali mit der Bibliotheksleitung betraut worden, durfte jedoch keinen neuen Mitarbeiter einstellen. Sie fand sich allein wieder. Die Ecke mit den abgelehnten Manuskripten verstaubte allmählich und geriet zunehmend in Vergessenheit. Selbst Magali, die von anderen Aufgaben beansprucht wurde, dachte nur noch selten daran. Wer hätte geglaubt, dass die Geschichte mit den abgelehnten Manuskripten noch einmal ihr Leben verändern sollte?
1 Mit dem Untertitel Eine historische Romanze 1966.
2 Man findet über die Brautigan Library leicht Informationen im Internet: www.thebrautiganlibrary.org
3 Als Gourvec sie zum ersten Mal sah, dachte er augenblicklich: Ihr könnte Der Liebhaber von Marguerite Duras gefallen.
Zweiter Teil
1
Auch wenn Delphine Despero aus beruflichen Gründen seit knapp zehn Jahren in Paris lebte, fühlte sie sich doch immer noch als Bretonin. Sie wirkte größer, als sie tatsächlich war, was aber nicht nur an den hohen Absätzen lag, die sie trug. Schwer zu sagen, wie manche Leute es schaffen, größer zu wirken. Strahlen sie so viel Ehrgeiz aus, wurden sie als Kind so sehr geliebt, blicken sie mit so großer Gewissheit in eine glorreiche Zukunft? Vielleicht kam ein wenig von alldem zusammen. Delphine war eine charismatische, dabei niemals aufdringliche Persönlichkeit, der man gerne Aufmerksamkeit schenkte und zuhörte. Als Tochter einer Französischlehrerin hatte sie die Literatur quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Wenn die Mutter Schularbeiten korrigierte, war Delphine, fasziniert vom Rotstift, immer dabei. Sie ermittelte die Fehler der anderen, hielt nach ungeschickten Wendungen Ausschau und prägte sich alles ein, was man ja nicht machen durfte.
Nach dem Abitur nahm sie in Rennes ein sprach- und literaturwissenschaftliches Studium auf, wollte danach aber keinesfalls Lehrerin werden. Sie träumte von einer Karriere im Verlagswesen. Während der Semesterferien machte sie einschlägige Praktika oder ging zumindest Beschäftigungen nach, die ihr Zugang zu literarischen Kreisen verschafften. Sie hatte sehr früh erkannt, dass sie nicht selbst zum Schreiben berufen war, was sie kein bisschen frustrierte, denn sie wollte ja nur mit Schriftstellern arbeiten. Nie würde sie den Schauder vergessen, der sie überlaufen hatte, als sie zum ersten Mal Michel Houellebecq begegnet war. Sie absolvierte damals gerade ein Praktikum bei Fayard, dem Verlag, bei dem Die Möglichkeit einer Insel erschienen war. Houellebecq war kurz stehen geblieben, weniger, um sie anzustarren, mehr, um sie zu beschnuppern, sagen wir mal. Sie brachte stammelnd ein »Bonjour« über die Lippen, das unerwidert blieb, und doch schien ihr, als wäre das ein ganz außergewöhnliches Treffen gewesen.
Als sie am darauffolgenden Wochenende ihre Eltern besuchte, konnte sie stundenlang von diesem belanglosen Augenblick erzählen. Sie bewunderte Houellebecq und »sein unglaubliches literarisches Gespür«. Sie hatte es satt, all die bösen Kritiken über ihn zu lesen; sein Stil, seine Verzweiflung, sein Humor wurden überhaupt nicht richtig thematisiert. Sie sprach von Houellebecq wie von einem alten Bekannten, oder so, als durchdränge sie nach der flüchtigen Begegnung im Korridor sein Werk nun besser als der Rest der Welt. Die Eltern betrachteten belustigt ihre Tochter, die im Überschwang redete. Sie hatten ja alles dafür getan, dass Delphine sich für Sachen interessierte und begeisterte. Insofern hatte die Erziehung ziemlich gut gefruchtet. Delphine konnte spüren, was einen Text antrieb und ihm Leben einhauchte. Wer sie kannte zu der Zeit, dem war klar, dass ihr eine glänzende Zukunft bevorstand.
Nach einem Praktikum bei Grasset wurde sie als Junior-Lektorin angestellt. Dass eine so junge Frau eine solche Position bekleidete, war alles andere als alltäglich, aber wer im richtigen Augenblick zur Stelle ist, hat meist auch Erfolg. Als sie ihr Praktikum angetreten hatte, strebte die Verlagsleitung sowohl eine Verjüngung des Teams als auch eine Erhöhung des Frauenanteils an. Delphine durfte ein paar Autoren betreuen, nicht die wichtigsten, das muss man klar sagen, doch die Autoren freuten sich, eine junge Lektorin an ihrer Seite zu wissen, die mit vollem Einsatz bei der Sache war. Zu Delphines Aufgaben gehörte auch, wenn die Zeit es gestattete, ein Auge auf die unverlangt eingesandten Manuskripte zu werfen. So stieß sie auf den Roman HHhH – Himmlers Hirn heißt Heydrich, den großartigen Erstling von Laurent Binet. Nachdem sie ihn gelesen hatte, eilte sie zu ihrem Chef Olivier Nora und beschwörte ihn, dieses Manuskript zu lesen. Ihr Enthusiasmus zahlte sich aus. Noch bevor die Konkurrenz Binet ein Angebot unterbreiten konnte, unterschrieb er bei Grasset. Wenige Monate darauf erhielt er den Prix Goncourtfür Debütromane, und Delphine Despero wurde für Grasset langsam unentbehrlich.
2
Einige Wochen später stellte sie erneut ihren grandiosen Riecher unter Beweis, als sie den ersten Roman des jungen Frédéric Koskas entdeckte. Die Badewanne handelte von einem jungen Mann, der sich weigerte, sein Badezimmer zu verlassen, und beschlossen hatte, sein Leben in der Badewanne zu verbringen. Etwas Vergleichbares hatte sie noch nie gelesen, das Ganze war in einem zugleich heiteren und melancholischen Stil gehalten. Sie war sich ihrer Sache so gewiss, dass sie keinerlei Mühe hatte, die Programmleitung von dem Roman zu überzeugen. Er erinnerte ein wenig an Oblomow von Gontscharow oder an Der Baron auf den Bäumen von Calvino, unterschied sich von diesen Büchern jedoch darin, dass die Ästhetik der Weltverweigerung sich in zeitgenössischen Dimensionen bewegte. Sie beruhte auf folgender Feststellung: Das Leben der heutigen Jugend spielt sich hauptsächlich am Bildschirm ab, wo man sich theoretisch alles ansehen kann, rund um die Uhr Informationen bekommt und seine sozialen Netzwerke hat. Wozu also überhaupt noch einen Fuß vor die Tür setzen? Delphine konnte stundenlang von diesem Roman schwärmen. Sie erkannte in Koskas ein kleines Genie. Obwohl sie sich schnell für eine Sache begeisterte, war das nun ein Wort, das sie selten gebrauchte. Eine Kleinigkeit muss man allerdings schon dazusagen: Sie war auch dem Charme des Autors von Die Badewanne sofort erlegen.
Vor der Vertragsunterzeichnung hatten sie sich mehrmals getroffen. Zuerst im Verlag, dann im Café, schließlich in einer großen Hotelbar. Sie redeten über das geplante Buch und verhandelten die Konditionen. Koskas’ Herz schlug aufgeregt bei dem Gedanken daran, dass man seinen Namen bald auf einem Cover lesen würde. Ein absoluter Traum ging in Erfüllung. Nun begann das wahre Leben, dessen war er sich sicher. Doch bis zum Erscheinungstag würde er noch wie entwurzelt dahintreiben. Sie sprachen über seine Vorbilder. Delphine war sehr belesen. Sie unterhielten sich über ihre Geschmäcker, aber nie driftete das Gespräch ins Persönliche ab. Dabei hätte die Lektorin furchtbar gern gewusst, ob es im Leben ihres neuen Autors eine Frau gab. Sie hätte sich jedoch nie erlaubt, ihn so etwas zu fragen. Auf Umwegen versuchte sie, an Informationen zu gelangen, vergeblich. Schließlich unternahm Frédéric einen Vorstoß:
»Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen?«
»Ja, bitte.«
»Haben Sie einen Freund?«
»Soll ich Ihnen eine ehrliche Antwort geben?«
»Ja.«
»Ich habe keinen Freund.«
»Warum?«
»Weil ich auf einen Mann wie Sie gewartet habe«, antwortete Delphine plötzlich, verwundert über die eigene Spontaneität.
Am liebsten hätte sie es gleich wieder zurückgenommen, hinzugesetzt, das sei ihr gerade so herausgerutscht, aber sie hatte schon gemerkt, dass sie sich überzeugend ausgedrückt hatte. An der Aufrichtigkeit ihrer Worte konnte kein Zweifel bestehen. Frédéric hatte freilich seinen Teil zu dem Schlamassel beigetragen und ihr das Geständnis entlockt, indem er in der Verkettung der Ereignisse »Warum?« gefragt hatte. So etwas fragt man nur, wenn man weiß, man kommt gut an, oder? Delphine saß etwas verlegen da, musste sich jedoch eingestehen, dass es ihre Liebe zur Wahrheit gewesen war, die ihr ihre Worte eingegeben hatte. Zur reinen, unzähmbaren Wahrheit. Ja, sie sehnte sich nach einem Mann wie ihm. Körperlich und emotional. Es heißt, die Liebe auf den ersten Blick ist die Begegnung mit etwas, das im eigenen Innern schon immer existiert hat. Seitdem sie Frédéric zum ersten Mal gesehen hatte, hatte sie so ein verwirrendes Gefühl gehabt; das Gefühl, ihn zu kennen, und vielleicht war er ihr in einem prophetischen Traum tatsächlich schon erschienen.
Frédéric wusste nicht, was er sagen sollte, Delphine hatte ihn überrumpelt. Das waren wohl ganz und gar aufrichtigeWorte gewesen. Wenn sie seinen Roman mit Lob überschüttete, kam es ihm meist etwas übertrieben vor. Bestimmt Berufspflicht, ständig hingerissen zu sein, dachte er sich. Aber jetzt durfte er sie anscheinend beim Wort nehmen. Er musste irgendetwas antworten, und diese Antwort würde die Richtung bestimmen, in die es gehen sollte mit ihnen. Wollte er sie nicht eher auf Distanz halten? War ihm nicht vielmehr daran gelegen, dass sich ihr Austausch ganz auf seinen Roman sowie seine folgenden Romane beschränkte? Aber das Berufliche war vom Privaten schwer zu trennen. Er war für die Reize dieser Frau, von der er sich so gut verstanden fühlte und die sein Leben verändert hatte, ja durchaus empfänglich. Da er durch das Labyrinth seiner Gedanken irrte, musste erneut Delphine das Wort ergreifen.
»Ich werde Ihr Buch mit unvermindertem Enthusiasmus herausbringen, sollten die Gefühle nun nicht auf Gegenseitigkeit beruhen.«
»Vielen Dank für diese Klarstellung.«
»Bitte.«
»Also nehmen wir einmal an, dass wir beide ein Paar wären …«, setzte Frédéric in einem plötzlich amüsierten Ton an.
»Ja, nehmen wir es doch mal an …«
»Was passiert, wenn wir uns trennen?«
»Sie sind wirklich ein großer Pessimist. Es hat noch überhaupt nicht angefangen, und Sie reden schon von Trennung.«
»Aber ich möchte, dass Sie mir trotzdem antworten: Sollten Sie mich eines Tages hassen, lassen Sie dann all meine Bücher einstampfen?«
»Ja, natürlich. Das ist das Risiko, das Sie in Kauf nehmen …«
»…«
Er sah sie an und lächelte, und mit diesem Lächeln begann alles.
3
Sie verließen die Bar und fingen an zu gehen. Sie waren wie Touristen in ihrer eigenen Stadt, streiften durch Paris und verliefen sich, erreichten aber dennoch Delphines Wohnung. Sie hatte ein kleines Appartement gemietet in der Gegend des Montmartre, in einem Viertel, bei dem es schwierig zu sagen ist, ob es nun einfach oder vornehm zugeht. Sie stiegen die Stufen zum zweiten Stock hinauf: eine Art Vorspiel. Frédéric betrachtete Delphines Beine, die sich beobachtet fühlten und daher nur langsam voranschritten. Oben angekommen, packte sie keine stürmische Leidenschaft, als sie sich gemeinsam aufs Bett legten, ihr brennendes Verlangen mündete in eine ebenso erregende Ruhe. Sie schliefen miteinander. Und hielten sich anschließend lange in den Armen, bewegt von dem seltsamen Gefühl, mit jemandem, der noch vor wenigen Stunden ein Fremder war, auf einmal innig vereint zu sein. Die Wandlung hatte sich so rasch vollzogen – und sie war schön. Delphines Körper erreichte ein lange ersehntes Ziel. Frédéric fühlte sich erleichtert, in seinem Leben schloss sich eine vage empfundene Lücke. Und sie wussten beide, was gerade mit ihnen geschah, geschah sonst nie. Oder vielleicht manchmal, im Leben der anderen.
Mitten in der Nacht schaltete Delphine das Licht an:
»Es wird Zeit, dass wir über deinen Vertrag reden.«
»Ach so … dir ging’s nur darum, deine Verhandlungsposition zu verbessern …«
»Natürlich. Ich schlafe immer mit den Autoren, bevor sie den Vertrag unterschreiben. Dann ist es leichter, an die Filmrechte ranzukommen.«
»…«
»Also? Was ist?«
»Ich trete dem Verlag die Filmrechte ab. Ich trete sämtliche Rechte ab.«
4
Die Badewanne wurde leider ein Flop. Wobei Flop noch ziemlich gelinde ausgedrückt ist. Aber was hatte man denn erwartet? Auch wenn Delphine Despero sich alle Mühe gab und ihre Pressekontakte spielen ließ, änderten ein paar Artikel, die die »hohe Veranlagung eines vielsprechenden Talents« priesen, doch nichts an dem Schicksal, das den meisten Romanen blüht. Man glaubt, das gedruckte Buch sei schon der Gral. Wie viele Leute, die schreiben, träumen davon, eines Tages ihr eigenes Buch in Händen zu halten? Aber es gibt Schlimmeres als das Leid, nicht veröffentlichen zu können: das Leid, überhaupt nicht wahrgenommen zu werden.4 Nach ein paar Tagen verschwinden die Titel wieder aus den Regalen, man rennt verzweifelt von einer Buchhandlung zur anderen, auf der Suche nach einem Belegexemplar der eigenen Existenz. Wer ein Buch schreibt, das keine Leser findet, für den nimmt die Gleichgültigkeit der Welt Gestalt an.
Delphine strengte sich an, beruhigend auf Frédéric einzuwirken. Sie versicherte ihm, der Rückschlag zerstöre keineswegs die Hoffnungen, die der Verlag in ihn setze. Doch nichts zu machen, Frédéric fühlte sich leer und gedemütigt. Wörter waren nun mal sein Leben, jahrelang hatte er die Gewissheit gehabt, dass sie ihn eines Tages auch ernähren würden. Er hatte sich gefallen in der Rolle des schreibenden jungen Mannes, dessen Roman bald erscheinen würde. Aber was durfte er jetzt noch vom Leben erwarten, nachdem die Wirklichkeit seinen Traum in so ein klägliches Kleid gezwängt hatte? Er hatte keine Lust, Theater zu spielen, so zu tun, als wäre er angesichts hervorragender Kritiken ganz aus dem Häuschen, mit einer dreizeiligen Notiz in Le Monde zu prahlen, wie so viele andere es machten. Frédéric Koskas wusste die eigene Lage objektiv einzuschätzen. Er kapierte, er brauchte nichts zu ändern an dem, was ihn auszeichnete. Sein Roman wurde nicht gelesen, so war das nun eben. »Immerhin hat mir das Buch dazu verholfen, die Frau meines Lebens kennenzulernen«, tröstete er sich. Er musste mit eisernem Willen seinen Weg weitergehen wie ein von seinem Regiment vergessener Soldat. Einige Wochen später fing er wieder mit dem Schreiben an. Und arbeitete an einem Roman, der den vorläufigen Titel Das Bett trug. Er wollte Delphine nicht verraten, worum es ging, er sagte nur schlicht: »Wenn es der nächste Flop wird, ist so ein Bett wenigstens gemütlicher als eine Badewanne.«
5
Frédéric zog bei Delphine ein. Sie wohnten nun also zusammen. Damit kein Gerede aufkam, wurde im Verlag niemand eingeweiht, welcher Art ihre Beziehung war. Morgens ging Delphine in ihre Arbeit, und Frédéric machte sich an seine. Er wollte sein ganzes Buch im Bett schreiben. Der Schriftstellerberuf liefert hervorragende Alibis. Kein anderer Beruf erlaubt es, den lieben langen Tag unter der Decke zu liegen und dennoch von sich zu behaupten: »Ich arbeite.« Manchmal träumte und döste er vor sich hin und redete sich ein, dies sei dem Schaffensprozess dienlich. Die Wirklichkeit sah anders aus. Ihm fiel überhaupt nichts ein. Schadete sein wunderbar bequemes Glück seiner Kreativität? Musste er sich nicht verloren und zerbrechlich vorkommen, um etwas ganz Großes zu schaffen? Nein, das war doch absurd. Manche Meisterwerke waren Produkte der Verzweiflung, andere entstanden im Gefühl der Euphorie. Sein Leben verlief eben zum ersten Mal in einigermaßen geordneten Bahnen. Delphine verdiente genug Geld für beide, während er seinen Roman schrieb. Er fühlte sich nicht zum Parasiten oder Hilfeempfänger geboren, aber es störte ihn auch nicht, sich aushalten zu lassen. Letztlich arbeitete er ja für sie, da sie hinterher den Roman herausbringen würde. Das war sozusagen der Liebespakt. Aber Delphine war eine unbestechliche Richterin, ihre Liebe würde keinen Einfluss auf ihr Urteil über sein Buch haben, das wusste er auch.
In der Zwischenzeit veröffentlichte sie Bücher von anderen Autoren, und ihr Gespür für Literatur machte weiter von sich reden. Sie schlug mehrere Angebote von anderen Verlagen aus, denn sie fühlte sich Grasset, dem Haus, das ihr eine erste berufliche Chance gegeben hatte, sehr verbunden. Es kam vor, dass Frédéric ihr kleine Eifersuchtsszenen machte. »Was? Du hast dieses Buch verlegt? Aber wieso denn das? Es ist total schlecht.« Delphine meinte: »Verbitterte Schriftsteller, die andere Autoren unlesbar finden, gehen mir auf den Geist. Das sind perverse Egomanen, die muss ich mir sowieso den ganzen Tag reinziehen. Zu Hause möchte ich einen solchen haben, der sich auf seine eigene Arbeit konzentriert. Womit die anderen sich abgeben, spielt überhaupt keine Rolle. Außerdem vertreibe ich mir mit denen bloß die Zeit, eigentlich sehne ich mich doch nur nach deinem Bett.« Delphine hatte eine herrliche Art, Frédérics Ängste zu zerstreuen. Sie verkörperte die perfekte Mischung aus einer verträumten Literatin und einer Frau, die fest in der Wirklichkeit verankert war. Sie schöpfte Kraft aus ihren bretonischen Wurzeln und der Liebe ihrer Eltern.
6
Ihre Eltern, wo wir schon von ihnen reden. Jeden Tag telefonierte Delphine mit ihrer Mutter und erstattete in allen Einzelheiten Bericht darüber, was in ihrem Leben vorfiel. Sie sprach auch mit ihrem Vater, doch bei ihm verzichtete sie auf unnütze Details und erzählte nur die komprimierte Fassung. Vor Kurzem waren beide Eltern in Rente gegangen. »Meine Mutter ist Französischlehrerin, mein Vater Mathelehrer, das erklärt wohl meine Widersprüchlichkeit«, pflegte Delphine zu scherzen. Der Vater hatte in Brest gearbeitet, die Mutter in Quimper, und am Abend war man wieder in Morgat zusammengekommen, in der Gemeinde Crozon. Eine ursprüngliche Gegend, wo die wilde Natur regiert, ein magischer Ort. Es war unmöglich, sich dort zu langweilen; allein die Betrachtung des Meers konnte ein ganzes Leben ausfüllen.
Delphine verbrachte die Sommerferien immer bei ihren Eltern, und die nun bevorstehenden sollten keine Ausnahme von der Regel bilden. Sie schlug Frédéric vor mitzukommen. Bei der Gelegenheit könne er auch endlich Fabienne und Gérard kennenlernen. Er tat so, als würde er überlegen, als hätte er etwas anderes vor. Er fragte:
»Was hast du dort für ein Bett?«
»Da hat noch nie ein Mann drin geschlafen.«
»Du meinst, ich wäre der erste, der mit dir in diesem Bett schläft?«
»Der erste und hoffentlich auch der letzte.«
»Ich würd gern so schreiben können, wie du sprichst. Das klingt immer alles so schön, so kraftvoll, so endgültig.«
»Du kannst besser schreiben. Das weiß ich. Ich muss es ja wissen.«
»Du bist wundervoll.«
»Du bist aber auch nicht übel.«
»…«
»Crozon ist das Ende der Welt. Wir werden lange Spaziergänge am Meer machen, das Wasser ist ganz klar.«
»Und deine Eltern? Ich bin meist nicht so umgänglich, wenn ich im Schreibprozess stecke.«
»Meine Eltern verstehen das schon. Dann redest du eben mehr mit mir. Niemand ist zum Reden verpflichtet. So ist das in der Bretagne …«
»Was soll denn das heißen? ›So ist das in der Bretagne‹? Das sagst du die ganze Zeit.«
»Wirst schon noch merken.«
»…«
7
Es sollte alles ein bisschen anders kommen. Frédéric wurde von Delphines Eltern in der Bretagne sehr herzlich empfangen. Offensichtlich war es das erste Mal, dass ihre Tochter ihnen einen Mann vorstellte. Sie wollten gleich viel über ihn wissen. Darüber, dass angeblich niemand »zum Reden verpflichtet« sei, würde er sich mit Delphine noch mal unterhalten müssen. Er sah sich mit allerhand Fragen konfrontiert, die seinen Lebenslauf, seine Eltern und seine Kindheit betrafen, wo es ihm doch so unangenehm war, seine Vergangenheit auszubreiten. Er bemühte sich, seine Geselligkeit unter Beweis zu stellen, indem er seine Antworten mit komischen Anekdoten würzte. Delphine hatte den Eindruck, dass das meiste frei erfunden war und die fesselnde Darstellung die düstere Realität verschleiern sollte, ein ganz richtiger Eindruck.
Gérard hatte Die Badewanne aufmerksam gelesen. Für einen Autor, der ein in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommenes Buch herausgebracht hat, ist es immer etwas deprimierend, wenn er auf einen Leser trifft, der ohne Unterlass über das Buch spricht und glaubt, dem Autor damit eine Freude zu bereiten. Natürlich beruht das Ganze auf hehren Absichten. Doch schon als sie beim ersten Aperitif auf der Terrasse saßen und in die entwaffnend schöne Landschaft starrten, war es Frédéric peinlich, dass sein letztlich ziemlich armseliger Roman auf dem Gespräch lastete. Er fing langsam an, sich innerlich von dem Text zu lösen, er erkannte die Schwachstellen daran, er hatte es eben zu gut machen wollen. Als müsste man mit jedem Satz zeigen, was für ein gewaltiger Schriftsteller man ist. Der erste Roman ist immer der eines fleißigen Schülers. Nur Genies sind von Anfang an faul. Es brauchte sicher Zeit, um zu begreifen, wie so ein Text atmet, wie man im Geheimen die Fäden spinnt. Frédéric hatte das Gefühl, dass sein zweiter Roman besser werden würde, er dachte ständig über sein neues Buch nach, ohne je ein Wort darüber zu verlieren. Aber er durfte niemanden ins Vertrauen ziehen, der seiner inneren Stimme widersprechen könnte.
»Die Badewanne ist eine hervorragende Parabel, in der sich die heutige Zeit widerspiegelt«, meinte Gérard.
»Oh …«, sagte Frédéric.
»Sie haben vollkommen recht: Das Leben im Überfluss richtet erst mal Chaos an. Und schließlich führt es dazu, dass die Leute auch verzichten können. Wer alles hat, will irgendwann gar nichts mehr. Das ist eine sehr stimmige Gleichung in meinen Augen.«
»Danke. Sie machen mich ganz verlegen mit Ihren Komplimenten …«
»Genießen Sie Ihr Glück. So geht’s bei uns nicht immer zu«, gab er unter schallendem Gelächter zurück.
»Man erkennt in Ihrem Buch den Einfluss von Robert Walser, nicht wahr?«, warf Fabienne ein.
»Robert Walser … ich … ja … stimmt, ich mag Robert Walser. Mir wäre das wohl nicht aufgefallen, aber Sie haben wahrscheinlich recht.«
»Ihr Roman hat mich vor allem an seine Erzählung Der Spaziergang