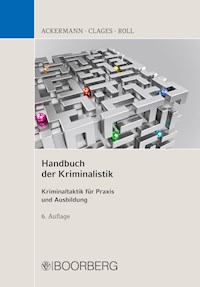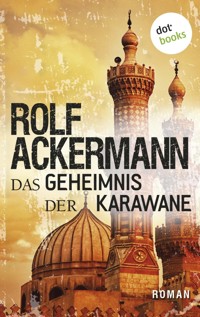
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was vor langer Zeit geschah, wird zur tödlichen Gefahr: Rolf Ackermanns spannungsgeladener Roman "Das Geheimnis der Karawane" als eBook bei dotbooks. Ein Geheimnis, das die Welt in ihren Grundfesten erschüttern kann … Als der Abenteurer Peter Föllmer bei einem Freund in Kairo ankommt, ist dieser bereits tot – brutal ermordet. Offenbar wusste er zu viel über eine geheimnisvolle Landkarte, auf der die Route einer Karawane eingetragen sein soll, die im 15. Jahrhundert spurlos verschwand. Was ist damals geschehen? Und führten die Männer einst wirklich einen der größten Schätze der Menschheitsgeschichte mit sich? Peter beginnt, nach Antworten zu suchen. Dabei begegnet er der Äthiopierin Jahzara – doch diese schöne wie geheimnisvolle Frau bringt ihn in größte Gefahr … Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Das Geheimnis der Karawane" von Rolf Ackermann. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein Geheimnis, das die Welt in ihren Grundfesten erschüttern kann … Als der Abenteurer Peter Föllmer bei einem Freund in Kairo ankommt, ist dieser bereits tot – brutal ermordet. Offenbar wusste er zu viel über eine geheimnisvolle Landkarte, auf der die Route einer Karawane eingetragen sein soll, die im 15. Jahrhundert spurlos verschwand. Was ist damals geschehen? Und führten die Männer einst wirklich einen der größten Schätze der Menschheitsgeschichte mit sich? Peter beginnt, nach Antworten zu suchen. Dabei begegnet er der Äthiopierin Jahzara – doch diese schöne wie geheimnisvolle Frau bringt ihn in größte Gefahr …
Über den Autor:
Rolf Ackermann, geboren 1952 in Duisburg, ist ehemaliger Beamter eines deutschen Nachrichtendienstes, Journalist und Autor zahlreicher Sachbücher und Romane. Seine langjährigen Aufenthalte und Recherchen in Ostafrika inspirierten ihn zu »Weiße Jägerin«. Zudem begleitete er auch die ZDF-Filmproduktion »Momella – eine Farm in Afrika« über Margarete Trappes Leben in beratender Funktion. Rolf Ackermann lebt seit einigen Jahren in Namibia, wo er eine Hilfsorganisation für San („Buschmänner“) gegründet hat. Er beschäftigt sich intensiv mit den traditionellen Heilmethoden und Heilkräutern Afrikas.
Die Website des Autors: www.rolf-ackermann-namibia.over-blog.de
***
Neuausgabe Juli 2015
Dieses Buch erschien bereits 2010 unter dem Titel Die verschollene Karawane bei Knaur Taschenbuch, München.
Copyright © der Originalausgabe 2010 Knaur Taschenbuch, München
Copyright © der Neuausgabe 2015 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung eines Motivs von istockphoto/Orietta Gaspari
ISBN 978-3-95824-029-2
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Das Geheimnis der Karawane an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://gplus.to/dotbooks
http://instagram.com/dotbooks
Rolf Ackermann
Das Geheimnis der Karawane
Roman
dotbooks.
In Erinnerung an Mavros – einen Husky
Träume von großen Gefühlen in Freiheit enden schnell an den engen Grenzen derjenigen, die Gefangene ihres Umfeldes und Geisel ihres eigenen Geistes sind. Sie sperren ein, was sie vorgeben, zu lieben, aus Angst, es laufe weg oder werde ihnen genommen. Einen Traum als Illusion zu entlarven, ist schmerzhaft. Dazu gezwungen zu werden, ist grausam. Denjenigen wie einen räudigen Hund davonzujagen, der für Träume und Freiräume großer Gefühle und für die Freiheit aller kämpft, ist zynisch.
Kapitel 1
Fassungslos starrte Pater Giovanni auf die blutüberströmte Leiche. Er hätte schreien mögen, aber schrille Laute waren in diesen heiligen Gemäuern nicht erwünscht. In einem Franziskanerkloster definiert sich Gottesfurcht über lautlose Demut.
Panisch presste er sich die Hand auf den Mund. Er zitterte am ganzen Leib. Zu grauenhaft war das, was er sah. Tote hatte er schon oft gesehen: runzlige Mütterchen mit Bartstoppeln im Gesicht ebenso wie Frauen in der Blüte ihres Lebens. Und einmal sogar einen Fötus, der den Schoß der Mutter leblos verlassen hatte. Der Tod war nun mal fester Bestandteil Seiner Schöpfung. Asche zu Asche, Staub zu Staub, so gab Er es vor. Doch dieser Leichnam war grässlicher als alles, was er je zuvor gesehen hatte. Zumal er den Toten gut kannte. Er fühlte sich angewidert vom Anblick des alten Mannes zu seinen Füßen. In Bruchteilen von Sekunden rebellierte sein Körper gegen den Ekel erregenden Geruch von Erbrochenem auf dem Hemd des Ermordeten, der auf dem Boden der Wandnische zusammengesackt war, den Rücken gegen die Statue des heiligen Franziskus gelehnt. Das Gesicht war voller Blut, die Nase deformiert. Und immer noch rann dem Toten Blut über den Kinnbart auf sein weißes Hemd. Am Hals waren blaurote Hämatome zu sehen. Jemand hatte ein fingerdickes Seil mehrfach um seinen Hals gezurrt und es an der Statue hinter ihm festgebunden. Die Zunge des alten Mannes hing schlaff seitlich aus dem Mund heraus. In seinem weit aufgerissenen, fast zahnlosen Mund steckte etwas, das ihm bis tief in die Speiseröhre reichte. Es sah wie zusammengeknülltes Papier aus. Kein Zweifel: Dieser Mann war misshandelt und schließlich zu Tode stranguliert worden. Die hervorgetretenen Augen des Toten ließen erahnen, dass er Höllenqualen gelitten hatte. Dio mio! Wer war zu solch einer bestialischen, geradezu teuflischen Tat fähig? In einem Kloster! Und ausgerechnet vor der Statue des heiligen Franziskus, dessen Sanftmut und Respekt vor allen Geschöpfen des Herrn legendär war.
Der junge Mönch bekreuzigte sich hastig, stammelte nochmals mehrere »Dio mio« vor sich hin, atmete tief durch, raffte seine Kutte zusammen und kniete nieder. Aus einem Winkel des Klosters nahm er undeutlich Schritte wahr, die sich entfernten. Wahrscheinlich waren es die Besucher, die noch vor einer halben Stunde diese Nische hier bestaunt und den Brunnen des heiligen Bernhardin aus Siena und die Zisterne aus dem 15. Jahrhundert bewundert hatten. Aus aller Welt kamen Menschen in dieses Kloster, da der heilige Bernhardin hier einst ein Wunder vollbracht hatte. Mit dem Zeichen des Kreuzes hatte er das salzige Wasser der Lagune zu köstlichem Trinkwasser verwandelt. Auf diesem winzigen Eiland waren schon einige Wunder geschehen: Angefangen hatte es irgendwann im Jahre 1220 des Herrn, als der heilige Franziskus bei seiner Rückkehr von der Reise zum heidnischen Sultan von Ägypten in einem Boot hier angelegt hatte und von den Schwalben der Insel mit freudigem Gezwitscher begrüßt worden war. Der heilige Bonaventura, Gott sei seiner Seele gnädig, hatte in der Legenda maior sogar geschrieben, dass der heilige Franziskus die wundersame Fähigkeit besessen habe, den Vögeln gleich von der Erde abzuheben. Damals, bei seiner Rückkehr aus Ägypten und Jerusalem, habe er das Gezwitscher der Schwalben verstanden und von ihnen den Auftrag des Allmächtigen erhalten, auf dieser kleinen Insel, eine Bootsstunde von Venedig entfernt, ein Haus zu Ehren Gottes zu erbauen. So waren zunächst eine kleine Kirche und dann dieses Kloster entstanden. Später hatte man dann zu Ehren des heiligen Franz von Assisi eine hölzerne Statue errichtet. Dem Künstler war es vortrefflich gelungen, das sanfte, von göttlicher Gnade und Weisheit geprägte Antlitz des Franziskus zu modellieren. Die Statue zeigte den bärtigen, schmallippigen Mönch mit tiefen Denkfalten auf der Stirn, das Haar ergraut, sein ausgemergeltes, von Enthaltsamkeit geprägtes Gesicht mit der schmalen Nase erhaben gen Himmel gerichtet. Ja, doch, der Mann in der braunen Kutte war ein Heiliger gewesen. Doch nun lag an dieser herrlichen Heiligenstatue eine schrecklich zugerichtete Leiche gelehnt.
Pater Giovanni lauschte gebannt den plötzlich knarrenden Scharnieren der Klostertür. Die Schritte, das monotone Murmeln der Besucher verstummten abrupt. Es wurde Furcht erregend still. Respektvoll beugte er sich über den Leichnam, schloss mit zittriger Hand die Lider der in Pein und Angst aufgerissenen Augen und schlug ein Kreuz über der Stirn des Toten: »Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen!« Das Antlitz des Alten strahlte mit den geschlossenen Augen eine bizarre Friedfertigkeit aus. Selbst in den erschlafften Gesichtszügen war erkennbar, dass dieser Mensch zu Lebzeiten eine grenzenlose Güte in sich getragen hatte. Ja, Charles war wirklich ein guter, ein Gott ergebener, ehrfürchtiger Mensch mit sanftem Blick und einer noch sanfteren Seele gewesen. Nun waren seine Gesichtzüge verzerrt. Er hatte sich offensichtlich gewehrt, hatte um sein Leben gekämpft. Die Kratzer in den Sandsteinfliesen auf dem Boden und die abgebrochenen Fingernägel des Toten ließen erahnen, dass der Todeskampf lange gewährt hatte. Der Mörder musste kräftig gewesen sein, ein starker, hasserfüllter oder auch gieriger Mensch, der mithilfe einer Hanfkordel sein Opfer bis zum qualvollen Tod stranguliert hatte.
Entsetzt starrte Pater Giovanni auf das Seil. Erst in diesem Moment realisierte er das Unglaubliche. Irritiert schluckte er und blickte zögernd an seinem eigenen Körper hinab. Ein helles, kunstvoll verknotetes Hanfseil hielt auch seine geknüpfte Kutte in Hüfthöhe zusammen – ganz in der Tradition der Franziskaner. Um Gottes willen! Charles war mit einem Seil erwürgt worden, das dem seinen und dem seiner Mitbrüder hier im Kloster glich.
Plötzlich schreckte er auf. Die Glocke des Kirchturms rief zum Nachmittagsgebet und zur Meditation: Vesperzeit! In einer Dreiviertelstunde würde das Nachmittagsgebet beendet sein und das Abendessen beginnen. Aus der Kirche klang die erste Strophe des Sonnengesangs des heiligen Franziskus: »Höchster, allmächtiger, guter Herr, Dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen. Dir allein, Höchster, gebühren sie, und kein Mensch ist würdig, Dich zu nennen.« Beängstigende Gedanken schossen Pater Giovanni durch den Kopf. Sein Blick haftete an dem Hanfseil am Hals des Opfers. Jeder seiner fünf Mitbrüder trug ein solches Seil. Was wäre, wenn nachher, beim Abendessen, einer der Mönche fehlen würde? Was, wenn der Mörder aus ihren eigenen Reihen käme? Oder war es einer der Besucher gewesen? Als wolle er sich gegen solchermaßen unfassbare Gedanken wehren, schüttelte er seinen Kopf. Doch woher stammte dieses Seil? Einige der Fischer drüben in dem kleinen Ort Burano auf der Nachbarinsel benutzten ebenfalls solche Hanfseile. Zumindest sahen sie so ähnlich aus, oder nicht? Schockiert von dem sich ihm aufdrängenden Verdacht sprang Pater Giovanni so hastig auf, dass er seine Brille verlor. Laut klirrend zerbrachen die Gläser auf dem Steinboden. Seine Hände tasteten nach ihr. Schließlich konnte er die Hornfassung zwischen den seitlich ausgestreckten Beinen der Leiche erfühlen. Beim Einsammeln der Scherben schnitt er sich. Warm und klebrig fühlte er sein eigenes Blut über die Hand rinnen. Schnell sprang er auf, raffte seine Kutte hoch und hetzte durch die Kapelle der Jungfrau Maria zu seinen Mitbrüdern.
»Bruder Giovanni«, kam ihm kurz vor dem Speisesaal Pater Ernesto, der Älteste der Glaubensgemeinschaft, aufgeregt und mit fragendem Blick entgegengehinkt, »mein Sohn, weißt du vielleicht, wo der altehrwürdige Bruder Elias steckt? Er hätte eigentlich mit dem letzten Boot aus Burano kommen sollen. Ist er aber nicht. Das ist sehr ungewöhnlich! Sein Platz beim Nachmittagsgebet ist leer geblieben. Wir machen uns große Sorgen um ihn. Der Herr verwirrt seinen in die Jahre gekommenen Geist hin und wieder so sehr, dass er nicht immer genau weiß, was er tut. Gottes Fügungen sind unergründlich.«
Fassungslos starrte Pater Giovanni seinen Mitbruder an. Der fürchterlichste aller Verdachtsmomente schien sich zu bestätigen. Der greisenhafte und manchmal völlig abwesend wirkende Bruder Elias! Nein, unmöglich! Pater Giovanni versuchte, diesen Gedanken zu verdrängen. Zunehmend wurde ihm die Tragweite dessen bewusst, was hier in den heiligen Gemäuern geschehen war. Was sollte er tun – den Prior informieren oder seine Mitbrüder zusammenrufen? Nur den Namen von Charles zu erwähnen, war eine höchst prekäre Angelegenheit. Man musste genau überlegen, mit wem man über ihn sprach. Und nun auch noch dieser Mord. Was in Kürze passieren würde, war nicht auszudenken. Die Carabinieri würden kommen, Staatsanwälte und wahrscheinlich Heerscharen von Journalisten würden Fragen stellen. Der Orden würde weltweit in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten. Und der Heilige Vater in Rom erst! »Mord im Kloster – Geistig verwirrter Mönch verschwunden – Ehemaliger Franziskanermönch erhängt an der Statue des heiligen Franz von Assisi gefunden«, so würden die Schlagzeilen in den Zeitungen lauten. Und die Carabinieri würden auf der Suche nach dem Mörder sicherlich auch Dinge wissen wollen, die sie eigentlich nichts angingen. Dinge, die schon lange zurücklagen und von denen im Orden nur hinter vorgehaltener Hand getuschelt wurde. Um den toten Charles rankten sich nämlich sehr mysteriöse Gerüchte. Der Einzige, der Einzelheiten wusste, war Bruder Elias. Und der war auf einmal verschwunden. Zu allem Überfluss lag diese Leiche im heiligsten Refugium, nur wenige Schritte entfernt von den Kammern der sechs hier lebenden Mönche. Vor vielen Jahren hatte Charles zu ihrer Gemeinschaft gehört, erst bei den Franziskanern in der Stadt, dann hier auf der Insel, in diesem Kloster. Damals hatte er Bruder Leo geheißen. Einige Leute sagten, er sei ein sehr kluger, wissbegieriger Mann gewesen. Aber auch ein Haderer und Zweifler, dem es an Respekt gegenüber dem Heiligen Vater in Rom gemangelt habe. Wie ein Besessener hatte er sich angeblich mit Dingen aus der Vergangenheit beschäftigt, um Antworten auf Fragen der Gegenwart zu finden. Gerüchten zufolge hatte Bruder Leo in der Klosterbibliothek Sensationelles über einen weltbekannten Mönch und Kartographen namens Fra Mauro entdeckt. Dieser hatte von einem honorigen Mitglied der Erzbruderschaft der Scuola Grande di San Rocco in Venedig wohl etwas erfahren, das die Ordensleitung der Franziskaner ihm weder erklären konnte noch wollte. Bis zum Heiligen Vater in Rom war Bruder Leo bei seiner Suche nach Antworten vorgedrungen. Es hatte etwas mit der Reise des heiligen Franziskus zu den Sarazenen in Ägypten und zu dem Sultan von Kairo zu tun gehabt. Doch der Papst höchstpersönlich, so munkelte man, habe Bruder Leo verboten gehabt, in dieser Sache weitere Nachforschungen anzustellen. Als aus unerklärlichen Gründen auch noch der Verdacht im Raum gestanden hatte, Bruder Leo habe die traditionelle Toleranz des Franziskanerordens für das weibliche Geschlecht missverstanden und, in verwerflicher Auslegung der Beziehung des heiligen Franziskus zur heiligen Klara, unkeuschen Gedanken angeblich verwerfliche Taten folgen lassen, sah sich die Ordensführung damals schließlich genötigt, ihm den Austritt nahezulegen. Bruder Leo hatte dann tatsächlich den Orden verlassen und unter dem bürgerlichen Namen Charles Bahri begonnen, seine Leidenschaft für alte Bücher zum Lebensinhalt zu machen. Das zumindest war die offizielle Version.
Pater Giovanni überlegte angestrengt. Alles, was er über Charles gehört hatte, wirkte seltsam, sogar der weltliche Nachname des einstigen Bruders. Bahri war ein ungewöhnlicher Name für einen ehemaligen französischen Mönch. In Ägypten gab es zwar einen weltberühmten Tempel ähnlichen Namens, jener der Königin Hatschepsut in Deir el Bahri, bei Theben. Aber warum sich der Bruder diesen ägyptischen Namen gegeben hatte, wusste niemand.
Vor einigen Jahren war Charles dann plötzlich wieder hier aufgetaucht. Es war nichts Ungewöhnliches, das sich weltliche Besucher im Kloster aufhielten. Seit die Franziskanergemeinschaft einige Zimmer für Nichtordensmitglieder auf der Suche nach spirituellen Erfahrungen zur Verfügung stellte, kamen manchmal gläubige Christen, die sich hier für einige Wochen einquartierten. So wie Charles. Er kam als Privatmann, um in der Abgeschiedenheit der Insel in sich zu kehren, damit er, wie er es Bruder Elias mal sehr kryptisch gesagt hatte, »… auf der Suche nach den Wahrheiten dieser Welt meinen wahren christlichen Glauben nicht gänzlich verliere«. Zu Bruder Elias hatte Bahri ein sehr inniges Verhältnis gehabt. Erst vorgestern war Charles aus dem Land angereist, aus dem auch der heilige Franziskus vor mehr als 800 Jahren gekommen war, als er auf der Insel angelegt hatte: aus Ägypten. Der alte Mann hatte bei seiner Ankunft einen sehr verstörten Eindruck gemacht. Schon am folgenden Tag war er mit einem großen Umschlag nach Venedig gefahren. Abends war er ohne diesen zurückgekehrt. Nun war er tot. Ermordet.
Peter Föllmer konnte nicht widerstehen. Er hatte das Dokument zwar schon dutzendmal gelesen, aber einzelne Passagen hatten sich derart in seinem Kopf festgesetzt, dass er an nichts anderes mehr denken konnte. Seit er vor drei Tagen das Fax seines Freundes mit der eigentümlichen Landkarte und diesen wundersamen Textseiten erhalten hatte, raubten ihm aufwühlende Gedanken den Schlaf. Nächtelang hatte er Bücher gewälzt und Unterlagen aus seiner Studienzeit durchgestöbert. Sonderlich erfolgreich war er nicht gewesen. Was da in Latein geschrieben stand, las sich wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Es war ein Sammelsurium fantastischer, mystischer und im wahrsten Sinne des Wortes unglaublicher Beschreibungen aus einer anderen Welt, ergänzt durch Skizzen von fabelhaften Lebewesen: Menschen, die einen Hundskopf hatten, Raubtiere mit Menschenköpfen, Giganten und Zyklopen. Und doch gab es darin auch Abschnitte, die von einem enormen geografischen wie auch historischen Wissen des unbekannten Verfassers zeugten. Wer immer auch dieses Pamphlet verfasst hatte, er war sicherlich kein orientalischer Geschichtenerzähler gewesen. Zudem gab es auffallend viele religiöse Bezüge. Peter war sich nicht sicher, wie der Text letztendlich einzustufen war: Waren es Fantasien, Hirngespinste und Wahnvorstellungen – willkürlich ergänzt durch vermeintliche Fakten? Auch aus welcher Zeit die Zeilen stammten, war nicht eindeutig zu belegen. Manche Textpassagen deuteten darauf hin, dass sie im zwölften Jahrhundert entstanden waren. Und: Wer war der Verfasser dieses in Briefform geschriebenen Werkes, wer der Empfänger gewesen? Um welches fantastische Land ging es da eigentlich?
Peter fand keine Antworten auf seine Fragen. Müde fuhr er sich durch seinen schwarzen Haarschopf und massierte kurz seinen Nacken. Warum hatte der alte Mann ihm nur Auszüge aus diesem Brief zukommen lassen? Ganz offensichtlich waren einzelne Passagen absichtlich weggelassen, andere sogar geschwärzt worden. Ließen die fehlenden Zeilen Rückschlüsse auf den Verfasser und den Empfänger zu? Er griff in seinen Rucksack, zog die Faxseiten hervor und überflog den geheimnisvollen Brief nochmals. Leise las er einzelne Auszüge vor sich hin:
»Man erzählte Unserer Majestät, dass Du Unsere Exzellenz in Liebe verehrst und die Kunde von Unserer Größe zu Dir gedrungen ist. Während Wir wissen, dass Wir Mensch sind, halten Dich die Graeculi für Gott. Wir hingegen wissen, dass Du sterblich bist und der menschlichen Hinfälligkeit unterliegst …
Unser Land erstreckt sich vom jenseitigen Indien, in dem der Körper des heiligen Apostels Thomas ruht, durch die Wüste und weiter bis zum Aufgang der Sonne und kehrt zurück durch den Untergang zum verlassenen Babylon neben dem Turm zu Babel …
An Gold und Silber und Edelsteinen, Elefanten, Dromedaren, Kamelen und Hunden haben Unsere Hoheit Überfluss … unter dem Übrigen, was sich wunderbarerweise in Unserem Land befindet, ist ein sandiges Meer ohne Wasser. Der Sand bewegt sich und schwillt zu Wellen an wie das Meer und ist niemals still. Drei Tagesreisen entfernt von diesem Meer liegen Berge, von denen ein Fluss von Edelsteinen herabfließt in derselben Weise ohne Wasser, und er fließt durch Unser Land bis zum sandigen Meer …
Jeden Monat bedienen Uns sieben Könige, ein jeder nach seiner Ordnung, 72 Herzöge, 365 Grafen an Unserem Tisch, ausgenommen jene, die zu verschiedenen Aufgaben an Unseren Hof abgeordnet sind. An Unserem Tisch speisen täglich nahe bei Uns auf der rechten Seite zwölf Erzbischöfe, auf der linken Seite 20 Bischöfe …
Wenn wir gegen Unsere Feinde in den Krieg ziehen, lassen Wir 13 große und sehr hohe Kreuze aus Gold und mit wertvollen Steinen in einzelnen Wagen anstelle von Fahnen vor Uns hertragen, und einem jeden von ihnen folgen 10 000 Soldaten und 100 000 bewaffnete Fußsoldaten, ausgenommen diejenigen, die dem Gepäck, den Wagen und dem Proviant des Heeres zugeordnet sind.
Wir haben gelobt, das Grab des Herrn zu besuchen mit einem mächtigen Heer, wie es dem Ruhm Unserer Majestät entspricht, die Feinde des Kreuzes Christi zu erniedrigen und zu bekriegen und seinen gepriesenen Namen zu verherrlichen.
Gegeben an den XV. Kal. Aprilis im Jahre LI Unserer Geburt. Zur Bestätigung: Alles, was oben gesagt worden ist, gleichwie unglaublich, dass dies wahr ist, hat ein Kardinal namens Stephanus mit Treu und Glauben versichert und allen offen verkündet.«
Peter atmete tief durch. Er wusste einfach nichts mit diesem Dokument anzufangen. Fraglos war darin die Rede von einem unvorstellbar mächtigen Christenreich, das sich verpflichtet gefühlt hatte, gegen die Feinde des Kreuzes Christi zu kämpfen. Damit konnten nur moslemischen Heere gemeint sein. Vielleicht war der Text zu Zeiten der Kreuzfahrer entstanden. Aber von welchem Christenreich war da die Rede? Die beigefügte Landkartenskizze schien zwar zu diesem Text zu gehören, irritierte ihn jedoch mehr, als dass sie Sinn stiftend wäre. Möglichweise hatte er etwas übersehen. Bevor er sich nochmals mit der Karte beschäftigen konnte, kündigte eine Stewardess die Landung in Hurghada an.
»Diese verfluchten Terroristen! Allah möge sie dafür strafen«, lamentierte der Fahrer nach der sechsten Straßensperre und glaubte erklären zu müssen: »Ägypten, Sir, ist ein wunderbares, ein sehr friedliches Land! Aber einige wenige islamische Extremisten aus anderen arabischen Ländern missachten Allahs Wille nach Friede unter den Menschen.«
Der Taxifahrer schaute in den Rückspiegel, weil er eine Reaktion seines Fahrgastes erwartete. Doch der breitschultrige Mann mit den schwarzen Haaren und dem kantigen Gesicht wirkte eher desinteressiert und schien zudem müde zu sein. Peter schaute auf die Uhr. Es war bereits kurz nach fünf. Vor einer Stunde war die Maschine gelandet. Er hoffte, noch vor Einbruch der Dunkelheit anzukommen. Für die Fahrt vom Flughafen Hurghada entlang der Küste zu dem nördlich gelegenen kleinen Haus in der Bucht über dem Yachthafen von Abu Tig brauchte der Taxifahrer diesmal ungewöhnlich lange. Fast an jeder größeren Kreuzung gab es eine Straßensperre der Polizei oder der Armee. Misstrauen und Angst standen in den Gesichtern der Polizisten geschrieben, die da nach Ausweis, Herkunft, Ziel und Grund des Aufenthaltes fragten und dabei ihre Zeigefinger beunruhigend dicht am Abzug ihrer Maschinenpistolen hielten. Nach gut einer Stunde hielt das Taxi schließlich an jenem Schotterweg, der zu dem Haus mit dem herrlichen Blick über die Bucht hinunterführte.
Peter wischte sich den Schweiß von der Stirn. Es war unerträglich heiß. Sein Hemd klebte am Körper. Er war nervös. In wenigen Minuten würde er hoffentlich wissen, worum es bei diesem geheimnisvollen Dokument und der Landkarte ging. Er klingelte mehrmals an der Haustür. Niemand öffnete.
»Hallo! Bonjour! Anybody at home?«
Niemand schien ihn zu hören. Langsam drückte er die Türklinke herunter. Die Haustür war nicht verschlossen. Sein Puls fing an, schneller zu schlagen.
Der Hieb traf ihn am Hinterkopf in dem Augenblick, in dem er in den Flur trat. Es war ein dumpfer Schlag, den ihm jemand, der hinter der Tür gelauert haben musste, versetzte. Peter stieß ein mehr überraschtes als schmerzerfülltes Stöhnen aus. Im Fallen sah er, wie sich die Sonnenreflexe in den Fluten des Roten Meers in Millionen tanzende Irrlichter verwandelten. Dann schlug er bewusstlos auf dem Boden auf.
Als er die Augen wieder öffnete, nahm er schemenhaft einen Mann in einem weiten Gewand wahr, der neben ihm kniete. Der Fremde war dunkelbraun, fast schwarz. Auf seiner Stirn befand sich ein seltsames Zeichen. Die Mündung der Pistole war auf seine Schläfe gerichtet: »Give it to me! Donnez-moi le papier!«, zischte der Mann und spannte mit dem Daumen den Hahn. Das mechanische Geräusch hallte Furcht erregend laut durch den Flur wider. Trotz seiner Benommenheit ahnte Peter, was der Araber wollte. Plötzlich drangen arabische Wortfetzen aus dem Mund einer Frau zu ihm durch. Er wartete auf den Schuss, der sein Leben beenden würde, ohne zu erfahren, warum. Stattdessen richtete sich der Fremde abrupt auf, presste einige wütende arabische Worte hervor und hetzte auf nackten Fußsohlen über den Steinboden in Richtung der Terrasse. Mit einem athletischen Sprung verschwand er über die Mauer.
Wenige Stunden später saß Peter abermals im Flugzeug. Das Umbuchen des Tickets von Hurghada über Kairo nach München hatte ihn ein kleines Vermögen gekostet. Wenn die Maschine pünktlich in München landete, hätte er eine realistische Chance, den Anschlussflug nach Venedig noch zu erwischen. Sein Kopf dröhnte mit dem Aufheulen der Flugzeugturbinen beim Start. Durch das Fenster sah er die Flughafengebäude, die wie überdimensionale Zelte wirkten, kleiner werden. Erst als das Flugzeug in einen ruhigen Gleitflug überging, löste er sich aus seiner verkrampften Sitzhaltung. Nur mühsam gelang es ihm, seine Gedanken zu ordnen. Die Geschehnisse der letzten Tage hatten sein eher langweiliges berufliches Dasein als Geograf bei einer Firma, die Navigationssysteme für Autos entwickelte, auf den Kopf gestellt. Bei der Landkarte und dem sagenhaften Brief hatte er eine Sensation gewittert. Und beinahe wäre er auch noch umgebracht worden! Der Mann, der ihm die Pistole an die Schläfe gepresst hatte, war fraglos hinter genau diesen Dokumenten her gewesen. Wäre die alte Fatima nicht zufälligerweise vorbeigekommen, wer weiß, ob der Araber ihn nicht erschossen und die Unterlagen geraubt hätte. Ein Zufall hatte ihm das Leben gerettet. Schließlich hatte ihm die Putzfrau eine Nachricht seines Freundes überreicht. Der alte Mann hatte eine nur schwer zu entziffernde Handschrift. Aber es war seine Handschrift. Peter kannte sie von den vielen Notizzetteln und Randnotizen, die er während der zurückliegenden Jahre immer wieder in den Büchern im Haus seines Freundes in Kairo gefunden hatte. Dass, der Alte immer nur in Französisch schrieb, erschwerte ihm das Entziffern.
Erneut überflog Peter die krakelige Schrift: »Mein Freund, ich musste leider überstürzt abreisen, wollte mich nicht der Gefahr aussetzen, auf dich zu warten. Warnen konnte ich dich leider auch nicht. Fatima wird dir diese Nachricht geben. Die Welt des Bösen hat wieder einmal Einzug in mein Leben gehalten. Der Allmächtige hat mir die kaum zu ertragende Bürde auferlegt, Dinge zu sehen, die andere nicht sehen können oder wollen, und Dinge zu verstehen, die andere nicht verstehen können – oder dürfen. Alles ist plötzlich anders. Nichts hat mehr Bestand! Das Gute wandelt sich zum Bösen, aus oben wird unten, aus Süden wird Norden und aus Osten Westen. Und eins steht fest: Der maurische Bruder hat es schon damals gewusst! Auch die Geschichte mit Johannes wusste er! Mein verehrter Freund, ich brauche deine Hilfe. Dringend! Du findest mich bei Francois, du weißt schon, der Mann, der einst aus der Wüste kam! Den Weg dorthin wird dir mein Freund vor der Tür des Heiligen aus Montpellier beschreiben. Du erinnerst dich: jener, der hört, was andere sehen. Er weiß, wo ich mich aufhalte. Ihm kannst du trauen. Frage ihn nach dem Libretto einer Oper von Jakob Meyer. Aber sei vorsichtig! Die Gier der Gläubigen nach Macht und der Ungläubigen Habgier haben einst schon die Getreuen des IDA und der gottesfürchtigen Eleni ins Verderben geführt. Die gleiche Gier und dieselben Lügen haben nun mein Leben erfasst.«
Peter dachte angestrengt nach. Was war mit IDA gemeint? Und wer verbarg sich hinter der gottesfürchtigen Eleni? Beide Namen hatte er noch nie gehört. So wenig Sinn diese kryptischen Formulierungen ergaben, so sicher war er sich zumindest, wo er den alten Mann finden würde. Es gab nur einen Ort, der infrage kam.
Das Flugzeug änderte seine Flugrichtung und glitt in einer langen Linkskurve dem Mond entgegen. Vorsichtig kramte Peter aus seiner Aktentasche nochmals das Fax hervor, das er vor drei Tagen erhalten hatte. Sein Interesse galt der handschriftlichen Nachbildung der seltsamen Landkarte, auf der unter geografischen Aspekten nichts zu stimmen schien. Drei Tage hatte er gebraucht, um wenigstens zu erahnen, welcher Tricks sich der Verfasser der Karte bedient hatte, um den Betrachter in die Irre zu führen. Aus welchen Gründen auch immer. Viele Details der Karte, die aus einem alten Buch stammen musste, ließen einerseits den Schluss zu, dass sie zwischen dem 14. und dem 15. Jahrhundert entstanden war. Andererseits waren darauf aber auch Ortsnamen in Lateinisch sowie Fluss- und Landschaftsnamen in Portugiesisch eingetragen, die überhaupt nicht dem geografischen Wissen dieser beiden Jahrhunderte entsprachen. Was ihn noch mehr irritierte: Da waren geografische Termini vermerkt, die aus einer Kombination ägyptischer Hieroglyphen mit einer ihm völlig fremden Schrift zu bestehen schienen. Im Westen der Karte stand »Meer der Finsternis« geschrieben. Von einem solchen Meer hatte er noch nie gehört. Alles an dieser Karte war widersprüchlich. Mit viel Fantasie ließ sich erahnen, dass da der afrikanische Kontinent grob skizziert worden war, allerdings auf dem Kopf stehend. Zwischen den Kontinenten waren Landmassen umrissen, die es nicht wirklich gab. Hätte er in seinem Geografiestudium nicht gelernt, dass sich die Kartografie über Jahrtausende mit dem sich wandelnden Erdbild der Menschheit permanent verändert hatte, er wäre zu dem Schluss gekommen, diese Karte sei ein Fantasieprodukt.
Peter starrte aus dem Flugzeugfenster. Unter ihm tauchte im Mondlicht ein mattsilberner Streifen auf. Der Nil! Fluss aller Flüsse, heilige und mystische Aorta der Pharaonenreiche. In wenigen Minuten würden sie in Kairo zwischenlanden. Niemand konnte sagen, ob dort unten, in diesem Moloch beidseitig des Nils und nahe der Pyramiden, zehn, 15 oder gar 20 Millionen Menschen lebten. Er liebte diese Stadt, die in Abgasen, Blechlawinen und Menschenmassen erstickte. Er mochte dieses Konglomerat aus jahrtausendealten Kunstschätzen, Slums und betonierten Neubausiedlungen.
In Kairo hatte er im fünften Semester seines Studiums ein halbjähriges Praktikum gemacht, um Arabisch zu lernen. Schon während der ersten Semester hatte er erkannt, dass viele offene Fragen der Entdeckungsgeschichte der Welt sich klären lassen würden, wenn es möglich wäre, sich arabischer Quellen zu bedienen. An europäischen Universitäten wurden die Kenntnisse der Araber oftmals ignoriert, die wissenschaftliche Aussagekraft angezweifelt. Dieser über Jahrhunderte währende Dünkel des Abendlandes hatte ein Weltbild kreiert, das vornehmlich von den moral-ethischen Dogmen der christlichen Kirchen und von einem manchmal geradezu absurden Irrglauben geprägt war. Der Fall des italienischen Astronomen Galileo Galilei war eines der berühmtesten Beispiele dafür, wie freigeistigen Denkern im Mittelalter von der Kirche Maulschellen verpasst worden waren. Unter Androhung der Todesstrafe war ihnen von der Inquisition verboten worden, Wahrheiten oder Vermutungen zu äußern, die den Lehren der Kirche nicht entsprachen. Beispiele dafür gab es viele. Während in Rom im 13. Jahrhundert noch immer gelehrt wurde, dass die Welt eine Scheibe sei, an deren Rand man herunterfallen und ins Verderbnis der Hölle stürzen würde, hatten arabische Forschungsreisende wie Ibn Batuta längst bestätigt, was die Griechen Posidonius wie auch Serapion von Antiochia schon vor Christi Geburt festgehalten hatten: dass nämlich die Erde eine Kugel ist. Und dieses Wissen war keineswegs als Geheimnis gehütet worden. Kreuzritter, unter ihnen viele Templer, hatten es mit nach Europa gebracht. Aber dumpfe Ergebenheit gegenüber dem Papst hatte die Ritter davon abgehalten, den Lehren der Kirchenoberen zu widersprechen.
Auch die für das Reisen über das Meer so hilfreichen Kamal und Issabah hatten Araber erfunden. Beides waren faktisch die Vorgänger des Quadranten, ohne den europäische Seefahrer die Welt nicht hätten erkunden können. Von christlichen Dogmen deformierte Wahrheiten, das hatte Peter im Studium schnell gelernt, waren über Jahrhunderte schier unüberwindbare Stolpersteine für europäische Gelehrte und Reisende geworden. So gesehen, hatte sich das Abendland lange Zeit in einem dunklen Loch der Unwissenheit befunden.
In den Archiven einst so berühmter Universitäten wie in Damaskus, Kairo, Bagdad und Konstantinopel schlummerte ein fantastisches Potenzial an Wissen, weshalb er in Kairo Arabisch hatte lernen wollen. Und in dieser Stadt hatte er damals Charles kennengelernt.
Gleich in der ersten Woche hatte er das Büro der Air France am Talaat-Harb-Platz wegen eines Ticketproblems aufsuchen müssen und war danach zu einem nahegelegenen Café in der Sharia-Qasr-el-Nil-Straße geschlendert. Dort hatte er auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Schaufenster entdeckt, über dem kaum lesbar L’Orientaliste geschrieben stand. Die Auslage mit den vielen Büchern hatte ihn neugierig gemacht. Und tatsächlich: Hinter der Fassade des ziemlich heruntergekommenen Hauses aus der Kolonialzeit hatte sich ein Garten Eden für Liebhaber seltener Bücher und antiker Landkarten verborgen. Über mehrere Etagen verteilt hatten sich dort Berge antiquarischer Raritäten getürmt: seltene Werke aus Afrika und dem gesamten Orient; wunderbare, handkolorierte Kupferstiche und ganze Schubladen voller Stahlstiche in bester Qualität. Der Bewohner dieser Schatzkiste war zu beneiden. Und genau das hatte Peter dem Eigentümer, einem ziemlich kauzigen alten Mann namens Charles Bahri, gesagt. Auf dieses erste Gespräch an jenem Tag waren schnell weitere gefolgt. Bald hatte er erfahren, wie der alte Mann zu diesen Schätzen gekommen war. Als Ägypten im Jahre 1922 unabhängig wurde, verließen Heerscharen der einstigen englischen und französischen Kolonialherren das Land. Viele von ihnen hatten wertvolle Kulturgüter zusammengetragen. Ihre Villen quollen über an Kunstschätzen und antiquarischen Büchern. Aber die junge ägyptische Regierung erlaubte den Besitzern nur jene Dinge mitzunehmen, die nach ihrem Dafürhalten nicht als ägyptisches Nationaleigentum zu betrachten waren. Statt ihr Hab und Gut für geradezu lächerliche Entschädigungssummen dem Staat zu überlassen, schenkten sie Bücher, Bilder und archäologische Funde dem allerorts als fanatischer Sammler bekannten Charles Bahri für wissenschaftliche Arbeiten. Damit avancierte Charles binnen weniger Jahre zum Besitzer eines Schatzes, den ihm die ägyptische Regierung und gierige Kunsthändler schon bald abspenstig machen sollten. Mit allen Mitteln.
Während unter ihm Hurghada aus seinem Blickfeld verschwand, erinnerte sich Peter wehmütig an die ersten Zusammentreffen mit Charles. Es war der Beginn einer Freundschaft zweier Männer, die zwei Dinge gemein hatten: die Liebe zu Afrika und die Leidenschaft für alte Bücher und alte Landkarten. Peter begeisterte sich für diese Dinge seit Beginn des Studiums. Längst hatte er sein Fachwissen so vertieft, dass er über das Internet mit seltenen Karten und Büchern handelte und dabei schon so manch gutes Geschäft gemacht hatte. Erst vor wenigen Monaten war es ihm gelungen, einem Sammler zwei Hemisphärenkarten von Henricus Hondius aus dem 17. Jahrhundert zu vermitteln. Pro Blatt der handkolorierten Kupferdrucke hatte der Sammler aus Kanada 2000 Euro gezahlt, womit Peter nach Abzug aller Kosten einen Gewinn von mehr als 1500 Euro gemacht hatte. Mit den Erlösen solcher Vermittlungsgeschäfte und seinem Verdienst bei der Firma für Navigationssysteme finanzierte er seine Reisen nach Afrika. Denn das war seine andere große Leidenschaft: die Wüsten Afrikas!
Alle zwei Jahre brach er mit seinem Landrover von München aus auf zu Off-Road-Touren durch die Sahara. Er liebte die Wüste, war sehr oft in der Sahara in Südmarokko, Tunesien und in Libyen gewesen. Zwei Mal war er auf der Tamanraset-Route durch Algerien nach Niger und Mali gefahren. Er liebte die Weite unberührter Landschaften Nordafrikas, suchte das Abenteuer, die Herausforderung, liebte Unbekanntes und tastete sich mit jeder Tour an seine eigenen wie auch an die technischen Grenzen seines Geländewagens heran. In der Wüste durfte und konnte er sein, wer er war – oder sein wollte.
Ansonsten waren der alte Mann in Kairo und er so verschieden, wie zwei Menschen nur sein konnten. Der eine war fast 80 Jahre alt, Peter hingegen hätte mit seinen 45 Jahren sein Enkel sein können; der Alte war strenggläubig, ein nicht unkritischer, aber letztendlich überzeugter Christ, während er selbst der institutionellen Kirche gegenüber sehr skeptisch eingestellt war. Er war ungeduldig, wissbegierig und sehr pragmatisch veranlagt, während Charles meinte, er hetze nicht mehr der Zeit und anderen vergänglichen Dingen hinterher.
Im Laufe der Jahre entwickelte sich zwischen ihnen eine tiefe Verbundenheit. Sie schrieben sich Briefe, tauschten ihr Wissen über alte Bücher und Landkarten aus, gaben sich Tipps, schafften es allerdings nur selten, sich zu treffen. Und wenn, dann meistens in Kairo, in Charles’ Ferienhaus am Roten Meer, wo der Alte ihm bei einem Glas Wein einmal offenbart hatte: »Weißt du, mein Sohn, wenn ich noch ein wenig jünger wäre, würde ich dir eine sehr ungewöhnliche Sahararoute zeigen. Eine, auf der schon seit Jahrhunderten niemand mehr Afrika durchquert hat. Du wärst der Richtige für diese außergewöhnliche Reise! Es wäre eine Expedition, die der Wahrheit sehr dienlich wäre. Ich weiß allerdings auch, dass es Menschen gibt, die diese Wahrheit nicht sonderlich mögen würden. Wahrheiten brauchen ihre Zeit. Aber nicht jede Zeit ist gut für Wahrheiten.«
Was der alte Mann damals damit gemeint hatte, begann Peter allmählich zu ahnen. Charles hütete offensichtlich ein Geheimnis. Die mysteriösen Textseiten sowie die Landkarte ließen darauf schließen, dass er ein Buch besaß, das aus irgendwelchen Gründen so brisant war, dass der Alte sogar fliehen musste. Scheinbar wurde er von sehr habgierigen und extrem rücksichtslosen Menschen verfolgt. Kriminelle, die auch bereit waren, zu töten. Peter fragte sich, woher diese Leute gewusst hatten, dass er zum Haus am Roten Meer fahren würde. War sein letztes Telefonat kurz vor dem Abflug nach Hurghada abgehört worden?
Er schaute auf die Uhr. Nach dem Umsteigen in Kairo würde es noch dreieinhalb Stunden bis nach München dauern. Yvonne, seine Freundin, würde ihn am Flughafen abholen. Zusammen mit ihr würde er dann hoffentlich eine Stunde später gleich weiterfliegen. Und mit etwas Glück würde er den alten Mann dann bald treffen. Er ahnte, wo er sich versteckte. Wie hatte er geschrieben? »Tu sais déjà, mon ami, l’homme, qui venait du désert.«
Kapitel 2
Commissario Toscanelli war wütend. Er litt unter dem Spott seiner Kollegen, die in der Kajüte des kleinen Motorbootes standen und sich vor Lachen schüttelten. Aber er hatte nicht die Kraft, sich zu wehren. Mit aschfahlem Gesicht hing er über der Reling und übergab sich. Und das schon seit einer halben Stunde. Er fühlte sich so elend, dass er sich wieder einmal schwor, sich versetzen zu lassen. Seit sechs Monaten ging das schon so. Seit er aus seiner Heimatstadt Mailand hierher versetzt worden war, kämpfte er mit dieser elenden Übelkeit, die ihn schon überkam, wenn er auch nur ein Boot betrat. Und das musste er eigentlich jeden Tag. Denn Dienst in Venedig hieß Dienst auf dem Wasser. Selbst in seiner Freizeit kam er an dem ihm längst verhassten Meer und den Booten nicht vorbei. In der Lagunenstadt führten alle Wege übers Wasser: Kanäle, Buchten, selbst das offene Meer gehörte zu seinem Dienstbereich.
Als Leiter des Kommissariats für Kapitalverbrechen hatte ihm seine Neigung, sich übergeben zu müssen, mittlerweile den wenig schmeichelhaften und in mancherlei Hinsicht zweideutigen Beinamen »der Großkotzige« eingebracht. Ein Spottname, den inzwischen jeder Carabinieri in Venedig kannte und bedauerlicherweise auch einige Leute der Unterwelt. Es war ihm durchaus bewusst, dass einige seiner Kollegen mit diesem Namen nicht nur seine Seekrankheit meinten. Sie hatten nicht gerade ein Faible für Beamten aus anderen Regionen Italiens. Dabei machte es ihm nichts aus, dass sie ihn nicht mochten, weil er kein Venezianer war. Auch nicht, dass er wegen seiner perfekten Laufbahn und des für seine gerade mal 38 Jahre auffällig hohen Dienstranges permanent von Neidern aufgezogen wurde. Er selbst wiederum empfand die Venezianer als sehr arrogant.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!