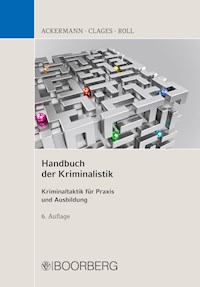5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Der unbändige Traum von Afrika: „Das Leuchten der Savanne“ von Rolf Ackermann jetzt als eBook bei dotbooks. Ein Leben im wilden und wunderschönen Herzen Afrikas – davon schwärmt Margarete seit frühester Kindheit. Und tatsächlich, mit einer Farm am Fuße des Kilimandscharo verwirklicht sie gemeinsam mit ihrem Mann Ulrich diesen Traum. Tansania erwartet sie in all seiner Schönheit, Weite und voller Abenteuer! Während Margarete sich schnell in ihre neue Heimat verliebt, bleibt das Leben in der Savanne ihrem spröden Ehemann fremd. Erst in dem attraktiven Griechen Anthimos findet sie jemanden, der all ihre Leidenschaften von Herzen teilt … Doch als der Erste Weltkrieg auch über Afrika hereinbricht, muss Margarete mit allen Mitteln kämpfen, um ihr Glück zu bewahren! Die wahre Geschichte der deutschen Afrikanerin Margarete Trappe – ein Roman wie eine Safari: wild und unbändig, dabei von erhebender Schönheit. Jetzt als eBook kaufen und genießen: mit „Das Leuchten der Savanne“ von Rolf Ackermann auf den Spuren der deutschen Kolonialgeschichte. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Ähnliche
Über dieses Buch
Am Fuße des Kilimandscharo fühlt sich die preußische Kolonialistenfrau zum ersten Mal wirklich geborgen. Ihre Liebe entbrennt für einen kernigen Griechen, noch stärker jedoch für die Savanne. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, gerät ihr Paradies in höchste Gefahr und Margarete muss kämpfen, damit ihre beiden großen Leidenschaften die Wirren der Zeit überdauern.
Ein Roman wie eine Safari: wild und unbändig, dabei von erhebender Schönheit.
Über den Autor
Rolf Ackermann, geboren 1952 in Duisburg, ist ehemaliger Beamter eines deutschen Nachrichtendienstes, Journalist und Autor zahlreicher Sachbücher und Romane. Seine langjährigen Aufenthalte und Recherchen in Ostafrika inspirierten ihn zu »Weiße Jägerin«. Zudem begleitete er auch die ZDF-Filmproduktion »Momella – eine Farm in Afrika« über Margarete Trappes Leben in beratender Funktion. Rolf Ackermann lebt derzeit in Namibia, wo er exklusive Safaritouren veranstaltet.
Die Website des Autors: www.rolf-ackermann-namibia.over-blog.de
***
Neuausgabe Juli 2012
Dieses Buch erschien bereits 2006 bei Knaur Taschenbuch
Copyright © der Originalausgabe 2005 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München.
Copyright © der Neuausgabe 2012 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nicola Bernhart Feines Grafikdesign, München
Titelbildabbildung: © Alex Stokes – Fotolia.com
978-3-943835-30-4
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Weiße Jägerin an: [email protected]
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
Rolf Ackermann
Weiße Jägerin
1. Kapitel
»Wenn Elefanten kämpfen,
leidet das Gras unter ihnen …«
Julius Nyerere (ehem. tansanischer Staatspräsident)
Die letzten Sonnenstrahlen ließen den Oldoinyo le Engai in wundersamer, erhabener Schönheit erstrahlen und kolorierten Ostafrikas Steppen in den Pastellfarben Caspar David Friedrichs. Das Land war weit und schön und wunderbar friedlich. Die sanften goldgelben Grashügel kokettierten mit langen Schatten. Weit
ausladende Akazienbäume streckten ihre fingerlangen weißen Dornen der untergehenden Sonne entgegen; kleine Bäche schlängelten sich, matt glänzenden Nattern mit blauen Rückenstreifen gleich, durch die Weiten; Berge mit magischen Namen umringten die Ebenen; die Luft war erfüllt vom schweren, süßlichen Duft der Leleshwa-Blätter. Aus den nahen Galeriewäldern des Flusses hallte das dumpfe Echo dahinstampfender Elefanten zu den Hütten; Hunderte, Tausende, nein, Hunderttausende Zebras, Gnus und Antilopen verharrten in erwartungsvoller Anspannung am Flussufer.
Wie ein von mächtiger Hand geformter Naturaltar ragte der vom Volk der Massai als »Berg Gottes« verehrte Vulkan Oldoinyo le Engai in den Abendhimmel. Am Horizont türmten sich mächtige Kumuluswolken wie Berge aus Licht und Schatten zu einem herannahenden Gewitter auf. Als wolle Engai, der Gott der Massai, auf die makellose Schönheit seines Werkes hinweisen, kreierte er am Firmament zaghaft das Kreuz des Südens und ließ einen weiß glühenden Kugelblitz über das Land hin zu seinem Berg rollen. Der trockene Knall des ihn begleitenden Donners hallte an den Hängen des Vulkans wider. Die Natur duckte sich erschrocken. Alle Tiere erstarrten in Ehrfurcht. Die Kinder unter der inmitten der schier unendlichen Massaisteppe stehenden Schirmakazie rückten zusammen und starrten mit angsterfüllten Augen auf den alten Mann, der ihnen gegenüber mit dem Rücken zum Baum saß.
»Das sind die Zeichens Engais, unseres Gottes«, sprach Masiani ole Chieni. Der Alte mit dem kahlgeschorenen Schädel und dem starren Cape aus dem buschigen, braunen Fell des Baumschliefers blickte Ansehen heischend in die Runde der auf dem Boden sitzenden Kinder, die sich nicht trauten, dem alten Mann in die Augen zu schauen. Denn ihr Laibon, der meistgeachtete, meistgefürchtete Älteste, hatte schon seit Geburt nur ein Auge, dessen starrer Blick nicht nur Kinder ängstigte.
»Einst, so haben es uns die Urahnen unseres Volkes unseren Großvätern und Vätern schon erzählt, nannte Engai drei Söhne sein Eigen. Jeden der drei Söhne bedachte er mit einem Geschenk: Der erste Sohn erhielt einen Speer, um seinen Lebensunterhalt als Jäger zu bestreiten; der zweite eine Hacke, um das Land zu bearbeiten; und der dritte einen Stock zum Hüten des Viehs. Dieser dritte Sohn, Natero Kop genannt, gilt als der Urvater der Massai, die seit jener Zeit stolze Besitzer großer Viehherden sind und im Schutze des Berges Lengai unzählige Sonnenaufgänge und feurige Abenddämmerungen erlebt haben und ihre Rinder hüten, die in den endlosen Savannen grasen. Einem Storch gleich manchmal auf einem Bein stehend, wacht der Hirte über das, was Engai ihm gegeben hat. Und …«
Die beschauliche Zusammenkunft unter dem Baum wurde plötzlich unterbrochen von einem Schrei aus der nahe gelegenen Manyatta. Es war ein Schrei, der den Tod in sich trug: gellend, schmerzerfüllt, nur kurz und doch grausam.
Die Kinder starrten zu den Hütten der nächstliegenden Manyatta. Jeder im Dorf wusste, dass Nasira, die jüngste Frau der sieben Frauen des Kriegers Mojo ole Chieni, ein Kind erwartete. Hastig sprangen die Kinder auf und rasten los.
Masiani ole Chieni war der Älteste des Stammes und ob seines Alters und der damit einhergehenden Weisheit zum Laibon, aber auch zum Propheten, geistigen Führer, Wahrsager, Ritualexperten und Heilkundigen des Stammes auserwählt. Trotz des Schreis verharrte er regungslos unter der Akazie. Nasira, die Frau, die soeben geschrien hatte, war seine Schwiegertochter, Ehefrau seines Sohnes Mojo. Und doch blieb der Alte sitzen, schenkte der hörbaren Aufregung keinerlei Aufmerksamkeit. Mit seinem einzigen Auge fixierte er stattdessen einen fernen Punkt am Himmel, wo sich die Wolken unheilvoll zu einem Unwetter zusammenzogen. Sein Auge glänzte eigentümlich. »Es ist Olasera ingumok, der Farbenreiche, der dort in der Ferne zu mir spricht«, murmelte der Greis, verbeugte sich ehrfurchtsvoll vor dem, was er dort am Firmament in einer sonderbaren Wolken- und Farbkonstellation zu sehen glaubte, und sprach in die Ferne: »Engai tajapaki tooinaipuko inono – Gott, nimm mich unter deine Obhut!« Dann stand er schwerfällig auf und ging zu den Hütten. Mojo, sein Sohn, kam ihm auf halbem Wege entgegen.
»Vater, Nasira, die schönste und ehrfurchtsvollste meiner sieben Frauen, hat mir einen Sohn geboren, bevor sie den friedlichen Weg zu Engai beschritt.«
»Ich weiß, mein Sohn. Ich weiß! Der Farbenreiche hat zu mir gesprochen. Er zeigte sich soeben am Himmel in einem dahingehauchten Zartrosa, gleich dem eines jungen Flamingos, und ließ einen Weißkopfadler aus dem Himmel her niedersausen, um uns eine Nachricht zu überbringen. Geh, Mojo, und rufe die Ältesten zusammen. Auch du, der nach mir als Laibon die Menschen unseres Stammes mit Weisheit und Rat begleiten wirst, komme zu uns. Wir müssen eine Engidong halten. Denn Engai hat uns Zeichen gesandt, die wir mit unserem Verstand, der so klein ist wie der einer Siafu-Ameise, nicht verstehen und daher deuten müssen.«
Eine halbe Stunde später trafen sich die ältesten Männer des Massaistammes auf einem Hügel nahe dem Fluss. Das Kreuz des Südens stand sehr klar und scheinbar zum Greifen nah über den ostafrikanischen Weiten. Der Mond versteckte sich ängstlich hinter einer furchterregend großen Regenwolke über dem Berg Oldoinyo le Engai. Myriaden von Sternen erhellten die Nacht. Irgendwo ganz in der Nähe tat ein Löwe seinen Unmut über das hoch lodernde Feuer, um das herum sich die Massai zusammengesetzt hatten, durch ein dumpf-bronchiales Grollen kund. Starke Windböen zerrten an den togaähnlichen, ockerfarbenen Umhängen der Männer.
»Dieser Sturm trägt das Böse in seinem Bauch«, orakelte einer der Ältesten und resümierte: »Der Wind ist in Aufruhr, die Wolken des Himmels verzerren sich zu Fratzen, und die Tiere unten am Fluss in den Ebenen blöken und brüllen seit einer halben Stunde so laut und ängstlich, wie sie es zu tun pflegen, bevor sie sich sammeln, um auf die Große Wanderung zu den saftigen Weiden im Norden des Landes zu gehen. Aber es ist noch nicht die Zeit gekommen, dass sie davonziehen. Und daher weiß ich, dass Großes, vielleicht Gutes, vielleicht auch Unheilvolles geschehen wird. Lasst uns eine Engidong durchführen, auf dass uns Mbatian und Nelion, unsere großen Ahnen, den Geist geben, ihre Prophezeiung zu verstehen.« Die Männer rollten eine trockene Kuhhaut auf dem Boden aus und kramten aus kleinen Ledertäschchen mehrere farbenprächtige, daumengroße, von der Zeit glattgeschliffene Flusssteine hervor. Der Laibon Masiani ole Chieni murmelte mystische Worte vor sich hin, als er die Steine wieder und wieder über die Kuhhaut rollte, sie zählte, ihre Farbnuancen interpretierte und sie schließlich nach mehr als einer Stunde in einer ihm bedeutungsvoll erscheinenden Konstellation liegen ließ, um seine Prophezeiung zu machen. Die anderen Männer schauten ihn erwartungsvoll an. Angst, aber auch grenzenlose Hochachtung lag in ihren Blicken, als der einäugige Alte zu sprechen begann: »Der heutige Tod von Nasira, der Frau meines Sohnes Mojo, und das aus ihrem Tode zu Leben erwachte Kind werden einen neuen Laibon für den Stamm der Matapato-Massai hervorbringen.«
»So soll es sein«, kommentierten die Männer die Worte des Alten einstimmig.
»Doch ich sehe auch einen furchterregenden weißen Schatten über das Land und über das Volk der Massai huschen, mit Augen aus Glas und mit seidigem, dunklem Haar. Der Schatten wird diesen unseren neugeborenen Laibon auf immer und ewig begleiten, so wie der Tag der Nacht für immer folgt, und in einer Sprache zu ihm sprechen, deren Worte mir fremd klingen!«
»So soll es sein!«, murmelten die Männer erneut.
»Aber die Angst wohnt fortan in meinem alten Herzen! Denn ich sehe auch eine riesige, eiserne Schlange, deren schwarze Zunge Feuer und Rauch speit und die Schmerz, Not und Unfrieden über die Ebenen, Hügel und Berge, über das Rinder züchtende Volk der Massai, aber auch über die niedrigen, den Boden bestellenden Völker im Norden und Süden dieses Landes bringen wird.«
Wieder grummelten die Männer am Feuer ihr »So soll es sein« in die Nacht. Ihre Worte waren von Entsetzen bestimmt. Die Prophezeiung ihres Laibon erfüllte sie mit Angst. Sie wussten nicht, was diese Prophezeiung bedeutete, aber sie spürten, dass es nichts Gutes für die Zukunft ihres Volkes heraufbeschwor.
Plötzlich zerfurchten taghelle Blitze die Nacht. Donnergrollen rollte zwischen den Hügeln und Bergen hin und her und erfüllte die Ebenen mit ohrenbetäubendem Lärm. Und dann, ausgelöst durch eine mächtige Windböe, geschah es: Überall auf den Grasebenen unten am Fluss erhoben sich die dort seit Tagen lagernden Tiere. Hunderttausende Weißbartgnus und ebenso viele Zebras und Antilopen blökten ihre Furcht vor dieser Nacht, vor dem tosenden Gewitter und den Blitzstakkatos über das Land. Die Erde begann zu beben, Staubwolken verhüllten die Sterne, und Afrika erzitterte, als die riesigen Herden um Mitternacht plötzlich losrasten, obwohl sie nicht wussten, wohin sie in der Dunkelheit rennen sollten, und wieder abrupt stehen blieben und dann doch wieder panisch losgaloppierten und Angst vor der Nacht und vor den Raubtieren hatten und daher noch schneller über die Steppe hetzten.
»Die große Wanderung der Tiere hat begonnen«, schrie einer der Massaiältesten in den Sturm. Masiani ole Chieni, ihr Laibon, blieb neben einem Felsen stehen und starrte hinaus in die Nacht zu den in alle Himmelsrichtungen dahinrennenden Tieren. Er konnte nichts erkennen, alles nur hören. Aber er ahnte, was er sehen würde. »Nein«, brüllte er in den Wind. »Sie wandern nicht. Sie fliehen! Sie verlassen dieses Land, weil sie spüren, dass Unheilvolles geschehen wird …«
2. Kapitel
»Wer Allah verleugnet, obwohl er früher an ihn geglaubt hat,
es sei denn gezwungen, indes das Herz noch fest im Glauben ist, wer also freiwillig sich zum Unglauben bekennt, den trifft
der Zorn Allahs und seiner wartet peinvolle Strafe …, weil Allah ungläubige Menschen nicht leitet …« (Koran, Sure 16, 106/108)
Die zierliche Frau mit den durch bunte Glasperlen kunstvoll zu Zöpfen geflochtenen Haaren saß gegen Mitternacht vor dem Schreibtisch und blickte prüfend auf den vor ihr liegenden Brief. Es war stickig in der engen Vierzimmerwohnung in der Potsdamer Straße nahe dem Botanischen Garten von Berlin.
Unnatürliche Sommerhitze lag seit Wochen über der Stadt. Selbst in der Nacht kühlte die Wohnung kaum ab.
An der Wand neben dem Schreibtisch hingen zwei Stahlstiche mit prachtvollen Silberrahmen. Das größere Bild zeigte einen gütig wirkenden, weißbärtigen arabischen Mann im weißen Kaftan mit einem goldverzierten Krummdolch in der Hand. Auf dem anderen Bild war ein von Palmen gesäumter Palast mit mehreren Segelschiffen zu sehen, die in dem Hafen, der sich vor dem Palast befand, ankerten.
Die Frau am Schreibtisch war kaum älter als vierzig. Und doch zeigte das sanfte, durch kleine Grübchen akzentuierte Gesicht mit den unübersehbar arabischen Zügen bereits Falten des Grams. Tränen rannen ihr über die Wangen. Sie zupfte ein Tüchlein aus dem Ärmel ihres schwarzen Kleides und tupfte sich die Tränen ab. Dann las sie den Brief nochmals laut vor sich hin:
Berlin, am 14. Juni 1884
An Seine Majestät, Kaiser Wilhelm I.
– per Kurier –
Wie Eurer hochwohlgeborenen Majestät zwischenzeitlich sicherlich zur Kenntnis gelangt sein wird, wandte ich mich Anfang dieses Monats mit meinem Anliegen ehrfurchtsvoll an Seine Exzellenz, den Deutschen Reichskanzler, Fürst Otto von Bismarck-Schönhausen. Die von mir untertänigst vorgebrachte Bitte um eine Audienz und um Unterstützung der Ansprüche, die ich als eine deutsche Untertanin gegen den Sultan von Sansibar erhebe, wurden von Seiner Exzellenz, dem Reichskanzler, leider abschlägig beschieden, da sich der hochgeschätzte Fürst von Bismarck derzeit nicht in der Lage sieht, meiner Bitte zu entsprechen.
Inständig und von Hoffnung auf Gerechtigkeit getragen, erlaube ich mir hiermit dennoch, Eure Majestät als Kaiser und Oberbefehlshaber der Armee des Deutschen Reiches zu bitten, meinem Falle nochmals eine wohlwollende Würdigung zuteilkommen zu lassen.
Eure Exzellenz mögen mir in der Ihnen zu eigenen Güte zunächst gestatten, den eher juristischen, erbrechtlichen Aspekten meiner nachfolgenden Ausführungen einige wenige sehr persönliche Zeilen voranzuschicken. Denn so wie der Tag nicht ohne die Nacht, das Gute nicht ohne das Böse und die Leidenschaft nicht ohne den Schmerz existieren können und zu erklären sind, so ist mein Leidensweg nicht ohne das Wissen um die Macht der Liebe zu verstehen.
Liebe, so hat mich die wunderbare und doch leidvolle Erfahrung gelehrt, ist kein Ideal, sie ist eine Sehnsucht. Und ebenjene Sehnsucht war es, die mich an der Hand meines Geliebten aus meiner fernen Heimat hier nach Deutschland führte und zu einer untertänigen Bürgerin des Deutschen Reiches und zu einer bekennenden Christin werden ließ. Liebe ist aber auch Rausch, Verzückung und bedeutet oftmals Aufhebung, die Ignoranz gesellschaftlicher Reglements.
Eine solche Liebe hat mich und meinen verstorbenen Ehemann und gütigen Vater unserer Kinder, Gott sei seiner sanften Seele gnädig, angehalten, das zu tun, was die Fügung uns vorgab, tun zu müssen. Und Gott möge mein Zeuge sein, dass unser Tun aus grenzenloser Reinheit und Unschuld erwuchs. Diese Liebe konnte jedoch nur zu gänzlicher Erfüllung gelangen, indem ich meinem früheren Glauben als Mohammedanerin abschwor und eine ehrfurchtsvolle Christin wurde, um meinem verehrten Ehemann und unseren ebenfalls im christlichen Glauben erzogenen Kindern eine würdige Ehefrau und Mutter sein zu können.
Und so empfinde ich das Joch der Strafe und Ungerechtigkeit, das nunmehr auf mir und meinen Kindern lastet, als demütigend und in seiner Grausamkeit unerträglich. Gottes Strafe, die mir und unseren Kindern bereits den geliebten Ehemann und Vater entriss, wird nunmehr zu einem schier nimmer endenden Martyrium durch die Weigerung des Sultans von Sansibar, mir meine von Rechtens zustehenden Erbansprüche zu gewähren, womit das Leid meiner Seele durch die Angst vor der Armut in unerträgliche Sphären geführt wird. Und doch lebt in mir ein Hauch von Hoffnung, dass mir mit Hilfe Eurer Majestät noch Gerechtigkeit zuteilwird und meine Erbforderungen durchgesetzt werden können. Und sei es nur,
um eine ungetrübte, glückliche Zukunft meiner Kinder zu sichern.
Dem beigefügten Verzeichnis meiner verstorbenen Geschwister (und deren Vermögen), die ich von Rechts wegen zu beerben habe, mögen Eure Exzellenz entnehmen, dass eine Summe von 400 000 bis 500 000 Reichsmark keineswegs zu hoch gegriffen ist.
In dieser meiner Hilflosigkeit und Verzweiflung erflehe ich gnädigst die Unterstützung Eurer Majestät. Denn in meiner früheren Heimat Sansibar wird nur jenes Recht für mächtig gehalten, das durch stattliche Kriegsschiffe repräsentiert wird. Und da meine bisherigen Versuche, meine legitimen Forderungen an meinen Halbbruder, Sayyid Barghash ibn Sa’id, Herrscher und Sultan von Oman und Sansibar, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, kläglich misslungen sind, möchte ich Eure Exzellenz in aller Ehrfurcht ersuchen, mir und meinen drei Kindern bei meiner nächsten Reise nach Ostafika allergnädigst den Schutz durch ein deutsches Kriegssciff zu gewähren, um meine Ansprüche gegen den Sultan von Sansbar mit Nachdruck geltend machen zu könnn.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!