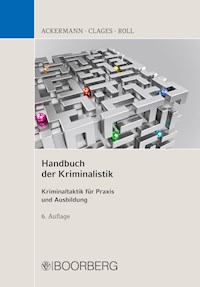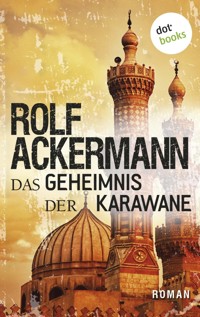Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die gefährliche Jagd nach einem verlorenen Diamanten – "Der Fluch des Florentiners" von Rolf Ackermann jetzt als eBook bei dotbooks. Hat ein alter Fluch sein nächstes Opfer gefunden? Die Edelsteinexpertin Marie-Claire de Vries soll für das Auktionshaus Christie's die Echtheit eines ganz besonderen Diamanten überprüfen. Handelt es sich bei dem Stein tatsächlich um den 1920 verschwundenen Florentiner? Schnell merkt Marie-Claire, dass sie nicht die einzige ist, die sich für den Edelstein interessiert: Die Ritter eines mysteriösen Ordens und die Nachfahren eines indischen Herrschergeschlechts sehen sich gleichermaßen als rechtmäßige Besitzer. Sie wollen das Juwel zurück, koste es, was es wolle! Doch der Florentiner stürzte bisher alle seine Besitzer ins Verderben – wird Marie-Claire nun das erste von vielen neuen Opfern? Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Der Fluch des Florentiners" von Rolf Ackermann. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Hat ein alter Fluch sein nächstes Opfer gefunden? Die Edelsteinexpertin Marie-Claire de Vries soll für das Auktionshaus Christie’s die Echtheit eines ganz besonderen Diamanten überprüfen. Handelt es sich bei dem Stein tatsächlich um den 1920 verschwundenen Florentiner? Schnell merkt Marie-Claire, dass sie nicht die einzige ist, die sich für den Edelstein interessiert: Die Ritter eines mysteriösen Ordens und die Nachfahren eines indischen Herrschergeschlechts sehen sich gleichermaßen als rechtmäßige Besitzer. Sie wollen das Juwel zurück, koste es, was es wolle! Doch der Florentiner stürzte bisher alle seine Besitzer ins Verderben – wird Marie-Claire nun das erste von vielen neuen Opfern?
Über den Autor:
Rolf Ackermann, geboren 1952 in Duisburg, ist ehemaliger Beamter eines deutschen Nachrichtendienstes, Journalist und Autor zahlreicher Sachbücher und Romane. Seine langjährigen Aufenthalte und Recherchen in Ostafrika inspirierten ihn zu »Weiße Jägerin«. Zudem begleitete er auch die ZDF-Filmproduktion »Momella – eine Farm in Afrika« über Margarete Trappes Leben in beratender Funktion. Rolf Ackermann lebt seit einigen Jahren in Namibia, wo er eine Hilfsorganisation für San („Buschmänner“) gegründet hat. Er beschäftigt sich intensiv mit den traditionellen Heilmethoden und Heilkräutern Afrikas.
Bei dotbooks erschienen bisher Die weiße Jägerin und Das Geheimnis der Karawane.
Die Website des Autors: www.rolf-ackermann-namibia.over-blog.de
***
Neuausgabe Februar 2015
Copyright © der Originalausgabe 2006 Droemer Verlag, München
Copyright © der Neuausgabe 2015 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung eines Motivs von istockphoto/Orietta Gaspari
ISBN 978-3-95824-030-8
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Der Fluch des Florentiners an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://gplus.to/dotbooks
http://instagram.com/dotbooks
Rolf Ackermann
Der Fluch des Florentiners
Roman
dotbooks.
Widmung
Béatrice: Woher nimmst du nur die Geduld und Kraft, deinen manchmal in schriftstellerischen Sphären über den irdischen Dingen schwebenden Mann so liebevoll und zudem noch, als wissenschaftliche Ratgeberin, so kompetent zu unterstützen?
In diesem Buch ist viel von dir. Und das ist gut so! Meinen Söhnen, Tobias und Philippe, möchte ich mit diesem Buch aufzeigen, wie spannend und gleichsam unterhaltsam Geschichte sein kann. Es sind nicht immer die Fakten, die zählen.
Die Dinge dazwischen, die unsichtbaren, das Menschliche macht das wahre Leben aus …
Und also werden die Edelsteine von Feuer und Wasser erzeugt, deshalb haben sie auch Feuer und Wasser und viele Kräfte und Wirkungen in sich …
»Physica« von Hildegard von Bingen (1098-1179
Kapitel 1
Freiherr Georg Ludwig von Hohenstein kannte den Mann in seinem Traum nicht. Weder hatte er jemals zuvor die Stimme gehört, noch diese Augen schon einmal gesehen. Ein komplettes Gesicht hatte der Mann nicht, aber er wirkte bedrohlich. Seine Augen zeigten einen Schimmer von Hass und sein französischer Befehl hallte wie ein Peitschenschlag durch Georgs Traum.
»Reveillez!«
Freiherr von Hohenstein drehte sich mürrisch auf die Seite, zog die Bettdecke über die Schulter und versuchte den Traum zu verdrängen. Dann hörte er Klara hinter sich sprechen. Ihre Hand lag auf seiner Schulter. Sie sprach mit gepresster Stimme, angsterfüllt und panisch. Plötzlich wusste er, dass es kein Traum war.
»Georg …«, stotterte sie.
Er versuchte sich aufzurichten, aber etwas presste ihn mit einem kalten Gegenstand auf das Kopfkissen zurück. Aus dem Augenwinkel sah er, dass der Mann mit den hasserfüllten Augen Wirklichkeit geworden war. Er stand direkt vor ihm am Bett und richtete eine Pistole auf ihn. Die Mündung zeigte genau zwischen Freiherr von Hohensteins Augen. Im diffusen Morgenlicht des Schlafzimmers waren noch andere Gestalten zu erkennen. Sie huschten umher und trugen alle Kapuzen. Der Mann vor ihm sprach diesmal sehr leise.
»Guten Morgen, Monsieur Freiherr von Hohenstein …« Es klang seltsam. Er strengte sich an, das H auszusprechen, aber es gelang ihm nicht. Als sei ihm das peinlich, räusperte er sich kurz. Dann sprach er in exzellentem Deutsch mit einem sehr eigentümlichen Akzent.
»Ich bedaure, Ihre Nachtruhe so rüde unterbrechen zu müssen, Monsieur, aber ich muss Sie und Ihre werte Gattin bitten, mir Ihre geschätzte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Wir müssen über unaufschiebbare geschäftliche Belange sprechen.«
Freiherr Georg von Hohenstein wunderte sich über die gewählte Ausdrucksweise des Mannes mit der Pistole.
»Was wollen Sie?«, presste er hervor. Er versuchte bei seiner Gattin nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, er habe Angst. Aber er hatte Angst. Panische Angst. Und seine Stimme verriet ihn: »Ich habe nicht viel Bargeld im Hause. Nehmen Sie …«
»Ich will Ihr Geld nicht. Ich will den Sancy!«
Freiherr von Hohenstein stockte der Atem. Die Hand seiner Frau, die auf seiner Schulter lag, zuckte merklich. Der Sancy! Woher wusste dieser Einbrecher, dass der Sancy im Haus war? Woher wusste er, dass der Brillant morgen zu einer Ausstellung über den Schmuck der preußischen Könige ins Schloss Charlottenburg nach Berlin gebracht werden sollte und nur deswegen am Tag zuvor aus der Panzerglasvitrine herausgenommen worden war und zusammen mit den anderen Schmuckstücken im Safe lag – allein durch die Stahltür geschützt?
»Alle Wertsachen sind in einem Tresor mit Zeitschloss. Der Sancy auch. Der Tresor ist erst wieder am Montag zu öffnen«, log er.
Der Mann mit der Pistole nickte einem seiner Begleiter zu. Er schien verärgert zu sein. Die Morgensonne schien jetzt in den Raum. Aus den Umrissen der anderen Männer wurden große, klar erkennbare Gestalten, die alle blaue Overalls trugen. Einer war kleiner, fast schmächtig, die beiden anderen waren muskulös. Sie schienen keine Waffen zu haben. Der Schmächtige trat an das Bett.
»Drehen Sie sich langsam um«, befahl der scheinbare Anführer Georg von Hohenstein. Mit dem Pistolenlauf drückte er ihn unmissverständlich zu jener Seite hin, wo seine Frau lag. Langsam drehte sich Freiherr von Hohenstein um. Seine hellen Stirnhaare fielen ihm ins Gesicht. Er erschrak. Klara lag auf dem Rücken. Die Bettdecke hatte sie bis zum Mund hochgezogen. Mit panischen Augen schaute sie ihn an. Schweißperlen rannen ihr über das Gesicht. Todesangst verfärbte ihren ohnehin fahlen Teint grau-weiß. Der Schmächtige trat an ihr Bett heran und riss die Bettdecke weg. Klara schrie lautlos-entsetzt auf. Ihr von Furcht erfüllter Blick verriet, wovor sie Angst hatte. Ohne die Reaktion seines in Angst erstarrten Opfers abzuwarten, presste der Mann Klara seine Hand auf den Mund und riss ihr brutal das Nachtkleid vom Leib.
Freiherr von Hohenstein bäumte sich kurz gegen den Druck der Pistole in seinem Nacken auf, aber er wusste, dass das sinnlos war. Seine Frau lag wie gelähmt auf dem Bett mit dem dunkelroten Seidenbezug. Tränen rannen ihr über die Wangen.
Im Raum herrschte plötzlich eine eigentümlich angespannte Atmosphäre. Der Schmächtige taxierte Klara von Hohenstein ungeniert.
»Bitte tun Sie ihr nichts …«, wollte Freiherr von Hohenstein seine Bereitschaft, den Tresor zu öffnen, artikulieren, aber der Mann hinter ihm steckte ihm den Lauf der Waffe von der Seite her in den Mund.
»Los, beeil dich«, herrschte der Anführer den Kleinen an.
Der Schmächtige beugte sich über das Bett. Die Frau zitterte am ganzen Körper. Sie atmete jetzt sehr schnell, weinte aber nicht mehr. Der Mann streifte den Handschuh von seiner rechten Hand ab. Freiherr von Hohenstein starrte wie gebannt auf die Finger des Mannes. Solche Hände hatte er schon einmal gesehen. Nein, er hatte sie schon sehr oft gesehen. Damals, in Ägypten. Fast alle Menschen in Ägypten hatten solche Hände: braun gebrannt, mit helleren Handinnenflächen, sehr weißen Fingernägeln und sehr hellem Nagelbett. Ja, schoss es ihm durch den Kopf, ein Araber!
Der Kleine genoss seine Macht. Sein Atem ging jetzt sehr schnell. Die Brust hob und senkte sich sichtbar unter seinem Overall. Er fingerte an dem Reißverschluss seines Overalls und zog ihn ostentativ langsam herunter. Klara von Hohenstein schloss die Augen. Sie weinte jetzt wieder.
»Die Nummernkombination zum Tresor«, forderte der Anführer.
Freiherr von Hohenstein schielte zu seiner Frau hinüber. Sie lag wie aufgebahrt, mit starrem Blick und aschfahlem Gesicht auf dem Bett.
Der Druck des Pistolenlaufs in seinem Nacken nahm zu. Er wusste, dass er keine Wahl hatte, dass es aussichtslos war, mit diesen Männern zu verhandeln. Aber würden sie ihn und seine Frau nicht sowieso umbringen, hätte er erst einmal den Code des Tresors verraten? Im Tresor lagen derzeit Schmuckstücke von unschätzbarem Wert! Die Versicherungsprämie belief sich alleine für den Transport der Schmuckstücke auf über zehntausend Euro – bei einem Versicherungswert aller Preziosen von acht Millionen Euro! Vom ideellen Wert dieses jahrhundertealten Schmucks ganz abgesehen. Erst gestern waren die schönsten und wertvollsten Diademe, Armreifen, Halsketten und Ringe, besetzt mit Diamanten, Smaragden, Saphiren und Perlen, mithin also die schönsten Stücke des Familienschmucks, durch eine Sicherheitsfirma aus den Vitrinen des Museums geholt und für den Transport verpackt worden. Morgen sollten sie mit einem Hubschrauber nach Berlin gebracht werden. Wie hatten diese Männer davon wissen können? Alles war in höchster Geheimhaltung arrangiert worden. Nur die Versicherung und das Museum, in dem der Schmuck ansonsten ausgestellt war, wussten davon. Aus Sicherheitsgründen war sein gesamtes Hauspersonal über das Wochenende in Urlaub geschickt worden. Nur zwei Sicherheitsbeamte hielten sich unten im Erdgeschoss auf. Sie waren bewaffnet und für solch brisante Aufträge extra geschult worden. Aber wo waren sie? Waren sie bereits tot? Und wieso wollte der Anführer den Sancy? Ausgerechnet den Kleinen Sancy, einen der berühmtesten Diamanten des Abendlandes? Ein vierunddreißig-karätiger Brillant, der zum Kronschatz deutscher Kaiser gehört hatte und dessen Versicherungswert bei drei Millionen Euro lag?
Die Stimme des Mannes neben ihm ließ Georg von Hohenstein aus seinen Gedanken hochfahren. Er schämte sich, dass seine Gedanken bei dem Schmuck gewesen waren und er seine Frau darüber völlig vergessen hatte. Klara starrte voller Angst auf den schmächtigen Mann, der sie nicht aus den Augen ließ.
»Komm, wir vergnügen uns ein wenig mit ihr«, forderte er den Anführer auf.
»Lass sie in Ruhe«, herrschte dieser ihn an und wischte sich mit der freien Hand Schweißperlen aus dem Nacken.
»Abu Farez, du bist ein Spielverderber! »
Bevor er weiter redete, richtete der Anführer plötzlich seine Waffe mit gestrecktem Arm auf den Kopf des Kleinen. »Mach weiter!«, fuhr er den anderen an. Er klang aufgebracht und schien seine Drohung ernst zu meinen.
Der Schmächtige griff in seinen geöffneten Overall und zog ein kleines, schwarzes Gerät aus Plastik, kaum größer als eine Zigarettenschachtel, heraus. Er schien irgendwie erstaunt, dass am Rande des Gerätes ein rotes Lämpchen in Intervallen aufleuchtete. Fragend blickte er für Bruchteile von Sekunden den Anführer an. Dann wandte er sich wieder der Frau im Bett zu. Er nahm das kleine Gerät, steckte es ihr in den Slip, drehte an einem Knopf des Gerätes und zog den Slip hoch, so dass das Gerät stecken blieb. Nur der obere Teil schaute heraus. Das rote Lämpchen leuchtete in kurzen Intervallen auf.
»Nicht bewegen«, zischte der Bewaffnete.
Freiherr Georg von Hohenstein konnte sich die Motive der Männer noch immer nicht erklären. Er hatte nicht alles verstanden, was die beiden Männer miteinander gesprochen hatten. Sie sprachen manchmal auf Arabisch. Ihm war klar, dass er es hier nicht mit schnöden Kriminellen zu tun hatte, diese Männer wussten genau, was sie wollten: den Sancy! Aber warum wollten sie nur diesen einen Diamanten? Und würden sie ihn und seine Frau dafür tatsächlich umbringen?
»Nein, wir werden Sie nicht umbringen«, schien der Anführer seine Gedanken erraten zu haben. »Ich will den Diamanten. Sonst nichts!«
»Sieben links, vier rechts, fünf links«, presste Freiherr Georg von Hohenstein die Nummernkombination des Tresors hervor.
»Sie sind sehr klug, Monsieur! Ihre Frau wird es Ihnen danken, dass Sie sie mit Ihrer Weisheit aus ihrer misslichen Situation befreit und Schlimmeres verhindert haben. Warum sollten Sie auch Ihr Leben und das Ihrer so attraktiven Gattin aufs Spiel setzen für etwas, das Ihnen sowieso nie gehört hat und nie wieder gehören wird! Der Sancy gehört nicht ins christliche Abendland. Dieser wunderschöne Diamant ist legitimes Eigentum des arabischen Volkes. Was die Kreuzritter einst raubten, werden wir jenen zurückgeben, denen es gehörte.«
Als habe er zu viel gesagt, richtete sich der Anführer plötzlich auf. Seine Waffe zielte nicht mehr auf den Nacken seines Opfers.
»Schauen Sie sich dieses kleine Gerät an. Das ist ein Zeitzünder mit ein paar Gramm Sprengstoff. Er ist mit einem Vibrationszündmechanismus versehen. Wir werden Sie und Ihre Frau jetzt zusammenbinden und den Diamanten aus dem Tresor im Keller holen. Bleiben Sie ganz einfach zwei Stunden lang völlig regungslos liegen. Dann geschieht Ihnen beiden nichts. Nach zwei Stunden schaltet sich das Gerät automatisch ab. Bewegen Sie sich bis dahin nicht zu heftig! Versuchen Sie nicht, sich zu drehen. Atmen Sie ruhig. Jede zu schnelle Bewegung aktiviert den Mechanismus. Dann zerreißt die Sprengladung den Unterleib Ihrer Frau. Und Sie mit …«
Der Mann ging um das Bett herum zu Klara von Hohenstein. Sie starrte ihn hass- und angsterfüllt an.
»Wie war die Kombination noch einmal?«, fragte er, ohne sie dabei aus den Augen zu lassen.
»Sieben links, vier rechts, fünf links …«
»Ich hoffe in Ihrem Interesse, dass diese Kombination stimmt. Und ich hoffe sehr, dass Sie sich nicht für einen schnöden Diamanten, der ohnehin überversichert ist, irgendwelche anderen Tricks einfallen lassen. Genießen Sie das Leben, Monsieur von Hohenstein! Wäre doch höchst bedauerlich, wenn Sie für einen durchsichtigen kleinen Stein aus dem fernen Morgenland in die Luft fliegen würden, oder? »
Die vier Männer gingen zur Tür. Freiherr Georg von Hohenstein und seine Frau lagen jetzt Bauch an Bauch eng aneinander gepresst auf der Seite, die Hände hinter dem Rücken des anderen mit Klebeband festgebunden und an den Füßen gefesselt. Zwangsweise Auge in Auge, nur wenige Zentimeter voneinander getrennt, starrten sie sich panisch an. Der Anführer blieb an der Tür stehen und schaute auf seine Armbanduhr.
»Es ist jetzt 6.32 Uhr. In genau zwei Stunden, um 8.32 Uhr, schaltet sich der Mechanismus der Sprengladung automatisch ab. Versuchen Sie, das zu erleben …«
Zu dem Schmächtigen gewandt, befahl er: »Du bleibst hier und passt auf die beiden auf. Wir gehen runter und holen den Diamanten. Und lass die Finger von der Frau.«
Als er die Tür langsam hinter sich schloss, hielt Klara von Hohenstein den Atem an und blickte ihren Mann aus nächster Nähe fragend und doch wissend an. Tränen liefen ihr über die Wange. Ihr Mann schlug verschämt die Augen nieder. Er wusste, wovor seine Frau Angst hatte.
Fünfzehn Minuten später, Freiherr Georg von Hohenstein hatte das Aufheulen zweier Automotoren gehört und daraus geschlossen, dass die Täter davongefahren waren, klingelte bei Oberkommissar Friedhelm Sauer, Leiter des Frühdienstes der Kriminalwache Sigmaringen, das Telefon. Drei Minuten später rasten zwei Streifenwagen mit Blaulicht aus der Tiefgarage der Polizeiwache. Weitere sieben Minuten später hatten die Polizisten eine provisorische Straßensperre kurz vor der Einmündung der kleinen Privatstraße, die von Schloss Hohenstein auf die Bundesstraße führte, errichtet. Zwei Nagelbretter lagen quer versetzt über der Straße. Die beiden Polizeifahrzeuge standen kurz dahinter nebeneinander auf der Fahrbahn. Zwei Polizisten standen einige Meter seitlich von den Fahrzeugen entfernt hinter Bäumen. Sie hielten MP-5-Maschinenpistolen im Anschlag. Die beiden Kriminalbeamten hatten sich hinter einem Felsbrocken neben der Straße geduckt. Auch sie waren schwer bewaffnet. Gebannt starrten alle vier in den Wald hinein.
»Die können noch nicht unten sein«, murmelte Oberkommissar Sauer seinem Kollegen zu. »Von Schloss Hohenstein bis zu dieser Abzweigung braucht man mindestens fünfunddreißig Minuten. Ich bin die Strecke schon oft gefahren.«
Während er es sagte, hoffte er insgeheim, dass das alarmierte Sondereinsatzkommando noch rechtzeitig eintreffen würde. Er hatte das untrügliche Gefühl, dass vier Beamte zu wenige waren, um diese Männer zu stoppen. Soeben wollte er weitere Anweisungen geben, als das Dröhnen von Fahrzeugmotoren aus dem Wald heraus zu ihnen herabhallte. Reifen quietschten.
»Sie kommen!«, brüllte er den anderen Polizisten zu. Hektisch entsicherte er seine Waffe, richtete sie mit gestreckten Armen in Kombattstellung auf das, was da jeden Augenblick um die Kurve aus dem Wald herauskommen würde: zwei Fahrzeuge mit Männern, die Freiherr von Hohenstein beraubt hatten. Männer, Araber, die skrupellos und bewaffnet waren …
Freiherr Georg von Hohenstein saß im Schlafanzug in seinem Range Rover. Neben ihm auf dem Beifahrersitz lagen eine Schrotflinte und ein großkalibriges Jagdgewehr mit Zielfernrohr. Im Schoß lag ein Trommelrevolver. Der Motor des Achtzylinders heulte auf. Mit quietschenden Reifen schoss der Geländewagen aus dem Innenhof des Schlosses. Die Augen des Vierzigjährigen glänzten unnatürlich. Er zitterte am ganzen Leib.
»Ich bringe euch um«, schrie er aus dem geöffneten Seitenfenster hinaus und raste talwärts, den Fluchtfahrzeugen hinterher. Die Reifenspuren auf der nassen Fahrbahn zeigten ihm, dass die Araber über die kleine Privatstraße, die durch die Wälder ins Tal führten, geflohen waren. Nervös fingerte er nach der 44er Magnum zwischen seinen Oberschenkeln. Sein Vater hatte ihm die Waffe geschenkt. Sie war extrem schwer, klobig und unhandlich. Sechs Patronen waren in den Kammern der Trommel. Jedes dieser Projektile war tödlich. Fast egal, wie und wo man traf.
Wer mit solcher Munition schoss, wollte töten. Und genau das wollte er! Er wollte – und er musste töten! Den einen dieser Männer, der ihn die erniedrigendsten Momente seines Lebens hatte erleben lassen. Momente, die er nie würde vergessen können. Und Klara? Wie würde sie das Geschehene jemals verkraften können? Den Überfall würde sie vielleicht verdrängen können, aber was dann geschehen war, als die drei Männer hinunter in den Keller gegangen waren und den Schmächtigen zurückgelassen hatten, um auf sie aufzupassen, nein, das würde Klara niemals vergessen. Wie tot hatte sie auf dem Bett gelegen und nicht reagiert, als er davonstürzte. Dafür würde er ihn umbringen. Wenn er ihn kriegte.
Der Range Rover raste durch ein idyllisches Tal. Freiherr Georg von Hohenstein merkte, dass er zu schnell fuhr. Die Novembersonne stand milchig-gelb über den bewaldeten Hügeln vor ihm und blendete ihn. Morgentau, Laub und Lehm machten den Asphalt zu einer glitschigen Rutschbahn. Er wusste, dass er den schweren Geländewagen nicht halten konnte, wenn dieser seitlich ausbrach. Ein Reh wechselte plötzlich nur wenige Meter vor ihm von rechts aus dem Wald kommend in das Dickicht der anderen Straßenseite. Es war ein sehr junges Tier. Es verharrte für Momente, hatte panische Angst, starrte mit seinen wunderschönen, dunklen Augen zu ihm ins Fahrzeug hinein.
Es war der gleiche Augenausdruck, den Klara gehabt hatte, als der kleine Araber, kaum dass die anderen das Zimmer verlassen hatten, sie vergewaltigt hatte. Ihre Seele hatte aus ihren Augen herausgeschrien.
Als er den gequälten Augenausdruck seiner Frau, das schmerzerfüllte Gesicht von Klara nicht mehr hatte sehen können, hatte er die Augen geschlossen und hemmungslos geweint.
Er wäre in diesem Moment am liebsten gestorben, weil er ahnte, dass es nach diesem Tag keine Zukunft mehr für ihn und Klara geben konnte. Ein einziger Gedanke hielt ihn am Leben. Rache! Denn plötzlich war ihm durch den Kopf geschossen, dass der Araber die Sprengladung in Klaras Slip gar nicht deaktiviert hatte. Er hatte ihr den Slip einfach zerrissen. Das kleine schwarze Gerät war aufs Bett gerutscht, ohne zu explodieren. In diesem Augenblick hatte Georg von Hohenstein mit Entsetzen erkannt, dass dieses Gerät eine Attrappe war. Mehr nicht. Und von diesem Moment an wollte er wieder leben – leben, um sich zu rächen.
Mit diesem Hass, mit dem unbändigen Wunsch zu töten, raste er nun in seinem Range Rover hinter den Männern her. Er hoffte, dass er sie einholen würde, bevor die von ihm telefonisch alarmierten Polizisten auftauchten.
»Ich töte dich – ich töte euch!«, schrie er erneut. Dann sah er hinter der nächsten Kurve die beiden Fahrzeuge. Keine dreihundert Meter entfernt. Sie fuhren waghalsig schnell, aber er war schneller. Der Range Rover schlidderte bedrohlich aus der Kurve heraus über den Grünstreifen am Fahrbahnrand. Das Allradfahrzeug fing sich und schoss talwärts. Die Fahrzeuge vor ihm gerieten plötzlich ins Schlingern, blieben abrupt fast quer auf der schmalen Straße stehen. Er sah die Reifen qualmen. Dann sah er die zwei Polizeifahrzeuge, die Straßensperre, sah, wie das hintere Fluchtfahrzeug den Rückwärtsgang einlegte, dann aber wieder scharf bremste, weil der Fahrer wohl den Range Rover hinter sich gesehen hatte.
Erstaunt stellte Freiherr Georg von Hohenstein fest, dass er nicht aufgeregt war. So wie auf der Jagd. Auf der Pirsch war er nie aufgeregt. Er war ein guter Jäger.
Jetzt war er nahe genug an den Fahrzeugen, um erkennen zu können, dass in dem hinteren Wagen, einem BMW, nur ein Mann saß. Davor war das Heck eines japanischen Geländewagens zu sehen. Er ahnte – wusste es plötzlich. In dem BMW saß der schmächtige Araber! Langsam manövrierte er seinen Range Rover seitlich auf die Straße, griff nach seinem Jagdgewehr, richtete es auf den hinteren Wagen. Er atmete ruhig durch, visierte über das Fadenkreuz des Zielfernrohrs den Hinterkopf des Mannes am Steuer an. Der Fahrer trug keine Kapuze mehr. Ja, er war es! Groß und klar konnte er das Profil des Mannes sehen. Der Mann in dem anderen Fahrzeug wandte sich jetzt nach hinten, blickte durch das getönte Heckfenster und sah den Range Rover. Freiherr Georg von Hohenstein sah ihn, sah das Gesicht des Vergewaltigers groß, blass und matt inmitten des Fadenkreuzes, sah seine Augen und sah, dass der Araber wusste, was geschehen würde.
Ein Schuss hallte durch das Tal. Kurz, bellend, trocken – tödlich. Der BMW schoss mit aufheulendem Motor über den Straßenrand, überschlug sich am Hang mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Der japanische Geländewagen davor raste davon, querfeldein, über die Wiese in Richtung des Waldrandes.
Es dauerte lange, unendlich lange, bis die nächsten Schüsse durchs Tal hallten, bis die Männer hinter den Polizeifahrzeugen hervorsprangen. Die Polizisten schossen. Aber sie trafen den über die Felder davonrasenden Wagen nur am Heck. Freiherr Georg von Hohenstein folgte dem Fluchtfahrzeug durch das Zielfernrohr hindurch. Er sah die wenigen Einschläge der Polizeikugeln am Heck des Fahrzeugs, wusste, dass die Neun-Millimeter-Geschosse auf diese Entfernung keinen großen Schaden anrichten konnten. Sein Zielfernrohr schwenkte hin zum Fahrerfenster. Er sah einen der breitschultrigen Araber am Lenkrad. Die anderen zwei Männer hatten sich im Fahrzeug weggeduckt.
Sein Zeigefinger tastete nach dem Abzug des Jagdgewehrs. Die linke Schläfe des Arabers am Lenkrad war jetzt mitten im Fadenkreuz. Aber Freiherr Georg von Hohenstein schoss nicht. Tränen rannen auf das Glas des Zielfernrohrs. Die Silhouette des Fahrers verschwamm vor seinen tränenerfüllten Augen, wurde kleiner und verschwand im Wald.
***
Vor dem Tod hatte Leonardo Frattini keine Angst. Doch dass sein missratenes Leben jetzt in Florenz, fern seiner Heimat Sardinien, enden würde, gefiel ihm nicht. Und es enttäuschte ihn maßlos, dass es so schnell gehen würde. Andererseits, dachte er sich, so schlecht ist es nun auch wieder nicht, als verarmter sardischer Hirte im weltberühmten Palazzo Pitti zu sterben.
Seine allerletzten Gedanken, jene Augenblicke, die zwischen dem erstaunten Blick auf den davonlaufenden Jungen und der Explosion lagen, kreisten daher nicht um das Entsetzen über den Tod. Er hatte in seiner Zeit bei der französischen Fremdenlegion im Krieg in Algerien so viel Totes, tote Menschen, verendete Tiere, leblose Landschaften und abgestorbene Gefühle gesehen, dass ihn das nicht mehr entsetzen konnte.
Vielmehr bereute er in diesen wenigen ihm noch verbleibenden Sekunden seines Lebens, die eine Sache mit seiner Enkelin Francesca nicht geregelt zu haben. Die Kleine sollte sein winziges Landhaus bei San Teodoro auf Sardinien erben. Ebenso wie das Segelboot und die Ersparnisse. Sie sollte alles bekommen. Dieses Vorhaben war mit dem Wissen um die Unabwendbarkeit seines baldigen Todes gereift. Die Entscheidung, seinen Sohn Carlo zu enterben und alles der kleinen Francesca zu vermachen, war gefallen, als er erfahren hatte, dass Carlo bereits mit dem Erbe kalkulierte. Carlo brauchte wieder einmal Geld für eine seiner absurden, seit jeher schon im Ansatz zum Scheitern verurteilten Geschäftsideen, und er stand unter Druck bei seinen Gläubigern. Banken, Freunde und suspekte Geldverleiher. Folglich hatte er sein zu erwartendes Erbe bereits verpfändet. So gesehen wartete Carlo sehnsüchtig auf den Tod seines Vaters. Das wusste Leonardo Frattini. Doch sein Sohn hatte nicht damit gerechnet, dass Leonardo ihm einen Strich durch seine zynische Rechnung machen würde. Er lebte länger als erwartet, denn die Metastasen vermehrten sich langsamer als von den Ärzten prognostiziert. Daher hatte Leonardo Frattini auch geglaubt, noch Zeit genug zu haben für die Änderung des Testaments. Die Schmerzen waren in den letzten Wochen seltsamerweise nicht so grauenhaft wie zuvor. Zwar wuchs der Tumor in der rechten Schädelseite, aber die Schmerzen ließen nach. Das hatte Leonardo zu der fatalistischen Erkenntnis geführt, dass der Tod wohl auch etwas Gutes habe, da mit seinem Herannahen die Schmerzen wichen. Und weil dem so war, hatte er sich bei der Personalabteilung des Palazzo Pitti wieder zur Arbeit gemeldet. Er hatte erfahren, dass man im Palazzo wegen einer Sonderausstellung zusätzliche Mitarbeiter benötigte. Seine Arbeit als Wärter in jenem Gebäudetrakt des Museums, in dem unter anderem die Schätze der Medici ausgestellt waren, machte ihm Spaß. Für Glanz und Glorie dieses italienischen Herrschergeschlechts hatte er sich schon als kleiner Junge begeistert. Die prachtvollen Schätze der Medici im Palazzo Pitti zu bewachen, sah er als ehrenvolle Aufgabe an, auch wenn es manchmal langweilig war, den ganzen Tag durch den linken Flügel des Palazzo zu gehen und zu warten, bis Besucher ihn etwas fragten. Andererseits hatte er seit Monaten ohnehin nichts anderes getan als gewartet. Auf den Tod. Die Arbeit machte das Warten auf das Ende kurzweiliger, und eine Sonderausstellung brachte Abwechslung in seinen Tagesablauf. Daher hatte er sich sehr darauf gefreut, als am heutigen Morgen die Sonderausstellung über Maria de Medici im Palazzo Pitti eröffnet worden war. Aus aller Welt waren prachtvolle Exponate eingetroffen und in den Vitrinen ausgestellt. Unter den Exponaten befanden sich auch viele Gemälde von Michelangelo, der eng mit den Medici befreundet gewesen war. Schon am frühen Morgen hatten sich Besucherschlangen vor dem Palazzo auf der Piazza dei Pitti bis in die Via Guicciardini und auf die Piazza San Felice gebildet. Der Ansturm war überwältigend. Jetzt, am frühen Nachmittag, waren die Salons der zweiten Etage noch immer überfüllt.
Dass du dich freiwillig zur Arbeit gemeldet hast, schoss es ihm in diesen letzten Momenten seines Lebens durch den Kopf, war eine tödliche Entscheidung gewesen. Hätte er weiterhin nicht gearbeitet, würde er noch ein wenig länger leben und hätte Zeit, sich um diese leidige Erbsache zu kümmern.
Das Letzte, was der sechsundsechzigjährige Museumswärter Leonardo Frattini an diesem frühen Novembernachmittag dachte, war, dass es eigentlich ein zynischer Seitenhieb des Schicksals sei, von einem ungefähr zwölfjährigen kleinen Jungen getötet zu werden, wo er doch gerade entschieden hatte, seiner ebenfalls zwölfjährigen Enkelin alles zu vererben und der Kleinen damit ein angenehmes Lebens zu garantieren.
Er starrte bei diesem Gedanken auf die graue, von Kinderhand geformte Knetmasse an der linken unteren Ecke der Glasvitrine. Eine kleine Hülse steckte in der Masse, und aus der Hülse schaute ein blaues Kabel hervor. Das Ganze sah sehr unscheinbar aus, fast so wie die Knetmassen, mit denen er als Kind im Kindergarten von San Teodoro gespielt hatte. Aber er kannte diese Masse mit der Hülse aus dem Krieg und wusste, dass es Plastiksprengstoff war. Vielleicht dreißig Gramm. Das war nicht sehr viel, aber dennoch genug, um die Vitrine aus Panzerglas in Millionen kleine Teile zu zerfetzen. Er sah den Zeitzünder und war sich todsicher, dass irgendjemand hier im Palazzo Pitti gleich auf einen Knopf drücken und die funkgesteuerte Sprengladung zünden würde. Er verstand nur nicht, warum. Denn von den kostbaren Schmuckstücken in der Vitrine, von den unvorstellbar wertvollen goldenen Colliers, Broschen, Armreifen, Haarnadeln und Ringen, den goldenen Insignien des Herrschergeschlechts der Medici und anderer abendländischer Fürsten, würde nichts übrig bleiben. Nur deformiertes Metall, das nichts wert sein würde. Nein, er verstand nicht, was da direkt vor seinen Augen gleich geschehen würde.
Leonardo Frattini hörte wie aus weiter Ferne das unsagbar grelle Schrillen der Alarmanlage, ausgelöst durch die abrupten Bewegungen des Jungen, der sich über die rote Absperrkordel gebeugt und blitzschnell die Knetmasse an die Vitrine geklebt hatte. Er hörte das Hallen der schnellen Schritte des davonlaufenden Jungen auf dem Marmorboden. Er vernahm verwundert murmelnde Besucher, sah erstaunte Gesichter und sah seinen Kollegen Vincenzo aus dem Nebenraum hereineilen. Vincenzo sah wie immer sehr lächerlich aus mit seinem dicken Bauch in der viel zu engen Uniform und mit der leger in den Nacken geschobenen Schirmmütze.
Der sardische Hirte und Exfremdenlegionär Leonardo Frattini sah in diesen Sekunden viel, hörte alles, verstand aber nicht, was da vor sich ging. Den kleinen, arabisch aussehenden Jungen hatte er zwar kurz beobachtet, als dieser vor wenigen Minuten in den Raum gekommen war. Er hatte irgendwie hilflos ausgesehen, als suche er Rat oder seine Eltern. Mit großen Augen der Begeisterung hatte der Kleine mit dem Unschuldsblick eines Kindes im Ausstellungsraum herumgeschaut und war dann vor der Vitrine, in der rechten Ecke des Salons, nahe dem Fenster stehen geblieben.
Warum sollte man als Wärter im Palazzo Pitti einem Kind Misstrauen entgegenbringen? Ein Kind im Alter seiner Enkelin Francesca würde wohl kaum auf die wahnwitzige Idee kommen, Ausstellungsstücke aus den Königsgemächern, Bilder aus der palatinischen Galerie, Preziosen der Medici oder Gemälde von Michelangelo, der Maria de Medici so wunderschön gemalt hatte, zu stehlen. Zumal das ohnehin schier unmöglich war. Die Alarmanlagen des Palazzo Pitti galten unter Experten als perfekt. Bewegungsmelder, Infrarotsensoren, Überwachungskameras, Panzerglasvitrinen: Nein, jeder Versuch, diese kostbaren Schätze zu stehlen, war zum Scheitern verurteilt. Auch das war ein Grund, warum Leonardo Frattini nicht begriff, was da um ihn herum geschah.
Er ärgerte sich vielmehr ein wenig darüber, dass er wie zu einer Salzsäule erstarrt vor der Vitrine mit dem Plastiksprengstoff stand: unfähig sich zu bewegen, unfähig etwas zu unternehmen. Er fühlte sich so, wie sich ein Soldat fühlt, der auf eine jener Landminen getreten ist, die nicht explodieren, wenn man auf sie tritt, sondern erst dann, wenn der Fuß sich hebt und der tödliche Mechanismus ausgelöst wird.
In solchen Momenten wird einem bewusst, dass es völlig egal ist, was man selbst tut. Man kann nur warten – und hoffen.
Genau so fühlte Leonardo Frattini sich in jenem Moment, einen Schritt entfernt von der mit Goldschmuck und Edelsteinen so prachtvoll dekorierten Vitrine im Palazzo Pitti, unterhalb des Giardino di Boboli von Florenz.
Die Alarmanlage schrillte noch immer. Irgendwie klang sie erbärmlich mickrig. Sein Kollege Vincenzo stand ebenfalls vor der Vitrine und starrte auf die Knetmasse. Fragend blickte er dem arabischen Jungen hinterher. Dann drehte er sich zu seinem Kollegen um. Leonardo blickte Vincenzo an. Und beide wussten, dass es Sprengstoff war, der jeden Augenblick explodieren würde.
In jenem Moment befand sich der kleine Araber bereits vor dem Fenster rechts neben der Zwischentür. Blitzschnell fuhr seine Hand in die Tasche seines Kaftans, zuckte hervor, streckte sich in Richtung des abgedunkelten Fensters, von dem man ansonsten von der zweiten Etage herab einen wunderschönen Blick über die hinter dem Palazzo liegenden Boboli-Gärten hatte. Der Junge zog seine Hand zurück. An dem mit Panzerglas und Alarmanlagen gesicherten Fenster in der zweiten Etage klebte plötzlich ebenfalls eine graue Masse mit einem kleinen Metallröhrchen darin.
Der Junge rannte los und verschwand durch die Verbindungstür zum Nebenraum.
Bruchteile von Sekunden später war Leonardo Frattini aus dem kleinen Dorf Lu Fraili in Sardinien, seit fünfzehn Jahren Museumswärter im Palazzo Pitti in Florenz, tot. Glasfragmente der explodierenden Vitrine trennten seinen Kopf ab. Die zweite Detonation am Fenster schleuderte seinen Rumpf quer durch den Raum, neben eine japanische Touristin. Sie war jung und sehr schön. Auch sie war tot.
Leonardo Frattinis Kollege Vincenzo lebte noch, weil er sich nicht über die Vitrine gebeugt, sondern sich auf den Boden hatte fallen lassen. Ihm fehlte nur der rechte Arm.
Die Alarmanlage schrillte nicht mehr, dafür schrien die Menschen umso mehr. Überall war Blut und Glas und Gold. Ein wunderschönes Diadem mit vielen blau und rot funkelnden Steinen lag nahezu unbeschädigt auf einer toten dicken Frau, die sehr ärmlich gekleidet war. Riesige Gemälde mit goldenen Prunkrahmen hingen zerfetzt von den Wänden herab. Zwischen den kreischend und stöhnend umherirrenden Menschen und inmitten der Trümmer kullerten schöne, bunte Edelsteine auf dem Marmorboden herum. Deformiertes Geschmeide türmte sich zu kleinen Haufen auf. Dutzende haselnussgroße Perlen rollten wie Murmeln durch den Raum. Ohne Fassung sahen sie irgendwie wertlos aus.
Der Museumswärter Vincenzo di Lucca lag am Boden und fühlte nichts. Sein zweiter Arm baumelte ziemlich skurril an seinem Oberkörper. Seine Beine waren seltsam verdreht. Er fühlte sich wie tot, aber er lebte. Und daher konnte er am Boden liegend sehen, dass der arabische Junge plötzlich wieder da war. Der sehr unschuldig aussehende Knabe wühlte zielstrebig in dem Schutt herum und fingerte aus dem Schatzmüll einen walnussgroßen, schön geschliffenen gelblichen Stein hervor. Vincenzo di Lucca wusste, dass es ein Brillant war. Er war erst vor wenigen Tagen als Leihgabe eines Privatsammlers nach Florenz gekommen. Ein berühmter Brillant: der in Form eines Pfirsichkerns geschliffene Große Sancy. Kardinal Mazarin hatte ihn einst König Ludwig XIV. geschenkt. Maria de Medici trug ihn vor dreihundert Jahren besonders gerne zusammen mit dem Kleinen Sancy und dem Florentiner.
Der arabische Junge hielt den funkelnden Edelstein hoch, begutachtete ihn vermeintlich wissend, schritt zum zerborstenen Fenster, lehnte sich über die Brüstung und winkte irgendjemandem auf dem Lieferantenparkplatz am Ende der Via de Bardi zu. Bedächtig griff der Junge unter seinen Kaftan, zog eine Steinschleuder mit schwarzem Gummizug und lederner Lasche hervor, legte den Großen Sancy ein, zog die Schleuder und katapultierte den Brillanten aus dem Fernster hinaus und hinab in den Park vor dem Palazzo Pitti. Dann setzte sich der Kleine mit dem Rücken zur Wand auf den Boden, ließ die Steinschleuder fallen und schaute hinüber zu Vincenzo. Es sah nicht so aus, also tue ihm der Museumswärter, der nur noch einen Arm hatte, Leid. Den Anblick des toten Leonardo Frattini, aus dessen Torso noch immer Blut im abflachenden Rhythmus des Herzens hervorquoll, vermied er jedoch.
Kapitel 2
Das Telefon klingelte, kaum dass Marie-Claire de Vries ihr Büro betreten hatte. Sie schaute auf die Uhr. Punkt neun. Die Durchwahlnummer auf dem Telefon-Display zwang ihr einen Fluch auf die Lippen.
»Merde, was will die Sicherheitsabteilung aus London schon so früh am Montagmorgen …?«
Missmutig griff sie nach dem Hörer. Nur wenige Minuten später wusste sie, warum Francis Roundell sie angerufen hatte. Vier kurze Sätze hatte der für internationale Sicherheitsfragen im Auktionshaus Christies zuständige Deputy Chairman im Direktorium der Zentrale in London ihr am Telefon gesagt.
»Sorry, Marie-Claire, aber Ihr Urlaub ist tatsächlich zu Ende! Ich bin zum Lunch bei Ihnen in Wien. Lassen Sie alle anderen Termine streichen. Bestellen Sie für halb eins einen ruhigen Tisch im Landtmann.«
Warum Francis jedes Mal, wenn er nach Wien kam, in dieses ihrer Meinung nach an wienerischer Arroganz, ewiggestrigem K.u.k.-Dünkel und Biedermeiermobiliar erstickende Café wollte, war ihr schleierhaft. Das mit Kirschbaumholz getäfelte, grauenhaft enge und dennoch permanent überfüllte Lokal neben dem Burgtheater war ihr persönlich zuwider. Manchmal glaubte sie, Francis beharre nur auf diesem Café als Treffpunkt für dienstliche Gespräche, weil er hier all seine Vorurteile gegen die ihm nicht sonderlich sympathischen Wiener bestätigt bekam. Er mochte Österreich, aber die Wiener mochte er nicht. Vielmehr schien er geradezu auf eine Gelegenheit zu warten, seine Aversionen gegen den arrogant-wienerischen Dünkel kundzutun. Dafür war das Café Landtmann ein idealer Ort. Dort traf sich jenes Wien, das gesehen werden wollte und im Bewusstsein lebte, gesehen werden zu müssen. Die Nähe zur Hofburg, zum Rathaus und die unmittelbare Nachbarschaft zum Burgtheater zog die vermeintliche Hautevolee der Stadt an wie Honig die Bienen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!