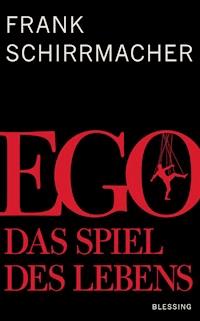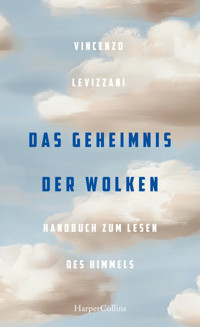
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
»Ein Gewitter kommt selten allein.« Was Wolken übers Wetter verraten. Ist uns eigentlich bewusst, dass wir den größten Teil unseres Lebens unter einer Wolkendecke verbringen? Vincenzo Levizzani, Wolkenphysiker und Atmosphärenforscher, nimmt uns mit in seine Welt: Er erklärt nicht nur, wie (und woraus) Wolken entstehen, sondern auch warum sie so viel übers Wetter und Klima verraten. Was sind Hydrometeore? Was passiert bei einem Superzellengewitter? Wie entsteht der in Gruselfilmen beliebte Strahlungsnebel? Warum hagelt es? Und wieso bloß impft man Wolken? Sein Buch ist eine Grand Tour durchs Wolkenuniversum, die uns eindrücklich vor Augen führt, wie komplex und fragil, aber auch wunderschön die Naturgesetze unserer Erde sind. »Ich möchte versuchen, den Kontakt zu unserem Wolkenuniversum wiederherzustellen, der uns in der Hektik des Alltags verloren gegangen ist. Die erste Frage, die wir uns dabei stellen sollten, ist vorhersehbar und für uns zugleich am interessantesten, da sie das Leben der Menschen seit Urzeiten und bis heute beeinflusst: Liefern uns die Wolken – ihre Formen und Farben, ihre Anordnung am Himmel, ihre Dichte und Höhe, ihre Struktur oder Größe – unmittelbare Informationen darüber, wie das Wetter kurz- oder mittelfristig sein wird? Eine Antwort darauf zu geben ist kompliziert, aber nicht unmöglich.« »Aus Sicht der Klimatologie sind die Wolken der gordische Knoten unseres Klimaproblems, da sie das Klima einerseits beeinflussen und andererseits vom Klima beeinflusst werden.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Vincenzo Levizzani
Das Geheimnis der Wolken
Handbuch zum Lesen des Himmels
Aus dem Italienischen von Andrea Kunstmann
HarperCollins
Die italienische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel Il libro delle nuvole bei il Saggiatore, Mailand.
© 2021 il Saggiatore S.r.l., Milano
Deutsche Erstausgabe
© 2025 für die deutschsprachige Ausgabe
by HarperCollins in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbHValentinskamp 24 · 20354 Hamburg [email protected]
Covergestaltung von HarperCollins nach einem Originalentwurf von Lübbeke Naumann Thoben, Köln
E-Book Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783749907106
www.harpercollins.de
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte der Urheber und des Verlags bleiben davon unberührt.
für Angela, die dafür sorgt, dass ich am Boden bleibe
für alle jungen Menschen: Mögen sie stehen bleiben und voller Staunen den Himmel betrachten, um ihn den Achtlosen zu erklären
in Erinnerung an einen ganz Großen: Hans Rudolf Pruppacher (1930–2020)
Behutsamer sei nun
dein Schritt: einen Steinwurf
entfernt bereitet
sich eine seltenere Szene.
Das verwitterte Tor eines Tempels
ist für immer verschlossen.
Über die grasbewachsene
Schwelle streut sich
ein großes Licht.
Und hier, wo menschliche Fährten
niemals ertönen, o erdachte Trauer,
wacht auf den Boden gestreckt
ein magerer Hund.
Niemals mehr wird er sich
in dieser Stunde, die man heiß
glaubt, bewegen.
Großartig zeigt sich
über dem Dach eine Wolke.
Eugenio Montale, »Behutsamer sei nun dein Schritt«, in: Tintenfischknochen (1925) 1
Ich bin das Kind aus Luft und Wind,
die Tochter von Wasser und Erde;
ich trotze der Zeit mit Unsterblichkeit,
weil ich ewig vergehe und werde.
Denn wenn klar wie Kristall nach des Regens Fall
die Kuppeln des Himmels erstrahlen,
wenn der Wind sich verdichtet und die Sonne errichtet
aus der tiefblauen Luft Kathedralen,
dann lächle ich weise und unendlich leise,
aus den dunklen Kavernen des Regens,
wie ein Geist in der Nacht, wie ein Kind, das erwacht,
steig ich auf – und ihr Werk war vergebens.
Percy Bysshe Shelley, Die Wolke (1820) 2
Draußen dehnt sich das leere Land bis zum Horizont, tut sich der Himmel auf, wo die Wolken laufen. In der Form, die Zufall und Wind den Wolken verleihen, ist der Mensch schon im Begriff, Gestalten zu sehen: ein Segelschiff, eine Hand, einen Elefanten …
Italo Calvino, Die unsichtbaren Städte (1972) 3
Einführung: Der Mensch und die Wolken
Einführung
Der Mensch und die Wolken
Klar und verlassen gehen die Morgen hin
an den Ufern des Flusses, der sich früh umnebelt
und, die Sonne erwartend, in dunkleres Grün fällt.
[…] Die Wolken haben reifes Fleisch.
Cesare Pavese, Grappa im September, in: Arbeiten macht müde (1943) 4
Ist uns eigentlich bewusst, dass wir den größten Teil unseres Lebens unter einer Wolkendecke verbringen? Manchmal achten wir auf den Himmel, manchmal auch nicht. Meist lenken uns derart viele Dinge ab, dass unsere Aufmerksamkeit nur selten dem Regen oder Schnee gilt, der auf unsere Köpfe fällt, oder den Formen und Farben eines Gewitterhimmels – außer natürlich, das Wetter wirkt sich negativ auf unsere Pläne aus, was hin und wieder vorkommt. Die Wolken jedoch sind immer irgendwie da, auch wenn wir uns ihrer nicht bewusst sind, denn wirklich wolkenlos ist der Himmel so gut wie nie. Wer auf einem Hügel oder Berg wohnt, weiß dies aus seiner privilegierten Perspektive nur zu gut, ebenso wie diejenigen, die in der Landwirtschaft arbeiten und Wolken als lebenslange Begleiter betrachten. Vielleicht achtet der moderne Mensch auch so selten auf den Himmel und seine Wolken, weil der Horizont meist von riesigen Gebäuden verstellt ist oder weil unser Blick durch das ständige Klingeln des Smartphones unweigerlich nach unten wandert. Die Wolken jedoch sind immer da. Und sie bieten ein Schauspiel, das meist interessanter ist als die banalen Ereignisse, die in unserem hyperkommunikativen Zeitalter ständig über die Bildschirme flimmern.
Wolken sind zu jeder Jahreszeit Bestandteil des Himmels und zugleich viel mehr als nur ein dekoratives Element. In ihren vielen Erscheinungsformen haben sie großen Einfluss auf unser Leben, weswegen wir sie mit Fug und Recht als ständige Reisebegleiter betrachten können. So kündigt ein bleigrauer Himmel Regen an, während weiße Wattebällchen schönes Wetter garantieren und damit signalisieren, dass wir uns ruhig aufs Fahrrad schwingen können. Das heißt, Wolken haben viel zu tun mit unserem Alltag, weil sie Informationen über kurz Bevorstehendes liefern.
Ich finde es erstaunlich, wie wenig Interesse der moderne Mensch noch der Beobachtung des Himmels entgegenbringt. Eigentlich würde es genügen, einen Moment lang den Blick zu heben, doch wie wolkig unser Planet ist, fällt uns immer nur dann auf, wenn wir die Aufnahmen betrachten, die uns von Satelliten oder Raumstationen erreichen. Seltsam, nicht wahr?
Auf den folgenden Seiten möchte ich versuchen, den Kontakt zu unserem Wolkenuniversum wiederherzustellen, der uns in der Hektik des Alltags verloren gegangen ist. Die erste Frage, die wir uns dabei stellen sollten, ist vorhersehbar und für uns zugleich am interessantesten, da sie das Leben der Menschen seit Urzeiten und bis heute beeinflusst: Liefern uns die Wolken – ihre Formen und Farben, ihre Anordnung am Himmel, ihre Dichte und Höhe, ihre Struktur oder Größe – unmittelbare Informationen darüber, wie das Wetter kurz- oder mittelfristig sein wird? Eine Antwort darauf zu geben, ist kompliziert, aber nicht unmöglich. Die volkstümlichen Wetterregeln gründen auf Erfahrungen, die die Menschen über viele Jahrhunderte gesammelt haben, indem sie ihre Nasen nach oben reckten und vom Anblick des Himmels und der Wolken eine Wettervorhersage abzuleiten versuchten. Nicht immer sind diese Regeln zutreffend, manchmal ein wenig naiv, ein andermal zu sehr von lokalen Gegebenheiten oder von Aberglauben bestimmt. Und doch wussten unsere Eltern und Großeltern meist, wovon sie sprachen, wenn sie in den Himmel schauten.
Abb. 1 Blick von einem Wettersatelliten auf die Erde. Siebzig Prozent der Erdoberfläche sind ständig von Wolken bedeckt (NASA).
Die meisten von uns können nur sehr selten einen völlig wolkenlosen Himmel bewundern. Im Detail hängt das natürlich von unserem Wohnort, der Jahreszeit und auch unserem Standpunkt ab. Doch seit es Satelliten gibt, die unsere Erde aus dem Weltall rund um die Uhr im Blick haben, wissen wir, dass der Globus immer zu gut siebzig Prozent von Wolkenformationen umgeben ist. Die Erde, die gemeinhin »blauer Planet« genannt wird, weil ein großer Teil ihrer Oberfläche von Ozeanen bedeckt ist, müsste man treffender als »wolkigen Planeten« bezeichnen. Auch andere Planeten unseres Sonnensystems könnte man als »wolkig« definieren, doch die Wolken des Jupiters beispielsweise bestehen aus molekularem Wasserstoff und Helium mit Spuren von Methan, Ammoniak, Schwefelsäure und weiteren Elementen – eine Mischung, die einem Leben, wie wir es auf der Erde kennen, alles andere als förderlich ist. Unsere Wolken dagegen sind Teil des weltweiten Wasserkreislaufs, somit unabdingbar für das Leben auf der Erde und nach heutigem Wissensstand auch einzig in ihrer Art.
Die Wissenschaft hat die Wolken und ihre Strukturen im Lauf der Zeit immer genauer untersucht. Die Wolkenphysik ist integraler Bestandteil der Physik der Atmosphäre und insbesondere der Meteorologie. Wer Wolken professionell unter die Lupe nimmt, betrachtet sie nicht zur Zerstreuung und schreibt auch keine Gedichte über sie, sondern beobachtet aufmerksam auch kleinste Veränderungen ihres Aussehens, um Aussagen über das Wetter zu treffen und die Gründe für schnelle oder auch längerfristige Wetterveränderungen zu verstehen. Wer sich ein Leben lang beruflich mit ihnen beschäftigt, empfindet beim Blick in die Wolken nichts Esoterisches. Als Wolkenphysiker stehe ich vielmehr mit beiden Beinen auf der Erde und versuche mit größtmöglicher Präzision zu analysieren, was ich sehe. Die Geheimnisse der Wolken zu entschlüsseln, erfordert Kenntnisse in Physik, Chemie und manchmal auch Biologie, denn Wolken sind unglaublich komplizierte Gebilde aus vielen Bestandteilen, die sich in Laboren nur schwer nachbauen lassen, also im Wesentlichen flüchtig und schwer zu fassen sind, selbst für die Wissenschaft. Sie, die Leserinnen und Leser dieses Buchs, müssen sich diese Kenntnisse natürlich nicht über Nacht aneignen, ich möchte Ihnen vielmehr Schritt für Schritt alle Basisinformationen zur Verfügung stellen, die es Ihnen am Ende der Lektüre ermöglichen, täglich den Himmel zu lesen – oder es zumindest zu versuchen. Glauben Sie mir, es lohnt sich!
Ich habe mein ganzes Leben der Wolkenbeobachtung gewidmet. Das klingt seltsam, und ich glaube nicht, dass meine Eltern bei meiner Geburt auch nur im Entferntesten daran gedacht haben, dass ich mich später einmal ganz der Verfolgung dieser flüchtigen, ätherischen Boten der Launen des Himmels hingeben würde. Schwer zu erklären, was im Kopf eines Menschen vorgeht, der Wolken zu seiner wissenschaftlichen und persönlichen Mission gemacht hat. Wenn ich noch hinzufüge, dass der ausschlaggebende Grund mein Wunsch war, etwas »Handfestes« zu studieren, klingt es vollends widersinnig. Und doch ist es das nicht. Ich hatte mich am Ende meines Physikstudiums für die Astrophysik entschieden, weil mich die Unendlichkeit und die Physik und Mathematik des Kosmos faszinierten. Dann aber waren es die Worte Franco Prodis, der mein Lehrer wurde, die mich trafen wie ein Donnerschlag: »Ein Leben für die Wolken.« Im letzten Studienjahr nahm ich aus reiner Neugier an einem Vortrag teil, in dem Professor Prodi die Physik der Atmosphäre erläuterte. Er lud mich ein, sein Labor im nationalen Forschungszentrum in Bologna zu besuchen. Dort begriff ich, dass mein Drang, die Unendlichkeit und die physikalischen Gesetze der Natur zu erforschen, mich den Tiefen des Weltalls deutlich näherbrachte, woraus der Wunsch entstand, die unvorstellbar kleinen Strukturen eines Hydrometeors (dazu später mehr) in einer flüchtigen Wolke in der Luft erklären zu können. Ich ging dann nach Kalifornien, wo ich die Ehre hatte, mit Hans R. Pruppacher zusammenzuarbeiten, dem weltweit renommiertesten Experten zu dem Thema, ein Lehrmeister der Wissenschaft und des Lebens. In der Regel stehen hinter Forschenden immer Mentorinnen oder Mentoren, die sie dazu bringen, ihre Möglichkeiten zu erkennen und auf bestmögliche Art auszuschöpfen. Das ist in der Wolkenphysik nicht anders als in anderen Wissenschaftszweigen. So wurde ich zu einem Forscher, der in den bewölkten Himmel blickt, und schließlich selbst Professor, der seine Leidenschaft an Studierende weitergibt, die eine Arbeit fortsetzen, die nie fertig wird. Nicht umsonst legt Platon in der Apologie des Sokrates seinem Lehrer, dem großen athenischen Philosophen, die Worte »Ich weiß, dass ich nichts weiß« in den Mund – denn zumindest weiß man nie alles, was man wissen will oder wissen müsste. Was wiederum die Basis jeder Forschung ist, die nie endet.
Blicken wir also nach oben und betrachten wir die Wolken als Teil unseres Lebens und nicht nur als Verzierungen des Himmels. Lernen wir diese Gebilde näher kennen, um ihre Hinweise auf eine sich immerfort wandelnde Atmosphäre zu verstehen, und begreifen wir sie als wertvolle Botschaften des wechselnden Wetters, das unser Leben beeinflusst. Lassen Sie sich beim Blättern in diesem Buch erklären, wie Wolken am blauen Himmel entstehen und wie viele unterschiedliche Arten es gibt – denn keine gleicht der anderen. Wir bewegen uns zwischen Tröpfchen, Kristallen, Graupeln und Hagelkörnern und dringen tief ins Innere der Wolken ein, um ihnen ihre Geheimnisse zu entlocken. Wir beschäftigen uns mit der Rolle der Wolken in der Meteorologie und Wettervorhersage und mit der Frage, ob der aktuelle Klimawandel auch die Wolken verändert. Wir besichtigen Forschungslabore, schnelle Flugzeuge, die durch Wolken rauschen, sowie Radargeräte und Satelliten, die sie unter ständiger genauer Beobachtung haben. Wir lernen außergewöhnliche Fachleute kennen, die die Geheimnisse der Wolken entschlüsselt und gezeigt haben, dass sie keine Produkte der Fantasie sind, sondern natürliche Prozesse mit festen Regeln, die wir immer noch genauer zu durchdringen versuchen.
Los geht’s!
Eins: Wolken in Raum und Zeit
Eins
Wolken in Raum und Zeit
Du sollst mich nicht tadeln, wenn ich mit den Wolken spreche.
Henry D. Thoreau, Brief an Mrs. Lucy Brown (1942)
Wie schon gesagt, gehören die Wolken zu den Alltagserfahrungen jedes Menschen, sie sind integraler Bestandteil seines Lebensraums und beeinflussen seine Sicht auf den Himmel und dessen mehr oder weniger auffällige Erscheinungen. Schriftstellerinnen, Dichter und Malerinnen haben den Himmel erforscht und versucht, die Geheimnisse der Wolken, ihre Bewegung, Entstehung und Entwicklung zu begreifen. Sie haben sich bemüht, deren Wirkung auf die Tiefen der menschlichen Seele zu erfassen, der der Himmel näher ist, als wir glauben. Darüber hinaus waren Verwunderung und Staunen angesichts des überwältigenden Anblicks der Wolken immer die vorherrschenden menschlichen Emotionen, wie es sehr schön Eugenio Montales eingangs zitiertes Gedicht »Ora sia il tuo passo« (»Behutsamer sei nun dein Schritt«) aus dem Band Ossi di seppia (Tintenfischknochen) von 1925 ausdrückt.
Die Religionen haben die Wolken immer als eine Art Grenze zwischen Himmel und Erde betrachtet, eine Pforte, an der Menschen vielleicht auch durch die Gewalt der Elemente hindurch mit Gott in Verbindung treten können. In der Bibel sind Wolken in vielen Passagen präsent, besonders einprägsam im »Bogen in den Wolken«, dem Regenbogen als Besiegelung des Bundes zwischen Gott und den Menschen nach der Sintflut (1. Mose 9,13). Eine Wolke begleitet und leitet die Israeliten beim Auszug aus Ägypten (2. Mose 13,21). Die Wolke bei der Verklärung Christi (Mk 9,7; Mt 17,5; Lk 9,34) verweist auf die Erscheinung Gottes im Alten Testament, und der gefangene Jesus prophezeit den Hohepriestern: »Ihr werdet sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels.« (Mk 14,62). Wolken tauchen auch in Darstellungen des Himmels als oberster Sphäre auf, von der aus Gott mithilfe der Elemente eingreift: »Singt dem Herrn ein Danklied und lobt unsern Gott mit Harfen, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen gibt auf Erden […]. Er gibt Schnee wie Wolle, er streut Reif wie Asche. Er wirft seine Schloßen [Hagelkörner] herab wie Brocken, wer kann bleiben vor seinem Frost?« (P 147). Oder: »Wasser ergossen sich aus dem Gewölk, die Wolken donnerten, und deine Pfeile fuhren einher. Dein Donner rollte, Blitze erhellten den Erdkreis, die Erde erbebte und wankte.« (Ps 77).
Der Koran wiederum berichtet: »Sahst du nicht, dass Allah die Wolken treibt und sie dann wieder versammelt und sie dann aufhäuft? Und du siehst den Regen mitten aus ihnen herauskommen. Und Er sendet Berge [= Wolken] vom Himmel hernieder, erfüllt mit Hagel, und Er trifft damit, wen Er will, und wendet sie ab, von wem Er will. Der Glanz Seines Blitzes raubt fast die Blicke!« (Koran 24,43) 5 Diese mehr oder weniger realistische Darstellung der Wolkenbildung ist den Menschen über die Jahrhunderte hinweg im Kopf geblieben und prägte vorwissenschaftliche Ansätze und noch deutlicher die Kunstgeschichte.
Natürlich haben wir die unzähligen Darstellungen in der gesamten abendländischen Kunst vor unserem geistigen Auge, die zeigen, wie sich die Kenntnisse über die Bildung und Entwicklung der Wolken im Lauf der Zeit gewandelt haben. In byzantinischen Darstellungen haben sie etwas Feierlich-Starres, sind alles andere als realistisch und verweisen auf die darüberliegenden himmlischen Sphären. Auch in den folgenden fast tausend Jahren bleiben die Wolken sowohl in den Fresken als auch in den mittelalterlichen Miniaturen noch sehr schematisch und ohne Bezug zur beobachtbaren Wirklichkeit. Im vierzehnten Jahrhundert ist Giotto einer der Ersten, der sie wie Wattebäusche in einen blauen Himmel hineinmalt, doch auch seine Wolken sind noch sehr idealisiert und gebunden an die theologische Botschaft. Im fünfzehnten Jahrhundert finden sie sich bei Piero della Francesco stilisiert als Hintergrundkulisse für die weit wichtigeren Figuren im Vordergrund (zum Beispiel in Die Taufe Christi, um 1450), und am Ende des Jahrhunderts plustern sie sich in der von Andrea Mantegna ausgemalten Camera degli Sposi im Castello San Giorgio in Mantua richtig auf.
Erst mit Leonardo da Vinci, Cima da Conegliano und Albrecht Dürer bekommen die Wolken ein natürlicheres Aussehen. In Das Gewitter (um 1508) von Giorgione sind die dunklen Wolken eine Bedrohung für das kleine Dorf und das geruhsame Leben der Menschen. Das Gemälde gilt als das erste echte Landschaftsbild in der Geschichte der westlichen Kunst, da die Natur darin ganz ausdrücklich eine Hauptrolle spielt.
Im Manierismus und im Barock wirbeln theatralische Wolken über die Gewölbedecken von Kirchen und Kathedralen in ganz Europa, insbesondere dann, wenn die Heiligen gen Himmel fahren. Die flämischen Maler verewigen mit großer Detailtreue die bleigrauen Himmel Nordeuropas – ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist Jan Vermeers Meisterwerk Ansicht von Delft (1660 – 61) mit tief hängenden Wolken über der friedlichen Handelsstadt. Bei den berühmten Vertretern der venezianischen Vedutenmalerei, Giovanni Antonio Canal (besser bekannt als Canaletto), seinem Neffen Bernardo Bellotto und Francesco Guardi stehen die Wolken am Himmel dagegen für frühlingsfrische Heiterkeit.
Der Romantik dienen die großzügig eingesetzten teils finsteren, teils heiteren Wolkenhimmel dem Ausdruck seelischer Zustände. Der Engländer John Constable hielt zwischen 1820 und 1822 die Veränderungen des Himmels in kleinen schnellen Bildern fest, die er nicht auszustellen gedachte – es handelte sich im Grunde um Beobachtungen, im Englischen Cloud Spotting genannt.
Im 19. Jahrhundert schließlich entstanden zahlreiche realitätsgetreue und wissenschaftlich haltbare bildliche Darstellungen von Wolken, man denke an Claude Monet und Alfred Sisley. Der Impressionismus thematisierte in den Wolken das schnelle Vergehen der Zeit, die unaufhörliche Veränderung der Welt – ein Ausdruck ihrer Poetik, die darin bestand, den Augenblick auf der Leinwand einzufangen, bevor er unwiederbringlich vergangen und verloren war. Ein Meister in der Wiedergabe wolkiger Momente ist sicherlich Gustave Courbet, einer der bedeutendsten Vertreter des Realismus.
Eine spezielle Erwähnung verdienen die Himmel Vincent Van Goghs, der einen tiefen Respekt vor der Natur und ihren Kräften hegte, die er als Spiegel der ruhelosen menschlichen Seele ansah. Sturmhimmel sind eine Konstante in seinem mit vielen Qualen erkauften Werk. Ein Beispiel dafür ist das berühmte Getreidefeld mit Raben (1890), in dem das niedergehende Gewitter wie ein Vorbote des Todes wirkt und die Raben bedrohlich über einem imaginären Leichnam zu kreisen scheinen, von dem der Maler ahnt, dass es bald seiner sein wird. Van Gogh war wie andere Kunstschaffende seiner Zeit beeinflusst von japanischen Werken, die damals gerade in Europa bekannt wurden, vor allem die Drucke von Hiroshige Utagawa und Hokusai Katsushika, Letzterer Schöpfer der Großen Welle vor Kanagawa, vermutlich der berühmteste Holzschnitt der japanischen Kunst.
Die Wolken werden von den avantgardistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts schließlich verdreht und verzerrt, der Expressionismus verleiht ihnen bunte Farben, und der Surrealismus enthebt sie dem Raum und der Zeit. Vor allem René Magritte treibt sein vieldeutiges Spiel mit ihnen, als Elemente seiner symbolischen Landschaften treten sie zugleich in den Dialog mit den Betrachtenden. In Roy Lichtensteins Cloud and sea (1969) sehen sie aus wie Sprechblasen und schlagen damit eine Brücke zur populären Comicliteratur.
Die Dichtkunst hat die Wolken naturgemäß immer als zarte Metaphern der vielfältigen Schattierungen der menschlichen Seele genutzt, in unzähligen Werken von der griechischen Antike über die Peanuts bis zu aktuellen Singer-Songwritern. Auch wenn es nicht Absicht dieses Buchs ist, empfinde ich es doch bereits als lohnende Übung voller Überraschungen, in den Literaturen der Welt und in der Musik aller Zeiten auf Wolkensuche zu gehen.
Wer mit nüchternerem Blick an die Wolken herangeht, landet bei Seeleuten und Fliegern, Reisenden, Militärs und Wissenschaftlern. Unter ihnen finden sich die Ersten, die begriffen, dass bestimmte Wolken gutes Wetter ankündigten, andere Stürme, Regen, Schnee, Hagel oder Blitze mit sich brachten. Ihre Schilderungen stellen den maßgeblichen Übergang zur Wissenschaft von heute dar, in der Wolken nicht mehr als »Thron Gottes« gesehen werden, sondern als natürliche, den Gesetzen der Physik und Chemie unterworfene und somit erforschbare Prozesse.
Mit der Vorhersage von Wetterphänomenen, insbesondere von Wolken, beschäftigen sich bereits die Babylonier, doch erst im antiken Griechenland, genauer im Jahr 340 v. Chr., prägt Aristoteles den Begriff meteōrología aus metéros (Objekte »hoch am Himmel«) und logía (»Gespräch«), den er auf Beobachtungen von Vorgängen in der Atmosphäre (und am Himmel) in seinen Meteorologica bezieht. Die meteorologische Neugier gibt die griechische ganz selbstverständlich an die lateinische Kultur weiter, wo sich Plinius der Ältere hervortut, der im zweiten Buch seiner Naturalis Historia die Meteorologie abhandelt.
Wang Chong, ein Philosoph, Physiker, Astronom und Meteorologe der Han-Dynastie, untersucht im ersten Jahrhundert nach Christus systematisch meteorologische Vorgänge, und in seinem Bemühen um eine rationale Beschreibung der Welt gelingt es ihm als Erstem, den Kreislauf des Wassers zu erklären, womit er seinen Zeitgenossen weit voraus ist. Eine seiner »modernen« Einsichten lautet: »Die Konfuzianer behaupten, die Formulierung, der Regen komme vom Himmel, bedeute, dass er tatsächlich vom Himmel fällt (wo sich die Sterne befinden). Doch eine genauere Überprüfung der Frage zeigt, dass der Regen zwar aus der Höhe, von oberhalb der Erde kommt, nicht jedoch vom Himmel.« In der Folge hat Shen Kuo, berühmter Gelehrter und Staatsmann der Song-Dynastie, zwischen 1000 und 1100 als Erster Tornados beschrieben und die Hypothese aufgestellt, Regenbogen entstünden, indem das Sonnenlicht auf Regentropfen trifft. Seine Darstellung der atmosphärischen Refraktion (Strahlenbrechung) entspricht dem modernen Wissensstand und entstand zeitgleich mit dem Schatz der Optik (1021) des Arabers Alhazen (Abū ʿAlī al-Ḥasan bin al-Haiṯam). Zugleich stellte Kuo die Theorie eines allmählichen Klimawandels auf, als er nach einem Erdrutsch im Jahr 1080 in der Nähe von Yanzhou Pflanzen untersuchte, die er als versteinerten Bambus aus der Antike identifizierte. Es handelte sich in Wahrheit um heute ausgestorbene Pflanzen der Gattung Calamites aus der Ordnung der Equisetales (Schachtelhalme) aus dem Karbon. Solche Fossilien hatten sich unterirdisch in trockener Umgebung erhalten, doch das feuchte Klima des Orts in der Antike hatte offenbar ihr Wachstum gefördert. Kuo verstand also, dass dies einen Wechsel des Klimas von feucht zu trocken implizierte, und kann somit möglicherweise als erster Paläoklimatologe der Geschichte bezeichnet werden.
Abb. 2Calamites carinatus aus dem Karbon.
Die wenigsten wissen vermutlich, dass die ersten Meteorologen im modernen Sinne weder Europäer noch Chinesen waren, sondern Koreaner. Sejong, vierter König der Joseon-Dynastie, und sein Sohn Prinz Munjong sind die wichtigsten Protagonisten der koreanischen Meteorologie, indem sie 1442 das cheugugi entwickeln ließen, das erste standardisierte Regenmessgerät der Geschichte. In Indien und China gab es zwar bereits viel früher Messungen, doch der koreanische Apparat ist der erste mit verlässlichen und nachvollziehbaren Maßeinheiten und diente der Berechnung der Steuern auf Basis der geschätzten Ernteerträge. Daraus entstand ein das ganze Reich überziehendes Netz an Messstationen, das bis heute als eines der technisch besten der Welt gilt.
Abb. 3 Ein cheugugi, das erste standardisierte Regenmessgerät der Geschichte, das 1442 in Korea erfunden wurde.
Die islamische Welt, Verbindungsglied zwischen hellenistischer, indischer, chinesischer Wissenschaft einerseits und der europäischen andererseits, beschäftigte sich mit allen Bereichen, besonders intensiv jedoch mit Mathematik, Astronomie und Medizin. Der wichtigste Physiker des goldenen Zeitalters des Islams, Abū Yaʿqūb ibn Ishāq al-Kindī, widmete sich im 9. Jahrhundert zwischen Basra und Bagdad der Meteorologie und Ozeanographie (er war ein Experte für die Gezeiten).
All diese Wissenschaftler waren Vorläufer von Roger Bacon, der im 13. Jahrhundert als erster Europäer den Regenbogen als Effekt der Brechung des Sonnenlichts beschrieb und damit vielen bedeutenden weiteren Entdeckungen den Weg bahnte. Leonardo da Vinci behandelt in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts die Wolken im siebten Abschnitt seines Traktats über die Malerei, vor allem unter dem Gesichtspunkt ihrer Auswirkung auf Helligkeit und Dunkelheit in Abhängigkeit von Position und Beleuchtung, ohne jedoch eine Reihe grundlegender Fragen zur Entstehung der Wolkenkörper zu vernachlässigen.
Wolken bilden sich aus der durch die Luft ergossenen Feuchtigkeit; dieselbe zieht sich vermöge der Kälte zusammen, die mit verschiedenen Winden durch die Luft hingeführt wird. Und solche Wolken erzeugen (selbst), sowohl bei ihrer Entstehung als auch bei ihrer Auflösung, Windströme. Bei der Entstehung erzeugen sie dieselben deshalb, weil die verteilte und dunstförmig ausgebreitete Feuchtigkeit, indem sie zur Wolkenbildung zusammenläuft, den Raum, aus dem sie entweicht, leer läßt; in der Natur aber ist Leere nicht statthaft, und so ist es notwendig, daß die Teile der Luft um das Entweichen der Feuchtigkeit her die begonnene Leere mit sich selbst ausfüllen, und diese Bewegung nennt man Wind. 6
Leonardo erfindet neben vielen anderen Dingen einen Luftfeuchtigkeitsmesser (Hygrometer), während Galileo Galilei ein präzises Thermometer entwickelt. In der Folge erschafft ein weiterer berühmter Italiener, Evangelista Torricelli, im Jahr 1643 das Barometer, was den Ausgangspunkt für echte meteorologische Messungen darstellt, die der Wolkenphysik den Weg bahnen. In Les Météores, einem Abschnitt des Discours de la méthode (1637), versucht auch René Descartes, die Wolken vom wissenschaftlichen Standpunkt aus zu ergründen, indem er alle Aspekte des Wunderbaren eliminiert und sie der Vernunft unterwirft: »Dies läßt mich hoffen, daß, wenn ich hier die Natur der Wolken auf eine Weise erkläre, daß man nicht mehr länger Anlaß hat, irgendetwas, was wir an ihnen sehen oder was von ihnen kommt, zu bewundern, man leicht glauben wird, daß es möglich ist, in der gleichen Weise die Ursachen all der wunderbarsten Dingen [sic] auf unserer Erde aufzufinden.« 7
Abb. 4 Frontispiz der 1637 erschienenen Erstausgabe der Discours de la methode.
Es ist allerdings der englische Chemiker und Apotheker Luke Howard, der die ersten systematischen Wolkenbeobachtungen niederschreibt. Beruflich hatte er mit der Mischung chemischer Substanzen zu tun, doch aus persönlicher Leidenschaft widmete er sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Mariabella der täglichen Analyse der Atmosphäre im Raum London – Aufzeichnungen, die unter dem Titel The Climate of London in den Jahren 1817 und 1833 veröffentlicht wurden. Howard erkennt von seinem dezidiert cartesianischen Standpunkt aus den physikalischen Charakter der Wolken, die daher den gleichen Gesetzen unterworfen sind wie alle anderen natürlichen Vorgänge auch. So wie Carl von Linné es für Pflanzen und Tiere getan hatte, erstellt Howard die erste Klassifikation von Wolken mit lateinischen Begriffen, um sie universell verwendbar zu machen, und veröffentlicht sie 1803 in seinem Essay on the Modification of Clouds (Abhandlung über die Veränderungen der Wolken). Mit den nötigen Anpassungen bildet Howards Einteilung noch immer die Basis der heutigen Terminologie.
Abb. 5 Luke Howards jährliche Klimaaufzeichnungen für London (1818).
Wolken und die Notwendigkeit von Wettervorhersagen stehen in einem engen Zusammenhang, was auch die große Zahl traditioneller Bauernregeln belegt, die aus dem Anblick des Himmels die meteorologische Zukunft ableiten.
Abendrot Schönwetterbot.
Wenn Schäfchenwolken am Himmel stehn, kann man ohne Schirm spazieren gehn.
Regenbogen am Morgen lässt für Regen sorgen.
Berg mit Hut, das Wetter wird gut.
Ist der Himmel voller Sterne, ist die Nacht voll Kälte gerne.
Kommt Wind vor Regen, ist wenig daran gelegen, kommt aber Regen vor dem Wind, zieht man die Segel ein geschwind.
Das sind nur einige wenige Beispiele der von unseren Vorfahren überlieferten bäuerlichen Weisheit, geboren aus der Notwendigkeit, für die Landbestellung, für Reisen und letztlich zur Sicherung des Überlebens der Familien Voraussagen über das Wetter zu treffen. Wohl deshalb werden Wetterereignisse auch häufig als Metaphern für Ereignisse im menschlichen Leben genutzt: Der »Sturm im Wasserglas« ist dafür nur ein Beispiel.
Die Metapher von der Wolke als einem sich in Raum und Zeit ausbreitenden und aus unzähligen Elementen bestehenden Gebilde hat sich in der Alltagssprache unseres digitalen Zeitalters festgesetzt, bezeichnet aber etwas komplett anderes: Das englische Wort cloud wird für einen virtuellen, über Tausende von »Knoten« im Netz verbundenen Raum genutzt, in dem sich Daten speichern, teilen und austauschen lassen (cloud computing). Wolken spielen auch in der Vorstellung der Schlagwortwolke (tag-cloud) eine Rolle, einer Methode, um das Vorkommen bestimmter Wörter in einem bestimmten Textkorpus zu visualisieren: optisch in einer Art Wolke aus Wörtern, die ihrer Häufigkeit entsprechend groß oder fett dargestellt werden – irgendwie auch Wolken, aber ohne Tropfen und Kristalle.
Zwei: Keine Wolke gleicht der anderen
Zwei
Keine Wolke gleicht der anderen
Am Anfang war alles lebendig. Die kleinsten Gegenstände waren mit pochenden Herzen ausgestattet, und selbst die Wolken hatten Namen.
Paul Auster, Bericht aus dem Inneren8
Bevor wir beginnen, die Wolken zu befragen, sollten wir versuchen, sie zu klassifizieren. Wolken klassifizieren – klingt das für Sie widersinnig? Wie soll man Wolken benennen, deren Aussehen sich abhängig von den Launen des Windes und der Sonnenstrahlung ununterbrochen verändert? Tatsächlich ist das schwierig, aber nicht unmöglich. Fangen wir bei den Grundlagen an.
Klassifizieren bedeutet »in Klassen einteilen«, »Pflanzen, Tiere, Mineralien, Bücher etc. einer festgelegten Kategorie zuweisen«. Die Geschichte dieser Wortbedeutung verweist zurück auf Carl Nilsson Linnaeus – bekannter als Carl von Linné –, einen schwedischen Arzt, Botaniker, Naturkundler und Wissenschaftler, der die moderne wissenschaftliche Klassifikation aller Teilbereiche des Systems »Natur« initiierte. Linné führte 1735