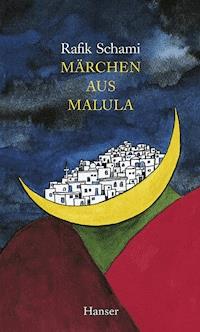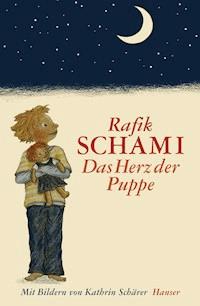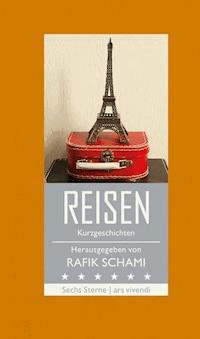Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Damaskus macht ein Gerücht die Runde: Nura, die schöne Frau des berühmten Kalligraphen Hamid Farsi, sei geflüchtet. Warum hat sie ein Leben, um das viele sie beneiden, hinter sich gelassen? Oder war sie Opfer einer Entführung der Gegner ihres Mannes? Schon als junger Mann wird Farsi als Wunderkind der Kalligraphie gefeiert. Nun arbeitet er verbissen an Plänen für eine radikale Reform der arabischen Sprache, nicht ahnend, dass zwischen Nura und seinem Lehrling Salman eine leidenschaftliche Liebe ihren Anfang nimmt - die Liebe zwischen einer Muslimin und einem Christen. Der neue Roman des deutsch-syrischen Autors ist ein großer Bilderbogen der syrischen Gesellschaft, der alle Sinne der Leser anspricht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 718
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rafik Schami
Das Geheimnis des
Kalligraphen
Roman
Carl Hanser Verlag
eISBN: 978-3-446-23340-9
Alle Rechte vorbehalten
© 2008/2010 Carl Hanser Verlag München
Satz: Filmsatz Schröter, München
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Für
Ibn Muqla,
(886–940)
den größten Architekten der
Buchstaben und seines Unglücks
Das Gerücht oder Wie Geschichten in Damaskus anfangen
Noch lag die Altstadt von Damaskus unter dem grauen Mantel der Dämmerung, als ein unglaubliches Gerücht an den Tischen der kleinen Garküchen und unter den ersten Kunden der Bäckereien seine Kreise zog: Nura, die schöne Frau des angesehenen und wohlhabenden Kalligraphen Hamid Farsi, sei geflüchtet.
Der April des Jahres 1957 bescherte Damaskus sommerliche Hitze. Zu dieser frühen Stunde füllte die Nachtluft noch die Gassen, und die Altstadt roch nach den Jasminblüten der Höfe, nach Gewürzen und nach feuchtem Holz. Die Gerade Straße lag im Dunkeln. Nur Bäckereien und Garküchen hatten Licht.
Bald drangen die Rufe der Muezzins in die Gassen und Schlafzimmer. Sie setzten kurz nacheinander ein und bildeten ein vielfaches Echo.
Als die Sonne hinter dem Osttor am Anfang der Geraden Straße aufging und das letzte Grau vom blauen Himmel wegfegte, wussten die Metzger, Gemüse- und Lebensmittelhändler bereits von Nuras Flucht. Es roch nach Öl, verbranntem Holz und Pferdeäpfeln.
Gegen acht Uhr begann sich in der Geraden Straße der Geruch nach Waschpulver, nach Kumin und hier und da nach Falafel breitzumachen. Friseure, Konditoren und Tischler hatten nun geöffnet und die Fläche auf dem Bürgersteig vor ihren Läden mit Wasser bespritzt. Inzwischen war durchgesickert, dass Nura die Tochter des bekannten Gelehrten Rami Arabi war.
Und als die Apotheker, Uhrmacher und Antiquitätenhändler gemächlich ihre Läden aufschlossen, ohne besondere Geschäfte zu erwarten, hatte das Gerücht das Osttor erreicht, und weil es bis dahin zu einem gewaltigen Gebilde angewachsen war, passte es nicht durch das Tor. Es prallte auf den steinernen Bogen und zerplatzte in tausendundeinen Fetzen, die lichtscheu wie Ratten durch die Gassen huschten und die Häuser aufsuchten.
Böse Zungen erzählten, dass Nura geflüchtet sei, weil ihr Ehemann ihr feurige Liebesbriefe geschrieben habe, und die geübten Damaszener Gerüchteverbreiter hielten inne, wohl wissend, dass sie damit ihre Zuhörer endgültig in die Falle gelockt hatten.
»Wie?«, fragten diese empört. »Eine Frau verlässt ihren Mann, weil er ihr vom Feuer seiner Liebe schrieb?«
»Nicht von seiner, nicht von seiner«, erwiderten die bösen Zungen mit der Ruhe der Sieger, »er schrieb im Auftrag des Schürzenjägers Nassri Abbani, der die schöne Frau mit den Briefen verführen wollte. Dieser Gockel hat Geld wie Heu, aber außer seinem Namen kann er nichts Gescheites schreiben.«
Nassri Abbani war ein stadtbekannter Frauenheld. Er hatte von seinem Vater mehr als zehn Häuser und in der Nähe der Stadt große Obstgärten geerbt. Im Gegensatz zu seinen zwei Brüdern, Salah und Muhammad, die fromm und fleißig den geerbten Reichtum vermehrten und brave Ehemänner waren, hurte Nassri, wo immer er konnte. Er hatte vier Frauen in vier Häusern, zeugte pro Jahr vier Kinder und ernährte dazu drei Huren der Stadt.
Als es Mittag wurde, die sengende Hitze alle Gerüche aus der Geraden Straße vertrieben und der Schatten der wenigen Passanten nur noch Fußlänge hatte, wussten die Bewohner sowohl des christlichen als auch des jüdischen und muslimischen Viertels von der Flucht. Das prächtige Haus des Kalligraphen lag nahe dem römischen Bogen und der orthodoxen Kirche der heiligen Maria, dort, wo die Viertel aufeinanderstießen.
»Manche Männer erkranken an Arrak oder Haschisch, andere sterben an ihrem unersättlichen Magen. Nassri ist an den Frauen erkrankt. Das ist wie Schnupfen und Tuberkulose, es trifft einen oder es trifft einen nicht«, sagte die Hebamme Huda, die allen seinen Kindern auf die Welt verhalf und Geheimnisträgerin seiner vier Frauen war. Sie stellte betont langsam das zierliche Mokkatässchen auf den Tisch, als litte sie selbst unter dieser schweren Diagnose. Die fünf Nachbarinnen nickten ohne zu atmen.
»Und ist diese Krankheit ansteckend?«, fragte eine beleibte Frau mit gespieltem Ernst. Die Hebamme schüttelte den Kopf und die anderen lachten verhalten, als wäre ihnen diese Frage peinlich.
Getrieben von seiner Sucht machte Nassri jeder Frau den Hof. Er unterschied nicht zwischen Frauen aus der Oberschicht und Bäuerinnen, zwischen alten Huren und jungen Mädchen. Seine jüngste Frau, die sechzehnjährige Almas, soll einmal gesagt haben: »Nassri kann kein Loch sehen, ohne sein Ding hineinzustecken. Mich würde es nicht wundern, wenn er eines Tages nach Hause kommt und an seinem Stock ein Bienenvolk hängt.«
Und wie das bei solchen Männern üblich ist, ging Nassris Herz erst richtig in Flammen auf, wenn sich ihm eine Frau verweigerte. Nura wollte von ihm nichts wissen und so wurde er fast verrückt nach ihr. Er soll monatelang keine Hure mehr angefasst haben. »Er war besessen von ihr«, vertraute seine junge Frau Almas der Hebamme Huda an. »Er schlief nur noch selten mit mir, und wenn er auch bei mir lag, wusste ich, er war mit seiner Seele bei der Fremden. Aber bis zu ihrer Flucht wusste ich nicht, wer sie war.«
Dann habe ihm der Kalligraph die Liebesbriefe geschrieben, die jeden Stein gefügig machen konnten, aber das war für die stolze Nura der Gipfel der Unverschämtheit. Sie übergab ihrem Vater die Briefe. Der Sufigelehrte, dessen Charakter ein Vorbild der Ruhe war, wollte es erst nicht glauben. Er vermutete, irgendein böser Geist wolle die Ehe des Kalligraphen zerstören. Doch die Beweise waren erdrückend. »Es war nicht nur die unverwechselbare Schrift des Kalligraphen«, erzählte die Hebamme, die in den Briefen besungene Schönheit Nuras sei zudem so genau beschrieben, dass außer ihr selbst und ihrer Mutter nur der Ehemann und sonst niemand genau Bescheid darüber wissen könne. Und nun senkte die Hebamme ihre Stimme so weit, dass die anderen Frauen kaum noch atmeten. »Nur sie konnten wissen, wie Nuras Brüste, ihr Bauch und ihre Beine aussahen und wo sie welches Muttermal trug«, fügte sie hinzu, als hätte sie die Briefe gelesen. »Der Kalligraph wusste dann nichts anderes zu sagen«, ergänzte eine andere Nachbarin, »als dass er nicht gewusst habe, für wen der Gockel die Briefe brauche, und dass Dichter, wenn sie eine fremde, ihnen unbekannte Schönheit besingen, immer nur das, was sie kennen, beschreiben würden.«
»Welch ein charakterloser Mann«, dieser Seufzer wanderte in den nächsten Tagen von Mund zu Mund, als hätte ganz Damaskus nur dieses Thema. Manch einer fügte hinzu, wenn keine Kinder in seiner Nähe standen: »Dann soll er in der Schande leben, während seine Frau unter dem Gockel liegt.«
»Aber sie liegt nicht unter dem Gockel. Sie flüchtete und ließ beide zurück. Das ist ja das Wundersame«, korrigierten die bösen Zungen geheimnisvoll.
Gerüchte mit bekanntem Anfang und Ende leben in Damaskus nur kurz, aber das Gerücht von der Flucht der schönen Frau hatte einen kuriosen Anfang und kein Ende. Es schlenderte unter den Männern von Café zu Café und in den Innenhöfen von Frauenrunde zu Frauenrunde, und immer wenn es von einer Zunge zur nächsten Zunge sprang, veränderte es sich.
Von den Ausschweifungen des Kalligraphen wurde erzählt, zu denen ihn Nassri Abbani verführt habe, um so an dessen Frau zu kommen. Von den Geldsummen, die der Kalligraph für die Briefe bekam. Nassri soll das Briefgewicht in Gold bezahlt haben. »Deshalb schrieb der gierige Kalligraph die Liebesbriefe mit großen Buchstaben und breitem Rand. Aus einer Seite machte er fünf«, wussten die bösen Zungen zu berichten.
Das alles mag dazu beigetragen haben, der jungen Frau die Entscheidung zu erleichtern. Ein Kern der Wahrheit blieb allen verborgen. Dieser Kern hieß Liebe.
Ein Jahr zuvor, im April 1956, hatte eine stürmische Liebesgeschichte ihren Anfang genommen. Damals stand Nura am Ende einer Sackgasse, als plötzlich die Liebe die sich vor ihr auftürmende Mauer sprengte und ihr eine Kreuzung der Möglichkeiten zeigte. Und Nura musste handeln.
Da die Wahrheit aber keine simple Aprikose ist, hat sie einen zweiten Kern, von dem nicht einmal Nura etwas wusste. Der zweite Kern dieser Geschichte war das Geheimnis des Kalligraphen.
Der erste Kern der Wahrheit
Ich folge der Liebe.
Wohin auch ihre Karawane zieht,
Liebe ist meine Religion,
mein Glaube.
Ibn Arabi
(1165 – 1240)
Gelehrter Sufi
1.
Unter dem Gejohle einer Gruppe Jugendlicher taumelte ein Mann aus seinem Getreidegeschäft. Er versuchte verzweifelt, sich an der Tür festzuhalten, doch die lärmende Meute schlug ihm auf die Finger und Arme, zerrte an ihm, versetzte ihm Schläge, wenn auch keine besonders kräftigen. Als wäre das Ganze ein Spaß, lachten die Jugendlichen dabei und sangen ein absurdes Lied, in dem sie zugleich Gott dankten und den Mann unflätig beschimpften. Es waren gereimte Obszönitäten von Analphabeten.
»Hilfe«, schrie der Mann, doch keiner half ihm. Die Angst ließ seine Stimme heiser klingen.
Wie Wespen schwirrten kleine Kinder in ärmlichen Kleidern um die Traube der Jugendlichen, die den Mann hermetisch umschloss. Die Kinder quengelten und bettelten in einem fort, auch sie würden den Mann gerne einmal anfassen. Sie fielen zu Boden, richteten sich auf, spuckten geräuschvoll und weit wie Erwachsene und rannten hinter der Meute her.
Nachdem zwei Jahre lang Dürre geherrscht hatte, regnete es an diesem Märztag 1942 wie schon seit über einer Woche ununterbrochen. Erleichtert konnten die Bewohner der Stadt nun wieder tief schlafen. Schlimme Sorgen hatten wie ein Alp auf Damaskus gelegen. Schon im September des ersten Jahres der Dürre waren die Unheilverkünder, die Steppenflughühner, gekommen, sie suchten in riesigen Schwärmen Wasser und Nahrung in den Gärten der grünen Oase Damaskus. Man wusste seit Urzeiten, wenn dieser taubengroße, sandfarben gesprenkelte Steppenvogel erscheint, wird es Dürre geben. So war es auch in jenem Herbst. So war es immer. Die Bauern hassten den Vogel.
Sobald das erste Steppenflughuhn gesichtet wurde, erhöhten die Großhändler von Weizen, Linsen, Kichererbsen, Zucker und Bohnen die Preise.
In den Moscheen beteten die Imame seit Dezember mit Hunderten von Kindern und Jugendlichen, die, von Lehrern und Erziehern begleitet, scharenweise alle Gebetshäuser aufsuchten.
Der Himmel schien alle Wolken verschluckt zu haben. Sein Blau war staubig. Die Saat harrte voller Sehnsucht nach Wasser in der trockenen Erde aus, und was kurz keimte, erstarb – dünn wie Kinderhaare – in der sommerlichen Hitze, die bis Ende Oktober anhielt. Bauern aus den umliegenden Dörfern nahmen in Damaskus für ein Stück Brot jede Arbeit an und waren dankbar dafür, denn sie wussten, bald würden die noch hungrigeren Bauern aus dem trockenen Süden kommen, die mit noch weniger Lohn zufrieden wären.
Scheich Rami Arabi, Nuras Vater, war seit Oktober völlig erschöpft, denn neben den offiziellen fünf Gebeten in seiner kleinen Moschee musste er Männerkreise leiten, die bis zur Morgendämmerung religiöse Lieder sangen, um Gott milde zu stimmen und Regen zu erbitten. Und auch am Tag kam er nicht zur Ruhe, denn zwischen den offiziellen Gebetszeiten rückten die Massen der Schüler an, mit denen er traurige Lieder anstimmen musste, die Gottes Herz erweichen sollten. Es waren weinerliche Lieder, die Scheich Rami Arabi nicht mochte, weil sie von Aberglauben nur so trieften. Der Aberglaube beherrschte die Menschen wie ein Zauber. Es waren keine ungebildeten, sondern angesehene Männer, die glaubten, die Steinsäulen der benachbarten Moschee würden beim Gebet Scheich Hussein Kiftaros vor Rührung weinen. Scheich Hussein war ein Halbanalphabet mit großem Turban und langem Bart.
Rami Arabi wusste, dass Säulen niemals weinen, sondern durch die Kälte Wassertropfen aus dem Dampf kondensieren, den die Betenden ausatmen. Aber das durfte er nicht sagen. Den Aberglauben müsse er erdulden, damit die Analphabeten ihren Glauben nicht verlören, sagte er seiner Frau.
Am ersten März fiel der erste Tropfen Wasser. Ein Junge kam in die Moschee gerannt, während Hunderte von Kindern sangen. Er schrie so schrill, dass alle verstummten. Der Junge erschrak, als es so still wurde, dann aber kamen die Worte schüchtern und leise aus seinem Mund: »Es regnet«, sagte er. Eine Woge der Erleichterung ging durch die Moschee und man hörte aus allen Ecken den Dank an Gott: Allahu Akbar. Und als hätten auch ihre Augen den Segen Gottes erfahren, weinten viele Erwachsene vor Rührung.
Draußen regnete es, anfangs zögerlich und dann in Strömen. Die staubige Erde hüpfte vor Freude, dann sättigte sie sich und wurde ruhig und dunkel. Innerhalb weniger Tage glänzte das Pflaster der Straßen von Damaskus vom Staub befreit, und die gelben Felder außerhalb der Stadt bekamen einen zarten, hellgrünen Mantel.
Die Armen atmeten erleichtert auf und die Bauern machten sich auf den Weg zurück zu ihren Dörfern und zu ihren Frauen.
Scheich Rami aber regte sich auf, denn nun war die Moschee wie leergefegt. Abgesehen von ein paar alten Männern kam niemand mehr zum Gebet. »Sie behandeln Gott wie einen Restaurantdiener. Sie bestellen bei ihm Regen, und sobald er ihnen das Bestellte bringt, zeigen sie ihm die kalte Schulter«, sagte er.
Der Regen wurde weniger und ein warmer Wind fegte die feinen Tropfen in die Gesichter der Jugendlichen, die nun ihren Tanz mit dem Mann in die Mitte der Straße verlegten. Sie schlossen ihre Arme um ihn und drehten ihn in ihrer Mitte, und dann flog sein Hemd über die Köpfe, und als wäre es eine Schlange oder eine Spinne, traten die Kleineren im äußersten Kreis der Tanzenden erregt auf das Hemd, zerbissen und zerrissen es in Fetzen.
Der Mann hörte auf, Widerstand zu leisten, weil ihn die vielen Ohrfeigen verwirrten. Seine Lippen bewegten sich, aber er brachte keinen Ton heraus. Irgendwann flog seine dicke Brille durch die Luft und landete in einer Pfütze am Bürgersteig.
Einer der Jugendlichen war schon heiser vor Aufregung. Er sang inzwischen keine Reime mehr, sondern aneinandergereihte Schimpfwörter. Die Jugendlichen skandierten wie berauscht und streckten ihre Hände gen Himmel: »Gott hat uns erhört.«
Der Mann schien niemanden zu sehen, während sein Blick auf der Suche nach Halt umherirrte. Für einen Augenblick starrte er Nura an. Sie war gerade sechs oder sieben und stand vor dem Regen geschützt unter der großen, bunten Markise des Süßigkeitenladens am Eingang ihrer Gasse. Sie wollte gerade anfangen, den roten Lutscher zu genießen, den sie für einen Piaster bei Elias geholt hatte. Aber die Szene vor ihr nahm sie gefangen. Jetzt zerrissen die Jugendlichen die Hose des Mannes, und keiner der Passanten half ihm. Er fiel zu Boden. Sein Gesicht war starr und blass, als hätte er bereits eine Ahnung von dem, was noch kommen sollte. Die Tritte, die ihm die Tanzenden versetzten, schien er nicht zu spüren. Er schimpfte nicht und flehte nicht, sondern tastete zwischen den dünnen Beinen der Jugendlichen den Boden ab, als ob er seine Brille suchen würde.
»In der Pfütze«, sprach Nura, als wollte sie ihm helfen.
Als ein älterer Herr im grauen Kittel der Angestellten zu ihm gehen wollte, wurde er auf dem Bürgersteig von einem Mann unsanft aufgehalten, der elegante traditionelle Kleider trug: nach hinten offene Schuhe, weite schwarze Hosen, weißes Hemd, bunte Weste und einen roten Schal aus Seide um den Bauch. Über seinen Schultern lag das gefaltete, schwarzweiß gemusterte Kufiya, das arabische Männerkopftuch. Unter dem Arm trug er ein verziertes Bambusrohr. Der dreißigjährige muskulöse Mann war glatt rasiert und hatte einen großen, mit Bartwichse gepflegten schwarzen Schnurrbart. Er war ein bekannter Schlägertyp. Man nannte solche Damaszener Männer Kabadai, ein türkisches Wort, das so viel bedeutet wie Raufbold. Das waren kräftige und furchtlose Männer, die oft Streit suchten und davon lebten, für Wohlhabende mit sauberen Händen schmutzige Aufträge zu erledigen, wie etwa jemanden zu erpressen oder zu demütigen. Der Kabadai schien Gefallen an der Tat der Jugendlichen gefunden zu haben. »Lass den Kindern ihren Spaß mit diesem Ungläubigen, der ihnen das Brot vom Mund raubt«, rief er wie ein Erzieher, packte den Mann im grauen Kittel mit der linken Hand am Hals und schlug ihm mit dem Stock lachend auf den Hintern, während er ihn ins Geschäft zurückbeförderte. Die umstehenden Männer und Frauen lachten über den Angestellten, der wie ein Schüler zu flehen anfing.
Nun lag der vermeintliche Räuber zusammengekauert und nackt auf der Straße und weinte. Die Jugendlichen zogen davon, immer noch im Regen singend und tanzend. Ein kleiner, blasser Junge mit schmalem, vernarbtem Gesicht löste sich von der Meute, kehrte zurück und versetzte dem Liegenden einen letzten Tritt in den Rücken. Jauchzend und mit ausgebreiteten Armen ein Flugzeug nachahmend, rannte er zu seinen Kameraden zurück.
»Nura, geh nach Hause. Das ist nichts für Mädchen«, hörte sie Elias’ sanfte Stimme, der das Ganze vom Fenster seines Ladens aus beobachtet hatte.
Nura zuckte zusammen, aber sie ging nicht. Sie beobachtete, wie der nackte Mann sich langsam aufsetzte, um sich schaute, einen Fetzen seiner dunklen Hose heranzog und damit sein Geschlecht bedeckte. Ein Bettler las die Brille auf, die trotz des weiten Wurfs unversehrt geblieben war, und brachte sie dem Nackten. Der Mann setzte sie auf, und ohne den Bettler weiter zu beachten, lief er in sein Geschäft.
Als Nura ihrer Mutter beim Kaffee im Wohnzimmer atemlos von dem Vorfall erzählte, blieb diese ungerührt. Die dicke Nachbarin Badia, die täglich zu Besuch kam, stellte die Mokkatasse auf den kleinen Tisch und lachte laut auf.
»Geschieht dem herzlosen Kreuzanbeter recht. Das hat er davon, die Preise zu erhöhen«, zischte die Mutter. Nura erschrak.
Und die Nachbarin erzählte belustigt, ihr Mann habe berichtet, in der Nähe der Omaijaden-Moschee hätten Jugendliche einen jüdischen Händler nackt bis zur Geraden Straße geschleift und dort unter Gejohle beschimpft und geschlagen.
Nuras Vater kam spät. Sein Gesicht hatte an diesem Tag jede Farbe verloren. Er war nur noch grau, und sie hörte ihn lange mit ihrer Mutter über die Jugendlichen streiten, die er »gottlos« schimpfte. Erst beim Abendessen hatte er sich wieder beruhigt.
Jahre später dachte Nura, wenn es so etwas wie eine Kreuzung auf dem Weg zu ihren Eltern gegeben hätte, dann hätte sie sich in jener Nacht entschieden, den Weg zum Vater zu nehmen. Das Verhältnis zu ihrer Mutter blieb immer kalt.
Am Tag nach dem Vorfall wollte Nura wissen, ob der Mann mit der Brille auch ohne Herz leben könne. Der Himmel klarte für Stunden auf, nur eine Flotte kleiner Wolken überquerte den himmlischen Ozean. Nura schlich durch die offene Haustür und gelangte von ihrer Gasse zur Hauptstraße. Sie bog nach links ab und ging am großen Getreidegeschäft vorbei, das zur Straße hin ein Büro mit großen Fenstern hatte. Daneben lag die Halle, in der Arbeiter pralle Jutesäcke mit Körnern trugen, wogen und aufstapelten.
Als wäre nichts geschehen, saß der Mann wieder vornehm dunkel angezogen an einem mit Blättern übersäten Tisch und schrieb etwas in ein dickes Heft. Er hob kurz den Kopf hoch und schaute zum Fenster hinaus. Augenblicklich drehte Nura ihren Kopf zur Seite und lief schnell weiter bis zum Eissalon. Dort holte sie tief Atem und machte kehrt. Diesmal vermied sie es, ins Büro hineinzuschauen, damit der Mann sie nicht erkennen konnte.
Noch Jahre später verfolgte sie das Bild des auf der Straße liegenden nackten Mannes bis in ihre Träume. Nura wachte immer erschrocken auf.
»Josef Aflak, Getreide, Saatgut«, entzifferte sie einige Zeit später das Schild über dem Eingang des Geschäfts, und kurz darauf erfuhr sie, dass der Mann Christ war. Es war nicht so, dass ihre Mutter diesen Mann hasste, für sie waren alle, die nicht Muslime waren, Ungläubige.
Auch der Süßigkeitenverkäufer mit den lustigen roten Haaren war Christ. Er hieß Elias und machte immer Scherze mit Nura. Er war der einzige in ihrem Leben, der sie Prinzessin nannte. Sie fragte ihn einmal, warum er sie nicht besuche, und hoffte dabei, dass er mit einer großen Tüte voller bunter Süßigkeiten kommen würde, aber Elias lachte nur.
Auch der Eissalon gehörte einem Christen, Rimon. Der war sonderbar. Wenn er keine Kunden hatte, nahm er seine Laute von der Wand und spielte und sang, bis der Laden voll wurde, dann rief er: »Wer will ein Eis?«
Deshalb dachte Nura, ihre Mutter mochte Christen nicht, weil sie lustig waren und immer das Leckerste verkauften. Ihre Mutter war spindeldürr, lachte selten und aß nur, wenn es sich nicht vermeiden ließ.
Oft tadelte sie der Vater, dass sie bald keinen Schatten mehr werfe. Auf den alten Bildern sah die Mutter rundlich und schön aus. Aber jetzt sagte auch Badia, die beleibte Nachbarin, sie fürchte, dass Nuras Mutter beim nächsten Wind weggeweht würde.
Als Nura kurz vor Ende der neunten Klasse stand, hörte sie von ihrem Vater, Josef, der Getreidehändler, sei gestorben. Er soll vor seinem Tod erzählt haben, dass er damals, als die Jugendlichen ihn gequält hatten, für einen Augenblick ohnmächtig gewesen sei und wie in einem vorbeiziehenden Film gesehen habe, dass seine Tochter Marie und sein Sohn Michel zum Islam übertreten würden.
Niemand nahm ihn ernst, weil der alte Mann kurz vor seinem Tod Fieber hatte. Die Entscheidung seiner Tochter Marie, nach einer stürmischen Liebe einen Muslim zu heiraten, hatte er nie verdaut. Die Ehe endete später unglücklich.
Und über seinen einzigen Sohn Michel, der nicht sein Geschäft weiterführen, sondern Politiker werden wollte, war er schon lange verärgert. Doch Josefs Traum ging in Erfüllung, denn fünfzig Jahre später, kurz vor seinem Tod, erklärte Michel als verbitterter alter Politiker im Bagdader Exil seinen Übertritt zum Islam und wurde schließlich dort unter dem Namen Ahmad Aflak begraben. Aber das ist eine andere Geschichte.
Die Aijubigasse lag im alten Midan-Viertel südwestlich der Altstadt, aber außerhalb der Stadtmauer. Sie duftete nach Anis, aber sie langweilte Nura. Sie war kurz und hatte nur vier Häuser. Nuras Elternhaus bildete den Abschluss dieser Sackgasse. Die fensterlose Mauer des Anislagers besetzte die stumme rechte Seite.
Im ersten Haus auf der linken Seite der Gasse lebte Badia mit ihrem Mann. Er war groß und formlos und sah aus wie ein ausgedienter Kleiderschrank. Badia war die einzige Freundin von Nuras Mutter. Nura kannte die neun Töchter und Söhne Badias nur als Erwachsene, die sie immer freundlich grüßten, aber wie Schatten vorbeihuschten, ohne Spuren zu hinterlassen. Nur die Tochter Buschra war ihr aus der Kinderzeit im Gedächtnis geblieben. Sie mochte Nura, küsste sie, wann immer sie sie sah, und nannte sie »meine Schöne«. Buschra duftete nach exotischen Blumen, weshalb sich Nura gerne von ihr umarmen ließ.
Das zweite Haus bewohnte ein reiches und kinderloses, sehr altes Ehepaar, das kaum Kontakt zu den anderen hatte.
Im Haus unmittelbar neben Nura wohnte eine große Familie von Christen, mit denen die Mutter kein Wort wechselte. Ihr Vater dagegen grüßte die Männer freundlich, wenn er sie auf der Gasse traf, während die Mutter etwas murmelte, das wie Abwehrzauber klang, der sie schützen sollte, für den Fall, dass diese Feinde einen ihrer Zaubersprüche gegen sie schleuderten.
Sieben oder acht Jungen zählte Nura im Haus der Christen. Es gab kein einziges Mädchen. Sie spielten mit Bällen, Murmeln und Kieselsteinen. Manchmal tollten sie fröhlich den ganzen Tag wie übermütige Welpen herum. Nura beobachtete sie oft von der Haustür aus, immer bereit, die Tür zuzuschlagen, sobald sich einer ihr näherte. Zwei von ihnen, die etwas älter und größer waren als die anderen, machten ihr immer, sobald sie sie erblickten, Andeutungen, dass sie sie umarmen und küssen wollten, dann huschte sie schnell ins Haus und beobachtete durch das große Schlüsselloch, wie die Jungen miteinander lachten. Ihr Herz raste, und sie wagte sich den ganzen Tag nicht mehr hinaus.
Manchmal trieben sie es wirklich schlimm. Wenn Nura auf dem Rückweg vom Eisverkäufer oder vom Süßigkeitenhändler war, tauchten die Jungen plötzlich auf und stellten sich wie eine Mauer vor sie. Sie forderten, an ihrem Eis oder Lutscher lecken zu dürfen, und drohten, ihr sonst den Weg nicht freizumachen. Erst wenn Nura anfing zu weinen, verschwanden sie.
Eines Tages beobachtete Elias die Szene, als er zufällig vor seinem Laden kehrte und einen Blick in die Gasse warf. Er kam Nura mit seinem großen Besen zu Hilfe und schimpfte mit den Jungen. »Wenn es noch einmal einer wagt, dir den Weg zu versperren, komm nur zu mir. Mein Besen hungert nach einem Hintern«, rief Elias laut, damit die Jungen es hörten. Das wirkte. Seit diesem Tag standen ihr die Jungen Spalier, wenn sie sich zufällig trafen.
Nur einer gab nicht auf. Er flüsterte ihr häufig zu: »Du bist so schön. Ich will dich sofort heiraten.«
Er war dick, hatte weiße Haut und rote Backen und war jünger als sie. Die anderen, schon größeren Jungen, die ihr schöne Augen machten, lachten ihn aus.
»Dummkopf, sie ist eine Muslimin.«
»Dann will ich auch ein Muslim sein«, rief der Junge verzweifelt und handelte sich eine schallende Ohrfeige von einem seiner Brüder ein. Der Dicke hieß Maurice, ein anderer Giorgios. Komische Namen, dachte Nura und hatte Mitleid mit dem Dicken, der nun laut heulte.
»Und wenn schon. Ich bin Muslim, wenn es mir gefällt, und Muhammad ist mir lieber als du«, rief er trotzig, und der andere gab ihm eine zweite Ohrfeige und einen kräftigen Tritt gegen das Schienbein. Maurice schniefte und schaute unaufhörlich auf Nuras Haus, als würde er von dort die Rettung erwarten.
Bald darauf rief eine Frau aus dem Hausinneren nach ihm, und er ging langsam und mit gesenktem Haupt hinein. Es dauerte nicht lang, und Nura hörte die Schreie der Mutter und das Flehen des Sohnes.
Seit diesem Tag sprach Maurice nicht mehr vom Heiraten. Er mied Nuras Blick, als ob er durch ihn krank werden könnte. Einmal saß er am Hauseingang und schluchzte. Als er Nura sah, drehte er sich zur Wand und weinte leise. Nura blieb stehen. Sie sah seine großen dunkelroten Ohren und verstand, dass man ihn geschlagen hatte. Er tat ihr leid. Sie näherte sich ihm und berührte ganz leicht seine Schulter. Maurice hörte abrupt auf zu weinen. Er drehte sich zu ihr und lächelte mit einem Gesicht voller Tränen und Rotz, den er mit dem Ärmel über beide Wangen verteilt hatte.
»Nura«, flüsterte er erstaunt.
Sie wurde rot und rannte nach Hause. Ihr Herz klopfte. Sie gab ihrer Mutter die Papiertüte mit den Zwiebeln, die sie bei Omar, dem Gemüsehändler, gekauft hatte.
»Hat der Gemüsehändler was gesagt?«, fragte die Mutter.
»Nein«, sagte Nura und wollte zur Haustür gehen, um nach Maurice Ausschau zu halten.
»Du bist ja so außer dir, hast du etwas angestellt?«, fragte die Mutter.
»Nein«, antwortete Nura.
»Komm her«, sagte die Mutter, »ich werde alles von deiner Stirn ablesen.« Nura bekam fürchterliche Angst, und die Mutter las und las und dann sagte sie: »Du kannst gehen, du hast nichts Schlimmes getan.«
Jahrelang glaubte Nura, dass ihre Mutter ihr die Untaten von der Stirn ablesen könne, deshalb schaute sie nach jeder Begegnung mit dem dicklichen Jungen in den Spiegel, um zu sehen, ob irgendetwas auf der Stirn zu sehen war. Sie schrubbte sie sicherheitshalber mit Olivenkernseife und wusch sie danach gründlich ab.
Überhaupt war ihre Mutter sonderbar. Sie schien sich für die ganze Welt verantwortlich zu fühlen. Einmal nahm ihr Vater Nura und die Mutter zu einem Fest mit, bei dem Derwische tanzten, und selten fühlte sich Nura so leicht wie an jenem Abend. Auch ihr Vater schien zu schweben vor Glückseligkeit. Der eine Derwisch tanzte mit geschlossenen Augen und die anderen kreisten um ihn wie Planeten um die Sonne. Ihre Mutter aber sah nur, dass sein Kleid an mehreren Stellen schmutzig war.
An religiösen Festen schmückten ihre Eltern und die Muslime der ganzen Straße ihre Häuser und Geschäfte mit bunten Tüchern. Teppiche hingen aus den Fenstern und von Balkonen, Blumentöpfe wurden vor die Hauseingänge gestellt. Prozessionen zogen singend und tanzend durch die Straßen. Manche zeigten Schwert- und Bambusrohrkämpfe, andere veranstalteten ein Feuerwerk und aus den Fenstern regnete es Rosenwasser auf die Passanten.
Die Christen feierten leise, ohne bunte Fahnen und ohne Umzüge. Diesen Unterschied hatte Nura sehr früh bemerkt. Nur die Kirchenglocken schlugen an jenen Tagen etwas lauter. Man sah die Christen in festlichen Kleidern, aber es gab weder einen Jahrmarkt noch ein Riesenrad oder bunte Fahnen.
Auch kamen die christlichen Feiertage immer zur gleichen Jahreszeit. Weihnachten Ende Dezember und Ostern im Frühjahr und Pfingsten im Frühsommer. Der Ramadan aber wanderte durch das ganze Jahr. Und wenn er im Hochsommer kam, war es kaum auszuhalten. Sie musste von morgens bis abends ohne ein Stück Brot, ohne einen Schluck Wasser ausharren und das bei vierzig Grad im Schatten. Maurice hatte Mitleid mit ihr. Er flüsterte ihr zu, auch er faste heimlich, damit er sich genauso elend fühle wie sie.
Sie vergaß nie den Tag, als Maurice ihr zuliebe eine kleine Verwirrung auslöste. Sie war bereits vierzehn und der Ramadan war in jenem Jahr im August. Sie fastete und litt. Plötzlich hörten die Nachbarn deutlich die Muezzinrufe und stürzten sich auf das Essen. Nur ihre Mutter sagte: »Das kann doch nicht stimmen! Dein Vater ist noch nicht zu Hause und die Kanone wurde noch nicht abgefeuert.«
Eine halbe Stunde später hörte man dann die Rufe der Muezzins über den Dächern und ein Kanonenschuss erschütterte die Luft. Ihr Vater, der bald darauf hereinkam, erzählte, die Leute hätten wegen eines falschen Muezzins das Fasten zu früh gebrochen. Nura wusste sofort, wer dahintersteckte. Eine Stunde später klopften zwei Polizisten bei der christlichen Familie, es gab Geschrei und Tränen.
Von allen Festen und Feiertagen mochte Nura den siebenundzwanzigsten Tag des Ramadan am liebsten. An diesem Tag öffne sich der Himmel und Gott höre für kurze Zeit die Wünsche der Menschen, sagte ihr Vater. Seit sie denken konnte, war sie jedes Jahr schon Tage vorher unruhig, sie überlegte und überlegte, was sie sich von Gott wünschen solle.
Nie hatte er ihr auch nur einen einzigen Wunsch erfüllt.
Gott schien sie nicht zu mögen. Doch der dicke Maurice erklärte ihr, Gott möge mit Sicherheit schöne Mädchen, er könne aber ihre Stimme nicht hören. Und Maurice wusste auch warum: »Die Erwachsenen beten in dieser Nacht so laut, dass Gott Kopfschmerzen bekommt und den Himmel schließt, noch bevor er ein einziges Kind gehört hat.«
Und in der Tat versammelte ihr Vater seine Verwandten und Freunde im Hof und bat mit ihnen zusammen Gott laut um Vergebung ihrer Sünden und Erfüllung der Wünsche nach Glück und Gesundheit. Nura blickte auf die Versammelten und wusste, dass Maurice recht hatte. Da rief sie einmal mitten im Gebet laut aus: »Aber für mich kannst du, lieber Gott, ja einen Eimer Vanilleeis mit Pistazien schicken.« Die Betenden lachten und konnten trotz wiederholter Versuche nicht weiterbeten, denn immer wieder unterbrach einer das Gebet mit schallendem Gelächter.
Nur Nuras Mutter fürchtete sich vor der Strafe Gottes. Und sie war die einzige, die am nächsten Tag Durchfall hatte. Sie jammerte, warum Gott ausgerechnet sie bestrafe, obwohl sie kaum gelacht habe. Überhaupt war die Mutter sehr abergläubisch, sie schnitt ihre Nägel nie nachts, damit die Geister sie nicht mit Alpträumen bestraften. Sie kippte kein heißes Wasser ins Waschbecken, ohne vorher den Namen Gottes laut auszurufen, damit sich die Geister, die gerne in den dunklen Wasserrohren hausen, nicht verbrühten und sie nicht bestraften.
Von nun an durfte Nura nicht mehr mitbeten. Sie musste in ihrem Zimmer bleiben und leise ihre Wünsche aussprechen. Oft lag sie nur auf dem Bett und schaute durch das Fenster zum dunklen Sternenhimmel hinauf.
Schon früh merkte sie, dass ihr Vater an den Feiertagen von einer sonderbaren Trauer heimgesucht wurde. Er, dessen Worte in der Moschee Hunderte von Männern aufrichteten und den alle Ladenbesitzer auf der Hauptstraße, wenn er vorbeiging, respektvoll begrüßten – manchmal unterbrachen sie sogar ihre Gespräche, um ihn kurz um seinen Rat zu fragen –, dieser mächtige Vater war jedes Jahr nach dem feierlichen Gebet unglücklich. Er ging gebeugt zum Sofa, kauerte sich hin und schluchzte wie ein Kind. Nie erfuhr Nura den Grund.
2.
Nachdem Salman in einer kalten Februarnacht des Jahres 1937 unsanft auf die Welt gekommen war, folgte ihm das Unglück lange Jahre treuer als sein Schatten. Damals hatte es die Hebamme Halime eilig gehabt. Faise, die quirlige Frau des Verkehrspolizisten Kamil, hatte sie wegen ihrer Freundin Mariam in der Nacht geweckt, und so kam sie schlecht gelaunt in die kleine Wohnung, und statt der zwanzigjährigen dürren Frau, Mariam, auf der schmutzigen Matratze bei ihrer ersten Geburt Mut zu machen, fauchte sie sie an, sie solle sich nicht so anstellen. Und dann, als wollte der Teufel seine ganze Palette an Boshaftigkeiten auffahren, kam auch noch Olga, die alte Dienerin der reichen Familie Farah. Faise, eine kräftige kleine Frau, bekreuzigte sich, weil sie sich vor Olgas bösem Blick schon immer gefürchtet hatte.
Das vornehme Anwesen der Farahs lag direkt hinter der hohen Mauer des staubigen Gnadenhofs mit seinen Elendsbehausungen.
Hier durften Gestrandete aus allen Himmelsrichtungen kostenlos wohnen. Der Hof war früher ein Teil eines gewaltigen Anwesens mit herrschaftlichem Haus und großem Garten gewesen, dazu gehörten auch ein weitläufiges Gelände mit Werkstätten, Ställen, Kornspeichern und Wohnungen für die über dreißig Bediensteten, die für ihren Herrn auf dem Acker, in den Ställen und im Haushalt gearbeitet hatten. Nach dem Tod des kinderlosen Ehepaars erbte der Neffe Mansur Farah, ein reicher Gewürzhändler, Haus und Garten, andere Verwandte wurden mit den zahlreichen Äckern und edlen Pferden noch reicher. Der Hof mit den vielen Behausungen wurde der katholischen Kirche vermacht, mit der Auflage, arme Christen darin aufzunehmen, damit, wie es im Testament pathetisch hieß, »in Damaskus nie ein Christ ohne Dach über dem Kopf schlafen muss«. Und noch bevor ein Jahr vergangen war, hatte der Gewürzhändler eine unüberwindbare Mauer aufbauen lassen, die sein Haus und seinen Garten vom übrigen Anwesen trennte, in dem sich nun arme Teufel einquartierten, bei deren Anblick der feine Herr Brechreiz bekam.
Die katholische Kirche freute sich über den großen Hof mitten im christlichen Viertel, war aber nicht bereit, auch nur einen Piaster für Reparaturen zu zahlen. So verkamen die Wohnungen immer mehr und wurden von den Bewohnern mit Blech und Lehm, Karton und Holz notdürftig repariert.
Man gab sich Mühe, das Elend mit bunten Blumentöpfen ein wenig zu retuschieren, doch die Not mit ihrem hässlichen Gesicht lugte aus allen Ecken.
Der große Hof lag zwar in der Abbaragasse, nahe dem Osttor der Altstadt, doch er blieb all die Jahre isoliert wie eine Insel der Verdammten. Und obwohl das Holztor von den armen Bewohnern Stück für Stück verheizt wurde und schließlich nur noch der offene steinerne Bogen blieb, ging kein Bewohner der Gasse freiwillig zu den Armen hinein. Sie blieben ihnen über all die Jahre fremd. Der Gnadenhof erschien wie ein kleines Dorf, das durch einen Sturm von seinem angestammten Platz am Rande der Wüste gerissen und mit seinen Bewohnern samt Staub und mageren Hunden in die Stadt geweht worden war.
Ein entfernter Cousin half Salmans Vater, ein großes Zimmer zu bekommen, als dieser auf der Suche nach Arbeit aus Chabab, einem christlichen Dorf im Süden, nach Damaskus gekommen war. Das zweite kleinere Zimmer ergatterte der Vater nach einem Faustkampf mit den Konkurrenten, die es, noch bevor die Leiche der alten Bewohnerin zum Friedhof gebracht worden war, besetzen wollten. Jeder trug seine Geschichte vor, die auf unbeholfene Art beweisen sollte, dass es der einzige Wunsch der Verstorbenen gewesen sei, ihm, dem jeweiligen Erzähler, die Wohnung zu überlassen, damit ihre Seele Ruhe habe. Manche machten die Tote zu einer entfernten Tante, andere behaupteten, sie schulde ihnen Geld, aber man sah es den Händen dieser Lügner an, dass sie nie zu Geld gekommen waren. Als alle Geschichten von ihren Zuhörern als Lügen entlarvt worden waren und die heiseren Stimmen immer lauter wurden, entschieden die Fäuste – und da war Salmans Vater unbesiegbar. Er schickte alle Konkurrenten erst zu Boden und dann mit leeren Händen zu ihren Frauen.
»Und dann hat dein Vater die Mauer zwischen beiden Zimmern mit einer Tür durchbrochen und schon hattet ihr eine Zweizimmerwohnung«, erzählte Sarah Jahre später. Faises Tochter wusste über alles Bescheid, deshalb wurde sie von allen »Sarah die Allwissende« genannt. Sie war drei Jahre älter und einen Kopf größer als Salman.
Sie war außerordentlich klug und konnte noch dazu am schönsten von allen Kindern tanzen. Das hatte Salman durch Zufall erfahren. Er war acht oder neun und wollte sie zum Spielen abholen, da sah er sie in ihrer Wohnung tanzen. Er stand regungslos in der offenen Tür und schaute ihr zu, wie sie ganz in sich versunken war.
Als sie ihn entdeckte, lächelte sie verlegen. Später dann tanzte sie für ihn, wenn er traurig war.
Eines Tages schlenderten Salman und Sarah zur großen Geraden Straße, wo Sarah für ihre fünf Piaster ein Eis am Stiel kaufte. Sie ließ ihn immer wieder daran lecken unter der Bedingung, dass er kein Stück abbiss.
Sie standen am Eingang ihrer Gasse, leckten am Eis und beobachteten die Kutschen, Lastenträger, Pferde, Esel, Bettler und fliegenden Händler, die die lange Gerade Straße zu dieser Stunde bevölkerten. Als vom Eis nur noch der gefärbte Holzstil und die roten Zungen in ihren kühlen Mündern übrig waren, wollten sie nach Hause gehen. Da versperrte ein großer Junge ihnen den Weg: »Ich kriege einen Kuss von dir«, sagte er zu Sarah. Er beachtete Salman nicht.
»Iiiiih«, rief Sarah angeekelt.
»Du kriegst nichts«, rief Salman und sprang zwischen Sarah und den Koloss.
»Ach, Mücke, mach mal Platz, sonst zerdrücke ich dich«, sagte der Junge, schob Salman zur Seite und packte Sarah am Arm, aber Salman sprang ihm auf den Rücken und biss ihn in die rechte Schulter. Der Junge schrie auf und schleuderte Salman gegen die Mauer, und auch Sarah schrie so laut, dass die Passanten aufmerksam wurden und der Kerl in der Menge verschwinden musste.
Salman blutete am Hinterkopf. Man brachte ihn schnell zum Apotheker Josef an der Kischle-Kreuzung, der die Augen verdrehte und ihm den Kopf verband, ohne dafür Geld zu verlangen.
Es war nur eine kleine Platzwunde, und als Salman aus der Apotheke herauskam, schaute Sarah ihn verliebt an. Sie nahm ihn an der Hand und ging mit ihm zusammen nach Hause.
»Morgen darfst du abbeißen«, sagte sie beim Abschied. Er hätte es zwar lieber gehabt, wenn Sarah einmal nur für ihn allein tanzen würde, aber er war viel zu schüchtern, um so etwas über die Lippen zu bringen.
Nun zurück zu jener schwierigen Geburtsstunde und zur alten Dienerin Olga, die wie vom Teufel bestellt erschienen war. Sie war in Schlafrock und Hausschuhen herbeigeeilt und hatte die Hebamme angefleht, zu ihrer Herrin zu kommen, da die Fruchtblase bereits geplatzt sei. Die Hebamme, eine hübsche Frau, an deren frischer Erscheinung die vierzig Jahre ihres Lebens spurlos vorübergegangen waren, betreute seit Monaten die sensible und immer ein wenig kränkelnde Ehefrau des reichen Gewürzhändlers und bekam für jeden Besuch so viel Geld, wie zehn arme Familien nicht zahlen konnten. Und im gefährlichsten Augenblick wolle sie ihre Herrin wohl im Stich lassen, knurrte Olga unverschämt laut, drehte sich um und schlurfte, über das undankbare Gesindel schimpfend, davon. Faise schickte der alten Frau zwei Zaubersprüche hinterher, die die Pechspuren hinter gewissen Personen reinigen sollten.
Als hätten die Worte der alten Dienerin mehr Wirkung als alle Gebete, wurde die Hebamme nun vollends zornig. Ihr so früh unterbrochener Schlaf und die beiden Geburten, die gleichzeitig eingesetzt hatten, verschlechterten ihre Laune. Und außerdem hasste sie es, im Gnadenhof zu arbeiten.
Olgas Mann Viktor, der Gärtner der Familie Farah, hatte der Hebamme dagegen bei jedem Besuch eine Tasche voller Gemüse und Obst geschenkt. Alles wuchs und gedieh im großen Garten der reichen Farahs. Aber die Herrschaften waren vernarrt in Fleisch und nahmen Süßigkeiten, Gemüse und Obst nur aus Höflichkeit den Gästen gegenüber zu sich.
Es wurde gemunkelt, dass der sonnengebräunte, drahtige Gärtner ein Verhältnis mit der früh verwitweten Hebamme habe. Man sah ihm seine sechzig Jahre nicht an, seine Frau Olga dagegen war durch Müdigkeit um Jahre gealtert und suchte abends das Bett nur zum Schlafen auf. Im Garten gab es einen kleinen Pavillon für exotische Pflanzen, von dem eine direkte Tür zur Straße führte, und dort empfing der Gärtner seine vielen Geliebten. Angeblich verabreichte er ihnen die Frucht einer brasilianischen Pflanze, die sie wild machte. Die Hebamme aber liebte den Gärtner, weil er der einzige war, der sie zum Lachen bringen konnte.
An jenem kalten Morgen, als sie merkte, dass es bei der jungen Frau noch länger dauern würde, verließ sie die kleine Wohnung wieder, um zu den Farahs zu gehen. Am Tor des Gnadenhofs versuchte Nachbarin Faise sie aufzuhalten. »Mariam hat sieben Leben wie die Katzen und stirbt nicht so leicht«, sagte die Hebamme, als wollte sie ihre Gewissensbisse beruhigen, denn die Frau auf der Matratze sah elend aus wie alles, was sie umgab.
Faise ließ die Hebamme los, band ihre langen schwarzen Haare zu einem Pferdeschwanz und folgte ihr mit den Augen, bis diese nach rechts in Richtung Buloskapelle einbog. Das erste Haus rechts war das der Farahs.
Der Morgen graute schon, aber die staubigen Straßenlaternen der Abbaragasse leuchteten noch. Faise atmete die frische Brise ein und ging zu ihrer Freundin Mariam zurück.
Die Geburt war schwer.
Als die Hebamme gegen acht Uhr vorbeischaute, war Salman bereits in alte Tücher gewickelt. Die Hebamme lallte und roch stark nach Schnaps. Sie berichtete fröhlich vom neugeborenen, hübschen Baby der Farahs, einem Mädchen, warf einen Blick auf Salman und seine Mutter und krächzte Faise ins Ohr: »Katzen sterben nicht so leicht.« Und dann torkelte sie davon.
Am nächsten Tag bekamen alle Bewohner der Abbaragasse eine kleine Porzellanschale mit rosa gefärbten Zuckermandeln. Und von Mund zu Mund wanderten kurze Gebete und Glückwünsche für die neugeborene Tochter der Familie Farah: Viktoria. Der Name soll übrigens ein Vorschlag der Hebamme gewesen sein, nachdem sich das Ehepaar nicht einigen konnte. Auch Jahre später nannte man das Mädchen noch »Viktoria Zuckermandel«. Zur Geburt ihrer Brüder Georg und Edward verteilte der Vater keine Mandeln mehr. Angeblich, weil man in der Gasse über ein Verhältnis seiner Frau mit seinem jüngsten Bruder gelästert hatte. Den bösen Zungen war der Umstand Anlass, dass beide Jungen dem Onkel, einem verwegenen Goldschmied, bereits bei der Geburt sehr ähnelten und genau wie dieser schielten.
Das aber geschah später.
Als Salman zur Welt kam, starb seine Mutter nicht, aber sie wurde krank, und als sie sich nach Wochen vom Fieber erholte, fürchtete man, dass sie ihren Verstand verloren hatte. Sie jaulte wie eine Hündin, lachte und weinte in einem fort. Nur wenn ihr Kind in ihrer Nähe war, wurde sie ruhig und sanft und hörte auf zu wimmern. »Salman, Salman, er ist Salman«, rief sie und meinte damit, der Junge sei gesund, und bald nannten alle das Baby Salman.
Der Vater, ein armer Schlossergeselle, hasste Salman und beschuldigte ihn, seine Mariam durch die ungesegnete Geburt in den Wahn getrieben zu haben. Und irgendwann begann er zu trinken. Der billige Arrak machte ihn böse, anders als Faises Mann Kamil, den Polizisten, der jede Nacht mit grässlicher Stimme, aber vergnügt sang, wenn er betrunken war. Er behauptete, mit jedem Glas Arrak verliere er ein Kilo Schüchternheit, so dass er sich nach einigen Gläsern leicht und unbekümmert wie eine Nachtigall fühle.
Seine Frau Faise freute sich über seinen Gesang, der zwar falsch, aber von feuriger Leidenschaft getragen war, und manchmal sang sie sogar mit. Salman fand es immer sonderbar, das Duo singen zu hören. Es war so, als ob Engel Schweine hüten und mit ihnen gemeinsam singen würden.
Auch der jüdische Gemüsehändler Schimon trank viel. Er sagte, er sei eigentlich kein Trinker, sondern ein Nachfahre des Sisyphus. Er könne den Anblick eines vollen Weinglases nicht ertragen. So trank er und trank, und wenn das Glas leer war, machte ihn der Anblick der Leere melancholisch. Schimon wohnte im ersten Haus rechts vom Gnadenhof, dort wo die Abbaragasse in die Judengasse mündete. Von seiner Terrasse im ersten Stock konnte er direkt in Salmans Wohnung sehen.
Schimon trank jede Nacht bis zur Bewusstlosigkeit, lachte in einem fort und erzählte dreckige Witze, während er in nüchternem Zustand mürrisch und einsilbig war. Man sagte, Schimon bete den ganzen Tag, weil ihn wegen seiner nächtlichen Eskapaden das Gewissen plage.
Salmans Vater verwandelte der Arrak in ein Tier, das nicht aufhörte, ihn und seine Mutter zu verfluchen und zu schlagen, bis einer der Nachbarn auf den wutschnaubenden Mann einredete, der plötzlich mitten im Toben einhielt und sich ins Bett führen ließ.
So lernte Salman früh, die heilige Maria anzuflehen, dass einer der Nachbarn ihn hören und schnell kommen möge. Alle anderen Heiligen, sagte Sarah, taugten nichts, wenn man sie brauchte.
Sie war wie er spindeldürr, hatte aber das schöne Gesicht ihres Vaters und die Tatkraft und die scharfe Zunge ihrer Mutter geerbt. Und solange Salman denken konnte, trug Sarah immer, auch später als erwachsene Frau, die Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, was ihre schönen kleinen Ohren freilegte, um die Salman sie beneidete. Vor allem aber las Sarah Bücher, wann immer sie die Zeit fand, und Salman lernte früh, Respekt vor ihrem Wissen zu haben.
Einmal hatte er sie samt der heiligen Maria ausgelacht, und augenblicklich war der Maikäfer, den er an einem Faden in die Höhe fliegen ließ, ausgerissen. Der Faden, an dessen Ende ein kleines lebloses Beinchen hing, fiel zu Boden. Sarahs Käfer dagegen flog munter so lange und so weit er wollte am Ende seines dünnen Fadens, und das knochige Mädchen flüsterte der heiligen Maria zu, die Beine des Tieres zu schützen. Sie holte den Käfer sooft sie wollte vom Himmel, fütterte ihn mit frischen Maulbeerblättern und steckte ihn in eine Streichholzschachtel, dann marschierte sie erhobenen Hauptes in ihre Wohnung, die von Salmans nur durch einen Holzschuppen getrennt war.
Sarah war es auch, die ihm als erste von den Männern erzählte, die Samira besuchten, wenn ihr Mann, der Tankwart Jusuf, nicht zu Hause war. Sie wohnte am anderen Ende des Gnadenhofs zwischen dem Bäckergesellen Barakat und dem Hühnerstall.
Als er Sarah fragte, warum die Männer zu Samira und nicht zu ihrem Mann kommen, lachte sie. »Dummkopf«, sagte sie, »weil sie einen Schlitz hat da unten, und die Männer haben eine Nadel, und sie nähen ihr das Loch zu, und dann geht der Schlitz wieder auf und dann kommt der nächste Mann.«
»Und ihr Mann Jusuf, warum näht er ihr den Schlitz nicht selber zu?«
»Er hat nicht genug Garn«, sagte Sarah.
Sie erklärte Salman auch, warum sein Vater immer wild wurde, wenn er trank. Es war an einem Sonntag, und als der Vater genug getobt hatte und endlich von Schimon und den anderen Männern ins Bett gebracht worden war, setzte sich Sarah zu Salman. Sie streichelte ihm die Hand, bis er aufhörte zu weinen, dann putzte sie ihm die Nase.
»Dein Vater«, erzählte sie leise, »hat einen Bären im Herzen. Da drinnen wohnt er«, sie klopfte ihm auf die Brust, »und wenn er trinkt, wird das Tier wild und dein Vater ist nur noch seine Hülle.«
»Seine Hülle?«
»Ja, seine Hülle, wie wenn du ein Bettlaken über dich wirfst und dann herumtanzt und singst. Man sieht das Bettlaken, aber das ist nur die Hülle, und du bist derjenige, der tanzt und singt.«
»Und was hat dein Vater in seinem Herzen?«
»Einen Raben hat er, aber dieser Rabe hält sich für eine Nachtigall, deshalb singt er dann so fürchterlich. Schimon hat einen Affen, deshalb wird er nur dann lustig, wenn er genug getrunken hat.«
»Und ich, was habe ich?«
Sarah legte ihr Ohr an seine Brust. »Einen Spatz höre ich. Er pickt vorsichtig und hat immer Angst.«
»Und du? Was hast du?«
»Einen Schutzengel für einen kleinen Jungen. Dreimal darfst du raten, wer das ist«, sagte sie und rannte davon, weil ihre Mutter nach ihr rief.
Abends, als er sich zu seiner Mutter legte, erzählte er ihr vom Bären. Die Mutter staunte nicht wenig. Sie nickte. »Er ist ein gefährlicher Bär, geh ihm aus dem Weg, mein Junge«, sagte sie und schlief ein.
Seine Mutter erholte sich von ihrer Krankheit erst zwei Jahre nach Salmans Geburt, aber sein Vater trank trotzdem immer weiter. Die Frauen aus der Umgebung wagten nicht, ihm nahe zu kommen. Weil der Vater stark wie ein Stier war, konnten nur Männer ihn beruhigen. In der Zwischenzeit versuchte Salman Mutters Kopf mit seinem Leib zu schützen. Vergebens. Wenn sein Vater in Rage war, schleuderte er seinen Sohn in die Ecke und schlug wie besinnungslos auf die Mutter ein.
Seit Salman die heilige Maria anflehte, kam immer gleich jemand gelaufen. Das hatte aber damit zu tun, dass Salman aus Leibeskräften schrie, wenn der Vater auch nur den Arm hob. Sarah erzählte, dass es bei ihnen wegen des Geschreis einen Kurzschluss gegeben habe.
Die Mutter war Salman für sein Gebrüll dankbar, denn sobald ihr betrunkener Ehemann durch das Tor schwankte, flüsterte sie: »Sing, mein Vogel, sing«, und Salman begann so zu schreien, dass der Vater sich manchmal nicht in die Wohnung traute. Salman erinnerte sich noch Jahre später daran, wie glücklich seine Mutter war, einmal einen Tag ohne Schläge zu verbringen. Sie schaute Salman dann mit fröhlichen, runden Augen an, küsste und streichelte ihm das Gesicht und legte sich in ihrer Ecke auf der schäbigen Matratze schlafen.
Manchmal hörte Salman seinen Vater in der Nacht kommen und die Mutter in das andere Zimmer tragen, als wäre sie ein kleines Mädchen, und dann hörte er, wie sich sein Vater bei seiner Mutter für seine Dummheiten entschuldigte und verlegen lachte. Seine Mutter jaulte dann leise und fröhlich wie eine zufriedene Hündin.
Seit Salman denken konnte, durchlebten er und seine Mutter fast täglich diese Wechselbäder, bis zu jenem Sonntag im Frühjahr, an dem sich der Vater nach dem Kirchgang im Weinlokal an der nächsten Ecke betrank und bereits am frühen Nachmittag auf die Mutter eindrosch. Nachbar Schimon kam zu Hilfe, beruhigte den Vater und brachte ihn schließlich ins Bett.
Schimon trat leise in das kleinere Zimmer und lehnte sich erschöpft an die Wand. »Weißt du, dass das Haus des verstorbenen Webers nahe der Buloskapelle seit einem halben Jahr leersteht?«, fragte er. Die Mutter wusste es wie alle Nachbarinnen auch.
»Natürlich«, stammelte sie.
»Worauf wartest du noch?«, fragte der Gemüsehändler und ging, noch bevor er die Fragen hören musste, die Salmans Mutter auf dem Herzen hatte.
»Lass uns gehen, bevor er zu sich kommt«, drängte Salman, ohne zu wissen, wohin.
Die Mutter schaute um sich, stand auf, ging im Zimmer hin und her, warf einen sorgenvollen Blick auf Salman und sagte mit Tränen in den Augen: »Komm, wir gehen.«
Draußen fegte ein eiskalter Wind über den Gnadenhof, und dunkelgraue Wolken hingen tief über der Stadt. Die Mutter zog Salman zwei Pullover übereinander an und warf sich einen alten Mantel über die Schultern. Die Nachbarn Marun und Barakat reparierten gerade eine Dachrinne. Sie schauten ihr kurz nach, ohne etwas zu ahnen, aber Samira, die am anderen Ende des Hofes wohnte und an diesem Tag mit Kochen, Waschen und Radiohören beschäftigt war, hatte eine Ahnung.
»Meine Schulhefte«, rief Salman besorgt, als sie das Tor erreichten. Die Mutter schien nicht zu hören, stumm zog sie ihn an der Hand mit sich davon.
Die Gasse war fast leer an diesem kalten Nachmittag, so dass sie das kleine Haus schnell erreichten. Die Mutter drückte die angelehnte Tür auf. Dunkelheit und modrige, feuchte Luft strömten ihnen entgegen.
Er spürte die Angst seiner Mutter, da ihr fester Griff seine Hand schmerzte. Ein merkwürdiges Haus war das. Die Tür führte über einen langen, dunklen Korridor zu einem winzigen Innenhof unter freiem Himmel. Im Erdgeschoss waren die Räume zerstört. Fenster und Türen waren herausgerissen.
Eine dunkle Treppe führte in den ersten Stock, der einem Weber bis zu seinem Tod als Wohnung gedient hatte.
Vorsichtig folgte Salman seiner Mutter.
Das Zimmer war groß, aber schäbig, überall lagen Unrat und zerschlagene Möbelstücke, Zeitungen und Essensreste.
Sie setzte sich auf den Boden und lehnte sich an die Wand unter dem Fenster, das durch eine Rußschicht, durch Staub und Spinnweben blind geworden war und nur schwaches, graues Licht hereinließ. Sie begann zu weinen. Sie weinte und weinte, so dass der Raum noch feuchter zu werden schien.
»Als Mädchen habe ich immer geträumt ... «, begann sie, aber als hätte die Enttäuschung in diesem heruntergekommenen Raum auch noch das letzte Wort in ihrem Mund ertränkt, schwieg sie und weinte stumm vor sich hin.
»Wo bin ich gelandet? Ich wollte doch ... «, unternahm sie erneut einen Versuch, doch auch dieser Gedanke erstarb auf ihrer Zunge. In der Ferne rollte der Donner seine schweren Steine über ein Blechdach. Ein flüchtiger Sonnenstrahl suchte seinen Weg durch einen Spalt zwischen den Häusern, gerade bevor die Sonne unterging. Doch als würde ihm das Elend keinen Platz lassen, verschwand er sofort wieder.
Seine Mutter umarmte ihre Knie, legte den Kopf darauf und lächelte ihn an. »Ich bin doch dumm, nicht wahr? Ich sollte mit dir lachen, dir die Angst ... stattdessen weine ich ... «
Draußen stürmte der Wind und schlug eine lose Dachrinne gegen die Mauer. Und dann begann es auch noch zu regnen.
Er wollte sie fragen, ob er ihr irgendwie helfen könne, aber sie weinte schon wieder, nachdem sie kurz die Hand ausgestreckt und ihm über die Haare gestreichelt hatte.
Auf einer Matratze, die nach ranzigem Öl roch, war er bald eingeschlafen. Als er aufwachte, war es vollkommen dunkel und draußen regnete es heftig. »Mama«, flüsterte er ängstlich, da er dachte, sie sitze weit von ihm entfernt.
»Ich bin da, hab keine Angst«, flüsterte sie unter Tränen.
Er setzte sich auf, legte ihren Kopf auf seinen Schoß. Mit leiser Stimme sang er ihr die Lieder vor, die er von ihr gehört hatte.
Er hatte Hunger, wagte aber nichts zu sagen, weil er Sorge hatte, dass sie vollends verzweifeln würde. Sein Leben lang vergaß Salman diesen Hunger nicht, und immer wenn er etwas als »gewaltig lang« bezeichnen wollte, sagte er: »Das ist länger als ein Hungertag.«
»Morgen putze ich das Fenster«, sagte die Mutter auf einmal und lachte. Er verstand nicht.
»Gibt es hier keine Kerze?«, fragte er.
»Ja, daran müssen wir auch denken, also ... «, sagte sie, als wäre ihr plötzlich etwas eingefallen. »Hast du ein gutes Gedächtnis?«
Er nickte in der Dunkelheit, und als hätte sie es gesehen, fuhr sie fort: »Dann spielen wir: ›Morgen bringen wir alte Lappen‹.«
Er war dran. »Wir bringen alte Lappen und zwei Kerzen.«
»Wir bringen Lappen, Kerzen und eine Streichholzschachtel«, fügte sie hinzu. Und als er spät in der Nacht in ihren Armen lag und vor Müdigkeit die Augen nicht mehr offenhalten konnte, lachte sie und rief: »Und wenn wir all das mitbringen wollten, bräuchten wir einen Lastwagen.«
Der Regen klopfte gleichmäßig an die Fensterscheiben, und Salman drückte sich fest an seine Mutter. Sie roch nach Zwiebeln. Sie hatte dem Vater an jenem Tag Zwiebelsuppe gekocht.
So tief hatte er seit langem nicht geschlafen.
3.
Nuras Mutter, die ihren Mann bisweilen wie einen unsicheren, tollpatschigen Jungen behandelte, zitterte vor ihm, wenn es um Nura ging. Sie schien dann mehr Angst vor ihrem Mann zu haben als ihre kleine Tochter. Nichts entschied sie ohne den Zusatz, »aber erst, wenn dein Vater zustimmt«. Würde der Vater nicht eingeweiht, ginge alles schief.
So auch an jenem Tag, an dem Nura zum letzten Mal Onkel Farid, den Halbbruder ihrer Mutter, begleitete. Er war ein schöner Mann. Erst Jahre später sollte Nura erfahren, dass Onkel Farid in jenen Tagen bereits bettelarm war, was man ihm aber nicht ansah. Die drei Textilgeschäfte, die ihm sein Vater überlassen hatte, waren innerhalb kurzer Zeit Bankrott gegangen. Farid gab dem Vater die Schuld, der sich dauernd einmische und mit seinen altmodischen Ideen jeden Erfolg verhindere.
Sein Vater, der große Mahaini, enterbte ihn daraufhin. Aber nicht einmal das konnte dem Lebemann die Laune verderben.
Da er in den besten Schulen gelernt hatte, eine begnadete Sprache und eine schöne Schrift beherrschte, übte er den seltsamen Beruf des Ardhalgi, des Antragsschreibers, aus. Im Damaskus der fünfziger Jahre konnten mehr als die Hälfte der Erwachsenen weder lesen noch schreiben. Der moderne Staat aber bestand auf geordneten Verhältnissen und deshalb verlangten seine Bürokraten jede auch noch so geringe Anfrage in schriftlicher Form. Diesen schriftlichen Antrag konnten sie dann verbindlich bearbeiten und mit einer Menge Staatsmarken und Stempeln versehen dem Bürger zurückgeben. Damit hoffte der Staat, so etwas wie Ansehen bei der Bevölkerung hervorzurufen, deren beduinische Wurzeln sie immer zu Anarchie und Respektlosigkeit gegenüber allen Gesetzen verführten.
Die Anträge, Petitionen und Gesuche wucherten derart, dass man in Damaskus darüber witzelte: »Wenn dein Nachbar ein Beamter ist, solltest du ihn nicht grüßen, sondern ihm besser einen gestempelten Antrag auf einen Gruß übergeben. Dann bekommst du vielleicht eine Antwort.«
Man sagte aber auch, Bürokratie sei notwendig, damit die Staatsbeamten produktiver und moderner arbeiten könnten. Würde man den redseligen Syrern mündliche Bitten und Anfragen erlauben, wüchse sich jeder Antrag zu einer unendlichen Geschichte mit verschachtelten Arabesken und Fortsetzungen aus. Die Beamten wären zu keiner vernünftigen Arbeit mehr gekommen. Zudem würden Staatsmarken schlecht auf gesprochenen Worten kleben.
Und so saßen die Schreiber am Eingang der Behörden unter ihren verblichenen Sonnenschirmen an winzigen Schreibtischen und schrieben Anfragen, Einsprüche, Anträge, Bitten und andere Schriften. Da die Polizei pro Schreiber nur einen Stuhl und einen Tisch genehmigte, blieben die Kunden stehen. Sie sagten dem Schreiber, worum es ungefähr ging, und der legte sofort los. Damals schrieb man alles mit der Hand, und der Ardhalgi schrieb mit ausladenden Handbewegungen, um den Aufwand deutlich zu machen, der ihm gerade dieser Antrag abnötigte.
Je besser das Gedächtnis eines Schreibers war, desto flexibler war er, denn die Anträge bei Gericht sahen anders aus als die beim Finanzministerium und die wiederum anders als beim Einwohnermeldeamt. Manch ein Schreiber hatte mehr als fünfzig Versionen im Kopf parat und konnte mit Klapptisch und Stuhl je nach Saison und Tag zwischen den Eingängen der verschiedenen Behörden pendeln.
Onkel Farid saß immer unter einem schönen roten Schirm vor dem Familiengericht. Er war eleganter als alle seine Kollegen und hatte deshalb immer viel zu tun. Die Leute dachten, er hätte ein besseres Verhältnis zu den Richtern und Anwälten, und Onkel Farid bestärkte sie in ihrem Glauben.
Die Ardhalgis schrieben nicht nur, sie berieten die Kunden auch, wohin sie mit dem Antrag am besten gehen sollten und wie viel er an Staatsmarken kosten dürfe. Sie trösteten die Verzweifelten und stärkten die Protestierer, ermunterten die Schüchternen und bremsten die Optimisten, die meist übertriebene Vorstellungen von der Wirkung ihrer Anträge hatten.
Onkel Farid hätte, wenn er nicht zu faul gewesen wäre, ein großes Buch mit Geschichten, Tragödien und Komödien füllen können, die er – während er schrieb – von den Klienten gehört hatte, die aber niemals in einem Antrag Platz fanden.
Nicht nur Anträge schrieb Onkel Farid. Auch Briefe aller Art. Am häufigsten aber schrieb er an Emigranten. Man musste ihm nur den Namen des Emigranten und das Land, wo er arbeitete, mitteilen, und schon hatte er einen langen Brief im Kopf. Es waren, wie Nura später erfuhr, nichtssagende Briefe, deren Inhalt sich in einer Zeile zusammenfassen ließ. Im Falle der Emigranten hieß es häufig einfach: Schicke uns Geld, bitte. Diese eine Zeile war allerdings versteckt in wortreichen Lobeshymnen, in übertriebenen Sehnsuchtsbezeugungen, in Treueversprechen und einem Schwur auf Vaterland und Muttermilch. Alles, was die Tränendrüsen betätigte, war ihm recht. Die wenigen Briefe, die Nura später lesen durfte, wirkten auf sie jedoch nur lächerlich. Zu seinen Lebzeiten sprach Onkel Farid nie über seine Briefe, sie waren ein intimes Geheimnis.
Wer etwas mehr Geld hatte, bestellte Onkel Farid zu sich nach Hause und diktierte ihm in aller Ruhe, was zu schreiben oder zu beantragen war. Das war natürlich teurer, aber diese Briefe waren dafür bestens komponiert.
Die noch reicheren Damaszener gingen nicht zu einem Ardhalgi, sondern zu den Kalligraphen, die schöne, mit Kalligraphien umrandete Briefe schrieben und meist über eine Bibliothek verfügten, deren Weisheiten und erstklassig passende Zitate sie dem Kunden anbieten konnten. Solche Briefe waren Unikate im Gegensatz zu jenen der Straßenschreiber, die Fließbandware lieferten.
Die Kalligraphen machten aus dem einfachen Akt des Briefschreibens einen Kult voller Geheimnisse. Briefe an Ehemänner oder Ehefrauen schrieben sie mit einer kupfernen Feder, für Briefe an Freunde und Geliebte nahmen sie eine silberne, an besonders wichtige Personen eine goldene, an Verlobte eine aus dem Schnabel eines Storches und an Gegner und Feinde eine aus einem Granatapfelzweig geschnitzte Feder.
Onkel Farid liebte Nuras Mutter, seine Halbschwester, er besuchte sie – bis zu seinem Tod durch einen Autounfall zwei Jahre nach Nuras Hochzeit – sooft er konnte.
Erst später sollte Nura erfahren, dass die Abneigung gegen den eigenen Vater, den alten Mahaini, die verbindende Brücke zwischen ihrer Mutter und ihrem Onkel bildete.
Nura mochte den Onkel, weil er viel lachte und sehr großzügig war, aber das durfte sie ihrem Vater nicht verraten. Vater nannte den Onkel eine »lackierte Trommel«. Seine Briefe und Anträge seien wie er, bunt, laut und leer.
Eines Tages kam Onkel Farid am Vormittag zu Besuch. Er war nicht nur immer elegant gekleidet, er trug darüber hinaus auch stets rote Schuhe aus feinem, dünnem Leder, die beim Gehen geräuschvoll musizierten. Das war damals sehr beliebt, weil nur edle Schuhe quietschten. Und als Nura die Tür aufmachte, sah sie einen großen weißen Esel, den der Onkel an einem Ring neben der Haustür angebunden hatte.