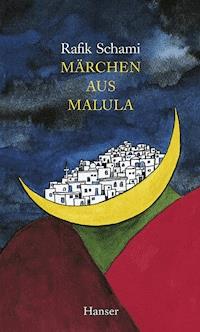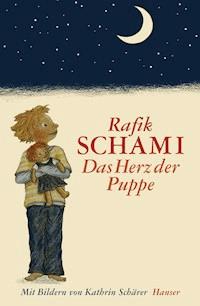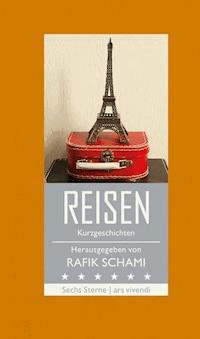Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KGHörbuch-Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn er erzählt, erblüht die Wüste – der neue Roman von „Meistererzähler Rafik Schami“. Denis Scheck
In einem arabischen Land herrscht im 19. Jahrhundert der weise König Salih. Als die Königin bei einem Attentat ums Leben kommt, versinkt die einzige Tochter in tiefe Melancholie. Die Thronfolgerin hat sich in einen armen Fischer verliebt, wovon ihr Vater nichts ahnt. Als Karam, der Kaffeehauserzähler, von ihrer Krankheit erfährt, beschließt er, die Prinzessin zu heilen. Allabendlich versammelt er erzählfreudige Menschen im Palast, um die junge Frau durch die schönsten Geschichten ins Leben zurückzuholen: von Mut und Feigheit, von Freundschaft und Feindschaft, von der Liebe und der Weisheit des Herzens. Eine Hommage an das Erzählen, die nicht nur Leserinnen und Leser von „Tausendundeiner Nacht“ begeistern wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Wenn er erzählt, erblüht die Wüste — der neue Roman von »Meistererzähler Rafik Schami«. Denis ScheckIn einem arabischen Land herrscht im 19. Jahrhundert der weise König Salih. Als die Königin bei einem Attentat ums Leben kommt, versinkt die einzige Tochter in tiefe Melancholie. Die Thronfolgerin hat sich in einen armen Fischer verliebt, wovon ihr Vater nichts ahnt. Als Karam, der Kaffeehauserzähler, von ihrer Krankheit erfährt, beschließt er, die Prinzessin zu heilen. Allabendlich versammelt er erzählfreudige Menschen im Palast, um die junge Frau durch die schönsten Geschichten ins Leben zurückzuholen: von Mut und Feigheit, von Freundschaft und Feindschaft, von der Liebe und der Weisheit des Herzens. Eine Hommage an das Erzählen, die nicht nur Leserinnen und Leser von »Tausendundeiner Nacht« begeistern wird.
Rafik Schami
Wenn du erzählst, erblüht die Wüste
Roman
Hanser
Für Hanne, meine Mutter, die mich mit ihrem feinen Gehör und Humor zum Erzähler machte,
und für Ibrahim, meinen Vater, der mir die Liebe
zur Stille der Bücher beigebracht hat.
Und für Root und Emil, mein erstes kritisches Publikum bei jeder Geschichte.
Das grosse Geschenk
oder wie man unverhofft zu Geschichten kommt
Mit meiner Schwester Samar verbindet mich seit der Kindheit eine innige Liebe. Ich war vier, als sie auf die Welt kam. Sie weinte laut, die Hebamme, eine Freundin meiner Mutter, wusch sie und sang ihr schöne Lieder, die das neugeborene Baby willkommen heißen sollten, aber das Baby wollte nicht aufhören zu schreien. Es war eine Hausgeburt, und ich durfte — wenn auch in gewissem Abstand vom Bett — dabei sein. Dann plötzlich drehte sich das namenlose Baby auf dem Arm der Hebamme zu mir, hörte auf zu weinen und lachte mich an. Die Hebamme war verwundert und rief mich zu sich. Auf meinen fragenden Blick, ob ich das wirklich darf, nickte meine erschöpfte Mutter und lächelte. Ich kam näher, und das Baby lachte nun laut und entblößte seinen zahnlosen Mund. Ich fand das lustig, weil es mich an den Mund meiner Großmutter mütterlicherseits erinnerte.
Ich soll den Zeigefinger auf das Baby gerichtet und gerufen haben: »Tete Samar«, Großmutter Samar, und so nannte meine Mutter das Baby Samar. Meine Eltern hatten eine Abmachung getroffen: Meine Mutter gibt den Mädchen den Namen, dafür gilt der Wunsch des Vaters bei den Jungen.
Ich wurde zum Beschützer von Samar, und sie war die Zauberin, die Spenden aus Mutters Hand lockermachte. Sie war als Kind engelhaft schön, und wenn sie so still vor der Mutter stand und sie in einer gewissen Weise anlächelte, so sprangen dabei fünf bis zehn Piaster heraus, mit anderen Worten ein Eis und manchmal sogar eine Handvoll Erdnüsse dazu. Wir genossen die Beute immer zusammen und lachten viel. Ich allein hätte kaum eine Chance gehabt, die Mutter täglich um zehn Piaster zu erleichtern. Dafür wagte niemand weit und breit, Samar auch nur ein Haar zu krümmen. Diese Sicherheit hat ihr geholfen, eine scharfe Zunge zu entwickeln.
Auch heute sind wir trotz Entfernung und fünfzig Jahren Exil unzertrennlich. Wir telefonieren in der Regel zweimal wöchentlich und lästern über die Welt. Diese besondere, innige Freundschaft hat uns nicht selten in Krisen Halt gegeben. Samar und ich haben uns nie gescheut, einander auch unsere herbsten Niederlagen und dümmsten Fehler einzugestehen und beim anderen Rat zu holen.
Mein Vater hatte zu Lebzeiten nur ein Hobby: Bücher. Er war wohlhabend und errichtete mit den Jahren eine große Bibliothek in unserem Sommerhaus in Maalula, einem christlich-aramäischen Dorf sechzig Kilometer nördlich von Damaskus. Er liebte edle Bücher, vor allem aber Erstdrucke, Handschriften und seltene Ausgaben historischer Werke.
Auf einem Regal stand ein gerahmter Spruch, von einem Kalligraphen mit schöner Schrift geschrieben. Der kleine Rahmen war mit Intarsien geschmückt. Ich konnte diesen Spruch auswendig, weil er mir bei jedem Vorbeigehen auf Augenhöhe entgegenstrahlte. Er stammte nicht von einem arabischen Gelehrten, sondern von Pierre Curie, dem Atomphysiker. Jetzt, während ich an diesem Text arbeite, fällt er mir wieder ein, ich suchte danach, und tatsächlich, er existiert. Wortwörtlich so, wie er auch hinter der Glasscheibe in jenem Rahmen stand:
»Nur dreißig Bücher aus Andalusien haben uns erreicht, und wir konnten das Atom spalten. Wenn wir nur die Hälfte der Million Bücher hätten, die alle verbrannt worden sind, würden wir heute zwischen Galaxien hin- und herreisen.«
Doch als Naturwissenschaftler zweifele ich bei aller Verehrung von Marie und Pierre Curie daran, dass er von Pierre Curie stammt. Das Atom wurde erst etwa dreißig Jahre nach seinem Tod 1906 gespalten. Dennoch hat der Spruch seine Berechtigung, denn in Spanien wurden Berge von Manuskripten und Büchern nach der Vertreibung der Araber und Juden verbrannt.
Damals sagte mir mein Vater, der Spruch von Pierre Curie gebe genau seine Meinung wieder und sei die treibende Kraft hinter seiner Bücherleidenschaft. Auch als er alt wurde, ließ sie nicht nach. Ich war inzwischen in Deutschland. Immer wieder rief er mich an und erzählte mir stolz, welche Werke er nun erworben habe. Wenn er nach Beirut, Aleppo oder Amman reiste, so suchte er immer zuerst die Antiquariate auf.
Nach dem Tod meines Vaters war die Bibliothek nur noch eine schöne Dekoration. Viele der alten Bücher waren edel gebunden, nicht selten mit Leder und Goldprägung. Doch keiner in der Familie außer mir liebt Bücher. Auch Samar nicht. Sie ist Filmfanatikerin. Nicht selten scherzte sie, sie wolle mir die Bücher in einem Container nach Deutschland schicken, als Entwicklungshilfe.
»Um Gottes Willen«, rief ich und spielte den Entsetzten, »ich habe nicht einmal Platz für meine eigenen Bücher.«
Am Sonntag, dem 9. Januar 2014, rief sie mich an. Sie erzählte mir zuerst von dem Gottesdienst, den sie gerade besucht und wen sie dort getroffen hatte. »Aber ich war wie abwesend«, sagte sie und stockte dann.
»Und? Ist etwas passiert?«, fragte ich neugierig und zugleich besorgt.
»Nein, aber ich hatte gestern Nacht einen Albtraum«, sagte sie mit brüchiger Stimme, bei der ich mir jeden witzigen Kommentar verkniff.
»Einen Albtraum?«
»Ja, dass unser Haus in Maalula brannte. Vater stand in den Flammen und las unbeeindruckt und total versunken in einem Buch. Ich wollte zu ihm rennen, doch meine Füße waren schwerer als Blei. Er schaute zu mir herüber, lächelte und begann dann seelenruhig, Buch für Buch aus den Regalen zu nehmen und durch das offene Fenster zu mir herunter auf den Hof zu werfen. Sechs Bücher habe ich gezählt, dann flog das siebte auf mich zu, das bereits brannte. Ich wachte auf und war — trotz der Kälte — schweißgebadet. Ich musste mein Nachthemd wechseln.«
Ich schwieg.
Man muss erwähnen, dass die alten Araber, Aramäer und Juden den Traum nicht als Resultat von verdrängten Kindheitserlebnissen betrachten, sondern, und das war seit dem alten Ägypten und Griechenland so, als Zukunftsdeutung, bisweilen als Orakel oder prophetische Voraussicht, und zwar bis heute. Freud hat da kaum Kundschaft.
Eine Woche später rief Samar mich wieder an. »Ich hatte wieder denselben Albtraum«, sagte sie gepresst. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte.
»Hast du vielleicht eine Möglichkeit, ich meine, kennst du jemanden, der diese seltenen Bücher aus Vaters Bibliothek würdigt und gebrauchen könnte?«, fragte sie. Das Schicksal der Bücher musste sie intensiv beschäftigen, dass sie auf einen solchen Gedanken kam.
»Ich kümmere mich darum«, sagte ich. Samar bedankte sich. »Schick mir doch ein paar, damit ich den Wissenschaftlern zeigen kann, was das für ein Schatz ist. Es reichen erst einmal fünf Bücher.«
»Sagen wir sechs«, erwiderte Samar und lachte. Ich merkte ihre Erleichterung.
Zwei Wochen später kam eine Holzkiste mit sechs Bänden und einer Schachtel meiner Lieblingssüßigkeit »Nachtigallennester«, einem Pistaziengebäck.
Ich breitete die herrlichen Bücher auf einem Extratisch in meiner Bibliothek aus. Sie rochen nach Maalula, nach Thymian und Basilikum, nach Koriander und Papier. Ich sah das helle Zimmer in unserem Haus in Maalula und das große Bücherregal, das eine ganze Wand bedeckte.
Vor mir lagen zwei Bücher mit Abhandlungen und Reden über christliche Theologie und Ethik des Kirchenlehrers Johannes Damascenus (650—754). Er war ein bekannter syrischer Theologe und Lyriker. Seine Werke der Kirchenmusik werden bis heute geschätzt. Man hat ihn »Johannes des goldenen Mundes« genannt. Außerdem hatte das Paket einen Lyrikband mit Spottgedichten, ein Buch über Astronomie und eines über Alchimie enthalten. Der sechste Band war der unauffälligste, dessen Titel mich aber sofort gefangen nahm.
Wenn du erzählst, erblüht die Wüste. Das Buch war handgeschrieben. Weder am Anfang noch am Ende stand ein Autorenname. Nur, wie es bei solchen handgeschriebenen Büchern üblich war, das Datum der Niederschrift: Ostern1890. Das ist ein deutlicher Hinweis, dass der Kopist oder Kalligraph ein Christ war. Der Autor bleibt im Dunkeln.
Ich ließ alles Übrige liegen und las den Text in einer Woche von vorn bis hinten durch. Danach beschloss ich, diesen Band für mich zu behalten. Wegen der anderen fünf kontaktierte ich Institute in Deutschland, die sich mit der arabischen Kultur beschäftigen. Doch die Reaktion war ernüchternd. Die Lager der Institute seien überfüllt und es bestehe kein Bedarf. Erst ein Telefonat mit einem holländischen Wissenschaftler an der Universität Leiden hat mir Hoffnung gemacht. Er war sehr neugierig und bat um die Zusendung der Bücher. Ich behielt das eine Buch und schickte ihm die anderen. Eine Woche später kam eine euphorische, begeisterte E-Mail. Solche Bücher gebe es selten, schrieb er, der Lyrikband habe eine Lücke in der Gedichtsammlung der Bibliothek geschlossen. Er würde die ganze Bibliothek meines Vaters adoptieren und die Transportkosten übernehmen. Die niederländische Botschaft in Damaskus habe er bereits kontaktiert, und der Kulturattaché sei sehr hilfsbereit. Meine Schwester solle die Bücher in gute Kartons einpacken, alles andere übernehme die Botschaft.
Ich bedankte mich und rief Samar sofort an. Sie war absolut begeistert, als sie auch noch erfuhr, dass das Institut den Namen unseres Vaters als Spender festhalten wolle.
»Er würde sich freuen, dass sich professionelle Liebhaber der Bücher um seinen Schatz kümmern«, sagte sie.
Doch wegen des Krieges konnte Samar lange nicht nach Maalula fahren. Der bewaffnete Kampf hatte den zivilen friedlichen Aufstand für Freiheit und Demokratie erstickt. Die Kämpfe um Damaskus waren die heftigsten.
Ich tröstete den holländischen Orientalisten und hoffte mit ihm, dass unser Sommerhaus in Maalula verschont bliebe. Leider vergeblich. Maalula wurde in Mitleidenschaft gezogen, durch seine Berge und die Nähe zur Autobahn M5, die Damaskus mit dem Norden verbindet, war der Ort für die rivalisierenden Truppen strategisch besonders interessant. Viermal wurde das Dorf erobert und zurückerobert. Dabei erlebte die Gegend erbitterte Kämpfe, bei denen viele Häuser und Kirchen beschädigt wurden. Unser Haus am Dorfplatz wurde von einer kleinen Brandrakete getroffen, die durchs Wohnzimmerfenster ins Innere gelangte und das Zimmer in Flammen setzte. Möbel und Bibliothek waren innerhalb kürzester Zeit vernichtet. Die Nachbarschaft eilte herbei, bildete eine Menschenkette und löschte den Brand.
Samar erfuhr durch ein Telefonat davon. Sie selbst konnte nichts tun. Von Damaskus aus beauftragte sie Handwerker mit der Renovierung des Wohnzimmers. Und bald glänzten die Wände wieder schneeweiß, aber von den Büchern war keine Spur geblieben.
»Ich glaube, es war eine Rakete der Islamisten, die Bücher hassen«, sagte Samar, die alle Fundamentalisten verachtet.
Ich berichtete dem holländischen Wissenschaftler von der Zerstörung der Bibliothek.
»Was für eine kulturelle Katastrophe«, schrieb er mir.
Es vergingen fünf Jahre, bis Samar unser Sommerhaus wieder betreten konnte.
Nur die genannten sechs Bücher wurden aus der Bibliothek meines Vaters gerettet. Hunderte andere fielen den Flammen zum Opfer, so wie Samar es im Traum erlebt hatte.
Ich weiß selbst nicht warum, aber im Sommer 2015 fühlte ich mich auf einmal wieder zu diesem einen, mir verbliebenen Band aus der Bibliothek hingezogen. Ich nahm ihn mit auf meine Erzähltournee, aufs Neue faszinierte er mich sehr, und so beschloss ich, das Buch nicht nur zu übersetzen, sondern auch von der Last und den Fesseln der Zeit zu befreien und für die heutige Leserschaft zugänglich zu machen.
Der anonyme Autor hat das Buch wahrscheinlich um die Jahre 1820 oder 1830 geschrieben. Die Zahlen 2 (٢) und 3 (٣) sind bei einer schlechten Handschrift kaum zu unterscheiden, zumal das Original, das der Kopist sauber abschrieb, durch die Zeit sehr gelitten hat, wie er am Ende seiner Niederschrift vermerkt. Der Autor hat unter den poetischen Titel Wenn du erzählst, erblüht die Wüste das Wort Riwaia, Roman, gesetzt. Es ist auch wahrlich ein Roman, nur nicht nach europäischem Muster. Anscheinend nahm er sich die legendäre Scheherazade zum Vorbild, um in einem Buch Perlen der arabischen Erzählkunst zu versammeln und durch eine ungewöhnliche Rahmenhandlung zu verbinden.
Fünf Jahre lang arbeitete ich an dem Buch. Eine Geschichte neu erzählen ist nichts anderes als sie neu erfinden. Die Grenzen einer Geschichte sind die ihrer Erzählerinnen und Erzähler.
Die Arbeit verlangte Geduld und Kraft, sie bereitete mir aber täglich ein besonderes Vergnügen, ging es doch darum, einen mutigen Pionier des arabischen Romans zu würdigen, der jedwede Nachahmung ablehnte und sich auf die spannende Kunst des mündlichen Erzählens verließ. Das Schönste für mich aber ist, meinem Vater damit eine Liebeserklärung zu machen, dessen Paradies in den Büchern verborgen lag.
Wo auch immer er ist, ich glaube fest daran, dass er sich über das gerettete Buch freuen würde.
Von der Hoffnung eines Königs und eines Kaffeehauserzählers
Jasmin, die Retterin
Vor nicht allzu langen Jahren lebte ein König namens Salih. Sein Land verfügte über die größten Goldminen auf der Welt. Salih heiratete Halima, die Liebe seiner Jugend, und bald freuten sie sich, weil Halima ein schönes gesundes Mädchen zur Welt brachte.
Wie das Mädchen zu seinem Namen kam, ist ungewöhnlich. Es war Sommer und sehr warm, und die Mutter lag im Bett am Fenster, um jede frische Windböe zu genießen. Da kam ihr Mann, küsste sie dankbar auf die Augen und ging zu dem kleinen Bett, in dem das Mädchen lag. Die Hebamme stand noch da und beobachtete das Baby.
»Wie soll unsere Tochter heißen?«, fragte der König und bewunderte das engelhafte Gesicht der schlafenden Tochter. In diesem Augenblick wehte eine starke, frische Brise herein und trug den Duft der Jasminsträucher zu der erleichtert tief atmenden Mutter.
»Ah, Jasmin«, flüsterte sie mit wohlig geschlossenen Augen. Sie meinte den Duft ihrer Lieblingsblüte.
»Ein schöner Name«, sagte der König. Er küsste seine Frau auf den Mund und verabschiedete sich. Vor der Tür drehte er sich noch einmal um.
»Und ein guter Name, die Kleine duftet auch nach Jasmin wie ihre Mutter«, sagte er und lachte.
Das arabische Land Sitt Hudud war klein, aber mächtig. Es verfügte wie gesagt über die größten Goldminen der Welt und grenzte an sechs Länder, sein Name bedeutete »Sechs Grenzen«. So sehr die Nachbarländer König Salih auch beneideten, bildeten sie doch keine Gefahr, denn seine Armee war stark, und die sechs Länder waren untereinander sehr zerstritten. Der König wiederholte vor seinen Freunden immer: »Der Streit meiner Feinde ist ein Teil meines Friedens.«
Jasmin wuchs heran. Ihre Eltern liebten sie und erzogen sie mit der Hilfe guter Lehrerinnen und Lehrer zu einer klugen jungen Frau. Halima wurde nach Jasmins Geburt nie wieder schwanger. Sie sehnte sich nach einem Prinzen, doch König Salih beruhigte sie, er finde Jasmin klug und auch schon mit sechzehn eine reife Persönlichkeit. »Mit ihrem Mut, den man hinter ihrer zarten Schönheit nicht erwarten würde, besiegt sie jeden Mann ihres Alters im Kampf. Das hat mir ihr Sportmeister versichert.«
Als Jasmin siebzehn wurde, besprach ihr Vater mit ihr seinen Plan, sie offiziell zur Kronprinzessin auszurufen. Jasmin bat um ein Jahr Zeit, sie wolle zuvor das Land bereisen und Menschen und Natur kennenlernen, und das wolle sie nicht als Prinzessin tun, sondern als einfache Wandersfrau, denn nur so würden die Menschen sich ihr anvertrauen und offen erzählen, wovon sie träumten und worunter sie litten. König Salih war zu Tränen gerührt. Er drückte seine Tochter zärtlich an seine Brust. »Was für eine mutige Prinzessin!«, sagte er bewundernd.
Mit ihrer zwei Jahre älteren Zofe Nura, die Jasmin wie eine Schwester liebte, machte sie sich auf den Weg.
Ein Jahr lang wanderten die zwei jungen Frauen durch das Land, und als der Geldbeutel nur noch aus Stoff und Luft bestand, verdingten sich Jasmin und Nura als Wäscherinnen, Hauslehrerinnen, Strickerinnen, Köchinnen oder Erntearbeiterinnen. Oft in Häusern und Küchen, manchmal auf den Feldern. Bei Reichen und Armen lernten sie Freude und Kummer der Menschen aus nächster Nähe kennen.
Unzählige Male gerieten sie in Gefahr, sei es auf verlassenen Wegen, in Herbergen, in feinen Häusern oder zu später Stunde an ihren Arbeitsplätzen, doch beide hatten bereits als junge Mädchen die Kunst der Selbstverteidigung erlernt, und das lähmte sogar Grobiane.
Nach einem Jahr intensiven Reisens kehrten Jasmin und Nura in die Hauptstadt Lulu zurück, und es kam ihnen vor, als wären sie zehn Jahre fort gewesen.
König Salih freute sich über die strahlende Tochter, deren Auftritt viel an Sicherheit gewonnen hatte und deren Rede von der Tiefe ihrer Gedanken zeugte.
Ein halbes Jahr später beschloss Jasmin, auch eine Wanderung durch die sechs umliegenden Länder zu unternehmen. Ihre Eltern waren zuerst absolut dagegen, nach einer Woche Diskussion mit Jasmin relativ dagegen und nach weiteren zwei Wochen gar nicht mehr dagegen. Doch auch Jasmin musste Zugeständnisse machen und den Elternwunsch akzeptieren, diese lange Reise nicht mehr zu Fuß, sondern gemeinsam mit Nura auf zwei guten Pferden anzutreten und genügend Geld mitzunehmen, um in der Fremde nirgends arbeiten zu müssen. Ihr Vater hatte große Angst, dass sie in diesen sechs fremden Ländern überfallen und ausgeraubt werden könnte. Also nähten Nura und Jasmin in ihre Mäntel und Taschen jeweils ein Geheimfach ein für das Geld.
Und sie ritten davon.
Diese Reise war genauso bedeutend für die Prinzessin wie die Reise durch ihr eigenes Land. In allen Ländern sprach man dieselbe Sprache, Arabisch, aber Sitten und Gebräuche waren Jasmin völlig fremd. Erst durch diese Reise erkannte sie, wie viel schlechter die Herrscher in den sechs Ländern im Vergleich zu ihrem Vater regierten.
Es war eine ernüchternde Erfahrung. Jasmin fühlte natürlich Mitleid mit den Benachteiligten, aber die Lage der Menschen in allen sechs Ländern war ähnlich. Bald überraschte sie nichts mehr. Und doch: Im sechsten und letzten Land, das für seine schönen Strände berühmt war und dessen Meer reich an Fischen und Perlen war, geschah es.
Jasmin und Nura nahmen ein Zimmer in einem winzigen Gasthaus am Meer, brachten ihr Gepäck aufs Zimmer und übergaben ihre Pferde einem Mitarbeiter zur Betreuung.
Sie machten einen langen Spaziergang am Meer. Schließlich setzten sie sich auf einen Felsen, wo sie von der Höhe einen wunderschönen Blick auf das ausgedehnte Blau des Himmels und des Meeres hatten.
Plötzlich bemerkte Jasmin, etwas schneller als Nura, dass ein Fischer beim Hantieren auf seinem Boot über Bord gefallen war, und sie erkannte, dass er nicht schwimmen konnte. Er schlug im Wasser wild um sich und begann, um Hilfe zu rufen. Jasmin zögerte nicht lange, sie war eine erfahrene Schwimmerin. Sie ließ ihre Kleider bei Nura und sprang ins Meer. Mit wenigen Zügen war sie bei dem jungen Mann. Sie packte ihn von hinten unter den Achseln und half ihm ins Boot. Als der junge Mann sie nackt im Wasser sah, murmelte er ängstlich: »Bin ich schon tot? Bis du eine Nymphe? Oder gar eine Fee?«
»Nein, nein, ich bin Jasmin«, antwortete Jasmin lachend, und noch bevor der junge Fischer die nächste Frage stellen konnte, war sie bereits verschwunden. Sie zog sich wieder an und genoss mit Nura die Sonne. Plötzlich sah Nura, dass der Fischer auf sie zuruderte.
»Vielleicht will er dir ein paar Fische schenken«, sagte sie und lachte.
Der junge Fischer stieg aus seinem Boot und stand jetzt vor dem Felsen und schaute zu den zwei Frauen hinauf.
»Ich möchte mich für meine Rettung bedanken. Habe heute schöne Fische gefangen. Wenn ihr wollt, werde ich sie für euch hier am Strand grillen. Das kann ich besser als schwimmen.«
Die zwei Freundinnen schauten einander an. »Warum nicht?«, meinte Jasmin.
Es war ein Gefühl, das Jasmin bisher nicht kannte. Immer wenn der Fischer ihr sein schönes Gesicht zuwandte und sie anschaute, klopfte ihr Herz heftig. Sicher trug die herrliche Umgebung dazu bei. Das Meeresrauschen, der Vollmond und die hereinbrechende Dunkelheit. An dieser Stelle des Strandes waren sie allein. Der Fischer hatte sehr geschickt die Fische ausgeweidet, gewaschen und mit aufgeschnittenen Zitronen, die er aus einem nahen Garten gestohlen hatte, eingerieben. Danach hatte er mit leichter Hand ein Feuer entfacht und grillte darauf die Fische. Sie schmeckten Jasmin und Nura ausgezeichnet.
»Wir sitzen hier mit dir und essen, dabei wissen wir nicht einmal, wie du heißt, und auch du weißt nicht, wer wir sind. Ich bin Nura«, sagte die Zofe.
»Und ich Jasmin.«
»Ich heiße Amir. Aber der Name ist das einzige Edle an mir. Ich bin bettelarm und verdiene gerade einmal so viel, dass meine Mutter und ich nicht hungern müssen«, antwortete der Fischer.
»Und wo wohnst du mit deiner Mutter?«, fragte Nura, als ahnte sie, dass Jasmin das dringend wissen wollte.
»Unsere kleine Hütte liegt unmittelbar neben der Moschee«, antwortete er. Dann hielt er kurz inne. »Und was arbeitet ihr?«
»Wir sind Wanderarbeiterinnen«, antwortete Nura. Jasmin senkte den Blick. Sie fühlte etwas wie Scham, dass sie den jungen Mann belügen mussten.
»Und wir sind auf dem Weg nach Hause. Nach Sitt Hudud«, fügte Nura hinzu.
Spät in der Nacht begleitete Amir Nura und Jasmin zu ihrem kleinen Gasthaus. Der Abschied war merkwürdig bewegend. Der junge Fischer stand schüchtern da und wusste nicht, was er sagen sollte. Jasmin nahm seine Hand in ihre Hände.
»Sei nicht traurig. Ich komme wieder«, sagte sie und gab ihm einen Kuss auf die Wange.
»Wirklich?«
Amir konnte sein Glück kaum fassen.
»Bis dahin werde ich schwimmen lernen«, antwortete er.
»Und wenn ich nicht störe«, rief Nura belustigt, »komme ich auch mit.«
»Ja, bitte«, erwiderte Amir.
Der Ort, wo Amir lebte, war nicht weit von der Grenze zu Sitt Hudud entfernt. Die Hauptstadt Lulu erreichte ein Reiter bequem in zwei Stunden.
Jasmin konnte lange nicht einschlafen. Und Nura wusste, dass die Lebensretterin ihr Herz verloren hatte. Sie lächelte still für sich und fühlte ein großes Glück, denn Jasmin war — im Gegensatz zu ihr — Männern bisher immer aus dem Weg gegangen.
Am nächsten Morgen ritten beide Frauen zurück.
Das doppelte Unglück
Die verliebte Jasmin schwebte auf einer Wolke. Sie wollte in Ruhe auf einen geeigneten Augenblick warten, um ihren Eltern von Amir zu erzählen. Die waren erst einmal außer sich vor Freude und erleichtert, dass sie heil zurückgekommen war. Ihr Vater wollte Nura, der Zofe, zur Belohnung ein großes Geldgeschenk machen, doch diese lehnte höflich ab. »Mit Jasmin zu reisen ist eine einzige Belohnung.«
Jasmin träumte immer wieder von Amir. In ihrem Traum schwamm er elegant neben einem Delphin.
In den darauffolgenden Monaten ritt Jasmin in Nuras Begleitung immer wieder zu Amir. Nura überließ die beiden Liebenden sich selbst und machte lange Spaziergänge oder erkundete auf ihrem Rappen die Umgebung.
Und egal, wie lange sie wegblieb, jedes Mal erschrak Jasmin, die nicht auf die Zeit achtete, bei der Aufforderung, sie sollten bald nach Hause zurückreiten. So ist es mit der Zeit der Verliebten, sie ist immer zu kurz.
Jasmins Eltern bemerkten zwar eine gewisse Veränderung an ihrer Tochter, aber wenn sie danach fragten, antwortete Jasmin ausweichend. Auch Nura verriet ihnen nichts.
So mutig Jasmin sonst war, auch in den nächsten drei Monaten fand sie nicht den Weg, ihren Eltern mitzuteilen, dass sie weder ihren Cousin, Prinz Abdullah, noch einen der vielen anderen Söhne reicher Wesire und Händler, die um ihre Hand anhielten, heiraten wollte, sondern nur ihren Amir.
Eines Morgens wünschte sie sich, zusammen mit ihren Eltern eine Kutschenfahrt zum Fluss zu unternehmen und dort den Tag zu verbringen. In dieser malerischen Umgebung wollte sie ihren Eltern von ihrer Liebe erzählen, und ihnen sagen, dass sie sogar bereit wäre, auf den Thron zu verzichten, um mit Amir zu leben, und sei es in Armut. Nura bestärkte sie darin.
Das würde, dachte Jasmin, sicher nicht das Ende der Herrschaft ihrer Familie bedeuten, denn der König hatte einen jüngeren Bruder, Badri, und der einen Sohn, Prinz Abdullah. Einer von beiden könnte das Königreich weiterführen.
Die Eltern freuten sich über die Idee eines gemeinsamen Ausflugs. Die Mutter ahnte, dass die Tochter irgendetwas auf dem Herzen hatte, und als diese sagte: »Aber bitte ohne Wächter und Dienerschaft. Ich will mit euch allein sein«, wusste die Mutter, dass ihr Gefühl sie nicht trog.
»Sehr gerne«, antworteten die Eltern wie im Chor. Auch sie sehnten sich nach einfachen Freuden.
Doch das Schicksal bereitete ihnen eine bitterböse Überraschung. Die Kutsche kam nicht weit. Ein paar hundert Meter vom Palast entfernt lauerte ein Attentäter auf die königliche Familie. Er schoss auf den König, aber die Kugel traf seine Frau. Sie war auf der Stelle tot. Da das Attentat in der Nähe des Palastes geschehen war, eilten die Wächter sofort hinter dem Attentäter her und holten ihn ein. Als er sein Gewehr auf sie richtete, schossen zwei Wächter ihn nieder. Der Attentäter starb und nahm das Geheimnis, warum er dem König nach dem Leben trachtete, mit ins Grab. Viele Gerüchte machten die Runde. Er sei verrückt gewesen, hieß es, oder er sei Agent eines anderen Herrschers, der König Salih hasste. Auch wurde gemunkelt, es sei eine Palastverschwörung gewesen, deshalb habe man den Verbrecher schnell erledigt, damit seine Verbindungen zu Hintermännern und Auftraggebern nicht ans Licht kämen. Wie auch immer. Das Motiv für den Mord wurde nie aufgeklärt.
Das Land trauerte um seine geliebte Königin, und vor allem natürlich der König, der gesagt haben soll: »Der Mörder ist tot, ich aber bin zu lebenslangem Schmerz verurteilt.« Als hätte die erste Katastrophe nicht gereicht, folgte eine zweite und raubte ihm jedwede Ruhe: Seine Tochter Jasmin war beim Anblick ihrer blutenden Mutter in eine tiefe Ohnmacht gefallen. Als sie wieder zu sich kam, wirkte sie ruhig, ja gelassen, doch Woche für Woche verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand. Sie schrie im Schlaf, aß kaum mehr und erbrach sich oft. Sie sah unendlich traurig aus und wollte mit niemandem außer ihrer Zofe und ihrem Vater reden. Lustlos verbrachte sie die Tage in ihrem Palastflügel und weigerte sich, irgendetwas zu unternehmen. Nicht einmal ihrer besten Freundin, der Zofe Nura, vertraute sie an, dass sie sich am Tod der Mutter schuldig fühlte, weil sie den Ausflug vorgeschlagen hatte.
Oft sah man König Salih am Grab seiner Frau weinen, das er mitten in seinem Garten errichten ließ. Dem Vorschlag seiner Berater, eine junge Frau zu heiraten, die ihm Kummer und Trauer vertreiben und einen Thronfolger schenken könnte, wollte er nicht folgen. Er konnte keine andere Frau lieben und plante, seine Tochter Jasmin, zur Kronprinzessin zu machen. Das war damals nicht üblich, doch der König konnte seinen Beratern und Wesiren die Königinnen aufzählen, die in vielen anderen Ländern herrschten und weder besser noch schlechter als die Könige waren. König Salih wusste nicht nur von berühmten Königinnen zu berichten, wie etwa Kleopatra von Ägypten oder die Königin von Saba, die sogar in der Bibel erwähnt wird, da sie König Salomo besuchte, um seine Weisheit zu prüfen, sondern auch von vielen anderen, weniger bekannten Königinnen: Nofrusobek und Hatschepsut von Ägypten, Königin Atalja von Israel, Amanirenas von Nubien sowie sieben Kaiserinnen, die in Japan mit kleinen Unterbrechungen zweihundert Jahre geherrscht hatten.
»Gewiss, Eure Gnaden, aber das geschah in fernen Zeiten und Ländern. Hier bei uns geht so etwas doch wohl nicht!«
»Wir wissen von unserer Vergangenheit weniger als von unserer Zukunft. Unser Unwissen darf aber nicht als Beweis für die Unmöglichkeit von irgendetwas gelten«, antwortete der König und lächelte. »Palmyra war der Sitz der syrischen Königin Zenobia, die sogar den Römern die Stirn bot. Schadscharat ad-Durr und Sitt al Mulk herrschten in Ägypten, es gab die jemenitische Herrscherin Saiyda al Hurra, auch genannt Arwa, die Berberkönigin Dihya, die assyrische Herrscherin Šammuramat und viele andere, die noch gestern und auch hier in unserer Gegend geherrscht haben«, antwortete der gelehrte König.
Er liebte seine Tochter innig und wünschte sie sich als Thronfolgerin. Er war sicher, sie wäre auch für das Land eine viel bessere Herrscherin als sein Bruder, der eher zum König der Genüsse taugte als dazu, ein Land ernsthaft zu regieren, oder dessen Sohn Abdullah, den der König überhaupt nicht mochte. Insgeheim war er glücklich, dass auch Jasmin ihn ablehnte. Abdullah war eine undurchsichtige Persönlichkeit, deshalb hatte der König ihn kürzlich aus allen Ämtern entlassen. Sein Wesir hatte ihm vertraulich versichert, der Neffe sei in mehrere Skandale verwickelt. König Salih hatte den Neffen zu sich gerufen und im Beisein seines Vaters, Prinz Badri, zur Vernunft gemahnt, sonst sähe er sich gezwungen, ihn ins Gefängnis zu stecken. Untertänig bettelte Abdullah um Gnade.
»Sie sei dir zum letzten Mal gewährt«, erwiderte der König, »aber nur aus Achtung und Liebe zu deinem Vater«, setzte er hinzu.
Einen Augenblick lang hatte er sogar gedacht, Abdullah könnte hinter dem Attentat stecken, aber dann vertrieb er den Gedanken.
Eigentlich war König Salih entschlossen, seiner Tochter bald den Thron zu überlassen, aber wie sollte das gehen: eine kranke, apathische Königin, die mit niemanden reden wollte und ihre Wohnung nicht verließ!
Kluge Berater des Königs vermuteten, dass sich Schamhuresch, der Sultan der Dschinn, in die Prinzessin verliebt habe, und da sie sich ihm verweigerte, ihr Herz und ihre Zunge gefangen hielt. Deshalb ließ der König die berühmtesten Zauberer, Seher, Mediziner, Hexen, Sterndeuterinnen und Schamanen einladen und versprach, wenn es einem oder einer gelinge, seine Tochter zu heilen, würde er sein oder ihr Gewicht in Gold aufwiegen.
Drei Monate lang ertrug die Prinzessin tapfer alle Torturen der Hexen und Magier. Doch dann wollte sie kein Kraut mehr essen, keine Salbe mehr auf ihre Haut auftragen lassen und keinen Weihrauch mehr riechen, und die Meister der verborgenen Welten kehrten mit leeren Händen und noch mehr als ihrem Gewicht an Wut und Enttäuschung beladen nach Hause zurück.
Als die Prinzessin neunzehn wurde, fasste König Salih einen äußerst kühnen Entschluss und ließ in seinem Land verkünden, wer seine Tochter heilen könne, der werde zum Fürsten geadelt und dürfe seine Tochter heiraten und der Mann der Königin sein.
Daraufhin strömten schöne und hässliche, alte und junge Männer herbei, Adlige, Abenteurer und auch arme Teufel, die sich sagten, sie hätten nichts mehr zu verlieren. Die Prinzessin aber saß stumm und hübsch wie eine Gipsfigur da und reagierte auf nichts.
Wenn ein Kandidat sie langweilte, hob sie die Hand. Sogleich wurde er von zwei Wächtern, die neben ihrer Zofe saßen, hinausbegleitet.
Da kam Nura auf eine naheliegende Idee. Sie schlug Jasmin vor, sie könne über Nacht zu Amir reiten und ihn bitten, er solle als Arzt oder Zauberer verkleidet zu Jasmin kommen. Bei seinem Anblick würde sie gesund werden, und dann könnten sie heiraten.
Wenn Jasmin nicht die Güte von Nuras Herz gekannt und ihre Fürsorge geschätzt hätte, wäre sie wütend geworden.
»Als ob ich hier ein falsches Spiel spielen würde, um Amir durch einen Gaunertrick zu heiraten! Mir geht es schlecht, liebe Freundin, sehr schlecht. Aber was würde geschehen, wenn mein gütiger Vater das Spiel durchschaut, zumal Amir weder in der Medizin noch in irgendeiner Heilkunst Erfahrung hat? Und selbst wenn mein Vater von unserer List erst später erfahren sollte, möchte ich ihm den Schmerz nicht zufügen, dass ich seine Liebe mit Betrug erwidere. Auch Amir würde das nicht wollen. Ich weiß, wie ehrlich und stolz er ist.
Wenn ich gesund werde, will ich selber zu meinem Vater gehen und ihm von meiner Liebe erzählen. Ich habe es Amir und mir ja versprochen, doch im Moment fehlen mir Kraft und Mut dazu. Und jetzt muss ich schlafen«, sagte sie. Dieser letzte Satz entglitt ihrer Kontrolle und kam fast zornig heraus. Sie zog sich die Decke über den Kopf und schlief bald ein. Die zwei Wächter gingen auf Zehenspitzen hinaus. Nura zog sich in ihr Zimmer zurück und ließ die Tür zu Jasmins Zimmer einen Spalt weit geöffnet.
Karam, der Kaffeehauserzähler
Eines Tages kam ein Kaffeehauserzähler aus einem benachbarten Land in die große Hauptstadt Lulu. Er hieß Karam. Er war groß und dürr. Groß war er schon immer gewesen, aber dürr war er in seinen jungen Jahren nicht. Fünf Jahre in einem Gefangenenlager in der Wüste hatten ihn bis auf die Knochen abmagern lassen, seine Seele und Würde konnten sie jedoch nicht zerstören.
Aber wie war es überhaupt dazu gekommen, dass ein Geschichtenerzähler in dem grausamen Lager für Staatsfeinde, wie es hieß, gequält wurde?
Kaum zu glauben, aber wahr, weil er eine witzige Tierfabel erzählt hatte, in der der Löwe, der König der Tiere, sich lächerlich machte. Nicht nur legten ihn Fuchs, Stier und Wiesel herein, sondern er biss auch seine nächsten Freunde zu Tode, bis er am Ende nichts mehr zu beißen hatte und elend starb.
Jahrelang hatte Karam zu später Stunde in seinem Kaffeehaus Geschichten erzählt und die Leute erst nach Hause geschickt, wenn eine Geschichte ihren spannenden Höhepunkt erreichte, mit dem Versprechen, am nächsten Abend die Fortsetzung zu erzählen. Jahrzehntelang ging das so, Nacht für Nacht. In jener besonderen Nacht aber ahnte er nicht, dass er sein Wort nicht mehr würde halten können. In dieser Nacht rückten Soldaten in seine Gasse ein, stürmten das Haus, als wäre darin eine Kompanie bewaffneter Feinde des Herrschers versteckt, und zerrten Karam aus dem Bett. Seine Frau schrie um Hilfe, doch niemand kam. Die Nachbarn standen hinter den Fenstern wie blasse Gipsfiguren. Ihre Gesichter zeigten stummes Entsetzen, bei manchen auch Gleichgültigkeit oder gar Häme.
Karam wurde beschuldigt, er habe den »Schatten Gottes auf Erden« beleidigt, so pflegte sich der Herrscher dieses Landes zu nennen. Er hieß Assad al Din, Löwe des Glaubens. Dafür gab es fünfzehn Jahre Gefängnis mit Schwerstarbeit. So kam Karam in das Lager für Staatsfeinde, einen höllischen Ort.
Seine Frau Farida starb drei Jahre nach seiner Verhaftung. Sie starb einsam, denn die Nachbarn besuchten sie nicht mehr. Manche hatten sie nicht einmal mehr gegrüßt, weil sie die Frau eines Staatsfeindes war. Karam erfuhr erst ein Jahr später vom Tod seiner Frau und von der anschließenden Plünderung seines kleinen Hauses und des Cafés. Das schilderte ihm ein neu ins Lager gebrachter Gefangener, der in derselben Straße wie Farida und Karam wohnte.
»Nichts mehr bindet mich an dieses Land«, soll er zu seinem Mitgefangenen gesagt haben.
Im fünften Jahr gelang ihm mit drei anderen Gefangenen die Flucht. Mithilfe eines freundlichen Beduinen durchquerte er die Wüste und erreichte Lulu, die Hauptstadt des Nachbarlandes Sitt Hudud. Er suchte das Haus seiner Tante Samia auf, der jüngsten Schwester seiner Mutter. Sie weinte vor Freude, als sie ihn sah, denn sie rechnete ihn bereits zu den Toten. Sie freute sich auch, weil sie seine Geschichten kannte und schätzte, und noch mehr seine Gastfreundschaft. Wenn sie früher einmal im Jahr zu Besuch kam, hätten er und Farida sie am liebsten nicht mehr zurückfahren lassen.
»Dass du lebst, ist ein Geschenk Gottes«, sagte Samia und weinte und lachte zugleich. Karam küsste seine Tante und umarmte sie innig. In der ersten Woche schlief er täglich bis zum Mittag. Seine Tante sorgte dafür, dass keiner ihn störte und kochte ihm seine Lieblingsgerichte
»Jetzt siehst du besser aus«, sagte sie eines Tages zufrieden, nachdem Karam schon am Morgen aufgestanden war und sich ausführlich gebadet und rasiert hatte.
Er erzählte ihr von seiner Höllenfahrt, davon, wie die Menschen sich unter extremen Bedingungen verändern. Manche ängstlichen Mitgefangenen werden zu mutigen Helden und sterben deswegen schnell. Andere ursprünglich starke Männer werden kleinlaut und freunden sich nicht selten mit den Wärtern und Folterern an. Sie werden belohnt: mit etwas weniger Qualen.
Samia hörte gespannt wie ein kleines Mädchen und mit vor Schreck geweiteten Augen zu, denn in Sitt Hudud kannte man so etwas nicht. Man durfte sagen, was man wollte, und niemand wurde wegen seiner Haltung zum Königshaus bestraft. Schließlich verstummte Karam, weil das ehrliche Erzählen ihn belastete und weil er aus Rücksicht auf seine Tante doch Teile der brutalen Gewalttätigkeiten im Gefängnis verschweigen musste … was ihn noch mehr schmerzte.
»Erzähl mir von dir, Tante«, sagte er.
»Was soll ich erzählen angesichts deiner Tragödie? Ich lebe hier seit dreißig Jahren, und es kommt mir vor wie dreißig Tage. Wir, mein Mann und ich, lebten glücklich miteinander, auch wenn für uns beide ein Kind ein Geschenk des Himmels gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob dir deine Mutter erzählt hat, dass wir überlegt haben, dich zu adoptieren. Wir hatten dich sehr gern, und meine Schwester hatte ja außer dir noch drei weitere Kinder, die beiden Mädchen, Nadia und Sara, und deinen Bruder Samir. Dein Vater, der sich mit meinem Mann sehr gut verstanden hat, stimmte zu, aber deine Mutter wollte nicht.«
»Viel ist ihr von ihren Kindern nicht geblieben. Du weißt ja, Nadia und Sara trennten sich im Streit von ihr, weil sie Männer heirateten, mit denen meine Mutter nicht einverstanden war. Samir wanderte mit zwanzig aus, und wir haben von ihm nichts mehr gehört. Man sagt, er sei ertrunken oder getötet worden. Nach dem Tod meines Vaters hatte sie nur noch mich. Gott sei Dank liebte meine Frau Farida meine Mutter und pflegte sie bis zum letzten Tag ihres Lebens. Wir haben sehr lange um sie getrauert, aber heute bin ich dankbar, dass sie meine Haft und den Tod von Farida nicht mehr erleben musste. Manchmal ist der Tod gnädiger, als man denkt.«
»Das stimmt«, nahm Samia den Faden wieder auf, »deine Mutter hat mir bei jedem Besuch erzählt, dass sie Farida wie eine eigene Tochter liebte. Kein Wunder!
Mein Mann ist in Frieden gestorben. In meinen Armen sagte er lächelnd: ›Wenn du mich liebst, so vergnüge dich in diesem Leben. Suche dir jemanden, der dich liebt und dich zum Lachen bringt. Dann bin auch ich drüben glücklich.‹ Stell dir vor, so ein feiner Mensch war er«, sagte sie und lachte. »Er hat mir genügend Besitz und Geld hinterlassen, dass ich noch hundert Jahre lang im Wohlstand leben kann. Und obwohl er schon vor einigen Jahren gestorben ist, fand ich bisher niemanden, der mir gefällt. Auch wenn sich das vielleicht gerade ändert … Doch das ist nicht das Problem, ich wäre auch so glücklich, aber …«, sagte sie und stockte.
»Was aber?«, fragte Karam.
»Unseren geliebten König ereilten vor ein paar Jahren zwei Katastrophen, und wir alle trauern mit ihm …«, und die Tante erzählte von der Tragödie des Könighauses. Karam wurde nachdenklich.
Am nächsten Tag begann er die große Stadt zu erkunden, die er seit Jahren nicht mehr besucht hatte. Das Zentrum der Hauptstadt, in dessen Nähe seine Tante in einem schönen kleinen Haus lebte, war eine Augenweide mit Prachtbauten, Parkanlagen, Geschäften, Krankenhäusern und gepflegten Straßen. Sie wäre ihm wie ein Paradies erschienen, hätten nicht so viele Bedürftige um ein Geldstück oder ein Stück Brot gebettelt. Auf einem Hügel im Norden der Stadt fand Karam ein Café. Hier ließ er sich nieder und beobachtete die Stadt. Aus der Ferne wirkte sie so harmonisch. Entfernung ist die beste Tarnung. Sie passt sich unseren Launen und Sehnsüchten an.
Er erinnerte sich an einen Ausflug mit seiner Farida, und wie sie am Ende erschöpft ein Café erreichten und sich wie zwei Kinder über einen Mokka mit Kardamom freuten. Farida konnte sich so sehr über Kleinigkeiten freuen, und das hatte er von ihr gelernt, nicht auf die großen Glücksmomente zu warten, sondern die kleinen glücklichen Augenblicke wie Mosaiksteine zu einem großen Glück zusammenzufügen.
Es waren nur wenige Gäste in dem Café, und bald setzte sich der Wirt zu Karam. Auch er erzählte vom Schicksal des Königs, mit dem er großes Mitleid hatte, und noch mehr mit dessen Tochter, Prinzessin Jasmin.
Auch Karam betrübte das Schicksal der jungen Prinzessin, vor allem aber empfand er eine ungeheure Sympathie für den König, dessen Liebe zu seiner verstorbenen Frau ihn sehr berührte, weil auch er beschlossen hatte, sein Leben lang nur Farida zu lieben.
Von diesem Moment an verließ ihn der Gedanke nicht mehr, was er tun könnte, um der kranken Prinzessin und ihrem traurigen Vater zu helfen. Karam glaubte fest daran, wenn man anderen Glück bringt, bleibt etwas Glück am Überbringer haften.
Ein gewagter Schritt
In dieser Absicht ging Karam eines Tages zum Palast. Dort meldete er sich nicht eben bescheiden beim Torwächter.
»Ich komme, um die Prinzessin zu heilen«, sagte er.
Der einfältige Wächter musterte Karam von oben bis unten und schüttelte den Kopf.
»Du siehst nicht gerade aus wie ein Arzt.«, antwortete er mit abweisendem Gesicht.
»Lass mich zu ihr, dann wirst du schon sehen. Sie hatte einst ein schönes Lachen. Ich habe sie im Traum erblickt, und sie sagte mir, ich solle kommen und ihr das Lachen zurückbringen«, sagte Karam und lächelte.
»Du bist vielleicht ein Spaßvogel«, meinte der Wächter und eilte zum Leiter der Wache. Denn der strenge Befehl des Königs lautete, auch wenn ein Bettler oder Verrückter käme, um der Prinzessin zu helfen, solle man ihn einlassen. So geschah es. Der Offizier begleitete den Kaffeehauserzähler zum König, der sich gerade im Audienzsaal mit Dichtern, Philosophen, Händlern und vielen angesehenen Männern und Frauen unterhielt.
Als der Offizier Karam ankündigte, herrschte Stille im Saal.
König Salih musterte den jungen Mann. Seine klugen Augen und der stolze Auftritt gefielen ihm.
»Du willst meine Tochter heilen und sie heiraten?«
»Eure Majestät. Eure Tochter ist nicht krank. Sie verweigert sich dem Leben, weil sie irgendeinen Kummer hat. Ich will versuchen, ihr die Lebenslust zurückzugeben, doch ich muss Euer Gnaden sagen, ich will sie gar nicht heiraten. Ich habe wie Ihr meine Frau verloren, die ich abgöttisch liebte, und ich habe wie Ihr kein zweites Herz für eine andere Frau. Vielleicht hat Eure kluge Tochter all die Anwärter durchschaut. Keiner wollte ihr aus Liebe und Achtung helfen, sondern alle waren nur daran interessiert, Prinzgemahl zu werden. Aber wer sagt Euch, dass Eure Tochter überhaupt heiraten will? Ich möchte mit ihr reden. Ich werde sie lange mit meinen Geschichten unterhalten, und dann wird der Tag kommen, an dem sie uns alle wieder mit ihrer zauberhaften Persönlichkeit beglücken wird, über die ich in der Stadt so viel hörte. Dafür bitte ich Euch nur um eines, o gnädiger Herrscher, dass in Eurer Hauptstadt, solange ich erzähle, keiner mehr hungern soll. Das wird mir und Prinzessin Jasmin sehr helfen. Mehr verlange ich nicht.«
Lautes Gemurmel erhob sich unter den Wesiren, Beratern und Besuchern im Audienzsaal.
»Was sagt er?«
»Ist das aber frech!«
»Das ist ja die reinste Anarchie!«
»Der Mann will eine Revolution anzetteln!«
»Mein Gott, wie redet er mit dem König?«
»So etwas habe ich noch nie erlebt!«
»Er beleidigt den König. Er stellt ihm Bedingungen!«
Der König hob die Hand und brachte damit alle zum Schweigen.
»Abend für Abend werde ich mit Eurer Tochter sprechen und ihr und Euch Geschichten erzählen. Wenn sie mich nicht mehr sehen und hören will, komme ich nicht mehr. Glaubt mir, o gnädiger Herrscher, sobald sie wieder zu sich findet, wird sie selber entscheiden, ob und wen sie heiraten will.«
Wieder entstand ein empörtes Gemurmel.
»Der will die Prinzessin nicht heiraten, dieser arrogante Nichtsnutz?«
»Was sagt er? Sie soll selbst entscheiden, wen sie heiraten will? Wo hat man denn so etwas je gehört?«
Noch einmal hob der König die Hand und schaute zornig in die Runde. Beinahe hätten einige aufgehört zu atmen.
König Salih staunte über die Redseligkeit des Fremden und seinen Mut, eigene Bedingungen zu stellen. Er senkte den Kopf und überlegte lange. Allmählich erhob sich in den Reihen seiner Berater und Gäste ein Gemurmel.
Als der König den Kopf wieder hob und Karam anschaute, trat absolute Stille ein.
»Junger Mann, ich muss eine Weile über die Sache nachdenken und mit meiner Tochter und dem Großwesir beraten. Komm morgen zur selben Zeit wieder, dann verkünde ich dir meinen Beschluss.«
Der Geschichtenerzähler verneigte sich und verließ den Audienzsaal.
Nach einer ausgedehnten Siesta und einer schönen Kaffeestunde mit seiner Tante kam Karam am nächsten Nachmittag wieder zum Palast. Er musste diesmal nicht lange erklären, was er wollte. Der Leiter der Wache wartete bereits auf ihn. Und der Audienzsaal war so voll, dass viele Gäste entlang der Wände stehen mussten.
»Junger Mann, meine Tochter und ich nehmen dein Angebot an. Meine Tochter freut sich, wenn du sie ab morgen mit deinen Geschichten unterhalten wirst. Ab heute um Mitternacht werden zwanzig Köche und dreihundert Helfer leckere Speisen vorbereiten und ab morgen früh auf allen Plätzen der Stadt kostenlos verteilen. Alle Armen sind eingeladen, sich satt zu essen.«
»O nein!«
»Mein Gott!«
»Aber, Eure Majestät!?« Allerlei Empörungsrufe waren zu hören. Der König richtete seinen Blick auf die Wesire.
»Die Gesundheit meiner Tochter ist mir das teuerste Gut auf Erden. Und wer von euch ist dagegen, dass Hungernde satt werden?«, schrie er wütend. Daraufhin herrschte Totenstille im Saal.
Jetzt wandte sich der König Karam zu.
»Junger Mann, wie heißt du?«, fragte er.
»Karam, Eure Majestät.«
»Schöner Name, Karam, Großzügigkeit, ich freue mich auf dich und hoffe, du wirst Jasmin helfen können.« Er bemühte sich, sanft zu sprechen, aber seine Stimme war durch den vorherigen Zorn spröde geworden. Beifall erhob sich, zuerst zögernd, dann schwoll er an, als der König lächelte.
»Gott schütze unseren König!«
»Gesundheit und Glück unserer Kronprinzessin!« Karam verneigte sich vor dem König und machte sich auf den Heimweg.
Ernüchternde Begegnung
In dieser Nacht konnte Karam kaum schlafen, seine Tante ebenso wenig. Als er in der Morgendämmerung leise aus dem Haus schleichen wollte, um zu prüfen, ob es in der Stadt schon irgendwelche Vorbereitungen gab, hörte er aus der Küche Samias Stimme.
»Nicht ohne einen Mokka«, rief sie und lachte.
Karam streifte durch die Stadt und war verwundert, wie leise und diszipliniert die Köche und ihre Helfer ihren Auftrag ausführten und wie freundlich sie die Menschen informierten. Große Tische und Sitzbänke wurden aufgestellt, und bald kamen die ersten Hungrigen. Sie näherten sich so vorsichtig, als hätten sie Angst, es sei ein Traum, der bei Übereilung verschwinden würde. Man bediente sie wie vornehme Gäste. Neugierig probierte Karam das Essen. Es gab frisches Brot, Käse, Oliven, Marmeladen, Obst und so viel Tee und Kaffee, wie man wünschte.
Zufrieden ging er heim und bereitete sich für seinen ersten Auftritt vor. Nach dem Mittagessen und einer Siesta machte er sich frisch und brach zum Palast auf.
Am Eingangstor empfing ihn der diensthabende Offizier und begleitete ihn bis zur Tür des Ostflügels, in dem Jasmin lebte.
Nura, die Zofe, lächelte ihn an, doch ihr Lächeln war viel zu dünn und durchsichtig, um ihre Trauer zu verhüllen. Sie flüsterte Karam zu: »Der Prinzessin geht es heute sehr schlecht.« Am liebsten hätte sie ihn gleich zu Jasmin gebracht, doch er schien es nicht eilig zu haben.
»Erzähl mir ein wenig von ihr. Ich habe in der Stadt gehört, was für weite und mutige Reisen ihr gemacht habt. Sie muss ja eine sehr starke Frau sein.«
»Das ist sie auch«, erwiderte Nura und erzählte ihm von Jasmins Kindheit. Nura und die Prinzessin kannten sich von Kind auf. Nura war die Tochter des Großwesirs, und Jasmin hatte sie sich als Zofe gewünscht. Ihre Freundschaft wurde dadurch noch stärker.
»Liebst du sie?«, fragte Karam.
»Mehr als das. Sie ist meine beste Freundin«, antwortete Nura.
Eine Stunde lang sprachen sie miteinander, doch Nura erzählte Karam kein Wort von der Liebesbeziehung zwischen Jasmin und Amir. Dann betrat Karam das Schlafgemach der Prinzessin. Er bat die zwei Wächter, draußen zu warten, und setzte sich auf den vorbereiteten Stuhl neben dem Bett.
»Ich grüße dich, liebe Prinzessin. Willst du mir etwas erzählen?«
Jasmin schüttelte den Kopf. Sie lag mit geschlossenen Augen im Bett, aber sie war wach.
»Soll ich dir ein wenig von mir erzählen?«
Wieder schüttelte Jasmin den Kopf.
»Ich will schlafen«, flüsterte sie kaum hörbar.
Über eine Stunde saß Karam ganz stumm neben ihr. Er schloss die Augen. Bilder tauchten in seinem Kopf auf. Seine Erlebnisse als Gefangener. Und so merkwürdig es sich anhört, das Gesicht der Prinzessin erinnerte ihn an das Gesicht eines Mannes, der mit ihm und zwanzig weiteren Gefangenen in einer kleinen Baracke dieses Höllenlagers gelebt hatte. Er hieß Isa. Wie man sich erzählte, gehörte er zu einer Gruppe von Männern und Frauen, die gegen den Sultan des Landes einen bewaffneten Kampf führten. Er wurde fast jede Woche abgeholt und gefoltert, und wenn er zurückkam, war er halb tot. Die Mitgefangenen trösteten ihn, gaben ihm zu essen und zu trinken. Manchmal auch etwas Haschisch, damit er weniger Schmerzen empfand und einschlafen konnte. Eines Tages war er, als er zurückkam, weder verletzt, noch sah man irgendwelche Folterspuren. Isa aber lief im Kreis herum und schlug sich ins Gesicht und weinte laut. Anders als früher wollte er mit niemandem reden. Er schrie und schlug sich, bis er erschöpft zusammenbrach. Karam und die anderen Männer trugen ihn sanft in seine Schlafecke und deckten ihn mit seiner dünnen Decke zu. In den nächsten Tagen weinte er Tag und Nacht, aß wenig und nahm öfter Haschisch. Ein paar bestechliche Wärter sorgten dafür, dass die Zufuhr von Lebensmitteln und Haschisch immer klappte.
Ein Arzt, der zehn Jahre Gefängnisstrafe absaß, weil er einmal öffentlich gesagt hatte, »Wenn man zu viel Wut herunterschluckt, wird man krank«, fragte ihn:
»Was hat man dir angetan?«
»Nichts, nichts«, erwiderte Isa und begann wie ein Hund zu heulen und zu schreien: »Ich bin ein Verräter, ich bin ein Verräter.«
»Beruhige dich, keiner von uns ist ein Verräter und am allerwenigsten du, sonst säßen wir nicht in diesem feinen Gasthaus und würden von unseren Dienern verwöhnt. Du bist kein Verräter!«
Den letzten Satz sprach der Arzt so laut und herrisch, wie wenn Isa schwerhörig wäre. Isa wurde still. Er schaute ängstlich um sich. »An dem Tag, als sie mich geholt haben«, sagte er leise, »hat der Offizier mit süffisant sadistischer Stimme zu mir gesagt, entweder verrate ich ihm die Namen der anderen drei Mitglieder unserer Gruppe, oder sie töten mich auf der Stelle, schlachten mich wie ein Schaf, und dabei hat er widerlich gelacht …«
Die letzten Worte waren kaum zu verstehen. Ein Gefangener überreichte Isa etwas Wasser aus einer rostigen Blechkanne, und der trank die Kanne in einem Zug leer.
»Dann hat er nach einem Soldaten gerufen, und da kam einer herein mit einem großen Messer in der Hand. Der packte mich an den Haaren und zog meinen Kopf nach hinten und hat mir das scharfe Messer an die Kehle gesetzt … Ich bin fast ohnmächtig geworden. Und plötzlich bekam ich eine heiße Sehnsucht nach dem Leben, wie ich sie nie zuvor gekannt hatte. Ich wollte nur noch überleben … und habe ihm … alles verraten.« Seine Stimme erstickte wieder in den Tränen. »Ich bat den Offizier, die Soldaten hinauszuschicken, und habe ihm die Namen meiner Kameraden verraten. Sie sind bestimmt bald tot … und es ist meine Schuld. Allein meine Schuld.«
»Nein, das ist es nicht«, rief ein alter Lehrer. »Auch ich wurde bestialisch gefoltert und habe — auch ohne Bedrohung mit einem Messer — die Namen meiner Helferinnen und Helfer verraten. Aber in dem Augenblick, als ich verhaftet wurde, haben meine Kameraden bereits die Stadt verlassen. Du kannst sicher sein, auch deine sind über alle Berge, und wenn nicht, wären sie schön dumm. Du bist daran nicht schuld.«
Isa beruhigte sich, und bald schlief er ein. In den folgenden Tagen erholte er sich langsam.
Als Jasmin wieder aufwachte, bat sie Nura um ein Glas Wasser. Sie schaute auf ihre Hände und mied Karams Blick. Er blieb ruhig, obwohl er schockiert war von der Apathie der Prinzessin.
Er wiederholte noch einmal die Fragen, die er ihr zuvor gestellt hatte, aber Jasmin schüttelte nur den Kopf. Karam schaute sich um, stand auf und fragte Nura: »Soll ich noch einmal kommen?«
»Ja, bitte«, erwiderte Jasmin jetzt ganz leise. Als er sich wieder zu Nura drehte, weinte diese bitter, aber tonlos.
Karam verließ das Zimmer und bat den einen der beiden Wächter, ihn zum Audienzsaal zu begleiten.
Mit gesenktem Kopf berichtete Karam dem König, dass Jasmin sich geweigert habe, mit ihm zu sprechen. Traurig blickte der König auf den Geschichtenerzähler.
»Das tut mir leid für dich, junger Mann.«
»Die Prinzessin … die Prinzessin«, stotterte Karam traurig und unsicher, »möchte, dass ich morgen wiederkomme.«
»Warum nicht?«, sagte der König mit freundlicher Stimme.
An diesem Abend aß Karam wenig. Seine Tante spürte, wie betrübt er war. »Ich möchte ein Gläschen Wein mit dir trinken«, sagte sie. Karam fühlte ebenfalls ein Bedürfnis nach Zerstreuung.
Bald tranken die zwei einen edlen Tropfen.
Tante Samia war eine begnadete Erzählerin, und es gelang ihr tatsächlich, Karam im Laufe des Abends auf andere Gedanken zu bringen.
Nach einiger Zeit begann Karam sogar zu lachen, weil die Tante so kluge und witzige Anekdoten erzählte.
Spät fiel er müde ins Bett, schlief aber einen unruhigen Schlaf.
Ein zweiter Anlauf
Am nächsten Morgen frühstückte Karam mit seiner Tante, half ihr beim Aufräumen, Kehren und Wischen und machte sich wie am Tag zuvor auf in die Stadt.
Die Helfer der Köche hatten gerade die Frühstückstische abgeräumt, andere begannen das Mittagessen vorzubereiten. Karam schlenderte wieder zum Wirt hinauf auf den Hügel.
Die Sonne schien, und der Wirt war sehr beschäftigt, also setzte Karam sich in eine ruhige Ecke und ließ den Blick über die Stadt schweifen. Viele Fragen gingen ihm durch den Kopf. Was für eine Katastrophe hatte die Prinzessin mit der Ermordung ihrer Mutter getroffen? War ihr Tod der einzige Grund für Jasmins sonderbares Verhalten? Was spielte Nura für eine Rolle?
Plötzlich dachte er an eine Mutter — sie war seine Nachbarin gewesen —, die alle Ärzte der Stadt aufgesucht hatte, weil ihre Tochter von einem Tag auf den anderen verstummt war. Die Ärzte behaupteten, dass ein böser Zauber daran schuld sei. Also hatte die arme Mutter in ihrer Verzweiflung auch die Zauberer aufgesucht. Aber keinem gelang es, der Tochter auch nur ein Wort zu entlocken … Seit seiner Verhaftung wusste er nicht mehr, was aus der Tochter geworden war.
Der Wirt holte ihn zurück in die Gegenwart.
»Seit wann sitzt du da?«, fragte er und lächelte Karam an.
»Ach, noch nicht lange, vielleicht eine Viertelstunde. Ich brauche einen Mokka mit viel Kardamom«, antwortete er.
»Und ich auch. Ich habe mir die Hacken abgelaufen, um die vielen Gäste zu bedienen. Jetzt sind meine Frau und mein neuer Lehrling an der Reihe«, rief er und eilte in die Küche.
Bald kam er mit zwei kleinen Mokka-Kännchen zurück. Der Duft eilte ihm voraus.
»Und?«, fragte er und wusste, dass Karam verstand, was er wissen wollte.
»Leider bin ich gestern völlig gescheitert, aber es tröstet mich, dass die Prinzessin mich noch einmal hören und sehen will.«
»Was, vermutest du, ist der Grund für die Krankheit der Prinzessin?«
»Nicht die geringste Ahnung habe ich bisher«, antwortete Karam aufrichtig.
»Glaubst du an Zauber?«, fragte der Wirt.
»Auf Jahrmärkten ja, und dort genieße ich ihn, aber ansonsten sind diese Leute Scharlatane, die besorgte Eltern ausnehmen. Ich verstehe wirklich nicht viel von Medizin, aber wenn du siehst, was für ein Heer von Quacksalbern an der armen Prinzessin herumgepfuscht hat, dann verlierst du das Vertrauen in alle Heiler.«
Lange erzählten die beiden einander, was für abergläubische Rezepturen sie als Kinder erlebt hatten, vom heiligen Olivenöl, das angeblich alles heilt, bis zu Amuletten, die gegen böse Blicke wirken sollten.
»Meine Mutter«, erzählte der Wirt, »war sehr abergläubisch. Die islamischen Rezepturen genügten ihr nicht, sie besorgte sich von den Christen Wasser aus Jerusalem und Sand aus Palästina. Bei einem berühmten Rabbiner hat sie magische Amulette mit Zitaten aus kabbalistischen Schriften gekauft, die gegen alle Krankheiten wirken sollten. Wir hatten auf dem Regal alle möglichen ranzigen Öle stehen und Flaschen mit Sand aus Mekka, Jerusalem und anderen heiligen Orten.«
»Sprichst du von deiner oder meiner Kindheit?«, fragte Karam, und beide lachten.
»Nein, nein, immer noch von mir«, antwortete der Wirt. »Einmal habe ich ein Amulett aufgerissen. Ich war zwölf oder dreizehn Jahre alt und sehr neugierig. Und was lag da? Ein Zettel! Darauf stand: ›Weil du mich aufgerissen hast, habe ich meinen Zauber verloren.‹
Meine Mutter war so wütend auf mich, dass sie eine Woche lang nicht mehr mit mir gesprochen hat. Der Scharlatan hatte sie wohl davor gewarnt, ein Amulett zu öffnen. Es könnte den Zorn der Heiligen über ihre Familie entladen. Stell dir diese Heiligen vor, die Tag und Nacht Tausende und Abertausende Amulette beobachten, und wehe, eins davon geht auf!«
Karam unterhielt sich bestens mit dem Wirt und erfuhr, dass er mit Vorname Sadek hieß. Sadek erzählte ihm, die Zofe Nura sei bis vor Kurzem die Geliebte eines verheirateten Holzhändlers gewesen, der sie mit der Ehe hinhielt und nur ihre jugendliche Schönheit ausbeutete.
»Auch ich habe mich einst in eine Frau verliebt«, fuhr der Wirt fort, »die an einem verheirateten Mann hing und jahrelang darauf wartete, dass er sich scheiden ließe. Doch der Mann hielt sie hin mit Sprüchen wie: ›Das kann ich meiner Frau nicht antun, sie ist todkrank.‹ Oder: ›Beim nächsten Streit werde ich mich scheiden lassen.‹
Irgendwann gab ich die Hoffnung auf. Als die Arme aber nach einem Jahrzehnt erkannte, dass sie sich seit ihrer Jugend vor der Wahrheit fürchtete, und beschloss, nun den Tatsachen ins Auge zu sehen, erfuhr sie von ihrem Liebhaber, dass er sie nie heiraten würde. Da beging sie Selbstmord.
Und ich habe mir geschworen, nie wieder jemanden so innig zu lieben. Nun bin ich seit Jahren glücklich verheiratet. Es war eine Vernunftehe, das Wunderbare daran aber ist, die Liebe wächst Tag für Tag«, erzählte Sadek.
Mit neuem Mut machte sich Karam nach seiner Siesta und einem ausgedehnten Gespräch mit seiner Tante am späten Nachmittag wieder auf den Weg zum königlichen Palast. Viele erkannten ihn und grüßten ihn freundlich. Die Menschen saßen bereits zu dieser frühen Stunde beim Abendessen, das die Köche und ihre Helferinnen und Helfer vorbereitet hatten.
Als Karam ankam, schlief Jasmin. Er folgte Nura in ihr Zimmer und unterhielt sich mit ihr.
Immer wieder vergewisserte Nura sich kurz, ob Jasmin noch schlief. Jedes Mal nickte sie, als sie zurückkam. »Die ganze Nacht hat sie geweint«, flüsterte sie.
»Warum?«, fragte Karam besorgt.
Nura wusste keine Antwort.
Danach saß Karam noch fast eine Stunde bei Jasmin und redete sanft auf sie ein, doch sie reagierte nicht. Er erzählte ihr auch kleine heitere Geschichten.
Keine Reaktion.
Geknickt stand er auf, schaute Nura hilflos an, dann wandte er sich wieder Jasmin zu.
»Soll ich morgen wiederkommen?«, fragte er.
Jasmin nickte.
Mit Tränen in den Augen umarmte ihn Nura draußen auf dem Gang. »Was für ein feiner, geduldiger Mensch bist du!«, sagte sie und drückte ihn fest.
Langsam marschierte er zum Audienzsaal, in dem sich die Leute bis zur Tür drängten. Alle warteten gespannt.
»Eure Majestät«, sagte Karam mit gesenktem Blick, »es ist mir nicht gelungen, Jasmin zu einem Gespräch zu bewegen.«
»Das tut mir leid«, sagte König Salih. »Will sie, dass du morgen wiederkommst?«
»Ja, Eure Majestät«, erwiderte Karam.
»Dann wünsche ich dir noch einen guten Abend … warte, warte«, stoppte der König Karam, den Blick auf seinen Ersten Sekretär gerichtet.
»Lass ihm eine Flasche Wein geben«, befahl er. Und zu Karam gewandt: »Rot oder weiß?«
»Rot, danke«, sagte Karam und verließ mit dem Sekretär den Saal.
Mit der Flasche in der Hand ging er durch die Stadt. Überall saßen Menschen zusammen, lachten und genossen das Essen. Niemand bettelte mehr auf den Straßen um Nahrung.
Karam lächelte in sich hinein. Sollte er die Prinzessin vielleicht auch nicht heilen können, dachte er, so hatte er immerhin die Hungrigen für ein paar Tage satt gemacht.
Zu Hause meinte seine Tante, sie wünsche sich auch wieder einmal, unter den Leuten zu sitzen und mit ihnen zu essen. Also schlenderten sie gemeinsam zum nächsten Platz. Es gab dort mehr als zehn große Tische mit jeweils über zwanzig Frauen, Männern und Kindern. Die Stimmung war fröhlich, die Leute erzählten und lachten und sangen. Die Menschen stammten aus allen Schichten, da saß eine Wäscherin neben einer Hebamme und daneben ein Händler oder ein Arzt, ein Goldschmied oder ein Schlosser.
»Ich bin so stolz auf dich«, sagte die Tante zu Karam, als sie zwei freie Plätze nebeneinander gefunden und sich niedergelassen hatten. An dem Tisch saßen zufällig einige arme Leute und Bettler.
Zu essen gab es fünf Gerichte: gefüllte Weinblätter, Auberginenmus, Fleischbällchen, gegrilltes Lammfleisch und Reis mit Rosinen und Pinienkernen.
Keiner der Anwesenden erkannte Karam, und das war ihm sehr angenehm.
Ein weiterer Bettler setzte sich Karam schräg gegenüber.