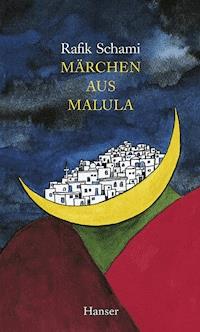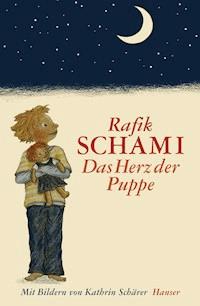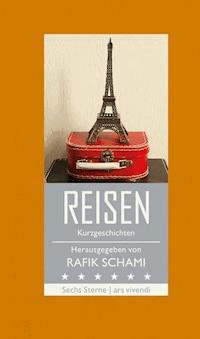Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Rafik Schami, 1946 in Damaskus geboren und seit 1971 in Deutschland lebend, gehört als brillanter Geschichtenerzähler und Romancier zu den erfolgreichsten Schriftstellern deutscher Sprache. "Meister der Erzählkunst" vereint seine schönsten Texte: die "Märchen aus Malula" und das Porträt seiner Heimatstadt "Damaskus im Herzen", aber auch sein neues, persönlichstes Buch "Die Frau, die ihren Mann auf dem Flohmarkt verkaufte", in dem er von seiner Kindheit in Damaskus berichtet und sich Gedanken darüber macht, wie die Märchen in die Welt gekommen sind. Den Höhepunkt bildet die Geschichte von Nura, der schönen Frau des berühmten Kalligraphen Hamid Farsi, in der sich eine leidenschaftliche Liebe entspinnt - die Liebe zwischen einer Muslimin und einem Christen. Der Roman des deutsch-syrischen Autors ist ein großer Bilderbogen der syrischen Gesellschaft, der alle Sinne der Leser anspricht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1457
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser eBook
Rafik Schami
Meister der Erzählkunst
Märchen aus Malula
Damaskus im Herzen
Das Geheimnis des Kalligraphen
Die Frau, die ihren Mann auf
dem Flohmarkt verkaufte
Interview mit Rafik Schami
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-23904-3
© Sonderausgabe 2011
Alle Rechte vorbehalten
Märchen aus Malula © 1997
Damaskus im Herzen © 2006
Das Geheimnis des Kalligraphen © 2008
Die Frau, die ihren Mann auf dem Flohmarkt verkaufte © 2011
Interview mit Rafik Schami © Rafik Schami
E-Book Konvertierung:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Rafik Schami
MÄRCHEN AUS
MALULA
Illustriert von
Root Leeb
Carl Hanser Verlag
Der Band Märchen aus Malula erschien zuvor
seit 1987 in vier Auflagen
beim NEUER MALIK VERLAG, Kiel.
ISBN 978-3-446-23900-5
© Carl Hanser Verlag München Wien 1997
© eBook Carl Hanser Verlag München Wien 2011
Ausstattung und Umschlag: Root Leeb
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
INHALT
Eine Vorgeschichte
oder
Vom Glück Geschichten zu finden
7
Der einäugige Esel
oder
Wie einer auf dem Richter
reiten wollte
17
Fatima
oder
Die Befreiung der Träume
23
Der kluge Rabe
oder
Der Fuchs als Pilger
43
Die fünf Kläger
oder
Was Undankbarkeit alles
ins Rollen bringen kann
55
Der Geizhals
oder
Wenn Zwiebeln Enten heißen
67
Blumer
oder
Das Geheimnis
hinter dem Lächeln
77
Das stille Wasser
oder
Wie der Sieger
zum Verlierer wird
95
Der Mäusevertilger
oder
Von der Ohnmacht
der Unwissenden
111
Wintertraube
oder
Die Geschichte
vom schwangeren Mann
121
Takla
oder
Warum mein Großvater
vierhundert Jahre sein Gewehr trug
133
Warum der Fisch spuckte
oder
Von der Gefahr
des blinden Vertrauens
161
Die Leichtgläubigen
oder
Wie eine Taube
zwei Gänse rettete
183
Der Korb
der Wünsche
oder
Der Traum der Hungernden
195
Aida
oder
Wenn Männer
eine starke Hand brauchen
223
EINE VORGESCHICHTE
oder
VOM GLÜCK,
GESCHICHTEN
ZU FINDEN
Meine Großmutter mütterlicherseits wäre mit Sicherheit eine Heilige, hätte der Vatikan den Himmel nicht den Europäern vorbehalten. Jahrhundertelang schreckten die europäischen Päpste nicht einmal davor zurück, europäische Könige wie Ludwig IX. heiligzusprechen, obwohl dieser Tausenden Mord und Elend gebracht hatte, bis er auf einem seiner Kreuzzüge vor Tunis mit einem großen Teil seines Heeres einer Seuche erlag. Auch europäische Kriegshetzer wurden mit einem herrlichen Platz im Himmel belohnt, wie der edle Bernhard von Clairvaux, der vielen armseligen europäischen Knechten die ewige Seligkeit versprach, wenn sie einen Orientalen in die Hölle beförderten. Er selbst hauchte seine zarte Seele friedlich in seinem Kloster aus. Durch die vielen Kriege und Meuchelmorde der Könige Europas wurde der Himmel besetzt, deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn den Chinesen, Afrikanern, Arabern und nicht zuletzt meiner Großmutter kein Plätzchen freigehalten wurde. Mein Nachbar, ein alter Bauer, der 1925 gegen die französischen Besatzer kämpfte und seine Hand dabei verlor, sagte einmal zu mir, er sei im Herzen sehr fromm, doch sündige er widerwillig, bloß damit er nicht ins Paradies käme und dort unter den Europäern leiden müsse.
Doch zurück zu meiner Großmutter. Wäre sie heiliggesprochen worden, hätte man sie die »Heilige der Geduld« genannt. Sie mußte oft auf uns aufpassen und setzte sich dann immer ruhig lächelnd zu uns. Hiob hätte bei meinem Bruder und mir geflucht, aber unsere Großmutter war geduldig. Wenn meine Eltern wegen irgendeiner Beerdigung oder Hochzeit für mehrere Tage verreisen mußten, holten sie diese Großmutter. Die andere wollte zum Essen eingeladen werden, aber nie zum Kinderhüten. Sie mochte uns nicht besonders, und wir konnten sie nicht ausstehen. So kam es, daß immer die »Heilige der Geduld« uns ertragen mußte. Wenn meine Eltern verreisten, hatten mein Bruder und ich endlich Gelegenheit, all die alten offenen Rechnungen zwischen uns zu begleichen. Die Großmutter wartete, bis wir uns ausgetobt hatten, dann lächelte sie uns zärtlich an und räumte auf. Für Minuten schämten wir uns. Manchmal versagte ich mir sogar, meinem Bruder eine runterzuhauen, nur aus Mitleid mit Großmutter. Ich wußte, daß die Ohrfeige in eine Schlägerei ausarten würde, denn wir waren gleich stark. Unser Kampf ging manchmal bis zur Erschöpfung, und so ertrug ich oft seine Gemeinheiten, um dieser armen und zärtlichen Seele die Qualen des Aufräumens zu ersparen. Mein Bruder aber legte mir das als Feigheit aus, und so mußte ich ihn schweren Herzens doch immer wieder vom Gegenteil überzeugen.
Wenn meine Eltern zurückkamen, lobte Großmutter uns überschwenglich, und meine Mutter wunderte sich, wie sie uns im Zaum gehalten hatte. Allerdings wunderte sie sich dann auch jedesmal über die merkwürdige Erschöpfung von Großmutter, die tagelang im Bett lag und nur noch schlafen wollte. Wenn das keine Heilige ist!
Diese Großmutter konnte gut kochen und nähen, aber sie konnte im Gegensatz zu den anderen alten Verwandten und Nachbarn nicht gut erzählen. Wir boten ihr manchmal an, ruhig wie die Engel zu sein, wenn sie bloß eine spannende Geschichte zu erzählen wüßte, aber sie lächelte und sagte: »Ich kann nur die vom dummen Raben erzählen!« Früher, als wir noch recht klein waren, gaben wir uns auch mit dieser Geschichte zufrieden, und sie erzählte vom Raben, der einen Pfau sah und ihn nachahmen wollte. Die Geschichte machte meinen Lieblingsvogel schlecht und endete für ihn katastrophal. Und die Moral der Geschichte? Natürlich alles so zu lassen, wie es ist. Ein Rabe ist ein Rabe, und ein Pfau ist von Geburt an König. Eine Geschichte, die ziemlich langweilig ist und sehr verbreitet war. Nicht einmal die Schulbücher haben auf sie verzichten können. Nach ein paar Jahren fragten wir nicht mehr, weil wir sicher waren, daß die alte Frau wirklich nur diese eine erbärmliche Fabel kannte.
Ein Zufall führte mich im Herbst 1984 in Nürnberg – fünfzehn Jahre nach dem Tode meiner Großmutter – an die Geschichten meines Dorfes heran. Wenn ich nun diese Begegnung mit einem meiner Zuhörer als märchenhaft bezeichne, werden es manche Leser für übertrieben halten, doch ich nenne sie so und wage eine kurze Schilderung, danach kann jeder selbst urteilen.
In einer eiskalten Nacht kam ich ziemlich erschöpft in Nürnberg an, um in der Buchhandlung »Bücherkiste« Märchen zu erzählen. Mein altes Auto trieb in jenem Herbst ein gnadenloses Spiel mit mir. Kurz vor den Städten, in denen die Lesungen stattfinden sollten, blieb es ohne Grund oder wegen eines seiner tausend Mängel stehen. Das Schlimme aber war, ich hatte nicht nur pünktlich, sondern auch noch frisch zu erscheinen, denn meine Arbeit fing ja nach der Fahrt erst an. Das war so auf dem Weg von Salzgitter nach Rendsburg, von Wetzlar nach Alsfeld und an jenem Abend von Schriesheim nach Nürnberg.
Die Buchhändlerin war wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen besorgt, ob überhaupt ein Zuhörer kommen würde. Ein wichtiges Fußballspiel wurde an diesem Abend im Fernsehen übertragen, die Alternativen hatten eine große Fete, und auch die eisige Kälte ließ die Frau nichts Gutes erwarten. Ich versuchte, wie so oft, mir selbst Mut zu machen, indem ich die Buchhändlerin ermutigte. Kurz vor acht war der Laden voll, und sie lächelte erleichtert.
Ich erzählte ein paar kurze Märchen aus meinem Band »Das letzte Wort der Wanderratte«. Ein Zuhörer schien aber besonders neugierig auf mein Dorf Malula zu sein, von dem das eine Märchen handelte, denn er stellte viele Fragen. Ich hatte keine große Lust zu diskutieren, doch der Mann blieb hartnäckig und erzählte mir, daß er in seiner Doktorarbeit die Sprache meines Dorfes neu untersuchen wolle. Ich wußte damals überhaupt nicht, daß diese alte Sprache hier jemals untersucht worden war. Wir redeten eine Weile miteinander und tauschten die Adressen aus; ein harmloser und in der Regel folgenloser, alltäglicher Vorgang.
Die Monate vergingen. Ich hatte den Mann fast vergessen, doch plötzlich meldete er sich. Er benötigte ein paar Informationen, und die gab ich ihm gern, da er auf dem Weg nach Syrien war. Er versprach mir, die Kopie einer Arbeit über mein Dorf zu schicken. Ich bedankte mich im voraus und erwartete nichts. Eine Woche darauf bekam ich eine Untersuchung über das Leben, die Sitten und Bräuche meines Dorfes Malula in den dreißiger Jahren. Die Lektüre war mühselig und langweilig, doch am Ende der Arbeit fand ich eine lange Literaturliste, und da machte ich die Entdeckung meines Lebens: Mehrere Literaturangaben wiesen auf Bücher und Zeitschriften hin, die die Märchen, die Geschichte und die Sprache meines Dorfes Malula behandelten. Unruhe packte mich. Ein Studienkollege besorgte mir die besagten Bücher aus der Heidelberger Universitätsbibliothek. Einige von ihnen waren fast zerfallen. Plötzlich entdeckte ich einen Märchenband. Auf über zweihundert Seiten waren in Aramäisch (Lautschrift) und Deutsch Geschichten und Alltagsberichte aus Malula festgehalten. Auf einmal tauchten Menschen auf, die ich als alte Männer und Frauen noch gekannt hatte; andere habe ich nicht mehr erlebt, doch ihre Söhne und Töchter leben heute noch. Ich kann meine Freude über diesen Fund gar nicht beschreiben. Dreitausend Kilometer von meinem Heimatdorf entfernt und hundertsechzehn Jahre nach dem Tag, an dem eine Frau namens Zeni Scho’ra zwei Orientalisten die erste Geschichte aus Malula erzählte, entdeckte ich sie in der Bundesrepublik. Was für ein Glück! Wenn mir das jemand vor fünfzehn Jahren vorausgesagt hätte, ich hätte es für einen derben Spaß gehalten.
Mehrere Männer und Frauen bemühten sich damals, die Geschichten zu erzählen, doch das größte Verdienst kommt unbestritten der oben erwähnten Zeni Scho’ra zu, die den größten Teil der Märchen im Jahre 1869 erzählt hat. Dieser Erzählerin und Tausenden von anderen Frauen Malulas ist es zu verdanken, daß die Sprache des Dorfes die Jahrhunderte überlebte. Sie bewahrten sie nicht nur, während die Männer mit ihrem Leben das Dorf verteidigten, sondern pflanzten sie von einer Generation auf die andere fort.
Als ich meinem Bruder von meinem Fund erzählte, wünschte er mir Geduld und lachte fröhlich, und gerade sein Lachen gab mir in den folgenden zwei Jahren den Mut der Geduldigen, im Dickicht der Literatur weiter zu suchen, auszuwählen und zu überarbeiten. Vieles, was mich im ersten Augenblick fasziniert hatte, erschien mir nach genauerer Untersuchung nur als ein Gerüst, das noch Leben braucht, um seine Schönheit zu entfalten. Auch hier war mein Bruder Francis mein erster kritischer Zuhörer, und wer erzählt, der weiß, wie unschätzbar ein kritischer Zuhörer ist, der aber auch so herzlich lachen kann wie mein Bruder, wenn ihm eine Stelle gefällt.
Die Geschichten und Märchen dieses Buches stellen eine Auslese dar. In meinem Dorf wurden auch Geschichten erzählt, die mich langweilen oder gar ärgern. Manche Geschichte habe ich ausgelassen, weil sie an anderer Stelle besser erzählt wurde, so z.B. die biblische Josephsgeschichte und eine kurze Fassung der Abenteuer Ali Saibaks, die im Arabischen sehr verbreitet ist. Meine Auswahl stützt sich auf die Sammlung »Neuaramäische Märchen aus Malula« und auf Fragmente, die mir einige Nachbarn vor langer Zeit erzählt haben. Nur die Geschichte von meinem Großvater und der heiligen Takla stammt von mir.
Ich gebe die Märchen und Geschichten meines Dorfes so wieder, wie ich mir vorstelle, daß sie einst fabuliert wurden. Vielleicht habe ich die eine oder andere auch erzählt, wie ich mir wünsche, daß sie so erzählt worden wäre. Es ist ein elementarer Bestandteil der Märchentradition, daß die Nacherzähler sich keine Zwänge und Grenzen durch eine einmal gehörte Geschichte auferlegen lassen, denn die Grenzen einer Geschichte sind die ihrer Erzähler. Sicher wurden und werden manche Märchen und Geschichten aus Malula auch anderswo erzählt. Ich habe Varianten in arabischen, persischen, jüdischen, griechischen, kurdischen und türkischen Geschichten gefunden. Welche Fassung nun die Urform darstellt und welche Gemeinschaft die Urquelle dieser Geschichten war, ist oft schwer herauszufinden und für den Genuß dieser eigenartigen Texte von zweitrangiger Bedeutung.
»Warum kannst du keine Geschichten erzählen?« fragte ich meine Großmutter eines Tages. Es war Winter, und wir saßen um den Holzofen herum. Mein Bruder hatte eine schlimme Grippe, lag fiebernd im Bett, und ich langweilte mich.
»Wie soll ich das können?« antwortete sie beschämt. »Vierzig Jahre lang habe ich unser Dorf Malula nicht verlassen. Damaskus habe ich erst vor zehn Jahren gesehen, als deine Mutter dich zur Welt brachte und meine Hilfe brauchte. Unser Leben in Malula war hart. Es war nicht die Zeit für Geschichten.« Diese Worte hallten in meiner Erinnerung wider, als ich durch die merkwürdige Begegnung in Nürnberg die Märchen meines Dorfes in die Hand bekam. Zwei Tage lang las ich die Geschichten, und erst am Morgen des dritten Tages gegen vier Uhr habe ich das Buch zugeklappt. Erschöpft machte ich das Licht aus und legte mich aufs Bett, aber ich konnte nicht einschlafen. In der Morgendämmerung jenes Tages dachte ich an meine Großmutter und wünschte mir, sie lebte noch, dann hätte ich ihr all diese Geschichten so erzählt …
DER EINÄUGIGE ESEL
oder
WIE EINER AUF DEM RICHTER
REITEN WOLLTE
In Malula lebte einst ein reicher Bauer, der viele Länder und Orte bereiste. Wenn er dann zurückkam, erzählte er von seinen Abenteuern in der Fremde, und die Bauern achteten ihn sehr, weil viele von ihnen nie die große Welt draußen gesehen hatten.
Der Bauer hielt sich für den klügsten Mann im Dorf, denn nicht einmal der Dorfälteste wagte es, ihm zu widersprechen.
Er heiratete eine junge und kluge Frau, hatte aber keine Achtung vor ihr.
Wenn sie ihm einen Rat geben wollte, unterbrach er sie: »Schweig, von dir brauche ich keinen Rat. Ich weiß es besser!«
Eines Tages kaufte der Mann auf einer seiner Reisen für hundert Piaster einen einäugigen Esel.
Seine Frau war erbost über den schlechten Handel, und sie versuchte, ihrem Mann zu erklären, daß er von den Städtern reingelegt worden sei, aber dieser schrie sie nur an: »Was verstehst du schon vom Handel? Dieser Esel ist kein einfaches Lasttier. Er ist klug und weise. Du wirst es sehen.«
Er fütterte den Esel mit dem besten Getreide. Dieser war aber ein gemeines Tier. Er schlug fortwährend aus, sobald sich die Frau ihm näherte.
Wenn sie sich darüber beschwerte, verhöhnte der Bauer sie.
»Er ist klüger und nützlicher als du«, sagte er und zeigte ihr, wie sanftmütig der Esel wurde, wenn er auf ihn zuging. Und in der Tat, der Esel fügte sich ergeben dem Willen seines Herrn, was dieser ihm auch immer befahl. So begann die Frau, den Esel zu hassen.
Kurze Zeit später mußte der Bauer wieder eine Reise antreten, und er befahl seiner Frau: »Gib gut acht auf den Esel, laß ihn keinen Hunger leiden. Was du ihm zufügst, tust du mir an.«
Gegen Mittag kam ein Händler, der Kleider und Schmuck von Haustür zu Haustür feilbot. Der Frau gefiel eine schöne Halskette und ein Kleid aus gutem Stoff, und so bot sie dem Mann kurzerhand den Esel dafür.
Der Händler schaute auf den wohlgenährten Esel, und da er sich wünschte, endlich seinen müden Rücken von der Last seines schweren Bündels zu befreien, nahm er den Esel und zog davon.
Nach einer Woche kehrte der Bauer zurück. Seine Frau schmückte sich mit der Kette und zog das schöne Kleid an, doch ihr Mann interessierte sich nicht für sie.
»Wo ist der Esel, Frau?«
»Lieber Mann«, erwiderte sie, »ich ging, wie du mir befohlen hast, ihm Futter zurechtzumachen. Die beste Gerste habe ich ihm gebracht, und was sehe ich da? Er hatte sich inzwischen in einen Richter verwandelt. Er sagte mir, er hätte keine Lust mehr, in deinem stinkenden Stall zu stehen und dich mit deinem fetten Bauch zu tragen. Das hat der verdammte Esel gesagt und ist in die Stadt gegangen, um über die Menschen zu richten.«
»Das habe ich nun von diesem undankbaren Vieh! Ich werde ihm zeigen, wer der Herr und wer der Esel ist. Hat er dir gesagt, wo er ist?«
»Ja, am Gerichtshof in der Hauptstadt.«
»Na warte, ich werde ihn zurückbringen!« rief der Mann und beeilte sich, in die nahe Hauptstadt zu kommen.
Dort fragte er nach dem Gerichtshof, und als er das prächtige Gebäude sah, stöhnte er: »Natürlich hast du es hier besser, aber ich bin nun mal dein Besitzer.«
Er nahm ein Büschel Gras und lief suchend von Raum zu Raum, bis er einen einäugigen Richter fand.
Er betrat den Saal, wedelte mit dem Gras und rief: »Komm! Komm, komm! Du Verfluchter, hast du die Gerste vergessen, die du bei mir gefressen hast? Komm!«
Da fragten ihn die Leute, die im Gerichtssaal saßen: »Was sagst du, Mann?«
»Der Richter ist mein Esel«, antwortete er. »Er hat meine Frau zum Narren gehalten. Sie ist ein dummes Weib. Aber er hat auch noch mich beschimpft. Jetzt sitzt er da und spielt den Richter. Nicht mit mir! Komm, du Hurensohn, komm!« rief er wieder und wollte zum Richter vortreten.
»Und woher weißt du, daß der Richter wirklich dein Esel ist?« wollte einer der Anwesenden wissen.
»Er ist einäugig«, antwortete der Bauer bestimmt. Die Leute lachten.
»Der Esel bist du! Weißt du, daß dieser Richter dich mit einem Wink seines Fingers an den Galgen bringen kann? Sei doch froh, daß er dich nicht gehört hat, du Dummkopf!« Sie warfen den Bauern hinaus.
Inzwischen war der Richter auf die Unruhe im Saal aufmerksam geworden und fragte nach dem Grund.
Einer erzählte ihm von dem verrückten Bauern. Der für seine Weisheit berühmte Richter hörte die Geschichte und lächelte. »Laßt den Mann hereinkommen!« befahl er.
Der Bauer zitterte vor Angst.
»Hab keine Angst, komm näher«, beruhigte ihn der Richter, und als der Mann ganz nahe bei ihm stand, fragte der Richter leise: »Wieviel war ich damals als Esel wert?«
»Fünfhundert Piaster, Euer Ehren!« sprach der Mann mit trockener Kehle.
»Nun, hier sind deine fünfhundert Piaster, nimm sie und geh nach Hause, aber sei so gut und verrate es niemandem hier, sonst kann ich nicht mehr richten.«
Er gab dem Bauern das Geld, und dieser eilte erleichtert davon.
Zu Hause angekommen, fragte ihn seine Frau: »Nun, was hast du erreicht?«
»Was habe ich dir gesagt?« antwortete er. »Der Esel war doch kein gewöhnliches Lasttier. Der Verfluchte saß auf einem schönen Stuhl und richtete über die Menschen. Und wenn ich nicht so klug wäre, hätte er mich an den Galgen gebracht.«
Das war die letzte Angeberei dieses Mannes, denn von nun an hörte er auf seine Frau und lebte glücklich bis zum Ende seiner Tage.
FATIMA
oder
DIE BEFREIUNG DER TRÄUME
In alter Zeit lebte eine arme Witwe mit ihren beiden Kindern, Hassan und Fatima. Ihr Mann, ein armer Holzhauer, war kurz nach der Geburt der Tochter gestorben. So lebte die Frau in Armut und erzog die Kinder in großer Not. Tag für Tag ging sie in das nahe Kloster und half dort bei der Wäsche, in der Küche und im Garten, und des Abends kehrte sie erschöpft nach Hause zurück, knotete ihr kleines Bündel auf und gab Hassan und Fatima das bißchen Essen, das sie aus dem Kloster mitgebracht hatte.
Als Hassan vierzehn Jahre alt war, wurde die Mutter eines Tages vor Erschöpfung krank. »Mutter«, sagte Hassan, »wir haben nur noch für zwei Wochen Mehl und Salz, Zwiebeln und Kartoffeln. Ich will hinausgehen und mir Arbeit suchen.«
»Aber mein Sohn, du bist noch ein Kind«, erwiderte die Mutter mit schwacher Stimme. »Bete mit deiner Schwester, damit ich schnell gesund werde und wieder im Kloster arbeiten kann.«
Hassan zog dennoch hinaus, aber sosehr er sich auch bemühte, er fand den ganzen Tag keine Arbeit. Als es dunkel wurde, sah er in der Ferne die Lichter eines großen Schlosses und eilte dorthin. Es war bereits spät, als er das Schloßtor erreichte. Er klopfte an, ein großer Mann öffnete und schaute Hassan an. »Was willst du hier?« fragte er.
»Ich suche Arbeit. Haben Sie Arbeit für mich, Herr?«
»Sicher, aber bei mir wirst du es nicht aushalten. Niemand hält es hier länger als eine Woche aus.«
»Ist die Arbeit so schwer?«
»Nein, die Arbeit ist kinderleicht, aber ich mag es nicht, wenn ein Knecht sich ärgert. Bist du oft zornig?«
»Oft nicht, aber manchmal schon.«
»Dann wirst auch du es bei mir nicht aushalten. Sobald du zornig wirst, verlierst du deinen Lohn und wirst auch nie mehr träumen können.«
Hassan hielt den Mann für verrückt. Er lächelte und dachte bei sich: Die Alpträume der letzten Wochen und Tage können mir gestohlen bleiben. Doch er setzte eine ernste Miene auf.
»Wieviel würden Sie mir zahlen?« fragte er.
»Wenn du bei mir arbeitest und dich nicht ärgerst, bekommst du in der Woche ein Goldstück. Das bekommst du am Samstagabend. Wenn du dich aber ärgerst, so bekommst du keinen Groschen und verlierst deine Träume für immer. Willst du trotzdem bei mir arbeiten?«
»Habe ich richtig gehört, daß ich ein Goldstück für die Woche bekomme?«
»Ja, wenn du dich aber …«
»Ich ärgere mich nie«, unterbrach Hassan ihn freudig und betrat das Haus.
Schon am selben Abend erklärte der Schloßherr, was Hassan zu tun habe. Jeden Morgen die dicke Kuh melken, das edle Pferd im Hof zehn Runden am Zügel führen, am Nachmittag den Perserteppich säubern und weiche Kissen darauf legen, den Weihrauch in der kleinen silbernen Schale anzünden und den exotischen Matebrockentee servieren. Das machte er jeden Tag. Die Arbeit war nicht schwer; Hassan wunderte sich jedoch über das große Schloß. Fünfhunderteinundzwanzig Zimmer zählte er. Fünfhundertzwanzig Zimmer durfte er betreten. Ihre Böden waren aus Marmor, die Wände aus Silber und die Decken aus Gold. Nur ein Zimmer war immer verschlossen.
Eine alte Frau erschien jeden Tag vor der Morgendämmerung, putzte bis zum Sonnenuntergang und verließ dann wieder das Haus. Sie war stumm und schwarz gekleidet. Ihr finsterer Blick war Hassan unheimlich. Und wenn sie an die verschlossene Tür kam, so bekreuzigte sie sich und eilte vorbei. Hassan arbeitete eifrig und lächelte von Tag zu Tag zufriedener. Nacht für Nacht lag er in seinem Kämmerlein unter dem Dach und träumte von dem Augenblick, in dem er seiner Mutter stolz das Goldstück überreichen wollte. Damals konnte eine Familie einen ganzen Monat lang von einem Goldstück leben. Freitag abend schwor Hassan bei allem, was ihm teuer und heilig war, daß er sich am nächsten Tag nicht ärgern würde, was immer der Schloßherr auch machen würde. Mit diesem Entschluß hüpfte er am frühen Samstagmorgen aus dem Bett und lief zuerst in die Küche. Er machte wie an jedem Morgen Feuer im Herd und ging pfeifend in den Kuhstall. Dort molk er die Kuh und kehrte mit der Milchkanne in die Küche zurück, wo der Herr bereits auf ihn wartete.
»Einen wunderschönen Morgen wünsche ich Ihnen!« rief Hassan, doch der Schloßherr lächelte nur merkwürdig. »Zeig mal her!« herrschte er seinen Knecht an, riß ihm die große Milchkanne aus der Hand und schaute hinein. »Du hast davon getrunken!« schrie er.
»Aber Herr, ich trinke nie Milch. Sie bekommt mir nicht.«
»Du wagst zu behaupten, daß ich lüge?« brüllte der Schloßherr wild.
»Nie im Leben Herr, ich habe bloß …«, doch Hassan konnte nicht zu Ende reden, denn der zornige Herr leerte die Kanne über seinem Kopf aus. Hassan kochte vor Wut, aber er biß die Zähne zusammen, als der Schloßherr ihn fragte: »Ärgerst du dich?«
»Nein«, antwortete Hassan und wunderte sich über das teuflische Lachen seines Herrn.
»Wenn du dich nicht ärgerst, ist es nur gut für dich. Geh und führe das Pferd aus.«
Hassan ging davon. Er wischte die Milch von seinem Gesicht und kochte innerlich über die Schmach. Draußen war es eiskalt. Seine nassen Kleider klebten an seiner Haut. Hassan zitterte. »Bloß nicht ärgern lassen, bloß nicht …«, murmelte er. Er führte das Pferd am Zügel zehn Runden im großen Hof herum, wie jeden Tag. Seine Finger schmerzten, und seine schlechten Schuhe lösten sich langsam vor Nässe auf, doch er mußte die zehn Runden durchhalten. Fast erfroren trat Hassan in die Küche und wollte seine Hände am Kamin wärmen.
»Du bist aber heute sehr schnell fertig«, donnerte die Stimme des Schloßherrn. »Waren das zehn Runden?« fragte er und lachte.
»Ja, Herr, es waren zehn Runden.«
»Bist du rechtsherum oder linksherum gegangen?« fragte der Herr wieder. Hassan schaute ihn erstaunt an, denn eine solche Frage hatte er nicht erwartet.
»Links … nein … rechtsherum, wie immer.«
»Um Gottes willen!« rief der Mann entsetzt. »Deshalb ging es meinem edlen Pferd so schlecht. Linksherum mußt du gehen, also mach zehn Runden, um die falschen auszugleichen, und dazu zehn richtige Runden, damit mein Pferd sich wieder wohl fühlt.«
»Aber Herr, es ist sehr kalt …«
»Ein Knecht widerspricht seinem Herrn nicht, es sei denn, er hätte sich geärgert. Hast du dich geärgert?«
»Nein, ich ärgere mich nie!« flüsterte Hassan und stürzte hinaus. Er zog das Pferd zwanzig Runden linksherum und flüsterte immer wieder: »Bloß nicht ärgern, es ist bald vorbei.« Als er erschöpft das Pferd in den Stall brachte, stand die stumme Putzfrau da, als hätte sie auf ihn gewartet. Sie blickte ihn mit besorgten Augen an, lief auf ihn zu, drückte fest seine Hände und lächelte, als wollte sie ihm Mut machen. Doch Hassan stieß sie von sich. »Du bringst mir noch Pech heute, laß mich in Ruhe«, rief er und eilte ins Haus.
In der Küche saß der Schloßherr hinter dem großen Tisch und speiste. Mehrere Schüsseln mit bunten und herrlich duftenden Gerichten füllten den Tisch. Hassans Magen knurrte vor Hunger, denn er hatte noch keine Zeit gehabt zu frühstücken. Er wollte sich ein Stück Brot abschneiden und es mit einem kleinen Stück Käse essen. Der Schloßherr aber lachte laut: »Was sehe ich da? Willst du etwa essen?«
»Ja, Herr, ich habe noch nicht gefrühstückt.«
»Habe ich dir nicht gesagt, daß meine Knechte am letzten Tag nichts essen dürfen?« fragte er und grinste Hassan an.
»Nein, Herr, das haben Sie nicht gesagt«, antwortete Hassan, und die Wut stieg in seiner Brust auf.
»Dann habe ich es vergessen. Jetzt kann ich es dir sagen. Du darfst nichts essen und schon gar nichts trinken. Bist du darüber verärgert?«
»Nein, Herr, ich kann den Tag auch ohne Essen verbringen. Ich ärgere mich nie!« rief Hassan und wollte hinausgehen, aber der Schloßherr brüllte fast vor Lachen.
»Ich sehe es, mein Kleiner, du fängst an, dich zu ärgern, deshalb darfst du nicht aus der Küche gehen. Du mußt hier in meiner Nähe bleiben«, befahl er und begann wieder zu essen. Er schmatzte und stöhnte vor Genuß.
Hassan dachte zum ersten Mal über die sonderbaren Gerichte nach, die der Schloßherr täglich zu sich nahm, ohne daß irgendein Koch sie zubereitete. Wenn er sich satt gegessen hatte, verschwand alles so plötzlich, wie es aufgetischt worden war. Nie hatte Hassan so genau hingeschaut wie an jenem Samstag. Eine große Angst lähmte ihn, als er hörte, wie der Schloßherr schwärmte: »Oh, wie lecker die Träume der Knechte sind.«
Immer wieder fragte der Schloßherr, ob Hassan sich ärgere, dieser antwortete nicht mehr, sondern schüttelte nur noch den Kopf. Mit Mühe konnte er seine Tränen zurückhalten. Als der Herr mit dem Essen fertig war, rief er: »Und nun mach mir meine Sitzecke zurecht!« Hassan stand auf und ging mit langsamen Schritten in den großen Raum, wo er jeden Nachmittag den Perserteppich bürstete und die weichen Kissen aufschüttelte, damit der Schloßherr im angenehmen Duft des Weihrauchs seinen Tee genießen konnte. Doch als Hassan den ohnehin sauberen Teppich abgestaubt hatte, trat der Schloßherr mit verdreckten Stiefeln auf den Teppich und ging ein paarmal hin und her, um dann wieder hinauszugehen. Der Teppich war nun richtig schmutzig, und Hassan mußte von vorne anfangen. Doch alsbald betrat der Schloßherr wieder den Raum und verschmutzte erneut den Teppich. »Aber Herr!« stöhnte Hassan.
»Was ist?« lachte der Mann zurück. »Ärgert es dich, daß ich immer wieder komme? Wenn das so ist, brauchst du es nur zu sagen, dann komme ich nicht mehr.«
»Nein, es ärgert mich überhaupt nicht«, knirschte Hassan und schrubbte weiter. Erst am späten Nachmittag zog der Schloßherr seine schmutzigen Stiefel aus. Er klopfte auf Hassans müde Schultern und brüllte: »Jetzt ist der Tee fällig!« Hassan schleppte sich in die Küche, um den Matebrockentee aufzukochen. Dort traf er die alte Frau wieder. Sie lächelte ihn an und drückte seine erschöpften Hände. Hassan wollte sie von sich stoßen, da er sehr verärgert war, aber die alte Frau hielt seine Hände fest und lächelte. Sie stieß unverständliche Laute aus und zeigte auf das verschlossene Zimmer, aber Hassan verstand nicht, was sie sagen wollte. Er kochte den Tee, stellte die Kanne und die vorgewärmte Tasse auf das silberne Tablett und trug es zum Schloßherrn. Der Matetee duftete anregend, doch als der Mann den ersten Schluck genommen hatte, spuckte er aus und stieß die Tasse fort.
»Was ist das nur für ein Sud? Hast du den guten Tee ausgetrunken und bringst mir statt dessen den zweiten Aufguß?« schrie er.
»Aber Herr. Bei der Seele meines Vaters! Ich habe keinen Tropfen davon getrunken«, stammelte Hassan ängstlich.
»Du Lügner, du! Willst du mich quälen?« rief der Schloßherr und warf mit der Teekanne nach Hassan. Sie traf ihn mitten im Gesicht und fiel zu Boden.
Hassans Geduld erstarb bei dieser Demütigung. »Genug!« schrie er und trat die Kanne gegen die Wand. »Was soll das? Ich habe mich die ganze Woche abgeschuftet, und nun willst du mich um die Frucht meiner Arbeit bringen. Jawohl, ich ärgere mich über deine Schweinereien. Ich könnte dich erwürgen. Was glaubst du, wer du bist? Hm?« Hassan schrie, wie er noch nie geschrien hatte, aber den Schloßherrn schien dies nur zu amüsieren. Er wälzte sich auf seinen weichen Kissen vor Lachen. Hassan erkannte nun, daß er verloren hatte. Er nahm seine Jacke und ging. Die Rufe des Schloßherrn hallten ihm nach: »Deine Träume werden mir schmecken … deine Träume werden mir schmecken …«
Hassan heulte, als er das Schloßtor hinter sich zuschlug. Die alte Frau saß auf einem flachen Stein vor dem Tor. Sie begrub ihren Kopf in den Händen und weinte.
Hassan rannte mit letzter Kraft nach Hause, aber erst um Mitternacht erreichte er das Haus. Er sah eine kleine Kerze am Fenster und konnte die Mutter im Bett liegen sehen, da das einzige Zimmer ihrer Hütte keinen Vorhang hatte. Fatima saß neben ihr und nähte. Nacht für Nacht stellte sie die Kerze ans Fenster, denn sie hatte geschworen, nie das Licht ausgehen zu lassen, solange ihr Bruder noch in der Fremde war. Hassan zögerte lange vor der Tür. Er schämte sich, mit leeren Händen hineinzugehen. Er hörte die Mutter fragen, ob Hassan je zurückkehren würde. Fatima beruhigte sie und sagte, daß er sie nie vergessen würde. Hassan, der diese Worte vernahm, wäre am liebsten vor Zorn und Trauer gestorben. Endlich faßte er Mut und betrat das Zimmer. Die Freude der beiden war unbeschreiblich, doch Hassan weinte nur und erzählte von seinem Unglück. »Wenn ich etwas klüger gewesen wäre, so hätte ich den Schloßherrn noch die paar Stunden ertragen. Ich bin dumm.«
»Nein, Bruder, du bist klüger als alle Schloßherren der Erde. Du warst aber nicht aufsässig genug. Warte hier bei der Mutter. Ich will mein Glück versuchen und dir deine Träume zurückholen.«
»Aber Tochter, du bist erst zwölf und so klein und schwach«, klagte die Mutter, doch Fatima machte sich am nächsten Morgen auf den Weg. Sie wußte, daß es im Hause nur noch für eine Woche Vorrat gab. Hassan beschrieb ihr den Weg zum Schloß, und so war es für Fatima nicht schwer, es schon am frühen Nachmittag zu erreichen. Sie klopfte an und wartete. Die stumme Putzfrau kehrte im Hof. Sie schaute kurz auf, schüttelte den Kopf und arbeitete weiter.
»Ach, wen haben wir denn da?« rief der Schloßherr. »Ein kleines Mädchen! Hast du dich verirrt, oder willst du um ein Stück Brot betteln?«
»Ich hatte gestern einen Traum, und er führte mich in dein Schloß. Ich folgte ihm und verlor meinen Weg nicht«, antwortete Fatima.
»Was für einen Traum? Und warum führte er dich zu mir?« belustigte sich der Schloßherr.
»Ich soll hier eine Woche lang arbeiten und reich und glücklich zurückgehen.«
»Ich brauche hier zwar jemanden, aber du wirst es nicht aushalten. Bei mir darfst du dich nicht ärgern, denn dann verlierst du deinen Lohn und deine Träume.«
»Und was bekomme ich für die Woche?«
»Diese Goldmünze«, sagte der Schloßherr.
»Zeig her, was mir gehören soll!« antwortete Fatima. Der Schloßherr war erstaunt über ihre Frechheit, doch er zog aus seiner Manteltasche eine glänzende Goldmünze und reichte sie Fatima. Sie nahm die Münze, warf sie mehrmals auf den Boden und horchte auf ihren Klang, dann schaute sie mißtrauisch die Münze an und biß in ihre Kante. »Sie ist echt«, bestätigte sie.
»Aber du darfst dich nicht aufregen. Wenn du dich nämlich ärgerst, wirst du gar nichts bekommen, und du verlierst deine Träume«, wiederholte der Schloßherr und öffnete das Tor, so als wüßte er, daß die Goldmünze jeden verführt.
»Ich ärgere mich nie«, antwortete Fatima und betrat den Hof. »Aber was ist, wenn du dich ärgerst?«
»Ich? Kein Mensch auf der Erde kann mich ärgern!« rief der Schloßherr amüsiert.
»Aber was ist, wenn du dich doch ärgerst?« lachte Fatima hell.
»Dann bekommst du zwei Münzen«, antwortete der Schloßherr und zeigte Fatima, was sie zu tun hatte.
Am nächsten Tag arbeitete Fatima, sang und lachte und beobachtete den Schloßherrn, der kurz vor dem Mittagessen das verschlossene Zimmer aufsuchte, für eine kurze Weile hineinging und fröhlich herauskam. Der Tisch deckte sich plötzlich mit den schönsten Gerichten, Früchten und Weinen. Gierig aß der Herr und sang: »Oh, wie gut die Träume schmecken.« Abends ging er wieder in das Zimmer hinein, und als er wieder herauskam, hörte Fatima ihn vor dem Schlafengehen singen: »Oh, wie weich die Träume mein Bett machen.« Fatima versuchte mit aller Kraft, das Schloß zum geheimnisvollen Zimmer aufzukriegen, aber sie schaffte es nicht. Erschöpft fiel sie zu später Stunde auf die Heumatratze in ihrem Kämmerlein und schlief sofort ein. Am nächsten Morgen grüßte Fatima die alte Frau und lächelte sie an. Als diese sich am Vormittag ermüdet an die Wand im großen Korridor lehnte, ging Fatima zu ihr, streichelte ihre vernarbten Hände und lächelte sie wieder an. Die Frau schaute jedoch weg.
»Hat er dir deine Träume geraubt?« fragte Fatima. Die Frau drehte sich zu dem jungen Mädchen, ihre Augen waren voller Tränen. Sie nickte. »Und deine Worte, hat er sie dir auch gestohlen?« bohrte Fatima weiter. Die Frau nickte erneut. Fatima umarmte sie. »Hab keine Sorge, wir werden einen Weg finden«, ermunterte sie die Alte.
Am späten Abend wartete Fatima, bis der Schloßherr ins Bad ging. Sie folgte ihm. Als sie hörte, wie er in der großen Badewanne sang, schlich sie in den Umkleideraum. Dort lagen die seidenen Kleider und die goldene Kette mit dem kleinen Schlüssel zum verschlossenen Zimmer. Fatima zog einen Wachsklumpen aus ihrer Tasche und nahm von dem Schlüssel einen Abdruck. Das Blut erstarrte in ihren Adern, als der Schloßherr rief: »Es zieht, es zieht. Ich sehe alles. Bewege dich nicht!« Doch Fatima rannte hinaus und legte sich ins Bett. Nach einer Weile spürte sie, wie der Schloßherr die Tür zu ihrer Kammer öffnete und die Öllampe hochhielt. »Nein, die schläft!« flüsterte er und ging.
Am nächsten Morgen drückte sie der alten Frau den Wachsklumpen in die Hand, und diese eilte damit in die Stadt. Am Freitag kam sie und überreichte Fatima einen kleinen Schlüssel aus Messing. Fatima wartete, bis der Schloßherr schlafen gegangen war. Dann nahm sie den Schlüssel und schlich barfuß zum Zimmer. Ihr Herz klopfte stark, als sie den Schlüssel ins Schloß steckte. Sie drehte ihn um, und siehe da, die Tür öffnete sich. Ein buntes Licht strahlte ihr entgegen, als sie das Zimmer betrat. Sie blieb wie angewurzelt stehen. Tausende von kleinen goldenen Käfigen hingen in dem großen fensterlosen Zimmer. In jedem Käfig flatterte hilflos ein Schmetterling. Ihre Flügel schimmerten und strahlten wie tausend kleine Monde und Sterne. Nur mit Mühe konnte sich Fatima zurückziehen. Nicht nur die Schönheit der Schmetterlinge machte es ihr schwer, sondern auch der Gedanke, daß sie sie noch in Gefangenschaft lassen mußte, bis der ersehnte Augenblick gekommen wäre.
Am Samstagmorgen strahlte der Schloßherr Fatima erwartungsvoll an:
»Wenn du diesen Tag aushältst, dann wirst du um eine Goldmünze reicher«, rief er und lachte listig.
»Ich träumte, daß ich um zwei Münzen reicher würde«, erwiderte Fatima.
»Träumerin! Sieh nun zu, daß du die Milch holst, bevor sie in den Eutern meiner teuren Kuh zu Joghurt wird«, befahl er. Fatima nahm die Kanne, lächelte der alten Frau zu, die vor der Küche den Boden fegte, und ging pfeifend in den Stall. Dort schaute sie die fette Kuh an und sprach: »Was machst du hier? Du arme Kuh! Fressen und schlafen, um gemolken zu werden. Bald wird er dich schlachten, weil du immer weniger Milch gibst. Geh in den Wald, dort ist das Leben gefährlich, aber doch lebenswert.« Sie öffnete bei diesen Worten die Tür, gab der Kuh einen kräftigen Schlag mit der flachen Hand auf den Hintern und kehrte mit der leeren Kanne ins Haus zurück. Als hätte sie die Worte verstanden, rannte die Kuh schnell in den nahen Wald und verschwand nach einer kurzen Weile im Dickicht.
»Was? Du hast die Kuh noch nicht gemolken?« brüllte der Schloßherr, als er Fatima mit der leeren Kanne sah.
»Die Kuh hat keine Lust mehr. Ich kam, um sie zu melken, da sprach sie: ›Geh und sage dem fetten Zweibeiner, ich habe keine Lust mehr, hier zu verblöden, damit er noch fetter wird. Ich haue ab.‹ Das hat sie gesagt und ist wirklich auf und davon gegangen.«
»Was? Meine teure Kuh ist fortgelaufen?« schrie der Mann und sprang vom Sessel auf.
»Ärgerst du dich darüber?« fragte Fatima und lächelte.
Der Schloßherr bemerkte sofort seinen Fehler. Er grinste: »Nein, ich glaube dir aber nicht. Sattele mir das Pferd. Ich werde hinausreiten und die Kuh fragen, ob sie dir das gesagt hat, und wenn du gelogen hast, dann mußt du den Stall mit deiner Zunge putzen, aber ohne dich zu ärgern. Beeile dich, ich habe keine Zeit.«
Fatima eilte in den Stall. Sie befreite das Pferd vom Zügel und sagte: »Pferd, schau, wie schön du ohne Zügel ausschaust. Draußen sind die Berge und Flüsse, die deine Hufe begehren. Geh! Was willst du in diesem stinkenden Stall?« Bei diesen Worten gab sie ihm einen Klaps auf den Hintern, und das Pferd rannte wie ein Pfeil davon.
»Das Pferd«, sagte Fatima, als sie zum Schloßherrn zurückkehrte, »hatte keine Lust mehr, dich zu tragen. Es sagte, du seist viel zu schwer für seinen Rücken, und für das bißchen Hafer lohne es sich nicht, die Schmach bei dir zu ertragen. Das Pferd will lieber die Welt bereisen, und wenn es einen noch schlimmeren Menschen als dich trifft, so wird es zurückkommen.«
»Ich werde verrückt. Mein edles Pferd ist weg. Ich höre nicht richtig!« schrie der Schloßherr.
»Doch, doch, aber ich sehe schon, daß du dich ärgerst«, lachte Fatima.
»Nein!« brüllte er. »Kühe und Pferde sind käuflich, und was ich mit meinem vielen Gold erwerben kann, das kann mich nie ärgern. Nun geh und mache mir einen Tee.«
»Jetzt schon?«
»Ja, jetzt. Samstag ist ein ungewöhnlicher Tag.«
»Ich habe aber noch nicht gefrühstückt«, antwortete Fatima und nahm einen Brotlaib aus dem Korb.
»Ich habe vergessen«, heuchelte der Schloßherr, »dir zu sagen, daß meine Knechte am Samstag nicht essen dürfen. Laß das Brot und beeile dich, mir einen Tee zu kochen.«
»Wenn ich nicht esse, werde ich schwerhörig und vergeßlich. Was hast du zuletzt gesagt?«
»Matebrockentee!« brüllte der Schloßherr.
»Komisch! Den willst du trinken?«
»Was ist daran komisch? Ich trinke ihn jeden Tag«, erwiderte der Herr laut.
»Bist du sicher?«
»Ja!« stöhnte er.
Fatima werkelte eine Weile am Herd und kehrte mit einer großen, dampfenden Tasse zurück. Der Herr nahm einen Schluck und mußte sofort husten und spucken. »Was ist das denn?« schrie er und wischte sich angewidert den Mund.
»Altesockentee«, antwortete Fatima.
»Was hast du gekocht?«
»Alte Socken. Ich habe mich auch gewundert und dachte, ich irre mich, doch du hast gesagt, jawohl, ich will das trinken.«
»Ich habe Matebrocken und nicht alte Socken gesagt«, knurrte der Schloßherr.
»Entschuldige mich bitte. Mein leerer Magen betäubt meine Ohren. Ärgerst du dich jetzt?« fragte Fatima.
»Ich?« lachte der Herr verbittert. »Nein, aber bald ist es Mittag, und du wirst hoffentlich deinen Hunger ertragen.«
»Doch, du ärgerst dich, aber du willst es nicht zugeben«, entgegnete Fatima und eilte hinaus. Die alte Frau strahlte ihr entgegen. »Nur noch ein paar Stunden, und dann wirst du deine Träume wiederhaben«, flüsterte Fatima und half der Frau bei ihrer Arbeit auf dem Hof.
Kurz vor Mittag hielt sie inne und schaute die Frau an. »Jetzt ist es soweit.« Die Frau ließ den Besen fallen und eilte mit Fatima ins Haus. Fatima öffnete die Tür zum Gefängnis der Schmetterlinge und befreite sie alle aus ihren goldenen Käfigen. Sie flatterten aus dem Zimmer und flogen aus dem Haus hinaus wie ein Bündel Farben. Zwei Schmetterlinge landeten auf dem Kopf und dem Mund der alten Frau, küßten sie, und die Frau lachte und sprach: »Mein Name ist Mariam.« Fatima und Mariam fielen sich in die Arme, und als sie dem letzten Schmetterling ans Licht geholfen hatten, schlossen sie leise die Tür und gingen wieder auf den Hof hinaus.
Es dauerte nicht lange, bis sie das Gebrüll des Schloßherrn hörten. »Wo sind die Träume? Wer hat sie gestohlen? Wo sind die Träume? Wie soll ich jetzt noch essen und ruhig schlafen?«
Mariam zischte: »Warte, du verfluchtes dickes Schwein, wenn du erst meinen Besen schmeckst, wirst du bestimmt ruhig schlafen.« Fatima bog sich vor Lachen, als der Schloßherr plötzlich an der Türschwelle stand und die sprechende Mariam anstarrte »Du … ka … ka … kannst … wie … wieder sprechen?«
»Bist du taub geworden, du Esel?« antwortete Fatima und schüttelte sich vergnügt vor Lachen.
»Du hast also die Schmetterlinge geraubt!« sprach der Herr mit trockener Kehle.
»Und du hast dich geärgert. Gib es zu!« rief Fatima.
»Jawohl, das hat mich geärgert, aber du wirst keinen Groschen sehen, weil du eine Diebin bist!« empörte sich der Schloßherr.
Fatima griff nach einem kräftigen Ast, und Mariam nahm den Besen. »Das werden wir sehen«, sagten sie und schlugen so lange auf den Mann ein, bis er um Gnade bettelte und jeder von ihnen zehn Goldstücke gab. Mariam umarmte Fatima, küßte sie und tanzte mit ihr im Kreis, dann aber eilte sie davon. »Leb wohl, tapferes Mädchen!« rief sie immer wieder, bis sie hinter dem Hügel verschwand. Fatima ging geradewegs durch den Wald, als sie das Pferd wiehern hörte, das ihr entgegengetrabt kam. Fatima sprang auf das Pferd und ritt davon. Es war schon dunkel, als sie ihre kleine Hütte erreichte. Sie freute sich über die Genesung ihrer Mutter und die Freude ihres Bruders. Tagelang hatte er nicht schlafen können, bis an diesem Tag ein bunter Schmetterling ins Haus geflattert kam und ihn auf die Stirn küßte, um danach wieder in den blauen Himmel aufzusteigen. Sofort fiel er in einen tiefen Schlaf und träumte von Fatima. Die Mutter kochte den feinen Matetee, den Fatima mitgebracht hatte, und sie hörte mit Hassan bis tief in die Nacht die Geschichte, die ich gerade zu Ende erzählt habe.
DER KLUGE RABE
oder
DER FUCHS ALS PILGER
Als der Fuchs alt geworden war und keine fette Beute mehr machen konnte, stieg er auf einen hohen Stein und rief laut: »Hört, ihr lieben Tiere! Ich will hiermit verkünden, daß ich all meine Sünden bereue. Viele von euch habe ich reingelegt. Nicht einmal vor dem Löwen habe ich haltgemacht.«
»Das kann man wohl sagen«, brüllte der Löwe. »Ja, ja, du warst der Meister der Lüge«, meckerte eine Ziege.
»Und nun, was willst du uns jetzt weismachen?« fragte die Eule erhaben und blickte in die Ferne.
»Ja genau, was für einen Trick hast du, altes Schlitzohr, jetzt wieder auf Lager?« jaulte der Wolf, der so oft unter dem Fuchs gelitten hatte.
»Gar nichts will ich euch weismachen«, antwortete der Fuchs und senkte die Augen, »ich habe jetzt erkannt, daß das Glück der Frommen dauerhafter ist als das der Listigen. Ich will allein zu unserem heiligen Ort pilgern. Ich habe euch zusammengerufen, damit ich Abschied nehmen und euch um Verzeihung bitten kann. Man kann nie wissen, die Reise geht durch die Wüste und über die Berge, und überall lauert unser aller Feind: der Mensch. Vielleicht muß ich wegen meines lausigen Pelzes dran glauben. Daher ist es mein innigster Wunsch, euch alle um Vergebung zu bitten, wenn euer großes Herz …« Dicke Tränen erstickten seine letzten Worte.
Der Löwe kratzte sich am Ohr. »Höre ich richtig? Der Fuchs will ein frommer Pilger werden?«
»Eher werde ich Vegetarier, als daß ein Fuchs jemals sein Herz der Frömmigkeit öffnet!« erwiderte der Wolf mißtrauisch.
»Man sollte nicht so unbarmherzig sein«, widersprach die Gans.
»Ja genau, schaut doch seine Tränen«, bestätigte ein Hammel, als eine Ziege die Gans auslachte. Die Tiere debattierten lange, doch der Fuchs rief plötzlich: »Lebt wohl, ihr barmherzigen Tiere!« Und nun fühlte sogar der skeptische Wolf Mitleid mit dem reuigen Fuchs.
»Komm gesund zurück, zieh in Frieden!« hallten die Rufe der Tiere ihm nach.
Noch viele andere Tiere waren auf der Pilgerreise. Sie schlossen sich zu kleinen Reisegesellschaften zusammen, um die Strapazen der Reise zu mildern und die Langeweile der öden Strecke zu verkürzen. So gesellten sich am nächsten Tag ein einsamer Hahn, ein Pfau, eine Gans, ein Rabe und ein Hase zum Fuchs.
Der Hase hetzte die Mitreisenden zu immer schnellerem Gang. Er rannte ihnen voraus, hielt kurz an und rief zurück: »Wo bleiben denn die Tapferen?«
Als es dunkel wurde, brachen die Tiere erschöpft zusammen, doch der Hase hüpfte ganz vergnügt im Kreis herum, als mache ihm das Reisen überhaupt keine Mühe.
»Also mir geht er langsam auf die Nerven. Er ist viel zu schnell«, flüsterte der Fuchs.
»Mir auch, ich habe kein Gefühl mehr in meinen Füßen«, bestätigte die Gans. Auch die übrigen grollten dem Hasen, bei dessen Anblick sie sich um Jahre gealtert fühlten.
»Was haltet ihr davon, wenn ich ihn verjage?« fragte der Fuchs.
»Wie willst du das anstellen?« fragte der Pfau.
»Er verwechselt Schnelligkeit mit Tapferkeit. Ich werde ihm aber zeigen, daß er es zwar in den Beinen, aber nicht im Herzen hat. Ich werde ihn so erschrecken, daß er sich seiner Feigheit schämt und im Dunklen verschwindet«, sprach der Fuchs leise und beobachtete den Hasen, der auf einem Hügel saß und den Mond betrachtete. Nicht einmal der ansonsten so mißtrauische Rabe fand den Vorschlag schlecht, dem Angeber etwas Bescheidenheit beizubringen. So geschah es, daß der Fuchs zum Hasen hinüberschlich. Nach einer Weile hörten alle den Hasen erschrocken um Hilfe rufen. Die Tiere lachten. Ein jämmerliches Piepsen folgte, dann trat Stille ein.
Es dauerte lange, bis der Fuchs zurückkehrte. »Ich habe ihn so erschreckt«, sagte er, »daß er uns für immer in Ruhe lassen will.« Immer wieder prahlte er mit seiner Tat, bis der Hahn gähnte.
»Ich muß schlafen gehen!« sagte er.
»Warum so eilig? Laßt uns doch etwas miteinander die Nacht genießen. Es ist eine Ewigkeit her, daß so verschiedenartige Tiere in solcher Eintracht miteinander reisten«, sagte die Gans, doch der Hahn setzte sich auf einen abseits stehenden Baum und war nach einer Weile fest eingeschlafen. Die anderen unterhielten sich bis tief in die Nacht. Alsbald aber weckte sie der Hahn. Schon in der ersten Morgendämmerung krähte er so laut, daß seine Reisegefährten erschreckt hochfuhren und ihn böse anstarrten.
»Muß das sein?« fragte der Fuchs.
»Ich verstehe die Hühner nicht. Sie verzichten auf die süße Nacht, um den Lebewesen mit ihrem Krach den Morgen zu vergällen«, jammerte die Gans.
»Munter sollt ihr werden, ihr Anbeter der Nacht. Habt ihr noch nie den weisen Spruch gehört: Morgenstund’ hat Gold im Mund?« krähte der Hahn, doch der Rabe konnte die Augen kaum öffnen. Er gähnte und nickte wieder ein.
»Ja und, was hat man davon, wenn man vor lauter Müdigkeit nicht einmal den eigenen Schnabel aufsperren kann?« bemerkte der Pfau schroff.
»Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!« setzte der Hahn sein Gekrächze fort.
»Hat dich eine Eule aufgezogen, daß du in der Morgendämmerung und auf nüchternen Magen solche Weisheiten ausspuckst?« fragte der Fuchs erbost, doch durch nichts ließ sich der Hahn seine gute Laune verderben. Er stupste den Raben an.
»Auf geht’s, Sohn der Finsternis. Kein Wunder, daß deine Stimme so gräßlich ist. Nur wenn sich deine Augen an Sonne und Morgenluft laben, wirst du Gold in deiner Kehle haben«, krähte er laut, doch der Rabe winkte ab. »Geht nur«, gähnte er, »ich fliege euch nach.« Und so setzte die Pilgergesellschaft ohne ihn ihre Reise fort.
Gegen Mittag wachte der Rabe ausgeruht auf. Er stillte seinen Hunger auf den nahen Feldern und flog dann hoch in den Himmel, um nach seinen Weggenossen Ausschau zu halten, doch weit und breit waren sie nicht mehr zu sehen. Eine herrliche Landschaft erstreckte sich unter seinen Augen und verlockte den Raben zum Bleiben, doch Raben ziehen eine gesellige Hölle einem einsamen Paradies vor. So eilte der Rabe gen Süden. Erst am frühen Nachmittag holte er die ermatteten Pilger ein. Sie fluchten alle über den Hahn, der sie aus dem Schlaf gerissen hatte, doch der Sonnenwecker ermahnte sie, sich vor der Verführung der Nacht in acht zu nehmen. Als es Abend wurde und der kühle Wind heraufzog, legten sich die Reisenden nieder. Der Mond stieg in den klaren Himmel auf und bezauberte die Ermüdeten. Der Pfau, der schon in seinen jungen Jahren an den vornehmsten Höfen Dichtung und Gesang gelernt hatte, hob an, die Schönheit des Mondes zu preisen, doch der Hahn krähte: »Geh lieber schlafen, kranker Fuß, sonst singst du uns morgen nur noch deine Klagelieder vor!« Er lachte verächtlich, hockte sich auf einen Ast und schlief sofort ein.
Der Pfau schaute verdutzt in die Gegend. »Also das macht mich langsam krank. Was geht das ihn an, wenn ich bis zum Mittag schlafe und die Nacht wach bleiben will?«
»Hühner sind nun mal besonders stumpfsinnig«, bestätigte die Gans.
»Ich finde es auch langsam öde, mit ihm zu reisen. Fromm werden wir sowieso bald und für immer. Was schadet es, daß man die Augen an dem Glanz deiner Federn weidet, wenn sie der Mond mit seiner zärtlichen Hand berührt«, sprach der Fuchs zum Pfau. Dieser stieß einen Freudenschrei aus und schlug sein Rad. Pfauen schätzen das Lob über alles.
»Er schnarcht schon«, krächzte der Rabe und schüttelte den Kopf.
»Der Gemeinschaft zuliebe werde ich euch von diesem Störenfried befreien!« brummte der Fuchs zornig.
»Mach, was du willst. Ich suche mir einen Platz aus, wo der Quälgeist mich nicht wecken kann«, sagte der Pfau und machte sich auf die Suche nach einem ruhigen Ort. Nach einer Weile folgte ihm die Gans. Auch dem Raben fielen bald die Augen zu. Mit letzter Kraft flog er in den Wipfel eines alten Walnußbaumes und schlief alsbald ein. Keiner von ihnen bemerkte, daß der Fuchs den Hahn fraß. Am nächsten Morgen standen alle erholt von ihrem ruhigen und langen Schlaf auf, und als der Pfau nach dem Hahn fragte, antwortete der Fuchs: »Ich habe es wider Willen für euch getan.« Die drei Vögel nickten verständnisvoll.
Es war eine anstrengende Reise. Der Weg führte durch eine Steppe, und die Sonne brannte erbarmungslos auf die Reisenden nieder. Mit letzter Kraft erreichten sie am Abend eine kleine Pfütze, in der sich etwas Regenwasser angesammelt hatte. Als die Gans die Pfütze erblickte, flog sie voraus und landete vergnügt mitten im Wasser. Nachdem sie genug getrunken hatte, planschte sie genüßlich im Wasser herum, bis es ganz trüb wurde. Als die drei durstigen Reisegenossen ankamen, starrten sie entsetzt in den schlammigen Brei. Die Gans drehte sich fröhlich singend im Wasser, doch langsam bemerkte sie die schlechte Laune ihrer Mitreisenden.
»Komm, genieß das nasse Element«, rief sie dem Pfau zu, doch dieser drehte nur angeekelt sein Gesicht zur Seite. »Es stinkt ja nach deinem Fett«, antwortete er. Nicht einmal der bescheidene Rabe mochte seinen Durst stillen. Das Wasser schmeckte ihm nicht. »Blöde Gans. Sie ist so selbstsüchtig. Sie geht über unsere verdursteten Leichen. Ich könnte ihr den Hals umdrehen!« zürnte der Pfau.
»Gesagt, getan!« bellte der Fuchs und sprang der Gans an die Gurgel. Nach einem kurzen Kampf lag die Gans tot am Boden. Der Rabe zog sich angewidert zurück. Er hörte noch lange den Fuchs schmatzen. »Du hast es verdient, blöde Gans. Warum hast du auch das Wasser verdorben? Hm? Jetzt bist du sprachlos, was?« rief der Fuchs immer wieder.
Am nächsten Tag erreichten die drei eine Oase, in der viele Tiere eine Rast einlegten, bevor sie zur letzten und anstrengendsten Etappe ihrer Reise aufbrachen. Eine große Quelle spendete genug Wasser, das klar im Bach plätscherte.
»Was für ein Paradies!« freute sich der Fuchs beim Anblick der vielen fetten Enten, Hasen und Lämmer.
»Ja, wahrlich, und ich bin der einzige Pfau«, stellte der König der Vögel befriedigt fest.
»Was machst du mit einem solch langen Schwanz?« fragte ihn ein Lamm, das zum ersten Mal in seinem jungen Leben einen Pfau sah.
»Ich schlage ein Rad, das in seiner Schönheit Sonne und Mond übertrifft«, kreischte der Pfau und entfaltete seine Federpracht. Das Lamm erschrak und rannte blökend zu seiner Mutter.
»Oh, oh, wie schön. Welch wunderbare Herrlichkeit!« staunten die Tiere, und der Pfau stolzierte herum. Der Fuchs ging auf und ab. Er flüsterte dem Raben zu: »Was für ein Angeber. Ich hätte ihn für seinen Hochmut gerne getadelt, doch er würde mir vorwerfen, ich sei eben ein Fuchs und verstünde die Seele der Vögel nicht.«
Auch der Rabe ärgerte sich über den Pfau und rief: »Hör auf anzugeben. Du platzt ja bald!«
»Bist du neidisch, Pechbruder?« gab der Pfau zurück. »Weder deine Kehle noch deine Federn sind mit Schönheit gesegnet. Was hast du also Schönes an dir?« fügte er giftig hinzu.
»Ein kluges Köpfchen, du Federklump«, krächzte der Rabe.
»Köpfchen!« rief der Pfau und lachte. »Köpfchen, genau, Köpfchen!« kreischte er und brachte damit viele Tiere zum Lachen. »Willst du ein Loch in deinem Köpfchen haben?« Und bevor der Rabe antworten konnte, versetzte ihm der Pfau einen Hieb mit seinem kräftigen Schnabel und verletzte ihn am Kopf. Ein erbitterter Kampf brach aus. Viele pilgernde Tiere eilten entsetzt davon, andere versuchten, Frieden zu stiften und den Streitenden Barmherzigkeit und Güte beizubringen, doch sie handelten sich nur Schnabelhiebe ein. Nach einer Weile war die Oase entvölkert. Nur der Fuchs schaute vergnügt dem Kampf zu. Der Rabe kämpfte tapfer, doch schließlich unterlag er der Übermacht des Pfaus. Verletzt schleppte er sich in eine Ecke und fing an, über sein Unglück zu klagen. Der Pfau stolzierte herum: »Laß es dir eine Lehre sein, Sohn der Nacht. Dem König mußt du dein Herz zu Füßen legen, sonst wirst du in deinem Leben noch viel zahlen!«
»Gib doch bitte nicht so an«, erwiderte der Fuchs, »du hast den tapferen Raben besiegt, weil du zehnmal größer bist als er. Du wirst dich aber vor einem Kampf mit einem gleich Starken drücken.«
»Ich nehme es mit jedem auf! Nicht einmal vor einem Tiger werde ich mich verstecken!« schrie der Pfau, immer noch außer Atem, zurück.
»Dann laß uns kämpfen! Nur so zum Spiel!« rief der Fuchs und sprang den Pfau an. Doch dieser wehrte sich mit kräftigen Hieben. Lange dauerte das Ringen, doch dann packte der Fuchs den Pfau am Hals.
»Laß das, das tut ja gemein weh«, winselte dieser, doch der Fuchs brach ihm den Hals. »Für dich, lieber Rabe, habe ich es getan«, säuselte er und fraß den Pfau.
»Nein, du mußt mich fressen, ob du es willst oder nicht«, antwortete der Rabe verzweifelt, »aber ich bitte dich um einen letzten Gefallen.«
»Und der wäre?« fragte der Fuchs und packte den Raben mit seinem Maul.
»Ich habe nicht verstanden, wie du mit deinem kleinen Maul den großen Hals des Pfaus umdrehen konntest. Wie weit kannst du dein Maul eigentlich öffnen?«
Am nächsten Tag wanderten der Fuchs und der Rabe weiter, doch als es Mittag wurde, rief der Fuchs: »Mein lieber Weggenosse, laß uns hier eine kleine Rast machen. Der heilige Ort ist nicht mehr weit.« Der Rabe wollte sich einen schattigen Platz suchen, doch plötzlich sprang der Fuchs auf ihn zu und packte ihn: »Hast du gedacht, ich lasse dich am Leben, damit du den anderen erzählst, was ich getan habe?«
»Nein, du musst mich fressen, ob du es willst oder nicht, antwortete der Rabe verzweifelt, aber ich bitte dich um einen letzten Gefallen.«
»Und der wäre?« fragte der Fuchs und packte den Raben mit seinem Maul.
»Ich habe nicht verstanden, wie du mit deinem kleinen Maul den großen Hals des Pfaus umdrehen konntest. Wie weit kannst du dein Maul eigentlich öffnen?«
»So weit!« rief der Fuchs und sperrte sein Maul auf. Der Rabe sprang schnell heraus und flatterte davon. Nach einem kurzen Flug erreichte er den heiligen Ort. Dort standen Tausende von Tieren und beteten. Der Rabe kreiste über ihnen und sah viele Füchse unter den betenden Lämmern, Hasen und Fasanen. »Quark, Quark, daß der Fuchs ein Pilger wird, ist doch Quark, Quark!« krächzte er und zog seine Kreise. Viele Tiere schauten den Raben verärgert an. Sie riefen ihm zu, er solle mit seinen Rufen den Frieden des heiligen Ortes nicht stören, doch der Rabe kreiste über ihnen und rief: »Quark, das ist doch Quark, wenn der Fuchs den Pilger spielt, Quark, Quark!« Als zwei Adler ihr Gebet unter den Hühnern unterbrachen, um den Störenfried zu vertreiben, machte sich der Rabe davon, doch er fliegt bis heute in der Welt herum und ruft: »Quark, Quark!«
DIE FÜNF KLÄGER
oder
WAS UNDANKBARKEIT ALLES INS
ROLLEN BRINGEN KANN
Vor langer Zeit, so erzählen die Großväter, lebte in Malula ein Mann namens Farag. Zusammen mit seiner Frau und seinen drei Kindern bewohnte er ein kleines Haus neben der Wasserquelle. Sein Bruder, der ein reicher Mann war, sehnte sich vergebens nach einem Sohn. Eines Tages bat er Farag: »Bete für mich, daß ich endlich Söhne bekomme. Gott ist eigenwillig, weder erreichen meine frommen Gebete sein Ohr noch können die Opfergaben meiner Frau sein Herz erweichen. Der Allmächtige erfüllt manchmal nur aus einer Laune heraus die Wünsche der Sündigen.« Farag lachte: »Wenn ich für dich bete und du Söhne kriegst, was willst du mir dafür geben, Bruder?«
»Ich will dir ein Lamm geben«, antwortete der Bruder. Farag, der seinen Bruder und seinen Geiz gut kannte, erwiderte: »Und was ist, wenn du dein Versprechen nicht hältst?«
»Aber Bruder! Hast du kein Vertrauen zu mir? Wenn ich mein Wort nicht halte, darfst du mir mitten im Sonntagsgebet vor allen Gläubigen hundert Ohrfeigen geben.«
»Gut!« stimmte Farag zu und betete. Nach neun Monaten brachte seine Schwägerin einen schönen Sohn zur Welt.
Farag freute sich über das Kind und noch mehr über das versprochene Lamm. Doch als er den Bruder an sein Versprechen erinnerte, wollte dieser davon nichts wissen.
»Lamm?« rief er entsetzt. »Reicht es nicht, daß ich die Amme und das Fest zur Geburt bezahlen mußte? Dein Gebet hat mich ruiniert«, lachte er bitter. »Sei doch froh, daß ich dich dafür nicht blechen lasse.«
»Gut!« antwortete der wortkarge Farag und wartete auf den Sonntag.
Er war seit seiner Kindheit nicht mehr in der Kirche gewesen, doch an jenem Sonntag ging er hin. Sein Bruder stand mit den Honoratioren des Dorfes in der ersten Reihe. Farag war ein kräftiger Bursche. Er ging zu seinem Bruder, warf ihn zu Boden und fing an, ihn zu ohrfeigen, während der Pfarrer von der Liebe zum Feind predigte. Die Männer, die in den vorderen Reihen saßen, rannten entsetzt hinzu, um den Störenfried hinauszuwerfen, doch Farag stieß sie zurück und ohrfeigte seinen Bruder weiter. Dann übermannten ihn die Männer. Er aber schrie: »Ich bin erst bei der dreiundzwanzigsten angekommen. Laßt mich!«
Nach dem Kirchgang wollte Farag sich nicht versöhnen. »Entweder bekomme ich das Lamm, oder ich gebe ihm die restlichen siebenundsiebzig Ohrfeigen!« brüllte er.
Der Bruder wollte vom Lamm nichts hören, dafür aber Schmerzensgeld für die Ohrfeigen haben.
Als alle Bemühungen der angesehenen Männer des Dorfes, Frieden zwischen den Brüdern zu stiften, scheiterten, empfahlen sie den Brüdern, zum Kadi nach Damaskus zu gehen. Beide willigten ein und machten sich am nächsten Morgen auf den Weg in die Hauptstadt. Sie wanderten den ganzen Tag, und als es dunkel wurde, erreichten sie Kabun, einen Vorort von Damaskus.
»Ich habe hier einen angesehenen Freund, bei dem ich übernachten kann. Sieh zu, daß du irgendwo eine billige Absteige findest«, sagte der Bruder.
»Du weißt doch, ich habe kein Geld. Ich werde vor dem Haus deines Freundes auf dich warten. Geh nur«, antwortete Farag.
Der Bruder wurde vom reichen Händler herzlich empfangen. Er ließ ihm nicht nur die schmackhaftesten Gerichte und Früchte vorsetzen, sondern unterhielt seinen Gast auch mit den Klängen seiner Laute. Farag hockte auf der Straße, roch den würzigen Duft, hörte die lieblichen Melodien und aß sein trockenes Brot mit den gekochten Malven, die seine Frau ihm als Proviant für die Reise mitgegeben hatte.