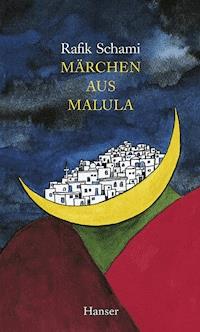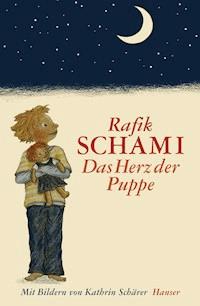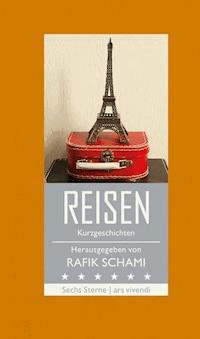Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Großer Auftritt für Rafik Schami: In seinem neuen, persönlichsten Buch erzählt er, wie er zu einem der beliebtesten Erzähler Deutschlands wurde. Er berichtet von seiner Kindheit in Damaskus, als es noch Geschichtenerzähler gab, die im Kaffeehaus ihr Garn gesponnen haben, er zeichnet ein liebevolles Porträt seines Großvaters, und er macht sich Gedanken darüber, wie die Märchen in die Welt gekommen sind. In diesem Buch, und das macht den großen Reiz aus, spricht Schami mit dem Leser - und wir hören ihm atemlos zu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Großer Auftritt für Rafik Schami: In seinem neuen, persönlichsten Buch erzählt er, wie er zu einem der beliebtesten Erzähler Deutschlands wurde. Er berichtet von seiner Kindheit in Damaskus, als es noch Geschichtenerzähler gab, die im Kaffeehaus ihr Garn gesponnen haben, er zeichnet ein liebevolles Porträt seines Großvaters, und er macht sich Gedanken darüber, wie die Märchen in die Welt gekommen sind. In diesem Buch, und das macht den großen Reiz aus, spricht Schami mit dem Leser — und wir hören ihm atemlos zu.
Rafik Schami
Die Frau, die ihren Mann auf dem Flohmarkt verkaufte
Oder wie ich zum Erzähler wurde
Carl Hanser Verlag
Wie alles begann
»Wie viele Lesungen haben Sie denn bisher gehalten?«, fragte mich eines Abends nach einer Veranstaltung eine Journalistin. Ich war überrascht und hatte keine genaue Antwort parat. Aber meine Steuerberaterin, deren Dienste ich seit Jahrzehnten in Anspruch nehme, teilte mir auf meine Anfrage hin mit, dass ich in den vergangenen dreißig Jahren genau 2321 Lesungen absolviert habe und dazu 362723 Kilometer gefahren war. Das heißt vereinfacht, aber poetisch formuliert: In all den Jahren bin ich neunmal erzählend um die Erde gefahren.
In der Ruhe, die sich nach einer langen Tournee einstellt, fand ich nun eine Oase, um mir ein paar Gedanken über meinen Weg zu machen.
Mit Sicherheit hat meine Entscheidung, Erzähler zu werden, mit meiner Kindheit zu tun. Aber was genau meinen wir mit Kindheit? Wenn man Leute danach fragt, erzählen sie von einem bestimmten Zeitabschnitt ihres Lebens und nicht selten von einem genau definierten Ort. Aber Kindheit ist mehr als Ort und Zeit. Sie ist ein Gefühl, eine Lebenseinstellung. Sie ist ein Spiel und eine Philosophie. Kindheit, das sind Träume, Geschehnisse und Geschichten, die uns prägten und prägen.
Wenn all das Kindheit heißt, und es ist bei Gott noch nicht alles, so hat mich meine Kindheit zum Erzähler gemacht. Und diese Kindheit muss so starken Einfluss gehabt haben, dass sie alle Vernunft besiegen und mich dazu bringen konnte, Damaskus, die schönste Stadt der Welt, zu verlassen, und nicht nur das. Sie ließ mich später fast kaltblütig eine wahnsinnige Entscheidung gegen meine Erziehung treffen: Ich gab einen sicheren, hochdotierten Beruf als Chemiker bei einem Weltkonzern auf und ergriff den unsicheren Beruf eines Erzählers in einer fremden Sprache. Heute, wiederum viele Jahre später, zittere ich, wenn ich daran denke, wie leichtsinnig die Entscheidung damals war. Aber heute weiß ich auch, dass ich niemals in meinem Berufsleben eine bessere Entscheidung getroffen habe.
Meine lange Reise als Erzähler führte mich, wie bereits gesagt, neunmal um die Erde. Sie begann aber mit einem kleinen Schritt an einem Frühlingstag im Jahre 1953. Ich war damals sieben Jahre alt und begleitete meinen Großvater durch die Altstadt. An jenem Tag erlebte ich etwas, das ich erst über fünfundfünfzig Jahre später als den Anfang meines Weges verstehen sollte.
Die Frau, die ihren Mann auf dem Flohmarkt verkaufte
»Das, wobei unsere Berechnungen versagen,
nennen wir Zufall.«
Albert Einstein
»Zufall ist vielleicht das Pseudonym Gottes,
wenn er nicht unterschreiben will.«
Anatole France
Mein Großvater väterlicherseits war witzig, großzügig und immer für ein Abenteuer bereit.
Er lebte in Malula, einem christlichen Dorf in den Bergen. Wenn er uns in Damaskus besuchte, kam er oft alleine, da seine Frau, meine Großmutter, uns nicht mochte. Das beruhte auf Gegenseitigkeit. Wir waren die Brut ihrer verhassten Feindin, meiner Mutter, die mit ihren schönen Augen meinen Vater verführt hatte. Der Plan der Großmutter, ihren Sohn mit seiner reichen Cousine zu verheiraten, scheiterte an dieser hübschen, aber bettelarmen jungen Frau, die später meine Mutter werden sollte.
Das Allerschlimmste für meine Großmutter aber kommt erst noch: Es war die Zunge meiner Mutter, mit der sie zehn Frauen vom Kaliber meiner Großmutter an die Wand stellen konnte. Großmutter lästerte, meine Mutter habe ihre Zunge vom Teufel geliehen.
Für meinen Großvater war dieselbe Zunge ein Garten voller Lachen, voller Gerüchte und Anekdoten, wie er sich einmal ausdrückte. Er selbst war schüchtern, und sein Leben lang bewunderte er die Schlagfertigkeit meiner Mutter.
Ich wunderte mich immer, wie er es mit seiner Frau aushielt. Einmal fragte ich ihn, warum er nicht zu uns ziehe. Da lachte er: »Deine Großmutter kann nicht einschlafen, wenn sie ihre Hände und Füße, die immer eiskalt sind, nicht bei mir deponiert hat. Und ich bin ein Ofen.«
Und als er abends seinen Rotwein genoss, sah er zu mir herüber und sagte nur: »Heizöl.« Keiner außer mir verstand ihn. Ich verschluckte mich vor Lachen, und mein Vater bekam ein rotes Gesicht, wie immer, wenn er mit seinem Vater schimpfen wollte und nicht durfte.
Wenn Großvater bei uns übernachtete, bestand er darauf, auf einer Matratze im Kinderzimmer zu schlafen. Er lehnte das herrliche Gästebett ab, das ihm mein Vater anbot. In jenen Nächten konnten wir, meine zwei Brüder und ich, kaum schlafen. Wir lachten über seine Geschichten, was nicht selten damit endete, dass unser Vater hereinkam und seinen Vater mahnte, endlich Ruhe zu geben und uns schlafen zu lassen. Er, der reiche und mächtige Großvater, mimte dann den Ängstlichen und versteckte sich unter seiner Decke, und wir konnten noch weniger einschlafen.
Eines Nachts tanzte er auf seiner Matratze und sang laut und unverständlich. Die Melodie hörte sich sehr fremdartig an. Es handelte sich, wie er behauptete, um Lieder und Gesänge der Dschinn, und seine Tanzpartnerin war keine Geringere als die Frau von Schamhuresch, dem Herrscher der Dämonen. Dieser konnte nicht billigen, dass sich seine Frau in einen »Irdischen«, wie er Großvater verächtlich nannte, verliebte. So ließ sich Großvater darauf ein, mit Schamhuresch zu kämpfen, nachdem dieser versprochen hatte, keine faulen Tricks anzuwenden. Dschinn haben nämlich die lästige Angewohnheit, sich in Sekundenschnelle in eine andere Form und Erscheinung zu verwandeln. Hat man sie am Hals gepackt, werden sie zu Skorpionen oder Krokodilen, legt man sie flach auf den Boden, werden sie zu einem See. Will man sie in den Hintern treten, werden sie zu Feuer und Glut. Das wussten wir aus früheren Erzählungen, und wir verfolgten die Schlägerei gespannt, bei der der Großvater sein Talent als Pantomime exzellent unter Beweis stellte. Man konnte beinahe die unsichtbare Faust des eifersüchtigen Dschinns sehen, wenn sie Großvaters Kinn traf. Der Kampf dauerte länger als zehn Minuten … Und das alles auf der Matratze in unserem Kinderzimmer! Als plötzlich die Tür aufging, erstarrte mein Großvater zu einer Gipsfigur.
»Soll ich den Hörern im Hof Eis servieren oder ihnen ein Eintrittsgeld abverlangen?«, fragte mein Vater verärgert. Ich hob den Vorhang. Tatsächlich saßen unsere Nachbarinnen und Nachbarn im Innenhof. Sie genossen in jener Sommernacht die kühle Luft unter freiem Himmel und desgleichen die Abenteuergeschichte meines Großvaters — bis die Zensur für eine Unterbrechung sorgte.
»Eis wäre nicht schlecht«, erwiderte Großvater und sackte in sich zusammen, als wäre er ein Löffel Vanilleeis in einer heißen Pfanne. Mein Vater schüttelte nur den Kopf, schloss die Tür und kehrte in sein Zimmer zurück.
»Und?«, flüsterte mein ältester Bruder, nachdem er sich vergewissert hatte, dass mein Vater weit genug weg war. »Wer hat gesiegt?«
»Natürlich ich, aber das hat mich einen Zahn gekostet«, erklärte Großvater, und er zeigte uns die Lücke in seinem Unterkiefer. Ich werde nie vergessen, wie er geduldig den Mund aufhielt, während wir drei mit der Taschenlampe seinen Unterkiefer erforschten.
So war er bis zum letzten Tag seines Lebens, von dem ich noch erzählen werde. Aber lange davor, an einem Tag in Frühjahr 1953, fragte er mich, ob ich mit ihm durch die Altstadt spazieren wolle.
Wir schlenderten durch die Gerade Straße. Mir schien an jenem Tag, dass alle Händler, Bettler, Polizisten, Lastenträger und Wirte meinen Großvater kannten und mochten. Sie grüßten ihn freundlich, und drei-, viermal luden ihn Männer zu einer Tasse Kaffee ein. Er lehnte höflich ab und wiederholte, er wolle mit mir, seinem Enkel, zum Flohmarkt gehen. Und das war keine Lüge gewesen, denn tatsächlich hörte ich an jenem Tag zum ersten Mal in meinem Leben vom »Suk Qumeile«, dem Flohmarkt. Ich war verwundert und dachte, mein Großvater wolle sich einen Scherz mit mir machen. Aber er schwor bei der heiligen Maria, dass eine ganze Straße den Namen Flohmarkt trage. Man könne dort interessante alte Dinge finden. Dann erzählte er mir, welche Raritäten er bisher schon erstanden hatte. Und auch von den Tricks der Händler, billige Ware als Antiquität zu tarnen und Anfängern für viel Geld anzudrehen.
Suk Qumeile lag in der Nähe der Zitadelle. Auf beiden Straßenseiten waren kleine, winzig kleine Läden dicht aneinandergereiht, und da es mehr Waren als Platz gab, standen auch die Bürgersteige voller Kleider, Spielzeug und Haushaltsgeräte. Es störte aber niemanden. Die Passanten gingen auf der Fahrbahn, und die wenigen Autofahrer, die vorbeikamen, hatten eine Engelsgeduld. Sie schlängelten sich im Schritttempo zwischen den Menschen hindurch und hupten nur, wenn man sie vergaß.
Ich durfte alles anfassen und fand bald einen bunten Musikkreisel, der zwar zwei Dellen hatte, aber wunderschöne Musik machte. Die Händlerin wollte — meinem Großvater zuliebe — keinen Gewinn machen und verlangte drei Lira. Mein Großvater behielt trotz der Schmeichelei einen kühlen Kopf und kaufte mir den Kreisel nach kurzem Feilschen für eine Lira. Für sich selbst erstand er bei einem anderen Händler eine Goldmünze und sagte leise zu mir, er habe diese seltene Münze seit Jahren gesucht.
Schließlich hielt er sich eine ganze Weile bei einem Händler auf, dessen Laden, abgesehen von Zetteln, die an der Wand klebten, leer war. Ich wunderte mich und fragte meinen Großvater, was der Mann verkaufe.
»Offiziell Häuser«, antwortete er. »Der Mann ist ein Makler. Aber inoffiziell verkauft er die besten Gerüchte, die man haben kann, weil er alle Häuser der Stadt und ihre Geheimnisse kennt.«
»Hallo«, rief ein Dattelverkäufer meinem Großvater zu, als wir weitergingen, »willst du zwei Kilo Kummer kostenlos haben oder ein Kilo irakische Datteln, bei denen du deinen Kummer vergisst?«
»Dann lieber die Datteln«, erwiderte mein Großvater, und ich bekam vom Verkäufer eine Tüte mit großen saftigen Datteln.
Plötzlich wurden mein Großvater und ich auf eine Menschentraube aufmerksam, die sich vor einem Laden gebildet hatte und bis zum Bürgersteig auf der anderen Straßenseite reichte. Mein Großvater, raffiniert wie er war, rief den Männern und Frauen, die uns im Wege standen, zu: »Macht Platz für das Waisenkind.« Nichts auf der Welt setzt einen schwergewichtigen Araber so schnell in Bewegung wie die Aufforderung, einem Waisenkind Durchgang zu gewähren. Mein Großvater schob mich vor sich her und schlüpfte, geschmeidig wie ein Schatten, hinter mich, bevor sich die Öffnung wieder schloss, und so standen wir binnen kürzester Zeit in der ersten Reihe.
»Waisenkind?«, raunte ich, denn meine Eltern waren erst Anfang dreißig.
»In siebzig Jahren bestimmt«, entgegnete er und richtete den Blick nach vorne. Ich wollte noch fragen, woher er das wisse, aber das Geschehen vor mir faszinierte mich so sehr, dass ich meine Eltern schnell vergaß. Mit offenem Mund starrte ich auf den Mann, der auf einem alten Sessel vor dem Laden saß. Er hielt ein Stück weißer Pappe vor sich, auf dem mit großen Buchstaben stand: Zu verkaufen. Das konnte ich gerade schon entziffern.
Am Eingang des Ladens stand neben Haushaltsgeräten und einem Haufen alter Kleider eine ältere Frau in einem blauen Overall. Sie stritt gerade mit einem jungen Mann, der nicht einsehen wollte, warum sie ihren Mann zum Verkauf gab.
Ich will wirklich nicht lügen und behaupten, ich hätte mit sieben Jahren alles verstanden. Was ich aber verstand, war, dass die Frau den Mann verkaufen wollte, weil dieser alt war.
»Und obwohl dieser Mann keineswegs stumm ist, macht er den Mund nicht auf, tage-, monate-, jahrelang kann der Mann ohne Worte leben«, rief die Frau in diesem Augenblick bitter, was ich nie vergessen habe. Und was ich auch verstand, war, dass sich der Mann mit Pferden gut auskannte und dass die Frau drei behinderte erwachsene Söhne zu ernähren hatte. Die Aufregung war groß, aber die Frau hielt allem stand. Auch vor einem besonders dürren Mann, der die Polizei rufen wollte, fürchtete sie sich nicht.
Nach einer Weile ging ein älterer Herr in einem feinen europäischen Anzug zu der Frau hin und zählte ihr den verlangten Preis Schein für Schein auf die Hand. Wie viel das war, weiß ich heute nicht mehr. Aber ich erinnere mich, dass die Frau ihren Mann ein letztes Mal umarmte und weinte.
Schweigsam zogen wir weiter, mein Großvater und ich. Mir schien, als hätte der Vorfall auch ihn mitgenommen. Erst auf dem Weg zurück, etwa auf der Höhe vom Suk al Busurije, dem Gewürzmarkt, fragte ich ihn, warum die Frau ihren Mann verkauft hatte.
»Weil sie arm ist. Immerhin kann sie mit dem Geld in schlechten Zeiten wie diesen überleben, und der Mann hat jemanden gefunden, der ihn für seine Pferde braucht.« Er hielt kurz inne. »Die Pferde nehmen es ihm nicht übel, wenn er den ganzen Tag schweigt, aber die Frauen mögen das nicht.«
»Und wird Großmutter dich verkaufen?«
Er lächelte. »Nein, ich glaube nicht, denn ich erzähle ihr dauernd etwas Neues, und dann vergisst sie, dass sie mich loswerden wollte.«
An diesem Tag fasste ich den geheimen Vorsatz, Frauen immer Geschichten zu erzählen, damit sie mich nicht verkaufen. Und noch einen geheimen Plan heckte ich auf dem Nachhauseweg aus.
»Liebte die Frau den Mann?«, fragte ich Großvater.
»Natürlich, du hast gesehen, wie sie beide beim Abschied weinten. Der Käufer tröstete sie, dass ihr Mann sie besuchen dürfe, so oft er wolle.«
Nun war mein Plan perfekt.
Zu Hause angekommen, machte meine Mutter Augen, als ich ihr vorschlug, meinen schweigsamen ernsthaften Vater auf dem Flohmarkt zu verkaufen und dafür den alten preiswerten Großvater und noch dazu ein Radio zu erstehen.
»Aber ich liebe deinen Vater«, sagte sie, wie ich erwartet hatte und wie alle Welt wusste.
»Macht nichts. Er kann dich so oft besuchen, wie er will«, beruhigte ich sie.
»Nein, nein«, sagte die Mutter, »den verkaufe ich nicht, und deinen Großvater bekommen wir gratis.«
Merkwürdigerweise kaufte mein Vater eine Woche später ein Radio für meine Mutter. Wahrscheinlich aus Dankbarkeit. Das waren damals sehr teure Geräte, die wie ein Möbelstück aussahen. Neben dem Arzt Michel waren wir die einzigen in der Gasse, die so ein Prachtstück besaßen. Und so kamen alle Nachbarn zu uns, um Kaffee zu trinken und Lieder, Nachrichten und Geschichten zu hören.
Manchmal jammerte mein Vater, dass das Radio mehr Kaffee verbrauche als Strom. Dann sah ich zu meiner Mutter und flüsterte nur: »Flohmarkt«, und sie lachte verschwörerisch.
Mit Papierschwalben nach Timbuktu
Großvater spielte nicht nur Theater. Er spielte mit allem, was in seine Hände geriet. Am liebsten aber bastelte er Papierdrachen und faltete Papierschwalben. Er hatte Hände, die das Papier auch ohne Lineal und Schere messerscharf falten und zerreißen konnten.
Wann immer ich als Kind krank war, setzte er sich zu mir und faltete mir Schwalben, und wir schickten sie gemeinsam aus dem Fenster im ersten Stock auf Reisen. Seine Schwalben schwebten lange und elegant in der Luft. Sie zogen weite Schleifen, bevor sie sanft landeten. Nur selten stürzten sie direkt in den Innenhof. Und dort, wo sie landeten, waren exotische Orte, von denen ich zum ersten Mal hörte.
Die Küche der Nachbarin Samira taufte mein Großvater auf den Namen Timbuktu, die Treppe vom Erdgeschoss zu uns herauf hieß Helsinki. Die Terrasse meinem Fenster gegenüber Sibirien, unsere Küche daneben Madrid, der Korridor, der im Erdgeschoss Innenhof mit Haustür verband, war der Gotthardtunnel. Unser Bad nannte er Honolulu und das Schlafzimmer meiner Eltern Bombay.
Niemand störte sich an unseren Schwalben, denn wenn eines der Nachbarkinder eine davon fing, schenkte der Großvater sie ihm mit den Worten: »Sie wollte seit Stunden zu dir.« Und das zu meinem Ärger, denn manch einem Nachbarskind gönnte ich nicht einmal einen Papierschnipsel, geschweige denn eine herrliche Schwalbe. Aber Großvater war nicht gewillt, in solchen Fragen auf mich zu hören.
Wie gesagt, niemand hat sich über eine Schwalbe geärgert, die in Timbuktu, Helsinki oder Bombay landete, aber mit der Zeit ärgerte sich mein Vater über unsere Gespräche beim Essen. »Salim kommt gerade aus dem Gotthardtunnel und geht nach Timbuktu«, sagte Großvater, wenn der alte Witwer Salim vom Einkaufen zu Samira in die Küche kam. Er kaufte gerne für die alte Nachbarin ein, dafür kochte sie seit dem Tod seiner Frau für ihn. Man sah am roten Gesicht meines Vaters, dass der Ärger, den er mit seinem Essen schlucken musste, ziemlich groß war. Und als ich kurz darauf meine Schwester, die gerade etwas aus der Küche holen wollte, unklugerweise aufforderte: »Bring mir bitte Salz aus Madrid mit«, war es um die Geduld meines Vaters geschehen …
Murmeln meiner Kindheit
»Der Mensch spielt nur,
wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist,
und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.«
Friedrich Schiller
»Wer älter wird, der wird nicht aufhören zu spielen. Aber wer aufhört zu spielen, der wird älter.«
George Bernard Shaw
»Murmeln« bedeutet, leise und undeutlich vor sich hin zu sprechen, und zugleich steht das Wort für die kleinen aus Marmor, Stein, Ton, Glas oder anderen Materialien hergestellten Kugeln, mit denen Kinder weltweit spielen. Man nennt sie auch Schusser, Marmeln, Marbeln, Batzen, Dotzer, Klicker und Kuller — über hundert verschiedene Bezeichnungen lassen sich zusammentragen. Das Wort Murmel selbst stammt von Marmor, aus dem Murmeln früher häufig hergestellt wurden.
Die leise Stimme meiner Kindheit, die mir flüsternd vergangene Zeiten und verlorene Paradiese zurückbringt, verbindet sich unzertrennlich mit dem Murmelspiel. Merkwürdigerweise meldet sich die Erinnerung nicht in Farben und Bildern, obwohl die alte Stadt Damaskus an beidem reich ist, sondern als Klangteppich aus Stimmen, Geräuschen, Musik und der Stille der Morgendämmerung, die ich als Kurzschläfer seit meiner Jugend genieße.
Der Klang der Stadt Damaskus veränderte sich einerseits mit der Zeit und andererseits mit seiner räumlichen Ausdehnung — von Gasse zu Gasse, von Straßenecke zu Straßenecke, von Viertel zu Viertel. Als Jugendlicher besaß ich ein Fahrrad, mit dem ich alle Viertel der Altstadt auf eigene Faust erkundete. Ich war neugierig, wie die Gassen aussahen, wie sie sich anhörten, wie sie dufteten.
In manchen Gassen lagerten die Händler Zimt, Koriander, Sesam, Thymian und Süßholz. In anderen Gassen standen kleine Fabriken, in denen Pistazien geröstet, Sesam und Oliven gepresst und vor allem Süßigkeiten hergestellt wurden.
In unserer Gasse im Osten der Altstadt etwa, mitten im christlichen Viertel, waren mehr Kirchenglocken als Muezzinrufe zu hören. Sie duftete sommers wie winters stark nach Anis, weil es hier ein großes Anislager gab, von dem aus landes- und weltweit Handel betrieben wurde. Ein alter Mann mit O-Beinen verbrachte den ganzen Tag damit, Anis zu sieben und in große Säcke zu füllen. Er war seit seinem zehnten Lebensjahr beim Anishändler angestellt. Von Jahr zu Jahr wurde der Mann kleiner, und er sah grüngrau wie die Aniskörner aus, wenn er bei Sonnenuntergang nach Hause ging. Mit der Zeit sah er auch grüngrau aus, wenn er am Morgen kam. Und er wurde immer kleiner, bis er eines Tages verschwand. Mein Großvater erzählte mir, der Mann wurde so klein, dass er selbst durch das Sieb fiel, in einen Sack verpackt und ins Ausland verschickt wurde.
Es dauerte Jahre, bis ich mit Sicherheit sagen konnte, ich kenne jede Gasse und jeden Winkel der Stadt. Von dem Zeitpunkt an war ich in sie vernarrt, ohne es jedoch zu merken. Und hätte sich irgendein verrückter Professor dafür interessiert, ich hätte ihm eine kuriose Klang- und Duftkarte der Stadt gezeichnet.
Ich war natürlich nicht überall gerne gesehen. Das konnte ich auch nicht erwarten, denn in meiner Gasse sahen wir auch nicht jeden Fremden gerne. Aber ich kam — nicht selten mit Schrammen und Beulen — immer davon, weil eine feine Antenne in meinem Innern mir die Gefahr im Voraus anzeigte und ich rechtzeitig die Flucht ergreifen konnte. Gläubige Menschen wie meine Mutter sprachen eher von einem Schutzengel, und da ich unbelehrbar blieb, sagte sie eines Tages in ihrer unnachahmlichen Art: »Ich werde sonntags eine Kerze mehr für die heilige Maria anzünden, damit sie dich vor allem Übel und den armen Schutzengel vor einem Herzinfarkt schützt. Du wirst sehen, die heilige Maria macht das schon. Sie war eine tapfere Mutter.«
Der Klang veränderte sich im Lauf der Jahreszeiten, aber auch im Lauf eines Tages. Am frühen Morgen hörte ich bereits als Kind gerne das leise Meckern der Damaszener Ziegen, einer besonders ruhigen Rasse mit glatten rotbraunen Haaren, deren Milch nach wilden Kräutern schmeckte. Die Milchverkäufer zogen von Gasse zu Gasse, und wir standen mit unseren Schüsseln an den Türen und erwarteten sie schon.
Ein wenig später mischte sich der Lärm der spielenden Kinder mit dem Dröhnen des Verkehrs, den Rufen der Bettler, dem Lachen aus der Nachbarschaft, dem Gesang aus den Radios, die voll aufgedreht wurden, und dem Singsang der Straßenverkäufer, die die Hausfrauen aus der Tiefe ihrer Häuser lockten. Nicht selten übertrieben die Händler maßlos. Aus ihren Tomaten wurden Schönheiten und aus einfachen Feigen wurden Honigdepots, um deren Süße die Bienen sie beneideten. Einfaches Gemüse wurde zu einem melodischen Gedicht. Die Straßenverkäufer in Damaskus besingen ihre Produkte so, als wären Tomaten, Kartoffeln, Aprikosen oder Thymian nicht Gemüse, Obst oder Kräuter, sondern Juwelen, Gaben des Himmels. Manchmal singen sie mit geradezu religiöser Inbrunst und oft witzig. Wer soll nicht lächeln, wenn er hört, dass die Tomaten sich mit Rouge die Wangen schminken, bevor sie mit dem Verkäufer spazieren gehen. Wer wird nicht neugierig, wenn er hört, dass EstragonVerräter genannt wird?
Gegen Mittag ebbten die Stimmen ab, denn dann genossen die Damaszener ihre Siesta, und abends klang Damaskus bunt geschwätzig, aber sehr friedlich.
Einzelne Stimmen von Nachbarn waren zu hören, so die unverwechselbare Stimme des Kutschers Salim, der mir als Erster erzählt hatte, dass sich hinter jeder unscheinbaren Damaszener Tür 1001 Geschichten verbargen. »Wer all die Geschichten sammelt, wird unsterblich«, sagte der alte Mann. Eine dieser Geschichten geschah sieben Häuser weiter. Sie handelte vom Lautenspieler Samir. Abends hörte man ihn spielen, und wenn meine Eltern und die Nachbarn die melancholische Melodie der Laute vernahmen, verstummten sie für einen Augenblick und nickten begeistert. Doch ihr Mund besiegte ihre Ohren, und so erhoben sich ihre Stimmen wieder und verdeckten die Klänge der Laute.
Der Fliesenleger Samir war ein schweigsamer Mann von gut dreißig Jahren. Nach der harten Arbeit duschte er, rasierte sich, ölte sein Haar, wie es damals Mode war, und zog sein schneeweißes arabisches Gewand an. Dann stolzierte er wie ein glücklicher Bräutigam zur Haustür, warf einen Blick auf die Gasse, bevor er zu seiner Braut, der Laute, zurückkehrte, sie umarmte und ihr die schönsten Töne entlockte. Seine Frau machte sich nichts daraus. Sie war eine spröde Bauerntochter. Ich kannte sie nur schwanger, fünf, sieben oder neun Kinder hatten die beiden.
Welcher Teufel ritt ihn plötzlich, dass er sich von einem Emigranten den Kopf verdrehen ließ, Frau und Kinder zurückließ und ohne Abschied mit seiner Laute nach Brasilien durchbrannte? Man hörte nie wieder von ihm, aber die irrsinnigsten Gerüchte über sein Verschwinden machten die Runde.
Seine Frau wurde verrückt und erzählte von Papageien, die zu ihr kamen und ihr von der Sehnsucht ihres Mannes erzählten.
Stimmengewirr, ein Streit zwischen zwei Nachbarn und dazwischen ein alter Mann, der die Streithähne mit einer Geschichte zu besänftigen versucht. An jenem Tag scheiterte er, aber von einem kleinen ängstlichen Jungen wurde er dennoch vergöttert. Der Mann war der Kutscher Salim und der Junge war ich.
Auch entsetzte Schreie drängen sich in meine Erinnerungen. Eine Verhaftungswelle brachte Trauer und Wut unter die Dächer von Damaskus. Meine Familie, die bis zu jenen Jahren der Union mit Ägypten (1958—1961) derartige Gewalt noch nie erlebt hatte, ging durch die Hölle. Ich war dreizehn, als man meinen Vater vor meinen Augen verhaftete. Das Nasser-Regime verbreitete Terror, statt für das versprochene Paradies der vereinigten arabischen Nation zu sorgen. Es herrschte Angst, als der erste Spitzel in unsere Gasse einzog. Es war, um in der Sprache der Industrie zu sprechen, eine neue Generation von Spitzeln. Sie agierte nicht mehr geheim, wie es sonst üblich war, sondern ungeniert und offen. Die Spitzel trugen eine große Pistole unter ihrem Hemd, die für jedermann sichtbar war. Deshalb nannte ich sie nicht Spitzel, sondern »Angstmacher«, denn es war ihre oberste Aufgabe, die Menschen einzuschüchtern.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: