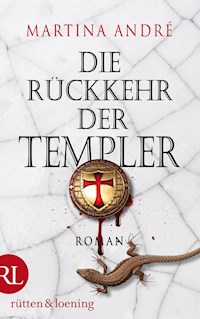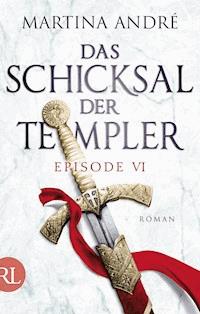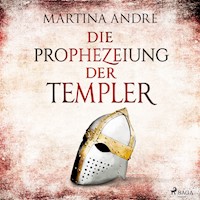Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martina André
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gero von Breydenbach
- Sprache: Deutsch
Im Jahre des Herrn 1292 kehrt der Edelfreie Richard von Breydenbach zusammen mit einem achtjährigen Mädchen zur Burg seiner Familie zurück. Nach dem Fall der Stadt Akko im Heiligen Land hat er die kleine Jüdin vom Totenlager ihrer Eltern gerettet. Er nimmt das Mädchen an Kindesstatt an und lässt es auf den Namen Elisabeth taufen. Seinem zwölfjährigen Sohn Gero befiehlt er, sich um die neue Adoptivschwester zu kümmern und sie im christlichen Glauben zu unterweisen. Nach Jahren kindlicher Zuneigung verlieben sich Gero und Lissy, wie er sie zärtlich nennt, ineinander. Als er zu seinem einundzwanzigsten Geburtstag den Ritterschlag erhält und dem Orden der Templer beitreten soll, steht er unvermittelt vor einer schweren Entscheidung. Bekennt er sich zu seiner verbotenen Liebe und bricht damit den heiligen Schwur seines Vaters, oder folgt er dem Ruf des Ordens, der ein ungeahntes Mysterium hütet. Gesamtausgabe Band 1 der Templer-Saga um den deutschen Templer "Gero von Breydenbach" mit sechs Episoden, die auch einzeln als eBook verfügbar sind. Ideal für Fans von "Knightfall" und "Outlander".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 876
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Geheimnis des Templers
Collector’s Pack
Episode I - VI
Martina André
»Das Geheimnis des Templers«
ISBN 978-3-911050-00-5
Veröffentlichung: Dezember 2023
© Martina André
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung der Autorin zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Dieser Titel erschien erstmals von Dezember 2012 bis Februar 2013 in sechs Teilen als »Das Geheimnis des Templers Ep. I - VI« im Aufbau Verlag, Berlin
Umschlaggestaltung und Illustration: Dr. Lukas Mühlbauer, Edinburgh
unter Verwendung von Shutterstock Inhalten von © Richard Peterson, © SimeonVD
Impressum/Herstellung:
Martina André c/o Dr. Lukas Mühlbauer
25/8 Greenpark, Edinburgh EH17 7TA, United Kingdom
www.martinaandre.com
Handlung und Personen in diesem Roman sind bis auf einige historische Persönlichkeiten, deren Handeln ebenfalls der Fantasie der Autorin entsprungen ist, frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten mit noch lebenden Personen und deren Handlungsweise sind rein zufällig.
* * *
Die chronologische Reihenfolge der „Gero von Breydenbach Saga“:
Das Geheimnis des Templers
Das Rätsel der Templer
Die Rückkehr der Templer
Das Schicksal der Templer
Das Erbe der Templer
Die Prophezeiung der Templer
Über die Autorin
Martina André, 1961 in Bonn geboren, ist eine erfolgreiche Autorin, bekannt für ihren Bestseller „Die Gegenpäpstin“ (2007) und die Templerroman-Serie um den deutschen Tempelritter Gero von Breydenbach. Ihr Pseudonym entstammt dem Nachnahmen ihrer Urgroßmutter, die hugenottische Wurzeln mit in die Familie brachte.
Martina André lebt in Koblenz und Edinburgh. Ihre Werke umfassen historische Romane und die Science-Fiction-Trilogie „RoboLOVE“, die in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Alle ihre Werke sind auch als Hörbücher verfügbar. Weitere Informationen zu Martina André und ihren Veröffentlichungen finden sich auf ihrer Webseite und bei Wikipedia.
www.martinaandre.com
Links zu Social Media:
X (Twitter)
YouTube
Inhaltsverzeichnis
Episode I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Episode II
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Episode III
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Episode IV
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Episode V
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Episode VI
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Personenregister
Glossar
Für meine Lieben
Episode I
Ein Heiliger Schwur
Kapitel 1
Breidenburg/Liesertal/Mosel
Im Jahre des Herrn 1300
* * *
Der 19. März 1292, auch Gedenktag des heiligen Josef genannt, würde Gero unvergesslich bleiben, wie so vieles, was ihn an Elisabeth erinnerte.
Damals waren die Vorbereitungen für seinen zwölften Geburtstag in vollem Gange, und seine Mutter, Jutta von Breydenbach, besprach mit einer Köchin die Menüfolge für ein Festmahl, zu dem sie einige Verwandte und Freunde des Hauses Breydenbach eingeladen hatte.
Auf einem Brotkanten kauend, saß Gero neben den Frauen in der Küche und lauschte interessiert, welche Köstlichkeiten sie aus dem wenigen, was sich nach einem harten Winter in der Speisekammer befand, zaubern wollte, als plötzlich eine alte Waschmagd durch den Türbogen gerannt kam. Wild gestikulierend verkündete sie, dass der Burgherr von seinem Kreuzzug aus dem Heiligen Land zurückgekehrt sei. So wie es aussah, war er zwar verletzt, aber er lebte. Geros Mutter ließ die Liste fallen, die sie bis dahin in der Hand gehalten hatte, und fasste sich ans Herz, als ob sie der Schlag getroffen hätte. Dabei war sie mit einem Mal so bleich wie der Inhalt des Butterfasses. Gero befürchtete schon, sie würde umfallen, doch dann nahm sie ihn bei der Hand und zerrte ihn, gefolgt vom übrigen Gesinde, hinaus auf den Hof, wo sie fünf völlig durchnässten Gestalten auf erschöpft wirkenden Gäulen gegenübertraten. Reiter wie Pferde boten ein Bild des Jammers. Abgekämpft und entkräftet, glitt ein Ritter nach dem anderen aus dem Sattel.
Der verschlossene Ausdruck ihrer bärtigen Gesichter war beängstigend düster und vermittelte Gero das Gefühl, als hätte sich der Anblick der Hölle darin eingebrannt.
„Richard“, stammelte Geros Mutter und fiel ausgerechnet dem Mann um den Hals, den er am allerwenigsten für seinen Vater gehalten hätte. Nur das weißblonde, strähnige Haar, das die eisblauen Augen fast vollständig verdeckte, ließ Gero erahnen, dass es sich um den richtigen Mann handelte. Auch die anderen Ritter – wie sein Vater Gefolgsleute des Erzbischofs von Trier, wie man an ihren abgerissenen Wappenröcken erkennen konnte – glaubte er noch nie im Leben gesehen zu haben. Erst bei näherer Betrachtung erkannte er in ihnen langjährige Kameraden seines Vaters, obwohl auch sie nur noch wenig Ähnlichkeit mit den glattrasierten, frohgemuten Männern hatten, die vor gut zwei Jahren von der Breidenburg ins Heilige Land aufgebrochen waren. Damals waren sie von frenetischem Jubel begleitet worden und der Hoffnung, Jerusalem von den Heiden zurückzuerobern. Später hieß es, die Sache sei nicht so einfach wie gedacht, und man werde länger für die Befreiung des Heiligen Landes kämpfen müssen. Vor ein paar Wochen war ein Bote des Erzbischofs auf der Burg angekommen und hatte Geros Mutter berichtet, Akko sei am 18. Mai des Jahres 1291 endgültig verloren worden, und man wisse nicht, ob die Männer zurückkehren würden. Geglaubt hatte Gero ihm nicht. Er hatte voll und ganz der Waffenkunst seines Vaters und dessen Begleiter vertraut, die nach einem heroischem Aufruf ihres Lehnsherrn mit beinahe dreißig Rittern ins Heilige Land aufgebrochen waren, um zunächst Akko vor dem Einfall der Heiden zu bewahren und später die Heilige Stadt zurückzuerobern. Geros Mutter war nicht gerade begeistert gewesen, als ihr Mann sie mit zwei minderjährigen Söhnen auf dem Familienstammsitz der Breydenbacher zurückgelassen hatte.
Aber Geros Vater hatte damit argumentiert, dass er einen solchen Lehnsdienst nicht ablehnen könne und sie froh sein solle, dass er ihr wenigstens die Wachtruppen zurücklassen werde. Außerdem hatte er ihr mit dem Zisterziensermönch Wintrich von Achenbach einen vertrauensvollen Verwalter an die Seite gestellt, der die Verbindung zum Erzbischof hielt und sich um die dringlichsten Amtsgeschäfte wie die Eintreibung der Abgaben kümmerte. Geros Mutter hätte für solcherlei Dinge fortan sowieso keine Zeit mehr gehabt, weil sie beinahe Tag und Nacht in der Kapelle gesessen hatte, um für die gesunde Rückkehr des Vaters zu beten.
Allem Anschein waren ihre Gebete erhört worden. Richard von Breydenbach machte zwar einen furchterregenden Eindruck, und zu allem Übel fehlte ihm die rechte Hand, aber immerhin lebte er noch.
Mitten unter diesen von Grausamkeiten und Elend gezeichneten Männern befand sich ein unerwarteter Lichtblick. Ein kleines, dunkelhaariges Mädchen, das offenbar hinter seinem Vater im Sattel gesessen hatte, war Gero erst später aufgefallen. In Lumpen gekleidet und dünn wie ein Stock, die großen, braunen Augen auf Gero gerichtet, als wäre er ein aufgehender Stern, stand die Kleine auf dem schmutzigen Pflaster des Burghofes, als habe sie sich verirrt. Und obwohl ihr lockiges Haar so verlaust war, dass selbst Essigwasser nichts helfen würde, war sie für Gero das schönste Wesen, das er je in seinem jungen Leben gesehen hatte.
Die niedliche Kleine war etwa drei Jahre jünger als Gero und allem Anschein nach Jüdin, wie der Vater wenig später bei einem deftigen Mahl zu berichten wusste. Er und seine Begleiter hatten sie beim Angriff der Mameluken auf Akko vom Totenlager der Eltern gerettet, die kurz zuvor von den einfallenden Heiden erschlagen worden waren.
„In der Hitze des Gefechtes habe ich geschworen, sie vor Gott dem Herrn an Kindes statt anzunehmen, wenn er uns lebend aus der Stadt heraushilft“, erklärte er Geros Mutter, die das Ganze zunächst für einen schlechten Scherz hielt. Doch als Geros Vater sie daran erinnerte, dass sie selbst zwei Töchter verloren hatte, lenkte sie ein, und schon kurz darauf hatte sie das Mädchen fest in ihr Herz geschlossen.
Auch Gero und sein Bruder Eberhard hatten keine Mühe, die Kleine als Schwester anzuerkennen, wobei sie Geros vier Jahre älterem Bruder eher gleichgültig war. Was vielleicht daran lag, dass er sich lieber seiner Knappenausbildung widmete als einem zerbrechlichen Püppchen aus dem Outremer, wie er sie nannte.
Der ursprüngliche Name des Mädchens war Hannah gewesen, doch schon bald hatte der Vater sie auf den christlichen Namen Elisabeth taufen lassen und heuerte Gero an, sie zusätzlich zur gottgefälligen Unterweisung durch Bruder Rezzo in der Bibel zu unterrichten. Obwohl Elisabeth so scheu war wie ein Reh und zu Beginn kein einziges Wort in deutscher Sprache verstand, faszinierte sie Gero so sehr, dass sie ihn sogar dazu verleitete, Hebräisch zu lernen.
Der Umstand, dass seine Eltern Elisabeth – oder Lissy, wie er sie nannte – nur an Kindes statt angenommen hatten und sie somit nicht seine leibliche Schwester war, hatte ihn in jungen Jahren bedrückt. Erst als er älter wurde, erkannte er den Nutzen darin. Sie waren nicht blutsverwandt. Das hieß, er durfte sie auf eine weitaus innigere Art lieben, als es bei leiblichen Geschwistern üblich gewesen wäre. Was zudem bedeutete, dass die Gefühle, die er für sie hegte, keiner wie auch immer gearteten Beichte bedurften. Ein geradezu himmlischer Vorteil, wenn man eine gottesfürchtige Mutter und einen strenggläubigen Vater besaß, dessen Verlangen nach unbeugsamem Gehorsam im Sinne der Heiligen Schrift keinen Raum ließ für eine Liebe, der keine Zukunft erlaubt war.
Seinem Vater schien diese Zuneigung ohnehin zu entgehen. Er zog es vor, nach seiner Rückkehr aus dem Heiligen Land unentwegt von seinen Heldentaten zu berichten, und Gero wurde das Gefühl nicht los, dass er sich auf diese Weise für die Niederlage, die er und die übrigen Christen hatten hinnehmen müssen, rechtfertigen wollte. In den endlosen Debatten, die er in Anwesenheit seiner noch jugendlichen Söhne mit anderen einheimischen Rittern führte, hieß es fortan, Jerusalem sei zwar seit der Einnahme von Akko vorerst an die Heiden verloren, aber es gebe durchaus noch eine Chance, diesen ungläubigen Teufeln den heiligen Boden aufs Neue zu entreißen. Allerdings nur, wenn Gott der Herr ein Einsehen habe und die mutigsten aller Ritter noch einmal zusammenrufe, um ihnen in einem letzten, alles vernichtenden Schlag gegen den Feind – und damit meinte er vor allem die ägyptischen Mameluken – endlich den lang ersehnten Sieg zu verschaffen.
Weil irgendein verteufelter Mameluke ihm im Kampf die rechte Hand abgeschlagen hatte, konnte Geros Vater sich leider nicht mehr persönlich für die Rettung des Heiligen Landes einsetzen.
„Aber ich habe ja noch einen jüngeren Sohn, der diese Aufgabe später einmal mit Bravour übernehmen wird“, betonte er stets vor versammelter Mannschaft mit glänzenden Augen und lenkte seine Aufmerksamkeit auf Gero, dem er damit gewaltig schmeichelte. „Nicht wahr, mein Junge?“, fragte er, wie um sich selbst zu bestätigen, und klopfte seinem Jüngsten mit stolzem Blick auf die Schulter. „Ich habe beim Niedergang von Akko vor Gott dem Allmächtigen geschworen, dass ich dich im rechten Alter zum Templerorden gebe“, bekannte er zu Geros Überraschung, „damit du mit der Miliz Christi das zu Ende bringst, was uns versagt worden ist.“ Anschließend schaute er Zustimmung heischend in die staunende Runde und nickte Gero, dem nicht eingefallen wäre, zu widersprechen, bedeutungsvoll zu. „Und so soll es sein.“
Gero hatte zu jener Zeit nicht die leiseste Ahnung, welches Gewicht ein solcher Schwur für ihn haben sollte. Geschweige denn, ob er ihm gerecht werden konnte. Aber es hatte ihm gefallen, wie wohlwollend ihn die Männer nach einer solch gewichtigen Ankündigung gemustert hatten. Jedes Mal, wenn fortan die Rede darauf kam, ließen sie ihm anerkennende Blicke zukommen, ähnlich einem prachtvollen Hengst, den man gewinnbringend versteigern wollte.
„Gero ist jetzt schon ein stattlicher Bursche“, waren sich die Bewunderer seines Vaters einig. „Größer als andere und geschickt mit dem Schwert.“
„Die Templer werden viel Freude mit ihm haben, und die Heiden wird er das Fürchten lehren, sobald sie ihn sehen“, hatte ein anderer gemeint. Worte, die Gero gegenüber seinem älteren, linkischen Bruder als zukünftigen Helden dastehen ließen. Was ihm eine gewisse Genugtuung verlieh. Denn Eberhard, der um einiges kleiner und schmächtiger war als Gero, hielt ihm ständig unter die Nase, dass er als der Ältere das Lehen des Vaters erben würde und damit auch dessen Machtanspruch. Gero blieb als Zweitgeborenem höchstens der Weg in einen christlichen Orden, wie Eberhard mit hämischem Grinsen bemerkte.
„Aus mir wird mal ein Burgherr, und aus Gero wird mal ein Mönch“, verkündete Eberhard gegenüber jedem, der es wissen wollte, mit hochnäsiger Miene. Wobei er absichtlich verschwieg, dass die weißgewandeten Tempelritter zwar Mönche, aber in erster Linie Krieger waren und damit unter der hiesigen Ritterschaft weit mehr Bewunderung auf sich vereinen konnten als gewöhnliche Ordensleute.
„Mönchskrieger“, verbesserte Gero ihn fortan und grinste zufrieden, obwohl er nicht wirklich einschätzen konnte, ob er sich mit einer solchen Aussicht wahrhaftig besser stand als sein Bruder.
Immerhin wurde über den Orden der Templer in den Reihen der Klosterschüler, denen Gero bis zum vierzehnten Lebensjahr angehörte, gerne und viel spekuliert. Nicht selten hinter vorgehaltener Hand, was die Sache für Jungs seines Alters nur noch spannender machte. Es hieß, sie seien in Wahrheit streitende Engel im Auftrag des Herrn, die sich im Kampf gegen die Heiden im Handumdrehen in fürchterliche Dämonen verwandeln konnten. Dabei ließen sie nicht die geringste Gnade walten und schlugen jedem noch so gewitzten Feind den Kopf ab. Selbst wenn Gero still für sich diese Behauptung anzweifelte, weil er sich fragte, wie es denn dann überhaupt zum Verlust des Heiligen Landes gekommen war, schien die Geschichte für sein Ansehen unter den Mitschülern durchaus nützlich zu sein.
Jeder wusste inzwischen, dass er spätestens nach der Schwertleite mit einundzwanzig selbst dieser kämpfenden und betenden Truppe von Engeldämonen angehören sollte. Besonders die schmächtigen Kameraden, denen allenfalls ein Leben als Klosterschreiber beschieden war, beneideten ihn glühend um die Aussicht, zu jener legendären Truppe der Templer zu gehören.
Allein schon aus diesem Grund wäre Gero nicht einmal im Traum eingefallen, den Vorstellungen seines Vaters zu widersprechen.
Im Nachhinein gab es wohl noch andere Gründe, warum er seinem Vater gefallen wollte. Gründe, die ihm damals nicht ins Bewusstsein gerückt waren. Richard von Breydenbach war vor seiner Abreise ins Heilige Land immer ein großer, respekteinflößender Mann gewesen, dem ebenbürtige Adlige mit erheblicher Achtung und seine Leibeigenen mit ängstlicher Unterwürfigkeit begegnet waren. Doch am Tag seiner Rückkehr hatte Gero ihn erstmals als einen gebrochenen Krieger erlebt, was bei ihm zu einer tiefen Verunsicherung geführt hatte. Es war eine seltsame Mischung aus Mitleid und Furcht, die ihn durchströmte, wenn er daran dachte, wie verwundbar sein starker Vater ihm plötzlich erschienen war. So ganz anders als vor diesem Krieg. Wobei ihn vor allem der Gedanke ängstigte, dass Gott der Allmächtige den christlichen Rittern offenbar seine Gnade verweigert hatte, und das, obwohl etliche von ihnen ihr Leben geopfert hatten, um das Land, in dem Sein Sohn geboren und gekreuzigt worden war, von den heidnischen Besatzern zu befreien. Stattdessen hatte der Allmächtige nur untätig zugeschaut, während das sogenannte Heilige Land die überlebenden Christen ausgespuckt hatte wie eine unbekömmliche Mahlzeit.
Was hatten die Streiter Christi falsch gemacht?, fragte Gero sich unaufhörlich. Und würde es ihm eines Tages als Templer gelingen, seinem Vater die Schmach dieser furchtbaren Niederlage zu nehmen, indem er die Heiden besiegte? Richard von Breydenbach glaubte jedenfalls daran, und Gero liebte ihn zu diesem Zeitpunkt zu sehr, als dass er ihn enttäuschen wollte.
Kapitel 2
Entgegen der Aussicht, die Burg eines Tages für die Templer verlassen zu müssen, galten Gero und seine angenommene Schwester schon bald als ein unzertrennliches Paar, obschon sich ihre Gemeinsamkeiten zunächst auf Spiel, Spaß und Lernen beschränkten. Hinzu kam bei Gero das Gefühl, sie vor anderen, stärkeren Kindern auf der Burg und in der Schule beschützen zu müssen. Das Bedürfnis, Elisabeth zu behüten, ließ selbst nicht nach, als sie beide den Kinderschuhen längst entwachsen waren.
Irgendwann kam der Tag, an dem Gero sich eingestehen musste, dass aus kindlicher Zuneigung längst eine tiefergehende Liebe geworden war, die sich mehr und mehr zu einem sehnsuchtsvollen Begehren entwickelte. Spätestens als er seinen sechzehnten Geburtstag beging, hatte ihn der Anblick ihres aufblühenden Leibes eisern im Griff. Schon bald verfolgte ihn ihre süße Gestalt bis in die kühnsten Träume, die, feucht und heiß, nur eine Vorstellung kannten: Elisabeth, wie sie nackt in seinen Armen lag und seine Küsse erwiderte. Unmerklich veränderte sich ihr Verhältnis zueinander. Hatten sie sich zuvor grob geneckt, so war es nun eher ein Gefühl von Zärtlichkeit, das sie füreinander empfanden. Es kam nun öfter vor, dass sie sich wie durch Zufall berührten. Elisabeth forderte ihn manchmal auf, ihr beim Schnüren des Kleides zu helfen, wenn sich die Bänder gelöst hatten, oder ihr die Füße zu trocknen und Blätter aus ihrem hüftlangen Haar zu entfernen, wenn sie gemeinsam durch die umliegenden Wälder gestreift waren.
„Aus dir ist ein gutaussehender junger Mann geworden“, bemerkte Elisabeth mit neckischem Augenaufschlag, wenn sie unter sich waren. Dann strich sie ihm über das dichte, schulterlange blonde Haar und kraulte ein wenig darin, als ob er Harko wäre, das kleine weiße Hündchen, das er ihr zu Weihnachten geschenkt hatte. Ab und an zupfte sie an seiner Kleidung herum und lobte seine breiten Schultern oder seinen hochherrschaftlichen Gang. Zudem bewunderte sie seine Reitkunst und seinen Umgang mit dem Schwert, was ihn dazu anstachelte, nicht nur sie, sondern auch seine Lehrer immer wieder in Erstaunen zu versetzen. Ihr zuliebe lernte er Laute spielen und beschäftigte sich, dem Spott seines Bruders zum Trotz, mit franzischem Minnegesang. Lissy spornte ihn in allem, was er tat, zu Höchstleistungen an. Ihr süßes Lächeln versetzte ihn in Verzückung, und ihre Stimme, glockenhell und klar, klang wie Musik in seinen Ohren. Schon bald kam der Tag, an dem der Gedanke, eines Tages ohne sie leben zu müssen, an Grausamkeit kaum zu überbieten war.
Der Tatsache, dass ihre Liebe zueinander wohl kaum eine Zukunft haben würde, musste er sich endgültig stellen, als im Frühsommer des Jahres 1300 das Ende seiner Knappenausbildung nahte.
Draußen vor der Burg blühten die Bäume, aber in Geros Herz war es kalt wie im tiefsten Winter.
Sein Vater schien im Gegensatz dazu bester Laune. „Spätestens zu seinem 21. Geburtstag nächstes Jahr an Maria Verkündigung wird Gero zum Ritter geschlagen werden“, erklärte er vor einigen Gästen, darunter Geros Patenonkel, Wilhelm von Eltz.
Was nichts Geringeres bedeutete, als dass sich der Schwur seines Vaters endlich erfüllte und es höchstens noch ein dreiviertel Jahr dauern konnte, bis man Gero zu den Templern nach Franzien schickte. Allerdings würde er sich zuvor kaum noch um Lissy kümmern können, sondern musste diese Zeit im Wesentlichen bei Roland von Briey verbringen, seinem bärbeißigen Ausbilder, dem es ein höllisches Vergnügen bereitete, seinem Lieblingsknappen das Fürchten zu lehren. Wobei Gero dafür sogar noch dankbar sein musste, weil Richard von Breydenbach seinen Sohn am liebsten gleich in eine Templerkommandantur geschickt hätte, um dort seine Ausbildung zum Ritter würdig beenden zu können und übergangslos dem Orden beizutreten. Aber Geros Mutter, die ihren Sohn am liebsten für immer zu Hause behalten hätte, hatte sich auch diesmal gegen den Alten durchsetzen können.
„Roland von Briey ist Gero über all die Jahre immer ein hervorragender Lehrmeister gewesen“, argumentierte Jutta von Breydenbach, deren verwitwete Schwester Margaretha als Gräfin auf Waldenstein herrschte.
„Er hat ihn mir immer wieder heil nach Hause gebracht.“
Sein Vater hatte schließlich dem Wunsch seiner Gemahlin nachgegeben. Obwohl Richard von Breydenbach seine Schwägerin nicht besonders leiden konnte, war ihr Mann ihm beinahe wie ein Bruder gewesen. Graf Gerhard von Lichtenberg zu Waldenstein hatte für Geros Vater in Akko sein Leben gegeben, was in Richard ein Gefühl tiefer Schuld hinterlassen hatte. Ein Umstand, der Geros Mutter offenbar zugutekam, als sie seinerzeit vorgeschlagen hatte, Gero für seine Ausbildung als Ritter auf Burg Waldenstein zu entsenden.
Margaretha und Gerhard hatten keine Kinder, daher verwaltete die Gräfin den ererbten Herrschaftssitz ihres verstorbenen Ehemanns als dessen Nachfolgerin. In erster Linie bediente sie sich dabei der Unterstützung ihres Burgvogts. Wobei Roland von Briey sich nicht nur in Fragen der Verwaltung und der Verteidigung gut auskannte, sondern noch andere Talente besaß. Inzwischen war es ein offenes Geheimnis, dass der stattliche, dunkeläugige Vogt und die zierliche, rotblonde Gräfin das Lager teilten. Dass sie sich wirklich liebten, glaubte Gero daran zu erkennen, wie sich in aller Öffentlichkeit küssten. Überhaupt ging es auf Waldenstein längst nicht so steif zu wie auf der Breidenburg. Ein paar Mal im Jahr lud Margaretha Spielleute ein und veranstaltete für ihre Untergebenen ein Tanzvergnügen. Gero mochte die ungezwungene, fröhliche Atmosphäre, die am Hof seiner Tante herrschte, und wünschte sich stets, dass er die Freude darüber mit Lissy teilen könnte. Doch daraus war bisher nichts geworden, und es würde wohl auch nicht mehr dazu kommen, falls ihm nicht bald etwas einfiel, das sie beide vor der gefürchteten Trennung retten konnte.
Zu dumm, dass der ansehnliche Besitz der Gräfin mit gut eineinhalb Tagesreisen südlich von der Breidenburg leider zu weit entfernt lag, um wenigstens heimliche Treffen zu ermöglichen.
Kapitel 3
Bevor es an die Abreise ging, besuchte Gero zusammen mit seinen Eltern, Geschwistern und Verwandten die Heilige Messe in der Burgkapelle. Danach debattierten die Männer im Herrenzimmer über die politische Lage, und die Frauen zogen sich zu einem kleinen Spaziergang in den sonnigen Burggarten zurück, wo ihnen Gertrudis, die heilkundige Magd, frisch sprießende Kräuter erläuterte.
Später beim Mittagsmahl gab Lissy vom anderen Ende des Tisches Gero mehrmals Zeichen, die außer ihnen beiden glücklicherweise niemand verstand. Beinahe zärtlich strich sie sich selbst übers Haar und legte den Zeigefinger an die Lippen, was nichts anderes bedeutete, als dass sie auf ein heimliches Stelldichein mit ihm drängte. Möglichst noch bevor er am nächsten Morgen in Begleitung seines Bruders Eberhard und ein paar Söldnern zur Burg seiner Tante aufbrechen musste.
Lissy entschuldigte sich von der Tafel und flunkerte, dass ihr nach dem Essen nicht wohl sei und sie frische Luft schnappen wolle. Gero folgte eine Viertelstunde später mit dem Hinweis, dass er noch ein paar persönliche Dinge einpacken müsse. Ohne sich seine Vorfreude anmerken zu lassen, eilte er zum Treppenhaus und bog nach links ab, wo er zu den Latrinen hätte gehen können. Doch er schlüpfte durch einen Nebeneingang der Burg hinaus zu den Stallungen und lief im Schatten der Wehrmauer entlang ins untere Heulager. Während er das abgelegene Gebäude ansteuerte, stellte er sicher, dass ihn niemand beobachtete. Er wusste, dass sie dort ungestört sein würden. Zum einen, weil Lissy und er sich dort schon öfters getroffen hatten, und zum anderen, weil die Tiere längst auf der Weide standen und kein Heu vom Boden benötigten. Gero war überzeugt davon, dass zumindest seine Mutter ihr gemeinsames Verschwinden bemerkt haben musste. Aber sie hatte nichts gesagt, und somit verschwendete er keinen Gedanken daran, als er in freudiger Erwartung die Leiter emporkletterte.
Lissy empfing ihn mit einem unschuldigen Blick, inmitten eines kleinen Heuhaufens. In ihren schönen, braunen Augen und ihrem makellosen Lächeln lag eine unübersehbare Verheißung. Die Gewissheit, dass sie dort oben vollkommen ungestört sein würden, nährte offenbar nicht nur Geros sündhafte Fantasien, sondern auch die des Mädchens. Nur dass sie bisher beide noch nicht gewagt hatten, ihre Träume in die Tat umzusetzen. Lissy neckte ihn gerne damit, wenn er behauptete, ihr hoffnungslos verfallen zu sein, und sie warnte, ihre Reize nicht allzu sehr auszuspielen, weil er sich sonst nicht mehr beherrschen könnte. Dass sie nunmehr bereit war, ihm alles zu geben, davon zeugte der rote Surcot, jenes ärmellose Überkleid, das eine adlige Frau über ihrem dünnen Untergewand trug und das nun ausgestreckt neben ihr lag, als ob es als Unterlage für ihr gemeinsames Lager dienen sollte. Nur noch mit ihrem eng anliegenden Untergewand bekleidet, spielte Lissy ihre unübersehbaren Vorzüge aus. Neben dem wohlgeformten Hintern und der schmalen Taille waren es vor allem die kleinen, drallen Brüste und deren harte Knospen, die Gero unter dem dünnen rosafarbenen Seidenstoff erkennen konnte und die ihn sogleich in Erregung versetzten.
„Du siehst zum Anbeißen aus“, murmelte er heiser, während er sich ihr auf allen vieren näherte.
Lissy errötete unter seinen Blicken; ein seltsames Glitzern lag in ihren braunen Augen. Sein Herz schlug noch heftiger, als sie sich mit ihrer rosigen Zungenspitze die Lippen befeuchtete, was er als eindeutiges Zeichen ihrer Bereitschaft wertete, weiterzugehen als bisher. Bei ihren vorangegangenen heimlichen Treffen hatten sie sich allenfalls geküsst und zaghaft gestreichelt.
Im Nu war er bei ihr und umschlang sie mit seinen starken Armen, wobei er ein wenig zu ungestüm vorging. Sie stieß einen spitzen Schrei aus, als er sie an sich drückte, und legte sogleich lachend die Hand auf Mund, bevor sie ihre Arme um seinen Nacken schlang. Ihre Brust drückte sich fest gegen sein Wams, und er spürte die weiche verführerische Wärme, die von ihr ausging. Lissy bäumte sich auf, und Gero verlor das Gleichgewicht, kippte nach hinten und wälzte sich seufzend mit ihr im weichen Heu.
Schwer atmend hielt er Lissy schließlich unter sich fest und küsste sie verlangend. Als sie die Lippen öffnete, drang seine Zunge in ihren warmen, nachgiebigen Mund. Keuchend erwiderte sie seinen kühnen Vorstoß.
Gero spürte, wie sein Schwanz hart wurde und sich unübersehbar gegen die Bruche drängte. Lissy entging nicht, wie sich seine weiche Lederhose darüber ausbeulte, und sie kicherte schon wieder, als sie zögernd ihre Hand darauf legte.
„Zieh dich aus!“, rief sie ihm aufgeregt zu. „Ich will sehen, was darunter ist.“
„Mein Gott, Lissy“, stöhnte Gero ihr ins Ohr, „was ist bloß in dich gefahren? Du bist ja wie von Sinnen.“
„Ich bin nicht von Sinnen, ich bin bei klarem Verstand“, erwiderte sie sanft. „Ich will nur nicht mehr warten, bis Vater mich ins Kloster geschickt hat, dann ist es zu spät.“
Sie schien es wirklich ernst zu meinen. Das hier war kein Kinderspiel mehr, sondern tiefe, aufrichtige Liebe.
„Sachte“, flüsterte er, als sie ihm helfen wollte, die Hose über die Hüften zu ziehen. Federnd sprang ihr sein hartes Glied entgegen, als er sich aufsetzte, um sein Wams über den Kopf auszuziehen.
„Du bist der schönste Mann, den ich je gesehen habe“, begeisterte sich Lissy und konnte ihre Finger nicht bei sich behalten, was Gero ein Lächeln entlockte. Schon hob sie ihre Röcke und setzte sich mit gespreizten Schenkeln über seinen nackten Schoß. Während sie mit den Händen zärtlich seine muskulösen Arme und Schultern streichelte, schob sich ihm kichernd ihr Becken entgegen, bis ihre Scham die pralle Spitze seines Glieds berührte. Gero zuckte regelrecht zurück, weil ihm die Gier, sie auf der Stelle zu nehmen, beinahe den Atem nahm.
„Lissy, Himmelherr“, entfuhr es ihm halb fluchend, halb flehend, „wenn du auch etwas davon haben möchtest, reiz mich nicht so, sonst bin ich verloren.“
Lachend umfasste sie seinen Schaft. „Wenn er dir nicht gehorsam ist, müssen wir ihn züchtigen“, bestimmte sie prustend und drückte fest zu.
„Au“, beschwerte sich Gero. „Nicht so grob, das ist kein Spielzeug!“
„Ist es doch“, hauchte sie und rieb ihn um einiges sanfter. „Und ein wunderschönes dazu.“
Ihre Entschlossenheit machte ihn schwindlig. Kaum zu glauben, dass sie erst sechzehn war und wie er selbst noch ihre Unschuld besaß. Dabei erschien sie ihm weitaus mutiger als er selbst. Aber vielleicht lag es daran, dass sie so ungezwungen mit ihm verfuhr, weil sie ihn nach all den Jahren der Freundschaft beinahe wie ihren Besitz betrachtete.
Plötzlich kamen ihm Zweifel.
„Vielleicht sollten wir doch damit warten, bis wir eines Tages verheiratet sind“, meinte er. Der Gedanke, sie zu verlassen, um zu den Templern zu gehen, erschien ihm mit einem Mal absurder denn je.
„Ich glaube nicht, dass Vater das je zulassen würde“, widersprach sie ihm heftig. „Er will mich ins Kloster stecken, nachdem er dich nach Franzien zu den Templern geschickt hat.“
„Mir wird schon was einfallen, damit wir zusammenbleiben können“, gab er zuversichtlich zurück. „Ich werde mich dem Wunsch meines Vaters verweigern, und dann werde ich dich heiraten, ganz gleich, ob der Alte was dagegen hat. Ich könnte mich im Söldnerheer meiner Tante verdingen, und du könntest ihr als Gesellschafterin dienen. Irgendwann haben wir dann genug Geld zusammen, um uns eine eigene Existenz aufzubauen.“ Er zog sie zu sich herab und strich eine Locke ihres hüftlangen, rotbraunen Haars zurück, obwohl er ihre Scham noch immer an seinem Glied spürte.
„Wenn du die Wahrheit wissen willst“, erwiderte sie mit einem spöttischen Lächeln. „Dein Versprechen ist nichts weiter als ein frommer Wunsch, den ich dir zwar gerne abkaufen würde, aber es dauert mir zu lange, bis ich das Geld dafür zusammengespart habe. Ich liebe und begehre dich viel zu sehr, um auch nur noch einen Tag länger warten zu können.“
Gero blieb vor Verblüffung der Mund offen stehen. Im nächsten Moment zog sie sich das Kleid hoch bis über den Kopf und streifte es ab. Darunter war sie vollkommen nackt. Gero glaubte, bei ihrem wundervollen Anblick auf der Stelle vor Sehnsucht zu sterben. Seine vom Schwertkampf schwieligen Hände griffen wie von selbst zu ihren kleinen Brüsten hin und liebkosten sie zärtlich. Lissy hatte anscheinend nichts Eiligeres zu tun, als ihm bei der Erstürmung des letzten Walls behilflich zu sein. Als sie sich aufsetzte und sein Glied mit einem verzückten „Oh“ in ihre feuchte Spalte dirigierte, wäre beinahe ein Unglück geschehen.
Gero biss die Zähne zusammen und hielt sich eisern zurück. „Elisabeth … bitte“, stieß er mit zusammengekniffenen Lippen hervor. „Halt ein … sonst verdirbst du noch alles.“
„Du weißt, wie man es macht?“, fragte sie atemlos und schob sich ihm so weit entgegen, bis er auf Widerstand stieß.
„Ja“, keuchte er, beeindruckt von der pulsierenden Enge, die ihn plötzlich umschloss. Wobei er sich fragte, woher Lissy so genau wusste, was zu tun war. Vielleicht hatte sie eine Magd zu Rate gezogen oder vielleicht sogar schon einmal heimlich bei jemandem zugeschaut, wie es vonstattenging.
Sie musste lachen, und er stimmte mit ein, obwohl er vor lauter Verlangen beinahe geplatzt wäre. „Und jetzt?“, fragte sie grinsend und sah ihn mit ihren großen braunen Augen an.
Natürlich wusste er, was zu geschehen hatte, wenn Männer und Frauen das Lager teilten. Bereits in jungen Jahren hatte er einen Knecht und eine Magd beim Liebesspiel beobachtet, als sie sich heimlich am Fischweiher vergnügten. Später hatte er herausgefunden, dass sie sich regelmäßig dort unten trafen, und zugesehen, wie sie verschiedene Freuden teilten. Der Anblick der beiden hatte ihn zunächst erregt, später jedoch gelangweilt.
Als Lissy sich noch einmal zu ihm hinunterbeugte, um ihn zu küssen, warf er sie sanft von sich ab, nur um sie erneut, nun unter ihm liegend, regelrecht zu bezwingen. „Schade“, wisperte sie, „dass ich nicht länger die Führung übernehmen durfte.“
„Wer eine Waffe einsetzt“, scherzte er grinsend und zog ihr die Handgelenke über den Kopf, „sollte wissen, wie man sich ihrer bedient.“ Nun war sie ihm hilflos ausgeliefert, was sie sehr zu genießen schien und ihn nur noch wilder machte.
„Hast du den Spruch von Roland gelernt?“, fragte sie mit einem lasziven Augenaufschlag und reckte ihm demonstrativ ihren Busen entgegen. „Ich hoffe, er hat dir in Sachen Waffenkunde nicht noch mehr beigebracht. Ich traue dem alten Haudegen nämlich nicht. Jeder weiß, dass er mit Gräfin Margaretha in Sünde lebt.“
„Roland ist die treuste Seele, die du dir vorstellen kannst“, verteidigte Gero seinen Waffenmeister. „Im Übrigen benötige ich keine anderen Frauen, um auf abwegige Gedanken zu kommen. Du reichst mir vollkommen, um den Verstand zu verlieren.“ Er erhöhte den Druck auf ihre Handgelenke, um ihr zu zeigen, dass es wenigstens etwas gab, bei dem er Macht über sie hatte. Umgekehrt hielt sie gerade sein Herz in Händen und würde es auf der Stelle zerquetschen können, falls sie ihm ihre Liebe entzog.
Als sie leise kichernd zu protestieren begann, neigte er sich zu ihr hinunter und verschloss ihre Lippen mit einem weiteren Kuss. Auf den Ellbogen abgestützt, ließ er sich langsam auf sie herab und neckte mit seiner harten Spitze die zarten Falten ihrer Scham. Wieder und wieder schob er sich nur ganz sacht in sie ein. Lissy seufzte; es schien ihr zu gefallen, dass er immer tiefer in sie eindrang.
Gero wagte es, sich mit einer Hand von ihr zu lösen und sie zunächst zaghaft, doch dann immer gezielter zwischen ihren Schenkeln zu liebkosen. Lissy lag mit geschlossenen Lidern da, und aus ihrem halb geöffneten Mund war nur noch ein erregtes, spitzes Keuchen zu hören. Als er glaubte, dass sie bereit war, ihn vollkommen in sich aufzunehmen, spreizte er ihre Schenkel noch ein wenig mehr und verstärkte den Druck.
„Keine Angst“, flüsterte er zitternd vor Erregung. „Ich werde vorsichtig sein. Wenn du nicht mehr willst, sag Bescheid, dann höre ich auf.“ Ein wagemutiges Versprechen, von dem er längst nicht sicher war, ob er es auch einhalten konnte.
Elisabeth kniff die Lider zusammen, als ob sie eine größere Pein erwartete. „Tu es“, stieß sie hervor und legte ihre Arme um seinen Nacken.
„Was ist?“, fragte er halb ohnmächtig vor Lust. „Tu ich dir weh?“
„Nein“, hauchte sie beinahe empört. „Um des heiligen Christus willen mach weiter, es fühlt sich ganz wunderbar an.“
Als ihr kurz darauf ein entspanntes „Ah“ entwich, fühlte Gero sich erleichtert und ermutigt zugleich. Wie von selbst nahm er einen sanften, stoßenden Rhythmus auf und ließ sich dabei von ihrem leisen Stöhnen leiten.
Als sich Lissy nach einer Weile heftig zuckend aufbäumte, konnte Gero nicht anders, als die Zügel fahren zu lassen und sich ebenso heftig in ihr zu ergießen. Mit pochendem Herzen blieb er für einen Moment auf ihr liegen, in dem ehrlichen Glauben, soeben ins Paradies eingefahren zu sein.
„Es war so unglaublich“, flüsterte sie mit bebender Stimme an sein Ohr und bereitete ihm damit eine Gänsehaut „Ich liebe dich so sehr. Ich würde mir wünschen, wir könnten das, was wir gerade getan haben, Tag und Nacht wieder tun.“
Was für ein unglaubliches Kompliment! Gero spürte, wie ihm, von Stolz erfüllt, das Herz aufging. „Ich liebe dich auch“, stammelte er hilflos, unfähig, sich von ihr zu lösen.
„Ich würde gerne deine Frau sein, Gero“, gab sie mit zärtlicher Stimme zurück. „Für immer und ewig.“ Als ob sie dieses Bündnis besiegeln wollte, schloss sie ihre Schenkel um seine Hüften und bewegte sie so eindeutig, dass ihm gar nichts anderes übrigblieb, als noch einmal zu beginnen, doch diesmal weitaus wilder und besitzergreifender. Als sie vor Lust schrie, hielt er ihr geistesgegenwärtig den Mund zu, während er spürte, wie sie ein weiteres Mal unter ihm erbebte.
„Du wirst meine Frau sein“, versprach er ihr inbrünstig, als er sich von ihr rollte und nach seiner Bruche tastete, die er sich, nachdem er sie gefunden hatte, rasch über die Hüften zog. Dann half er Elisabeth hastig zurück in die Kleider. Schließlich hockten sie sprachlos da, Auge in Auge und mit geröteten Wangen, dabei reichlich verlegen, wie zwei soeben fürstlich beschenkte Kinder, die ihr Glück noch gar nicht fassen können.
„Ich schwöre dir, Lissy, bei meiner Ehre“, bekannte er feierlich und küsste sie zart. „Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um mit dir auf immer und ewig zusammenbleiben zu können.“
Kapitel 4
Am nächsten Tag musste er bereits nach dem Frühessen nach Waldenstein aufbrechen, und das Schlimmste dabei war, Lissy zum Abschied nicht küssen zu dürfen. Doch sie hatte ihm zuvor in aller Heimlichkeit etwas zugesteckt. Einen kleinen, zusammengefalteten Brief, der – wie sich später herausstellte – mit einem wunderbaren, handbemalten Liebesgedicht beschriftet war.
Für Gero, meine Sonne, meinen Mond, meinen Abendstern.
Mein Herz hat Flügel,
siehst Du ein Vöglein am Himmel,
sollst Du wissen es fliegt zu Dir,
meine Liebe ist ein Windhauch,
wenn ein Säuseln durch Dein Haar streicht,
sollst Du wissen, sie ist bei Dir,
meine Sehnsucht ist ein Regen,
wenn die Tropfen auf Dein Gesicht herniederfallen,
sollst Du wissen, es sind die Tränen meiner Sehnsucht nach Dir.
In ewiger Liebe Elisabeth.
Sie konnte es unmöglich erst gestern geschrieben haben, weil die Tinte bereits vollkommen getrocknet war und es eine Menge Arbeit gekostet haben musste, so etwas Kunstvolles anzufertigen. Was bedeutete, dass sie sich bereits lange vorher Gedanken gemacht hatte, wie sie ihre tiefen Gefühle für ihn zu Papier bringen konnte. Etwas, das ihn all seinen Kummer über die Abreise vergessen ließ.
Nachdem er sich mit einer höfischen Verbeugung und einem angedeuteten Kuss von seiner Mutter verabschiedet hatte, salutierte Gero vor seinem Vater. Dabei setzte er eine möglichst grimmige Miene auf, die seine Bereitschaft, von nun an mit scharfen Waffen kämpfen zu wollen, eindrucksvoll unterstrich. Doch als er vor Lissy stand, um sie ein letztes Mal brüderlich in den Arm zu nehmen, zwinkerte er ihr zu und bedachte sie mit einem warmen Lächeln. Er würde schon bald zu ihr zurückkehren und sie heiraten, wenn er erst den Ritterschlag erhalten hatte. Aber bis dahin galt es, durchzuhalten und sich nicht zu verraten.
Kapitel 5
Die Nacht war bereits hereingebrochen, als Gero und sein Bruder zusammen mit dessen Mannen Waldenstein nach einem scharfen Ritt ohne größere Pausen endlich erreichten. Vor dem modrig riechenden Wassergraben, der die Festung zum Schutz gegen Angreifer umgab, mussten sie haltmachen. In der dunklen Brühe des Grabens spiegelte sich das lodernde Feuer der Fackeln, die Gero und seine Begleiter während der letzten Stunde entzündet hatten. Ein kühler Wind zerrte an ihren Kleidern und den bunten Schabracken der Pferde. Obwohl die Burgwachen von ihrem Ausguck herab im Schein des Feuers erkennen konnten, wer da um Einlass begehrte, und man sie aller Wahrscheinlichkeit nach bereits erwartet hatte, ließen sie die Zugbrücke nur gegen ein Losungswort herunter. Die Blicke des diensthabenden Kommandeurs huschten währenddessen in stetiger Wachsamkeit über die Umgebung vor den Festungswällen. Um ihn herum stand eine schwerbewaffnete Truppe von wild aussehenden Burschen.
Geros Bruder rief dem Kommandanten den geforderten Satz zu, wobei er gegen den Wind ankämpfte und gegen das Geräusch der flatternden Banner auf den Brückenköpfen.
Danach dauerte es einen Moment, bis sich die spitzen Eisenzähne des schweren Gitters unter Einsatz eines von Eseln betriebenen Kettenrades in die Höhe kämpften. Sobald die Besucher samt ihrer Pferde wohlbehalten den weitläufigen Burghof erreicht hatten, wurde es mit einem lauten Rattern wieder zu Boden gelassen. Gero sah sich rasch um. Überall brannten Feuerkörbe und die wild im Wind flackernden Flammen belegten Wälle, Türme und Mauern mit einem gespenstischen Licht.
Einen ganzen Tag und die anbrechende Nacht hatte der Ritt von der Breydenburg ins benachbarte Dreiländereck zwischen Lothringen, Luxemburg und dem Erzbistum Trier gedauert, und nun waren Tiere wie Menschen erschöpft.
Trotz allem kam bei Gero Freude auf, als Roland von Briey, den man pflichtgemäß über die Ankunft der Gäste in Kenntnis gesetzt hatte, ihnen mit offenen Armen entgegeneilte.
„Habt ihr unbehelligt zu uns durchdringen können?“, fragte der Burgvogt, an Eberhard gerichtet, dem der Wind die hellblonden Haarsträhnen ins Gesicht blies.
„Ja, warum nicht?“, erwiderte der zukünftige Erbe der Breidenburg und sah sich bestätigend nach seiner finster dreinblickenden Wachmannschaft um.
„Seit ein paar Wochen gibt es in den Nachbarregionen Probleme mit einer Raubritterbrut“, erklärte ihm Roland und wies ein paar Stallburschen an, die Pferde der Besucher über den Burghof zu den Stallungen zu führen. Dann fuhr er fort: „Unter dem Zeichen eines schwarzen Eberkopfes auf blutrotem Grund überfallen sie Bauernhöfe. Sie stehlen das Vieh und töten die Bewohner. Manchmal verschleppen sie auch die Frauen, von denen keine bisher wieder aufgetaucht ist.“
Eberhard nickte wissend und stellte ein paar Vermutungen an, um wen es sich bei dem Angreifer handeln könnte. Doch Gero konnte nicht länger zuhören, weil im selben Moment Gräfin Margaretha auf dem Burghof erschien und ihm, in einen grünen Hausmantel gehüllt, freudig entgegenging. Gero wollte sich formvollendet verbeugen, doch sie umarmte und drückte ihn sogleich an ihre schlanke Gestalt.
Gero täuschte einen Hustenanfall vor, um ihr auf diese Weise Einhalt zu gebieten, weil ihm das hämische Grinsen seines Bruders nicht entgangen war.
„Mein lieber Junge!“, rief Margaretha angstvoll, „Was ist mit dir, hast du dich erkältet? Soll ich sogleich nach einer heilkundigen Magd rufen lassen. Du wirst doch nicht krank werden?“
Eberhard wurde von solcherlei Attacken verschont. Und Gero fragte sich, ob es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war, dass sie seinen Bruder um einiges kühler empfing und sich von ihm die Hand küssen ließ.
Später am Abend saß Gero mit den anderen Männern im Rittersaal bei warmem Bier. Nicht jedoch, ohne die Scherze seines Bruders und dessen Begleitern ertragen zu müssen, die sich über Margarethas offensichtliche Zuneigung für ihn lustig machten.
Und so war Gero froh, als Eberhard und seine Truppe am nächsten Tag endlich von dannen ritten und die letzte Etappe zu seiner Ausbildung zum Ritter begann.
Bereits in den Jahren zuvor war Roland ihm ein guter und beständiger Lehrmeister gewesen. Mit vierzehn hatte er bei dem erfahrenen Recken seine Kampfausbildung begonnen. Damals hatte der alte Haudegen Gero wochenlang in voller Rüstung hinter seinem Pferd herlaufen lassen, damit er an Ausdauer gewann. Erst danach durfte er mit einem stumpfen Schwert gegen ihn antreten. Ziemlich bald hatte Roland herausgefunden, dass Gero ein wahres Talent für den Einsatz von Waffen besaß. Er war schnell und geschickt und ließ sich den nächsten Zug, den er vorhatte, nicht ansehen, berechnete aber sehr wohl jede Bewegung seines Kontrahenten.
Nun gehörte der Schwertkampf zu den morgendlichen Standardübungen, mit denen sich Gero und seine Gegner warm machten. Doch meist war es Roland selbst, gegen den er im Kampf mit verschiedenen Schwertern antreten musste.
Er und sein bulliger Meister standen sich dabei gegenüber wie zwei angriffslustige Bären. Wie so häufig machte Roland den ersten Stoß, wobei er mit einem sogenannten Oberhieb auf Gero losstürmte. Doch dieser wich geschickt aus und parierte mit einem Unterhieb, der die Kraft des Schlages abfing. Woraufhin sich Roland zurückzog und mit einem Sturzhieb parierte, den Gero mit einem von unten geführten Wechselhieb vergalt. Roland sprang zurück und stieß von oben herab auf Gero ein, was dieser mit einem seitlichen Oberhieb vereitelte. Als Roland ihn mit einem langen Stoß nach vorn zu erwischen versuchte, bog Gero seinen Oberkörper blitzschnell nach hinten und verschränkte sein ungeschliffenes Schwert über dem Kopf. Dabei traf er Roland schmerzhaft in der Halsbeuge.
Der Burgvogt zuckte fluchend zurück und hielt sich die Schulter.
„Verdammter Mistkerl!“, rief er seinem Schützling entgegen. „Wenn die Schneide scharf gewesen wäre, hättest du mich jetzt auf dem Gewissen!“
Gero lachte nur. „Wenn die Schneide scharf gewesen wäre, fehlte dir jetzt der Kopf.“ Angespornt von seinem Erfolg, sprang er Roland entgegen. Mit einem Mal fühlte er sich unendlich stark, zumal die umherstehenden Knechte und Mägde, die, neugierig geworden, bei ihrer Arbeit innegehalten hatten, vom Rand des Burghofs her frenetisch applaudierten.
Jedoch beim nächsten Schlag traf Rolands Schwert Geros eigene Waffe so unglücklich, dass ihm das Schwert entglitt und in hohem Bogen zu Boden sauste. Bevor er sich nun von Roland verprügeln ließ, duckte er sich und rannte wie ein wildgewordener Eber nach vorn, unterlief dabei Rolands Verteidigung und rammte seinen Kopf in dessen Magen.
Sein Lehrmeister ging trotz Kettenhemd keuchend zu Boden, wo er sich röchelnd erbrach. Für einen Moment war Gero zu schockiert, um reagieren zu können, zumal er den besorgten Blick seiner Tante auffing.
„Es tut mir leid“, rief er und ging auf Roland zu, um ihm aufzuhelfen. Mit zusammengekniffenen Augen starrte der Burgvogt ihn an und wischte sich dabei mit dem Unterarm grunzend den Mund ab. Dann grinste er schmerzerfüllt und ergriff Geros Hand.
Schneller als Gero gesehen hatte, landete er hart auf dem Rücken, Rolands Fuß auf der Kehle und die Spitze seines Schwertes drohend auf seinen Augapfel gerichtet.
„Traue niemals einem Feind“, raunte er düster, „schon gar nicht aus Mitleid!“
Die Wochen vergingen für Gero mit täglichen Übungseinheiten, ohne Aussicht auf einen Einsatz in einer echten Kampfsituation. Dabei behauptete Roland, dass er sich schon jetzt dem Stand eines Ritters als würdig erweisen würde. Gerne hätte er die gute Nachricht mit jemandem aus seiner näheren Familie geteilt. Am liebsten mit Lissy, doch seit seiner Abreise im Frühjahr hatte er nichts mehr von ihr gehört. Bei Nachfragen nach dem Wohlergehen seiner Familie hatte er zwar stets zu hören bekommen, dass alles bestens stehe, aber das war ein schwacher Trost, angesichts der Tatsache, dass er seine Liebste so furchtbar vermisste.
Inzwischen war Gero so erfahren, dass er gegen Rolands Söldner antreten konnte. Immer häufiger forderten ihn die hartgesottenen Männer zu einem Zweikampf heraus, und immer öfter behielt er die Oberhand. Wobei ihm nicht ganz klar war, ob sie ihn aus Gefälligkeit gewinnen ließen, wie sein Lehrmeister behauptete, oder ihm tatsächlich unterlegen waren. Vielleicht wollte Roland aber auch nicht, dass er eingebildet und zu selbstsicher wurde.
„Das größte Übel ist“, sagte er stets, „wenn ein Kämpfer sich überschätzt und seinen Gegner nicht ausreichend respektiert. Das macht unvorsichtig, und ich habe schon gestandene Ritter durch die Hinterlist eines schmächtigen Hirtenjungen fallen sehen.“
Gero versicherte Roland mindestens einmal am Tag, dass ihm so etwas nicht passieren würde. Wobei er sich dachte, dass ein Ritter, der sich von einem Hirtenjungen besiegen ließ, nicht unbedingt zur gescheitesten Sorte gehören konnte.
Eines Tages rief ihn seine Tante nach einer Übungsstunde zu sich in ihre Kemenate. Sie habe ihm etwas Wichtiges mitzuteilen, verriet sie ihm auf dem Weg dorthin.
Gero schlug das Herz hart in der Brust, als sie gemeinsam ihr sonnenüberflutetes Frauengemach betraten. Was mochte sie ihm wohl sagen wollen? Gab es vielleicht Nachrichten von zu Hause? Schon wieder war er in Gedanken bei Lissy.
Eine der älteren Gesellschafterinnen seiner Tante, die mit irgendeiner Handarbeit am Fenster saß, schaute kurz auf und verließ auf Margarethas Wink das Zimmer.
Als seine Tante aufblickte und die Erwartung in seinen Augen sah, strahlte sie übers ganze Gesicht.
„Ich habe von Roland gehört, dass du deine Ausbildung so gut wie abgeschlossen hast. Ich konnte mich soeben selbst davon überzeugen, dass du dich immer mehr zu einem passablen Ritter entwickelst. Deshalb habe ich mir eine kleine Belohnung für dich ausgedacht.“
Als er schüchtern aufschaute, sah er, wie seine Tante zu einer prunkvoll beschlagenen Kiste ging und daraus etwas hervorholte, das in ein langes Stück roten Brokatstoff eingewickelt war.
Margaretha kehrte zu ihm zurück und befreite behutsam ein glänzendes Schwert von dem Stoff, das sie ihm lächelnd entgegenhielt. Es war gut zwei Ellen lang, hatte einen mit Leder umwickelten Griff und ein sorgfältig graviertes Blatt, dessen Blutrinne mit Schnörkeln versehen war.
„Ein Meisterschmied aus Nogent hat es vor ein paar Jahren geschmiedet. Es hat Onkel Gerhard gehört und sieht noch ziemlich neu aus. Ich habe mir sagen lassen, dass es eine beachtliche Stabilität besitzt.“
„Das ist meiner nicht würdig“, stammelte Gero überrascht und nahm das Schwert prüfend entgegen. So eine Waffe kostete leicht den Gegenwert eines guten Streitrosses. Und obwohl sich das Geschenk als äußerst kostbar erwies, war sein Ausspruch mehr der Höflichkeit geschuldet. Trotz der soliden Qualität war es leider kein Anderthalbhänder, wie er ihn sich sehnlichst gewünscht hätte. Als Sohn eines Edelfreien und zukünftiger Ritter war er schließlich davon überzeugt, nur das Beste zu verdienen, wenn er seine Sache gut machen sollte. Aber versetzte es ihn nun in die Lage, mit einem erstklassigen Schwert kämpfen zu können.
„Danke“, sagte er artig und schenkte seiner Tante nicht nur das strahlendste Lächeln, zu dem er fähig war, sondern auch einen Kuss auf die Wange. Margaretha klopfte ihm sichtlich begeistert auf die Schulter. „Freut mich, dass es dir gefällt.“
„Verzeiht, Tante“, hob er vorsichtig an, weil er die gute Gelegenheit beim Schopfe packen wollte. „Wo Ihr mir nun dieses wunderbare Schwert geschenkt habt. Wann ist es endlich soweit, dass ich an Rolands Seite bei der Verteidigung der Burg mitreiten darf?“
Mit schmalen Lidern sah sie ihn plötzlich geradezu abweisend an. „Du bist noch nicht soweit, als dass ich dein Leben aufs Spiel setzen möchte. Zumal du noch nicht mal den Ritterschlag erhalten hast. Deine Mutter würde mich umbringen, wenn ich dich bis dahin irgendeiner Gefahr aussetze, die niemand einschätzen kann.“
„Bei allem Respekt, den ich Euch entgegenbringe“, widersprach Gero und trat ungeduldig von einem Fuß auf den anderen. „Ich bin zwanzig Jahre alt. Mit dem Alter regieren andere Männer ganze Reiche. Und die übrigen Recken an Rolands Seite haben auch keinen Ritterschlag erhalten und kämpfen trotzdem. Außerdem werde ich spätestens im März, vielleicht auch schon früher zum Ritter geschlagen. Das hat mein Vater versprochen. Wie soll ich diese Würde annehmen, wenn ich keinen einzigen ernst zu nehmenden Kampf bestritten habe?“ Gero hatte Mühe, gelassen zu bleiben. Als Rolands Knappe hätte er jedes Recht der Welt gehabt, seinen Herrn auch bei den gefährlichsten Feldzügen begleiten zu dürfen und ihm zur Seite zu stehen. Warum also nicht wenigstens bei harmlosen Vergeltungszügen und vorsorglichen Streifen durch das Gebiet der Waldensteiner?
„Weil ich es nicht will“, erwiderte Margaretha bestimmt. „Du bist kein dahergelaufener Söldner, über dessen Tod niemand trauert. Du bist der Sohn eines Edelfreien und der Neffe einer Gräfin. Wenn ein Söldner im Kampf gegen einen Schurken versagt, ist es ausgesprochenes Pech. Wenn ein Adliger wie du im Kampf gegen räuberisches Gesindel fällt, trifft es die Ehre eines ganzen Standes und ermutigt unsere Feinde, noch härter gegen uns vorzugehen. Abgesehen davon, dass ich es mir selbst nicht verzeihen würde, dich zu früh ins Feld geschickt zu haben.“
Gero trat einen Schritt zurück und verneigte sich demütig. Das Letzte, was er wollte, war, den Zorn seiner Tante auf sich zu ziehen.
„Verzeiht meine vorlauten Worte“, murmelte er halbherzig und bedachte sie mit einem reuevollen Blick. „Ich wollte Euch nicht erzürnen.“
„Mir tut es leid, dich enttäuschen zu müssen, mein Junge“, lenkte sie ein. „Aber ich habe mich gegenüber deiner Familie zu verantworten. Deine Mutter ist ohnehin halb krank vor Angst, seit sie weiß, dass Roland dich in Wahrheit nicht für unsere Schutzmannschaften, sondern für deine zukünftige Ausbildung bei den Templern schleift. Ich habe ihr versprechen müssen, dass ich auf dich achtgebe, als wärst du mein Augapfel.“
„Ich habe nicht vor, zu den Templern zu gehen“, erwiderte er leise und wich ihrem prüfenden Blick aus. „Ich möchte eine Frau ehelichen und eine Familie gründen. Ich wünsche mir eines Tages Kinder, die mein Haus mit Lachen erfüllen.“
Aus den Augenwinkeln sah er, wie Margarethas Blick weich wurde.
Sie streckte ihre Hand nach ihm aus, während er noch immer mit dem Schwert in der Hand vor ihr stand, und streichelte seine bärtige Wange.
„Ich habe es schon länger geahnt“, sagte sie nicht weniger leise. „Du bist kein raubeiniger Wüstling, dem nicht Besseres einfällt, als saufend und plündernd durch die Lande zu ziehen. Ich finde deine Ansichten äußerst vernünftig und würde nichts lieber tun, als dich in deinem Vorhaben zu unterstützen. Du weißt, dass ich keinen Erben vorweisen kann. Und ich würde gern Frieden schließen mit den Herzögen von Lothringen. Wenn du meine Burg übernimmst und eine von den Grafentöchtern heiraten könntest, deren Vater im Auftrag des Herzogs die Feste Sierck verwaltet, würde man uns dort nicht länger als Feinde ansehen. Was meinst du?“
Gero schwieg. Nein, hätte er am liebsten gesagt. Ich kann keine Grafentochter heiraten. Ich will Lissy, niemanden sonst.
„Du vermittelst mir nicht unbedingt einen erfreuten Eindruck“, wandte die Gräfin stirnrunzelnd ein. „Dabei dachte ich, das ist genau das, wonach du verlangst?“ Sie nahm ihn beiseite, um ihn auf einen Stuhl zu dirigieren.
Gero wollte sich eigentlich nicht hinsetzen, schon gar nicht in den Frauengemächern, an einem filigranen, mit violetten Herbstblumen geschmückten Tischchen. Roland wartete draußen auf dem Hof auf ihn. Er würde Fragen stellen, wo er sich so lange aufgehalten hatte. Doch was blieb ihm anderes übrig, wenn er die Gunst der Stunde nutzen wollte?
„Was hast du denn?“, bohrte die Gräfin weiter, während sie sich neben ihn auf einen zweiten Stuhl setzte. „Mit einem entsprechend politischen Hintergrund wird sich dein Vater schon noch davon überzeugen lassen, dass es besser ist, dich hierzubehalten, anstatt dich in ein ungewisses Schicksal zu diesen verdammten Rotkreuzlern zu schicken.“
Als Zeichen dafür, dass sie durchaus bereit war, sich länger mit ihm zu unterhalten, griff sie nach einer blau glasierten Karaffe und goss weißen Wein in zwei ebenfalls blau glasierte Becher, die auf dem Tischchen standen. Sie reichte ihm einen Becher und prostete ihm aufmunternd zu.
„Man munkelt, dass der Großmeister der Templer, Jacques de Molay, unbedingt einen neuen Kreuzzug durchführen möchte“, sprach die Gräfin weiter und nahm einen Schluck. „Um die Rückeroberung des Heiligen Landes zu erreichen.“ Sie stellte den Becher ab, schnaubte ungalant und sah ihn mit ihren klaren blauen Augen durchdringend an. „Ich frage mich ernsthaft, was sich dein Vater davon verspricht, dich diesem verrückten Haufen von Totschlägern in die Arme zu treiben. Jeder halbwegs vernünftige Mensch ahnt, dass ein solches Unterfangen wenig Aussicht auf Erfolg hat und es die Templer wie immer höchstens unzählige Opfer kosten wird. Aber was will man von einem Ritterorden verlangen, der stolz darauf ist, wenn das Blut seiner jungen Mönchskrieger den Boden der Heiden tränkt?“
Gero räusperte sich leise, während seine Tante sich weiter in Rage redete.
„Ich sagte doch“, bekannte er kaum hörbar. „Ich habe nicht vor, einen weißen Mantel tragen, und schon gar nicht will ich ein Keuschheitsgelübde ablegen.“
„Aber heiraten willst du augenscheinlich auch nicht?“ Seine Tante schaute ihn überrascht an. „Was willst du dann? Dir eine Mätresse halten oder womöglich mehrere und mit ihnen einen heimlichen Harem gründen?“
„Ich sagte doch, dass ich gerne eine Frau heiraten und eine Familie mit ihr haben möchte“, erklärte Gero. „Nur würde ich mir die Frau, die es betrifft, gerne selbst aussuchen.“
„Oho!“ Seine Tante sah ihn verständnislos an. „Seit wann darf man sich in unseren Kreisen aussuchen, wen man heiraten möchte?“
Ihrem Lächeln haftete eine Ironie an, für die sie trotz aller Güte berüchtigt war.
„Mutter behauptet immer, Ihr hättet Onkel Gerhard aus Liebe geheiratet“, widersprach Gero leidenschaftlicher, als er es eigentlich gewollt hatte.
„Sagt sie das?“ Margaretha hob eine Braue. „Und am Ende hat Gott der Herr mich dafür gestraft, indem er mir meinen Auserwählten so grausam genommen hat.“
„Er hat ihn durch Roland ersetzt“, antwortete Gero kühn. „Und jeder kann sehen, wie sehr Ihr diesen Mann schätzt.“
„Wobei wir wieder beim Thema wären“, erwiderte Margaretha unbeeindruckt. „Ich kann Roland nicht heiraten und er mich nicht, weil er bedauerlicherweise nicht meinem Stand entspricht.“
„Aber die Frau, die ich liebe, entspricht meinem Stand“, stieß Gero reichlich unbedacht hervor.
„Ach so?“, fragte Margaretha spitz. „Und? Willst du mir auch ihren Namen verraten?“
Gero hätte sich verwünschen können, weil er so vorlaut gewesen war. Nun würde seine Tante nicht eher Ruhe geben, bis er ihr die Identität des Mädchens verriet. Doch das konnte er unmöglich tun. Wenn sich die Meinung der Tante gegen eine Verbindung mit seiner nicht leiblichen Schwester richtete – und davon war auszugehen –, würde er Lissy in Schwierigkeiten bringen. Gut möglich, dass sie auf diese Weise noch rascher im Kloster landete.
Er schüttelte seine blonde Mähne. „Ich kann es Euch nicht sagen“, flüsterte er schließlich. „Mir fehlt die Zustimmung des Mädchens, es zu verraten.“
„Wenn du mir nicht vertraust“, wandte seine Tante ein, „kann ich dir auch nicht helfen.“
Gero horchte unvermittelt auf. „Würdet Ihr mir denn helfen, wenn ich es Euch verrate?“
„Selbstverständlich würde ich das“, bestätigte seine Tante im Brustton der Überzeugung. „Nichts wäre mir wichtiger, als dich glücklich zu sehen.“
„Ganz gleich, wer sie ist?“
„Wenn zutrifft, was du sagt, und sie von Stand ist, sehe ich keinerlei Hindernis“, meinte Margaretha mit einem zuversichtlichen Nicken. „Wenn alles stimmt, dürfte es uns nicht schwerfallen, zunächst deine Mutter von unserem Vorhaben zu überzeugen. Wenn wir sie auf unserer Seite haben, wird sie deinen Vater von ganz alleine eines Besseren belehren.“
Geros Herz klopfte plötzlich wie wild. „Elisabeth!“, brach es aus ihm hervor. „Es ist Elisabeth.“
Margaretha verlor augenblicklich jegliche Farbe im Gesicht. „Du sprichst nicht etwa von deiner Schwester?“
Gero nickte. „Lissy ist durch die Taufe und die gesetzliche einwandfreie Annahme an Kindes statt unzweifelhaft eine Adlige.“
Obwohl Margaretha saß, suchte sie mit einer Hand Halt an dem kleinen Tisch. „Aber sie ist deine Schwester“, murmelte sie.
„Ist sie nicht!“, entfuhr es Gero leidenschaftlich. „Wir sind nicht blutsverwandt.“
„Trotzdem ist es ein Frevel“, schleuderte Margaretha ihm harsch entgegen. „Mein Gott, Junge, was denkst du dir eigentlich? Glaubst du, dein Vater bricht zweimal sein Gelübde und erspart ihr das Kloster?“
„Verdammt“, entfuhr es Gero ebenso ungalant. „Ich pfeife auf dieses blöde Gelübde. Überhaupt, was sollte es jetzt noch bringen? Akko ist verloren, und Onkel Gerhard ist tot. Denkt mein Vater etwa, dass seine rechte Hand wieder nachwächst, wenn er mich zu den Templern schickt und Lissy ins Kloster verbannt? Das ist doch vollkommener Irrsinn. Wir lieben uns, Tante Margaretha!“, bekannte er mit einer Inbrunst, die ihm den Atem nahm. „Wenn ich sie nicht haben kann, will ich nicht mehr leben! Dann können die Templer von mir aus freiwillig all mein Blut haben und es in irgendeinem heidnischen Land verteilen. So einfach ist das!“
Margaretha war aufgesprungen und legte ihm beide Hände auf die bebenden Schultern. „So beruhige dich doch, mein Junge.“
Gero wollte sich aber nicht beruhigen. Jedenfalls nicht, bevor er sicher sein konnte, Margarethas Unterstützung zu haben.
„So versteh doch, Gero“, redete sie unermüdlich auf ihn ein. „Alle Welt sieht sie als deine kleine Schwester. Und jedermann weiß inzwischen, dass sie in Kürze das siebzehnte Lebensjahr erreicht und in den Orden der Zisterzienserinnen eintreten soll. Dabei darfst du nicht vergessen, dass sie ihrem Ursprung nach eine Jüdin ist. Es hat deine Eltern eine Menge Überzeugungsarbeit bei Erzbischof Bohemond von Warnesberg gekostet, der zudem euer Lehnsherr ist, sie katholisch taufen zu lassen, damit dein Vater sie zur rechten Zeit in die Obhut der frommen Schwestern geben kann. Was sollen der Klerus und auch eure Untergebenen denken, wenn Elisabeth plötzlich allem entsagt, was dein Vater so lautstark verkündet hat, und das nur, weil sie deine Frau werden will?“
„Wieso ‚nur‘?“, ereiferte sich Gero. „Und wieso entsagt sie dem christlichen Glauben, weil wir vor Gott ein Paar werden wollen?“ Verständnislos starrte er seine Tante an.
„Ach, Junge“, warf Margaretha mit einem Seufzer ein, „niemand will, dass die alten Geschichten wieder hochkochen. Wenn Elisabeth keine Nonne mehr werden soll, wird alle Welt fragen, warum. Erst recht, wenn die Frage auftaucht, wie es sein kann, dass du deine eigene Schwester zur Frau nehmen willst. Ihre Herkunft wäre dann plötzlich wieder ein Thema, und die Leute, die eure Familiengeschichte nicht näher kennen, fangen an, Fragen zu stellen. Und deine Eltern kämen in Erklärungsnot. Wenn dann herauskommt, dass sie gar nicht deine leibliche Schwester ist, sondern eine geborene Jüdin, wird es nicht eben einfacher. Und das nicht nur, weil der Jude die christliche Taufe nicht anerkennt und eure Kinder nach deren Gesetz jüdischen Glaubens wären. Juden haben nun mal keinen guten Stand in unserer Gesellschaft.“
„Warum in aller Welt“, erwiderte Gero aufgebracht, „sollen wir auf unser Glück verzichten, nur weil irgendwelche dahergelaufenen Bauerntölpel zu dumm sind, die Zusammenhänge zu verstehen?“
„Es geht nicht allein um die Bauerntölpel. Es geht um die Ehre des Hauses Breydenbach! Denkst du wirklich, dass dein Vater die Schmach eines gebrochenen Gelübdes und dazu endlose Fragen und Diskussionen auf sich nehmen würde, nur weil ihr euch entschlossen habt, in den heiligen Stand der Ehe einzutreten?“
Margaretha schaute ihn aus großen Augen an. Ihre Miene verriet, für wie absurd sie diese Vorstellung hielt.
„Dein Vater wird für kein Geld der Welt seine Zustimmung zu dieser Verbindung geben! Eher wird Köln über Rom stehen! Im Gegenteil, wenn du stur bleibst und auf eine Heirat bestehst, bringst du Elisabeth in große Gefahr. Unbeherrscht, wie dein alter Herr sein kann, wird er am Ende noch denken, dass sie dich verführt hat, und es könnte gut sein, dass er keinen anderen Ausweg sieht, als sie offiziell zu verstoßen.“
„Damit wären dann ja alle Probleme gelöst“, erklärte Gero trotzig. „Falls er so etwas wagen sollte, gehe ich mit ihr fort. Ganz gleich, wohin! Wir werden schon einen Weg finden, zusammenbleiben zu können. Und wenn wir fortan als Bettler leben müssten. Das ist allemal besser, als gegen seinen Willen einem Orden beitreten zu müssen und sich niemals wiederzusehen.“