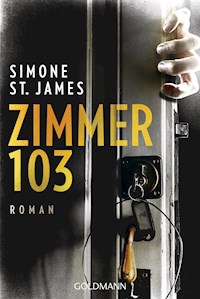5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
England, 1921. Drei Jahre, nachdem ihr Mann Alex im Krieg über Deutschland abgeschossen wurde, trauert Jo Manders immer noch. Als sie zu dessen Anwesen in Sussex reist, merkt Jo schnell, dass sie über seine Herkunft kaum etwas wusste. Die Enthüllung eines mysteriösen Todesfalls in der Vergangenheit der Familie ist nur der Anfang … Im Wych Elm House ist nicht alles geheuer. Die Einheimischen sagen, die Familie sei verflucht. Und während Jo die dunklen Geheimnisse ihres Mannes aufdeckt, fragt sie sich, ob sie ihn jemals wirklich gekannt hat. Suspense Magazine: »Leser, die den Klassiker Rebecca genossen oder sogar die Verfilmung von Alfred Hitchcock gesehen haben, werden diese Geschichte absolut lieben ... Ein Buch, das sehr wohl eines Tages zu einem eigenen Klassiker werden könnte.« Library Journal: »Die Spannung ist erstklassig aufgebaut, und die Liebesgeschichte gehört zu den besten der Autorin.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Claudia Rapp
Impressum
Die australische Originalausgabe Lost Among the Living
erschien 2016 im Verlag Berkley Books.
Copyright © 2016 by Simone Seguin
Copyright © dieser Ausgabe 2024 by Festa Verlag GmbH, Leipzig
Veröffentlicht mit Erlaubnis von Berkley, ein Unternehmen der
Penguin Publishing Group/Penguin Random House LLC.
Titelbild: »NeatDesign«/99Designs
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-180-6
www.Festa-Verlag.de
Für Adam
1
ENGLAND, 1921
Als wir Calais verließen, dachte ich, dass ich Dottie Forsyth vielleicht hasste.
Für Außenstehende gab es dafür keinen Grund, denn Dottie hatte mich durch die Anstellung als ihre Gesellschafterin sowohl vor der Armut als auch vor einem farblosen Leben in meiner Mietwohnung bewahrt, dem Leben, das ich ohne Alex zu führen versuchte. Allerdings hätten diese Außenstehenden auch nicht die letzten drei Monate damit verbringen müssen, mit ihr durch Europa zu reisen und ihr dabei zuzusehen, wie sie nach Kunst stöberte und diese so billig wie möglich erwarb, während sie ihre Zigaretten in dem langen schwarzen Halter rauchte.
»Manders«, sagte sie zu mir – ich hieß zwar Jo, aber eine ihrer Liebenswürdigkeiten war die Angewohnheit, mich beim Nachnamen zu nennen, als wäre ich das Hausmädchen – »Mrs. Carter-Hayes möchte meine Fotos sehen. Hol doch bitte mein Fotobuch aus meinem Gepäck, ja? Und frag den Dienstmann, ob sie Sherry servieren.«
Sie sagte es, als wären wir auf einem luxuriösen, transatlantischen Ozeandampfer und nicht auf einem einfachen Schiff, das die nächsten drei Stunden über den Ärmelkanal fuhr. Trotzdem erhob ich mich, um das Gepäck, das Fotobuch und den Dienstmann zu suchen, und mein Magen vollführte mehrere unruhige Saltos, während ich über das Deck ging. Der Kanal war heute nicht ganz ruhig, und das neblige Grau in der Ferne ließ den nahenden Regen erahnen. Die anderen Passagiere an Deck warfen mir nur kurze Blicke zu, als ich an ihnen vorbeiging. Ein Mädchen in einem Wollrock und einer Strickjacke war ein unauffälliger und äußerst englischer Anblick, auch wenn sie einigermaßen hübsch war.
Mithilfe des Dienstmanns, dessen überraschter Blick in Mitleid umschlug, als ich nach dem Sherry fragte, fand ich den Gepäckraum, und dort durchstöberte ich Dotties viele Taschen und Kisten auf der Suche nach dem schmalen Fotobüchlein mit den vergilbten Seiten. Ich glaubte nicht, dass Mrs. Carter-Hayes, die Dottie erst seit 20 Minuten kannte, ein wirkliches Interesse daran hatte, die Fotos zu sehen, aber vielleicht lag es an der Sinnlosigkeit der Mission, dass ich länger als nötig in der Ruhe und Abgeschiedenheit des Gepäckraums verweilte. Ich strich mir eine Haarsträhne hinters Ohr, atmete aus und setzte mich mit dem Rücken zu einem von Dotties Koffern auf den Boden. Wir fuhren zurück nach England.
Ohne Alex hatte ich dort nichts. Ich hatte nirgendwo etwas. Ich hatte meine Wohnung aufgegeben, als ich mit Dottie weggegangen war, und den letzten Rest meines Besitzes mitgenommen. Es war nicht viel. Etwas Kleidung sowie ein paar Päckchen mit geliebten Büchern, ohne die ich nicht leben konnte. Ich hatte bis dahin alle Möbel verkauft und sogar das meiste von Alex’ Kleidung, was mir immer noch ein mulmiges Gefühl in der Magengegend bereitete. Ich hatte keine Angst vor Armut; bevor Alex mich in das große Abenteuer unserer Ehe hineingezogen hatte, war Armut alles gewesen, was ich kannte, und sie war mir inzwischen so vertraut wie die alte Strickjacke, die ich trug. Wenn man arm war, gab es keinen Platz für Sentimentalitäten.
Das einzig Unnötige, was ich behalten hatte, war Alex’ Kamera, für die ich ein paar Pfund bekommen hätte, von der ich mich aber nicht trennen konnte. Die Kamera hatte mich auf all meinen Reisen begleitet, auf jedem Schiff und in jedem Zug, obwohl ich die Tasche nicht ein Mal geöffnet hatte. Falls Dottie es bemerkt hatte, kommentiert hatte sie nichts.
Und so lag mein Leben in England nun wie eine absolute Leerstelle vor mir. Wir würden zu Dotties Haus in Sussex fahren, einem Ort, den ich noch nie gesehen hatte. Ich sollte weiterhin auf Dotties Gehaltsliste stehen, obwohl sie nicht mehr auf Reisen war und mir meine weiteren Aufgaben nicht erklärt worden waren. Als sie mir zum ersten Mal geschrieben und knapp erklärt hatte, dass sie Alex’ Tante sei, dass sie gehört habe, dass ich in London sei, und dass sie eine weibliche Begleitung für ihre Reisen auf den Kontinent benötigte, hatte ich mir vorgestellt, das freundliche Kindermädchen einer anspruchslosen alten Dame zu spielen, ihr Tee zu servieren und Dickens und Collins vorzulesen, während sie einnickte. Dottie mit ihrem streng zurückgestriegelten Haar, ihren harten Urteilen und ihrem gierigen Streben nach Geld war ein ziemlicher Schock.
Ich versuchte, mir Schlüsselblumen, Hecken und sanften, kühlen Regen vorzustellen. Keine Hotels mehr, keine rauchgeschwängerten Speisewagen, keine mürrischen Kellner und keine Suche nach dem richtigen Tonicwater oder Magenmittel in fremden Städten. Keine schwülen Tage mehr im Kolosseum oder auf dem Eiffelturm, keine Touristen, die fröhlich ihre Kinder umherführten und Fotos schossen, als hätten wir nie einen Krieg gehabt. Ich würde nicht mehr ständig die Namen von Schlachtfeldern auf den Abfahrtstafeln der Züge sehen und mich fragen, ob auf diesem, jenem oder einem anderen die Leiche von Alex irgendwo unter dem frisch gewachsenen Gras vergessen lag.
Ich würde Mutter besuchen müssen, wenn ich zurück war; es gab kein Entrinnen. Und es gefiel mir nicht, von der Wohltätigkeit einer anderen Frau zu leben, etwas, das ich nie zuvor getan hatte. Aber wenigstens würde ich in Dotties Haus London und all den Orten aus dem Weg gehen können, an denen Alex und ich gewesen waren. Seit er das letzte Mal in den Krieg gezogen war, hatte mir alles in und an London einen Stich versetzt. Ich wollte es nie wieder sehen.
Schließlich gab ich die muffige Stille des Gepäckraums auf und kehrte mit dem Fotoalbum in der Hand an Deck zurück. »Was hat so lange gedauert?«, fragte Dottie, als ich mich ihr näherte. Sie saß auf einem hölzernen Klappstuhl, hatte ihre Cloche gegen den Wind heruntergezogen und die Füße in ihren praktischen Oxfords an den Knöcheln gekreuzt. Sie sah mich stirnrunzelnd an, und obwohl das trübe Licht die harten Kanten ihrer Gesichtszüge abschwächte, ließ ich mich nicht täuschen.
»Hier gibt es keinen Sherry«, antwortete ich und reichte ihr das Album.
Dotties Augen verengten sich zusehends. Ich glaube, sie war häufig davon überzeugt, dass ich sie anlog, obwohl sie nicht genau wusste, wann und warum. »Sherry wäre ausgesprochen angenehm gewesen«, sagte sie.
»Ja«, stimmte ich zu. »Ich weiß.«
Sie wandte sich an ihre Begleiterin, eine Frau um die 40 mit einem breitkrempigen Hut, die auf dem Klappstuhl neben ihr saß und bereits aussah, als wollte sie am liebsten fliehen. »Das ist meine Gesellschafterin.« Ich erkannte an ihrem Tonfall, dass sie ihrem Hohn mir gegenüber Ausdruck verleihen wollte. »Sie ist die Witwe meines lieben Neffen Alex, das arme Ding. Er ist im Krieg gefallen und hat sie ohne Kinder zurückgelassen.«
Mrs. Carter-Hayes schluckte. »Ach, herrje.« Sie sah mich an und schenkte mir ein mitfühlendes Lächeln; ein Ausdruck, der so echt und freundlich war, dass ich sie fast bemitleidete für die nächsten drei Stunden, die sie in Dotties Gesellschaft würde leiden müssen. Wenn Dottie in dieser Stimmung war, machte sie keine Gefangenen – und sie war immer öfter in dieser Stimmung, je näher wir England kamen.
»Können Sie sich das vorstellen?«, rief Dottie aus. »Es war ein schrecklicher Verlust für unsere Familie. Er war ein wunderbarer junger Mann, unser Alex, wie ich nur allzu gut weiß, da ich ihn mit aufgezogen habe. Er hat einige Jahre seiner Kindheit bei mir in Wych Elm House verbracht.«
Sie richtete den Blick auf mich, und im triumphierenden Schimmer ihrer Augen sah ich, dass sich mein Schock auf meinem Gesicht abzeichnete. Dottie lächelte süßlich. »Hat er dir das nicht erzählt, Manders? Meine Güte, Männer sind so vergesslich. Aber so lange wart ihr dann ja auch nicht zusammen.« Sie wandte sich wieder an die verwirrte Mrs. Carter-Hayes. »Kinder sind die größte Freude im Leben, finden Sie nicht auch?«
Ich wusste, dass es so weitergehen würde, bis wir angedockt hatten: Dottie würde in Andeutungen und Doppeldeutigkeiten sprechen, getarnt als höflichen Small Talk. Ich entfernte mich, stellte mich an die Reling – es gab keinen Klappstuhl für mich – und überließ es dem Rauschen des Windes, die Worte wegzuwehen. Ich hatte mir nicht die Mühe gemacht, einen Hut aufzusetzen, und ich spürte, wie sich meine Locken aus ihrem Knoten lösten und mein Gesicht berührten, wie sich mein Haar verhedderte und meine Wangen rissig wurden, während ich auf das Wasser blickte, ohne etwas zu sehen.
Sie war nicht immer in dieser Stimmung, es war nur eine ihrer Launen, wenn auch die bösartigste und unglücklichste. In den vergangenen drei Monaten hatte ich gelernt, mich im Labyrinth von Dotties Höhen und Tiefen zurechtzufinden, eine Aufgabe, die ich mit Leichtigkeit erfüllte, da ich mich selbst gut mit dem Unglücklichsein auskannte. Sie war um die 50, ihr Körper schlank und seltsam muskulös, ihr Gesicht mit seinem graubraunen Rahmen aus sorgfältig zurückgestecktem Haar von Natur aus glatt, mit einem spitzen Kinn. Sie sah Alex überhaupt nicht ähnlich, obwohl sie die Schwester seiner Mutter war. Sie war nicht eitel und griff nie zu Puder oder Lippenstift, was auf ihrer gebräunten Haut und dem schmalen Strich ihres Mundes auch absurd ausgesehen hätte. Sie aß wenig, ging viel spazieren und hielt ihr Haar stets ordentlich und ihre Kleidung auf geheimnisvolle Weise makellos, selbst wenn sie auf Reisen war. Umso besser konnte sie ihre Beute jagen und verschlingen.
Ich blickte zu ihr zurück und stellte fest, dass sie Mrs. Carter-Hayes gerade die Fotos zeigte. Sie bewahrte sechs oder sieben davon in dem schmalen Fotobuch auf, für Gelegenheiten, bei denen sie eine Fremde in die Enge getrieben hatte und angeben wollte. Daran, wie Dotties Gesichtszüge weicher wurden, konnte ich ablesen, dass sie das Bild ihres Sohnes Martin in seiner Offiziersuniform betrachtete. Ich hatte das Foto schon oft gesehen, und ebenso oft hatte ich die dazugehörige Geschichte gehört. Er kommt nach Hause, um zu heiraten. Er ist so ein lieber Junge, mein Sohn. Die Zuhörenden waren immer zu höflich oder zu gelangweilt, um zu hinterfragen, warum Dottie Forsyths Sohn erst jetzt nach Hause kam, obwohl der Krieg schon vor drei Jahren zu Ende gegangen war. Und warum sie immer noch das Foto von Martin in Uniform zeigte, als ob sie ihn seit der Aufnahme nicht mehr gesehen hätte.
Es hatte auch eine Tochter gegeben – so viel wusste ich von Alex. Meine seltsame Cousine Fran, hatte er gesagt, in einem der wenigen Fälle, in denen er diese Seite der Familie überhaupt erwähnt hatte. Die seltsame Cousine Fran war 1917 gestorben, obwohl Alex’ Brief von der Front nicht erklärt hatte, wie oder warum. Sie ist gestorben, das arme Ding, schrieb er. Sind die Rationen zu Hause so schlecht, wie ich höre? Er sprach nie wieder von ihr, und in den Monaten, in denen ich für sie arbeitete, hatte auch Dottie ihre seltsame Tochter Fran nie erwähnt. Ihr Foto war auch nicht in dem Buch.
Ich wandte mich wieder dem Wasser zu. Ich sollte kündigen. Ich hätte es schon längst tun sollen. Die Stelle war unangenehm und erniedrigend. Bevor ich Alex geheiratet hatte, war ich Schreibkraft gewesen, bevor mein Leben wie eine Daunenfeder nach oben geweht worden und dann wieder nach unten gefallen war. Meine Fähigkeiten waren nun eingerostet, aber es war 1921, und Mädchen fanden ständig Arbeit. Ich könnte es in Newcastle, Manchester oder Leeds versuchen. Dort brauchten sie sicher Schreibkräfte. Es wäre kein schönes Leben, aber ich wäre versorgt, was Essen und Kleidung anging, das Unterbringungsgeld meiner Mutter würde bezahlt werden, und ich könnte angenehm betäubt vor mich hin leben.
Aber ich würde nicht kündigen. Ich wusste das, und ich glaubte, Dottie wusste es auch. Es lag nicht an dem Gehalt, das ich erhielt, denn das war gering und sporadisch. Es lag nicht an der Reiserei, die mir wie ein Albtraum vorkam, als würde ich mit dem Zug über einen riesigen Kriegsfriedhof fahren, auf dem die zerbombten Gebäude langsam ihre verkohlte Schwärze verloren und die Leichen direkt unter der Oberfläche der noch immer zerstörten Felder begraben lagen. Ich würde nicht kündigen, denn Dottie, auch wenn sie eine giftige Natter sein konnte, war meine letzte Verbindung zu Alex. Und obwohl es mir wehtat, auch nur an ihn zu denken, konnte ich ihn nicht loslassen.
Ich hatte ihn zuletzt Anfang 1918 gesehen, als er auf Urlaub zu Hause war, bevor er nach Frankreich zurückkehrte, um weitere RAF-Einsätze zu fliegen, und vom letzten nicht zurückkehrte. Sein Flugzeug wurde vier Tage später gefunden, abgestürzt hinter den feindlichen Linien. Es gab keine Leiche. Der Rucksack mit seinem Fallschirm war verschwunden. Er war in keiner deutschen Kriegsgefangenenliste, in keiner Begräbnisliste und in keiner Todesliste aufgeführt. Er war kein Patient in irgendeinem bekannten Krankenhaus gewesen. Das Rote Kreuz hatte ihn in dem Chaos nach dem Waffenstillstand auf keiner Gefangenen- oder Flüchtlingsliste verzeichnet. In drei Jahren hatte es kein Telegramm, keinen Hilferuf, keine Sichtung von ihm gegeben. Er war verschwunden. Mein Leben war mit ihm verschwunden.
Er ist im Krieg gefallen, hatte Dottie gesagt, aber das war nur ein weiterer Stachel von ihr. Laut den offiziellen Unterlagen war mein Mann nicht im Krieg gestorben. Wenn es eine Leiche gab, ein Grab, dann war ein Mensch gestorben. Aber das sagte einem niemand: Was passierte, wenn man nichts mehr hatte außer dünner Luft? War man eine Witwe, wenn vom Leben nichts als ein klaffendes Loch geblieben war? Wer war man dann eigentlich? Drei Jahre lang war ich nun schon in Bernstein gefangen – zuerst in meiner Angst und Ungewissheit und dann schließlich in einem langsamen, kalten Ausatmen unaufhaltsamer Trauer.
Solange ich mit Dottie zusammen war, war ein Teil von mir die Ehefrau von Alex. Er existierte noch, wenn auch nur in Form von Dotties Andeutungen und Vorwürfen. Jemanden, irgendjemanden seinen Namen laut aussprechen zu hören war ein Balsam, von dem ich nicht lassen konnte. Dafür war ich ihr quer durch Europa gefolgt, und nun würde ich ihr nach Wych Elm House folgen, ihrem Familiensitz. Dort hatte Alex einen Teil seiner Kindheit verbracht, was er mir nie zu erzählen für nötig gehalten hatte.
Mit Unbehagen starrte ich aufs Wasser hinaus, während sich England am Horizont abzeichnete.
2
Als sie mich eingestellt hatte, war ich davon ausgegangen, dass es sich bei Dotties Reise auf den Kontinent um einen Vergnügungsausflug handelte, um etwas, das reiche Frauen mittleren Alters ohne Grund taten. Als wir in Rom ankamen, begriff ich, dass meine Arbeitgeberin ein ganz anderes Ziel verfolgte: Obwohl sie bereits reicher war, als ich es je sein könnte, war Dottie erpicht darauf, Geld zu verdienen.
Der Krieg, so erklärte mir Dottie, während wir in einem Zugwaggon saßen und sie eine Zigarette in den Halter steckte, hatte dafür gesorgt, dass viele Angehörige der Oberschicht ruiniert waren und keinerlei Liquidität mehr besaßen. Die Klugen hatten bei Kriegsausbruch in Waffenfabriken und Armeelieferungen investiert. Die Törichten, die auf ihren alten Vermögenswerten gesessen und darauf gewartet hatten, dass die Alte Welt sich selbst wieder in Ordnung brachte, hatten verloren, und Dottie wollte daraus einen Vorteil ziehen.
Ihre Währung, ihr großer weißer Wal, war die Kunst. Gemälde, Skulpturen, Skizzen; von Scherben antiker griechischer Meisterwerke bis zu zusammengerollten Leinwänden der Genies des letzten Jahrhunderts – all das konnte man auf dem Kontinent finden, im Besitz von jemandem, der verzweifelt Geld brauchte. Und Geld war etwas, das Dottie hatte. Sie bot ihnen niedrige Preise für den Inhalt ihrer Galerien an, bezahlte in bar und baute langsam einen Vorrat an Kunst auf, der unbezahlbar sein würde, sobald die Nachkriegsdepression nachließ, und sie war sicher, dass dies eintreten würde.
»Aber du hast doch schon Geld«, sagte ich an jenem Tag im Zugwaggon. »Du machst dir eine Menge Mühe dafür.«
»Hör gut zu, Manders«, erwiderte sie und gab mir ein Zeichen, damit ich ein Streichholz für ihre Zigarette anzündete. »Sieh dir diese Menschen an. Sieh dir an, was aus ihnen geworden ist, wenn ich sie besuchen komme. Reiche, alteingesessene Familien – einige von ihnen sind jahrhundertealt. Meine Familie ist jünger als ihre, und mein Geld ist es auch. Die Lektion ist, dass wir jetzt Geld haben, aber wir haben keine Ahnung, was in zehn oder 20 Jahren aus uns wird.« Sie nahm einen Zug von der Zigarette, während ich das Streichholz ausschüttelte. »Ich habe nicht die Absicht zuzulassen, dass meinem Sohn oder seinen Kindern etwas Derartiges widerfährt. Man kann nie zu viel Geld haben. Vielleicht macht mich das habsüchtig; ich nehme an, das tut es.« Sie nahm einen weiteren Zug und betrachtete mich. »Hätte meine Schwester etwas mehr Habsucht besessen, als sie heiratete und Alex bekam, wärst du jetzt nicht in dieser Situation.«
Wieder einer ihrer Stiche, aber es stimmte. Ich dachte an ihre Worte, als ich Monate später in einem anderen Zug saß, diesmal auf der Fahrt von London nach Hertford. Alex’ Mutter hatte sich dem Wunsch ihrer Eltern widersetzt und einen ungeeigneten Mann geheiratet – sie hatte in einem Zustand des Glücks und begrenzter finanzieller Mittel gelebt, während ihr Mann Erfolg zu haben begann; bis beide unerwartet starben, als Alex noch klein war, und ihn als Waise zurückließen. In den folgenden Jahren war das wenige Geld, das ihnen geblieben war, aufgebraucht worden, und nun war es weg.
Ich starrte aus dem Fenster des Wagens der dritten Klasse, ohne etwas zu sehen. Ich war wieder in England, genau wie ich es befürchtet hatte. Ich hatte zwei Tage freibekommen, genug Zeit, um Mutter in Hertford zu besuchen, dort zu übernachten und nach London zurückzukehren, wo Dottie die Zeit damit verbrachte, die Lieferung ihrer geraubten Stücke zu organisieren und sie nach Wych Elm House zu bringen.
Dottie musste alles über Mutter wissen; das nahm ich als selbstverständlich an, obwohl wir nie darüber gesprochen hatten. Sie hatte sich bemüht, alles über mich in Erfahrung zu bringen. Sie konnte unmöglich damit einverstanden gewesen sein, dass jemand wie ich in ihre kostbare Familie eingeheiratet hatte – eine, die nicht einmal wusste, wer ihr Vater war, und deren Mutter in eine Klinik für Geisteskranke eingewiesen worden war. Und obwohl sie in ihren Launen an mir herumstocherte und herumschnüffelte, warf sie mir diese offensichtlichen Fehler nie vor. Sie war seltsam tolerant gegenüber der Tatsache, dass meine Mutter unheilbar verrückt war und dass ich freie Tage brauchte, um sie in der Klinik zu besuchen, deren Kosten ich von meinem Gehalt bezahlte. Ich stellte keine Fragen und nahm die Gnade des Schweigens dankbar an, denn Mutter war ein Thema, das ich nicht unter Dotties schonungslosem Blick sezieren wollte.
»Es geht ihr heute gut«, sagte die Krankenschwester zu mir, als sie mich in das Besuchszimmer führte. »Wir werden herumkommandiert wie eine Horde Dienstmädchen.« Sie schenkte mir ein Lächeln.
Ich lächelte höflich zurück. Dann also wieder einmal Mutters »Gutsherrinnen«-Stimmung, wie ich es nannte. Ich hatte sie schon oft erlebt. Sie war rätselhaft und manchmal ärgerlich, aber zumindest war es eine ihrer ruhigeren Phasen.
Mutter saß in einem Korbsessel im Besuchszimmer und blickte aus dem Fenster auf den Garten. Sie trug ein kariertes Kleid und weiche Pantoffeln, ihr langes Haar war zu einem lockeren Zopf auf dem Rücken gebunden. Man hatte ihr einen Morgenmantel gegeben, vermutlich weil sie irgendwann einmal über Kälte geklagt hatte, und sie hatte ihn als einen Haufen zu ihren Füßen auf dem Boden liegen lassen. Nach meiner letzten Zählung war sie 46, aber ihre Haut ließ sie jünger aussehen und ihre hängenden Schultern und ihre schmalen, ständig zappelnden Hände ließen sie älter wirken. Sie wandte mir ihre großen braunen Augen zu, als ich den Raum betrat.
»Hier ist Ihr Besuch«, sagte die Krankenschwester zu ihr, als ich meine Handtasche abstellte und mich auf den Stuhl ihr gegenüber sinken ließ.
»Wie schön«, sagte Mutter.
Das Krankenhaus befand sich in einem ehemaligen Privatanwesen auf einem grünen Hügel auf dem Land. Es hatte einen hübschen Garten und rustikale Fensterläden an den Fenstern. Der Blick fiel auf die sanft abfallende Landschaft, die mit Bäumen, Hecken und Zäunen durchsetzt war. Die Krankenschwestern sprachen leise und schrien nicht. Es gab keine Schlösser, Fesseln oder Kaltwasserbäder. Ich hätte sie an einem billigeren Ort unterbringen können, aber stattdessen gab ich das meiste Geld dafür aus, sie hierzubehalten, wo sie gelebt hatte, seit ich 18 war.
Sie schenkte mir jetzt ein Lächeln, höflich und starr. Ihre Haut war makellos und schimmerte im Licht, das durch das Fenster fiel. Wie so oft erkannte sie mich nicht.
»Ich bin deine Tochter«, sagte ich sanft zu ihr, als die Schwester das Zimmer verließ.
Etwas flackerte kurz über ihr Gesicht, straffte die Haut zwischen ihren Augen und war dann wieder verschwunden. »Bitte trinken Sie einen Tee«, sagte sie freundlich. »Ich habe die Mädchen gebeten, ihn zu bringen.«
Ich brauchte mich nicht im Besuchszimmer umzusehen, um zu wissen, dass es keinen Tee gab und auch keine Dienstmädchen. »Das ist sehr nett«, sagte ich. »Es tut mir leid, dass ich eine Weile fort gewesen bin.«
»Waren Sie fort?«, fragte Mutter. »Das ist sehr interessant.«
Selbst in einem Irrenhaus war die Schönheit meiner Mutter eine Augenweide. Sie hatte tief kakaobraune Augen, ein spitzes Kinn und eine kleine, feminine Nase. Ich hatte ihr Aussehen nicht geerbt – meine Augen standen gerade unter dunklen, gewölbten Brauen, meine Nase war unverschämt normal, und bei hellem Licht hatte ich ein paar Sommersprossen auf den oberen Wangenknochen, die ich nicht mit Puder abdeckte. Mein Haar war dunkel und wild, während ihres honigfarben und weich wie Kaschmir war. Ich musste mein Aussehen von meinem Vater geerbt haben, obwohl ich es nie erfahren würde. Mutter hatte mir nie gesagt, wer mein Vater war, und wenn sie die Antwort überhaupt noch wusste, sagte sie es nicht.
Während meiner gesamten Kindheit waren wir nur zu zweit, und meine Mutter und ich waren von einer Wohnung zur nächsten in den schäbigeren Vierteln Londons gezogen. Mutter arbeitete in allen möglichen sporadischen Jobs, um uns zu ernähren: Kellnerin, Künstlermodell, Kleindarstellerin am Theater, Ticketverkäuferin im Kino, als das erste in der Nähe unserer Wohnung eröffnet wurde. Ich machte den Haushalt, kochte, kümmerte mich um die praktischen Dinge und versuchte, zur Schule zu gehen. In den ersten 18 Jahren meines Lebens hatten wir irgendwie Essen und Unterkunft zusammengeschustert. Wenn sie bei klarem Verstand war, war es immer noch schwer, aber zu schaffen. Wenn sie nicht bei klarem Verstand war, was mit der Zeit immer häufiger der Fall war, lebte ich in einer Art blinder Panik, unfähig zu denken oder zu atmen, von einer Minute zur nächsten, von einer Stunde zur nächsten, in Erwartung eines unausweichlichen, schrecklichen Ergebnisses und doch im steten Kampf dagegen.
Ich wusste nie, wann sie mitten in der Nacht verschwinden würde. Ich wusste nie, wann ich nach Hause kommen und sie zusammengesunken auf dem Boden vorfinden würde, schluchzend, dass sie nicht mehr leben wolle. Ich wusste nie, wann ein fremder Mann an die Tür klopfte und behauptete, Mutter habe ihn belästigt und sie müsse damit aufhören, bevor er die Polizei rief, oder wann sie tagelang im Bett lag, unfähig aufzustehen, nicht einmal um zu ihrer bezahlten Arbeit zu gehen, bevor sie entlassen wurde. Ich wusste nie, wann sie mich anlog – sie mochte ein Foto von einem Fremden finden und mir sagen, es sei mein Vater, oder sie erzählte mir von den Tagen, an denen sie mit dem Zirkus umhergereist war und in einem Trikot und mit einem hübschen Diadem für das Publikum tanzte.
Die Polizei hatte tatsächlich ein paarmal vor der Tür gestanden, immer nach einem von Mutters Anfällen. Vagabundieren war eine ihrer Sünden, sie wanderte durch die Straßen und lachte leise vor sich hin. Leichte Diebstähle waren eine andere – wenn sie einmal in einem manischen Zustand war, konnte sie nicht mehr unterscheiden, was ihr gehörte und was nicht, und sie nahm Gegenstände mit und ging damit weg, weil sie sicher war, dass sie ihr gehörten. Und manchmal fixierte sie sich auf einen Mann, folgte ihm und schaute in seine Fenster, in der Überzeugung, er sei ihr imaginärer Liebhaber oder der Mann, der sie mitnehmen würde, wohin auch immer.
Es tat ihr immer leid, so leid, wenn die klaren Gedanken zurückkehrten. Ich bin nicht geeignet für dich, sagte sie, streichelte mein Haar und hielt mich fest. Ich werde mich bessern, mein braves, süßes Mädchen. Und eine Zeit lang tat sie das dann auch, arbeitete fleißig, half beim Kochen und Putzen, ermutigte mich zum Lernen, lachte mit mir über die Absurditäten des Tages. Und dann wachte ich nachts auf und stellte fest, dass sie verschwunden war, und alles begann von vorn. Und wieder von vorn.
Mit 18 Jahren hatte ich das Geld für einen Schreibmaschinenkurs zusammengekratzt. Ich arbeitete hart daran und war sehr gut. Bald würde ich mein eigenes Geld verdienen, und die Dinge würden besser werden. Doch als ich eines Tages vom Unterricht nach Hause kam, stand wieder einmal die Polizei in unserer Wohnung. Mutter war dabei erwischt worden, wie sie eine Pelzstola aus einem Damenbekleidungsgeschäft mitnehmen wollte, weil sie sie angeblich für eine Reise nach Russland brauchte. Die Stola war eine Menge Geld wert, und das Geschäft wollte sie anzeigen. Sie müsse eingewiesen werden, erklärte mir der Polizist nicht ohne Mitleid in seinen Augen, oder sie müsse mit einer Anklage rechnen.
Es war genau dies, was ich all die Jahre gefürchtet hatte, das Ereignis, das mir in unzähligen Nächten den Atem und den Schlaf geraubt hatte. Erschöpft und betäubt gab ich nach, aber ich kämpfte weiter für sie. Ich fand einen Job und nutzte das Geld, um ihr die bestmögliche Pflege zukommen zu lassen. Immer, immer hatte ich gekämpft.
Und nun saß sie mir gegenüber, Jahre später, und ihr ausdrucksloses Gesicht zeigte mir, dass sie mich überhaupt nicht wiedererkannte.
»Hast du Ivanhoe beendet?«, fragte ich. »Sie haben es dir vorgelesen, als ich dich das letzte Mal besucht habe.«
Mutter schaute wieder aus dem Fenster, wo ein Gärtner auf dem Gelände arbeitete. Als sie den Kopf drehte, konnte ich die roten Kratzspuren an ihrem Hals sehen, direkt über ihrem Kragen. »Ich habe ihm wiederholt gesagt, dass die Rosen zu trocken sind«, beklagte sie sich. »Er hört nie zu. Vielleicht muss ich ihn entlassen. Es ist so schwer, gute Angestellte zu finden, sehen Sie das nicht auch so?«
»Mutter, hast du dich gekratzt?«
Ihre Stimme wurde eisig, und sie schaute immer noch aus dem Fenster. »Ich habe keine Ahnung, was du meinst.«
Ich seufzte, lehnte mich auf meinem Stuhl zurück und schaute auf meine Uhr. Ich würde das Personal nach den Kratzern fragen müssen – sie sollten sie doch genau im Auge behalten. Hatte sie sie sich selbst zugefügt oder war sie in eine Auseinandersetzung mit einem anderen Patienten verwickelt gewesen? Ich überlegte einen Moment lang, was wohl wahrscheinlicher war, konnte mich aber nicht entscheiden.
Ich blickte wieder auf und sah, dass meine Mutter mich mit einem offenen und klaren Blick anstarrte.
»Joanna«, sagte sie.
Ich erstarrte vor Überraschung. Es war Jahre her, dass sie meinen Namen gesagt hatte.
»Hallo, Mutter«, antwortete ich zögernd. »Ich bin’s.«
»Ich mache mir Sorgen um dich.« Meine Mutter drückte ihre Fingerspitzen an ihre Porzellanschläfen und runzelte die Stirn. »Die ganze Zeit, die ganze Zeit mache ich mir Sorgen.«
Ich runzelte nun selbst die Stirn. Meinte sie jetzt, oder erinnerte sie sich an eine Sorge aus der Vergangenheit? »Das brauchst du nicht. Mir geht es gut.«
»Wo ist der Mann, den du geheiratet hast?«
Das war eine weitere Überraschung. Ich konnte den schnellen Bahnen von Mutters Gedanken nicht folgen, ihren rasanten Abstürzen in den Kaninchenbau. Alex war zweimal mit mir gekommen, um sie zu besuchen, und obwohl Mutter ihm die gleiche abweisende Reaktion entgegengebracht hatte wie mir heute, hatte er einen solchen Eindruck auf sie gemacht, dass die Erinnerung an ihn immer noch von Zeit zu Zeit hochkam.
»Er wartet im Auto«, antwortete ich. Man hatte mir gesagt, es sei keine gute Idee, sie zu schockieren, vor allem nicht mit Gerede über den Tod, also tat ich immer so, als wäre Alex am Leben, wenn sie mich nach ihm fragte.
»Er soll reinkommen. Es ist unhöflich, einen Gast draußen zu lassen.«
»Er hat eine Erkältung. Er will nicht, dass du dich ansteckst. Nächstes Mal kommt er rein, versprochen.«
»Ist er sehr krank?«
Ich zuckte die Achseln. »Du weißt ja, wie Männer sind. Es gibt immer ein großes Drama, aber in ein paar Tagen ist er wieder gesund.« Ich sagte das so, als wäre ich eine andere Frau, die ihren Mann jeden Tag zu Hause hatte, wo er ihr im Weg war.
Mutter blinzelte mich an; sie hatte noch nie einen Ehemann gehabt und keine Ahnung, was ich meinte. »Er sieht sehr gut aus. Der Mann, den du geheiratet hast. Nicht wahr?«
»Ja.« Ich zwang die Worte aus meiner Kehle. »Er sieht gut aus.«
Sie öffnete den Mund, als wollte sie noch etwas sagen, schloss ihn dann aber wieder und schaute aus dem Fenster, wobei die Kratzer an ihrem Hals wieder sichtbar wurden.
Ich wartete. Die Erwähnung von Alex, die Behauptung, dass er draußen im Auto saß und nicht schon seit drei Jahren tot war, versetzte mir einen Stich in den Magen. Ich fragte mich, ob dieser Schmerz mein Schicksal war, ob er jemals nachlassen würde. In einem scharfen Anflug von Selbsthass wünschte ich mir, mit Mutter tauschen zu können, die nicht wusste, dass es einen Krieg gegeben hatte, die nicht wusste, dass Alex aus seinem Flugzeug gesprungen und verschwunden war. Auch wenn sie nach der Grenze zwischen Fakt und Fiktion tastete wie ein Blinder durch ein Zimmer, so dachte sie doch, dass, wenn ich sagte, dass Alex im Auto wartete, er wirklich dort sein musste: vor Leben und Kraft strotzend, die Krempe seines Hutes über seine hübsche Stirn gezogen, während er sich im Sitz zurücklehnte, einen Mantel und ein Paar lederne Fahrhandschuhe trug, die ich ihm zu Weihnachten geschenkt hatte, und sich die Nase mit einem Taschentuch aus der Manteltasche abtupfte. Für Mutter konnte das die Wahrheit sein.
»Dieser Rock«, sagte Mutter und drehte sich wieder zu mir um. »Er ist kariert. So unvorteilhaft. Und diese Strickjacke. Du solltest dich für ihn netter anziehen.«
Reflexartig glättete meine Hand meinen Rock über meinem Schoß. Drei Jahre lang hatte ich mir keine Gedanken darüber gemacht, wie ich mich kleidete. »Alex gefällt, wie ich aussehe.«
»Das gefällt keinem Mann.« Für einen Moment war die Gutsherrin verschwunden und Nell Christopher starrte mich an. »Es reicht nicht aus, den Mann zu heiraten, Joanna. Du musst ihn auch behalten.«
»Ich habe ihn behalten«, protestierte ich, und die Worte waren aus meinem Mund, bevor ich mich daran erinnern konnte, dass ich mit einer Verrückten diskutierte. »Er hat mich geliebt. Er gehörte mir.« Bis er mir nicht mehr gehörte. Mir nie wieder gehören würde.
»Du hörst mir nicht zu«, sagte sie. Falls sie bemerkt hatte, dass ich die Vergangenheitsform benutzte, als ich von Alex sprach, ließ sie sich nichts anmerken. »Kein Mann gehört jemals dir, nicht ganz. Du musst dich anstrengen.« Sie blickte sich im Zimmer um. »Meine Güte. Wie viel Uhr ist es?«
Ich schaute wieder auf die Uhr, mein Herz sank angesichts ihres abwesenden Tons. »Vier Uhr.«
»Ach, du liebe Zeit. Es tut mir furchtbar leid, aber ich muss unseren Besuch ein wenig abkürzen. Der Viscount kommt nämlich.«
»Heute?«, sagte ich bestürzt. »Jetzt?«
»Ja. Er wird jeden Moment hier sein.« Ihre Augen waren wieder leer, einfach so. Sie sah etwas an, das ich nicht sehen konnte. »Er nimmt mich mit nach Ägypten. Das wird ein großes Abenteuer!«
Der Viscount – er hatte nie einen Namen bekommen, soweit ich wusste – war eine von Mutters Lieblingserfindungen, ein reicher Mann, der immer kurz davor war aufzutauchen und sie mitzunehmen. Er tauchte gewöhnlich auf, wenn Mutter gestresst oder verwirrt war oder wenn sie schlicht ein Gespräch beenden wollte. War er erst einmal in ihrem Kopf, sprach sie stundenlang, manchmal tagelang, von nichts anderem mehr. Es war eine Reise nach Russland mit dem Viscount, die Mutter dazu veranlasste, die Pelzstola aus dem Damenladen zu stehlen.
Der kurze Blick auf Nell Christopher war verschwunden, und ich war mir nicht sicher, ob ich sie wiedersehen würde. Der Gedanke war schmerzhaft und fast eine Erleichterung zugleich.
»Mutter«, sagte ich, wohl wissend, dass sie nicht auf mich hören würde, »der Viscount wird nicht kommen.«
»O doch!« Wenn sie glücklich war, strahlte sie vor Schönheit. »Er wird bald hier sein. Ich bin nicht richtig gekleidet. Wo sind meine Dienstmädchen? Ich muss mich fertig machen.« Sie zog ihren Ärmel zurück, und vor meinen Augen grub sie ihre Nägel in die weiche Haut ihres Arms knapp unterhalb des Handgelenks und zog sie nach oben, wobei sie rote Rillen in das weiße Fleisch zog, während ihr Blick weit entfernt blieb.
Erschrocken zuckte ich von meinem Stuhl hoch. Ich rief nach der Pflegerin; sie brachte Mutter weg und ließ sie glauben, dass sie sie auf die Ankunft des Viscounts vorbereiten würde, wobei sie mir einen um Entschuldigung bittenden Blick zuwarf. »Das hat gerade erst angefangen«, sagte sie leise zu mir. »Man hat es den Ärzten gemeldet. Ein bisschen Ruhe scheint zu helfen.«
Ich starrte auf Mutters sich entfernenden Rücken in ihrem verblichenen, karierten Kleid. »Ich komme wieder …« Ich wollte eigentlich bald sagen, aber mir wurde klar, dass ich morgen nach Wych Elm House fuhr und keine Ahnung hatte, wann ich wieder zurück sein würde. »Ich werde wiederkommen.« Mutter reagierte darauf nicht.
Draußen lenkte ich meine Schritte in Richtung des kleinen Hotels, in dem ich während meiner Besuche bei Mutter immer übernachtete, verdrängte den Krankenhausgeruch mit der frischen Luft und lauschte den Vögeln, die ihr Feierabendgespräch führten. Ich war schon einige Häuserblocks weit gelaufen, als mich ein Gefühl wie eine Welle der Übelkeit überkam, so heftig, dass mir der Schweiß ausbrach und mir schwindelig wurde. Meine Augen brannten vor Tränen. Ich blieb stehen und setzte mich auf eine Bank, wo ich zusammensackte wie eine verwelkende Pflanze. Ich war 26 Jahre alt, und in dieser erstickenden Wolke der Traurigkeit spürte ich, dass ich keinen Kampfgeist mehr in mir hatte. Ich fühlte mich wie eine alte Frau.
Überraschenderweise war es Dotties Gesicht, das mir in den Sinn kam, ihre Augen verengten sich, ihr Mund drückte mit der kleinsten Bewegung ihrer dünnen Lippen Abscheu aus. Pass auf, Manders. Na los. Kein Mädchen hat es je zu etwas gebracht, indem es auf einer Bank in der Öffentlichkeit saß und Trübsal blies. Ich stieß einen leisen Laut des Selbstmitleids aus, richtete mich aber auf und lehnte mich an die Rückenlehne der Bank, beobachtete die wenigen Passanten und atmete tief durch. Was konnte ich denn tun? Aufhören, Jo Manders zu sein, geborene Christopher, ohne festen Wohnsitz? Es gab keine Möglichkeit aufzugeben. Die Mutter wurde verrückt, der Ehemann sprang aus einem Flugzeug in die leere Luft, und man machte einfach weiter.
Ich ging zurück in mein Hotel, wo ich eine Tasse Tee trank, mich in meiner Unterwäsche auf das schmale Bett legte und bei Lampenlicht D. H. Lawrence las, bis ich einschlief. Am nächsten Morgen nahm ich den Zug nach London.
Dottie empfing mich am Bahnhof, sie trug ein neues Kostüm – einen olivgrünen Rock und eine passende Jacke mit goldenen Knöpfen, wie eine Militäruniform. Sie warf mir einen ihrer strengen, abschätzenden Blicke zu und betrachtete meinen grauen Wollrock, meine cremefarbene Bluse mit dem weiten Kragen und die hellgraue, mit Satinbündchen eingefasste Strickjacke, die ich übergeworfen hatte. Ihr Blick verengte sich auf meine dunklen Locken, die sich immer wieder aus ihrem Knoten lösten, sosehr ich mich auch bemühte, auf mein sauber geschrubbtes Gesicht, auf meine teilnahmslose Miene. Beinahe hätte sie mich wie üblich kommentarlos ignoriert, aber etwas veranlasste sie, fast widerwillig zu fragen: »Geht es ihr gut?«
Ich verbarg meinen Schock und zuckte die Achseln. »So gut, wie man es erwarten kann.«
In Dotties Blick flackerte etwas Nachdenkliches auf, aber ihr Gesicht verschloss sich rasch wieder, sie schaute weg und griff nach ihrer Handtasche, als hätte ich sie stehlen wollen. »Komm mit, Manders«, sagte sie. »Der Wagen wartet.«
3
Dottie hatte ein Auto mit Fahrer, das uns nach Sussex brachte. Ich musste erschöpfter gewesen sein, als ich dachte, denn ich schlief fast sofort ein, weil die Wärme und das Brummen des Motors mich ins Vergessen trieben. Als ich wieder aufwachte, saß ich zusammengekauert in der Ecke meines Sitzes, die Arme verschränkt und die Strickjacke an meinen Körper gedrückt. Dottie saß aufrecht, ein ledernes Notizbuch auf dem Schoß, und blätterte mit einem Stift in der Hand in einem Stapel von Papieren.
»Wir werden in knapp 30 Minuten in Wych Elm House sein«, sagte sie zu mir, als ich die Augen öffnete, obwohl sie mich nicht angesehen hatte. Sie schaute auf die Uhr an ihrem schmalen Handgelenk und vergewisserte sich erneut. »Mein Mann Robert wird dort sein. Er ist wegen Martins Rückkehr nach Hause gekommen.«
Ich setzte mich in stiller Überraschung auf. In den Monaten, in denen ich mit Dottie gereist war, hatte sie nie einen Ehemann erwähnt. Es war logisch, dass sie einen haben musste, denn sie hatte ja Kinder, aber er war nicht ein einziges Mal zur Sprache gekommen, nicht einmal am Rande. Ich hatte angenommen, er wäre längst tot.
Dottie starrte auf die Sitzlehne vor sich und suchte in ihrem Kopf nach etwas. Ihr Kiefer spannte sich und ihre Hand zuckte auf den Seiten. »Ich kann nicht genug betonen, Manders«, sagte sie langsam, »dass du dich in Wych Elm House anständig benehmen musst.«
Ich rieb mir mit der Hand über die Augen und fragte mich, worauf sie wohl hinauswollte. »Ich benehme mich immer anständig«, antwortete ich. »Ich habe dir nie Anlass zur Beschwerde gegeben.«
»Sei keine Närrin, Manders«, schnauzte sie. »Wir sind nicht mehr in Europa.«
Ich starrte sie an und versuchte zu verstehen, was sie meinte. Wollte sie andeuten, ich hätte eine lockere Moral? Das taten die Leute manchmal wegen Mutter. Ich öffnete meinen Mund, um beleidigt zu protestieren, hielt aber inne und beobachtete sie.
Sie ließ ihren Blick wieder auf die Papiere sinken und unterzeichnete eines davon mit einer Handbewegung. »Er wird dir sagen, dass sein Verhalten keine Rolle spielt. Glaub ihm nicht.« Die Seite verschwand mit einer Handbewegung, und eine andere ersetzte sie. »Es spielt keine Rolle, dass du Alex’ Frau warst. Wenn du Robert auch nur im Geringsten ermutigst, werde ich dich entlassen und du wirst nicht länger mit dieser Familie verbunden sein.«
Es war absurd, beleidigend – dass sie dachte, ich würde mich mit ihrem Mann unter ihrem Dach irgendwie danebenbenehmen. Aber ich konnte das Elend sehen, das sich in Dotties Gesichtszügen sorgfältig verbarg. Es schmerzte sie, demütigte sie, überhaupt darüber zu sprechen. Sie wurde immer angespannter und unglücklicher, je näher wir ihrem Haus kamen. Diese Heimkehr, so wurde mir klar, war ganz und gar nicht die freudige, von der sie Mrs. Carter-Hayes bei der Überquerung des Ärmelkanals wahrscheinlich erzählt hatte. Der Gedanke, dass ihre Familie noch unglücklicher sein könnte als meine eigene, versetzte mir einen Schock.
»Ich verstehe«, sagte ich.
Sie unterschrieb einen weiteren Zettel und blätterte die Seite erneut um. »Martin kommt morgen früh an.« Wieder war ihre Stimme hart und düster, so ganz anders als der schmeichelnde Ton, den sie benutzt hatte, als sie das Foto ihres Sohnes auf dem Schiff von Calais gezeigt hatte. »Er hatte nach dem Krieg ein Gesundheitsproblem, das seine Nerven beeinträchtigte, und war in der Schweiz in einem Kurort.«
Der Ehemann war also ein Lustmolch und der Sohn ein Verrückter, der gerade aus der Anstalt kam. Kein Wunder, dass Dottie mit Details sparsam umgegangen war, bis jetzt, wo sie mich im Auto gefangen hielt, unfähig, schreiend davonzulaufen. Und ich wusste immer noch nichts über die seltsame Cousine Fran. »Es ist schön, dass er nach Hause kommt«, gelang es mir zu sagen.
»Ich möchte nicht, dass in der Gegenwart meines Sohnes irgendwelche beunruhigenden Themen angesprochen werden«, sagte sie, als hätte ich nichts gesagt. »Der Krieg darf nicht erwähnt werden. Alex ebenso wenig. Martin mochte Alex sehr und fand seinen Tod erschütternd. Wenn er dich darauf anspricht, erwarte ich, dass du ihn ablenkst und das Thema wechselst.«
»In Ordnung«, antwortete ich, da ich mir nichts Widerlicheres vorstellen konnte, als mit einem Mann, der den Verstand verloren hatte, über meinen Mann zu sprechen. Das Gespräch mit Mutter war schon schlimm genug gewesen. Ich betrachtete meinen Daumennagel, kratzte mit einem Fingernagel daran entlang und überdachte meine Entscheidung, nicht in Armut in London zu leben, aufs Neue. »Was genau werden meine Aufgaben sein?«
Sie sah mich zum ersten Mal an, dann richtete sie ihren Blick wieder auf ihre Papiere. »Du wirst mich durch meinen Tag begleiten und mir zur Seite stehen. Ich erwarte, dass du dich jeden Morgen um acht Uhr beim Frühstück zu mir gesellst. Ich werde mich mit Käufern von Kunstwerken treffen und mit ihnen verhandeln. Von dir wird nicht erwartet, dass du Konversation machst – je weniger du sprichst, desto zufriedener bin ich tatsächlich. Deine Aufgabe wird es sein, Tee zu servieren und mir bei meinem Schriftverkehr zu helfen. Ich habe das richtig verstanden, dass du tippen kannst?«
»Ja. Ich kann tippen. Aber ich habe noch nie Tee serviert.«
Sie warf mir einen Blick zu, der mir eindeutig vermittelte, dass sie mich für dumm hielt. »Das ist nicht schwer, Manders. Versuch einfach, ihn nicht zu verschütten.« Sie lehnte sich in ihrem Sitz zurück. »Neben dem Verkauf der gekauften Stücke werde ich auch mit der Planung von Martins Verlobung und Hochzeit beschäftigt sein.«
Ich runzelte verwirrt die Stirn. »Mit wem ist Martin denn verlobt, wenn er in einem Kurhaus war?« Wenn sie es als Kurort bezeichnen wollte, würde ich mich dem anschließen.
»Er ist noch nicht verlobt. Ich glaube, ich habe erwähnt, dass er nach Hause kommt, um zu heiraten.«
»Ja«, erwiderte ich langsam. Die Reihenfolge schien mir verkehrt zu sein. »Ich dachte, man braucht eine Verlobte, um eine Verlobung zu haben.«
Dottie wischte dieses Detail mit einer Handbewegung beiseite. »Ich kümmere mich darum«, sagte sie, und während ich sie anstarrte, nahm sie ihren Stift zur Hand und fuhr fort. »Es wird einige Nachmittage geben, an denen ich dich nicht benötige, und die stehen dir zur freien Verfügung. Nach sechs Uhr sind deine Abende dir überlassen, es sei denn, ich habe eine besondere Aufgabe für dich.«
Ich schaute aus dem Fenster auf die vorbeiziehenden Wälder und dachte an die langen Abende, an denen ich allein sein würde, während sich der Herbst in den Winter hineinzog. »Es scheint einsam zu liegen.«
»Es gibt eine Stadt, die weniger als eine Stunde Fußweg entfernt ist. Möglicherweise kannst du das Auto und den Fahrer in Anspruch nehmen, wenn sie frei sind. Es gibt eine Leihbibliothek, soweit ich weiß.«
Es war ein großzügiges Angebot, ganz untypisch für Dottie. Ich drehte mich zu ihr um, bereit, ausnahmsweise freundlich zu sein, aber sie sah mich nicht an. Sie starrte vor sich hin, ihre Papiere waren vergessen. Sie zog ihre lange Zigarettenspitze heraus, steckte eine Zigarette hinein und zündete sie an, direkt im Auto, wobei sie einen üblen Rauchschwaden erzeugte. Sie hatte mich vergessen, und ganz sicher hatte sie den Fahrer vergessen, den sie die ganze Fahrt über nicht beachtet oder auch nur wahrgenommen hatte. Ihr Blick verdüsterte sich, und irgendetwas in ihrem Gesicht ließ mich erschaudern.
Die Dottie, mit der ich drei Monate in Europa verbracht hatte, war unliebsam gewesen, aber sie war auch energisch und nervös gewesen, unfähig, still zu sitzen. Jetzt sah ich, dass diese Frau in Wirklichkeit die glücklichere Version von sich selbst war – sie schleppte ihr Gepäck von Bahnsteig zu Bahnsteig, verhandelte mit Hotelangestellten, schritt zügig über Kopfsteinpflaster mit einer Karte in der Hand und einer Zigarette zwischen den Lippen, feilschte stundenlang um Kunstwerke. Auf ihre Art schien sie dabei zu gedeihen, aufzublühen. Diese stille Laune, diese in sich gekehrte Unzufriedenheit war neu, und sie bereitete mir Unbehagen, denn offensichtlich war etwas in Wych Elm House die Ursache dafür.
Schweigend folgte ich ihrem Blick und riss meinen eigenen von ihrem Profil los. Sie starrte am Fahrer vorbei durch die Frontscheibe, wo sich die dichten Bäume lichteten und wir die ungepflasterte Auffahrt entlangruckelten, bis ein Haus in Sicht kam.
Dottie nahm einen langen, bedächtigen Zug von ihrer Zigarette und stieß Rauch aus wie ein Drache. Sie blinzelte langsam, die Falten in ihrem Gesicht spannten sich an, und als sie die Augen wieder öffnete, waren sie verschlossen, undurchdringlich, und was auch immer an der Oberfläche gewesen war, versank wieder in der Tiefe.
»Nun, dann«, sagte sie zu niemandem speziell. »Da ist es. Mein Zuhause.«
4
Für mich sah es einfach wie ein Haus aus. Groß, mit buttergelben Ziegeln und Giebeln und einem großen, doppeltürigen Eingang am Kopf einer runden Zufahrt. In der Mitte des Gebäudes, über dem Eingang, ragte ein hoher Giebel durch das Blätterdach der Bäume in die Höhe. Es handelte sich nicht um eines jener gepflegten Anwesen inmitten einer sanft geschwungenen Landschaft, wie man sie in Wochenschauen über die königliche Familie sieht, die schon seit Jahrhunderten existierten und von einer Schar von Gärtnern betreut wurden. Stattdessen war es ein teures Haus, das in ein Waldgewirr hineingebaut worden war und von den ausladenden Bäumen, die das Dach berührten, verdunkelt wurde, umgeben von bräunlichem Gestrüpp, das mit sterbenden Blumen geschmückt war. Es wirkte irgendwie verlassen und leer. Das Haus selbst beeindruckte durch den offensichtlichen Reichtum, aber wenn je ein Gärtner hier gewesen war, dann schon seit langer Zeit nicht mehr.
Der Fahrer half mir aus dem Auto, und als ich mich aufrichtete, strömte mir ein voller Atemzug frischer Septemberluft in die Nase. Es roch nach totem Laub und frischem Saft, und es war seltsam kalt. Ich war an die schwüle Hitze eines europäischen Sommers gewöhnt, gemischt mit der abgestandenen Luft des Reisens und dem ewigen Gestank Londons. Ich atmete noch einmal ein und glaubte, einen Hauch von Meer zu riechen.
Dottie, die Papiere unter den Arm geklemmt, entledigte sich ihrer Zigarette und marschierte die Treppe zum Haus hinauf. Sie verschwand darin, ohne mir einen Blick zuzuwerfen. Ich folgte ihr, beeilte mich, mit ihr Schritt zu halten, und kam mit einem unbeholfenen Gepolter durch die Haustür. Außer meiner Handtasche hatte ich nichts bei mir, denn unser Gepäck folgte in einem separaten Wagen.
Der Vorraum war schummrig, das einzige Licht kam indirekt von den hohen Fenstern des angrenzenden Raums, zu dem die doppelflügelige Glastür weit geöffnet war. Ich erblickte einen Schirmständer, eine Anrichte, Böden aus dunklem Holz mit sauberen, passenden Teppichen, einige mittelmäßige Landschaftsgemälde an den Wänden. Es war frisch abgestaubt und aufgeräumt, die Luft roch streng nach Reinigungsessig. Es gab keine Mäntel, die achtlos über die Haken geworfen wurden, keine Hüte, die an der Tür hingen, und auch sonst keine Anzeichen dafür, dass Menschen kamen und gingen. Mir wurde klar, dass, während Dottie in Europa gewesen war, ihr Mann Gott weiß wo und ihr Sohn in einem Krankenhaus, schon seit einiger Zeit niemand mehr hier gewohnt hatte.
Ich folgte dem Geräusch von Dotties klappernden Oxfords den Korridor entlang, vorbei an einem Wohnzimmer und einem Arbeitszimmer sowie einem kleinen Salon mit unbequemen antiken Stühlen, die in eine ungünstige Anordnung gezwängt waren und wo ein Dienstmädchen mit einem Staubtuch zugange war und überrascht aufschaute, als ich vorbeiging. Überall sahen die Möbel makellos und neu aus, sogar die antiken Stücke, und jedes Zimmer schien mit teurem Schnickschnack gefüllt zu sein – Lampen mit Glasschirmen, verzierte Vasen mit teuren, frisch arrangierten Blumen, Uhren und Schäferinnen und Messinglöwen und bemalte Seidenschirme, die auf den Punkt in den Ecken platziert waren. Ich vermutete, dass sich Dotties Anschaffungen im Laufe der Jahre angesammelt hatten. Ich hatte sie in Aktion gesehen, und sie war sehr gut darin, teure Dinge zu kaufen.
Es gab keine Zeit, um anzuhalten und zu gaffen. Dottie stürmte mit voller Geschwindigkeit, wohin sie wollte, und erwartete, mich an ihrer Schulter zu finden, wenn sie sich umdrehte; sie war wie ein Uhrwerk. Ich eilte schneller.
Ich beobachtete, wie ihre schlanke Gestalt vor dem Eingang zu einem Speiseraum stehen blieb und nur kurz innehielt, bevor sie über die Schwelle ins Innere stürzte. »Wie ich sehe, hast du es geschafft«, hörte ich sie sagen.
Ich folgte ihr und fand einen Mann vor, der allein am Esstisch saß, einen Teller mit Rindfleisch und ein Glas Wein vor sich. Er war um die 50, schlank und hatte kurz geschnittenes, hellbraunes Haar, das sich natürlich lockte. Er hatte blaue Augen in einem Gesicht, das redlich versuchte, gut auszusehen, auch wenn die Ränder seiner Gesichtszüge einen Hauch von Verfall aufwiesen wie ein Stück Papier, das im Laufe der Zeit mit Stockflecken übersät worden war. Er trug einen bräunlichen Anzug, der ihm fachmännisch auf den Leib geschneidert worden war, und eine Seidenkrawatte, die im elektrischen Licht einen matten Schimmer hatte.
Er stand nicht auf und legte nicht einmal Messer und Gabel ab, als Dottie den Raum betrat. »Hallo, Dottie«, sagte er, seine Stimme klang melodisch und ungekünstelt. Er setzte sein Messer an das Stück Rindfleisch. »Ich bin vor knapp einer Stunde angekommen. Habe mir von der Köchin etwas zusammenstellen lassen, denn ich bin total ausgehungert. Zum Glück hatte sie das Essen schon fast fertig.«
Dottie machte einen weiteren Schritt in den Raum, sodass sie nicht mehr vor mir stand. Sie trug weder Hut noch Handschuhe, da sie im Auto darauf verzichtet hatte, um bequemer arbeiten zu können, und nun sah sie verloren aus und wünschte sich etwas Überzeugendes, mit dem sie herumfuchteln konnte. Ihre Hände zuckten auf ihren Papieren. Ihre Zigarettenspitze war bereits wieder in ihre Tasche geschoben worden. »Ich nehme an, deine Reise war ereignislos?«, fragte sie, wobei ihr Blick auf den Mann vor ihr gerichtet war und sich dann von ihm losriss. »Du warst in Schottland, glaube ich.«
»Auf der Jagd mit ein paar Freunden, ja. Wir hatten eine gute Zeit, bis dein Telegramm sie unterbrochen hat. Und die Reise war ein verdammtes Ärgernis.« Er hob seinen Blick und sah mich an. »Ich bitte um Verzeihung«, sagte er, ohne sein Besteck abzulegen oder aufzustehen. »Wir sind uns noch nicht vorgestellt worden.«
»Das ist Manders«, sagte Dottie, bevor ich etwas sagen konnte. »Meine Gesellschafterin.«
»Jo Manders«, unterbrach ich, da ich diesmal nicht wollte, dass man mich mit meinem Nachnamen ansprach, als ob ich keine eigene Identität hätte. Dottie warf mir einen Blick zu, ihre Augen blitzten auf wie die eines erschrockenen Pferdes, aber ich ignorierte sie.
Der Mann schien über den Namen nachzudenken, ging die Möglichkeiten in seinem Kopf durch. »Die Frau von Alex?«, fragte er schließlich.
»Ja«, antwortete ich.
Sein Blick flimmerte über mich, auf und ab, seine Augenlider hingen nachlässig herab, und ich wusste, dass ich gerade kategorisiert worden war. Meine Brüste, meine Hüfte, meine Taille, die Länge meiner Beine. Ich beobachtete, wie er mein unmodisch langes Haar und meine ebenso altmodische Kleidung registrierte, bis sein Blick auf meinem Gesicht ruhte, die blauen Augen scharf und nachdenklich. »Du hast mir nicht gesagt, dass du eine Gesellschafterin eingestellt hast, Dottie«, sagte er. »Mrs. Manders. Ich bin Robert Forsyth, wie meine Frau versäumt hat, Ihnen zu sagen. Es ist schön, Sie kennenzulernen. Ein wenig Aufregung ist willkommen, und wir waren hier schon immer neugierig auf die Frau, die Alex aufgestöbert und plattgemacht hat.«
»Ist das Haus bereit für Martins Rückkehr?«, unterbrach Dottie mit scharfer Stimme, während ich nach einer schockierten Antwort suchte.
Robert schaute sie an und zuckte die Achseln. »Irgendwo gibt es eine Haushälterin.«
»Wann hat sie sich gemeldet? Ich habe sie gebeten, vor zwei Tagen mit der Arbeit zu beginnen.«
»Ich habe keine Ahnung, oder?«, fragte Robert. »Ich bin gerade erst angekommen. Haushälterinnen sind deine Domäne.«
»Martin legt heute Abend an und nimmt morgen den ersten Zug. Ich habe ihr gesagt, welche Zimmer sie vorbereiten soll. Und drei Dienstmädchen sollten auch da sein.«
»Dann ist das wohl erledigt«, antwortete er und wandte sich wieder seinem Stück Rindfleisch zu. »Wenn es in diesem Kaff irgendwo eine Zeitung gibt, dann lass sie mir bitte bringen. Ich würde gern ein wenig wissen, was in der Welt vor sich geht.«
Dottie stand in ersticktem Schweigen da. Monate getrennt, und ihr Mann fand seinen Teller bereits schmackhafter als seine Frau. Sie hätte mir fast leidtun können. Doch dann drehte sie sich mit geröteten Wangen zu mir um und bellte: »Was stehst du hier herum? Geh und suche die Haushälterin und sorge dafür, dass alles erledigt wird, um Himmels willen.«
Ohne ein Wort zu sagen, machte ich auf dem Absatz kehrt und ging den Flur entlang in das Zimmer, in dem ich das Dienstmädchen gesehen hatte. Sie war nicht da. Stattdessen saß auf einem der Stühle ein Mädchen. Sie hatte dunkelblondes Haar, das ordentlich am Hinterkopf zusammengebunden war, sodass ich die Haarnadeln deutlich sehen konnte, da sie von mir abgewandt war. Sie trug ein dunkelgraues Kleid und eine Kette mit kleinen Perlen um den Hals. Als ich mich der Tür näherte, drehte sie sich um und sah mich aus ruhigen blauen Augen an. Ihr Gesicht war lang, ihre Stirn hoch, aber sie war seltsam attraktiv. Ich schätzte sie auf etwa 17 Jahre.
»Oh«, sagte ich überrascht. »Ich bitte um Verzeihung.«
»Miss?«
Ich drehte mich um. Das Dienstmädchen stand im Korridor hinter mir, mit dem Staubtuch in der Hand.
»Kann ich Ihnen bei irgendetwas behilflich sein?«, fragte mich das Dienstmädchen und reckte sich, um mir über die Schulter zu schauen.
»Ja, ich …« Verwirrt drehte ich mich wieder zu dem Mädchen auf dem Stuhl um, aber das Mädchen war weg. Der Stuhl war leer, ebenso wie der Rest des Raums.
»Miss?«, fragte das Dienstmädchen erneut.
»Wo ist sie hin?«, fragte ich. »Das Mädchen. Die, die gerade hier war.«
»Es tut mir leid, Miss. Ich weiß nicht genau, was Sie meinen.«
Das Zimmer war vollkommen leer. Auch der Korridor war leer, als ich mich auf dem Absatz umdrehte, um nachzusehen. Es waren keine Schritte zu hören. Aber ich hatte sie gesehen.
»Ich weiß nicht …«, stotterte ich. »Ich …«
»Meinen Sie vielleicht mich, Miss?«, fragte das Dienstmädchen. »Ich habe vorhin erst in diesem Zimmer Staub gewischt.«
Ich hielt inne. Es war nicht das Dienstmädchen gewesen, das ich gesehen hatte, daran gab es keinen Zweifel. Ich konnte immer noch das Gesicht des Mädchens sehen, den Ausdruck in ihren blauen Augen unter der hohen Stirn, als sie mich ansah. Aber wenn ich darauf bestanden hätte, hätte ich wie Mutter geklungen, die von ihrem imaginären Viscount sprach. Also sagte ich: »Vielleicht habe ich Sie gesehen. Es tut mir leid.«
»Gar kein Problem.« Das Dienstmädchen schenkte mir ein zaghaftes und zugleich neugieriges Lächeln.
Ich verdrängte das, was ich gerade gesehen hatte, energisch aus meinem Gedächtnis. »Ich bin Jo Manders, die Gesellschafterin von Mrs. Forsyth. Können Sie mir sagen, wo die Haushälterin ist?«
Ihr Lächeln entspannte sich ein wenig. »Mrs. Bennett ist in der Küche, glaube ich, und kümmert sich um den Wein. Sie war jedenfalls vor einer halben Stunde da.«
»Gibt es hier noch andere Dienstmädchen außer Ihnen?«, fragte ich, als ich mich zittrig an Dotties Anweisung erinnerte.
»Zwei andere, Ma’am. Wir sind alle vorgestern angekommen.«
Es gab also keinen ständigen Stab treuer Bediensteter, der in Wych Elm House blieb, wenn die Familie nicht zu Hause war. Das gesamte Personal schien neu eingestellt worden zu sein. Ich bedankte mich bei dem Dienstmädchen und fand die Tür, die nach unten zur Küche führte, aber als ich mich ihr näherte, hörte ich aus irgendeinem Grund die Schritte des Mädchens hinter mir. Ich drehte mich um, um ihr zu sagen, dass sie mir nicht zu folgen brauchte, aber ich stellte fest, dass sie nicht mehr da war. Es war überhaupt niemand da.
In der Küche stieß ich auf zwei Frauen über 60, von denen die eine in einer Kiste mit Weinflaschen herumsortierte und die andere auf einem Stuhl am Küchentisch saß. Als ich eintrat, verstummten sie vor Verlegenheit, und die sitzende Frau machte Anstalten, sich zu erheben.
»Bitte«, sagte ich. »Ich bin nur die bezahlte Gesellschafterin von Mrs. Forsyth.«
Die Frau setzte sich sofort wieder hin, und die beiden tauschten einen kurzen Blick der Überraschung aus. Anscheinend hatte sich Dottie nicht die Mühe gemacht, jemandem von mir zu erzählen. Ich befand mich also auf halbem Weg zwischen Dienerschaft und Familienmitglied, was alles sehr unangenehm machte.
Die Frau mit den Weinflaschen war Mrs. Bennett, die Haushälterin, und die Frau, die am Tisch saß, war Mrs. Perry, die Köchin. Beide hatten ordentliches Haar unter sauberen Hauben und starke, raue Hände. Sie waren Frauen der englischen Dienstbotenklasse, stramm und unerschütterlich, die wahrscheinlich seit ihrem 13. Lebensjahr fegten, Staub wischten und Teig zu Kuchenböden kneteten. Eine Klasse, die zunehmend rascher in einer Welt von Dosenmahlzeiten und Teppichkehrmaschinen verschwand. Angesichts meines unsicheren Status waren sie zunächst misstrauisch, aber da ich nach der unangenehmen Szene im Esszimmer keine Lust hatte, zu Dottie zurückzugehen, zog ich einen Stuhl zurück und setzte mich stattdessen an den Küchentisch.
»Ich nehme an, Sie kennen Mrs. Forsyth sehr gut«, sagte Mrs. Bennett zu mir. Ihr Ton war lässig, aber ich wusste, dass sie nach Informationen fischte.
»Ja«, antwortete ich und dachte dann, dass ich Dottie seit heute überhaupt nicht mehr kannte.
»Ich habe gehört, dass sie eine schwierige Herrin sein kann«, sagte Mrs. Perry unverblümt. »Das macht mir keine Angst. Ich hatte schon früher mit schwierigen Herrinnen zu tun.«
»Ja, ich auch«, sagte Frau Bennett. »In meiner letzten Anstellung hat die Herrin zwei Kinder verloren, eines nach dem anderen. Beide starben bei der Geburt. Danach war sie nicht mehr dieselbe. So etwas trifft sie schwer, manche Frauen schwerer als andere.«
»Das nehme ich an«, sagte ich. Sie meinte damit wohl die seltsame Cousine Fran.
»Ich glaube nie etwas von dem, was die anderen sagen.« Mrs. Perry hob vorwurfsvoll ihr Kinn. »Ich halte nichts von Klatsch und Tratsch.«
Mrs. Bennett klappte den Karton mit den Weinflaschen zu und machte ein abweisendes, leises Geräusch. »Märchen, um Kinder zu erschrecken, mehr ist nicht dran.«
»Was für Märchen?«, fragte ich.
Wieder tauschten die beiden Frauen einen Blick aus, aber dieses Mal war ihre Professionalität wichtiger als das Bedürfnis nach Klatsch und Tratsch. »Wie ich schon sagte«, wiederholte Mrs. Bennett, »dumme Geschichten für Kinder.«
»Bitte.« Plötzlich war ich neugierig. »Mrs. Forsyth spricht nie über ihren Tod, und mein Mann wollte es mir nicht sagen.«
Es war Mrs. Perry, die mir schließlich antwortete. »Das Mädchen war verrückt.« Ihre Stimme war voller Missbilligung. »Sie haben sie eingesperrt, außer Sichtweite, bis sie eines Tages aus ihrem Zimmer geflohen ist. Sie ist vom Dach gesprungen, vom Giebel ganz oben am Haus. Sie war noch keine 15 Jahre alt.«
Einen langen Moment konnte ich nicht sprechen. Der Raum zog sich zurück. Ich erinnerte mich, wie ich aus dem Auto gestiegen war und zu dem hohen Giebel hinaufgeschaut hatte. Wie ich über den kopfsteingepflasterten Weg unter dem Giebel gegangen war. Dottie, dachte ich, kein Wunder, dass du nicht glücklich warst, nach Hause zu kommen.
Mrs. Perry ergriff wieder das Wort, ihre Stimme war grimmig. »Am selben Tag ist ein Mann im Wald gestorben. Einige sagten, das Mädchen müsse es getan haben, obwohl er in Stücke gerissen wurde, also sehe ich nicht, wie sie so etwas getan haben könnte, verrückt oder nicht. Wie gesagt, ich halte nichts von Klatsch und Tratsch. Sie haben das Haus verschlossen, nachdem es passiert war, und sind alle fortgegangen. Aber jetzt sind sie wieder da, und wir erwarten den Sohn zurück, der in einem Krankenhaus war. Ich hoffe, dass er keinen Ärger machen wird.«
»Wenn es eine Kriegsneurose ist, könnte er lammfromm sein«, sagte Mrs. Bennett. »So einen hatte ich vor zwei Anstellungen auch. Er hat kaum ein Wort gesagt, der arme Junge.«
Ich schob meinen Stuhl zurück und stand auf. »Ich sollte gehen. Mrs. Forsyth wird mich suchen.«
»Sagen Sie ihr, dass die Zimmer vorbereitet sind, so wie sie es gewünscht hat«, schickte Mrs. Bennett mir noch hinterher.
Ich drehte mich um und sah sie an. »Wie viele?«, fragte ich, dachte an das Mädchen, das ich im Salon gesehen hatte, und zwang mich, die Frage auszusprechen. »Wie viele Schlafzimmer sind vorbereitet?«
Mrs. Bennett runzelte die Stirn, als ob ich nicht ganz richtig im Kopf wäre. »Aber natürlich vier. Für Sie, Mr. Martin und Mr. und Mrs. Forsyth.« Sie schürzte kurz die Lippen. »Sie schlafen getrennt.«
Darauf hatte ich nichts zu erwidern. Ich drehte mich schweigend um und verließ den Raum.
5