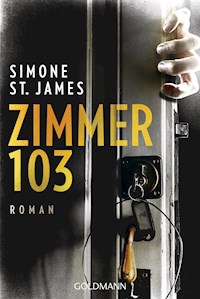5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kitty Weekes muss dringend untertauchen, und Portis House ist dafür der perfekte Ort. Sie fälscht ihren Lebenslauf und schafft es, als Krankenschwester eingestellt zu werden ... Das abgelegene Herrenhaus wurde in eine Einrichtung für »kriegsneurotische« Soldaten umgewandelt, die durch die Schrecken des Ersten Weltkriegs traumatisiert sind. Doch die junge Frau wird bald feststellen, dass sie nicht nur mit den Männern, die sie pflegen soll, alle Hände voll zu tun hat, sondern auch mit dem Haus selbst. Mächtige gespenstische Kräfte bewegen sich durch die Räume und suchen die Patienten mit Albträumen heim, die so grauenvoll sind, dass keiner wagt, darüber zu sprechen. Publishers Weekly: »St. James verwebt geschickt das Paranormale mit dem, was man heute posttraumatische Belastungsstörung nennt, und schafft so eine angenehm gruselige Geschichte über die eindringliche Macht des Unsichtbaren.« Library Journal: »Geisterhafte Erscheinungen, Schrecken und Rätsel ... Liebhaber klassischer Gothic-Romane in der Tradition von Victoria Holt werden sich diese atmosphärische Geschichte mit romantischer Spannung nicht entgehen lassen wollen.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Heiner Eden
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe Silence for the Dead
erschien 2014 im Verlag Thorndike Press.
Copyright © 2014 by Simone Seguin
Copyright © dieser Ausgabe 2025 by
Festa Verlag GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 10
04451 Borsdorf
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Veröffentlicht mit Erlaubnis von Berkley, ein Unternehmen der Penguin Publishing Group/Penguin Random House LLC.
Titelbild: Lady Elizia / 99design unter Verwendung von alva studio/AdobeStock
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-194-3
www.Festa-Verlag.de
Für Adam, wieder und immer
TEIL EINS
Engel der Barmherzigkeit
Die Selbstsucht ist zuallererst eine Unzulänglichkeit, die eine Frau für den Beruf der Krankenschwester disqualifiziert.
Eva Luckes,
Schwester Oberin des London Hospital,
1880–1919
1
ENGLAND, 1919
Portis House tauchte aus dem Nebel auf, als wir uns ihm näherten. Nach und nach zeigte es sich als ein langer, tief stehender Schatten. Ich neigte meine Schläfe gegen das Fenster des Wagens und versuchte, es in dem schwindenden Licht genauer zu betrachten.
Der Fahrer sah, wie ich meinen Hals reckte. »Das ist es, zweifelsohne«, bestätigte er. »Man kann es gar nicht verwechseln. In der Gegend gibt es sonst nichts.«
Ich beäugte es weiter. Ich konnte nun gerade so die Gesimse erkennen, und auch die schmalen griechischen Säulen waren in der aufziehenden Dunkelheit nur schemenhaft auszumachen: ein breiter, kühler Portikus und dahinter Efeu, der an den blassen georgianischen Mauern emporkletterte. Seine Ränder verblassten im Nebel, als hätte ein Künstler sie mit seinem Daumen verwischt.
»Es ist ein guter Ort«, fuhr der Fahrer fort. Mein Schweigen schien ihm unbehaglich zu sein, seit vielen Meilen schon. »Ich meine, wofür sie das Haus benutzen. Ich selbst würde hier nicht leben wollen.« Er richtete die Mütze auf seinem grau melierten Kopf und fuhr sich dann mit einem rauen Finger über den Bart. »Das Land hier liegt tief, was heißt, dass es immer feucht ist. Der Nebel rührt vom Wasser her. Im Winter vereist alles ganz fürchterlich.«
Ich löste mich von dem Seitenfenster und lehnte meinen Kopf zurück an den Sitz, um durch die Windschutzscheibe zuzusehen, wie das Haus näher kam. Wir rumpelten über eine lange, schlammige Zufahrt. »Aber warum«, fragte ich, »ist es dann ein guter Ort?«
Er hielt überrascht inne. Ich versuchte, mich zu erinnern, wann ich ihn das letzte Mal angesprochen hatte, seit ich am Bahnhof in sein Taxi gestiegen war, und konnte es nicht. »Nun, für diese Burschen natürlich«, antwortete er nach einem Moment. »Für die Verrückten. Hält sie vom Rest der Welt fern, nicht wahr? Und die Brücke vom Festland sorgt dafür, dass sie nirgends hinkönnen.«
Das stimmte. Die Brücke war lang und schmal und einem Wind ausgesetzt, der uns schonungslos durchgeschüttelt hatte, als wir sie überquerten. Jeder, der versuchte, das Festland zu Fuß zu erreichen, riskierte Kopf und Kragen. Ich überlegte, ob es schon einmal jemand gewagt hatte und ob er dabei in das tosende Meer gestürzt und zu Tode gekommen war. Ich öffnete den Mund, um zu fragen, schloss ihn aber wieder.
Der Fahrer schien es nicht bemerkt zu haben. »Wissen Sie, es ist nicht als ein Krankenhaus errichtet worden. Es war ein Wohnhaus, vor nicht allzu langer Zeit. Um die 20 Jahre muss es her sein. Eine Familie mit Kindern. Gersbach hießen sie. Weiß der Himmel, wie sie es hierher geschafft haben. Vier Stunden mit dem Zug von Newcastle bis in die Stadt, und dann noch über die Brücke. Es ist kein Ort für ein Kind, sage ich Ihnen. Oft hat man sie nicht gesehen, und das ist kein Wunder – einen anderen Weg gab es nicht, um sich Vorräte vom Festland zu beschaffen, und kein Dienstbote hielt es lange bei ihnen aus. Ich schätze, so sind die Reichen eben. Sie gingen wieder, als der Krieg ausbrach. Wie ich hörte, waren sie recht unnahbar, was ganz typisch für Deutsche ist.«
Wir erreichten das Haus, und er lenkte das Fahrzeug über die Auffahrt hin zum Haupteingang. Wir umkreisten eine Rasenfläche, in deren Mitte ein unbenutzter Steinbrunnen trocken und verdreckt in einem leeren Blumenbeet stand. Nebelwolken schoben sich über ihn hinweg und glitten lautlos an einer Marienstatue mit traurigen Augen vorbei, die ihre segnenden Arme über das leere Becken ausstreckte. An ihren Seiten standen Engelsfiguren mit ausdruckslosen Gesichtern.
»Sie müssen sich keine Sorgen machen.« Der Fahrer stellte den Motor an der Vordertreppe ab. »Es ist abgelegen, das ist wohl wahr, doch ich habe noch nie gehört, dass jemand in dem Krankenhaus schlecht behandelt wurde. Ihrem Burschen geht’s bestimmt gut. Heute Abend werde ich nicht zurückkommen können, dafür ist’s zu spät, aber hier gibt es schöne Gästezimmer für die Angehörigen. Ich könnte gleich morgen früh wieder hier sein, wenn Sie möchten.«
Ich sah ihn einen Augenblick lang an, bevor mir bewusst wurde, dass er mich für eine Besucherin hielt. »Ich werde bleiben«, erklärte ich.
Er zog seine Augenbrauen hoch, als hätte ich behauptet, dass ich mich selbst einweisen würde. Dann senkte er sie wieder. »Eine Krankenschwester? Ich dachte …« Sein verdutzter Blick fand den Laderaum im Heck, wo meine Reisetasche lag. Sie war so klein, dass sie nicht für mehr als eine Nacht zu reichen schien. Als er sich mir wieder zuwandte, blickte ich ihm in die Augen und sah zu, wie er langsam begriff, dass all meine Habseligkeiten in der Tasche steckten.
»Nun«, verkündete er dann. Die Stille hing einen Moment lang zwischen uns. »Dann werde ich Ihnen nur Ihre Tasche holen.«
Er stieg aus dem Wagen. Ich öffnete meine Tür, bevor er es tun konnte, und erhob mich aus dem schmerzhaft harten Sitz. Er hob die Hände vor lauter Frust und machte sich daran, meine Tasche zu holen. »Seien Sie bloß vorsichtig«, warnte er mich, als er sie mir reichte. Sein wohlwollender Tonfall war verschwunden. »Das sind alles Verrückte, wissen Sie? Ein paar davon sind richtige Unmenschen. Und Sie, Sie sind nur ein kleines Ding und auch noch so jung. Ich wusste ja nicht, dass Sie eine Krankenschwester sind, sonst hätte ich schon eher etwas gesagt. Die meisten Schwestern halten es nicht lange aus. Das macht die Einsamkeit.«
Ich reichte ihm sein Fahrgeld. Es war das letzte Geld, das ich noch hatte. »Die Einsamkeit ist, was ich brauche.«
»Manchmal werde ich hergerufen, um die Mädchen abzuholen, die wieder wegwollen. Sie sind so still wie Geister, und in der Stadt sehen wir nie eine von ihnen. Vielleicht dürfen sie nicht in die Stadt, wer weiß. Ich weiß nicht einmal, ob sie überhaupt Urlaub bekommen.«
»Ich brauche keinen Urlaub.«
»Welche Krankenschwester braucht denn keinen Urlaub?«
Nun klang er fast erbost. Ich wandte mich von ihm ab und schritt die Treppe hinauf.
»Sie scheinen mir einfach nicht der Typ dafür zu sein«, rief er mir hinterher.
Ich drehte mich um. »Sie müssen sich um mich keine Sorgen machen.« Ich überlegte einen Augenblick lang. »Es ist kein deutscher Name, Gersbach«, bemerkte ich noch, als er zu mir heraufblickte. »Er kommt aus der Schweiz.« Ich sah über seine Schulter zum Brunnen, zur Mariengestalt mit ihren zarten drapierten Schultern und eleganten Armen. Dann nahm ich die letzten Stufen bis zur Eingangstür von Portis House.
»Katharine Weekes.« Die Frau überflog die Unterlagen in ihrer Hand und blätterte geschickt mit ihren langen Fingern darin. Sie hatte die Mundwinkel konzentriert nach unten gezogen.
»Kitty«, verbesserte ich.
Sie blickte scharf zu mir auf. Wir befanden uns in einem behelfsmäßigen Büro, in dem früher vielleicht ein Butler oder die Haushälterin ihre Schreibstube hatte. Das Zimmer befand sich ganz hinten im Gebäude und war nur mit einem alten verkratzten Schreibtisch und einem nicht dazu passenden Aktenschrank aus Holz möbliert. Jenseits des Fensters zog der Nebel vorüber.
Sie war eine groß gewachsene Frau mit kräftigen Schultern. Ihr Haar war zu einem stumpfen Pony geschnitten, der beinahe männlich wirkte. Sie trug eine dicke Wolljacke über ihrer Uniform; an einer Kette um ihren Hals hing eine Halbmondbrille, die sie nicht zum Lesen benutzte. Die weiße Haube auf ihrem Kopf wirkte fehl am Platz und fast schon lächerlich. Ihre Augen wurden schmal, als sie mich betrachtete. »Wir werden Sie nicht Kitty nennen«, verkündete sie. »Sie werden Schwester Weekes sein. Ich bin hier die Oberschwester, Mrs. Hilder. Sie werden mich Schwester Oberin nennen.«
Ich prägte mir diese Auskunft ein. Sie war albern und dumm, aber ich würde sie brauchen. »Ja, Schwester Oberin.«
Wieder verengten sich ihre Augen. Sogar wenn ich mir Mühe gab, schaffte ich es kaum, gehorsam zu klingen, und etwas in meinem Tonfall musste das preisgegeben haben. Die Schwester Oberin schien eine jener Frauen zu sein, denen nicht einmal der Anflug einer Unverfrorenheit entgeht. »Hier steht«, fuhr sie einen Moment später fort, »dass Sie ein Jahr lang im Belling Wood Hospital in London tätig waren.«
»Das stimmt, Schwester Oberin.«
»Es ist ein schwieriges Krankenhaus, das Belling Wood. Unzählige Verwundete wurden dort behandelt. Viele fordernde Fälle.«
Ich nickte stumm. Woher wusste sie das? Woher konnte sie es wissen?
»Normalerweise bevorzugen wir Schwestern mit mehr Erfahrung, aber da Sie im Belling Wood waren, ist anzunehmen, dass Ihre Fähigkeiten die Ansprüche hier im Portis übertreffen dürften.«
»Ich bin mir sicher, dass es genügen wird«, murmelte ich. Ich hatte meine Hände sorgsam in den Schoß meines dicken Rocks gelegt und richtete meinen Blick auf sie. Ich trug mein einziges Paar Handschuhe. Ich hasste Handschuhe, doch den Anblick meiner Hände hasste ich noch mehr. Wenigstens verbargen die Handschuhe die Narbe, die sich von dem sanften Gewebe zwischen meinem Daumen und den Fingern bis hinunter zu meiner Handwurzel zog.
»Ist das so?«, fragte Mrs. Hilder, die Schwester Oberin. Etwas an der verhaltenen Neutralität in ihrer Stimme ließ ein Gefühl der Panik wie einen Puls in meiner Kehle pochen.
Ich wagte einen kurzen Blick zu ihr hinauf. Sie betrachtete mich mit steten Augen, die nichts preisgaben. Ich würde etwas sagen müssen und wühlte rasch in meinen Erinnerungen.
»Das Belling Wood war beschwerlich«, erklärte ich. »Ich war kaum zu Hause. Mit der Zeit verlor ich den Glauben daran, überhaupt etwas ausrichten zu können.« Ja, ich erinnerte mich, so etwas gehört zu haben. »Ich wurde der vielen Verwundeten überdrüssig, und der Ruf von Portis House war mir vom Hörensagen bekannt.«
Das war vielleicht ein wenig dick aufgetragen, doch es schien mir angebracht. Die Miene der Schwester Oberin veränderte sich nicht. »Portis hat keinen Ruf«, sagte sie tonlos. »Es wurde erst im letzten Jahr eröffnet.«
»Ich hörte, die Patienten werden hier sehr gut behandelt«, bekräftigte ich. Das stimmte ebenfalls, auch wenn ich es erst vor 20 Minuten vom Taxifahrer gehört hatte.
»Sie werden so gut behandelt, wie es uns möglich ist«, entgegnete sie. »Sie haben auch ein Empfehlungsschreiben von Gertrude Morris, der Stationsschwester im Belling Wood.«
Ich sah zu, wie sie das Stück Papier aus den Unterlagen hervorholte und sorgsam las. Ihr Blick wanderte die handgeschriebene Seite hinunter und wieder hinauf. Schweißperlen bildeten sich auf meiner Stirn.
Es war eine Lüge, jedes einzelne Wort. Ich hatte das Belling Wood nie betreten. Alison, meine Zimmergenossin in London, hatte dort gearbeitet, und in den wenigen Stunden, die sie zwischen ihren Schichten zu Hause war, hatte sie mir ausführlich darüber berichtet, was dort vor sich ging. Es klang nach schwerer Arbeit, doch schwere Arbeit machte mir nichts aus, und ich suchte nach einer Anstellung. Die Aussicht, Verbandszeug zu waschen und ein paar Bettpfannen auszuleeren, schien nichts im Vergleich zu der Schufterei in der Fabrik zu sein, und als ich schließlich entlassen wurde, sah ich mich nicht mehr in der Lage, meine Hälfte der Miete zu bezahlen.
Eines Abends kamen zwei von Allys Kolleginnen zu Besuch, und als ich in meinem winzigen Zimmer hockte, konnte ich ihre Unterhaltung durch die dünnen Wände hören. Eine von ihnen hatte eine Broschüre von Portis House dabei, in der nach Krankenschwestern gesucht wurde, und sie überlegte, sich dort zu bewerben. Sie hatte London so satt, und die Arbeit klang nicht beschwerlich – nur ein paar unter Kriegsneurosen leidende Männer, wenn man so wollte, weit weg von dem Blut und dem Erbrochenen und der um sich greifenden Grippe in der Stadt. Doch die anderen sagten, der Ort liege so weit weg, dass sie bestimmt den Verstand verlieren würde. Außerdem, so wurde gemunkelt, blieben die Angestellten kaum länger als ein paar Wochen in Portis House, auch wenn niemand wusste, warum, und deshalb suchten sie so dringend nach Mädchen. Wer wollte schon eine gute Anstellung in London aufgeben, nur um den ganzen Weg an einen Ort auf sich zu nehmen, wo die Schwestern nicht bleiben wollten? Es wäre wohl das Beste, stimmten die Mädchen überein, in London zu bleiben und auf eine Beförderung zu hoffen – oder, noch besser, auf einen Ehemann.
Ich saß auf meinem schmalen Bett, die Knie an die Brust gezogen, das Herz vor Aufregung pochend, als sie die Idee verwarfen, und nachdem sie gegangen waren, fischte ich die Broschüre aus dem Mülleimer. Es war die perfekte Lösung. Ein entlegener Ort, der verzweifelt nach Mädchen suchte, und alles, was ich zu tun haben würde, war, mich um eine Handvoll Soldaten zu kümmern. Ich hatte eine Bewerbung abgeschickt und Allys Berufserfahrung als meine eigene ausgegeben. Ich hatte sogar ein Empfehlungsschreiben der Stationsschwester beigefügt. Ally hatte oft genug von ihr gesprochen; es war mir ein Leichtes, meine Handschrift etwas abzuändern und den Namen der Frau zu benutzen. Wer würde schon in diesen Tagen des Chaos, so kurz nach dem Krieg, allzu genau hinsehen?
Schon nach ein paar Tagen erhielt ich eine Antwort – eine Zusage, ungesehen, zusammen mit einer Wegbeschreibung. Ich erzählte Ally, ich hätte eine Stelle in einer anderen Fabrik bekommen, packte meine Sachen und ließ sie so klug wie zuvor zurück. Solange es niemandem schadet, dachte ich immer, ist alles erlaubt.
Die Schwester Oberin faltete das Stück Papier wieder und legte es auf den Schreibtisch. Der panische Puls in meiner Kehle beruhigte sich etwas.
»Es scheint alles seine Ordnung zu haben«, stellte sie fest.
Ich schluckte und nickte.
»Die Umstände hier können sehr fordernd sein«, fuhr sie fort, »und das Haus liegt einsam. Die Arbeit ist nicht leicht. Wir haben große Mühe, Mädchen zu finden, die bei uns bleiben.«
»Ich werde bleiben.«
»Ja«, erwiderte sie. »Das werden Sie wohl.« Sie neigte den Kopf und betrachtete mich. »Denn wie es der Zufall will, ist Gertrude Morris meine Cousine zweiten Grades, und das hier sieht ihrer Handschrift überhaupt nicht ähnlich.«
Mir war, als würde mein Herz zerspringen. »Nein. Nein. Ich …«
»Schweigen Sie.« Ihr Tonfall blieb gefasst, und einen Moment lang sanken ihre Lider über ihre Augen und sie machte eine Miene, die, so schien es, von Triumph erfüllt war. »Ich sollte Sie nicht einfach nur abweisen. Ich sollte Sie Mr. Deighton, dem Besitzer, melden. Ein Wort von ihm zu Ihrem nächsten Arbeitgeber, und Sie finden sich auf der Straße wieder.«
»Aber Sie haben mich den ganzen Weg hierher machen lassen.« Ich versuchte, ruhig zu sprechen und nicht schrill zu klingen, doch ich brachte nur ein Krächzen hervor. »Bitte schicken Sie mich nicht fort. Warum haben Sie mich herkommen lassen?«
»Das habe ich nicht. Das war Mr. Deighton. Ich war einige Tage nicht anwesend, und er hat Ihre Bewerbung in die Finger bekommen. Glauben Sie mir, wenn er gewartet und mich zurate gezogen hätte, wäre uns all das hier erspart geblieben.« Sie klang ein wenig angewidert, als wäre sie nicht zum ersten Mal übergangen worden. »Doch nun ist es, wie es ist.«
Was hatte das zu bedeuten? Ich wartete.
Die Oberschwester lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und betrachtete mich eingehend. »Wie alt sind Sie?«, fragte sie.
»20.«
»Hatten Sie schon die Masern?«
»Ja.«
»Windpocken?«
»Ja.«
»Haben Sie Krampfadern?«
»Nein.«
»Sind Sie für Infektionen anfällig?«
»Ich war in meinem ganzen Leben noch keinen Tag krank.«
»Sind Sie in der Lage, einen Mann zu bändigen, der um sich schlägt und Ihnen Schimpfwörter an den Kopf wirft?«
Sachte. Sie versuchte, mich ins Straucheln zu bringen, aber das würde ich nicht zulassen. »Ich bin mir nicht sicher wegen des Umsichschlagens, aber mir wurden schon alle möglichen Schimpfwörter und Schlimmeres an den Kopf geworfen.«
Sie seufzte. »Wie es scheint, sind Sie außerordentlich selbstbewusst. Das sollten Sie nicht sein. Und glauben Sie bloß nicht, dass ich nicht merken würde, wie schnippisch Sie sind. Mir gefällt Ihre Art überhaupt nicht.« Sie blickte noch einmal hinunter auf ihre Unterlagen, dann wieder hinauf zu mir. Nun machte sie ein angespanntes Gesicht. »Ich weiß nicht, was Sie im Schilde führen, Miss Weekes, und ich will es gar nicht wissen. Es ist nun einmal so, dass ich dringend eine Krankenschwester brauche. Bisher ist kein Mädchen länger als drei Wochen geblieben, und darum hinken wir mit der Arbeit weit hinterher. Ehrlich gesagt könnte ich deswegen sogar meine Stelle verlieren.«
Ich blinzelte. So viel Offenheit hatte ich nicht erwartet. »Ich werde bleiben«, beteuerte ich noch einmal.
»Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich an diesen Satz erinnern und nachher nicht zu mir kommen, um sich auszuweinen.«
»Ich weine mich bei niemandem aus.«
»Das sagen Sie jetzt. Noch etwas: Hier in Portis House achte ich darauf, dass die Regeln eingehalten werden. Zeigen Sie mir und den Ärzten den nötigen Respekt, und auch Mr. Deighton, wenn er für eine Überprüfung herkommt. Seien Sie zu jeder Zeit reinlich und ordentlich und tragen Sie stets Ihre Uniform. Die Schichten dauern jeweils 16 Stunden, am frühen Nachmittag haben Sie zwei Stunden zur persönlichen Verfügung. Jeden Monat müssen Sie eine Woche lang die Nachtschicht übernehmen. Alle vier Wochen bekommen Sie einen halben Tag frei, anderen Urlaub gibt es nicht. Es herrscht eine strikte Sperrstunde, und es ist Ihnen nicht gestattet, mit den Männern zu verkehren. Eine Überschreitung der Regeln führt zur sofortigen Entlassung. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt? Und zum letzten Mal, Sie werden mich Schwester Oberin nennen.«
Ich konnte kaum glauben, dass es wirklich geschah; dass ich bleiben würde. Dass mein wilder Plan funktionierte. Dieser Ort ist perfekt – einfach perfekt. Hier wird man mich niemals finden. »Ja, Schwester Oberin.«
»Ich werde Ihre Herkunft und Ihre mangelnde Erfahrung fürs Erste für mich behalten. Doch ich erwarte, dass Sie alle Pflichten einer Krankenschwester erfüllen, und zwar genauso gut, wie es die anderen Schwestern hier tun. Wie Sie das bewerkstelligen, ist Ihr Problem. Haben wir uns verstanden?«
»Ja, Schwester Oberin.«
»Also gut. Ich werde Schwester Fellows anweisen, Sie herumzuführen.« Sie stand auf.
Auch ich erhob mich, doch ich folgte ihr nicht zur Tür.
»Nun?«, fragte sie gereizt, als sie die Tür geöffnet hatte und sich zu mir umdrehte. »Was gibt es noch?«
»Warum?«, wollte ich wissen. »Warum haben Sie mir die Stelle wirklich gegeben? Sie können mich nicht leiden. Warum haben Sie mich nicht fortgeschickt?«
Ich konnte sehen, wie sie überlegte, ob sie mir antworten sollte, doch dann gewann ihre Abneigung gegen mich die Oberhand und sie erwiderte: »Meinetwegen. Weil ich glaube, dass nur solche Mädchen hierbleiben werden, die nirgendwo anders hingehen können. Mit herkömmlichen Mädchen hat es nicht funktioniert, aber vielleicht klappt es mit einem, das verzweifelt genug ist.« Sie zuckte die Schultern. »Und nun habe ich Sie gefunden.« Sie drehte sich zu der offenen Tür um. »Schwester Fellows, bitte begleiten Sie Schwester Weekes auf ihr Zimmer.«
2
»Die Bettwäsche ist im zweiten Schrank«, informierte mich Schwester Fellows. »Schwester Oberin hat den Schlüssel und ich den Zweitschlüssel. Ein Kissen, ein Laken und eine Decke für jeden Mann – mehr ist nicht gestattet. Im Winter geben wir ein zweites Laken und eine zweite Decke heraus, aber es ist erst Juni, also bekommen sie nur eine Sommerdecke. Der dritte Schrank ist für das Desinfektionsmittel. Er wird einmal in der Woche aufgefüllt. Merk’s dir, du wirst es brauchen. Schwämme liegen auf diesem Regal hier. Bei größeren Sauereien rufst du nach Paulus. Er wird die Pfleger herschicken. Mit diesem Knopf hier klingelst du in Paulus’ Büro. Die Pfleger dürfen nur im Notfall herbeigeholt werden, nicht für alltägliche Angelegenheiten, oder Schwester Oberin wird Wind davon bekommen. Kannst du mir folgen?«
»Ja.« Ich nahm meine Tasche in die andere Hand. Mir wurde angeboten, dass einer der Pfleger sie für mich in mein Zimmer bringen würde, doch das lehnte ich ab. Mir gefiel die Vorstellung nicht, dass ein fremder Mann in meinen Sachen herumwühlt.
Schwester Fellows war schmächtig und hatte schmale Hüften. Sie musste um die 24 sein, auch wenn die Pockennarben in ihrem Gesicht und die schmale Linie, die ihre Lippen zog, sie älter aussehen ließen.
Sie trug die Bluse mit dem Schalkragen, den langen blassblauen Rock und die lange Schürze, die die Schwesterntracht in Portis House bildeten. Die Schürze hatte sie um ihre knabenhafte Taille geknotet. Unter der gestärkten weißen Haube trug sie ihr Haar fest zusammengebunden. Es hatte eine hellgelbe Farbe, wie ich sie noch nie in natura gesehen hatte.
»Frühstück gibt es um Punkt sieben Uhr, gefolgt von der morgendlichen Gymnastik. Mittagessen um zwölf, Nachmittagstee um drei und Abendbrot um halb sieben. Die Sperrstunde für die Männer beginnt um halb zehn, ohne Ausnahme, und für die Schwestern um zehn. Jede Ruhestörung nach zehn Uhr wird umgehend der Schwester Oberin mitgeteilt.«
Wir verließen die hinteren Flure, die mit Vorratsschränken gesäumt waren, und gingen die Dienstbotentreppe hinauf.
Das Haus war viel größer, als es mir auf der Herfahrt erschienen war. Bisher hatte ich nur die Quartiere der Dienstboten gesehen, und die waren viel vornehmer als jede Unterkunft, die ich je bewohnt hatte. Die Böden waren abgenutzt, doch das Holz war noch gut; das Geländer der gewundenen Treppe lag schwer und geschmeidig unter meiner Hand. Ich fragte mich, wie wohlhabend die Gersbachs gewesen waren.
Schwester Fellows sprach weiter, als würde sie keine Rückmeldung von mir benötigen. »Die Ärzte kommen jeden zweiten Mittwoch, um sich die Patienten anzusehen. Sie führen Inspektionen durch, also achte darauf, dass die Patienten ruhig sind und dass alles sauber und vorzeigbar ist.«
»Die Ärzte leben nicht hier?«
Sie sah mich an. »Ich weiß ja nicht, in welchem Krankenhaus du vorher warst, aber nein, Ärzte leben für gewöhnlich nicht auf dem Klinikgelände.«
Kalter Schweiß schlug mir auf die Stirn. »Nun … Nein, natürlich nicht. Ich dachte nur …«
»Hattest du es vielleicht mit Verwundeten zu tun? Mit Männern, die eine Betreuung rund um die Uhr benötigten?«
»Ja, so war es.«
»Nun, dann wirst du dich umgewöhnen müssen. Wir haben es hier nicht mit kranken Männern zu tun, Schwester Weekes, zumindest nicht mit wirklich kranken. Sie werden mit Ruhe behandelt, mit einer stillen Umgebung und mit Routine. Die Ärzte kommen nur, um nachzuschauen, ob sie Fortschritte machen.«
»Damit werde ich schon fertig.«
»Sei dir nicht zu sicher. Ohne Disziplin können die Männer ganz schön widerspenstig sein. Ein paar von ihnen sind richtig hinterhältig. Ich traue ihnen nicht weiter, als ich spucken kann. Die Mahlzeiten werden hier im Speisesaal eingenommen.«
Kurz darauf waren wir im Haupthaus und liefen einen breiten, mit einer dunklen Vertäfelung besetzten Gang entlang. Es duftete nach Holzpolitur, doch darunter lag ein feuchter Geruch, als würde sich der Nebel durch die Fensterritzen quetschen. Wir kamen um eine Ecke, und sie öffnete eine Doppeltür in den Raum, der dahinter lag. »Oh«, entfuhr es mir.
Die ursprüngliche Einrichtung, wie auch immer sie ausgesehen haben mochte, war fort und von zwei langen Tischen mit Stühlen an allen Seiten ersetzt worden. Stuck in der Form von Eichenblättern säumte die Wände dort, wo sie auf die Decke trafen. Diese wiederum war mit Ranken dekoriert, die sich um ihre dicken Balken schlangen. Eine der Wände wurde von zwei Fenstern und schweren Brokatvorhängen geschmückt, die einen Rahmen um den undurchdringlichen Anblick des Nebels bildeten. Blasse Rechtecke an den Wänden zeugten von den Familiengemälden, die dort gehangen haben mussten, und der harte Holzfußboden warf das leere Echo unserer Schritte durch den Raum, der kahl wirkte, als wäre das ganze Haus den Bach hinuntergegangen. Doch die Eleganz war noch immer zu spüren, wie bei einer aristokratischen Frau, die schlichte Kleider trug.
Allein die Größe des Raumes versetzte mich in Erstaunen. »Das war das Esszimmer einer einzigen Familie?«
»Nun ja, so war es. Dies war ein Privathaus. Hat man dir das nicht erzählt?«
An den Tischen fanden 20 Menschen Platz, ohne Mühe, und ein Raum wie dieser hätte dort, wo ich herkam, leicht zwei Familien beherbergen können. »Sind sie fortgegangen, weil sie kein Geld mehr hatten?«, fragte ich.
Der Blick, mit dem sie mich bedachte, war ein abfälliger. »Woher um alles in der Welt soll ich das wissen? Es hat nichts mit mir zu tun – und auch nicht mit dir. Warum stellst du überhaupt solch eine Frage?«
Ich sah sie an und bemerkte unter der schroffen Art, die sie vermutlich jedem entgegenbrachte, dass sie mich einfach nicht leiden konnte. Nun gut. »Ich bin nur neugierig, wie die Reichen leben. Du etwa nicht?«
»Bin ich nicht. Und falls ich dir einen Rat geben darf, dann hütest du besser deine Zunge, wenn du hier zurechtkommen möchtest. Das, was Leute treiben, die herrschaftliche Häuser besitzen, geht uns nichts an.«
»Meinetwegen«, erwiderte ich schulterzuckend, doch ich kniff die Augen zu einem finsteren Blick zusammen, als sie mir ihren Rücken zukehrte.
»Wir haben zurzeit 19 Patienten«, fuhr sie fort, als wir den Speisesaal wieder verließen. Ich trug noch immer meine Reisetasche. »Jeder der Männer hat sein eigenes Zimmer, wofür sie ehrlich dankbar sein sollten. Dann gibt es noch das Schwesternzimmer, abgetrennte Zimmer für die Schwester Oberin und mich sowie vier Gästezimmer für die Ärzte, die Familien der Patienten und für Mr. Deighton. Unten befinden sich die Unterkünfte der Pfleger, des Küchenpersonals und des Gärtners. Trotz alledem ist noch ein Teil des Westflügels abgesperrt. So groß ist das Haus.«
»Wo sind die Patienten jetzt?«
»Auf ihren Zimmern, um sich auszuruhen. Das gehört zu ihrem Nachmittagsprogramm. In einer Stunde gibt es Abendbrot, und danach stehen ihnen im Gemeinschaftsraum 90 Minuten zur freien Verfügung.« Am Ende des Gangs öffnete sie eine weitere Tür. »Das wäre dann hier.«
Dieser Raum war sogar noch größer als der Speisesaal. Auch ohne Möbel und Gemälde machte er einen prachtvollen Eindruck. Er war üppig vertäfelt und verfügte über einen unteren Bereich, der über drei breite Treppenstufen mit einem oberen Bereich verbunden war. Am hinteren Ende des oberen Bereichs blickten eine Reihe von Terrassentüren – ich zählte drei Paar – hinaus auf eine Veranda und ein paar gepflegte Gärten, die dahinter lagen. Die Türen waren geschlossen, die Veranda lag feuchtkalt und verlassen da, und von den Gärten war kaum mehr als die Schatten von geschnittenen Hecken zu erkennen, die sich im Nebel krümmten.
Genau wie der Speisesaal war auch dieser Raum leer geräumt und mit harten, zweckmäßigen Möbelstücken ausgestattet worden. Stühle mit dünnen Polstern standen eng beieinander auf billigen Teppichen, was wohl der Geselligkeit dienen sollte. Zwei durchhängende Sofas standen neben einem verschrammten Bücherregal, auf dem sich ausgefranste Magazine und Bücher mit dunklen, zerlesenen Seiten stapelten. Darüber hinaus gab es noch einen Tisch mit einem Schachbrett darauf und zwei sich gegenüberstehenden Stühlen.
Ich blickte auf und sah dieselben Stuckranken, die auch den Speisesaal zierten und von ihrem majestätischen Platz unter der Decke hinab auf dieses dürftige Bild schauten.
»Es ist nicht gestattet zu rauchen«, erklärte Schwester Fellows, während ich meinen Hals reckte. »Karten sind verboten, genau wie Würfel und Glücksspiele jeder Art. Wir bekommen Zeitungen, aber es dürfen keine aktuellen sein und sie müssen zuerst von der Schwester Oberin unter die Lupe genommen werden. Ankommende und ausgehende Briefe werden gelesen und, wenn nötig, zensiert. Wir haben die Männer ermuntert, es probeweise mit einem Amateurtheater zu versuchen, doch bislang hat keiner von ihnen ein Interesse daran bekundet.«
»Donnerlittchen«, bemerkte ich. »Was machen sie dann hier drin?«
Ein unverkennbarer Ausdruck von Abscheu huschte über ihr Gesicht, und sie antwortete mir, als würde sie in eine Zitrone beißen. »Dort auf dem Regal stehen Bücher. Einige nutzen die Zeit für eine Unterhaltung oder um einfach nur dazusitzen und nachzudenken. Viele sind zu nichts anderem fähig – du wirst’s schon sehen. Hin und wieder kommt der Pfarrer zu Besuch.«
»Na so was aber auch«, entgegnete ich, nur um sie zu verärgern. Du bist auch keine Hochwohlgeborene, Missy. Deine Vokale verraten dich. »Beeindruckend. So etwas hatten wir im Belling Wood nicht.«
Schwester Fellows rollte die Augen. »Natürlich hattet ihr so etwas nicht. Belling Wood ist ganz anders als das, was wir hier haben.« Sie zog eine Uhr aus ihrer Schürzentasche und warf einen Blick darauf. »Die Nachmittagsruhe ist fast vorüber. Ich bringe dich zu den Schwesternunterkünften, damit du dich frisch machen und umziehen kannst. Du wirst beim Abendbrot helfen.«
»Sehr wohl«, antwortete ich, als ich hinter ihrem schmalen Rücken hinaus aus dem Zimmer ging und wir den Flur zur Dienstbotentreppe zurückliefen. »Ich würde zuerst gern eine Zigarette rauchen, wenn’s recht ist. Es war ein langer Weg vom Bahnhof.«
Schnell schritt sie die Treppe hinauf. »Hast du mir nicht zugehört? Es ist nicht gestattet zu rauchen.«
Ich blieb stehen. »Was soll das heißen, es ist nicht gestattet?«
»Es ist, wie ich es sagte.«
»Ich dachte, das gilt für die Patienten.«
Sie hielt auf dem ersten Treppenabsatz inne und blickte zu mir herunter. In dem schwachen Licht leuchtete ihr gelbes Haar beinahe. »Schwester Weekes, in Portis House ist es nirgendwo gestattet zu rauchen. Zigaretten zu rauchen ist nicht gesund.«
»Nicht gesund?« Ich versuchte, meine Stimme ruhig zu halten, als ich mir ein Leben ohne Zigaretten vorstellte. »Was ist denn das für eine verrückte Vorschrift?«
»Die Schwestern sind dazu angehalten, den Patienten ein gutes Beispiel zu sein – ein Beispiel an Gesundheit, Hilfsbereitschaft, Moralität.« Sie legte eine besondere Betonung auf das letzte Wort ihrer kleinen Rede, die sie ganz offensichtlich auswendig gelernt hatte. »Die Pflicht einer Krankenschwester besteht darin, Trost zu spenden und sich still und fügsam zu verhalten. Das ist die höchste aller Berufungen. Bestimmt durften die Krankenschwestern in London auch nicht rauchen, nicht wahr?«
Ich hatte keine Ahnung, wie es im Krankenhaus war, doch Ally rauchte unentwegt, wenn sie nicht im Dienst war. »Darf ich rauchen, wenn ich freihabe?«
»Es ist nicht gestattet.«
»Das ist doch lächerlich.« Ich stellte meine Tasche ab. Sogar in der Fabrik hatten die Schichtleiter ein Auge zugedrückt, wenn wir uns für eine Zigarette aus der Hintertür schlichen. »Soweit ich weiß, bin ich nicht verrückt, und ich bin auch keine Patientin hier. Warum gibt es Regeln für das, was ich in meiner Freizeit mache?«
»Weil es so ist«, erwiderte sie nur. »Du bist eine Angestellte und du bekommst freie Kost und Logis. Das bedeutet, dass du rund um die Uhr mit gutem Beispiel vorangehen musst. Wenn wir einmal von der Tatsache absehen, dass die Irren über keinen moralischen Kompass verfügen, ist es einfach eine Regel, und wenn die Schwester Oberin eine Regel erlässt, dann befolgst du sie. Wirst du damit etwa ein Problem haben, Schwester Weekes? Falls dem so ist, kann ich gern die Schwester Oberin darüber in Kenntnis setzen.«
Ich biss die Zähne zusammen. Ich hatte die Stelle doch gerade erst bekommen und wollte sie nicht schon wieder verlieren. »Nein«, zwang ich mich zu sagen. »Das ist kein Problem.«
Wir blickten einander einen Moment lang an, und ich sah, wie es sein würde. Als ich meine Tasche wieder aufhob, zog sie ihre Mundwinkel triumphierend hoch. Dann wandte sie sich ab, und ich folgte ihr die Treppe hinauf.
Das Schwesternzimmer befand sich im zweiten Stockwerk in einem langen, schmalen Raum, der auf die vorderen Gärten und die Auffahrt hinaussah. Fünf ordentlich hergerichtete Pritschen standen in einer Reihe unter den Fenstern. Behelfsmäßige Vorhänge, die im Augenblick mit Stoffstreifen zusammengebunden waren, hingen zwischen den Betten; es sah ein wenig aus wie auf einer Krankenstation, doch dieser Eindruck wurde von den Koppelfenstern, dem prächtigen, nur mit dünnen Teppichen belegten Holzfußboden und einer dunklen Vertäfelung wie in den unteren Zimmern wieder wettgemacht. Erneut hatte ich das Gefühl, dass auch dies einmal ein opulenter Raum gewesen war.
Auf einem der Betten saß ein Mädchen mit dunkelblondem Haar in voller Schwesterntracht, den Rücken an das Kopfende gelehnt, ein aufgeschlagenes Magazin auf den Knien. Ein Paar schwere Schuhe lag auf dem Boden verstreut. Sie rieb ihre in Strümpfe gekleideten Füße aneinander, während sie las. Als wir eintraten, blickte sie auf, und ich sah, dass ihr Gesicht herzförmig war und sie große graue Augen hatte.
»Oh, hallo«, rief sie mir zu.
»Schwester Beachcombe«, sagte Schwester Fellows, bevor ich etwas erwidern konnte. »In einer Viertelstunde ist das Abendessen. Hast du abgespült und alles hergerichtet?«
Das Mädchen blinzelte. »Nein … Also Nina, sie hat …«
»Und wo steckt Schwester Shouldice? Sie sollte auch beim Herrichten helfen.«
»Ich bin hier.« Die tiefe Tenorstimme einer Frau drang aus der Tür hinter uns herein, und ich machte einen Schritt beiseite.
Ein zweites Mädchen betrat den Raum. Die junge Frau war groß, hatte breite Schultern, mattbraunes Haar und ein schlaffes, teigiges Gesicht. Sie betrachtete Schwester Fellows durch ihre Drahtgestellbrille mit offener Feindseligkeit. »Wen haben wir hier?«
Schwester Fellows zog ihre Lippen noch enger zusammen. »Das ist Schwester Weekes. Sie hat heute ihren ersten Tag.«
»Ach ja?« Die stattliche Frau wandte mir ihren Blick zu. »Wird sie denn länger als die letzte durchhalten?«
»Das war bedauerlich«, bemerkte Schwester Fellows. »Die Schwester Oberin wird sich damit befassen.«
Nun richtete sie ihre Augen wieder auf Schwester Fellows. »Wird sie sich auch damit befassen, dass Martha und ich schon seit vier Tagen Doppelschichten leisten?«
»Nina«, murmelte das Mädchen auf dem Bett schwach.
Der erwidernde Blick von Schwester Fellows war eisig. »Die Schwester Oberin ist sich sehr wohl bewusst, wie es um unseren Personalstand bestellt ist, das kann ich dir versichern. Darum haben wir nun einen Ersatz bekommen. Ihr zwei werdet sie anleiten müssen, denn ich habe jetzt schon viel zu viel um die Ohren. Ich erwarte, dass ihr sie ordentlich einarbeitet.« Sie drehte sich zu mir um. »Ich werde dir eine Uniform aus dem Schrank holen. Ich möchte dich noch einmal daran erinnern, dass du deine Uniform zu jeder Zeit tragen musst.« Sie bedachte Schwester Beachcombe, die immer noch ohne Schuhe auf dem Bett hockte, mit einem scharfen Blick. »Auch während der Pausen. Ich sehe euch alle in 15 Minuten.«
»Was ist denn mit der los?«, murrte Schwester Shouldice, nachdem Schwester Fellows gegangen war.
»Es waren doch nur die Schuhe«, murmelte Schwester Beachcombe unsicher, als sie aus dem Bett huschte. »Ich hatte ja keine Ahnung, dass das gegen die Regeln verstößt.«
»Natürlich nicht«, entgegnete das rundlichere Mädchen. »Viel zu viel um die Ohren? Womit denn, würde ich gern wissen.«
Ich starrte auf den Stapel Klamotten, den Schwester Fellows mir auf das Bett gelegt hatte. Die Kluft erschien mir unglaublich kompliziert zu sein. »Das werde ich niemals alles anziehen können«, seufzte ich.
Schwester Beachcombe schlüpfte in ihre Schuhe und gesellte sich zu mir. »So schwer ist es nicht. Komm, ich helfe dir.« Sie ging mir zur Hand, als ich aus meiner Bluse und meinem Rock schlüpfte, und lächelte mich schüchtern an. »Ich bin Martha«, stellte sie sich vor, »und das ist Nina. Woher kommst du?«
»London«, antwortete ich. »Und ich bin Kitty.«
»Der Name gefällt mir«, erwiderte Martha. »Ich war erst ein Mal in London, und es war einfach wundervoll! Siehst du, es ist ganz einfach – Unterrock, Rock, dann Bluse und Kragen. Die Schürze kommt zum Schluss.«
»Du bist also das neue Mädchen«, stellte Nina fest. Sie betrachtete mich mit einem Argwohn, den ich nicht so recht einzuschätzen wusste – als hätte ich eine ihrer Wertsachen gestohlen, was immer das auch sein sollte. »Dann hast du Boney schon kennengelernt, wie?«
»Boney?« Ich runzelte die Stirn, während Martha mir in den Rock half und ich die Anspielung zu deuten versuchte. »Meinst du Napoleon?«
»Oh, wie ich sehe, bist du gebildet.« Sie sagte es mit Abscheu. »Ja, unsere kleine Diktatorin. So nennen wir sie – natürlich nur, wenn sie nicht dabei ist. Sie ist das Schoßhündchen der Schwester Oberin, findest du nicht?«
»Keinen Schimmer.« Ich würde nicht noch ein Mädchen hinter dessen Rücken beleidigen, ohne zu wissen, wie die Lage der Dinge war – auch wenn sie ganz offensichtlich das Schoßhündchen der Schwester Oberin war. »Und ich bin nicht gebildet«, erklärte ich. »Ich lese nur Bücher.«
»Tja, dafür wird dir hier keine Zeit bleiben.« Ninas Brillengläser funkelten in dem schwindenden Licht, das durch die Fenster fiel. »Hier musst du bis zur Erschöpfung schuften. Um sechs stehen wir auf, um sieben beginnt der Dienst. Feierabend ist um halb zehn, und um zehn gehen die Lichter aus. Und dann fängt alles wieder von vorn an.«
»Nina ist verlobt«, verkündete Martha. »Mit einem Mann namens Roland. Er kommt nächsten Monat her, um sie zu holen. Ist das nicht romantisch?«
»Sch, Martha«, murmelte Nina, doch sie konnte den Stolz in ihrer Stimme nicht verbergen. »Wir kennen sie doch gerade erst.«
»Tja, nun ist sie eine von uns, also darf sie es wohl wissen. Ich finde es so aufregend. Ich hatte einen Freund zu Hause in Glenley Crewe, doch ich musste hierher, um eine Arbeit zu haben, und da hat er eine andere geheiratet. Hast du einen Liebsten, Kitty?«
In jeder Gruppe von Mädchen, mit der ich es je zu tun hatte – Mädchen, die in der Fabrik zusammenarbeiteten, Mädchen, die gemeinsam in Pensionen wohnten –, genoss diejenige, die verlobt war, das höchste Ansehen. Wahrscheinlich war das der Grund, warum Boney, die sich eine Menge auf ihre gehobene Position einzubilden schien, Nina nicht ausstehen konnte. Ich musste Vorsicht walten lassen. »Nein, habe ich nicht.«
»Oh, das ist aber schade. Die Männer hier werden dir keinen Ärger machen – in dieser Hinsicht sind sie harmlos. Einige wissen nicht einmal, was vor sich geht, also kommen sie auch nicht auf falsche Gedanken.«
»Falsche Gedanken?« Ich versuchte, den abtrennbaren Kragen mit Fingern festzuknöpfen, die plötzlich kalt und unbeholfen waren. »Was soll das heißen?«
»Um Himmels willen, Martha«, schimpfte Nina. »Sie sind Patienten. Und Verrückte.«
Martha zuckte die Schultern. »Das heißt ja nicht, dass sie nicht auf falsche Gedanken kommen können, oder? Mehr wollte ich nicht sagen. Na siehst du, jetzt passt’s perfekt.«
Ich blickte an mir hinab. Mein langer, enger Rock aus Serge und die recht brauchbare Bluse waren verschwunden und wurden von vielen Schichten Stoff und einer langen Schürze ersetzt, die fast über den Boden strich. Es gab Nörgler, die behaupteten, dass Röcke, die mehr als eine Handbreit über dem Boden hingen, zu kurz für anständige Mädchen seien. Das war ein Teil der Sittenlosigkeit, der wir Mädchen während des Krieges verfallen waren, und die Nörgler hatten uns noch nie davon abgehalten, die kürzesten Röcke zu tragen, die wir finden konnten. Nun war ich scheinbar in der Zeit zurückgereist und sah aus wie eine Frau auf einem alten Foto, eine von diesen stocksteifen Hennen mit den mürrischen Gesichtern. Der Schalkragen der Bluse lag schwer auf meinen Schultern, und die langen Puffärmel reichten mir bis zu den Händen. Wie sollte ich derart gekleidet arbeiten können?
»Deine Schuhe«, fragte Martha. »Sind das deine einzigen Schuhe?«
Ich blickte hinunter auf mein einziges Paar Oxfords, die ich auf dem Fußboden abgestellt hatte. Das Leder löste sich schon von den Sohlen. »Ja.«
»Oh, die werden nicht reichen. Die Böden hier sind kalt, und du wirst den ganzen Tag auf den Füßen sein.«
»Brauchtest du kein festeres Schuhwerk in dem Krankenhaus in London?«
Das war Nina, die mich eingehend mit ihren bebrillten Augen ansah. Sie hatte wieder diesen argwöhnischen Blick aufgesetzt.
»Nein«, stammelte ich. »Ich meine, es gab keine Vorschriften fürs Schuhwerk.«
»Ist auch egal.« Martha beugte sich neben meinem schmalen Bett hinunter und suchte etwas. »Das letzte Mädchen hat seine Stiefel dagelassen. Ich denke, sie werden passen. Sie hatte ungefähr deine Größe. Siehst du? Welch ein Glück!«
Ich nahm sie ihr ab. Es waren knöchelhohe Stiefel aus dickem Leder und mit einem festen, niedrigen Absatz von der Art, wie ein Mädchen auf einer Farm sie tragen würde. Ich zog sie an – sie passten überraschend gut – und starrte entsetzt auf meine Füße. Ich hatte kein Verlangen nach eleganten Kleidern, und wenn ich es doch gehabt hätte, so fehlte mir das Geld, um mir welche zu kaufen. Doch in diesem Augenblick erkannte ich mich kaum wieder. Worauf hatte ich mich nur eingelassen? Und welches Mädchen, fragte ich mich, ließ seine Stiefel zurück, wenn es seine Anstellung aufgab?
»Fehlt nur noch die Haube«, sagte Martha. »Sie muss gerade getragen werden, verstehst du? Wenn sie schief sitzt, wird die Schwester Oberin es merken.« Sie betrachtete meinen Kopf eingehend. »Dein Haar ist wie dafür gemacht. Hast du diese Zöpfe selbst geflochten?«
Ich strich mit den Fingern über die langen Zöpfe, die ich an meinem Hinterkopf zusammengesteckt hatte.
»Ja.«
»Es ist wirklich hübsch. Findest du nicht auch, Nina?«
»Ich finde, dass wir spät dran sind.«
Martha streckte sich, um mir die Haube aufzusetzen, und ich sah, dass ihre Unterarme frei lagen und dass ihre Ärmel kürzer als meine waren. Ich brauchte nur einen Moment, um das Rätsel zu lösen, denn ich entdeckte kleine Stoffschlaufen an ihren Bündchen, als sie meine Haube richtete. So funktioniert das also mit dieser Tracht – abnehmbare Ärmel. Pfiffig.
Ich schob meine Finger in meinen Ärmel, fand die Knöpfe und löste sie einen nach dem anderen. Ich machte eine gelassene, ja fast schon gelangweilte Miene, als hätte ich es schon die ganze Zeit gewusst.
»Ich hoffe, dass ich die nicht brauchen werde«, bemerkte ich und ließ die Ärmel auf das Bett fallen.
Nina starrte mich unsicher an, dann lief sie zur Tür hinüber. »Du wirst sie für die Besichtigungen brauchen, also halte sie griffbereit.«
»Ich werde sie schon nicht verlieren«, beteuerte ich.
»Das wäre auch besser. Und jetzt kommt, wir sind spät dran.«
3
20 Minuten später, nachdem ich hastig einen Happen Brot mit Käse gegessen und einen lauwarmen Schluck Tee getrunken hatte, stand ich wieder in der Tür zum großen Speisesaal, wo ich endlich einen ersten Blick auf die Patienten, auf die Verrückten von Portis House werfen konnte.
Sie marschierten ruhig und gesittet in Reih und Glied an mir vorüber. Es waren Männer aller Art: groß und klein, schmächtig und fett, hell und dunkel. Jeder von ihnen trug eine hellbeige Uniform aus schwerem Leinenstoff: eine einfache Hose und ein langärmeliges Hemd mit Knopfleiste, auf dem vorn und hinten die Worte PORTIS HOUSE HOSPITAL gedruckt standen. Mir wurde bewusst, dass ich sie mir in Militäruniform und Wickelgamaschen vorgestellt hatte, als wäre noch immer Krieg; sie in dieser Krankenhauskluft zu sehen war befremdlich und auf eine gewisse Weise erniedrigend.
Sie würdigten mich keines Blickes und sprachen untereinander im Flüsterton, wenn sie denn überhaupt etwas sagten, als sie ihre Plätze einnahmen.
Sie schienen mir fast zutraulich zu sein, und mein erster – unpassender – Gedanke lautete: Sie sehen gar nicht verrückt aus.
Nina schob sich an meine Seite. »Keine Gürtel oder Hosenträger«, erklärte sie. »Wenn du welche siehst, musst du sie konfiszieren. Das gilt auch für Rasiermesser.«
Hinter ihren Brillengläsern wartete sie auf meine Reaktion. Ich verzog keine Miene, doch ich sah, dass sie recht hatte: Keiner der Männer in dem Raum trug einen Gürtel oder Hosenträger. Wie es schien, wurden ihre Hosen nur durch Kordeln festgehalten. Vermutlich wurde es als zu schwierig erachtet, sich mit einer Kordel zu erhängen.
Ich räusperte mich und sprach so leise, wie ich konnte: »Wie … Wie rasieren sie sich?«
»Ausschließlich mit Rasierhobeln. Viele von ihnen kennen das aus dem Krieg. Hin und wieder beschwert sich einer darüber, doch wir dürfen kein Risiko eingehen. Ganz egal was ein Mann für eine Ausrede benutzt, es gibt keine Ausnahmen für diese Regel.«
Ich nickte und versuchte, die Frage zu verdrängen, was einen Mann dazu bringen würde, diesen Ort so sehnlichst verlassen zu wollen, dass man ihm kein Rasiermesser anvertrauen konnte, und ich versuchte, nicht daran zu denken, dass diese Regel aus der Erfahrung heraus entstanden sein musste.
Schwester Fellows – die ich in Gedanken schon als Boney bezeichnete – gesellte sich zu uns. Martha war an ihrer Seite. »Wir sind so weit«, verkündete sie. »Die Küche verteilt gerade das Essen. Schwester Shouldice, du bringst ein Tablett zu Mr. West. Seine Beine bereiten ihm heute noch mehr Schmerzen als üblich, darum bleibt er in seinem Bett. Mr. Childress bekommt seine Brühe auch auf der Station.«
»Ich werde mich um beide kümmern«, erwiderte Nina. »Meistens isst Mr. Childress etwas, wenn ich ihn ein wenig beschwatze.«
»Also gut. Schwester Beachcombe, du bringst ein Tablett zu Patient 16. Ich habe nichts von ihm gehört, doch ich schätze, dass er etwas haben möchte.«
Marthas Gesicht hellte sich auf. »Sehr wohl, Schwester Fellows.«
»Wer ist Patient 16?«, fragte ich.
Nina und Martha tauschten einen Blick, doch Boney ignorierte die Frage. »Du wirst den Speisesaal im Auge behalten«, wies sie mich an. »Ich werde dir beim Servieren helfen, doch dann muss ich zur Schwester Oberin und die Küche beaufsichtigen. Die Männer scheinen heute Abend bei guter Laune zu sein. Schaffst du das?«
Ich ließ meinen Blick über die Männer wandern, die an zwei Tischen unter den ausschweifenden Ranken aus Stuck an der opulenten Decke saßen. Ich hoffte, meine aufgesetzte Bravour war überzeugend. »Natürlich.«
»Gut. Dann ran an die Arbeit, oder die Schwester Oberin wird davon erfahren. Auf, auf.«
Die Pfleger – vier Männer in weißer Kleidung, von denen einer überaus groß und korpulent war – hatten Handwagen in den Speisesaal gerollt. Der Große schloss die Luke zu einem Speiseaufzug auf und öffnete sie. Unter dem lauten Krächzen von Flaschenzügen erschien eine Plattform mit Essenstellern, vermutlich aus der Küche. Der Pfleger nahm die Teller und stellte sie auf seinen Wagen. »Hopp!«, rief er den Schacht hinunter, und die Plattform senkte sich wieder. Ich sah gebannt zu, wie sich dieser Vorgang mehrmals wiederholte. Ich kannte Speiseaufzüge aus Restaurants, doch in einem Wohnhaus hatte ich sie noch nie gesehen.
Boney wandte sich zu mir, während die beiden anderen Schwestern Tabletts beluden und zur Treppe hinüberliefen. »Früher sprachen wir vor den Mahlzeiten Gebete, doch ein paar von ihnen schafften es nicht, so lange still zu sitzen, was einen störenden Einfluss auf die anderen hatte, also haben wir damit aufgehört. Ich schenke das Wasser ein. Jeder der Männer bekommt einen Teller. Und stelle sie behutsam ab. Um Himmels willen keine lauten Geräusche. Hast du verstanden?«
»Keine lauten Geräusche?«
Sie schürzte die Lippen. »Damit kommen sie nicht zurande. Ich habe noch mit keiner Schwester zusammengearbeitet, die genügend Sorgfalt walten lässt. Kein Klopfen, kein Klappern – nichts von dieser Art. Die Hälfte der Männer wird sich zu Boden werfen, weil sie glauben, wieder im Schützengraben zu sein. Portis House soll ein ruhiger Ort der Heilung sein, und eine Ermangelung von aufreibenden Geräuschen gehört zur Behandlung. Eine Anweisung der Ärzte.«
Ich blickte noch einmal durch den Raum. Die Hälfte wird sich zu Boden werfen. »Ich verstehe.«
Ich nahm die Teller von einem der Wagen, während sie mit einem großen Krug Wasser umherlief und den Männern einschenkte. Da drei Patienten fehlten – Mr. West mit den schlimmen Beinen, Mr. Childress, der auf der Station war, und der geheimnisvolle Patient 16 –, waren nur 16 Männer im Speisesaal, acht an jedem Tisch. Auf jedem Teller lagen ein quadratisches Stück Rindfleisch, ein Klumpen Stampfkartoffeln und ein Löffel voll wässriger Erbsen. Ich stellte den ersten Teller ab, dann den zweiten. Ich achtete darauf, sie leise abzustellen. Ich hatte immer noch Hunger, trotz des Käsebrots, doch als ich das Essen auf den Tellern sah, verging mir der Appetit.
Die Männer aßen klaglos. Boney schenkte zu Ende ein und nickte mir zu, bevor sie den Raum verließ. Eine schwere, bedeutungsvolle Stille breitete sich aus, kaum dass sie gegangen war.
»Eine neue Schwester«, sagte eine Männerstimme schließlich. Es war unmöglich zu erkennen, wer gesprochen hatte, da keiner der Männer seinen Kopf hob.
»Und ’ne hübsche obendrein«, rief jemand anderes.
Ganz sacht stellte ich den nächsten Teller ab.
»Wo ist die mit den Sommersprossen?«, fragte ein blonder Mann mit einem kurzen Bart, der in meiner Blickrichtung saß. »Wir haben sie seit Tagen nicht mehr gesehen, und sie ist auch nicht im Nachtdienst.«
Keine der anderen Krankenschwestern hatte Sommersprossen; es musste sich um das letzte Mädchen handeln, dessen Stiefel ich trug.
»Ja, wo ist sie?«, wollte ein Mann mit breiten Schultern und hellrotem Haar wissen, der etwas weiter hinten an dem Tisch saß, den ich gerade bediente. Der Blick, den er mir zuwarf, war ein höhnischer. »Sie werden’s uns armen Burschen doch sagen, nicht wahr, Frau?«
»Ich bin nicht Ihre Frau«, erwiderte ich scharf.
Zu meiner Überraschung lachte er, genau wie der Mann, der neben ihm saß, doch die anderen Männer stimmten nicht ein. Ich stellte einen Teller vor einem groß gewachsenen schlaksigen Mann ab, der eine Brille auf seiner großen Römernase trug. Er blickte mit freundlicher Miene zu mir herauf. »Ich glaube, Creeton wollte Sie als Ordensfrau bezeichnen«, erklärte er. Sein Akzent triefte vor Oxford oder Cambridge. »Ein Mitglied Ihres Klosters.«
»Kloster?« Ich konnte meinen Schrecken nicht verhehlen, als ich ihn anstarrte. »Sie meinen eine Nonne?«
»Eine Nonne!« Wieder lachte der rothaarige Mann. »Gott sei Dank ist sie keine von denen!«
»Eine Ordensfrau«, bestätigte die Römernase. Er senkte seine Stimme zu einem vertraulichen Flüstern und blickte auf seinen Teller, als er in sein Stück Fleisch schnitt. »Es ist ein Begriff, so glaube ich, der eine Schwester in einem Kloster bezeichnet.«
Ich errötete. Es waren erst zehn Minuten meiner ersten Schicht vergangen, und schon hatte mich einer der Männer durchschaut. In der Regel war ich viel umsichtiger. Ich hatte ein halbes Jahr lang in der Fabrik gearbeitet, ohne dass jemand herausfand, dass ich nicht die Schulfreundin der Tochter des Fabrikbesitzers war. Und davor glaubte der Inhaber einer Parfümerie in Mile End, dass das Mädchen, das beinahe ein Jahr lang für ihn als Verkäuferin gearbeitet hatte, Theresa Baker hieß. Um Himmels willen, reiß dich zusammen, oder sie werden dich im hohen Bogen rauswerfen. »Ich bin keine Ordensfrau«, verkündete ich dem ganzen Raum und lief den Tisch entlang. »Ich bin nur eine Krankenschwester. Mein Name ist Schwester Weekes.«
»Na prima!«, ertönte eine Stimme irgendwo hinter mir. »Sie sind die hübscheste Schwester, die wir je hatten.«
»Ganz recht«, stimmte der rothaarige Mann zu. »Dann können Sie ja Captain Mabry heute Abend ins Bett bringen, wie? Bestimmt würde er es zu schätzen wissen.«
Wieder erklang Gelächter, und so wie die Römernase errötete, nahm ich an, dass er Captain Mabry war. Ich blickte zur Tür, doch von Boney war nichts zu sehen. Und wo waren die Pfleger abgeblieben? »Ich bringe niemanden ins Bett«, wehrte ich ab.
Ich hatte den letzten Platz erreicht, der zufällig der von Creeton war, dem Rotschopf mit den breiten Schultern. Er blickte mit einem breiten Grinsen zu mir herauf. »Ach kommen Sie, Schwester. Wir machen doch nur ein bisschen Spaß.« Und als ich seinen Teller abstellte, legte sich seine große, fleischige Hand auf meinen Po und drückte zu, bis es wehtat.
Ich erschrak. Der Teller landete mit einem dumpfen Knall auf dem Tisch, das Besteck klapperte, das Wasserglas klirrte. Ein ohrenbetäubendes Schweigen legte sich über den Raum, die Luft spannte sich erwartungsvoll; dann erklang ein schriller Ton von einem der anderen Männer, eine Wehklage, die sich fast wie ein Lachen anhörte.
»Es tut mir leid«, stammelte ich und bewegte mich weg von Creeton, den Tisch entlang. »Es tut mir leid, ich …«
Der Mann, der das Geräusch von sich gab, ließ seine Gabel fallen. Erbsen rutschten über den Rand seines Tellers auf den Tisch. Er hob eine Hand an sein Gesicht, als wäre es ihm unangenehm, dass er es war, der das Geräusch machte. Ich erkannte nun, dass das Geräusch tatsächlich ein Lachen war – hysterisch und unkontrolliert. Er schaukelte nach vorn und wieder zurück. Sein Gesicht wurde puterrot. Das Geräusch kam tief aus seinem Inneren hervor, laut und gewunden.
»Es tut mir leid«, wiederholte ich.
»Sieh nur, was du angerichtet hast«, sagte Captain Mabry, doch er sprach zu Creeton, nicht zu mir. »Nun hast du ihn aufgebracht.« Seine Stimme schien von einem Hauch Angst erfüllt zu sein.
»Somersham!«, rief Creeton dem lachenden Mann zu, der noch immer seine Wehklage ausstieß. »Bist ein bisschen übergeschnappt, was? Somersham!« Er hob seinen Teller an und schlug ihn auf den Tisch. Bratensoße flog durch die Luft. Er machte es noch einmal. »Da! Was glaubst du, was das ist? Was glaubst du, wo du bist? An der verfluchten Somme?«
Der Mann lachte noch lauter. Die ganze Luft schien aus dem Raum zu entweichen; ich konnte kaum noch atmen. »Aufhören!«, rief ich. »Sofort aufhören!«
»Somersham, um Himmels willen«, bat Captain Mabry mit einem fast schon flehentlichen Tonfall. »Du musst damit aufhören.«
Somersham drückte sich seine Hände auf die Wangen. »Ich bin kein Feigling«, murmelte er zu niemandem. »Bin ich nicht.«
Ich spürte eine sanfte Berührung an meinem Arm und blickte hinunter zu einem rundlichen Mann, der mit seinem ruhigen, faltenlosen Gesicht zu mir heraufsah. »Sie dürfen nicht zu streng mit diesen Männern sein«, bat er. Dann beugte er sich zu mir herüber und senkte seine Stimme. »Ich glaube, sie waren in einem Krieg.«
Ich machte einen Schritt zurück, und dann noch einen. Und dann war ich raus aus dem Raum, allein im Flur mit den leeren Servierwagen und einer tiefen, wachsenden Finsternis. Ich schaffte es bis zum Ende des Flurs, wo es ein Fenster gab. Meine Schritte hallten sonderbar von den Wänden zurück. Ich blickte verzweifelt hinaus in die düsteren Nebelwolken.
Ich konnte es nicht tun. Es ging einfach nicht. Ich war mir so sicher gewesen, doch ich hatte mich geirrt. Diese Hand auf mir … Ich konnte sie noch immer spüren, und das Gefühl machte mich krank. Ich hatte gedacht, ich würde mich um Verrückte, um einfältige, sabbernde Idioten kümmern. Ich hatte nicht bedacht, dass es Männer waren.
Und nun war ich mit ihnen zusammen an diesem Ort eingesperrt, fernab von allem.
Ich legte meine Hand an das Glas, spürte seine kalte, rutschige Nässe. Sah zu, wie der Nebel an meinen Fingern vorüberzog. Von der Fensterbank und dem oberen Rand des Fensterrahmens blätterte Farbe ab. Es erschien mir sonderbar, dass sich in einem Haus, das noch recht neu anmutete, schon die Farbe löste.
Ich schloss die Augen. Im Speisesaal war das Lachen verstummt, und nun herrschte eine unheilvolle Stille. Eine fast schon kühle Ruhe legte sich über meinen Rücken und meine Schultern. Sie nahm mir die Angst und gab mir das Gefühl, wieder stark zu sein. Hatte die Tür zum Schlafraum der Schwestern ein Schloss? Gab es irgendwas in Portis House, das ich, wenn es notwendig war, als Waffe benutzen konnte?
Die Stille wurde von einem schrillen Schrei aus dem Speisesaal durchbrochen, von Geschirr, das zerschlagen wurde, von umgestoßenen Stühlen. Auf der anderen Seite des Flurs erklangen die schnellen, schweren Schritte der Pfleger, die die Treppe zur Küche hinaufrannten. Ein entsetztes Rufen. Doch ich war am nächsten, und ich brauchte nur ein paar Sekunden. Und so war ich die Erste, die den Speisesaal erreichte, und die Erste, die das Blut auf dem Boden sah.
4
Ich konnte nicht denken; ich sank nur auf meine Knie, mit meinen Röcken kämpfend, gleich neben den Mann, der seitlich auf dem Boden lag. Er war zwischen zwei Tische eingeklemmt, in sich zusammengerollt, die Hände von sich gestreckt. Als ich mich über ihn beugte, sah ich, dass es Captain Mabry war. Seine Brille war hinunter auf den Boden gefallen, sein Gesicht blutüberströmt.
Creeton. Er musste es gewesen sein. Oder vielleicht Creeton mit der Hilfe eines anderen. Oder war es jemand ganz anderes gewesen? Ich kannte keinen der Männer gut genug, um mir sicher zu sein.
Ich drehte den Captain auf den Rücken, während der Raum hinter mir in ein Chaos ausbrach: Stühle, die über den Boden schleiften, als die Männer sie zurückschoben; aufgeregte Stimmen. »Er hat’s schon wieder getan!«, sagte jemand.
»Also gut.« Eine Männerstimme schallte über die anderen hinweg. Ich blickte auf und sah, dass die Pfleger in den Raum gekommen waren, und der größte von ihnen, ein gewaltiger Kerl mit blassen, kurz geschorenen Haaren, erteilte Anweisungen. »Wir gehen nun in den Gemeinschaftsraum. Wir alle zusammen. In einer Reihe. Langsam und ruhig.«
Seine Vokale legten sich flach übereinander, die Konsonanten waren klar und spröde. Britisch, und doch irgendwie fremdartig. Ich hatte seinen Akzent gerade als südafrikanisch eingeordnet, als die Schwester Oberin hinter dem riesigen Mann auftauchte und an ihm vorbeilugte. Ihre Miene war von Zorn erfüllt.
»Was hat das zu bedeuten?«, blaffte sie in den Raum.
Ich sah wieder hinunter zu Captain Mabry. Er lag auf meinem Schoß, so sanftmütig wie ein dressierter Hund, und blickte zu mir herauf. Er blutete stark aus der Nase; ein roter Schwall floss an seinem Gesicht herab, über seine Lippen und sein Kinn, auf die Vorderseite seines Hemdes und auf den Boden. Das Nasenbluten wurde immer schlimmer; immer neue Klumpen aus dickem, dunklem Blut quollen zäh aus seinen Nasenlöchern.
Nina tauchte über meiner Schulter auf. Sie verschaffte sich kurz ein Bild der Lage und erklärte: »Ich hole das Winsoll’s.« Dann verschwand sie wieder, bevor ich sie fragen konnte, was das bedeutete.
Ich schluckte. »Also gut.«
Ich zog ihn noch ein wenig weiter auf meine Knie. Die Nase schien nicht gebrochen zu sein; es war unglaublich, doch es schien nichts weiter als ein einfaches Nasenbluten zu sein. Ich hob seinen Oberkörper an, sodass sich sein Kopf nach hinten neigte – er ließ mich bereitwillig machen, als würde ich wissen, was ich tat –, und stützte seinen Nacken mit meinem angewinkelten Ellbogen.
»Lehnen Sie sich zurück. Lehnen Sie sich so weit an mir zurück, wie es geht, und richten Sie den Blick nach oben.«
Eine blutige Nase, ausgerechnet. Die eine Sache – die einzige Sache –, von der ich wusste, wie man sie behandelte, zumindest provisorisch.
Captain Mabry neigte seinen Kopf nach hinten. Mit einer geübten Präzision kniff ich seine Nasenflügel zusammen, ganz weit oben, dort, wo der Knochen härter wurde. Er gluckste ein wenig. Die Männer verließen unter der Aufsicht des riesigen Pflegers murmelnd den Raum. Ich konnte die Rasierseife des Captains riechen und die raue Beschaffenheit seines Leinenhemdes an meinem Arm spüren. An seiner Stirn war ein Fleck getrockneter Seife. Ich sah weg.
Hinter mir schlurfte jemand entlang und ging hinaus, doch ich konnte nicht erkennen, wer es war. Der Captain rührte sich nicht.
Zwei maskuline Füße, in abgewetzte Lederschuhe gekleidet, traten in mein Sichtfeld. Creeton hockte sich neben mich, die Hände um seine Knie gelegt, und betrachtete uns abwechselnd. »Sieh an, sieh an«, raunte er in einem leisen, bedrohlichen und merkwürdig zufriedenen Tonfall. »Hallo, Schwester.«
Ich stierte ihn an und schwieg. Dieser Mann hatte mich angefasst. Ich bekam eine Gänsehaut.
Er beugte sich zu mir herüber, bis sein heißer, feuchter Atem mir über die Haarsträhnen hinter meinem Ohr strich. »Amüsieren Sie sich gut an Ihrem ersten Tag mit den Verrückten?«
»Seien Sie ja vorsichtig«, entgegnete ich genauso leise. »Ich beiße.«
Er zuckte zurück. Er musste den stählernen Ausdruck in meinen Augen gesehen haben, denn ihm huschte eine Unsicherheit über das Gesicht. Doch die legte er schnell wieder ab und grinste anzüglich. »Vielleicht würde mir das gefallen.«
»Das würde es nicht, das verspreche ich Ihnen.«
Er blickte mich überrascht an, doch er bekam keine Gelegenheit mehr, mir zu antworten. Die Schwester Oberin stand schon über ihm. »Es ist genug, Mr. Creeton.«
Creeton raffte sich langsam auf und gehorchte mit einem unübersehbaren Hauch von Trotz. Er wandte sich ab und folgte den anderen wortlos aus dem Raum.
Die Schwester Oberin machte einen Schritt vor und blickte auf uns herunter. »Mr. Mabry«, sagte sie in einem Tonfall der Enttäuschung.
Mabry blinzelte zu ihr hinauf. Ich konnte den Ausdruck auf seinem Gesicht, das hinter meiner Hand und unter einer Blutspur lag, nicht deuten.
»Wieder das Nasenbluten?«, fragte die Schwester Oberin. »Ich dachte, das hätten wir hinter uns. Sie haben schon seit Wochen keines mehr gehabt, und es schien, als hätten Sie dieses spezielle Problem besiegt. Doch nun sehe ich, dass ich mich geirrt habe. Ihnen ist bewusst, dass ich die Ärzte darüber unterrichten muss, nicht wahr?«
»Es tut mir schrecklich leid«, erwiderte Mabry.
»Das ist mir durchaus bewusst. Doch es ändert nichts an der Tatsache, dass ich es in meinem Bericht für die Ärzte erwähnen muss. Wenn Sie es zurückgehalten hätten, wäre die Lage nun eine andere.«
»Es tut mir schrecklich leid«, beteuerte er noch einmal mit schwacher Stimme.
»Schwester Weekes«, verfügte sie, ohne weiter auf ihn einzugehen, »bitte kümmern Sie sich darum, dass er gewaschen und auf sein Zimmer gebracht wird, um sich auszuruhen. Sein Anblick würde nur die anderen Patienten verstören.«
»Ja, Schwester Oberin.«
»Und melden Sie sich in 20 Minuten in der Küche. Ich nehme an, Sie wissen, wo sie ist.«
Die Küche befand sich unten, ein großer, zweckmäßiger Raum, der in verschiedene Bereiche unterteilt und voller Arbeitsgeräte war, die ich nicht benennen konnte.
Ein Koch und mehrere Küchenjungen räumten mithilfe von zwei Pflegern die Reste des Abendessens ab.