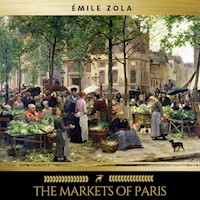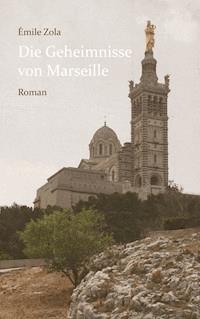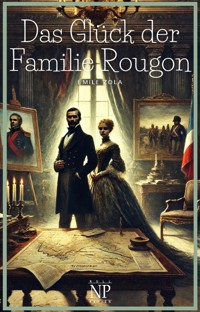Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Rougon-Macquart
- Sprache: Deutsch
Klassiker der Weltliteratur! eBooks, die nie in Vergessenheit geraten sollten. Börsenspekulanten und ihre großen und kleinen Opfer - von ihren Schicksalen erzählt Emile Zola in Das Geld. Ein Roman über die Intrigen und Machenschaften in der Finanzwelt, der heute aktueller ist denn je.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 759
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Emile Zola
Das Geld
Impressum
Instagram: mehrbuch_verlag
Facebook: mehrbuch_verlag
Public Domain
Erstes Kapitel
An der Börse hatte es elf Uhr geschlagen, als Saccard bei Champeaux den weißgoldenen Saal betrat, dessen zwei hohe Fenster auf den Platz hinausgingen. Mit einem Blick überflog er die Reihen kleiner Tische, an denen dichtgedrängt die geschäftigen Gäste saßen, und er schien überrascht, das Gesicht, das er suchte, nicht zu finden.
Als im Gedränge des Servierens ein mit Platten und Schüsseln beladener Kellner vorüberkam, fragte er ihn:
»Sagen Sie mal, Herr Huret ist noch nicht da?«
»Nein, mein Herr, noch nicht.«
Kurz entschlossen setzte sich Saccard in eine Fensternische an einen Tisch, von dem gerade ein Gast aufstand. Er glaubte, sich verspätet zu haben, und während man das Tischtuch wechselte, schweiften seine Blicke nach draußen und spähten nach den Passanten auf dem Bürgersteig aus. Selbst als ein neues Gedeck aufgelegt war, bestellte er nicht sofort, sondern ließ seinen Blick auf dem Platz ruhen, der heiter im hellen Licht der ersten Maitage lag. Zu dieser Stunde, da die Leute ihr Mittagessen einnahmen, war er fast leer. Unter den Kastanienbäumen mit ihrem zarten, frischen Grün waren die Bänke unbesetzt; längs dem Gitter standen in einer langen Reihe Droschken an der Haltestelle, und der Omnibus von der Bastille hielt vor dem Büro an der Ecke des Gartens, ohne daß Fahrgäste ein- oder ausstiegen. Die Sonne prallte herab, das Gebäude mit seinem Säulengang, seinen beiden Statuen, seiner breiten Freitreppe, oberhalb deren noch nichts weiter zu sehen war als die Armee der wohlgeordneten Stühle, wurde von ihrem Schein überflutet.
Aber als sich Saccard umdrehte, erkannte er Mazaud, den Wechselmakler1, am Nebentisch. Er streckte ihm die Hand hin.
»Ach, Sie sind hier? Guten Tag!«
»Guten Tag!« erwiderte Mazaud und reichte ihm zerstreut die Hand.
Dieser kleine, brünette, sehr lebhafte hübsche Mann hatte vor kurzem das Maklerbüro eines Onkels geerbt, mit zweiunddreißig Jahren. Er schien sich ganz dem Gast zu widmen, der ihm gegenübersaß, ein beleibter Herr mit rotem, glattrasiertem Gesicht: der berühmte Amadieu, den die Börse seit seinem großartigen Coup mit den Selsis-Gruben verehrte. Als die Aktien auf fünfzehn Francs gefallen waren und man jeden Käufer für verrückt erklärte, hatte er sein ganzes Vermögen in dieses Geschäft gesteckt, zweihunderttausend Francs, aufs Geratewohl, ohne Berechnung und Gespür, mit der Starrköpfigkeit eines sturen Klotzes, der sein Glück herausfordert Heute, da die Entdeckung beträchtlicher fündiger Adern den Kurs der Aktien auf über tausend Francs hatte steigen lassen, verdiente er dabei rund fünfzehn Millionen, und seine irrsinnige Spekulation, für die man ihn früher hätte einsperren lassen müssen, erhob ihn jetzt in die Reihe der großen Köpfe der Finanz. Jeder grüßte ihn und fragte ihn vor allem um Rat. Übrigens erteilte er, als sei er gesättigt, keine Orders2 mehr und sonnte sich hinfort in seinem einzigartigen, legendären Geniestreich. Mazauds Traum war es wohl, ihn als Kunden zu gewinnen.
Saccard, der von Amadieu nicht einmal ein Lächeln erhaschen konnte, grüßte zum Tisch gegenüber, an dem drei Spekulanten aus seinem Bekanntenkreis beisammensaßen, Pillerault, Moser und Salmon.
»Guten Tag! Wie gehtʼs?«
»Danke, nicht schlecht ... Guten Tag!«
Auch bei diesen spürte er Kälte, ja fast Feindseligkeit. Dabei zeigte Pillerault, sehr groß, sehr mager, heftig gestikulierend und mit einer Nase, die wie eine Säbelklinge in dem knochigen Gesicht eines fahrenden Ritters aussah, für gewöhnlich die Vertraulichkeit eines Spekulanten, der die Wagehalsigkeit zum Prinzip erhob und erklärte, daß er jedesmal in Katastrophen purzele, wenn er sich die Mühe gibt nachzudenken. Er hatte das überschwengliche Wesen eines Haussiers3, war immer auf Sieg eingestellt, während Moser mit seiner untersetzten Statur, mit seiner von einer Leberkrankheit verwüsteten gelben Gesichtsfarbe unaufhörlich jammerte, in der ständigen Angst vor einem Zusammenbruch. Was Salmon anbetraf, ein sehr gut aussehender Mann, der gegen die Fünfzig ankämpfte und mit einem prächtigen pechschwarzen Bart prunkte, so galt er als ein ungemein tüchtiger Kerl. Er sprach nie, antwortete nur mit einem Lächeln; man wußte nie, worauf er spekulierte, nicht einmal ob er spekulierte, und seine Art zuzuhören beeindruckte Moser dermaßen, daß dieser oft, nachdem er Salmon eine vertrauliche Mitteilung gemacht hatte, durch sein Schweigen so aus der Fassung geriet, daß er davonlief, um eine Order zu ändern.
Angesichts dieser Gleichgültigkeit, die man gegen ihn an den Tag legte, bekam Saccard einen fiebrigen, herausfordernden Blick, den er durch den ganzen Saal schweifen ließ. Doch er tauschte nur noch ein Kopfnicken mit einem großen jungen Mann, der drei Tische weiter saß: der schöne Sabatani, ein Levantiner mit langem, dunklem Gesicht, das wundervolle schwarze Augen erhellten, aber von einem bösen, beunruhigenden Mund entstellt wurde. Die Liebenswürdigkeit dieses Burschen brachte Saccard vollends auf: irgendein von einer ausländischen Börse Ausgeschlossener, einer dieser geheimnisvollen Frauenlieblinge, der im letzten Herbst auf den Markt geschneit war, den er schon als Strohmann bei einem Bankkrach am Werk gesehen hatte und der sich durch große Korrektheit und unermüdliches Wohlwollen, selbst den Verrufensten gegenüber, nach und nach das Vertrauen der Corbeille4 und der Kulisse5 erwarb.
Ein Kellner blieb vor Saccard stehen.
»Der Herr wünschen?«
»Ach ja ... Was Sie wollen, ein Kotelett mit Spargel.«
Dann rief er den Kellner zurück.
»Sind Sie sicher, daß Herr Huret nicht vor mir gekommen und wieder gegangen ist?«
»Oh, ganz sicher!«
So stand es nun mit ihm nach dem Zusammenbruch, der ihn im Oktober wieder einmal gezwungen hatte, seine Geschäfte zu liquidieren, sein Haus am Parc Monceau zu verkaufen und eine Wohnung zu mieten: nur Leute wie Sabatani grüßten ihn noch; bei seinem Eintritt in ein Restaurant, in dem er den Ton angegeben hatte, drehte sich nicht mehr alle Welt nach ihm um, streckten sich nicht mehr alle Hände ihm entgegen. Er war ein richtiger Spieler, er hegte keinen Groll nach diesem letzten skandalösen und unheilvollen Grundstücksgeschäft, aus dem er kaum mehr als die eigene Haut gerettet hatte. Aber ein fieberhaftes Verlangen, Revanche zu nehmen, entbrannte in ihm; Huret hatte ausdrücklich versprochen, gegen elf Uhr hier zu sein, um ihn über die Ergebnisse seiner Bemühungen bei Rougon zu unterrichten, dem damals allmächtigen Minister, und daß Huret nicht da war, brachte Saccard vor allem gegen seinen Bruder Rougon auf. Huret, der gehorsame Abgeordnete, die Kreatur des großen Mannes, war bloß ein Laufbursche. Nur, war es denn möglich, daß Rougon, der alles vermochte, ihn so im Stich ließ? Nie hatte er sich als guter Bruder erwiesen. Daß er nach der Katastrophe verärgert war, daß er offen mit ihm gebrochen hatte, um nicht selber bloßgestellt zu werden, war begreiflich; aber hätte er ihm nicht seit sechs Monaten heimlich zu Hilfe kommen müssen? Und jetzt sollte er die Stirn haben, ihm nicht kräftig unter die Arme zu greifen, wenn er ihn durch einen Dritten darum bitten ließ? Er wagte ja schon nicht, ihn persönlich aufzusuchen, weil er einen Zornesausbruch befürchtete, zu dem er sich möglicherweise hinreißen ließe. Rougon brauchte nur ein Wort zu sagen, dann käme er wieder auf die Beine und könnte diesem feigen, großen Paris von neuem den Fuß auf den Nacken setzen.
»Welchen Wein wünschen der Herr?« fragte der Weinkellner.
»Ihren einfachen Bordeaux.«
Saccard war in Gedanken versunken; er hatte keinen Appetit und ließ sein Kotelett kalt werden. Als er einen Schatten über das Tischtuch gleiten sah, hob er die Augen. Das war Massias, ein dicker, rotgesichtiger Kerl, ein Remisier6, den er als armen Mann gekannt hatte und der sich jetzt, mit seinem Kurszettel in der Hand, zwischen den Tischen hindurchschlängelte. Es traf Saccard schwer, daß Massias nicht stehenblieb, sondern an ihm vorbeiging, um den Kurszettel Moser und Pillerault zu reichen. Zerstreut und in ein angeregtes Gespräch verwickelt, warfen diese kaum einen Blick darauf: nein, sie hätten keine Orders zu erteilen, ein andermal. Massias wagte nicht, den berühmten Amadieu anzugehen, der, über einen Hummersalat gebeugt, leise mit Mazaud plauderte, und trat an Salmon heran, der den Kurszettel nahm, ihn lange studierte und dann wortlos zurückgab. Der Saal belebte sich. Alle Augenblicke gingen die Türen auf, und andere Remisiers kamen herein. Laute Worte flogen zwischen den Tischen hin und her, eine richtige Spekulationswut kam auf, je mehr die Zeit vorrückte. Und Saccard, dessen Blicke unaufhörlich nach draußen schweiften, sah, wie sich auch der Platz nach und nach füllte, wie die Wagen und die Fußgänger herbeiströmten, während sich auf den Stufen zur Börse, die im Sonnenlicht gleißten, schon einzelne schwarze Flecken zeigten, die Männer der Börse.
»Ich sage es Ihnen noch einmal«, sagte Moser mit seiner weinerlichen Stimme, »daß diese Nachwahlen vom 20. März7 ein höchst beunruhigendes Symptom sind ... Schließlich ist heute ganz Paris der Opposition ergeben.«
Aber Pillerault zuckte mit den Schultern. Carnot8 und Garnier-Pagès9 auf den Bänken der Linken, was konnte das schon ausmachen?
»Das ist wie mit der Frage der Herzogtümer10«, fing Moser wieder an, »das kann eine Menge Verwicklungen geben ... Ganz bestimmt! Aber lachen Sie ruhig. Ich sage ja nicht, daß wir Preußen hätten den Krieg erklären müssen, um es daran zu hindern, sich auf Kosten Dänemarks zu mästen; allein es gab Mittel und Wege zu handeln ... Ja, ja, wenn die Großen erst anfangen, die Kleinen aufzufressen, weiß man nie, wo das aufhört ... Und was Mexiko betrifft ..11.«
Pillerault, der einen seiner restlos zufriedenen Tage hatte, brach in Lachen aus.
»Ach nein, mein Lieber! Hören Sie doch auf, uns mit Ihren Schauergeschichten über Mexiko zu langweilen ... Mexiko wird einmal das Ruhmesblatt dieser Regierung sein ... Woher, zum Teufel, wollen Sie wissen, daß das Kaiserreich12 krank ist? Wurde nicht im Januar die Dreihundertmillionenanleihe um mehr als das Fünfzehnfache überzeichnet? Ein überwältigender Erfolg ... Passen Sie auf, wir sprechen uns 67 wieder, in drei Jahren, wenn die Weltausstellung13 eröffnet wird, die der Kaiser14 soeben beschlossen hat.«
»Ich sage Ihnen, die Dinge stehen schlecht!« bekräftigte Moser verzweifelt.
»Ach, lassen Sie uns in Frieden, die Dinge stehen gut!«
Salmon sah die beiden an und lächelte tiefgründig. Und Saccard, der ihnen zugehört hatte, führte die Krise, in die das Kaiserreich zu geraten schien, auf die Schwierigkeiten seiner persönlichen Lage zurück. Er selbst war wieder einmal am Boden: sollte dieses Kaiserreich, das ihn hervorgebracht hatte, pleite gehen wie er und plötzlich vom höchsten Glück ins tiefste Elend stürzen? Ach, zwölf Jahre lang hatte er es geliebt und verteidigt, dieses Regime, unter dem er gespürt hatte, wie er auflebte, wie er gedieh, sich mit Saft füllte wie der Baum, dessen Wurzeln sich in das nährende Erdreich senken! Aber wenn sein Bruder ihn da herausreißen wollte, wenn er ihn abschneiden wollte von denen, die den fetten Boden der Genüsse aussaugten, dann sollte auch alles hinweggerafft werden in dem großen letzten Zusammenbruch der nächtlichen Feste!
Jetzt wartete er auf seinen Spargel, in Erinnerungen versunken, weit weg von diesem Saal, in dem das hektische Treiben unaufhörlich zunahm. In einem breiten Spiegel gegenüber hatte er sein Bild erblickt und war überrascht. Das Alter nagte noch längst nicht an seiner kleinen Person, mit seinen fünfzig Jahren schien er kaum erst achtunddreißig und war noch genauso mager und lebhaft wie als junger Mann. Mit den Jahren hatte sein dunkles, eingefallenes Kasperpuppengesicht mit der spitzen Nase und den kleinen leuchtenden Augen sogar gewonnen, hatte den Reiz dieser andauernden, so geschmeidigen und unternehmungslustigen Jugend angenommen; in seinem buschigen Haar schimmerte noch kein weißes Härchen. Und er konnte nicht umhin, sich seiner Ankunft in Paris am Tage nach dem Staatsstreich15 zu entsinnen, als er an einem Winterabend mit leeren Taschen und ausgehungert auf dem Pflaster lag und einen wahren Anfall von Begierden zu befriedigen hatte. Ach, dieser erste Streifzug durch die Straßen! Noch ehe er seine Koffer ausgepackt, hatte er das Verlangen verspürt, sich mit seinen schiefgelaufenen Stiefeln und seinem speckigen Überzieher in die Stadt zu stürzen, um sie zu erobern! Seit diesem Abend war er oft sehr hoch gestiegen, ein Strom von Millionen war durch seine Hände geflossen, ohne daß ihm jemals das Glück wie ein Sklave gehört hatte, wie ein Ding, über das man verfügt, das man unter Verschluß hält, lebendig und greifbar. Immer hatten die Lüge, der Schein seine Kassen bewohnt, die sich durch unsichtbare Löcher ihres Goldes zu entleeren schienen. Nun lag er wieder auf der Straße wie in der fernen Zeit des Aufbruchs, ebenso jung, ebenso ausgehungert, immer noch unbefriedigt und gequält von dem gleichen Verlangen nach Genüssen und Eroberungen. Er hatte von allem gekostet, und er hatte sich nicht satt gegessen, da er, wie er glaubte, weder Gelegenheit noch Zeit gehabt hatte, tief genug in die Menschen und in die Dinge hineinzubeißen. In dieser Stunde empfand er das ganze Elend, wieder auf der Straße zu liegen und weniger zu sein als ein Anfänger, den wenigstens die Illusion und die Hoffnung aufrecht gehalten hätten. Und ein fieberhaftes Verlangen packte ihn, alles von vorn anzufangen, um alles zurückzuerobern, höher zu steigen, als er je gestiegen war, endlich der eroberten Stadt den Fuß auf den Nacken zu setzen. Nicht mehr den lügnerischen Reichtum der Fassade wollte er, sondern das dauerhafte Gebäude des Vermögens, das wahre Königtum des Goldes, das auf vollen Säcken thront!
Mosers kreischende hohe Stimme, die sich erneut vernehmen ließ, lenkte Saccard einen Augenblick von seinen Überlegungen ab.
»Die mexikanische Expedition16 kostet im Monat vierzehn Millionen, Thiers17 hat es nachgewiesen ... Und man muß wirklich blind sein, um nicht zu sehen, daß in der Kammer die Mehrheit ins Wanken gebracht worden ist. Auf der Linken sitzen jetzt schon mehr als dreißig. Der Kaiser selber begreift sehr wohl, daß die absolute Macht unmöglich wird, denn er macht sich ja zum Verkünder der Freiheit.«
Pillerault antwortete nicht mehr und begnügte sich mit einem verächtlichen Grinsen.
»Ja, ja, ich weiß, die Marktlage scheint Ihnen stabil, die Geschäfte gehen. Aber warten Sie nur das Ende ab ... Sehen Sie mal, in Paris hat man zu viel abgerissen und zu viel wieder aufgebaut! Die großen Bauten haben die Ersparnisse aufgebraucht. Und was die mächtigen Kreditinstitute betrifft, die Ihnen so blühend vorkommen, so warten Sie ab, bis eines von ihnen zusammenkracht – dann werden Sie sehen, wie alle anderen hinterherpurzeln ... Ganz davon zu schweigen, daß das Volk aufbegehrt. Diese Internationale Arbeiterassoziation18, die man jetzt gegründet hat, um die Lage der Arbeiter zu verbessern, erschreckt mich persönlich sehr. Es gibt in Frankreich eine Protestbewegung, eine revolutionäre Stimmung, die von Tag zu Tag zunimmt ... Ich sage Ihnen, da ist der Wurm drin. Alles wird zum Teufel gehen.«
Alle protestierten laut und heftig. Dieser verdammte Moser hatte es ohne Frage wieder mit der Leber. Aber Moser selbst blickte beim Sprechen unverwandt zum Nebentisch, an dem Mazaud und Amadieu in dem ringsum herrschenden Lärm ganz leise weiter plauderten. Allmählich geriet der ganze Saal über diese lang andauernden vertraulichen Gespräche in Unruhe. Was hatten sie sich bloß zu sagen, daß sie so flüsterten? Zweifellos erteilte Amadieu Orders und bereitete einen Coup vor. Seit drei Tagen gingen böse Gerüchte über die Arbeiten am Suezkanal19 um. Moser blinzelte mit den Augen und senkte ebenfalls die Stimme.
»Sie wissen doch, die Engländer wollen verhindern, daß man dort unten arbeitet. Das könnte leicht Krieg bedeuten.«
Diesmal war Pillerault durch die Ungeheuerlichkeit der Nachricht selber erschüttert. Das war ja unglaublich, und sogleich flog das Wort von Tisch zu Tisch und erlangte die Kraft einer Gewißheit: England habe ein Ultimatum gestellt und die sofortige Einstellung der Arbeiten am Suezkanal gefordert. Amadieu sprach mit Mazaud offensichtlich nur darüber und erteilte ihm die Order, alle seine Suez-Aktien zu verkaufen. Panisches Stimmengemurmel erfüllte die mit Fettgerüchen geschwängerte Luft inmitten des anschwellenden Tellergeklappers. Die Aufregung erreichte ihren Höhepunkt, als plötzlich ein Gehilfe des Wechselmaklers hereinkam, der kleine Flory, ein Bursche mit zartem Gesicht, das unter einem dichten kastanienbraunen Bart verschwand. Er stürzte zum Chef, übergab ihm einen Packen Zettel, die er in der Hand hatte, und flüsterte ihm etwas ins Ohr.
»Schön!« antwortete Mazaud nur und ordnete die Zettel in sein Handbuch ein.
Dann zog er seine Uhr.
»Gleich zwölf! Sagen Sie Berthier, daß er auf mich warten soll. Und seien Sie selbst da, gehen Sie hoch und holen Sie die Depeschen.«
Als Flory gegangen war, nahm Mazaud sein Gespräch mit Amadieu wieder auf, zog weitere Zettel aus seiner Tasche und legte sie neben seinen Teller auf das Tischtuch; alle Augenblicke beugte sich ein Kunde im Vorbeigehen zu ihm nieder und sagte ihm ein Wort, das er schnell zwischen zwei Bissen auf einen der Zettel schrieb. Die Falschmeldung, die weiß Gott woher gekommen, aus dem Nichts entstanden war, schwoll an wie eine Gewitterwolke.
»Sie verkaufen, nicht wahr?« fragte Moser Salmon.
Aber dessen stummes Lächeln war so vielsagend verschmitzt, daß Moser ängstlich blieb und jetzt an diesem englischen Ultimatum zweifelte, von dem er nicht einmal wußte, daß er selber es erfunden hatte.
»Ich kaufe soviel, wie man will«, schloß Pillerault mit der eitlen Tollkühnheit eines Spekulanten, der keine Methode hat.
Die Schläfen erhitzt vom Rausch des Börsenspiels, das dieser lärmende Abschluß des Mittagessens in dem engen Saal aufpeitschte, hatte sich Saccard entschlossen, seinen Spargel zu essen, während er sich erneut über Huret aufregte, mit dem er nicht mehr rechnete. Schon wochenlang zögerte er, der sonst so entschlußfreudig war, hin und her gerissen von der Ungewißheit. Er verspürte zwar die gebieterische Notwendigkeit, von vom anzufangen, und er hatte zunächst von einem ganz neuen Leben geträumt, in der Verwaltungsspitze oder in der Politik. Warum sollte ihn das Corps législatif20 nicht in den Ministerrat bringen, wie seinen Bruder? Was ihm an der Spekulation mißfiel, war die fortwährende Unbeständigkeit, die hohen Summen, die so schnell verloren wie gewonnen waren: nie hatte er sich, ohne jemand etwas zu schulden, auf einer wirklichen Million ausruhen können. Und in dieser Stunde, da er sein Gewissen erforschte, sagte er sich, daß er vielleicht zu leidenschaftlich sei für diese Schlacht des Geldes, die soviel Kaltblütigkeit erforderte. Das mußte es sein, weshalb er nach einem so außergewöhnlichen Leben des Luxus und der Geldverlegenheit mit leeren Händen dastand, ausgebrannt von diesen zehn Jahren fürchterlicher Grundstücksschachereien im neuen Paris, bei denen so viele andere, die schwerfälliger waren als er, Riesenvermögen zusammengescharrt hatten. Ja, vielleicht hatte er sich über seine wirklichen Fähigkeiten getäuscht, vielleicht würde er bei seiner Unternehmungslust und seinem glühenden Glauben auf der politischen Bühne mit einem Schlag triumphieren. Alles würde von der Antwort seines Bruders abhängen. Wenn der ihn abwies, ihn in den Schlund der Spekulation zurückstieß, dann sollten er und die anderen ihn kennenlernen, dann würde er den großen Coup wagen, über den er noch mit niemandem gesprochen hatte, das Riesengeschäft, von dem er seit Wochen träumte und das ihn selber erschreckte, so groß war es und dazu angetan, die Welt in Aufruhr zu versetzen, ob es nun gelang oder nicht.
Pillerault hatte die Stimme erhoben.
»Mazaud, ist Schlossers Ausschluß von der Börse nun perfekt?«
»Ja«, antwortete der Wechselmakler, »heute wird es angeschlagen ... Was wollen Sie? Das ist immer ärgerlich, aber ich hatte sehr beunruhigende Auskünfte erhalten, und dabei habe ich Schlosser als erster diskontiert. Von Zeit zu Zeit muß eben reiner Tisch gemacht werden.«
»Man hat mir versichert«, sagte Moser, »daß Ihre Kollegen Jacoby und Delarocque mit runden Summen dabei waren.«
Der Makler vollführte eine unbestimmte Gebärde.
»Ach was! Etwas wird immer verheizt ... Dieser Schlosser hat wohl zu einer Bande gehört; jetzt ist er frei und kann in Berlin oder in Wien die Börsen absahnen.«
Saccard hatte die Augen auf Sabatani gerichtet, dessen geheime Verbindung mit Schlosser ihm ein Zufall offenbart hatte: die beiden spielten das bekannte Spiel, der eine spekulierte auf die Hausse21, der andere auf die Baisse22 ein und desselben Wertpapiers; der Verlierer wurde am Gewinn des anderen beteiligt und hatte dann nur zu verschwinden. Aber der junge Mann bezahlte ruhig die Rechnung für das erlesene Mittagsmahl, das er eingenommen hatte. Dann ging er mit der einschmeichelnden Anmut eines Orientalen mit italienischem Einschlag zu Mazaud, dessen Kunde er war, und drückte ihm die Hand. Er beugte sich herab und erteilte eine Order, die jener auf einen Zettel schrieb.
»Er verkauft seine Suez-Aktien«, murmelte Moser.
Und krank vor Zweifel, fragte er ganz laut, einem Bedürfnis nachgebend:
»Was denken Sie denn über Suez?«
Schweigen trat ein in dem Stimmengewirr, alle Köpfe an den Nebentischen wandten sich um. Diese Frage faßte die wachsende Unruhe und Besorgnis zusammen. Aber der Rücken Amadieus, der Mazaud nur eingeladen hatte, um ihm einen seiner Neffen zu empfehlen, blieb undurchdringlich und hatte nichts zu sagen, während der Makler, den die Verkaufsorders, die er erhielt, langsam in Staunen versetzten, nur den Kopf schüttelte, von Berufs wegen an Diskretion gewöhnt.
»Suez steht ausgezeichnet!« erklärte in seinem singenden Tonfall Sabatani, der noch einen Umweg machte und Saccard zuvorkommend die Hand drückte, bevor er ging.
Und Saccard fühlte noch einen Augenblick diesen weichen, zerfließenden, fast weibischen Händedruck. In seinem Schwanken, welchen Weg er einschlagen sollte, wie sein Leben neu aufzubauen war, schimpfte er alle Anwesenden einen Haufen Spitzbuben. Ach, wenn man ihn dazu zwänge, wie würde er sie hetzen, wie würde er sie rupfen, die zittrigen Mosers, die großmäuligen Pilleraults, diese Salmons, die hohler als Kürbisse waren, und diese Amadieus, deren ganzes Genie im Erfolg bestand! Das Teller- und Gläsergeklapper hatte wieder eingesetzt, die Stimmen wurden heiser, die Türen wurden heftiger zugeschlagen in der Eile, die alle verzehrte, weil sie dabeisein wollten, wenn es einen Börsenkrach wegen des Suezkanals geben sollte. Und durch das Fenster sah Saccard mitten auf dem Platz, den Droschken durchfurchten und Fußgänger verstopften, die sonnenbeschienenen Stufen der Börse, die nun wie übersät von einem unaufhörlichen Strom menschlicher Insekten waren, korrekt in Schwarz gekleideten Herren, die nach und nach den Säulengang füllten, während hinter den Gittern verschwommen ein paar Frauen auftauchten, die unter den Kastanienbäumen herumlungerten.
Plötzlich ließ ihn in dem Augenblick, da er den Käse anschnitt, den er bestellt hatte, eine rauhe Stimme den Kopf heben.
»Ich bitte Sie um Entschuldigung, mein Lieber, ich konnte wirklich nicht eher kommen.«
Da war endlich Huret, ein Normanne aus dem Calvados23, ein schwerfälliger großer Kerl, der den Eindruck eines gerissenen Bauern machte, der den einfachen Mann spielt. Sogleich ließ er sich irgend etwas bringen, das Tagesgericht und dazu eine Gemüsebeilage.
»Na, was ist?« fragte Saccard, der sich zusammennahm, trocken.
Aber der andere beeilte sich nicht, betrachtete ihn als schlauer und vorsichtiger Mann. Als er dann zu essen begann, schob er den Kopf vor und senkte die Stimme.
»Also, ich bin bei dem großen Mann gewesen ... ja, bei ihm zu Hause, heute früh ... Oh, er meint es sehr gut, sehr gut mit Ihnen.«
Er hielt inne, trank ein großes Glas Wein und stopfte sich wieder eine Kartoffel in den Mund.
»Na und?«
»Ja, mein Lieber, die Sache ist die ... Er will für Sie gern alles tun, was er kann, er wird für Sie eine sehr hübsche Stellung finden, aber nicht in Frankreich ... Zum Beispiel den Gouverneursposten in einer unserer Kolonien, in einer von den guten. Da wären Sie wirklich Ihr eigener Herr, ein richtiger kleiner Fürst.«
Saccard war leichenblaß geworden.
»Sagen Sie mal, das soll wohl ein Scherz sein? Sie machen sich wohl lustig über mich? Warum nicht gleich in die Verbannung? ... Er will mich also loswerden. Soll er sich bloß hüten, daß ich ihm am Ende nicht ernstlich Schwierigkeiten mache!«
Huret suchte ihn mit vollem Mund zu beschwichtigen.
»Aber, aber, man will doch bloß Ihr Bestes, lassen Sie uns nur machen.«
»Mich ausschalten lassen, nicht wahr? Hören Sie mal! Vorhin war hier die Rede davon, daß das Kaiserreich bald keinen Fehler mehr ausgelassen hat. Ja, der Krieg in Italien24, Mexiko, die Haltung gegenüber Preußen25. Ehrenwort, das ist die Wahrheit! ... Ihr werdet noch so viele Dummheiten und Verrücktheiten anstellen, daß sich ganz Frankreich erhebt, um euch rauszuschmeißen.«
Da wurde der Abgeordnete, die getreue Kreatur des Ministers, ganz bleich und schaute unruhig um sich.
»Aber erlauben Sie mal, erlauben Sie, da kann ich Ihnen nicht folgen ... Rougon ist ein ehrenwerter Mann, es gibt keine Gefahr, solange er dabei ist ... Nein, reden Sie nicht weiter, Sie verkennen ihn, das muß ich Ihnen sagen.«
Saccard unterbrach ihn heftig und stieß zwischen den Zähnen hervor:
»Also gut, lieben Sie ihn, kochen Sie Ihr Süppchen zusammen ... Ja oder nein: will er mich hier in Paris unterstützen?«
»In Paris, niemals!«
Ohne ein weiteres Wort erhob sich Saccard und rief den Kellner, um zu bezahlen, während Huret, der seine Zornesausbrüche kannte, in aller Ruhe weiter große Bissen Brot hinunterschlang und ihn aus Furcht vor einem Skandal gehen ließ. Aber in diesem Augenblick entstand im Saal eine große Aufregung.
Gundermann war hereingekommen, der Bankkönig, der Herr der Börse und der Welt, ein Mann von sechzig Jahren, dessen riesiger Kahlkopf mit der dicken Nase und den hervortretenden runden Augen ungeheuren Starrsinn und große Müdigkeit ausdrückte. Nie ging er zur Börse, tat sogar so, als schickte er nicht einmal einen offiziellen Vertreter dorthin; auch speiste er nie in einem öffentlichen Lokal zu Mittag. Nur hin und wieder geschah es, wie an diesem Tag, daß er sich im Restaurant Champeaux zeigte, wo er sich an einen Tisch setzte, um sich nichts weiter als ein Glas Vichy-Wasser auf einem Teller servieren zu lassen. Da er seit zwanzig Jahren an einer Magenkrankheit litt, ernährte er sich ausschließlich von Milch.
Sofort war das ganze Personal in Aufruhr, alle rannten, um das Glas Wasser zu bringen, und alle anwesenden Gäste lagen vor ihm auf dem Bauch. Moser betrachtete demütig diesen Menschen, der die Geheimnisse kannte, der nach seinem Gutdünken Hausse oder Baisse machte wie der liebe Gott Donner und Blitz. Selbst Pillerault grüßte ihn, da er nur auf die unwiderstehliche Kraft der Milliarde vertraute. Es war halb eins; Mazaud ließ Amadieu kurzerhand stehen und verbeugte sich vor dem Bankier, von dem er manchmal mit einer Order beehrt wurde. Viele Börsenbesucher, die gerade gehen wollten, blieben stehen, umringten den Gott, machten ihm inmitten der Unordnung beschmutzter Tischtücher mit achtungsvoll gekrümmtem Rücken den Hof und sahen ihm ehrfürchtig zu, wie er mit zitternder Hand das Glas Wasser nahm und an die farblosen Lippen führte.
Vor einiger Zeit, bei den Spekulationen um die Grundstücke in der Ebene von Monceau, hatte es zwischen Saccard und Gundermann Auseinandersetzungen, ja sogar ein richtiges Zerwürfnis gegeben. Sie harmonierten nicht miteinander, der eine war leidenschaftlich und ein Genußmensch, der andere nüchtern und von kalter Logik. Daher wollte Saccard, wutentbrannt und zudem erbittert über diesen triumphalen Auftritt, gehen, als ihn der andere ansprach.
»Sagen Sie mal, mein Bester, ist das wahr? Sie ziehen sich von den Geschäften zurück? Glauben Sie mir, Sie tun gut daran, es ist besser so.«
Das war für Saccard ein Peitschenhieb mitten ins Gesicht. Er streckte seine kleine Gestalt und versetzte klar und messerscharf:
»Ich gründe eine Kreditbank mit einem Stammkapital von fünfundzwanzig Millionen; ich gedenke, Sie bald zu besuchen.«
Und er ging hinaus, ließ die hitzige Atmosphäre des Saales hinter sich, in dem einer den anderen anrempelte, um nicht die Eröffnung der Börse zu versäumen. Ach, endlich Erfolg haben! Wieder all diesen Leuten, die ihm den Rücken kehrten, den Fuß auf den Nacken setzen, mit diesem König des Goldes wie mit seinesgleichen kämpfen und ihn vielleicht eines Tages zu Boden strecken! Er war noch keineswegs entschlossen, sein großes Geschäft zu wagen, und selber überrascht über diesen Satz, den ihm das Verlangen zu antworten entlockt hatte. Aber konnte er das Glück anderswo versuchen, jetzt, da sein Bruder ihn im Stich ließ, die Dinge und die Menschen ihn verletzten, um ihn wieder in den Kampf zu werfen, wie man den blutenden Stier in die Arena zurückführt?
Zitternd verharrte er einen Augenblick am Rande des Bürgersteigs. Zu dieser betriebsamen Stunde schien sich das Leben von Paris auf diesen Platz zu ergießen, zentral gelegen zwischen der Rue Montmartre und der Rue Richelieu, den beiden verstopften Verkehrsadern, die die Menge wie Treibsand mit sich führen. Aus den vier Straßen, die von allen Seiten auf den Platz münden, ergoß sich ein ununterbrochener Wagenstrom und durchpflügte das Pflaster inmitten des strudelnden Gewühls der Fußgänger. Unaufhörlich rissen die beiden Droschkenreihen an der Haltestelle längs den Gittern auseinander und schlossen sich wieder, während in der Rue Vivienne die Viktorias26 der Remisiers eine dichte lange Reihe bildeten, überragt von den Kutschern, die sich, die Zügel in der Hand, bereit hielten, beim ersten Befehl auf die Pferde loszupeitschen. Die Stufen und die Vorhalle überschwemmte ein schwarzes Gewimmel von Gehröcken, und von der Kulisse, die schon unter der Uhr zusammengetreten war und ihre Arbeit aufgenommen hatte, stieg der Lärm von Angebot und Nachfrage, dieses Rauschen der Spekulationsflut, sieghaft über das Grollen der Stadt empor. Passanten wandten den Kopf aus Furcht vor dem, was hier geschah, und zugleich in dem Verlangen, das Geheimnis dieser Finanzoperationen zu ergründen, in die nur wenige französische Geister eindringen, dieses unerklärliche plötzliche Entstehen und Zusammenbrechen von Vermögen inmitten dieser wilden Gebärden und barbarischen Schreie. Und am Rande der Gosse, durch die fernen Stimmen betäubt, von den eiligen Leuten angerempelt, träumte Saccard wieder einmal vom Königtum des Goldes in diesem Stadtviertel aller Fieber, in dessen Mitte wie ein mächtiges Herz von eins bis drei die Börse schlägt.
Aber seit seinem Ruin hatte er nicht mehr gewagt, die Börse wieder aufzusuchen; und auch an diesem Tag hielt ihn ein Gefühl verletzter Eitelkeit, hielt ihn die Gewißheit, dort als Besiegter aufgenommen zu werden, davor zurück, die Stufen hinanzusteigen. Und so wie ein aus dem Schlafzimmer seiner Geliebten vertriebener Liebhaber diese nur noch mehr begehrt, auch wenn er sie zu verachten glaubt, kehrte er wie unter einem Zwang hierher zurück, machte er unter nichtigen Vorwänden eine Runde durch den Säulengang, bummelte durch den Garten und schlenderte im Schatten der Kastanienbäume umher. Auf diesem staubigen Square27 ohne Rasen und Blumen, wo auf den Bänken zwischen den Bedürfnisanstalten und den Zeitungsständen verdächtige Spekulanten lungerten, wo barhäuptige Frauen aus dem Viertel ihre Säuglinge stillten, gab sich Saccard als unbeteiligter Spaziergänger, blickte empor, spähte umher, von dem wütenden Gedanken erfüllt, daß er das Gebäude belagerte, daß er es mit einem engen Ring umschloß, um hier eines Tages wieder als Triumphator einzuziehen.
Um die rechte Ecke herum drang er bis zu den Bäumen gegenüber der Rue de la Banque vor und stieß sogleich auf die Winkelbörse für die vom Kurszettel gestrichenen Wertpapiere, auf die »Naßfüßler«, wie diese Spekulanten des Trödels mit spöttischer Verachtung genannt wurden, die unter freiem Himmel im Schlamm der Regentage die Aktienkurse der liquidierten Gesellschaften notieren. Ein Haufen Juden, schmutzig gekleidet, bildete dort eine lärmende Gruppe, lauter fettige, glänzende Gesichter, dürre Profile wie bei gefräßigen Vögeln, eine ungewöhnliche Ansammlung von typischen Nasen, dicht bei dicht, als wollten sie sich mit kehligen Rufen auf eine Beute stürzen oder sich untereinander verschlingen. Als er vorüberging, bemerkte er ein wenig abseits einen dicken Mann, der behutsam zwischen seinen großen schmutzigen Fingern einen Rubin in die Höhe hielt, um ihn in der Sonne zu prüfen.
»Sieh mal an. Busch! ... Da fällt mir ein, daß ich zu Ihnen hinauf wollte.«
Busch, der in der Rue Feydeau, Ecke Rue Vivienne ein Geschäftsbüro führte, war ihm zu wiederholten Malen in schwierigen Lagen von großem Nutzen gewesen. Er prüfte weiter verzückt das Feuer des Edelsteins, das breite, ausdruckslose Gesicht emporgerichtet, die großen grauen Augen wie erloschen in dem grellen Licht; man sah seine zu einem Strick zusammengedrehte weiße Halsbinde, die er immer trug, und sein gebraucht gekaufter Gehrock, der früher einmal prachtvoll gewesen sein mußte, jetzt aber unsagbar abgewetzt und fleckig war, reichte ihm bis an die fahlen Haare, die in spärlichen, widerspenstigen Strähnen von seinem kahlen Schädel herabhingen. Das Alter seines von der Sonne ausgebleichten, von den Regengüssen verwaschenen Hutes war nicht mehr zu bestimmen.
Endlich kam er aus seiner Verzückung wieder zu sich.
»Ach, Herr Saccard! Sie machen hier wohl einen kleinen Spaziergang?«
»Ja ... Da ist ein Brief in russischer Sprache von einem russischen Bankier, der sich in Konstantinopel niedergelassen hat, und ich dachte, daß Ihr Bruder ihn mir übersetzen könnte.«
Busch, der in der rechten Hand unbewußt und zärtlich noch immer den Rubin hin und her bewegte, gab ihm die linke und sagte, die Übersetzung würde ihm noch am gleichen Abend zugeschickt. Aber Saccard erklärte, es handele sich nur um zehn Zeilen.
»Ich gehe mal hinauf, Ihr Bruder kann es mir dann gleich vorlesen ...«
Er wurde unterbrochen, weil Frau Méchain hinzutrat, ein Riesenweib, das den Stammbesuchern der Börse wohlbekannt war, eine jener wütenden, erbärmlichen Spekulantinnen, die ihre fetten Finger in allen möglichen dunklen Geschäften haben. Ihr gedunsenes rotes Vollmondgesicht mit den winzigen blauen Augen, der verschwindend kleinen Nase, dem kleinen Mund, aus dem eine flötende Kinderstimme kam, quoll unter dem alten malvenfarbigen Hut hervor, dessen dunkelrote Bänder schief gebunden waren; der riesige Busen und der Wasserbauch ließen das ausgebleichte, völlig verdreckte grüne Popelinekleid in den Nähten krachen. Am Arm hatte sie eine uralte schwarze Ledertasche, groß und geräumig wie ein Koffer, von der sie sich nie trennte. An diesem Tag war die Tasche zum Platzen voll und so schwer, daß sie Frau Méchain zur Seite zog wie einen schiefgewachsenen Baum.
»Da sind Sie ja«, sagte Busch, der offenbar auf sie gewartet hatte.
»Ja, und ich habe die Papiere aus Vendôme bekommen, hier bringe ich sie Ihnen.«
»Schön! Gehen wir zu mir ... Hier ist heute nichts zu machen.«
Saccard hatte einen flackernden Blick auf die große Ledertasche geworfen. Er wußte, daß darin zwangsläufig die vom Kurszettel gestrichenen Papiere, die Aktien der bankrotten Gesellschaften, verschwanden, mit denen die »Naßfüßler« noch spekulieren, Aktien von fünfhundert Francs, die sie sich für zwanzig, für zehn Sous streitig machen in der unsicheren Hoffnung auf ein unwahrscheinliches Wiederanziehen des Kurses oder die sie zweckmäßigerweise gleich als strafbare Ware handeln, um sie mit Gewinn den Bankrotteuren abzulassen, die ihre Passiva28 aufblähen wollen. In den mörderischen Schlachten der Finanzwelt war die Méchain der Rabe, der den marschierenden Armeen folgt; nicht eine Gesellschaft, nicht ein großes Kreditinstitut brach zusammen, ohne daß sie mit ihrer Tasche erschien, ohne daß sie, selbst in den glücklichen Stunden der triumphierenden Emissionen29, die Leichen in der Luft witterte; denn sie wußte wohl, daß die Niederlage unabwendbar war, daß der Tag des Gemetzels kommen würde, an dem es Tote zu fressen und Wertpapiere für umsonst im Schlamm und im Blut aufzulesen gab. Und ihm, der sein großes Bankprojekt erwog, schauderte leicht; eine Vorahnung durchzuckte ihn beim Anblick dieser Tasche, dieses Beinhauses der entwerteten Aktien, in dem alles aus der Börse gefegte schmutzige Papier verschwand.
Als Busch die alte Frau mitnehmen wollte, hielt ihn Saccard zurück.
»Dann kann ich also hinaufgehen und treffe Ihren Bruder bestimmt an?«
Die Augen des Juden blickten mit einemmal sanft und drückten eine unruhige Überraschung aus.
»Meinen Bruder, aber sicher! Wo soll er denn sonst sein?«
»Sehr schön, bis gleich!«
Und Saccard, der die beiden gehen ließ, setzte entlang den Bäumen seinen langsamen Gang zur Rue Notre-Dame-des-Victoires fort. Auf dieser Seite des Platzes herrscht besonders reger Verkehr; Geschäfte und Etagenfirmen, deren goldene Schilder in der Sonne aufflammten, nehmen die ganze Front ein. Markisen knatterten an den Balkonen, eine Familie aus der Provinz stand offenen Mundes am Fenster einer Pension. Mechanisch hob Saccard den Kopf und betrachtete diese Leute, deren Verblüffung ihn lächeln ließ und ihn in dem Gedanken bestärkte, daß es in der Provinz immer Aktionäre geben würde. Hinter seinem Rücken hielt der Aufruhr der Börse, das Rauschen einer fernen Flut an, verfolgte ihn wie eine Drohung, ihn einzuholen und zu verschlingen.
Aber eine neuerliche Begegnung hielt ihn fest.
»Wie, Jordan, Sie an der Börse?« rief er und drückte einem großen braunhaarigen jungen Mann mit einem kleinen Schnurrbärtchen und entschlossener, eigensinniger Miene die Hand.
Jordan, dessen Vater, ein Bankier aus Marseille, seinerzeit nach unseligen Spekulationen Selbstmord begangen hatte, klapperte seit zehn Jahren, besessen von der Literatur, in einem tapferen Kampf gegen das graue Elend das Pariser Pflaster ab. Ein Vetter von ihm, der in Plassans ansässig war und dort Saccards Familie kannte, hatte ihn seinerzeit Saccard empfohlen, als dieser in seinem Haus am Parc Monceau ganz Paris empfing.
»Oh, ich an der Börse, niemals!« erwiderte der junge Mann mit einer heftigen Gebärde, als wollte er die tragische Erinnerung an seinen Vater verscheuchen.
Dann lächelte er wieder.
»Sie wissen doch, daß ich mich verheiratet habe ... Ja, mit einer früheren Spielgefährtin. Wir hatten uns zu einer Zeit verlobt, da ich noch reich war, und sie hat es sich in den Kopf gesetzt, trotz allem den armen Teufel zu wollen, der ich geworden bin.«
»Ganz recht, ich habe ja die Anzeige bekommen«, sagte Saccard. »Und stellen Sie sich vor, ich stand vor Jahren in Verbindung mit Ihrem Schwiegervater, Herrn Maugendre, als er seine Zeltplanenfabrik in La Villette hatte. Er muß sich dabei ein hübsches Vermögen verdient haben.«
Dieses Gespräch fand in der Nähe einer Bank statt, und Jordan unterbrach Saccard, um ihm einen dicken, untersetzten Herrn von militärischem Aussehen vorzustellen, der dort saß und mit dem er zuvor geplaudert hatte.
»Hauptmann Chave, ein Onkel meiner Frau ... Frau Maugendre, meine Schwiegermutter, ist eine Chave aus Marseille.«
Der Hauptmann hatte sich erhoben, und Saccard begrüßte ihn. Er kannte dieses apoplektische Gesicht mit dem vom Tragen des Uniformkragens steif gewordenen Hals vom Sehen, Chave war einer jener kleinen Spekulanten in Kassageschäften, denen man an diesem Ort mit Sicherheit täglich von eins bis drei begegnen konnte. Sie betreiben das Börsenspiel mit Kleingewinnst, einem fast sicheren Gewinn von fünfzehn bis zwanzig Francs, den man am gleichen Börsentag realisiert.
Um seine Anwesenheit zu erklären, hatte Jordan mit seinem gutmütigen Lächeln hinzugefügt:
»Mein Onkel ist ein wilder Börsenjobber, dem ich nur manchmal im Vorbeigehen die Hand drücke.«
»Freilich«, sagte der Hauptmann schlicht, »ich muß schon spekulieren, denn die Regierung läßt mich ja mit ihrer Pension verhungern.«
Darauf fragte Saccard den jungen Mann, der ihn ob seines Lebensmutes interessierte, wie es mit der Schriftstellerei vorangehe. Und Jordan, der immer vergnügter wurde, erzählte von der Einrichtung seines armseligen Haushalts im fünften Stock eines Hauses in der Avenue de Clichy; denn die Maugendres, die kein Zutrauen zu einem Dichter hatten, glaubten mit ihrer Einwilligung in die Ehe schon viel getan zu haben und hatten ihrer Tochter nichts mitgegeben unter dem Vorwand, daß sie nach dem Tode der Eltern sowieso das unangetastete, durch Ersparnisse fett gewordene Vermögen bekommen würde. Nein, die Literatur ernähre ihren Mann nicht. Er plante einen Roman, fand aber keine Zeit zum Schreiben und hatte sich gezwungenermaßen auf den Journalismus verlegt, wo er alles hinpfuschte, was in sein Fach fiel, vom Lokalteil bis zur Gerichtsberichterstattung und sogar bis zur Rubrik »Vermischtes«.
»Na schön!« sagte Saccard. »Wenn ich meine große Sache steigen lasse, kann ich Sie vielleicht brauchen. Besuchen Sie mich doch mal.«
Nachdem er gegrüßt hatte, bog er hinter die Börse ab. Dort endlich hörte das ferne Stimmengewirr, hörte das Gebell des Börsenspiels auf und war nur noch ein unbestimmtes Geräusch, das im Grollen des Platzes unterging. Auch auf dieser Seite waren die Stufen von Menschen überflutet, aber das Maklerzimmer, dessen rote Wandbespannung durch die hohen Fenster zu sehen war, hielt den Krach aus dem großen Saal von dem Säulengang fern, wo sich die feinen, die reichen Spekulanten einzeln oder in kleinen Gruppen bequem in den Schatten gesetzt und so die weite, nach drei Seiten offene Vorhalle in eine Art Klub verwandelt hatten. Diese Rückseite des Gebäudes war ein wenig wie die Kehrseite eines Theaters, der Bühneneingang mit der anrüchigen, verhältnismäßig ruhigen Straße, jener Rue Notre-Dame-des-Victoires, in der sich Weinhandlungen, Cafés, Braustuben und Schenken aneinanderreihten, die von einer besonderen, seltsam gemischten Kundschaft wimmelten. Auch an den Firmenschildern erkannte man das Unkraut, das am Rande der benachbarten großen Kloake in die Höhe schoß: übel beleumdete Versicherungsgesellschaften, Börsenzeitungen, die ihr Gewerbe wie Straßenraub betrieben, Gesellschaften, Banken, Agenturen, Büros, die ganze Reihe bescheidener Halsabschneider, die sich in Butiken oder Zwischengeschossen von Handbreite eingerichtet hatten. Auf den Bürgersteigen, mitten auf der Straße, überall lungerten Männer herum und lagen, gleich Räubern am Waldessaum, auf der Lauer.
Saccard war innerhalb der Gitter stehengeblieben und schaute mit dem scharfen Blick eines Heerführers, der den Platz, den er im Sturm nehmen will, von allen Seiten her prüft, auf die Tür, die in das Maklerzimmer führte. Da trat ein großer Kerl aus einer Schenke, kam über die Straße und verbeugte sich sehr tief.
»Ach, Herr Saccard, haben Sie nichts für mich? Ich habe den Crédit Mobilier30 für immer verlassen und suche eine Stellung.«
Jantrou, ein ehemaliger Professor, war wegen einer undurchsichtigen Geschichte von Bordeaux nach Paris gekommen. Er hatte die Universität verlassen müssen; heruntergekommen, aber ein hübscher Bursche mit seinem fächerförmigen schwarzen Bart und seiner frühzeitigen Glatze, überdies gebildet, intelligent und liebenswürdig, war er mit ungefähr achtundzwanzig Jahren an der Börse gelandet, hatte sich dort zehn Jahre lang als Remisier durchgeschlagen, sich in Verruf gebracht und dabei kaum das für seine Laster notwendige Geld verdient. Und heute, da er gänzlich kahlköpfig war und sich wie eine Dirne härmte, die von ihren Falten den Broterwerb bedroht sieht, wartete er immer noch auf die Gelegenheit, die ihm zum Erfolg, zum Reichtum verhelfen sollte.
Als Saccard ihn so demütig sah, erinnerte er sich voller Bitternis an Sabatanis Gruß bei Champeaux: keine Frage, ihm blieben nur die anrüchigen und die verkrachten Existenzen. Aber es fehlte ihm nicht an Achtung vor Jantrous scharfem Verstand, und er wußte wohl, daß man die tapfersten Truppen aus den Verzweifelten zusammenstellt, aus jenen, die alles wagen, weil sie alles zu gewinnen haben. Er gab sich wohlwollend.
»Eine Stellung?« wiederholte er. »Nun, da läßt sich vielleicht was machen. Besuchen Sie mich mal.«
»Rue Saint-Lazare wohnen Sie jetzt, nicht wahr?«
»Ja, Rue Saint-Lazare. Kommen Sie gleich früh.«
Sie plauderten. Jantrou war über die Börse sehr aufgebracht; ein Schurke müsse man sein, um dort Erfolg zu haben, wiederholte er mit dem Groll eines Mannes, der bei seinen Schurkenstreichen kein Glück gehabt hatte. Das war nun vorbei, er wollte etwas anderes versuchen; dank seiner Universitätsbildung und seinen Bekanntschaften in der Gesellschaft, so meinte er, konnte er sich eine schöne Anstellung bei den Behörden verschaffen. Saccard pflichtete ihm mit einem Kopfnicken bei. Und als sie dann die Gitter hinter sich gelassen hatten und auf dem Bürgersteig bis zur Rue Brongniart gegangen waren, erregte ein dunkles Kupee ihr Interesse: mustergültig bespannt, hielt es in dieser Straße, wobei das Pferd zur Rue Montmartre stand. Indes der Rücken des Kutschers hoch oben auf dem Bock in steinerner Unbeweglichkeit verharrte, tauchte ein Frauenkopf, wie sie bemerkten, zweimal hintereinander am Wagenfenster auf und verschwand gleich wieder. Plötzlich beugte er sich heraus und warf einen langen, ungeduldigen Blick hinter sich in Richtung Börse.
»Die Baronin Sandorff«, murmelte Saccard.
Es war ein ganz ungewöhnlicher brauner Kopf mit schwarzen Augen, die unter bläulichen Lidern brannten, ein leidenschaftliches Gesicht mit blutrotem Mund, das nur eine zu lange Nase entstellte. Sie schien sehr hübsch, zu reif für ihre fünfundzwanzig Jahre; sie sah aus wie eine Bacchantin, die sich von den größten Couturiers31 des Kaiserreichs kleiden ließ.
»Ja, die Baronin«, wiederholte Jantrou. »Ich habe sie bei ihrem Vater, dem Grafen de Ladricourt, kennengelernt, als sie noch ein junges Mädchen war. Oh, der war ein wütender Spekulant und von einer empörenden Rohheit! Jeden Morgen holte ich seine Orders ab, und einmal hat er mich beinahe verdroschen. Ich habe ihm nicht nachgeweint, als er an einem Schlaganfall gestorben ist, nachdem er sich durch eine Reihe jämmerlicher Liquidationen32 ruiniert hatte ... Die Kleine mußte sich damals entschließen, den österreichischen Botschaftsrat Baron Sandorff zu heiraten, der fünfunddreißig Jahre älter war als sie und den sie mit ihren feurigen Blicken buchstäblich verrückt gemacht hatte.«
»Ich weiß«, sagte Saccard.
Der Kopf der Baronin war wieder im Kupee verschwunden. Aber gleich darauf erschien er von neuem, glühte noch mehr, und sie verrenkte sich bald den Hals, um in die Ferne auf den Platz zu schauen.
»Sie spekuliert, nicht wahr?«
»Oh, wie eine Irre! An allen Krisentagen kann man sie dort in ihrem Wagen sehen, wie sie auf die Kurse lauert, sich fieberhaft Notizen in ihr Merkbuch macht, Orders erteilt ... Und sehen Sie, auf Massias hat sie gewartet: da geht er zu ihr.«
In der Tat, mit dem Kurszettel in der Hand, rannte Massias zu ihr, so schnell ihn seine kurzen Beine trugen, und sie sahen, wie er sich auf den Wagenschlag des Kupees stützte, den Kopf hineinsteckte und ein großes Palaver mit der Baronin begann. Saccard und Jantrou entfernten sich ein wenig, um nicht bei ihrem Spionieren überrascht zu werden, und als der Remisier zurückkam, immer noch im Laufschritt, riefen sie ihn an. Er warf erst einen Blick zur Seite und vergewisserte sich, daß er nicht gesehen wurde; dann blieb er stehen, ganz außer Atem; sein blühendes Gesicht mit den großen blauen Augen von kindlicher Reinheit war hochrot und trotzdem fröhlich.
»Was sie bloß haben!« rief er. »Suez purzelt auf einmal. Man spricht von einem Krieg mit England. Eine Nachricht, die sie ganz aus dem Häuschen bringt und von der man nicht mal weiß, woher sie stammt ... Ich bitte Sie, Krieg! Wer kann das bloß erfunden haben? Vielleicht ist das auch von ganz allein entstanden ... Richtig wie ein Blitz aus heiterem Himmel.«
Jantrou blinzelte mit den Augen.
»Die Dame beißt immer noch an?«
»Oh, wie wild! Ich bringe Nathansohn ihre Orders.«
Saccard, der das hörte, stellte ganz laut eine Überlegung an.
»Ja richtig! Man hat mir doch erzählt, daß Nathansohn in die Kulisse eingetreten ist.«
»Ein sehr netter Junge, der Nathansohn«, erklärte Jantrou, »er verdient es hochzukommen. Wir sind zusammen beim Crédit Mobilier gewesen ... Und er wird es auch zu etwas bringen, denn er ist Jude. Sein Vater, ein Österreicher, hat sich, glaube ich, als Uhrmacher in Besançon niedergelassen ... Sie müssen wissen, eines Tages hat ihn das da drüben beim Crédit gepackt, als er sah, wie das alles so gedreht wird. Und er hat sich gesagt, daß das gar nicht so schwierig sei, daß man nur einen Raum brauchte und einen Schalter aufmachen müßte; und er hat einen Schalter aufgemacht ... Na und Sie, sind Sie zufrieden, Massias?«
»Oh, zufrieden! Sie habenʼs ja selber mitgemacht, und Sie haben recht, wenn Sie sagen, daß man Jude sein muß. Ist man es nicht, braucht man gar nicht erst zu versuchen dahinterzukommen, man hat eben kein Glück, sondern bloß höllisches Pech ... Ein Hundeberuf! Aber ist man erst mal dabei, bleibt man auch dabei. Und dann habe ich ja noch gute Beine, ich gebe trotz allem die Hoffnung nicht auf.«
Und lachend rannte er wieder los. Es hieß, er sei der Sohn eines mit Schimpf und Schande entlassenen Beamten aus Lyon; nach dem Tode seines Vaters sei er an der Börse gelandet, weil er sein Jurastudium nicht hatte fortsetzen wollen.
Saccard und Jantrou gingen gemächlich in die Rue Brongniart zurück. Dort stand noch immer das Kupee der Baronin, aber die Fenster waren geschlossen, der geheimnisvolle Wagen schien leer zu sein, die Reglosigkeit des Kutschers hatte offenbar noch zugenommen bei diesem endlosen Warten, das oft bis zum letzten Kurswert dauerte.
»Sie ist verteufelt aufreizend«, versetzte Saccard unverblümt. »Ich kann den alten Baron verstehen.«
Jantrou lächelte eigentümlich.
»Oh, dem Baron ist sie, glaube ich, seit langem über. Und er soll sehr knickrig sein, wie man sagt ... Wissen Sie, mit wem sie sich eingelassen hat, um ihre Rechnungen bezahlen zu können, weil die Spekulation nie genug einbringt?«
»Nein.«
»Mit Delcambre.«
»Delcambre, der Generalstaatsanwalt? Dieser große Dürre, der so gelb und so steif ist? ... Na, die möchte ich ja mal zusammen sehen!«
Und die beiden trennten sich, lustig und aufgekratzt, mit einem kräftigen Händedruck, nachdem der eine den andern noch einmal daran erinnert hatte, daß er sich demnächst erlauben würde, ihn zu besuchen.
Als Saccard wieder allein war, wurde er erneut von der lauten Stimme der Börse gepackt, die ihn bei seiner Rückkehr mit dem Eigensinn der Flut umbrandete. Er war um die Ecke gebogen und ging nach der Rue Vivienne zu; er überquerte den Platz auf jener Seite, wo keine Cafés sind und die deshalb so streng wirkt. Er kam an der Handelskammer vorbei, am Postamt und an den großen Werbebüros; seine Betäubung und fieberhafte Erregung nahmen in dem Maße zu, wie er sich wieder der Hauptfassade näherte, und als er einen schrägen Blick auf die Vorhalle werfen konnte, legte er erneut eine Pause ein, als wollte er die Runde um den Säulengang, diese Art leidenschaftlicher Umklammerung, mit der er die Börse umschloß, noch nicht beenden. Dort, wo die Straße breiter wurde, herrschte reges Treiben: eine Woge von Gästen überflutete die Cafés, die Konditorei wurde nicht mehr leer, vor den Schaufenstern ballte sich die Menge, besonders vor der Auslage eines Goldschmiedes, die im Glanz kostbarer Silberarbeiten erstrahlte. Und auf den Kreuzungen an den vier Ecken schien sich der Strom der Droschken und Fußgänger, der aus den Straßen quoll, zu einem unentwirrbaren Durcheinander verdichtet zu haben; die Omnibushaltestelle vergrößerte die Stauung noch, und die Wagenreihe der Remisiers versperrte fast über die ganze Länge des Gitters den Bürgersteig. Aber Saccard starrte auf die obersten Stufen, wo sich in der prallen Sonne einzelne Gehröcke aus der Menge lösten. Dann fiel sein Blick wieder auf die kompakte Masse zwischen den Säulen, ein schwarzes Gewimmel, das die bleichen Flecken der Gesichter kaum aufhellten. Alle standen, die Stühle waren nicht zu sehen, den Kreis der Kulisse, die unter der Uhr saß, konnte man nur an jenem Brodeln erraten, an den wütenden Worten und Gebärden, von denen die Luft erzitterte. Links bei der Gruppe der Bankiers, die mit Arbitragen33 und mit englischen Wechsel- und Scheckgeschäften befaßt waren, ging es ruhiger zu, nur daß unaufhörlich in langer Schlange Leute vorbeizogen, die zum Telegrafen wollten. Bis unter die Seitengalerien drängten und quetschten sich die Spekulanten; und es gab welche, die es sich zwischen den Säulen auf dem Eisengeländer so bequem machten und ihren Bauch oder ihren Rücken rausstreckten, als säßen sie daheim in ihrem Kontor auf einem Samtsessel. Dieses Beben und Grollen einer unter Dampf stehenden Maschine nahm immer mehr zu und versetzte die ganze Börse in flackernde Unruhe. Plötzlich erkannte Saccard den Remisier Massias, der mit großen Sprüngen die Stufen hinunterrannte und in seinem Wagen verschwand. Der Kutscher trieb das Pferd zum Galopp an.
Da merkte Saccard, wie sich seine Fäuste ballten. Er riß sich mit Gewalt los, bog in die Rue Vivienne ein und überquerte den Fahrdamm, um die Ecke der Rue Feydeau zu erreichen, wo sich Buschs Haus befand. Ihm war der russische Brief eingefallen, den er sich übersetzen lassen wollte. Aber als er das Haus betrat, grüßte ihn ein junger Mann, der sich vor dem Papierwarengeschäft im Erdgeschoß aufgepflanzt hatte. Es war Gustave Sédille, der Sohn eines Seidenfabrikanten aus der Rue des Jeûneurs; sein Vater hatte ihn bei Mazaud untergebracht, damit er dort den Mechanismus der Finanzoperationen kennenlernte. Saccard lächelte diesem eleganten großen Burschen väterlich zu, denn er ahnte sehr wohl, weshalb Sédille hier auf Posten stand. Die Papierwarenhandlung Conin belieferte die ganze Börse mit Handbüchern, seitdem die kleine Frau Conin ihrem Mann, dem dicken Conin, im Geschäft half. Er selbst kam nie aus seiner Hinterstube heraus und befaßte sich mit der Herstellung, während sie ständig hin und her ging, am Ladentisch bediente und draußen die Besorgungen erledigte. Sie war üppig, blond und rosig, ein richtiges kleines gelocktes Schäfchen mit mattseidenem Haar, sehr reizend und anschmiegsam und immer fröhlich. Ihren Gatten liebte sie sehr, hieß es, was sie jedoch nicht hinderte, zärtlich zu werden, wenn ihr ein Börsenbesucher aus der Kundschaft gefiel – nicht etwa für Geld, sondern allein um des Vergnügens willen und nur ein einziges Mal, im Haus einer Freundin aus der Nachbarschaft, wie man sich erzählte. Auf jeden Fall mußten sich die von ihr Beglückten verschwiegen und dankbar erweisen, denn sie wurde weiterhin angebetet und gefeiert, ohne daß ein häßliches Gerede über sie umging. Und die Papierwarenhandlung blühte weiter, war ein Winkel echten Glücks. Im Vorbeigehen bemerkte Saccard, wie Frau Conin durch die Scheiben hindurch Gustave zulächelte. Was für ein hübsches kleines Schäfchen! Sie wirkte auf ihn wie eine zärtliche Liebkosung. Endlich stieg er hinauf.
Seit zwanzig Jahren hatte Busch ganz oben im fünften Stock eine kleine Wohnung, die aus zwei Zimmern und einer Küche bestand. Als Kind deutscher Eltern in Nancy geboren, war er aus seiner Geburtsstadt hierher verschlagen worden und hatte seinen ungemein verwickelten Geschäftsbereich nach und nach ausgedehnt, ohne das Bedürfnis nach einem größeren Arbeitszimmer zu empfinden; seinem Bruder Sigismond hatte er das Zimmer zur Straße überlassen, während er sich mit dem kleinen Raum auf den Hof hinaus begnügte, in dem sich der Papierkram, die Akten und alle möglichen Pakete derart häuften, daß nur noch für einen einzigen Stuhl am Schreibtisch Platz war. Eines seiner großen Geschäfte war wohl der Handel mit den entwerteten Papieren, die bei ihm zusammenliefen; er diente als Vermittler zwischen der Winkelbörse der »Naßfüßler« und den Bankrotteuren, die Löcher in ihrer Bilanz zu stopfen haben; daher verfolgte er die Kurse, kaufte manchmal direkt und bezog die Mittel dafür aus den Einlagen, die man ihm brachte. Aber außer dem Wucher und einem geheimen Handel mit Schmuck und Edelsteinen befaßte er sich besonders mit dem Ankauf von Schuldforderungen. Und das brachte die Wände in seinem Arbeitszimmer fast zum Einstürzen, das trieb ihn in Paris in alle vier Himmelsrichtungen, ließ ihn wittern und lauern, gewährte ihm Einblick in alle Schichten der Gesellschaft. Sobald er von einem Bankrott erfuhr, lief er herbei, strich um den Konkursverwalter herum und kaufte schließlich alles, woraus man nicht unmittelbar Nutzen ziehen konnte. Er schnüffelte in den Büros der Notare, wartete auf die Eröffnung strittiger Hinterlassenschaften und wohnte den Versteigerungen der hoffnungslosen Schuldforderungen bei. Er veröffentlichte selbst Anzeigen, lockte die ungeduldigen Gläubiger an, die lieber sofort ein paar Sous einstecken als Gefahr laufen wollten, ihre Schuldner gerichtlich belangen zu müssen. Und aus diesen mannigfachen Quellen floß das Papier wirklich körbeweise, entstand der unaufhörlich anwachsende Papierberg eines Lumpensammlers der Schuld: unbezahlte Wechsel, nicht eingelöste Schuldverschreibungen, nicht eingehaltene Vergleiche und Verpflichtungen. Dann begann die Auslese, wurde mit der Gabel in diesem Gericht aus verdorbenen Speiseresten herumgestochert, was ein besonderes, sehr feines Gespür erforderte. In diesem Meer von verschwundenen oder zahlungsunfähigen Schuldnern mußte man eine Auswahl treffen, um sich nicht allzusehr zu verzetteln. Grundsätzlich war er der Meinung, daß jede Schuldforderung, selbst die zweifelhafteste, noch einmal was wert sein konnte, und er besaß eine Reihe bewundernswert geordneter Akten, zu denen ein Namensverzeichnis gehörte, das er von Zeit zu Zeit noch einmal durchlas, um sein Gedächtnis aufzufrischen. Bei den Zahlungsunfähigen war er natürlich mehr hinter jenen her, von denen er glaubte, daß sie Aussichten hatten, bald zu Vermögen zu kommen. Bei seinen Ermittlungen schaute er den Leuten unters Hemd, drang in die Familiengeheimnisse ein, nahm Notiz von den reichen Verwandten, von den Existenzmitteln, vor allem von den neuen Anstellungen, die es erlaubten, Zahlungsbefehle zu erlassen. Oft ließ er auf diese Weise einen Menschen Jahre hindurch reif werden, um ihn beim ersten Erfolg abzuwürgen. Was die verschwundenen Schuldner anlangte, so versetzten sie ihn noch mehr in Leidenschaft und warfen ihn in ein Fieber ständiger Nachforschungen; dauernd hatte er ein Auge auf die Firmenschilder und auf die Namen in den Zeitungen, kundschaftete die Anschriften aus, so wie ein Hund das Wild aufspürt. Und sobald er die Verschollenen und die Zahlungsunfähigen aufgespürt hatte, wurde er grausam, fraß sie mit seinen Unkosten auf, saugte sie aus bis aufs Blut, schlug hundert Francs aus dem, was er mit zehn Sous bezahlt hatte, und führte brutal seine Risiken als Spekulant ins Feld, der gezwungen ist, an denen, die er erwischte, zu verdienen, was er angeblich bei jenen verlor, die ihm wie Rauch durch die Finger gingen.
Bei dieser Jagd auf die Schuldner war die Méchain eine seiner bevorzugten Gehilfinnen; denn wenn er dafür eine kleine Truppe von Treibern zu seiner Verfügung haben mußte, so lebte er doch in ständigem Mißtrauen gegen diese übelbeleumdeten, ausgehungerten Leute; die Méchain dagegen hatte selber einen schönen Batzen und besaß hinter dem Montmartre ein ganzes Häuserviertel, die Cité de Naples, ein weites Gelände, auf dem wacklige Hütten standen, die sie monatsweise vermietete: ein Winkel schrecklichen Elends, ein Haufen Hungerleider im Kot, Schweinekoben, die man sich gegenseitig streitig machte und aus denen sie erbarmungslos die Mieter samt ihrem Mist hinausfegte, sobald sie nicht mehr bezahlten. Was sie auffraß, was ihre Gewinne aus der Cité de Naples wieder verschlang, das war ihre unglückselige Spielleidenschaft. Und sie fand auch Gefallen an den vom Geld geschlagenen Wunden, an den Bankrotten, an den Feuersbrünsten, bei denen man geschmolzenen Schmuck stehlen kann. Wenn Busch sie beauftragte, eine Auskunft einzuholen, einen Schuldner zu exmittieren, so setzte sie manchmal aus der eigenen Tasche zu und verausgabte sich um des Vergnügens willen. Sie bezeichnete sich als Witwe, doch niemand hatte ihren Mann gekannt. Sie kam von Gott weiß woher, und mit ihrem schwabbeligen Fett und ihrer dünnen Kleinmädchenstimme schien sie immer fünfzig Jahre alt gewesen zu sein.
Als sich an jenem Tag die Méchain auf den einzigen Stuhl gesetzt hatte, war das Arbeitszimmer voll, gleichsam verstopft von diesem letzten Paket aus Fleisch, das da hingeplumpst war. Vor seinem Schreibtisch glich Busch einem Gefangenen, der in einem Meer von Akten vergraben war, aus dem nur sein eckiger Schädel auftauchte.
»Da«, sagte sie und schüttete aus ihrer alten, zum Platzen vollen Tasche den ungeheuren Papierhaufen, »das schickt mir Fayeux aus Vendôme ... Aus dem Bankrott von Charpier hat er für Sie alles aufgekauft, wie Sie ihm durch mich hatten ausrichten lassen ... Hundertzehn Francs.«
Fayeux, den sie ihren Cousin nannte, hatte sich in Vendôme ein Kuponeinnahmebüro eingerichtet. Er besaß die Konzession für die Einnahme der Kupons der kleinen Rentiers34 vom Lande, und als Verwahrer dieser Kupons und des Geldes spekulierte er hemmungslos.
»Nicht viel los mit der Provinz«, murmelte Busch, »aber trotzdem macht man dort auch mal einen tollen Fund.«
Er beschnupperte die Papiere, wählte sie schon mit kundiger Hand aus und ordnete sie grob nach einer ersten Einschätzung, nach dem Geruch. Sein ausdrucksloses Gesicht verdüsterte sich und nahm einen enttäuschten, brummigen Ausdruck an.
»Hm! Nichts Fettes dabei, nichts zum Anbeißen. Zum Glück war das nicht teuer ... Hier sind Wechsel ... noch mal Wechsel ... Wenn das junge Leute sind und wenn sie nach Paris kommen, werden wir sie vielleicht erwischen ...«
Doch da entfuhr ihm ein leiser Ausruf der Überraschung.
»Nanu, was ist denn das?«
Er hatte die Unterschrift des Grafen de Beauvilliers entziffert, auf einem Blatt Stempelpapier, auf dem nur drei Zeilen standen, in einer großen, greisenhaften Handschrift: »Ich verpflichte mich, an Fräulein Léonie Cron am Tage ihrer Volljährigkeit den Betrag von zehntausend Francs auszuzahlen.«
»Der Graf de Beauvilliers«, versetzte er langsam und überlegte ganz laut, »ja, bei Vendôme hat er Pachthöfe gehabt, eine ganze Domäne sogar ... Er ist bei einem Jagdunfall ums Leben gekommen und hat eine Frau und zwei Kinder in Not zurückgelassen. Ich habe früher Wechsel gehabt, die sie nur unter Schwierigkeiten bezahlen konnten ... Ein Angeber, ein Taugenichts ...«
Plötzlich lachte er laut auf, denn er ahnte, wie die Geschichte verlaufen sein mußte.
»Ach, der alte Gauner hat die Kleine reingelegt! ... Sie wollte nicht, und er hat sie mit diesem rechtlich wertlosen Fetzen Papier rumgekriegt. Dann ist er gestorben ... Wollen doch mal sehen, datiert ist das 1854, vor zehn Jahren also. Zum Teufel, das Mädchen muß jetzt volljährig sein! Wie konnte dieser Schuldschein Charpier in die Hände fallen? Einem Getreidehändler wie diesem Charpier? Der betrieb doch kurzfristige Wuchergeschäfte. Zweifellos hat ihm das Mädchen das da als Pfand für einige Taler abgelassen, oder vielleicht war er mit der Beitreibung beauftragt ...«
»Aber das ist doch sehr gut, ein richtiger Coup ist das!« unterbrach ihn die Méchain.
Busch zuckte verächtlich die Achseln.