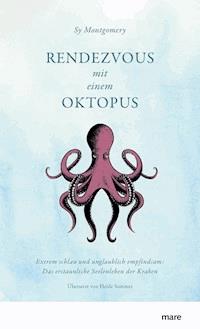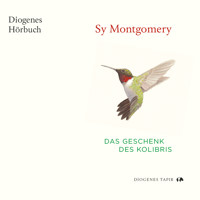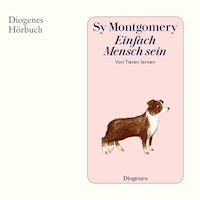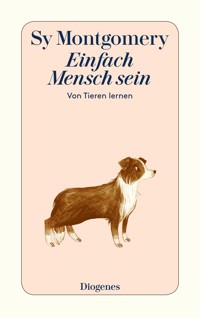14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Tapir
- Sprache: Deutsch
Nicht nur Bienen gilt es zu retten, auch den zauberhaftesten aller Vögel: den Kolibri. Sie sind als Baby klein wie ein Stecknadelkopf, brauchen ständig Nektar oder Fruchtfliegen. Doch einmal groß, stechen sie jede Rakete aus und können sich als einzige Vögel sogar rückwärts fortbewegen. Kolibris wurden schon immer als Wunderwesen verehrt, und doch sind diese zarten Geschöpfe in der heutigen Umgebung in Gefahr. Sie zu retten ist eine hohe Kunst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 94
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Sy Montgomery
Das Geschenk des Kolibris
Aus dem amerikanischen Englisch von Stefanie Schäfer
Mit zahlreichen farbigen Illustrationen
Diogenes Tapir
Für Mütter in aller Welt, die wissen, worauf es ankommt.
Vorwort
Dies ist die Geschichte einer Auferstehung.
Nicht etwa die weltbewegende Geschichte der Auferstehung Jesu nach seiner Kreuzigung. (Die kennt inzwischen jeder.) Auch keine so tragische wie die griechische Sage von Persephone, der Tochter der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter, die von Hades in die Unterwelt entführt wurde und jährlich daraus emporsteigt, um uns die Jahreszeiten für Saat und Ernte zu bringen – Frühling, Sommer und Herbst –, und sie ist auch nicht so dramatisch wie der ägyptische Mythos von Osiris, dem ermordeten Pharao, den die Liebe seiner Schwester wieder zum Leben erweckte. Dennoch ist es die Geschichte eines Wunders.
Zugegeben, eines kleinen Wunders. Wie klein? Nicht viel größer als zwei Hummeln – denn so klein waren Zuni und Maya, zwei verwaiste Kolibriküken, als ich sie vor über zehn Jahren zum ersten Mal sah. Sie waren so jung, dass wir nicht einmal ihre Art bestimmen konnten.
Als diese beiden Küken (die sich später als Allenkolibris erwiesen) zur Vogelretterin Brenda Sherburn im kalifornischen Fairfax gelangten, schwebten sie in Lebensgefahr. Niemand weiß, was mit ihrer Mutter geschah. Die Jungen zu retten, aufzuziehen und auszuwildern erforderte fast übermenschliche Anstrengung, und ich hatte das große Glück, Brenda dabei helfen zu dürfen.
Im Lauf der Wochen, die ich Brenda zur Seite stand, erlebte ich, wie herausfordernd und belastend unsere Aufgabe war. Wir kümmerten uns um winzige Wesen so zart wie Seifenschaum. Denn genau wie Seifenblasen bestehen Kolibris zu einem großen Teil aus Luft. Ihre winzigen Körper enthalten, neben zwei außergewöhnlich großen Lungenflügeln und dem riesengroßen Herzen, neun Luftsäcke. Damit sie überlebten, mussten wir diese winzigen, bläschengefüllten Wesen regelmäßig mit einer Spritze füttern, die im Vergleich zu ihnen so wuchtig aussah wie die Spitze des Empire State Building.
Doch hätten wir das nicht gewagt, wären sie verhungert. Und hätten wir sie überfüttert, wären sie womöglich geplatzt.
Anfangs befürchtete ich sie durch meine bloße Berührung zu zerquetschen. Alles an einem Kolibri ist hauchzart. Die winzigen Knochen sind äußerst porös, die Beine dünner als Zahnstocher, die Zehen fein wie Stickgarn. Schon 1890 begannen Wissenschaftler, Kolibris zu beringen, um ihre Wege verfolgen und einzelne Exemplare identifizieren zu können. Doch die ersten Ringe, die sich als leicht und sicher genug für die zerbrechlichen Beine der Vögel erwiesen, wurden erst 1960 entwickelt und nur erwachsenen Tieren angelegt. Unsere Kleinen waren noch viel zu zart dafür.
Kolibriküken erfordern rund um die Uhr sorgfältige Betreuung. Sie strapazieren ihre Mütter, die bis zu hundertmal am Tag und mehr ausfliegen, um Futter für ihre Jungen herbeizuschaffen. Obwohl Brenda schon zehn Jahre Erfahrung hatte, wussten wir, dass wir es mit einer Kolibrimutter nicht aufnehmen konnten. Wir würden uns ins Zeug legen müssen. Die winzigen Küken zu retten stellte uns vor eine riesige Herausforderung.
Doch die Belohnung, so erfuhr ich später, würde umso größer sein.
Es ist inzwischen über zehn Jahre her, dass ich Brenda zuletzt gesehen habe. Seitdem ist viel passiert. Ihre Eltern sind gestorben, ebenso ihre Schwiegereltern. Sie erzählte mir, dass sie das nachdenklich gemacht habe und sie sich gefragt habe, was sie mit dem Rest ihres Lebens anfangen wolle. Die Antwort fiel ihr nicht schwer: »Ich werde mich auf die beiden Dinge konzentrieren, die mich glücklich machen, neben meinen Kindern, meinem Mann und meinem Hund: Plastiken herstellen und mich um Kolibris kümmern.«
Waisenkinder zieht sie nicht mehr auf – sie brauchte zwei Jahre, um eine geeignete Nachfolgerin zu finden –, aber sie hat immer noch eine tiefe Beziehung zu diesen schillernden Funken des Lebens, was nach ihren Worten auch immer so bleiben wird. Bis heute erhält sie Anrufe von überall aus den USA und darüber hinaus, sogar aus dem fernen Guatemala. Einmal meldete sich eine Frau von ihrem Balkon im dritten Stock aus, die mit dem Fernglas ein vermeintlich verlassenes Kolibrinest beobachtete und gespannt auf die Rückkehr der Mutter zu ihren Jungen wartete. In einem anderen Fall hatte der Anrufer ein Nest in einer tristen Umgebung entdeckt. Nicht etwa in einem Banden- oder Drogenviertel: Aber es gab keine Blumen. Brenda riet dem Samariter, in die Gärtnerei zu fahren und Pflanzen mit nektarreichen, trompetenförmigen roten Blüten zu kaufen und diese um den Baum mit dem Nest herum zu setzen. Sie würden der Mutter genügend Nährstoffe für die kraftraubende Jagd nach Insekten bieten, die ihre bettelnden Jungen brauchten.
In Brendas Haus schwirren noch immer zahlreiche Kolibris umher. Fünf Nektarspender, die in verschiedenen Ecken der Zimmer aufgestellt sind, ernähren mehrere Dutzend Kolibris vier verschiedener Arten und sorgen dafür, dass die Tiere nicht aus Futterneid aufeinander losgehen. Täglich meldet Brenda pflichtbewusst ihre Vogelsichtungen an das landesweite Projekt FeederWatch der Cornell University, das Forschenden dabei hilft, die Entwicklung von Vogelpopulationen zu verfolgen.
Vor Kurzem, so erzählte mir Brenda, hätten sie und ihr Mann Russ ein Stück Land in Fort Bidwell gekauft, in der nordöstlichsten Ecke Kaliforniens am westlichen Rand des Großen Beckens. Es ist ein Hochplateau, das Wüstenklima und einen Streifen fruchtbares Grasland bietet, auf dem Rancher ihr Vieh weiden lassen – ein vielseitiger Lebensraum, der Säugetiere von Antilopen bis hin zu Füchsen und Vögel von Sandhügelkranichen bis hin zu Kolibris anzieht. Brenda und Russ haben vor, das alte Haus zu einem Gemeinschaftsatelier umzubauen, in dem sie und andere Kunstschaffende – darunter auch viele indigene – ihre Arbeiten ausstellen können. (Sie nennen das Projekt »Yampa Sculpture Path & Studio«, nach dem Paiute-Namen für eine essbare Knolle, die die Ureinwohner ernährte und die bis heute in der Gegend wild wächst.) »Ich möchte eine Brücke zwischen Kunst und Natur schlagen – die Skulptur in der Natur«, erklärte mir Brenda, »und eine gemeinsame, vorurteilsfreie Plattform für Künstlerinnen und Künstler aufbauen.« Außerdem verwandelt das Ehepaar das Grundstück in ein Paradies für Bestäuber.
Brendas Liebe zu den Kolibris hat sich auf Bienen, Schmetterlinge und Nachtfalter ausgeweitet. (Besonders liebt sie das Taubenschwänzchen, auch Kolibrimotte genannt. »Sie haben so eine lustige zusammengerollte Zunge«, sagt sie. »Einfach zu komisch! Sie sieht aus wie ein gebogener Strohhalm! Und wie diese Motten schweben können!« Die Tiere ernähren sich nachts von denselben Pflanzen, die die Kolibris tagsüber anfliegen.)
Auf ihrem neuen Grundstück pflanzen Brenda und Russ Gehölze und Blumen an. Überall sollen Bestäuberpflanzen wachsen: Kornblumen mit ihren weichen, flauschigen blauen Doppelblüten aus gefransten Blütenblättern; Buddlejas, auch Schmetterlingsflieder genannt, mit duftenden roten, gelben, weißen, orange-, rosa- oder lilafarbenen Rispen an den Enden der gebogenen Zweige; Akelei mit glockenförmigen gespornten Blüten, die in der Brise baumeln und nicken. Brenda pflanzt Prachtsalbei, dessen winzige röhrenförmige, meist scharlachrote Blüten auf hohen Stängeln sitzen, und fingerhutblütigen Bartfaden in Farben von Karmesinrot bis hin zu leuchtendem Blau. Zwischendrin sollen buschige Lupinen und Habichtskraut mit lanzettförmigen Blättern und gelben, orangefarbenen und roten Blüten wachsen.
Es geht jedoch nicht nur darum, Bestäubern Nahrung zu bieten, wie Brenda erklärt. »Indem wir Bäume setzen und Gärten mit Blumen bepflanzen, selbst solchen mit ganz winzigen Blüten«, sagt sie, »schaffen wir Ökosysteme mit einem eigenen Mikroklima.« Solche kleinen, schattigen und feuchten Oasen mit sorgfältig ausgewählten Pflanzengemeinschaften können dazu beitragen, einen Teil der durch den Klimawandel entstandenen Schäden auszugleichen. Ein Forscher der University of Singapore bestätigt in einem Artikel in Global Change Biology, dass selbst kleine Flächen »ein außerordentliches Potenzial besitzen, die Folgen von Klimaschwankungen zu mildern und unter Umständen das Artensterben während extremer Klimaereignisse zu reduzieren«.
Es wird bestimmt eine wahre Pracht: Brenda stellt sich vor, dass die Besucher:innen unter einem Spalier entlangspazieren, das mit orangefarbenen Trompetenblumen bewachsen ist, flankiert von Buddlejas und niedrigwüchsiger Indianernessel. »Ich möchte durch eine Laube gehen, in der Kolibris, Bienen und Schmetterlinge umherfliegen«, sagt Brenda. Kolibris, so erklärt sie, lieben besonders Spalierblumen, und das Geräusch, mit dem sie von Pflanze zu Pflanze schwirren, klingt für sie wie Musik. »Das hat etwas so Lebensfrohes!«, findet sie. »Fast melodiös, auch wenn Kolibris nicht singen. Vielleicht ist das ihre Art, sich auszudrücken.«
Ein ganzer Hektar wird einem besonderen spiralförmig angepflanzten Bestäubergarten gewidmet sein. Die zugrunde liegende Idee sei, erklärt Brenda, »auf dem Weg von außen nach innen eine symbolische Reise ins eigene Innere zu unternehmen – begleitet von Bienen, Schmetterlingen und Kolibris«.
Welche Geschöpfe wären passendere Gefährten für einen Menschen auf seiner inneren Reise? In den Überlieferungen der amerikanischen Ureinwohner symbolisieren Bienen die Gemeinschaft; in keltischen Mythen werden sie als Botengeister aus dem Jenseits betrachtet. Schmetterlinge wiederum stehen auf der ganzen Welt für Metamorphose, und die schillernden, schwebenden Kolibris verkörpern, da sie so unglaublich winzig, schnell und schön sind, den unauslöschlichen Funken des Lebens.
Heute, vielleicht mehr denn je, dürsten wir nach Gemeinschaft; wir sehnen uns nach Verwandlung; wir wünschen uns innig, wieder mit der Glut des Lebens verbunden zu sein. Es drängt uns danach, solche inneren Reisen zu unternehmen. Aber angenommen, es gäbe keine Bienen, Schmetterlinge oder Singvögel mehr, um uns dabei zu begleiten?
Diese Bedrohung rückt immer näher. Eine erschreckende Anzahl von Bestäubern, darunter auch Kolibris, sind stark gefährdet. Honigbienen sterben an der Varroamilbe oder dem Syndrom der colony collapse disorder, meist als CCD abgekürzt. Die Hummelpopulationen schrumpfen. Die Wahrscheinlichkeit, eine Hummel zu sehen, ist heutzutage nur noch halb so groß wie vor fünfzig Jahren. Die Schmetterlingspopulationen sind Schätzungen zufolge in den letzten zwanzig Jahren um ein Drittel zurückgegangen. Drei Milliarden Vögel sind in den letzten fünf Jahrzehnten vom nordamerikanischen Himmel verschwunden. Die Vogelschutzorganisation National Audubon Society warnt in ihrem Bericht Birds and Climate Change davor, dass die Hälfte aller Vögel auf dem amerikanischen Kontinent gefährdet sei, darunter vier Kolibriarten, einschließlich des Allenkolibris. Die Prognose lautet, dass sie bis zum Jahr 2080 neunzig Prozent ihres kleinen Brutgebietes durch den menschengemachten Klimawandel einbüßen werden.
Als ich im Herbst 2020 mit Brenda sprach, lag draußen so dichter Rauch in der Luft, dass sie die Fenster nicht öffnen konnte. Sie musste zwei Masken tragen, wenn sie das Haus verließ: eine zum Schutz gegen das Coronavirus und eine N95-Maske gegen den Rauch. Nicht weit von ihr entfernt wurden 68000 Menschen im Zuge des Glass Fires evakuiert, nur einem von achtundzwanzig Bränden, die in Kalifornien wüteten. Asche bedeckte Brendas Auto, die Bäume, die Blumen und die Kolibrifutterstellen.
Brenda machte sich Sorgen um die Kolibris und darüber, ob sie bei dem vielen Rauch überhaupt noch Luft bekämen. Auch befürchtete sie, die Vögel könnten wegen des rötlich verdunkelten Himmels glauben, es sei Nacht.
Ein Großteil Kaliforniens hatte sich in eine Flammenhölle verwandelt. Als die Asche vom Himmel herabwirbelte, als die Luft raucherfüllt, giftig und orangefarben wurde, hatten alle, ob Nachrichtensprecherinnen, Feuerwehrleute oder normale Bürger, immer wieder dieselbe Assoziation: Weltuntergang. Im Angesicht dieser Apokalypse ließ Brenda für die Kolibris Zuckerwasser zu Eiswürfeln gefrieren, um ihnen Kühle zu spenden, und plante ihren spiralförmigen Kolibrigarten, einen Garten der Auferstehung.
Die Azteken hielten die Kolibris, die tapfer kämpfen können, für wiedergeborene Krieger, die mit Schnäbeln als Schwerter ins Leben zurückgekehrt seien und ihre Kämpfe auf ewig am Himmel fortsetzten. Als die Spanier die Neue Welt eroberten und zum ersten Mal Kolibris sahen (sie leben nur auf dieser Hälfte des Globus), nannten sie sie »Auferstehungsvögel«. Sie glaubten, dass etwas, was so hell glitzerte, jeden Tag neu entstehen müsse.