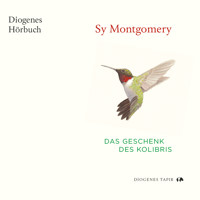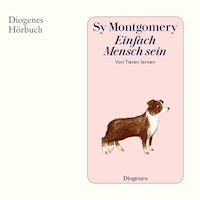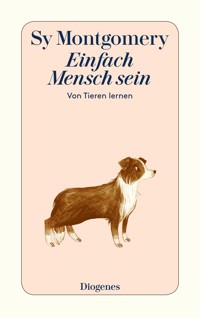Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BONNEVOICE Hörbuchverlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Er kann 1600 Küsse auf einmal verteilen, er kann mit seiner Haut schmecken, Farbe und Form ändern und sich trotz eines Körpergewichts von 45 Kilogramm durch eine apfelsinengroße Öffnung zwängen: der Oktopus. Und nicht nur seine körperlichen Superkräfte machen den Achtarmigen zu einem Wunderwesen der Meere. Kraken sind vor allem schlau. Sie können tricksen, spielen, lernen, sie können Menschen erkennen und Kontakt aufnehmen. In ihrem preisgekrönten Buch erzählt die Naturforscherin Sy Montgomery auf berührende, kenntnisreiche, unterhaltsame Weise von ihren Begegnungen mit diesen außergewöhnlichen Tieren und wirft eine bemerkenswerte Frage auf: Haben Kraken ein Bewusstsein? Das Nachwort wurde eigens für die deutsche Ausgabe von dem weltbekanntesten Fan dieses Buches verfasst: Donna Leon.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sy Montgomery
RENDEZVOUSmit einemOKTOPUS
Extrem schlau undunglaublich empfindsam:Das erstaunlicheSeelenleben der Kraken
Aus dem Amerikanischenvon Heide Sommer
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.de abrufbar.
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel The Soul of an Octopus: A Surprising Exploration into the Wonder of Consciousness bei Atria Books, New York
Copyright © 2015 by Sy Montgomery
© 2017 by mareverlag, HamburgDonna Leon: »Die Seele des Tintenfischs«Copyright © 2017 Diogenes Verlag AG Zürich
Covergestaltung Nadja Zobel / Petra Koßmann, mareverlag
Abbildung Oktopus: © Studio Nippoldt
Hintergrund © Mybona / fotolia.com
Lektorat Katharina Hierling
Register Rainer Kolbe
Typografie (Hardcover) Farnschläder & Mahlstedt, Hamburg
Datenkonvertierung E-Book bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-341-5
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-265-4
www.mare.de
Für Anna
»Das Gestern bleibtvollkommen«
Inhalt
Erstes Kapitel: ATHENA – Auf der Suche nach dem Verstand der Weichtiere
Zweites Kapitel: OCTAVIA – Schmerzen schmecken, Träume sehen
Drittes Kapitel: KALI – Die Gemeinschaft der Fische
Viertes Kapitel: EIER – Anfang, Ende und Gestaltveränderung
Fünftes Kapitel: TRANSFORMATION – Die Kunst, im Meer zu atmen
Sechstes Kapitel: EXIT – Freiheit, Sehnsucht und Flucht
Siebtes Kapitel: KARMA – Die Freiheit der Entscheidung, Schicksal und Liebe
Achtes Kapitel: BEWUSSTSEIN – Denken, Fühlen, Wissen
Die Seele eines Tintenfischs – Ein Nachwort von Donna Leon
Dank
Auswahlbibliografie
Register
Erstes Kapitel
ATHENA
Auf der Suche nach dem Verstand der Weichtiere
An einem dieser seltenen warmen Tage Mitte März, wenn der Schnee in New Hampshire zu schmelzen beginnt und in Matsch übergeht, fuhr ich nach Boston, wo die Menschen am Hafen entlangspazierten oder auf Bänken saßen und ihr Waffeleis schleckten. Ich aber tauschte die wohltuende Sonne gegen die feuchte, schummrige Atmosphäre der Auffangstation des New England Aquarium, denn dort war ich mit einem Pazifischen Riesenkraken verabredet.
Ich wusste nicht viel über den Oktopus im Allgemeinen – nicht einmal, dass der wissenschaftlich korrekte Plural von Oktopus nicht Octopi ist, wie ich immer angenommen hatte (die lateinische Pluralendung – i – lässt sich nicht auf Wörter anwenden, die aus dem Griechischen stammen). Doch das Wenige, das ich wusste, machte mich neugierig. Der Oktopus ist ein Tier, das über Gift verfügt wie eine Schlange, über einen Schnabel wie ein Papagei und über Tinte wie ein altmodischer Füllfederhalter. Er kann so viel wiegen wie ein Mensch, sich bis zur Größe eines Autos ausstrecken und dennoch seinen schlabberigen, knochenlosen Körper durch ein Loch mit dem Durchmesser einer Orange zwängen. Er kann Farbe und Form verändern. Er kann mit der Haut schmecken. Am meisten faszinierte mich jedoch, dass ich gelesen hatte, Kraken seien intelligent. Das bestätigten die dürftigen Erfahrungen, die ich schon gemacht hatte: Wie so viele Menschen, die Kraken in öffentlichen Aquarien besuchen, hatte ich oft das Gefühl, dass der Oktopus, den ich beobachtete, mich seinerseits ebenfalls beobachtete, und zwar mit genauso großem Interesse wie ich ihn.
Wie war das möglich? Es findet sich ja kaum ein Tier, das dem Menschen unähnlicher ist als ein Oktopus. Sein Körper ist nicht so aufgebaut wie unserer: Kopf, Rumpf und Glieder. Bei den Kraken ist die Reihenfolge anders: erst der Rumpf, dann der Kopf und die Glieder. Der Mund sitzt also in den Achselhöhlen – oder aber, wenn man die Arme lieber mit den unteren Extremitäten des Menschen vergleichen will, zwischen den Beinen. Sie atmen Wasser. Ihre Glieder sind übersät mit geschickt und fest zupackenden Saugnäpfen – eine Konstruktion, die bei Säugetieren nicht zu finden ist.
Nicht nur zählen die Oktopoden zu jener Gruppe von Lebewesen, die sich vornehmlich durch das Fehlen einer Wirbelsäule von den Lebewesen mit Wirbelsäule unterscheiden, als da sind Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische; innerhalb der Wirbellosen werden sie zu den Mollusken gezählt wie Schnecken, Nacktschnecken und Muscheln – Tiere, die nicht unbedingt für ihren Intellekt bekannt sind. Muscheln besitzen nicht einmal ein Gehirn.
Vor über 500 Millionen Jahren haben sich die Abstammungslinie der Oktopoden und die des Menschen voneinander getrennt. Würde es möglich sein, fragte ich mich, zu einem intelligenten Wesen auf der anderen Seite dieser Scheidelinie Kontakt aufzunehmen?
Oktopoden verkörpern das große Mysterium dieses Anderen. Sie wirken völlig fremdartig, und doch umfasst ihre Lebenswelt, das Meer, einen weit größeren Teil unseres Planeten als das Land (siebzig Prozent der gesamten Erdoberfläche und über neunzig Prozent des bewohnbaren Raumes). Die meisten Tierarten leben im Meer, und von ihnen zählen die meisten zu den Wirbellosen.
Ich wollte einen Oktopus kennenlernen. Ich wollte so eine alternative Lebenswirklichkeit berühren. Ich wollte eine andere Art von Bewusstsein erkunden, wenn es das überhaupt gab. Wie fühlte es sich an, ein Oktopus zu sein? Lässt es sich vergleichen mit dem Gefühl, ein Mensch zu sein? Und lässt sich das überhaupt herausfinden?
So kam es, dass ich mir wie der privilegierte Besucher einer anderen Welt vorkam, als der Pressesprecher des Aquariums mich in der Halle begrüßte und anbot, mich mit Athena, einem Tintenfischweibchen, bekannt zu machen. Doch was ich an diesem Tag wirklich zu entdecken begann, war mein eigener lieblich blauer Planet, eine Welt, so atemberaubend fremdartig, so erstaunlich und wundersam – ein Ort, an dem ich nach einem halben Jahrhundert meines Erdendaseins, und eines Großteils davon als Naturforscherin, nun endlich vollkommen heimisch werden sollte.
Athenas Tierpfleger ist nicht da. Mir wird ganz bang ums Herz: Nicht jeder darf das Oktopus-Becken öffnen, und das aus gutem Grund. Ein Pazifischer Riesenkrake, die größte aller etwa 250 Oktopus-Arten, kann einen Menschen leicht überwältigen. Bei einem großen Männchen kann jeder einzelne Saugnapf mit einem Durchmesser von 7,5 Zentimetern fünfzehn Kilo anheben, und ein Pazifischer Riesenkrake besitzt 1600 davon. Der Biss eines Oktopus kann ein neurotoxisches Gift injizieren sowie Speichel hinterlassen, der die Fähigkeit hat, Fleisch zu zersetzen. Im schlimmsten Fall kann ein Oktopus die günstige Gelegenheit nutzen und aus seinem geöffneten Becken flüchten, und ein entflohener Oktopus ist ein großes Problem, sowohl für ihn selber als auch für das Aquarium.
Zum Glück wird mir ein anderer Aquarianer, Scott Dowd, zur Seite stehen. Scott ist ein kräftiger Bursche, Anfang vierzig, mit einem silbrigen Bart und blitzenden blauen Augen. Er ist der Leiter der Süßwasserabteilung, die hinter der Kaltwasserabteilung liegt, in der Athena lebt. Scott hat das Aquarium am 20. Juni 1969, dem Eröffnungstag, als Baby und in Windeln zum ersten Mal besucht und es seither praktisch nicht mehr verlassen. Er kennt fast jedes Tier in der gesamten Anlage persönlich.
Athena ist etwa zweieinhalb Jahre alt und wiegt ungefähr zwanzig Kilo, erzählt Scott, als er den schweren Deckel von ihrem Bassin abnimmt. Ich steige die drei kurzen Stufen einer kleinen Trittleiter hinauf und beuge mich vor, um von oben in das Becken hineinzusehen. Sie ist ungefähr einen Meter fünfzig lang. Ihr Kopf – und damit meine ich sowohl den tatsächlichen Kopf als auch den Mantel, weil »wir« Säugetiere dort automatisch den Kopf eines jeden Lebewesens vermuten – hat die Größe einer kleinen Wassermelone. »Oder zumindest einer Honigmelone«, sagt Scott. »Als sie zu uns kam, war ihr Kopf gerade einmal so groß wie eine Grapefruit.« Der Pazifische Riesenkrake ist eines der am schnellsten wachsenden Tiere der Welt. Er schlüpft aus einem Ei von der Größe eines Reiskorns und kann binnen drei Jahren größer und schwerer werden als ein Mensch.
Als Scott mit dem Öffnen des Deckels fertig war, hatte sich Athena schon aus der hinteren Ecke ihres 2000-Liter-Tanks hervorgewagt. Während sie sich mit zwei Armen in der Ecke festklammert, entrollt sie die anderen und streckt sie, am ganzen Körper rot vor Aufregung, bis an die Oberfläche aus. Die Saugnäpfe zeigen nach oben wie die Handfläche eines Menschen bei der Begrüßung.
»Darf ich sie anfassen?«, frage ich Scott.
»Ja klar«, sagt er. Ich nehme Uhr und Schal ab, krempele die Ärmel hoch und tauche beide Arme bis zum Ellenbogen in das schockierende acht Grad kalte Wasser.
Unter Dreh- und Wellenbewegungen sprudeln Athenas gallertartige Arme aus dem Wasser und greifen nach meinen. Im Nu sind meine beiden Hände und Unterarme umschlungen von Dutzenden weicher, mich abtastender Saugnäpfe.
Nicht jeder würde das mögen. Der Naturkundler und Forscher William Beebe empfand die Berührung eines Oktopus als widerlich. »Ich muss mich jedes Mal überwinden, ehe ich meine Hände dazu bekomme, ihre Pflicht zu tun und einen Fangarm zu ergreifen«, gab er zu. Victor Hugo malte sich ein solches Erlebnis als absoluten Horror aus, der in das sichere Verderben führe. »Dieser Albdruck ist über euch gekommen. Der Tiger kann euch lediglich verschlingen. Der Polyp aber, o Graus!, atmet euch ein. Er zieht euch an sich und in sich hinein, und gefesselt und festgeleimt, fühlt ihr euch langsam in diesen schrecklichen Sack ausgeleert, der ein Monstrum ist«, schrieb der Dichter in seinem Roman Die Arbeiter des Meeres. »Eure Muskeln schwellen an, die Fasern krümmen sich, die Haut platzt unter dem widerlichen Druck, das Blut spritzt auf und mischt sich in abscheulicher Weise mit dem Körpersaft der Molluske. Das Tier stülpt sich mit tausend gemeinen Mündern über euch; die Hydra verleibt sich den Menschen ein; der Mensch vermischt sich mit der Hydra. Beide bilden ein einziges Wesen.« Die Angst vor dem Kraken ist tief in der menschlichen Psyche verankert. »Kein anderes Tier ist beim Töten eines Menschen im Wasser grausamer«, schrieb Plinius der Ältere etwa 79 n. Chr. in seiner Naturalis historia, »denn er kämpft mit ihm, umschlingt ihn, verschlingt ihn mit den Saugnäpfen und reißt ihn in Stücke.«
Athenas Saugen ist sanft, aber nachdrücklich. Es fühlt sich an wie der Kuss eines Unbekannten. Mit Schwung schießt ihr melonengroßer Kopf an die Oberfläche, und ihr linkes Auge – Kraken haben ein dominantes Auge, wie Menschen eine dominante Hand haben – dreht sich in der Augenhöhle, um meinen Blick zu erhaschen. Ihre schwarze Pupille ist ein dicker Strich auf einer perlmuttfarbenen Kugel. Ihr Ausdruck erinnert mich an die Augen von Hindugöttern und -göttinnen: Abgeklärt und allwissend blickt sie weise bis tief in die Urzeit zurück.
»Sie sieht dich direkt an«, sagt Scott.
Während ich ihrem funkelnden Blick standhalte, strecke ich instinktiv die Arme aus, um ihren Kopf zu berühren. »So geschmeidig wie Leder, hart wie Stahl, kalt wie die Nacht«, schrieb Victor Hugo über das Fleisch des Oktopus; zu meiner Überraschung ist ihr Kopf aber seidig und weich wie Vanillesoße. Ihre Haut ist weinrot und silbrig gesprenkelt wie der Nachthimmel über blutroter See. Als ich sie mit den Fingerspitzen streichele, wird ihre Haut ganz weiß. Weiß ist die Farbe des entspannten Oktopus; beim Kuttelfisch, einem zehnarmigen Verwandten des Oktopus, werden die Weibchen weiß, wenn sie einem anderen Weibchen begegnen, mit dem sie nicht kämpfen und vor dem sie auch nicht fliehen müssen.
Es ist gut möglich, dass Athena sogar spürt, dass ich ein weibliches Wesen bin. Wie weibliche Menschen besitzen weibliche Kraken Östrogene, und deshalb könnte sie diese auch bei mir schmecken und erkennen. Oktopoden können mit ihrem gesamten Körper schmecken, aber am feinsten ausgebildet ist dieser Sinn in ihren Saugnäpfen. Athenas Umarmung ist außergewöhnlich intim. Gleichzeitig berührt und erschmeckt sie meine Haut und wohl auch die Muskulatur darunter, Knochen und Blut. Obwohl wir uns gerade erst kennengelernt haben, kennt Athena mich schon so genau wie kein anderes Lebewesen vor ihr.
Auch scheint sie genauso neugierig auf mich zu sein wie ich auf sie. Ganz langsam überträgt sie ihren Griff von den kleineren Näpfen am Ende ihrer Arme auf die größeren, kräftigeren in der Nähe ihres Kopfes. Inzwischen stehe ich vornübergebeugt auf dem kleinen Tritt und hänge in einem 90-Grad-Winkel über dem Becken wie ein aufgeklapptes Buch. Und ich merke, was geschieht: Ganz langsam zieht Athena mich in ihr Bassin.
Wie gerne würde ich ihr folgen, doch leider passe ich nicht hinein. Ihre Höhle, in die sie wie Wasser hineinfließen kann, liegt hinter einem Felsvorsprung, und dorthin schaffe ich es, in meiner Beweglichkeit durch Knochen und Gelenke eingeschränkt, nicht. Stehend würde mir das Wasser im Becken bis zur Brust reichen, aber so, wie sie gerade an mir zieht, würde ich kopfüber hineinfallen und sehr bald an die Grenzen meiner sauerstoffhungrigen Lungen gelangen. Ich frage Scott, ob ich versuchen solle, mich aus ihrem Griff zu befreien, und ganz vorsichtig zieht er uns auseinander. Beim Abziehen von meiner Haut machen die Saugnäpfe schmatzende Ploppgeräusche wie kleine Pömpel.
»Was? Kraken?! Sind das nicht diese Ungeheuer?«, fragte meine Freundin Jody Simpson höchst besorgt, als wir am nächsten Tag mit unseren Hunden spazieren gingen. »Hattest du denn keine Angst?« Aus dieser Frage sprach weniger ihre Unkenntnis der Natur als vielmehr ihr umfangreiches, von der westlichen Kultur geprägtes Wissen.
Die Angst vor Riesenkraken und ihren Verwandten, den Riesenkalmaren, hat die westliche Kunst in allen Formen, von den isländischen Sagen des 13. Jahrhunderts bis hin zu amerikanischen Filmen des 20. Jahrhunderts, beeinflusst. Die Gestalt des mächtigen »Hafgufa«, der in der alten isländischen Örvar-Odds saga »Männer, Schiffe, Wale und alles, was ihm in die Quere kommt, verschlingt«, basiert sicherlich auf einem Weichtier mit Fangarmen und begründete den Mythos der Kraken. Berichte französischer Matrosen über Riesenkraken, die ihr Schiff vor der Küste von Angola angriffen, haben das Bild des Kraken bis in unsere Zeit geprägt, ein Bild, das Seeleute sich auch heute noch auf den Arm tätowieren lassen. So zeigt auch die ikonische Tuschezeichnung des Molluskenexperten Pierre Denys de Montfort aus dem Jahre 1801 einen riesigen Kraken, der sich aus dem Meer erhebt und mit seinen langen Armen die drei Masten eines Schoners bis zu den Spitzen umschlingt. Montfort sprach von mindestens zwei Arten des Riesenkraken, von denen eine, so folgerte er, höchstwahrscheinlich für den Verlust von nicht weniger als zehn britischen Kriegsschiffen verantwortlich sei, die in einer Nacht des Jahres 1782 auf ungeklärte Weise verschwanden. (Montfort war peinlich berührt, als ein Überlebender später berichtete, in Wahrheit seien die Schiffe in einen Orkan geraten und untergegangen.)
Im Jahre 1830 veröffentlichte Alfred Tennyson ein Sonett über einen riesigen Oktopus, dessen »unzählige gewaltige Polypen / mit Riesenarmen das still ruhende Seegras aufwirbeln«. Und natürlich ist in Jules Vernes Zukunftsroman 20 000 Meilen unter dem Meer der Erzfeind ein Oktopus. Obwohl in der Neuverfilmung des Romans von 1954 aus dem Oktopus ein riesiger Kalmar wird, sagte John Williamson, der Mann, der 1916 die Unterwasserszenen für den Originalfilm gedreht hat, über den echten Bösewicht des Romans: »Ein menschenfressender Hai, eine giftige Riesenmuräne, ein mörderischer Barrakuda erscheinen im Vergleich zum Oktopus harmlos, gutartig, freundlich und sogar attraktiv. Mit keinem Wort lässt sich das widerwärtige Grauen beschreiben, das uns überkommt, wenn wir aus der Tiefe seines geheimnisvollen dunklen Verstecks von den lidlosen Augen eines Oktopus angestarrt werden … Unter ihrem Blick erschrecken wir bis ins Mark, und kalte Schweißperlen stehen auf der Stirn.«
Ich beeilte mich, den Oktopus gegen diesen jahrhundertealten Rufmord zu verteidigen, und antwortete meiner Freundin: »Wieso Ungeheuer? Überhaupt nicht!« Lexika führen bei der Definition des Begriffs Ungeheuer zwar stets die Adjektive »groß«, »hässlich« und »furchterregend« an. Für mich aber war Athena wunderschön und gutartig wie ein Engel. Und selbst das Adjektiv »groß« steht neuerdings zur Disposition, wenn es um Oktopoden geht. Die größte Art, der Pazifische Riesenkrake, ist heute nicht mehr so groß, wie er früher einmal war. Ein Oktopus mit einer Spannweite von über 45 Metern mag einst existiert haben, aber der größte Oktopus, der im Guinness-Buch der Rekorde aufgeführt ist, wiegt 150 Kilogramm und verfügt über eine Spannweite von knapp zehn Metern. 1945 wurde in Santa Barbara vor der Küste Kaliforniens ein wesentlich schwererer Oktopus gefangen, der Berichten zufolge 200 Kilogramm gewogen haben soll. Enttäuschend ist allerdings, dass ein Foto dieses Tieres, auf dem ein Mann für einen Größenvergleich mit abgelichtet wurde, nur auf eine Spannweite von sechs bis sieben Metern schließen lässt. Doch reichen diese modernen Riesen kaum an die Größe ihrer nahen Weichtierverwandten, der Koloss-Kalmare, heran. In jüngerer Zeit wurde ein Exemplar dieser Spezies von einem neuseeländischen Fischerboot vor Antarktika gefangen; es wog mehr als 500 Kilogramm und hatte eine Länge von über neun Metern. In unserer Zeit beklagen die Liebhaber solcher Ungeheuer, dass die größten Oktopoden wohl schon vor über einem halben Jahrhundert gefangen wurden.
Während ich von Athenas Anmut, ihrer Sanftheit und unübersehbaren Freundlichkeit schwärmte, war meine Freundin Jody skeptisch. In ihrem Nachschlagewerk wurde solch ein riesiger, schleimiger, mit Saugnäpfen bedeckte Kopffüßer als Musterbeispiel eines Ungeheuers beschrieben. »Vielleicht hast du recht«, räumte ich ein und versuchte es mit einer anderen Taktik, »aber ein Ungeheuer zu sein, muss ja nicht unbedingt schlecht sein.«
Schon immer hegte ich eine Vorliebe für Ungeheuer. Schon als Kind stand ich auf der Seite von Godzilla und King Kong und nicht aufseiten derer, die ihnen nach dem Leben trachteten. Ich fand es immer vollkommen nachvollziehbar, dass diese Ungeheuer so gereizt waren. Niemand wird gern durch eine Atomexplosion aus dem Schlaf gerissen, und so wunderte es mich überhaupt nicht, dass Godzilla so wütend war. Was King Kong anbelangt, so gibt es wohl nur wenige Männer, die ihm seine Gefühle für die hübsche Fay Wray verübeln würden – wobei das Gekreische der blonden Frau alle menschlichen Verehrer abgestoßen hätte, die nicht so geduldig gewesen wären wie ein Gorilla.
Aus Sicht der Ungeheuer machen ihre Handlungen Sinn. Der Trick ist also, sich in sie hineinzuversetzen und wie ein Ungeheuer zu denken.
Nach unserer Umarmung glitt Athena in ihre Höhle zurück, und ich wankte die drei Stufen des kleinen Tritts hinunter. Einen Augenblick stand ich da, mir war leicht schwindelig, und ich musste erst einmal tief durchatmen. Das einzige Wort, das ich herausbrachte, war »Wow«.
»Dass sie dir ihren Kopf darbot, war ungewöhnlich«, sagte Scott, »das hat mich überrascht.« Und dann erzählte er mir, dass die beiden letzten Oktopoden, die hier lebten, Truman und vor ihm noch George, Besuchern ihre Arme, aber nie ihren Kopf entgegengestreckt hatten.
In Anbetracht ihrer Persönlichkeit war Athenas Verhalten besonders erstaunlich. Truman und George waren ganz entspannte Tiere gewesen, aber Athena hatte sich ihren Namen, den der griechischen Göttin der Strategie und des Kampfes, redlich verdient. Sie war ein besonders streitsüchtiger Oktopus: sehr aktiv und immer geneigt, sich aufzuregen, was sie durch Rötung und Schwellung der Haut anzeigte.
Kraken sind große Individuen, was sich oft in den Namen niederschlägt, die ihre Pfleger ihnen geben. Im Seattle Aquarium hieß ein Pazifischer Riesenkrake Emily Dickinson. Der Krake war so scheu, dass er sich immer hinter der Kulisse seines Bassins verkroch; das Publikum bekam ihn fast nie zu sehen. Irgendwann wurde er im Puget Sound im Nordwesten der USA freigelassen, dort, wo er einst gefangen wurde. Ein anderes Tier im selben Aquarium hieß Leisure Suit Larry – der »Jogginghosen-Larry«: Sobald sich der Pfleger einen der tastenden Krakenarme vom Körper pellte, rückten zwei andere nach. Ein dritter Oktopus verdiente sich den Namen Lucretia McEvil – »Lucretia von Böse« –, weil er ständig alle Dinge im Bassin zerlegte.
Kraken spüren, dass Menschen auch Individuen sind. Sie mögen die einen, die anderen mögen sie nicht. Und sie verhalten sich anders, wenn sie jemanden kennen und ihm vertrauen. Obwohl leicht misstrauisch gegenüber Besuchern, pflegte George einen freundlich-entspannten Umgang mit seinem Pfleger, dem leitenden Aquaristen Bill Murphy. Ehe ich zu meinem Besuch aufbrach, hatte ich mir ein Video angesehen, das 2007 vom Aquarium auf YouTube eingestellt worden war und die beiden zeigte. George trieb an der Oberfläche seines Beckens. Behutsam tasteten seine Saugnäpfe Bill ab, während der hoch aufgeschossene Aquarist sich hinunterbeugte und den Kraken kraulte und streichelte. »Er ist inzwischen mein Freund geworden«, wandte sich Bill an den Kameramann und ließ seine Finger über Georges Kopf gleiten, »weil ich häufig mit ihm kommuniziert habe. Ich habe mich um ihn gekümmert und ihn jeden Tag besucht. Manche Leute finden Kraken ziemlich gruselig und schleimig«, sagte er, »aber mir gefällt das. Irgendwie sind sie wie Hunde. Ich streiche ihm über den Kopf oder kraule ihm die Stirn. Er liebt das.«
Ein Oktopus braucht nicht lange, um herauszufinden, wer seine Freunde sind. In einer Studie des Seattle Aquarium konfrontierte der Biologe Roland Anderson acht Pazifische Riesenkraken mit zwei ihnen unbekannten Männern, die beide die gleiche blaue Aquariumsuniform trugen. Einer der beiden fütterte einen bestimmten Oktopus regelmäßig, der andere kratzte ihn immer mit einem stacheligen Stock. Binnen einer Woche bewegten sich fast alle Kraken, sobald sie die Männer sahen, ohne sie je berührt oder geschmeckt zu haben, hin zu dem fütternden und weg von dem, der sie ärgerte. Es kam auch vor, dass der Oktopus seinen Wasser speienden Trichter an der Seite des Kopfes, Sipho oder auch Funnel genannt, mit dessen Ausstoß er sich durch das Wasser pflügt, auf die Person richtete, die ihn mit dem stacheligen Stock berührt hatte.
Gelegentlich entwickelt ein Oktopus auch ohne Grund eine Abneigung gegenüber einer bestimmten Person. Im Seattle Aquarium zum Beispiel wurde eine Biologin jedes Mal mit einem Schwall schmerzhaft kaltem Salzwasser aus der Trichterröhre empfangen, wenn sie abends nach einem sonst immer freundlichen Oktopus schaute. Der Krake spritzte sie nass, und zwar nur sie. Wilde Kraken nutzen ihre Trichterröhre nicht nur als Antrieb für die Fortbewegung, sondern auch, um Dinge loszuwerden, die sie nicht mehr benötigen – ganz so, wie wir einen Laubbläser benutzen, um den Gehweg zu reinigen. Womöglich hatte die Lampe der Nachtschicht-Biologin den Oktopus irritiert. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin im New England Aquarium hat von Truman immer eine ähnliche Behandlung erfahren, der sie jedes Mal, wenn er sie sah, mit einem gewaltigen Schwall Salzwasser empfing und vollständig durchnässte. Später dann verließ die Ehrenamtliche das Aquarium und ging aufs College. Nach etlichen Monaten kehrte sie besuchsweise zurück. Und Truman, der zwischenzeitlich niemand anderen nass gespritzt hatte, beglückte sie augenblicklich wieder mit einer Dusche.
Die Vorstellung, dass Tintenfische Gedanken, Gefühle und eine Persönlichkeit haben, klingt für manchen Wissenschaftler oder Philosophen eher befremdlich. Aber selbst den Schimpansen, die mit dem Menschen so nah verwandt sind, dass sie uns ihr Blut spenden könnten, wurde von der Wissenschaft erst kürzlich bescheinigt, ein Lebewesen mit Verstand zu sein.
Der Gedanke, den der Philosoph René Descartes 1637 in die Welt setzte, dass nämlich nur der Mensch denkt (und folglich im Universum der Moral nur Menschen existieren – »Ich denke, also bin ich«), ist in der modernen Wissenschaft immer noch so weit verbreitet, dass sogar Jane Goodall, eine der weltweit anerkanntesten Wissenschaftlerinnen, sich davon einschüchtern ließ: Über zwanzig Jahre lang traute sie sich nicht, einige ihrer äußerst verblüffenden Beobachtungen an wild lebenden Schimpansen zu veröffentlichen. Bei ihren ausgedehnten Studien im Gombe-Stream-Nationalpark in Tansania beobachtete sie viele Male, wie wilde Schimpansen einander mit Absicht täuschten, indem sie zum Beispiel einen Freudenschrei unterdrückten, wenn sie etwas Essbares entdeckt hatten, damit andere nicht auch auf die Früchte aufmerksam wurden. Goodalls langes Zögern, darüber zu schreiben, rührte von ihrer Angst, andere Wissenschaftler könnten ihr vorwerfen, die Tiere zu vermenschlichen, »menschliche« Empfindungen in ihre Studienobjekte hineinzuprojizieren, was in der Tierkunde als Todsünde gilt. Ich habe mit anderen Forschern in Gombe gesprochen, die ebenfalls einige ihrer Erkenntnisse aus den 1970er-Jahren bis heute nicht veröffentlicht haben, weil sie fürchten, ihre Kollegen würden ihnen kein Wort glauben.
»Immer wieder gibt es Bestrebungen, das Vorhandensein von Emotionen und Intelligenz bei anderen Arten kleinzureden«, sagte der Pressesprecher des New England Aquarium, Tony LaCasse, nachdem ich Athena kennengelernt hatte. »Bei Fischen und Wirbellosen sind die Vorurteile besonders groß«, stimmte Scott ihm zu. Wir gingen die Rampe hinauf, die sich spiralförmig um den Giant Ocean Tank rankt, der liebevoll GOT genannt wird. Die dreistöckige, 750 000 Liter fassende Nachbildung einer karibischen Riffgemeinschaft ist die Hauptattraktion des Aquariums. Haie, Rochen, Schildkröten und ganze Schwärme tropischer Fische schwammen wie Traumbilder vorbei, während wir ein wissenschaftliches Tabu brachen und uns über die Existenz eines Bewusstseins unterhielten, das von vielen geleugnet wird.
Scott erinnerte sich an einen Oktopus, dessen hinterlistige Missetaten es mit den raffinierten Täuschungen von Goodalls Affen aufnehmen konnten. »Ungefähr fünf Meter vom Oktopus-Becken entfernt befand sich ein Becken mit einer besonderen Flunderart«, erzählte er. Diese Fische waren Teil einer Studie. Doch zum Schrecken des Wissenschaftlers verschwanden die Fische einer nach dem anderen, Stück für Stück. Eines Tages erwischten sie den Übeltäter – mit roten Armen. Der Oktopus war aus seinem Tank geglitten und hatte eine Flunder gefressen! Als sie dem Oktopus auf die Schliche gekommen waren, »schaute er schuldbewusst zur Seite und glitt fort«.
Tony LaCasse erzählte mir von Bimini, einem großen weiblichen Ammenhai, der einst im Giant Ocean Tank lebte. Eines Tages attackierte die Haidame eine Gefleckte Muräne und schwamm, der Schwanz ihres Opfers schaute noch aus ihrem Maul heraus, im Becken umher. »Einer der Taucher, der Bimini gut kannte«, fuhr Tony fort, »drohte ihr mit dem Zeigefinger und gab ihr einen Knuff auf die Nase.« Bimini reagierte sofort und würgte die Muräne wieder heraus. (Obwohl die Muräne schnellstens zu dem diensthabenden Tierarzt gebracht wurde, war sie nicht mehr zu retten.)
Auch mit unserer Border-Collie-Hündin Sally habe ich einmal etwas Ähnliches erlebt. Sie hatte im Wald ein totes Reh aufgespürt und tat sich gütlich daran. Als ich sie anblaffte und »Aus!« rief, hat sie ihre Beute für mich wieder erbrochen. Auf ihren Gehorsam war ich immer stolz – aber bei einem Hai?
Die Haie fressen die Fische im Becken eigentlich nicht, denn sie sind gut genährt. »Aber manchmal fressen oder verletzen sie andere Tiere, nicht, weil sie hungrig sind, sondern aus ganz anderen Gründen«, sagte Scott. Eine Gruppe Kurznasenmakrelen – lange, schlanke, glänzende Fische, deren Rückenflossen die gebogene Form eines Sensenblatts haben – balgte sich dicht unter der Oberfläche des Giant Ocean Tank. »Es war ein ziemliches Getöse und Getümmel«, sagte Tony. Einer der Sandtigerhaie kam an die Oberfläche geschossen und griff die Fische an. Er biss ihnen in die Flossen, aber er fraß oder tötete sie nicht. Offenbar war der Hai nur verärgert. »Es war der Biss des Überlegenen, nicht der des Räubers.«
Für viele waren solche Gedanken Ketzerei. Skeptiker weisen zu Recht darauf hin, dass es nur allzu einfach ist, sogar Tiere, die uns sehr ähnlich sind, misszuverstehen. Vor Jahren besuchte ich das Forschungscamp der Primatologin Birutė Galdikas auf Borneo, wo aus Gefangenschaft befreite Orang-Utans lernen, in der Wildnis zu leben. Eine noch neue amerikanische Freiwillige, hingerissen von den leuchtend orangeroten, langhaarigen Affen, rannte auf ein erwachsenes weibliches Tier zu, um es zu umarmen. Das Weibchen hob die Mitarbeiterin hoch und schleuderte sie zu Boden. Die junge Frau hatte nicht bedacht, dass der Orang-Utan vielleicht keine Lust hatte, von einer Fremden angegrapscht zu werden.
Es ist verführerisch zu glauben, dass Tiere genauso fühlen wie wir, besonders wenn wir wollen, dass sie uns zugetan sind. Einer meiner Freunde arbeitet mit Elefanten und erzählte mir von einer Frau, die sich Tierkommunikatorin nannte und einen aggressiven Elefanten im Zoo besuchte. Nach ihrer telepathischen Unterhaltung mit dem Elefanten sagte sie zu dem Wärter: »Also, dieser Elefant mag mich sehr. Er möchte seinen Kopf in meinen Schoß legen.« Etwas an diesem Gedankenaustausch hatte die Kommunikatorin wohl richtig verstanden: Elefanten legen durchaus manchmal ihren Kopf in den Schoß eines Menschen. Aber sie tun das, um ihn zu töten. Sie zerquetschen den Menschen mit ihrer Stirn, wie wir einen Zigarettenstummel mit dem Schuh austreten. Der Anfang des 20. Jahrhunderts wirkende österreichischbritische Philosoph Ludwig Wittgenstein schrieb die berühmten Worte: »Wenn ein Löwe sprechen könnte, wir könnten ihn nicht verstehen.« Bei einem Oktopus ist die Möglichkeit, ihn nicht zu verstehen, noch viel größer. Der Löwe ist immerhin ein Säugetier wie wir; ein Oktopus ist völlig anders aufgebaut: Er hat drei Herzen, sein Hirn ist um seinen Hals gewickelt, und statt mit Haaren ist er mit Schleim bedeckt. Sogar sein Blut hat eine andere Farbe als unseres: Es ist blau, weil Kupfer und nicht Eisen der Sauerstoffträger in seinem Körper ist.
In seinem Klassiker The Outermost House schrieb der amerikanische Schriftsteller Henry Beston, dass Tiere »nicht Gleiche und nicht Unterlegene« sind, sondern Geschöpfe, ausgestattet »mit Fähigkeiten der Sinne, die wir verloren oder nie besessen haben, und für Stimmen empfänglich, die wir nie hören«. Tiere sind, schreibt Beston weiter, »je eigene Geschöpfe, die gemeinsam mit uns im Netz aus Raum und Zeit gefangen sind, Mithäftlinge, die das irdische Leben in seiner Herrlichkeit wie in seiner Mühseligkeit mit uns teilen«. Vielen Menschen kommt ein Oktopus nicht nur wie eine andere Nation vor, sondern eher wie ein außerirdisches Wesen aus einer fernen, bedrohlichen Galaxie.
Für mich allerdings war Athena mehr als ein Oktopus. Sie war ein Individuum, das ich sehr mochte, und sie eröffnete mir möglicherweise auch neue Wege. Sie führte mich zu einer neuen Art des Denkens über das Denken, zu einer neuen Art, mir vorzustellen, wie andere Denkweisen aussehen könnten. Und sie inspirierte mich, meinen eigenen Planeten so zu begreifen, wie ich ihn noch nie gesehen hatte – als eine Welt, die fast nur aus Wasser besteht und die ich kaum kannte.
Wieder zu Hause, versuchte ich, meine Begegnung mit Athena noch einmal Revue passieren zu lassen. Das war nicht einfach. Sie war so vielseitig, sie war überall. Ich konnte meine Eindrücke kaum sortieren: der gallertartige Körper und die acht im Wasser schwebenden Gummiarme; die sich ständig verändernden Farben, ihre Form und ihre Textur. Einen Moment hellrot und voller Beulen, war sie kurz darauf wieder glatt und dunkelbraun oder weiß geädert. Einige Stellen ihres Körpers wechselten so schnell – in weniger als einer Sekunde – die Farbe, dass sie schon wieder eine andere Farbe angenommen hatten, ehe ich überhaupt dazu kam, die vorherige Farbe festzuhalten. Sie füllte meine Sinne auf, um es mit einem Wort des Songwriters John Denver zu sagen.
In ihrer Beweglichkeit nicht durch Gelenke eingeschränkt, waren Athenas Arme fortwährend auf der Suche, bildeten Schlingen, streckten und reckten sich, rollten sich auf und wieder ein, und das in alle Richtungen gleichzeitig. Jeder Arm wirkte wie ein eigenständiges Wesen mit einem separat gesteuerten Bewusstsein. Und das kann man wörtlich nehmen. Drei Fünftel der Neuronen eines Oktopus sitzen in den Armen und nicht im Gehirn. Sollte einmal ein Arm vom Körper abgetrennt werden, kann er sich mehrere Stunden lang weiterhin bewegen, als wäre nichts geschehen. Man könnte meinen, der abgetrennte Arm würde immer noch jagen und vielleicht sogar Beute machen, um sie dann in eine Mundöffnung zu befördern, die dummerweise nicht mehr mit dem Arm verbunden war.
Schon ein einziger von Athenas Saugnäpfen reichte aus, um meine ganze Aufmerksamkeit zu fesseln – und sie hatte 1600 davon. Jeder einzelne war ein Multitasking-Talent und konnte saugen, schmecken, zupacken, festhalten, zupfen und wieder loslassen. Jeder Arm des Pazifischen Riesenkraken hat zwei Reihen mit Saugnäpfen, die kleinsten sitzen an den Spitzen, die größten (mit einem Durchmesser von 7,5 Zentimetern bei einem großen männlichen Tier, bei Athena waren es etwa 2 Zentimeter) ungefähr auf einem Drittel der Armlänge, vom Mund aus gemessen. Jeder Saugnapf hat zwei Kammern. Die äußere ist wie eine breite Saugglocke geformt und besitzt Hunderte feiner, sternförmig von der Mitte zum Rand verlaufender Grate. Die innere Kammer ist ein kleines Loch in der Mitte des Napfes, das die Saugkraft erzeugt. Die gesamte Konstruktion ist so biegsam, dass sie sich an die Konturen jedweden Objekts anpassen kann, das der Saugnapf erfasst. Die Näpfe können sich auch zusammenziehen und mit ihren Lippen einen Pinzettengriff bilden, wie wir es mit Daumen und Zeigefinger können. Jeder einzelne wird von eigenen Nerven gesteuert, und der Oktopus kann sie individuell und unabhängig voneinander steuern. Alle Saugnäpfe sind erstaunlich stark. James Wood, verantwortlich für die schon lange bestehende Biologie-Website »The Cephalopod Page«, hat ausgerechnet, dass ein Saugnapf von etwa sechs Zentimetern Durchmesser fast sechzehn Kilogramm Gewicht anheben kann. Wenn alle Saugnäpfe diese Größe hätten, läge die gesamte Saugkraft eines Oktopus bei 25 000 Kilogramm. Ein anderer Wissenschaftler hat ausgerechnet, dass man die Zugkraft einer Vierteltonne benötigt, um den Griff des wesentlich kleineren Gewöhnlichen Kraken zu lösen. »Taucher«, sagte Wood, »sollten sehr vorsichtig sein.«
Athena hat sehr zärtlich an meiner Haut gesaugt. Da ich keine Angst hatte, habe ich keinen Widerstand geleistet, sondern ihrem Ziehen nachgegeben. Und das war goldrichtig, wie ich später erfuhr, als ich mit ihrem Pfleger Bill telefonierte, um einen neuen Besuchstermin zu vereinbaren.
»Sehr viele Leute flippen bei uns aus«, erzählte er mir. »Wir stellen Besuchern immer jemanden zur Seite, der helfen kann, falls jemand Panik bekommt. Unser wichtigstes Ziel ist es, den Oktopus im Becken zu halten. Aber wir können nicht garantieren, dass er drinbleibt. Mit Athena war es so, dass ich vier ihrer Arme auf mir hatte, und als ich sie abpellte, griffen sofort die anderen vier Arme nach mir.«
»Ich glaube, solche Verabredungen hatten wir alle schon mal«, bemerkte ich trocken.
Während Athena noch prüfte, wie meine Hände und Arme schmeckten, setzte sie alles daran, mir auch ins Gesicht zu sehen. Ich fand es beeindruckend, dass sie sogar ein Gesicht, das ihrem so unähnlich war, als Gesicht erkannte, und überlegte einen Moment, ob sie vielleicht mein Gesicht genauso gerne schmecken wie ansehen wollte. Ich fragte Bill, ob das überhaupt erlaubt sei. »Nein«, sagte er mit Nachdruck, »wir lassen sie nicht in die Nähe des Gesichts.« Und warum nicht? Könnte sie mir eventuell ein Auge heraussaugen? »Ja«, sagte Bill, »das könnte sie.« Bill hatte schon öfter ein vergebliches Tauziehen mit Oktopoden erlebt, wenn sie den Griff einer Reinigungsbürste gepackt hatten. »Der Oktopus gewinnt immer. Man muss schon wissen, was man tut – und auf keinen Fall darfst du sie an dein Gesicht lassen.«
»Es fühlte sich so an, als wollte sie mich ins Becken ziehen«, meinte ich.
»Sie könnte dich ohne Weiteres in ihr Becken ziehen, ganz gewiss«, antwortete Bill. »Und sie wird es versuchen.«
Ich aber wollte sie unbedingt ein zweites Mal treffen. Wir vereinbarten meinen nächsten Besuch für einen Dienstag, wenn Bill und sein erfahrenster freiwilliger Helfer, Wilson Menashi, anwesend wären. Scott und nun auch Bill hatten beide das Gleiche über den erfahrenen Wilson gesagt: »Der hat schon eine tolle Art, mit Tintenfischen umzugehen.«
Wilson war früher Ingenieur und Techniker bei der Arthur D. Little Corporation gewesen und hat viele Patente auf seinen Namen laufen. Neben anderen Erfindungen brachte er hochwertige Diamantenimitationen auf den Markt. (Kubische Zirkonia wurden in Frankreich künstlich hergestellt, aber die Franzosen wussten nichts damit anzufangen.) Im Aquarium sollte Wilson aus dem glitzernden Material interessantes Spielzeug für die Tintenfische herstellen, um sie zu beschäftigen. »Wenn sie nichts zu tun haben, langweilen sie sich«, erläuterte Bill. Und einen Tintenfisch zu langweilen, ist nicht nur grausam, sondern ein Vabanquespiel. Durch mein Leben mit zwei Border Collies und einem 350 Kilogramm schweren Hausschwein wusste ich ohnehin, dass intelligente Tiere sich nicht langweilen dürfen – das beschwört Unglück herauf. Unweigerlich lassen sie sich immer etwas Neues einfallen, womit sie die Zeit totschlagen können, und das sind meistens Dinge, die wir gar nicht gerne sehen, wie das Seattle Aquarium einst mit Lucretia McEvil erfahren musste. In Santa Monica brachte es dieser kleine, höchstens zwanzig Zentimeter lange Kalifornische Zweipunktkrake fertig, sämtliche Büros mit Hunderten Liter Wasser zu fluten. Das weibliche Tier hatte an einem Ventil in seinem Becken herumgespielt und so einen Schaden von mehreren Tausend Dollar verursacht; sämtliche nagelneuen und ökologisch hergestellten Fußböden waren ruiniert.
Eine andere Gefahr wäre, dass ein Oktopus aus Langeweile versuchen könnte, auf Wanderschaft zu gehen, um sich einen interessanteren Ort zum Leben zu suchen. In ihrer Fähigkeit, ihren Gefängnissen zu entfliehen, sind die Kraken dem berühmten Entfesselungskünstler Houdini vergleichbar. L. R. Brightwell von der Meeresbiologischen Station im englischen Plymouth traf einmal nachts um halb drei auf einen Oktopus, der gerade die Treppe hinunterkrabbelte. Er war aus seinem Bassin im Labor der Forschungsstation ausgebüxt. Auf einem Fischtrawler, der im Ärmelkanal unterwegs war, gelang es einem frisch gefangenen, auf Deck abgelegten kleinen Oktopus, die Mannschaftsleiter hinunterzugleiten und bis in die Kajüte zu gelangen. Stunden später fand man ihn wieder, er hatte sich in einer Teekanne versteckt. Ein anderer Oktopus, der in einem kleinen privaten Aquarium auf Bermuda gehalten wurde, stieß den Deckel von seinem Becken herunter, glitt auf den Boden, krabbelte von der Veranda und machte sich auf den Weg zurück ins Meer. Das Tier hatte immerhin dreißig Meter zurückgelegt, ehe es auf dem Rasen zusammenbrach, von einer Horde Ameisen attackiert wurde und starb.
Von einem vielleicht noch überraschenderen Fall wurde im Juni 2012 berichtet, als ein Sicherheitsbeamter im kalifornischen Monterey Bay Aquarium um drei Uhr nachts auf dem Fußboden vor dem Shale-Reef-Ausstellungsbecken eine Bananenschale fand. Bei genauerem Hinsehen entpuppte sich die Bananenschale als gesunder, faustgroßer Roter Krake. Der Sicherheitsbeamte verfolgte die nasse Schleimspur zurück und trug den Kraken wieder dorthin, woher er gekommen war. Das Erstaunlichste an der Sache aber war, dass man im Aquarium gar nicht wusste, dass im Shale-Reef-Becken überhaupt ein solcher Roter Krake lebte. Offenbar war er als junges Tier »per Anhalter« dorthin gelangt, festgesaugt an einem Stück Fels oder einem Schwamm, die der Ausstellung hinzugefügt wurden. Er ist dann dort aufgewachsen, ohne dass irgendjemand von seiner Existenz wusste.
Um Unheil abzuwenden, sind Aquariumsangestellte sehr bemüht, ausbruchsichere Deckel für die Oktopus-Becken zu konstruieren, und versuchen, ihre Oktopoden beschäftigt zu halten. Im Jahre 2007 hat der Metroparks Zoo in Cleveland ein Handbuch mit Vorschlägen zur Verbesserung der Lebensqualität von Oktopoden in Aquarien zusammengestellt. Darin finden sich viele Ideen, wie man diese schlauen Tiere unterhalten kann. Einige Aquarien verstecken etwas Essbares in »Mr. Potato Head«-Figuren und lassen die Tintenfische das Spielzeug zur Freude der Kinder auseinandernehmen. Andere bieten ihnen Legosteine an. Das Hatfield Marine Science Center an der Oregon State University entwickelte eine Vorrichtung, die es Tintenfischen erlaubt, durch das Umlegen von Hebeln Farben auf eine Leinwand aufzubringen und so Bilder zu malen, die dann versteigert werden, um Mittel für die Erhaltung der Oktopus-Becken zu generieren.
Im Seattle Aquarium spielte Sammy, der Pazifische Riesenkrake, sehr gerne mit einer Plastikkugel von der Größe eines Baseballs, die man in der Mitte aufschrauben konnte. Ein Angestellter versteckte etwas Essbares darin und war später nicht wenig erstaunt, dass Sammy die Kugel nicht nur auseinander-, sondern auch wieder zusammenschrauben konnte, nachdem er sich den Leckerbissen herausgeholt hatte. Ein weiteres Spielzeug wurde aus Plastikröhren hergestellt, wie man sie für das Tunnelsystem von Rennmäusen verwendet. Aber entgegen der Erwartung der Aquaristen versuchte Sammy nicht, die Spitzen seiner Arme in die Röhren zu stecken – er fand Gefallen daran, die einzelnen Glieder auseinanderzuschrauben. Nach vollbrachter Tat überreichte er sie dann seiner Mitbewohnerin im Wasserbecken, einer Seeanemone. Die Anemone, gehirnlos wie alle Blumentiere ihrer Ordnung, umklammerte die Teile mit ihren Tentakeln, führte sie zu ihrem Mund und spuckte sie schließlich wieder aus.
Aber Wilson Menashi, der begabte Tierpfleger, war seiner Zeit voraus. Lange bevor es das erste Handbuch zur Verhaltensanreicherung bei Oktopoden gab, also viele Tintenfische vorher, kreierte er ein sicheres Spielzeug, das dem Intellekt eines Oktopus angemessen ist. Im Labor der Arthur D. Little Corporation entwickelte er eine Serie von drei durchsichtigen Plexiglaswürfeln mit unterschiedlichen Verschlüssen. Der kleinste Würfel wird durch einen Riegel verschlossen, den man wie bei einer Pferdebox umlegen und mit einem Bolzen fixieren muss. Nun kann man einen lebenden Krebs – das Lieblingsfutter der Kraken – hineingeben und den Deckel unverschlossen lassen. Der Oktopus wird den Deckel öffnen. Verschließt man aber den Deckel, wird der Oktopus garantiert dahinterkommen, wie der Deckel zu öffnen ist. Dann ist es an der Zeit, den zweiten Würfel einzusetzen. Dieser hat einen Riegel, der gegen den Uhrzeigersinn auf eine Klammer gedrückt wird. Man setzt den ersten Würfel mitsamt dem Krebs in den zweiten und verschließt ihn. Der Oktopus wird das Rätsel lösen. Schließlich nimmt man den dritten Würfel hinzu. Dieser hat zwei verschiedene Riegel: Der eine ist ein Bolzenriegel, der andere ist ein Hebelverschluss und fixiert den Deckel wie bei einem altmodischen Einweckglas. Bill erzählte mir, dass der Oktopus, sobald er das System »kapiert« hat, alle vier Schlösser in drei bis vier Minuten öffnen kann.
Ich freute mich auf mein Treffen mit Bill und Wilson und war begierig zu hören, was sie zu erzählen hatten. Am meisten aber sehnte ich mich danach, Athena wiederzusehen und zu beobachten, wie sie sich unter Menschen verhielt, die sie kannte. Und natürlich fragte ich mich: Würde sie mich wiedererkennen?
Ich treffe Bill in der Eingangshalle des Aquariums. Er ist zweiunddreißig Jahre alt, einen Meter fünfundneunzig groß, schlank und muskulös, hat kurzes braunes Haar, ein Lächeln, so breit wie sein ganzes Gesicht, und viele Lachfältchen um die Augenwinkel. Tentakel ranken auf seinem rechten Arm und blitzen unter dem Ärmel seines grünen Diensthemdes hervor: Sein Tattoo zeigt ein portugiesisches Kriegsschiff mit einer Feuerqualle und azurblauen Segeln. Wir gehen die Treppe zum Café des Aquariums hinauf und nehmen von dort den für die Angestellten reservierten Aufgang zur Kaltwasserabteilung, die von Bill geleitet wird. Er ist dort für 15 000 Tiere verantwortlich, von den Wirbellosen wie Athena über Seesterne und Seeanemonen bis hin zu Riesenhummern und bedrohten Schildkrötenarten und den seltsam urzeitlich anmutenden Kurznasenschimären oder auch dem Geisterhai, einem Tiefseebewohner mit breiten anstatt spitzen Zähnen; diese knorpelige Gattung hat sich von der Erblinie der Haie vor 400 Millionen Jahren abgespalten. Bill kennt jeden seiner Schützlinge persönlich, viele von ihnen sogar schon, seitdem sie unter seiner Obhut geboren wurden (oder schlüpften oder keimten). Viele andere Exemplare hat er auf seinen Expeditionen in die eiskalten Gewässer von Maine und den nordwestlichen Pazifik gesammelt.
Wilson erwartet mich schon. Er ist wesentlich kleiner als Bill, ruhig und gepflegt, mit einem dunklen Oberlippenbärtchen und einem Haarkranz, wie er einem Großvater mit fast erwachsenen Enkelkindern zusteht. Er spricht mit einem nahöstlichen Akzent, den ich nicht genau zuordnen kann, und seine achtundsiebzig Jahre sieht man ihm nicht an.
Es ist fast elf Uhr, Athenas Fütterungszeit. Ihre Mahlzeit aus silbrigen, zwölf Zentimeter langen Kapelanen steht auf dem Deckel eines angrenzenden Beckens schon für sie bereit. Wir wollen sie nicht warten lassen. Die Männer heben den schweren Deckel ihres Beckens an und fixieren ihn oben an einem Haken, damit er nicht wieder zufällt. Der Deckel ist mit einem feinen Netz überzogen und präzise den gut durchdachten Umrissen des Beckens angepasst – eine über viele Tintenfischleben perfektionierte Vorsichtsmaßnahme, um Fluchten zu verhindern. Dann lässt Bill mich mit Wilson allein, um anderen Aufgaben in seiner Abteilung nachzugehen. Und Wilson steigt die kleine Trittleiter hinauf und lehnt sich über das Becken.
Athena erhebt sich aus ihrer Höhle, es sprudelt und dampft wie kochendes Wasser. Sie ist so schnell bei Wilson, dass es mir den Atem verschlägt – viel schneller, als sie jemals zuvor zu mir gekommen ist.
»Sie kennt mich eben«, bemerkt Wilson nüchtern und greift in das kalte Wasser, um sie zu begrüßen.
Athenas weiße Saugnäpfe wölben sich aus dem Wasser, um Wilsons Hände und Unterarme zu packen. Mit ihrem silbrigen Auge sieht sie ihn an und überrascht mich dann: Sie schmeißt sich herum wie ein Hundewelpe, der sein Bäuchlein darbietet. Wilson hält den mittleren Saugnäpfen an einem ihrer Vorderarme einen Fisch hin. Und der Fisch wandert wie auf einem Förderband zu ihrem Mund, indem sie ihn von einem Saugnapf zum nächsten weiterreicht. Zu gerne würde ich ihren Schnabel sehen, einen Blick in ihre Mundöffnung erhaschen. Doch ich werde enttäuscht. Der Fisch entschwindet rasch meinem Blickfeld, wie die Stufen am Ende einer Rolltreppe. Und Wilson sagt, auch er habe noch nie einen Oktopus gekannt, der seinen Schnabel gezeigt hätte.
Erst jetzt bemerke ich, dass ein großer orangefarbener Sonnenblumen-Seestern auf Wilsons Hand zuschwimmt. Mit über zwanzig Gliedern, auch Strahlen genannt, und einer Spannweite von über sechzig Zentimetern bugsiert sich das Tier auf 15 000 Röhrenfüßchen in unsere Richtung. Wie alle Seesterne hat auch diese größte Art keine Augen, kein Gesicht und kein Gehirn. (In den Embryos ist zwar ein Gehirn angelegt, doch besinnt sich der Seestern offenbar eines Besseren und bildet stattdessen ein neuronales Netz um die Mundöffnung aus.)
»Er will auch einen Fisch«, sagt Wilson. (Dieser Seestern war in der Tat ein männliches Exemplar, was herauskam, als er eines Tages sein Sperma absonderte und so das Wasser im Tank trübte.) Wilson reicht ihm mit derselben Selbstverständlichkeit einen Kapelan, mit der man einem Gast bei Tisch die Butter reicht.
Wie aber kann ein hirnloses Wesen etwas wollen – und erst recht seine Wünsche einer anderen Spezies gegenüber kommunizieren? Athena könnte es wissen. Für sie ist der Seestern womöglich ein anderes Individuum, ein Nachbar, dessen Gewohnheiten und Eigenheiten sie kennt und erahnen kann. Im Besucherzentrum der meereskundlichen Forschungsstation Hatfield hat ein Seestern die Augen von »Mr. Potato Head« aufgesammelt und zwischen zwei Armen herumgetragen, nachdem der Oktopus sie beim Spielen abgefummelt hatte. (»Das sah wirklich süß aus«, erzählte Kirsten Simmons, die den Mal-Apparat für die Kraken erfunden hat.) Sie beschrieb den Seestern als »neugierig«. Wann immer der Oktopus ein neues Spielzeug bekam, »versuchte der Seestern, es ihm wegzunehmen, und das finde ich erstaunlich«, sagte sie. Wenn einer der Angestellten diesem Seestern ein Spielzeug wegnahm und es versteckte, versuchte er, es so schnell wie möglich wiederzufinden.
Und wieder überlege ich: Kann ein hirnloses Tier neugierig sein? Hat es den Wunsch zu spielen? Oder braucht es Spielsachen und Nahrung in der Weise, wie Pflanzen die Sonne brauchen? Verfügt der Seestern über ein Bewusstsein? Wenn das so wäre, wie fühlt sich dieses Bewusstsein für einen Seestern an?
Offenbar habe ich gerade eine Welt betreten, die ich nicht nach den Regeln beurteilen kann, die an Land und unter Wirbeltieren gelten. Der Seestern beginnt inzwischen, den Fisch vor unseren Augen aufzulösen, der Kapelan schmilzt dahin wie in Zeitraffer. Seesterne können ihren Magen aus dem Mund herausstülpen und so ihre Beute verdauen, die meistens aus Seeigeln, Schnecken, Seegurken oder auch anderen Seesternen besteht.
Sobald der Seestern gesättigt ist, wendet Wilson sich wieder Athena zu und füttert sie mit den restlichen Fischen. Er reicht ihr einen Fisch nach dem anderen, drei insgesamt. Er legt jeden in die Saugnäpfe eines anderen Armes, und ich sehe mit Staunen, wie der Oktopus sie alle von Napf zu Napf weiterreicht und so in Richtung Mund befördert. Es dauert ziemlich lange, bis die einzelnen Fische ihren Bestimmungsort erreichen. Warum nur krümmt Athena nicht die Arme und führt die Fische direkt zu ihrem Mund? Plötzlich habe ich eine Eingebung: vielleicht ja aus demselben Grund, aus dem wir an unserem Eis lecken, anstatt es direkt die Kehle hinunterzuschieben. Geschmack bereitet uns Vergnügen, und Vergnügen empfinden wir auch, weil es nützlich ist: Denn nur durch Schmecken können wir unterscheiden, ob etwas gut und essbar oder ungenießbar ist. Ein Oktopus macht mit den Saugnäpfen das, was wir mit der Zunge machen.
Sobald Athena ihre Mahlzeit beendet hat, spielt sie sanft mit Wilsons Händen und Unterarmen. Gelegentlich kringelt sich die rankenähnliche Spitze eines Armes bis zu seinem Ellbogen hinauf, aber nur sehr träge. Meistens schlängeln sich ihre Arme schwerelos im Wasser, die Saugnäpfe küssen ganz sacht seine Haut. Bei mir hatte sich ihr Saugen forschend und fordernd angefühlt, aber bei Wilson wirkt das alles absolut entspannt. Wenn ich sehe, wie der Mann und der Krake sich berühren, erinnern sie mich an ein glückliches älteres Paar, das viele Jahre in einer liebevollen Ehe gelebt hat und jetzt zärtlich Händchen hält.
Ich tauche meine Hände mit Wilson zusammen ins Wasser und berühre einen von Athenas unbeschäftigten Armen. Langsam streichle ich über ihre Saugnäpfe. Sie ziehen sich zusammen, umschließen die Konturen meiner Haut, versuchen bei mir »anzu-docken«. Ich kann nicht sagen, ob sie mich wiedererkennt. Obwohl sie vermutlich schmecken kann, dass ich jemand anders bin als Wilson, scheint sie mich als einen Teil von ihm wahrzunehmen, vielleicht so, wie man sich gegenüber einem Bekannten verhält, den ein enger Freund mitgebracht hat. Athena saugt sich langsam an meiner Haut fest, lässig und entspannt, genauso, wie sie Wilson begrüßt hat. Ich beuge mich vor, um einen Blick auf ihr perlenförmiges Auge zu erhaschen, und sie zieht ihren Kopf an die Oberfläche, um mich direkt anzusehen.
»Sie hat Augenlider wie ein Mensch«, sagt Wilson. Vorsichtig legt er ihr die Hand über die Augen, sodass sich diese langsam schließen. Sie zuckt nicht zurück und weicht nicht aus. Es gibt zwar keine Fische mehr für sie, aber offenbar bleibt sie wegen unserer Gesellschaft an der Oberfläche.
»Sie ist ein sehr sanfter Oktopus«, sagt Wilson fast träumerisch, »wirklich sehr sanft …«
Hat die Arbeit mit den Kraken ihn selbst auch sanfter und vielleicht einfühlsamer gemacht? Wilson überlegt. »Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll«, sagt er, »mir fehlt die Sprache dafür.« Wilson wurde am Kaspischen Meer im Iran geboren, unterhalb der Küste mit Russland, und weil seine Eltern aus dem Irak kamen, sprach er Arabisch, ehe er als kleines Kind Englisch lernte. Ihm fehlen also nicht die englischen Worte. Er meint, dass er über diese Frage noch nie nachgedacht hat. »Ich habe schon immer Hosenmätze und Kinder gerngehabt«, sagt er, »ich habe einen Draht zu ihnen. Und das hier ist … ähnlich.«
Wie bei der Kommunikation mit einem Kind erfordert der Austausch mit Athena ein gewisses Maß an Aufgeschlossenheit und Intuition, mehr, als für den normalen Diskurs zwischen erwachsenen Menschen innerhalb eines Kulturkreises nötig ist. Aber Wilson vergleicht diesen starken, schlauen, wild gefangenen, erwachsenen Oktopus ganz sicher nicht mit einem menschlichen Säugling, der so unfertig, so unvollkommen und hilflos auf die Welt kommt. Athena ist in den Worten des großen kanadischen Geschichtenerzählers Farley Mowat »mehr-als-menschlich«, nämlich ein Lebewesen, dem wir ganz sicher nicht zur Vollendung verhelfen müssen. Das Wunder besteht darin, dass sie uns erlaubt, Teil ihrer Welt zu sein.
»Fühlst du dich nicht geehrt?«, frage ich.
»Unbedingt«, erwidert er mit Nachdruck. »Sogar sehr.«
Bill, der von seinen anderen Pflichten zurückgekehrt ist, beugt sich mit seinem großen Körper über den Beckenrand und streckt die Arme aus, um Athenas Kopf zu streicheln.
»Ein seltenes Vergnügen«, sagt Bill. »Das ist nicht jedem vergönnt.«
Wie viel Zeit haben wir jetzt mit Athena verbracht? Unmöglich, das zu sagen. Natürlich hatten wir unsere Uhren abgenommen, ehe wir die Arme ins Wasser tauchten. Und als wir das getan haben, begann eine andere Zeitrechnung für uns, die Oktopus-Zeit. Es ist bekannt, dass ehrfürchtiges Staunen das menschliche Zeitgefühl ausdehnt. Ebenso verhält es sich, wenn man im Flow ist, wenn man vollständig in seinem Schaffensprozess aufgeht, mit Konzentration, Engagement und Genuss. Meditation und Gebete verändern ebenfalls die Wahrnehmung der Zeit.
Aber es gibt noch etwas, das unser Erleben von Zeit verändert. Wir Menschen – aber auch Tiere – können den Gemütszustand eines anderen Wesens imitieren. Dabei spielen Spiegelneuronen die zentrale Rolle, eine bestimmte Art von Gehirnzellen, die in gleicher Weise reagieren, ganz egal, ob wir andere bei einer Handlung beobachten oder diese Handlung selber ausführen. Wenn wir zum Beispiel mit einem ruhigen und gut strukturierten Menschen zusammen sind, wird unsere eigene Zeitwahrnehmung sich der seinen anpassen. Vielleicht haben wir also, als wir sie im Wasser berührten, Athenas Zeitempfinden übernommen – flüssig, glitschig und urzeitlich, in einem anderen Takt als jede moderne Uhr. Ich könnte für immer dortbleiben, meine Sinne mit Athenas Fremdartigkeit und Schönheit aufladen und mit meiner neuen Freundin kommunizieren.
Allerdings starben uns allmählich die Hände ab! Sie waren schon so rot und steif, dass wir die Finger nicht mehr bewegen konnten. Unsere Hände aus Athenas Becken herauszuziehen, fühlte sich an, als würde ein Zauber gebrochen. Plötzlich war mir ganz seltsam zumute, ich fühlte mich beklommen, und ein Gefühl der Unzulänglichkeit durchdrang mich. Auch nachdem ich meine Hände minutenlang unter heißes Wasser gehalten hatte, konnte ich den Stift in meiner Tasche noch immer nicht greifen, geschweige denn mir Notizen machen. Als hätte ich Schwierigkeiten, wieder die Person zu werden, die ich vorher war, die Schriftstellerin.
»Guinevere war mein Erster«, erzählt Bill. »Also ist sie auch mein Liebling.« Bill, Scott, Wilson und ich sind zum Mittagessen in ein nahe gelegenes Sushi-Restaurant gegangen. Ich empfinde es als eine seltsame Wahl, aber vielleicht auch wieder nicht – immerhin hatten wir gerade noch Athena beim Verzehr von rohem Fisch beobachtet. Keiner von uns bestellt Oktopus. Ich entscheide mich für California Rolls.
»In den ersten zwei Minuten war Guinevere völlig durcheinander«, fuhr Bill fort. Doch dann habe sie sich beruhigt und sei ganz nah herangekommen, während sie mit ihren Saugnäpfen ganz vorsichtig seine Arme untersuchte.
Guinevere war auch der erste und einzige Oktopus, der Bill jemals gebissen hat. Sie hat ihn aber nicht vergiftet, und der Biss hinterließ auch keine Narbe. Dennoch gab er zu: »Ich möchte das nicht noch einmal erleben.« Es war wie ein Papageienbiss, sagte er. Ein Papagei kann mit seinem Schnabel einen Druck von 300 Kilogramm pro Quadratzoll ausüben, und das ist keine Kleinigkeit, aber Bill nahm es gelassen. Als wollte er Guineveres guten Ruf wiederherstellen, fügte er noch hinzu: »Es war kein schlimmer Biss.«
Und passiert sei es ganz am Anfang ihrer Beziehung. Außerdem, so fügte er noch galant hinzu, sei es seine Schuld gewesen, denn er hätte seine Hand zu nah an ihren Mund geführt. »Sie war neugierig und wollte wissen: Kann ich dich fressen?«
Die Männer erzählten nun von all den anderen Kraken, die sie gekannt hatten.
»George war wirklich sehr brav«, sagte Bill. »Er war ziemlich ruhig, ein ziemlich gutmütiger Oktopus – überhaupt nicht streitlustig. Bei den Streitlustigen musst du die ersten zehn Minuten immer wieder Arme von dir abziehen. Sie greifen ständig nach dir. George aber kam an, krabbelte dir auf den Arm, bekam etwas zu fressen und trollte sich wieder. Manchmal haben wir so eine ganze Stunde zusammen verbracht. Er starb«, fuhr Bill fort, »während ich im Urlaub war.«
Tintenfische leben schnell und sterben jung. Die Pazifischen Riesenkraken gehören wahrscheinlich zu den langlebigsten Tieren dieser Spezies, aber auch sie werden höchstens drei oder vier Jahre alt. Wenn sie ins Aquarium kommen, sind sie mindestens schon ein Jahr alt, manchmal älter. »Ich hatte keine Ahnung, dass George schon bald sterben würde«, sagte Bill. »Für gewöhnlich verändert sich vorher der Körper der Tiere, ihr Verhalten und ihre Färbung. Sie werden dann nicht mehr so rot, sondern sehen die ganze Zeit eher weißlich aus. Die Farbintensität ist nicht mehr da. Auch sind sie weniger verspielt, genau wie bei alten Menschen. Manchmal bekommen sie sogar Altersflecken, weiße Stellen auf der Haut, die sich dann abschälen.«
»Es muss sehr wehtun, einen zu verlieren«, sagte ich zu Bill. Er zuckte nur mit den Schultern. Immerhin gehörte das zum Job. Bei meinem ersten Besuch hatte Scott noch über Bill und seine Tintenfische gesagt: »Sie sind wie eigene Kinder für ihn. Wenn einer stirbt, ist das immer ein großer Verlust. Er hat das Tier schließlich geliebt und über Jahre hinweg jeden Tag betreut.«
Truman, der Nachfolger von George, kam im Aquarium an, als Bill gerade nicht da war. »Truman war von Anfang an einer der aktivsten Tintenfische überhaupt. Er war ein richtiger Opportunist«, erzählte Bill.
Die verschiedenen Tintenfische hatten ganz unterschiedliche Methoden, Wilsons Plexiglaswürfel zu knacken. Alle lernten recht schnell, die Schlösser zu öffnen. Bill begann immer mit dem kleinsten Würfel und zeigte ihn dem Oktopus einmal pro Woche, und das vier Wochen lang. Nach zwei Monaten kam dann der zweite Würfel dran, und diesen konnten sie nach zwei bis drei wöchentlichen Versuchen öffnen. Für den dritten Würfel mit seinen beiden unterschiedlichen Schlössern benötigten sie fünf oder sechs Versuche. Doch auch wenn sie allesamt die Schlösser meisterten, verwendete jeder Oktopus, je nach Charakter, seine eigene Strategie.