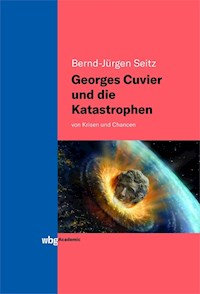11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Wald, Wasser, Wüste, Grasland und Kulturland - da sind die wichtigsten Lebensräume Europas. Wie vielfältig sie sind, zeigt Bernd-Jürgen Seitz anschaulich in diesem Band. Er beschreibt, wo die politischen und geographischen Grenzen verlaufen, die klimatischen und geologischen Grundlagen für die artenreiche Flora und Fauna Europas, welche Umweltbedingungen zu welchen Lebensräumen führen, ihre charakteristischen Tier- und Pflanzenarten sowie das Vorgehen des europäischen Naturschutzes. »Das Gesicht Europas« zeigt das heutige Gesicht der Landschaften und Lebensräume Europas - eine Momentaufnahme der Vielfalt. Dazu bietet der Band einen kleinen Reiseführer zu den Natur- und Kulturlandschaften Europas: Gegliedert nach den Großregionen des Kontinents, werden die wichtigsten Naturräume und Schutzgebiete sowie Nationalparks und Biosphärenreservate der 47 europäischen Staaten beschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Bernd-Jürgen Seitz
Das Gesicht Europas
Die Vielfalt unserer Landschaften
„Selbst unsere gezähmte, regulierte, über Jahrhunderte von Menschenhand überformte mitteleuropäische Landschaft ist immer noch so unendlich reich, vielfältig, aufregend, bezaubernd, wunderschön. Diese Schönheit aber kann man nur genießen, wenn man sich ihr zuwendet, sie im Wortsinn ‚zur Kenntnis nimmt‘ – sich also die Mühe macht, die Vielfalt der Arten wahrzunehmen und zu unterscheiden.“
Johanna Romberg, Federnlesen
Impressum
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitungdurch elektronische Systeme.
wbg THEISS ist ein Imprint der wbg.
© 2020 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), DarmstadtDie Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitgliederder wbg ermöglicht.Lektorat: Christiane Martin, KölnLayout, Satz und Prepress: schreiberVIS, SeeheimEinbandabbildung: mphoto-adobestock.comEinbandgestaltung: Harald Braun, Helmstedt
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-8062-4081-8
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:eBook (PDF): 978-3-8062-4095-5eBook (epub): 978-3-8062-4096-2
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Geleitwort
I.Das Gesicht Europas – und wodurch es geprägt wird
Gliederung und Grenzen Europas
Wie groß ist Europa? Flächen und Besiedlungsdichten
Flächennutzung – ein Indikator für Natur?
Geologie, Klima, Vegetation – Grundlagen der Vielfalt
Die Geologie Europas
Das Klima prägt die Vegetation
Die Vegetation – was wächst wo und warum
Vom Biotop zur Biosphäre
II.Landschaften und Lebensräume
Wald
Wälder in Europa
Gibt es in Europa Urwälder?
Wo welche Bäume wachsen und warum
Bis wohin Bäume wachsen
Was in und an Bäumen lebt
Im Wald da sind die Räuber
Wasser
Von der Quelle bis zur Mündung – Fließgewässer
Seen, Weiher, Tümpel – Stillgewässer
Moore und Sümpfe
Meere und Küsten
Wüste
Gibt es in Europa Wüsten?
Dünen
Kältewüsten
Felsen und Gesteinshalden Karst
Grasland
Grasland oder Grünland?
Steppen in Europa
Vom Winde verweht
Steppentiere
Kulturland
Von der Natur zur Kultur
Grünland – Weiden und Wiesen
Äcker
Weinlandschaften
Lebensraum Stadt
Landschaft im Wandel
Bergland
Gebirge in Europa
Höhenstufen
Lebensraum Hochgebirge
III.Natur oder Kultur – unser Erbe und wie wir damit umgehen
Wo gibt es in Europa noch Wildnis?
Wald
Wasser
Wüste und Steppe
Hochgebirge
Sind auch Kulturlandschaften schützenswert?
Dramatischer Artenrückgang
Gibt es noch Hoffnung?
Wer schützt Europas Natur- und Kulturlandschaften?
Schutzgebiete
Organisationen
Grenzüberschreitende Initiativen
IV.Gesicht zu erkunden – wo gibt es was zu sehen?
Albanien
Andorra
Baltikum
Estland
Lettland
Litauen
Belgien
Bosnien und Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Island
Italien
Kosovo
Kroatien
Liechtenstein
Luxemburg
Malta
Moldawien
Montenegro
Niederlande
Nordmazedonien
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ukraine
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Weißrussland
Literatur- und Quellenverzeichnis
Register
Vorwort
Nach meinem 2017 erschienenen Buch „Das Gesicht Deutschlands: Unsere Landschaften und ihre Geschichte“ war es für mich fast eine logische Konsequenz, meinen Radius auszudehnen und ein Buch über Europa zu schreiben, zumal ich bereits viele europäische Länder bereist habe. Mit einem Buch über die Landschaftsgeschichte Europas hätte ich mich aber übernommen, sodass hier das heutige Gesicht der vielfältigen Landschaften und Lebensräume Europas im Vordergrund steht.
Im ersten Teil werden die Grenzen Europas abgesteckt und die politische und geographische Gliederung aufgezeigt. Ich stelle unter anderem die Frage, ob die Flächennutzung und insbesondere der Waldanteil eines Landes ein Indikator für Naturnähe ist. Es folgen Ausführungen über Geologie und Klima als Grundlagen für die Vegetation bzw. die Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Ich erläutere Begriffe aus der Ökologie vom Biotop zur Biosphäre und gehe dann auf die Biogeographischen Regionen Europas ein.
Im zweiten, zentralen Teil des Buches wird die Vielfalt Europas auf der Grundlage seiner wichtigsten Landschaften und Lebensräume beschrieben. In den sechs Hauptkapiteln Wald – Wasser – Wüste – Grasland – Kulturland – Bergland schildere ich, welche Umweltbedingungen zu welchen Lebensräumen führen, und stelle charakteristische Tier- und Pflanzenarten vor. Dabei werden wichtige und aktuelle Themen immer wieder in Form von „Infoboxen“ eingestreut.
Im dritten Teil gehe ich den Fragen nach, wo es in Europa noch Wildnis gibt und ob auch Kulturlandschaften schützenswert sind. Ich nehme es gleich vorweg: Wenn das nicht der Fall wäre, gäbe es in Mittel- und Südeuropa nicht viel zu schützen, denn dort gibt es kaum noch größere Naturlandschaften. In der mitteleuropäischen Kulturlandschaft ist ein dramatischer Artenrückgang zu verzeichnen, der mit Bienen- oder Insektensterben nur unzureichend umschrieben wird.
Dem gegenüber stehen zahlreiche Regelungen und Initiativen zum Schutz europäischer Natur- und Kulturlandschaften. Da gibt es einmal Schutzgebiete wie Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks bis hin zu Schutzgebietsnetzwerken wie dem Smaragd-Netzwerk und Natura 2000, dem Schutzgebietsnetz der Europäischen Union. Dazu gibt es mehrere Organisationen, die sich dem Schutz der europäischen Natur verschrieben haben, und – besonders erfreulich – auch etliche grenzüberschreitende Initiativen. Besonders hervorzuheben ist dabei das „Grüne Band Europa“ (European Green Belt), das eine Gesamtlänge von rund 1400 km hat und entlang des ehemaligen sogenannten Eisernen Vorhangs durch 24 europäische Staaten vom Eismeer im Norden Norwegens bis zum Schwarzen Meer reicht.
Der vierte und letzte Teil des Buches ist eine Art Reiseführer zu den Natur- und Kulturlandschaften Europas. Die Länder Europas werden alphabetisch mit ihren wichtigsten Daten, Besonderheiten, Landschaften, Naturräumen und Lebensräumen aufgeführt.
Dr. Bernd-J. Seitz
Abb. 1: Landschaft in Sachsen (Deutschland), im Hintergrund das Erzgebirge.
Geleitwort
Das Gesicht eines Landes oder Erdteils wird von der Vielfalt seiner Strukturen, ihrer Zusammensetzung und Anordnung geprägt, deren Betrachtung und Erlebnis die menschlichen Sinne und Empfindungen bewegen. Wanderungen und Reisen durch die Länder sind davon motiviert, jene Vielfalt kennenzulernen und in der Erinnerung festzuhalten.
Doch viele Menschen wollen das Gesicht eines Landes nicht nur erleben und sich daran erfreuen, sondern möchten auch gern erfahren, wie es zustande kommt, worauf sich seine Strukturen und ihre Anordnung in Raum und Zeit gründen. Diesen Wunsch erfüllt das vorliegende Buch mit seinen vier Hauptkapiteln, die von den allgemeinen natürlichen Gegebenheiten bis zu Kurzbeschreibungen der europäischen Länder reichen, in umfassender Weise.
Dessen Bestandteile und Funktionen bringen wiederum die Vielfalt von Natur und Kultur mit ihrer gegenseitigen Abhängigkeit zum Ausdruck – vom Naturland der Wälder, Grasländer, Gewässer, Moore und Gebirge zum davon ausgehenden Kulturland, das zur Lebensgrundlage der Menschen geworden ist.
Als Grundlagen jener Vielfalt Europas beschreibt der weitgereiste Verfasser Geologie, Klima und die Pflanzendecke des Landes und verknüpft diese mit der menschlichen Besiedlung und Nutzung der Flächen. Daraus ergibt sich der – oft verwickelte – Zusammenhang von Natur und Kultur, die beide in regionaler Verschiedenheit und Gewichtung das Gesicht des Landes bestimmen und darin „Landschaften“ hervorgebracht haben. Dieses Wort, dessen Ursprung im Anblick eines als ästhetisch empfundenen Bildes von einem „Stück Land“ liegt und auch zur künstlerischen Gestaltung anregt, hat sich inhaltlich auch auf den Begriff des „Lebensraums“ ausgeweitet. Heute ist das Gesicht des Landes überall von den Menschen und ihren Entscheidungen bestimmt, die über das Land gebieten und dabei vor kaum überwindbaren Gegensätzen stehen: zwischen Wildnis oder Naturnähe und Kultivierung oder Überbauung, zwischen Schützen und Nutzen, zwischen Stadt und Land (wobei „Land“ die zusätzliche Bedeutung als quasi-natürlicher Gegensatz zum rein technischen Gebilde „Stadt“ erhält) sowie zwischen Verantwortung und Gewährenlassen.
Diese komplizierten Zusammenhänge werden in diesem Buch – trotz vieler Details und Verwendung von (gut erläuterten) Fachausdrücken – verständlich und übersichtlich dargestellt. Es vereinigt die Qualitäten eines Reiseführers (Teil IV) mit einem populären Fachbuch der Landschaftskunde, das mit didaktischem Geschick geschrieben ist. Daher empfehle ich es sogar als „transdisziplinäres Lernbuch“, das auch Studierende an Hochschulen neben der reinen Fachliteratur verwenden sollten. Darüber hinaus wird es dazu beitragen, die in aller Vielfalt zum Ausdruck kommende Einheit der Kultur Europas im globalen Kontext hervorzuheben und zu fördern.
Prof. em. Dr. Wolfgang Haber,Technische Universität München inFreising-Weihenstephan, Landschaftsökologie
„Man kann heute die Welt nicht ohne Karte sehen noch sich vorstellen. Die Karte ist eine Transkription der Welt, wie sie ist, sie regt auch die Imagination an und bewahrt unsere Erinnerungen. Woran wir uns in Wirklichkeit erinnern, sind die unzähligen Bilder, die uns die Karten veranschaulicht haben.“
Timothy Brooks (in Francois/Serrier: Europa)
I
Das Gesicht Europas – und wodurch es geprägt wird
Gliederung und Grenzen Europas
Europa ist ein Teil des Kontinents Eurasien, also ein Subkontinent, der aus historischen und kulturellen Gründen aber im Allgemeinen als eigener Kontinent betrachtet wird. Mit über 700 Mio. Einwohnern, die auf einer Fläche von etwa 10 Mio. km2 leben, gehört Europa zu den dichter besiedelten Teilen der Erde, vor allem weist es eine große Anzahl an Großstädten auf.
Deutschland liegt in Mitteleuropa und zumindest nach unserem Empfinden ziemlich genau in der Mitte Europas. Befindet sich also auch der geographische Mittelpunkt Europas in Deutschland? Der Autor war selbst überrascht, als er erfuhr, dass sich dieser in Litauen befindet, das aus deutscher Sicht sehr weit nordöstlich liegt.
Allerdings hängt die Berechnung des Mittelpunkts von den zugrunde gelegten Grenzen Europas ab, und die sind alles andere als eindeutig. Die Grenzfestlegung richtete sich nach wechselnden historischen und weltanschaulichen Kriterien und war daher im Lauf der Zeit immer wieder Änderungen unterworfen. So haben Geographen aus der Österreichisch-Ungarischen Monarchie (1867–1918) den 939 m hohen Tillenberg (tschechisch Dylen) in der Nähe der böhmischen Stadt Eger als den geographischen Mittelpunkt Europas errechnet. Umstritten ist heute insbesondere die Grenze Europas zwischen Kaspischem Meer und Schwarzem Meer (Abb. 2). Die Diskussion geht darum, ob der Hauptkamm des Kaukasus (Abb. 3) oder die Manytschniederung, die einst als Meeresstraße das Kaspische Meer mit dem Schwarzen Meer verband, als Grenze anzusehen ist. Nicht eindeutig ist auch die Abgrenzung in der Ägäis. Gemeinhin wird hier die politische Grenze zwischen Griechenland und der Türkei mit der Grenze zwischen Europa und Asien gleichgesetzt.
Abb. 2: Unterschiedliche Definitionen der Grenze zwischen Europa und Asien. A: Grenze nach Philip Johan von Strahlenberg (1730), B: Grenzziehung entlang Ural (Gebirge und Fluss), F: Kaukasus-Wasserscheide.
Der westlichste Punkt Europas liegt auf der portugiesischen Felseninsel Monchique bei Flores (Azoren), auf dem Festland ist es der Cabo da Roca in Portugal.
Der östlichste Punkt ist Kap Olenij im Norden der russischen Insel Nowaja Semlja; auf dem Festland erreicht das Uralgebirge in seinem nördlichen Teil den 67. östlichen Längengrad.
Der nördlichste Punkt ist Kap Fligely auf der russischen Inselgruppe Franz-Josef-Land, die allerdings gelegentlich zu Asien gezählt wird. Unstrittig zu Europa gerechnet wird die norwegische Inselgruppe Spitzbergen, deren nördlichste Insel Rossøya bis über 80° Nord reicht. Auf dem Festland ist der nördlichste Punkt nicht etwa das Nordkap, das auf einer Insel liegt, sondern das Kap Kinnarodden auf der Halbinsel Nordkinn in Norwegen.
Der südlichste Punkt ist Kap Tripiti auf der griechischen Insel Gavdos, auf dem Festland ist es die Punta de Tarifa in Spanien (Abb. 4).
Betrachtet man den Kaukasus-Hauptkamm als südöstliche Grenze Europas, was in Frankreich und den englischsprachigen Ländern der Fall ist, liegt der geographische Mittelpunkt Europas nach einer Berechnung des Nationalen Geographischen Instituts Frankreichs im Dorf Purnuškes, etwas nördlich von Vilnius in Litauen (Abb. 5).
Nach dem Vorschlag des Ständigen Ausschusses für geographische Namen (StAGN) beim Bundesamt für Kartographie und Geodäsie in Frankfurt/Main wird Europa, wie Abb. 6 zeigt, in Regionen eingeteilt. Einige Staaten liegen nur teilweise in Europa und/oder sind Mitglieder europäischer Bündnisse:
Abb. 3: Der Doppelgipfel des Ushba (4737 m) im georgischen Kaukasus an der Grenze zu Russland.
Abb. 4: Die Punta de Tarifa in Andalusien ist der südlichste Punkt des europäischen Festlands; die Berge im Hintergrund befinden sich in Marokko.
Abb. 5: Der geographische Mittelpunkt Europas liegt nördlich der litauischen Hauptstadt Vilnius.
Russland liegt mit bis zu 25 % seiner Fläche in Europa, wenn man den Nordkaukasus dazuzählt. Im europäischen Teil leben, je nach Zuordnung des Nordkaukasus, etwa 65 bis 75 % der Bevölkerung. Das Land ist ethnographisch, historisch und kulturell Teil Europas.
Kasachstan wird politisch und kulturell zu Asien gezählt und liegt nach der am weitesten verbreiteten geographischen Abgrenzung am Uralfluss mit 5,4 % seiner Landfläche in Europa. Etwa die Hälfte der Einwohner sind Angehörige europäischer Völker (Russen, Ukrainer, Polen, Deutsche).
Die Türkei liegt nach der traditionellen geographischen Abgrenzung an Bosporus und Dardanellen mit 3 % ihrer Fläche in Europa. Etwa 12 % der Bevölkerung leben im europäischen Teil, vor allem in der Altstadt Istanbuls.
Wenn man die Wasserscheide des Kaukasus als Grenze zwischen Europa und Asien ansieht (s. o.), dann liegen auch kleinere Teile Georgiens und Aserbaidschans in Europa. Beide Länder sind, wie auch Armenien, Mitglied im Europarat. Georgien fühlt sich als christlich geprägtes Land – schon 337 wurde das Christentum im antiken georgischen Staat Iberien zur Staatsreligion erklärt – zu Europa gehörig und wird von seinen Bewohnern als „Balkon Europas“ bezeichnet.
Zypern gehört geographisch zu Asien, wird politisch und kulturell jedoch meist zu Europa gezählt.
Wie groß ist Europa? Flächen und Besiedlungsdichten
Wie eingangs bereits erwähnt, leben in Europa auf rund 10 Mio. km2 über 700 Mio. Menschen.
Eine Fläche kann man sich leichter vorstellen, wenn man sie als Quadrat zeichnet (Seitz 2017). Bei einer in Quadratkilometern (km2) angegebenen Fläche hat man dann die Seitenlänge in Kilometern. Deutschland mit knapp 360.000 km2 wird dann zu einem Quadrat mit 600 km Seitenlänge (man zieht einfach die „Quadratwurzel“). Europa mit etwas über 10 Mio. km2 wäre ein Quadrat mit ungefähr 3170 km Seitenlänge.
Das größte Land Europas ist eindeutig Russland, dessen Gesamtfläche mit rund 17 Mio. km2 die Fläche des restlichen Europas deutlich übertrifft. Etwa 75 % davon liegen in Asien, die 25 % in Europa machen aber immer noch über 4 Mio. km2 aus; die Seitenlänge des entsprechenden Quadrats beträgt also mehr als 2000 km. Das zweitgrößte Land Europas wäre eigentlich Dänemark, wenn man das über 2,2 Mio. km2 große Grönland berücksichtigt. Mit seinem europäischen Anteil liegt Dänemark allerdings nur auf Platz 32. Das größte vollständig in Europa liegende Land ist die Ukraine mit rund 600.000 km2, danach kommt Frankreich mit 544.000 km2. Deutschland mit seinen 357.000 km2 liegt nach Spanien (505.000 km2) und Schweden (450.000 km2) auf Platz 5.
Gehen wir an das andere Ende der Skala: Der kleinste Staat Europas ist der Stadtstaat Vatikanstadt mit nicht einmal 0,5 km2, Monaco umfasst immerhin rund 2 km2. Auf rund 60 km2 bringt es der „Zwergstaat“ San Marino; Liechtenstein (160 km2), Malta (316 km2) und Andorra (468 km2) sind schon etwas größer. Luxemburg ist 2568 km2 groß; alle weiteren Staaten Europas haben mindestens 10.000 km2, ihr Quadrat hat also eine Seitenlänge von über 100 km (Abb. 7).
Abb. 6: Vorschlag des Ständigen Ausschusses für geographische Namen zur Abgrenzung europäischer Regionen.
Die Einwohnerdichte eines Landes ist in der Regel umso höher, je kleiner es ist. Dies ist auch in Europa so, wobei Monaco mit über 25.000 Einwohnern pro Quadratkilometer (Ew./km2) deutlich vor Vatikanstadt liegt, das „nur“ 1800 Ew./km2 beherbergt. Über 1000 Ew./km2 liegt sonst nur noch Malta. Am dünnsten besiedelt ist nicht Russland als größtes Land, sondern Kasachstan und Island mit wenig mehr als 3 Ew./km2. Das bedeutet, dass jedem Einwohner theoretisch eine Fläche von über 30 ha (oder 300.000 km2) zugeordnet werden kann. Russland hat eine Einwohnerdichte von 8 Ew./km2, im europäischen Teil liegt sie mit 26 Ew./km2 jedoch deutlich darüber. Wie im Deutschland-Buch (Seitz 2017) ist die Einwohnerdichte in Abb. 8 als Fläche dargestellt, die einem Einwohner theoretisch zur Verfügung steht, Kasachstan und Island liegen hier also an der Spitze.
Abb. 7: Fläche Europas im Verhältnis zu ausgewählten europäischen Staaten (angegeben in km2 und gerundeter Seitenlänge des Quadrats in m).
Abb. 8: Einwohnerdichte Europas und ausgewählter Staaten, dargestellt als Fläche pro Einwohner (angegeben in km2 und gerundeter Seitenlänge des Quadrats in m).
Flächennutzung – ein Indikator für Natur?
In Deutschland wird etwas über die Hälfte der Fläche landwirtschaftlich genutzt, rund 30 % sind von Wald bedeckt, die Siedlungs- und Verkehrsfläche macht (mit steigender Tendenz) knapp 14 % aus. Da auch die Wälder überwiegend nicht mehr dem Naturzustand entsprechen, gibt es in Deutschland keine vom Menschen unbeeinflusste „natürliche“ Landschaften mehr (Seitz 2017). Lediglich ein Drittel der Fläche Deutschlands ist noch „naturnah“ (geringe menschliche Beeinflussung) oder „halbnatürlich“ (extensiv genutzt), zwei Drittel der Fläche kann als „naturfern“ (intensiv genutzt) oder „naturfremd“ (versiegelt) bezeichnet werden (Quelle: www. ioer-monitor.de).
Wie sieht es in dieser Hinsicht in den anderen europäischen Ländern aus?
Zu den naturfremden „künstlichen Oberflächen“ gibt es nur für die Länder der Europäischen Union verlässliche Daten. Sie bedecken etwa 3,5 % der Gesamtfläche, sind allerdings nicht deckungsgleich mit den Siedlungs- und Verkehrsflächen, die neben den versiegelten („künstlichen“) Flächen auch z.B. Flächen für Hofräume, Grünflächen, Seitenstreifen u.a. enthalten. So umfassen die „künstlichen Oberflächen“ in Deutschland nur etwas über die Hälfte der Siedlungs- und Verkehrsflächen, nämlich 7,4 %. Dieser Anteil liegt in der Europäischen Union nur auf der kleinen Insel Malta (23,7 %) sowie in den Niederlanden (12,1 %), Belgien (11,4 %) und Luxemburg (9,8 %) höher, knapp hinter Deutschland liegen Dänemark und Italien (6,9 %), dann folgt das Vereinigte Königreich mit 6,5 %. Am wenigsten versiegelte Fläche weisen in der EU Finnland, Lettland und Schweden mit 1,6 % und Bulgarien mit 1,8 % auf, gefolgt von Estland mit 2 % und Rumänien mit 2,2 % (Quelle: Eurostat, Daten von 2015).
Auch wenn bei Weitem nicht alle Wälder naturnah sind, so ist doch der Anteil der Waldfläche eines Landes ein Indikator für dessen Naturnähe. Zu den Waldflächen der europäischen Länder gibt es unterschiedliche Angaben und Statistiken; hier werden (wie in Wikipedia) die Daten der Weltbank aus dem Jahr 2015 verwendet – aufgelistet werden nur Länder, die (zumindest mit ihrem Kernland, wie z.B. Frankreich) vollständig in Europa liegen (Abb. 9). Finnland und Schweden stehen mit Waldanteilen von 73 % bzw. 69 % an der Spitze, gefolgt von Slowenien (62 %), Lettland (54 %) und Estland (53 %). Ganz am unteren Ende dieser Skala stehen Island und die Insel Malta mit einem Waldanteil von gerade einmal 0,5 bzw. 1 %, weniger als 15 % Waldfläche haben Irland und die Niederlande (jeweils 11 %), das Vereinigte Königreich (13 %) und Dänemark (knapp 15 %).
Auf der anderen Seite weist ein hoher Anteil an landwirtschaftlich genutzten Flächen eher auf „Naturferne“ hin, da die Agrarflächen heute meist intensiv genutzt werden. Hier steht die Republik Moldau mit fast 75 % an der Spitze, gefolgt von der Ukraine und dem Vereinigten Königreich (71 %), Irland (64 %), Dänemark (62 %), Griechenland, Rumänien (je 60 %) und Ungarn (59 %). Den bei Weitem geringsten Anteil an landwirtschaftlicher Nutzfläche haben Norwegen (3 %), Finnland und Schweden (je 7,5 %), mit großem Abstand folgen San Marino und Montenegro (je 17 %), Island (19 %), Estland (23 %) und Kroatien (28 %).
Noch deutlichere Hinweise in Bezug auf die Naturnähe eines Landes erhält man, wenn man landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Nutzung miteinander in Beziehung setzt. So übersteigt in Norwegen, Finnland und Schweden der Waldanteil den Anteil an landwirtschaftlichen Flächen um den Faktor 11, 9,1 und 8,6, mit riesigem Abstand folgen Montenegro mit 3,6, Estland mit 2,3 und Slowenien mit 2,1, also mit doppelt so viel Waldfläche wie landwirtschaftlich genutzte Fläche. Deutschland liegt mit dem Faktor 0,7 im hinteren Mittelfeld; ganz am Ende stehen, sieht man einmal von Malta und Island mit ihrer extrem geringen Waldfläche ab, die Niederlande, Dänemark, Irland, das Vereinigte Königreich, Moldawien und die Ukraine mit 0,2 (Verhältnis Waldfläche zu Landwirtschaftsfläche 1 : 5).
Abb. 9: Waldanteil der europäischen Länder (6 Kategorien).
Wie hoch der Anteil der Waldfläche und der Landwirtschaftsfläche in Gesamteuropa liegt, lässt sich nur ungefähr abschätzen, da vor allem für den europäischen Teil Russlands keine verlässlichen Daten vorliegen. Wenn man zugrunde legt, dass der Anteil dieser Nutzungen im europäischen Teil ungefähr gleich ist wie in Gesamtrussland, nämlich 50 % Waldfläche und 13 % Landwirtschaftsfläche, kommt man für Europa auf ca. 4 Mio. km2 Waldfläche (davon allein 2 Mio. in Russland) und 3 Mio. km2 Landwirtschaftsfläche – bei einer Gesamtfläche von rund 10 Mio. km2 wären das 40 % Waldfläche und 30 % Landwirtschaftsfläche.
Genug der statistischen Daten, die für unser Thema „Natur in Europa“ nur grobe Hinweise geben können. Über großräumige naturnahe Landschaften wie das Wattenmeer (s. S. 64) oder artenreiche Kulturlandschaften wie die spanischen Dehesas (s. S. 104) sagen sie gar nichts aus.
Geologie, Klima, Vegetation – Grundlagen der Vielfalt
Die Geologie Europas
Die gegenwärtige Küstenlinie Europas mit ihrem vertrauten Umriss ist eine verhältnismäßig junge Erscheinung, größere Veränderungen gab es noch nach dem Ende der jüngsten Kaltzeit. So lag noch vor gut 10.000 Jahren zwischen Ostengland und Dänemark ein großes Landgebiet, als Doggerland bezeichnet (Park 2015).
Abb. 10: Spalte an der Grenze der Eurasischen und Nordamerikanischen Platte im bingvellir-Nationalpark auf Island.
Im vorliegenden Buch geht es aber nicht um die geologische Geschichte Europas, sondern um das heutige „Gesicht“ des Subkontinents. Der geologische Untergrund soll hier vor allem als Substrat für die Bodenbildung und die Vegetation betrachtet werden. Deshalb genügt die Betrachtung der groben Einteilung in Silikatgesteine und Karbonatgesteine, die entscheidend ist, da Silikate in Verbindung mit Wasser sauer, Karbonate aber basisch (alkalisch) reagieren. Dies wiederum ist von grundlegender Bedeutung für die Bodenbildung und die Pflanzendecke, die das Gesicht Europas prägten. Fast 90 % der Erdkruste bestehen aus Silikaten, sodass diese zumindest mengenmäßig bedeutender sind als die Karbonate. Unter Letzteren überwiegt das Kalziumkarbonat, der Grundbestandteil des Kalksteins.
Die imposantesten Zeugnisse der Landschaftsentwicklung sind sicherlich die Gebirge, die zu unterschiedlichen Zeiten durch Vorgänge der Plattentektonik (Abb. 10) aufgefaltet wurden, und zwar durch die Kollision von Kontinentalplatten. Den Unterschied zwischen Mittelund Hochgebirgen machen wir heute vornehmlich an ihrer Höhe fest; in Wahrheit sind die meisten Mittelgebirge aber lediglich älter und wurden seither zu großen Teilen durch Wasser und Wind abgetragen – man nennt dies Erosion. So entstanden viele Mittelgebirge wie der Schwarzwald, der Harz oder das Rheinische Schiefergebirge vor 300 bis 400 Mio. Jahren und werden seither abgetragen, während die Alpen erst vor 50 bis 100 Mio. Jahren aufgefaltet wurden und immer noch wachsen.
Abb. 11: Topographie Europas.
Die europäischen Gebirge (Abb. 11) entstanden im Wesentlichen in drei Phasen der Gebirgsbildung (Orogenese). Bei der Kaledonischen Orogenese entstanden vor rund 450 Mio. Jahren die heute nur noch als erodierte Reste erhaltenen Gebirge der Britischen Inseln, teilweise auch die skandinavischen Grundgebirge. Die Variszische Orogenese, die vor etwa 420 Mio. Jahren begann und vor 250 Mio. Jahren endete, ist für die heutigen Mittelgebirge Mitteleuropas bis nach Südengland und Südirland verantwortlich. Die bislang letzte globale Gebirgsbildungsphase, bei der die europäischen Hochgebirge von den Pyrenäen über die Alpen und die Karpaten bis zum Kaukasus aufgeworfen wurden, wird als Alpidische Orogenese bezeichnet. Sie begann vor etwa 200 Mio. Jahren im Zeitalter des Jura und hält bis heute an.
Das Klima prägt die Vegetation
Überwiegend liegt Europa in der gemäßigten Klimazone, die sich durch große Unterschiede zwischen den Jahreszeiten und große Schwankungen der Tageslänge auszeichnet. Dabei nimmt von West nach Ost der Einfluss des Meeres ab, das Klima ist zunehmend kontinental geprägt, d.h. die Temperaturunterschiede zwischen den Jahreszeiten werden größer und die Niederschlagsmenge geringer. Der Norden Europas ist der kaltgemäßigten und subpolaren Klimazone zuzurechnen. Im Süden herrscht mit dem Mittelmeerklima ein subtropisches Klima vor. Die Sommer sind heiß und trocken, die Winter mild und niederschlagsreich.
In den Gebirgsregionen herrscht aufgrund großer Höhen ein meist sehr kaltes Klima, in einem typischen Gebirge sinkt die jährliche Durchschnittstemperatur alle 1000 Höhenmeter um etwa 6 °C. An den Gebirgsrändern stauen sich feuchte Luftmassen bzw. Regenwolken, diese kühlen sich mit zunehmender Höhe ab und erzeugen starke Niederschläge. Die nun trockenen Luftmassen strömen jetzt über das Zentrum des Gebirges hinweg und am anderen Gebirgsrand als Föhn herab. Auch können innerhalb des Gebirges aufgrund von Höhenunterschieden starke Luftströmungen entstehen.
Abb. 12: Durch menschliche Nutzung geprägtes Vegetationsmosaik am Rand eines Weinbergs (Kenzingen, Deutschland).
Das Klima ist der prägende Faktor für die Vegetation einer Region und damit letztlich auch für die Tierwelt. Die biogeographischen Regionen Europas (s. S. 23) richten sich im Wesentlichen nach dem Klima.
Die Vegetation – was wächst wo und warum
Wichtigste großräumige Faktoren für das Vorkommen oder Fehlen bestimmter Pflanzenarten sind das Klima und der geologische Untergrund, hinzu kommen kleinräumig wirksame Faktoren. Von Bedeutung ist etwa die Exposition, d.h. die Ausrichtung eines Hangs in eine bestimmte Himmelsrichtung. Ist der Hang nach Süden geneigt, dominieren wärme- und trockenheitsliebende (bzw. -ertragende) Pflanzen, während bei Nordexposition solche vorherrschen, die Schatten und höhere Luftfeuchtigkeit bevorzugen. Auch die Neigung bzw. Steilheit eines Hangs spielt eine Rolle: Einen Extremfall stellt etwa ein Fels oder eine senkrechte Lösswand dar, auf der nur wenige Pflanzen wachsen können.
Ein entscheidender Faktor in der Kulturlandschaft ist natürlich der Einfluss des Menschen. Auf einer Wiese wachsen andere Pflanzen als auf einem Acker oder in einer Rebfläche. Der Grund hierfür liegt auf der Hand: Nicht jede Pflanzenart erträgt eine ein- bis mehrmalige jährliche Mahd, und noch weniger werden mit einer Bodenbearbeitung in Form von Hacken, Pflügen oder Fräsen fertig.
Es gibt aber auch Unterschiede im Pflanzenbewuchs, die sich nicht so einfach erklären lassen: Warum stehen an einem Wegrand an einer Stelle hauptsächlich Brennnesseln, während einige Meter weiter vorwiegend Gräser wachsen und noch ein Stück weiter Gebüschsteht? Auch hier hat der Mensch seine Finger im Spiel: An einer Stelle wurden vielleicht des Öfteren organische Abfälle abgelagert, was das Nährstoffangebot stark erhöht hat; eine andere Stelle wird regelmäßig gemäht, eine dritte ist nur in geringem Ausmaß Nährstoffen oder Störungen ausgesetzt (Abb. 12). Bereichert der Mensch durch seine Eingriffe also die Kulturlandschaft? Dies gilt nur, solange ein ausgewogenes Verhältnis zwischen vergleichsweise intensiv und extensiv bzw. nicht genutzten Bereichen besteht. Sind die Störungen zu groß bzw. ist die Nutzung zu intensiv geht die Anzahl der Tier- und Pflanzenarten drastisch zurück.
Bei genauerer Betrachtung der Pflanzenbestände fällt auf, dass man an vergleichbaren Standorten ähnliche Artenkombinationen antrifft. Dies hängt damit zusammen, dass diese Arten mit den entsprechenden Standortbedingungen besser zurechtkommen als andere und daher einen Konkurrenzvorteil haben. Solche wiederkehrenden Typen von Pflanzenbeständen nennt man Pflanzengesellschaften. Die Fachrichtung innerhalb der Botanik, die sich mit der Vergesellschaftung von Pflanzen befasst, ist die Pflanzensoziologie (Wilmanns 2002).
Aktuell ist der größte Teil der Fläche Europas nicht von Naturlandschaften, sondern von Kulturlandschaften bedeckt. Um die grundlegenden ökologischen Faktoren der Vegetation zu verstehen, soll hier zunächst die natürliche Vegetation Europas betrachtet werden (BfN 2000), auch wenn diese in manchen Regionen fast verschwunden ist. Die potenzielle Verbreitung der vorherrschenden natürlichen Vegetation steht im Einklang mit den aktuellen klimatischen Gegebenheiten, ist ein Ausdruck der Geologie und der Böden und zeigt ferner die Gesetzmäßigkeiten der Differenzierung der Vegetation in Länge, Breite und Höhe auf. Dagegen bleiben die Auswirkungen des direkten menschlichen Eingriffs weitgehend unberücksichtigt, da diese auf die potenzielle natürliche Vegetation bisher nur schwer eingeschätzt werden können.
Der größte Teil Europas wäre ohne Einfluss des Menschen von Wäldern bedeckt. In Mitteleuropa würden von Natur aus Buchenwälder (s. Abb. 17) dominieren, die vor allem in Berglagen weit nach Süden reichen würden. Auf Auenstandorten oder im winterkalten Kontinentalklima von Osteuropa gedeiht die Buche nicht sehr gut, an die Stelle der Buchenwälder treten Eichen-Hainbuchenwälder. Im kalten Klima Ost- und Nordeuropas treten Nadelbäume wie Fichte und Kiefer in den Vordergrund, man spricht von borealem Nadelwald oder Taiga. Die relativ gleichförmigen Nadelwaldgebiete werden unterbrochen von baumfreien Mooren. Noch weiter im Norden lichten sich die Wälder und Birken, Fichten oder Kiefern wechseln sich mit Zwergsträuchern und Hochstaudenfluren ab.
In Süd- und Südosteuropa besteht die natürliche Vegetation aus wärmeliebenden Laubmischwäldern, in denen zahlreiche verschiedene Eichenarten vorkommen. Im submediterranen Bereich mit warm-gemäßigtem Klima sind es meist sommergrüne Laubwälder, d.h. die Bäume werfen im Winter ihr Laub ab. Im Mittelmeerklima werden sie von immergrünen Hartlaubwäldern abgelöst, deren Bäume sich durch ledrige und langlebige Blätter vor der sommerlichen Trockenperiode schützen. Auch hier dominieren meist Eichenarten wie die Steineiche oder die Korkeiche (s. Abb. 18 und 19).
Wird das Klima noch trockener, wie im äußersten Südosten Europas, gehen die Laubwälder von aufgelichteten Waldsteppen in baumlose Steppen und schließlich sogar in Wüsten über (s. S. 77ff.). Als Wüsten bezeichnet man auch die vegetationsarmen Flächen im hohen Norden (Kältewüsten), an die sich bei weniger extremen Bedingungen die Tundra oder Kältesteppe anschließt. Charakteristisch für die verschiedenen Formen der Tundra ist eine offene, baumfreie Landschaf – meist über dauerhaft gefrorenen Böden (Permafrostböden) – die von Flechten, Moosen, Gräsern und Zwergsträuchern dominiert wird (Abb. 13).
Neben der bisher erwähnten zonalen Vegetation, die hauptsächlich vom Großklima der entsprechenden Zone bestimmt wird, gibt es auch die azonale Vegetation, die von speziellen Standortsbedingungen abhängt. Hierzu gehören z.B. die Wasservegetation, die Küstenvegetation und die Vegetation der Flussauen und sonstiger Feuchtstandorte. Weiterhin gibt es noch die extrazonale Vegetation auf Standorten, deren Mikroklima und sonstige Standortverhältnisse so stark vom Großklima abweichen, dass sie eher einer Vegetationseinheit einer anderen Klimazone gleichen. Ein Beispiel hierfür ist die Vegetation der Hochgebirge, die stark an diejenige des hohen Nordens erinnert und auch etliche Arten mit ihr gemeinsam hat (Arten mit boreo-alpiner Verbreitung.
Die biogeographische Region der Holarktis, die den Großteil der nördlichen Hemisphäre der Erde umfasst und zu der auch Europa gehört, wird in verschiedene Florenregionen unterteilt, die sich nach den dort vorkommenden Pflanzenarten richten. Durch die Kaltzeiten des Pleistozäns starb in Europa ein Großteil der Pflanzenarten des vorangegangenen Pliozäns aus, sodass die europäische Flora heute verarmt ist.
Abb. 13: Typische Zwergstrauchtundra (Fjäll in Nordschweden).
Vom Biotop zur Biosphäre
Die Biologie besteht aus vielen Teildisziplinen wie Zoologie, Botanik, Mikrobiologie, Genetik usw. Die Ökologie – als Lehre vom Haushalt der Natur – ist in der Regel keine eigene Teildisziplin, sondern „versteckt“ sich in anderen, wie z.B. der Zoologie und der Geobotanik. Der Autor, der Biologie studiert hat, hatte das Glück, an der Universität Freiburg zwei hervorragende Lehrer in Sachen Ökologie zu haben, Herrn Prof. Dr. Günther Osche (1926–2009) und Frau Prof. Dr. Otti Wilmanns (*1928).
Abb. 14: Gestufter Waldrand auf der Schwäbischen Alb (Baden-Württemberg, Deutschland).
„Ein Biotop ist, wenn man Gummistiefel braucht“, kolportierte Frau Prof. Wilmanns augenzwinkernd, denn das war es, was viele „gefühlsmäßig“ für ein Biotop hielten, als damals die Feuchtgebiete im Fokus des Naturschutzes standen. Viel diskutiert war auch die Frage, ob es „das Biotop“ oder „der Biotop“ heißen musste. In universitären Kreisen wurde Letzteres vertreten, heute geht beides.
Wörtlich übersetzt heißt Biotop „Ort des Lebens“ (griechisch: bios = Leben, topos = Ort), und das trifft auch ziemlich genau die Bedeutung des Begriffs: Ein Biotop ist der Lebensraum einer Lebensgemeinschaft – einer Biozönose – in einem bestimmten Gebiet. „Biotope sind die kleinsten Einheiten der Biosphäre“ (Quelle: Wikipedia/Biotop). Und damit sind wir schon beim nächsten „Bio-Begriff“, der Biozönose. Der Begriff „Biocönose“ wurde 1877 von Karl August Möbius (1825–1908) geprägt, der die auf einer Austernbank lebenden Organismen als eine Lebensgemeinschaft auffasste. Heute ist eine Biozönose definiert als Gemeinschaft von Organismen verschiedener Arten in einem abgrenzbaren Lebensraum (Biotop) bzw. Standort. Biozönose und Biotop bilden zusammen ein Ökosystem.
Den Übergangsbereich zwischen zwei Ökosystemen nennt man Ökoton. In diesen Übergangsbereichen finden sich in der Regel mehr Tier- und Pflanzenarten als in den angrenzenden Ökosystemen. Ökotone können natürlich auftreten, z.B. Seeufer oder die alpine Waldgrenze, oder auf den Einfluss des Menschen zurückgehen, z.B. Heckenstreifen und Waldränder in der Kulturlandschaft (Abb. 14).
Bisweilen falsch verwendet wird der Begriff der ökologischen Nische einer Tier- oder Pflanzenart. Das Wort „Nische“ suggeriert eine räumliche Kategorie, die ökologische Nische bezeichnet jedoch die Gesamtheit der biotischen und abiotischen Umweltfaktoren, die das Überleben einer Art beeinflussen. Einige Autoren (z.B. Osche 1973) umschreiben die ökologische Nische von Tieren auch als deren „Beruf“ oder „Planstelle“ innerhalb einer Lebensgemeinschaft. Das trifft die Sache insofern ganz gut, als die ökologische Nische neben den von einer Art genutzten Requisiten eines Lebensraums auch die „Fähigkeit“ (Anpassung) der Art beinhaltet, mit diesen Requisiten umzugehen.
Es soll nun hier noch auf einen weiteren, eher selten verwendeten Begriff eingegangen werden, der aber in diesem Buch eine Rolle spielt: das Biom, in den Geowissenschaften auch als Ökoregion oder Ökozone bezeichnet. Diese Begriffe stehen für die vorherrschende Lebensgemeinschaft (Biozönose) oder auch das gesamte vorherrschende Ökosystem eines ausgedehnten Bereichs der Erdoberfläche.
Die Umweltstiftung WWF (World Wide Fund for Nature) entwickelte ein Modell weltweiter Ökoregionen, die als relativ große Bereiche der Erdoberfläche „nach der potenziellen Zusammensetzung der Arten, der Lebensgemeinschaften und der Umweltbedingungen vor großen Landnutzungsänderungen geographisch abgegrenzt werden“ können. Wie bei allen biogeographischen Modellen erfolgt auch hier eine künstliche Grenzziehung, da die Übergänge zwischen den Regionen in Wirklichkeit fließend sind. Im Gegensatz zum klassischen Ökoregion-Begriff, der ausschließlich durch die Gestalt seiner Pflanzenformationen abgegrenzt wird, beruht das WWF-Modell auf einer Kombination verschiedener biogeographischer Konzepte. In einem zehnjährigen Prozess unter Hinzuziehung von Hunderten verschiedener Experten entstand so ein beispielhaftes System aus über 800 Land-Ökoregionen (terrestrisch), die in 14 „Major habitat types“ (Haupt-Biome) und sieben biogeographischen Reichen untergliedert werden. Ebenfalls neu ist die Festlegung von Süßwasser- und Meeres-Ökoregionen (Quelle: www.lexas.de).
Die Biosphäre ist der Raum der Erde, in dem Leben vorkommt. Sie reicht von ungefähr 60 km über bis 5 km unter die Erdoberfläche, dabei werden ihre Außengrenzen ausschließlich von Mikroorganismen bewohnt. Innerhalb der Biowissenschaften wird der Begriff vor allem in ökologischem Zusammenhang verwendet. Dies wird durch das Konzept der UNESCO-Biosphärenreservate untermauert, die teilweise ebenfalls kurz als „Biosphäre“ bezeichnet werden. Es handelt sich um Modellregionen, in denen nachhaltige Entwicklung in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht exemplarisch verwirklicht werden soll. Die Biosphärenreservate werden im weiteren Verlauf des Buches noch eine Rolle spielen.
Zur ökologischen Zonierung Europas werden in diesem Buch die Biogeographischen Regionen der Europäischen Union verwendet (Abb. 15), die auch die europäischen Länder außerhalb der EU mit umfassen – sie dienen insbesondere der Einordnung der Natura 2000-Gebiete und des Smaragd-Netzwerkes (s. S. 141). Teilweise wurden die Regionen etwas willkürlich an Ländergrenzen „abgeschnitten“, aber insgesamt sind sie gut geeignet, um die Biome bzw. Ökoregionen Europas abzugrenzen und zu charakterisieren. In Europa gibt es zehn Biogeographische Regionen (Tab. 1).
Abb. 15: Biogeographische Regionen Europas (s. auch Tab. 1).
Tab. 1: Die Biogeographischen Regionen Europas in der Reihenfolge ihrer Fläche mit charakteristischen Lebensräumen und Anzahl der Staaten, in denen sie vorkommen.
Abb. 16: Blick auf den 1062 m hohen Pfänder, den „Hausberg“ von Bregenz (Österreich).
„Landschaft ist etwas außerordentlich komplexes, nicht nur von ihrer Ausstattung her, sondern auch – oder insbesondere – bezüglich der Ansprüche, die an sie gestellt werden.“
Werner Konold (in Schindler/ Stadelbauer/Konold: Points of View)
II
Landschaften und Lebensräume
Abb. 17: Buchenjungwuchs in einem rumänischen „Urwald“ (Nationalpark Semenic-Cheile Carasului, Rumänien).
Wald
Wälder in Europa
Die Wälder Europas sind gegenüber denen anderer Kontinente vergleichsweise artenarm, insbesondere arm an Baumarten. Dies hängt in erster Linie damit zusammen, dass in Europa Querbarrieren wie die Alpen und der Kaukasus die Wanderung von Süd nach Nord erschweren oder gar verhindern, während dies z.B. in Nordamerika nicht der Fall ist – dort verlaufen die großen Gebirge von Nord nach Süd. Insbesondere während der Kaltzeiten (Pleistozän) verschwanden viele Baumarten aus Mitteleuropa, nur einige konnten danach wieder zurückkehren.
Nach der letzten Kaltzeit traten an die Stelle der eiszeitlichen Tundren nach und nach lichte, mit Kiefern durchsetzte Birkenwälder, später breiteten sich von den Alpen her Haselnusssträucher aus. In der sogenannten Mittleren Wärmezeit (Atlantikum) vor etwa 8000 bis 4000 Jahren dominierte der Eichenmischwald; zur Eiche gesellten sich Ulme, Linde und Esche. Danach wurde das Klima allmählich kälter und es tauchten erstmalig Buchen, Tannen und Fichten in größerer Zahl in den Wäldern auf.
Abb. 18: Alte Steineiche (Sierra de Grazalema, Andalusien, Spanien).
Für den steinzeitlichen Menschen verschlechterten sich durch zunehmende Bewaldung nach und nach die Jagdbedingungen. Zunächst konnte dies dadurch kompensiert werden, dass sich die Menschen bevorzugt an Gewässern ansiedelten, wo Fische und andere Wassertiere noch genügend Nahrung boten. Vor etwa 7000 Jahren war Mitteleuropa ein weitgehend geschlossenes Waldland. Wie dicht dieser Wald war, darüber gehen die Meinungen auseinander. Es gab zu dieser Zeit nämlich eine ganze Anzahl großer Pflanzenfresser wie Wisent, Auerochse und Wildpferd, die in der Lage waren, den Wald zurückzudrängen. Große Pflanzenfresser heißen in der Fachsprache Megaherbivoren, und daher wird die Auffassung, dass viele Wälder durch diese Pflanzenfresser stark aufgelichtet waren, als Megaherbivorenhypothese bezeichnet. Diese Frage ist auch deshalb so interessant, da vor 7000 bis 8000 Jahren die Ackerbauern und Viehzüchter der Jungsteinzeit (Neolithikum) aus Südosteuropa nach Mitteleuropa einwanderten. Wenn damals die Wälder (noch) nicht völlig geschlossen waren und z.B. baumlose „Inseln“ bestanden, sind die ersten Siedlungen wohl an diesen offenen Stellen angelegt worden (Poschlod 2015).
Abb. 19: Korkeichenwald mit teilweise abgeschälter Borke (Naturpark Los Alcornocales, Andalusien, Spanien).
Abb. 20: Mit Ausnahme des roten Samenmantels ist die Eibe sehr giftig.
Auch ohne die Megaherbivoren waren die Wälder zur Zeit der Einwanderung der Menschen nach Mitteleuropa deutlich lichter als heute, und zwar deshalb, weil ihnen ein „Schattbaum“ fehlte, der heute in unseren Laubwäldern allgegenwärtig ist: die Rotbuche, meist nur Buche genannt (Abb. 17). Sie wurde während der letzten Kaltzeit aus Mitteleuropa verdrängt und überlebte im Mittelmeerraum. Vor etwa 10.000 Jahren begann ihre Rückeroberung des europäischen Verbreitungsgebiets, vor etwa 7000 Jahren trat sie erstmals in Südostdeutschland auf. Da zu dieser Zeit die „Neolithiker“ bereits eingewandert waren, bezeichnen manche die Buche sogar als Kulturfolger. Da sie auf den meisten Standorten konkurrenzkräftiger ist als die anderen Baumarten, dominierte die Buche unsere Wälder mehr und mehr.
Heute findet man Buchenwälder von Mittel- bis Osteuropa, im Mittelmeerraum kommen sie in der Bergwaldstufe der Gebirge vor. Im osteuropäischen Tiefland werden sie nach und nach durch Eichen-Hainbuchen-Wälder ersetzt. Im Nordosten reicht die Rotbuche bis zur Weichselniederung in Polen, einzelne Bäume kommen noch bis Kaliningrad (Königsberg) vor. Nach Norden sind Buchenwälder bis Südschweden und Südengland verbreitet, in Norwegen in direkter Meeresnähe bis zu den Lofoten. Die artenreichsten Buchenwälder Europas finden sich im Norden der Balkanhalbinsel (Kroatien).
Buchenwälder können in den Süd- und Südostalpen die natürliche Baumgrenze bilden und hier bis über 1800 m Höhe wachsen. In Mitteleuropa und in den Nordalpen werden sie ab etwa 800 bis 1000 m Höhe von Nadelbaumarten, vor allem der Fichte, abgelöst.
Ähnlich wie in hohen Berglagen nehmen nach Norden hin die Nadelbäume zu, bis sich schließlich in Nordeuropa relativ einförmige boreale Nadelwälder breitmachen, auch Taiga genannt. Sie werden von Fichten, Kiefern, Tannen und Lärchen geprägt, Laubbäume wie Birken und Espen kommen in geschützten Lagen hinzu. Der Boden ist zumeist flächendeckend von niedrig wachsenden, sommergrünen Zwergsträuchern (z.B. Heidel- und Preiselbeeren) und von dicken „Teppichen“ aus Moosen und Flechten bedeckt.
Im warmen Mittelmeergebiet findet man dagegen häufig Hartlaubgewächse wie die Steineiche (Abb. 18) mit kleinen, steifen, ledrigen und langlebigen Blättern, die oft wie die Nadeln der Koniferen immergrün sind. Dies ist eine Anpassung an die sommerliche Trockenperiode. Im Mittelmeerraum sind die hochwüchsigen und geschlossenen Steineichenwälder, die früher für die Region kennzeichnend waren, durch Übernutzung (Holzeinschlag, Beweidung, Ackerbau) auf winzige Reste zusammengeschmolzen (s. S. 99). Im westlichen Mittelmeergebiet gibt es teilweise noch ausgedehnte Korkeichenwälder (Abb. 19).
Abb. 21: Stehendes und liegendes Totholz in einem Buchenurwald (Nationalpark Semenic-Cheile Carasului, Rumänien).
Die submediterrane Klimazone, die nördlich und in größeren Gebirgshöhen an die eigentliche mediterrane Zone anschließt, ist die Heimat der Flaumeichenwälder. Allerdings sind auch diese Wälder durch jahrhundertelange starke Übernutzung vielerorts stark zurückgedrängt und die verbliebenen Bestände degradiert worden. So wird für Italien geschätzt, dass Flaumeichenwälder in über 20 % der Landesfläche die potenzielle natürliche Vegetation bilden; ihr tatsächlicher Anteil beträgt aber nur noch 0,8 %. Die Flaumeiche erreicht u.a. am Kaiserstuhl den Süden Deutschlands.
Gibt es in Europa Urwälder?
Bevor diese Frage beantwortet werden kann, muss man zunächst fragen, was Urwälder überhaupt sind. „Ursprüngliche Wälder“ können es nicht sein, da sich die Vegetation im Lauf der Erdgeschichte in ständigem Wandel befindet und man daher keinen „Ursprung“ definieren kann. Während manche Regenwälder Millionen von Jahren alt sein können – das älteste Waldgebiet der Erde in Malaysia ist 130 Mio. Jahre alt –, ist das Alter von Wäldern in Europa durch die Kaltzeiten sehr begrenzt. Lediglich einige Baumarten wie die Eibe (Abb. 20) haben die Kaltzeiten in Refugien überdauert und gelten als sogenannte Tertiärrelikte.
Nach der Definition der FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) sind Urwälder oder Primärwälder Waldgebiete, die eine natürliche Vegetation aufweisen, ohne sichtbaren menschlichen Einfluss sind und deren natürliche Dynamik ungestört verläuft. Zumindest in Mitteleuropa gibt es nur noch ganz wenige vom Menschen unbeeinflusste Wälder. Die aus der Nutzung genommenen Naturwaldzellen oder Bannwälder werden daher auch als „Urwälder von morgen“ bezeichnet, da sie bis vor kurzer Zeit noch genutzt wurden und erst in der Zukunft vielleicht einmal an Urwälder erinnern werden. Auch wiederhergestellte „Urwälder“ können der FAO-Definition genügen.
Unter der Bezeichnung „Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas“ führt die UNESCO zahlreiche räumlich getrennte Buchenwaldgebiete in Albanien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Italien, Kroatien, Österreich, Rumänien (Abb. 21), der Slowakei, Slowenien, Spanien und der Ukraine als Weltnaturerbe. Die Gesamtfläche der eingetragenen Buchenwälder beträgt ca. 92.000 ha, wovon rund 30 % in der Ukraine liegen. In Deutschland handelt es sich bis auf winzige urwaldartige Reliktflächen um naturnahe Altwälder, während die Bestände in den Karpaten als echte Urwälder bezeichnet werden.
Im Jahr 2018 wurde eine Studie über die letzten Urwälder Europas veröffentlicht (Sabatini et al. 2018). Zunächst einmal stellten die zahlreichen Autorinnen und Autoren der Studie fest, dass über Primärwälder nur lückenhafte Daten vorliegen und diese kaum zwischen den verschiedenen Staaten verglichen werden können. Bekannte Urwälder bedecken immerhin 1,4 Mio. ha in 32 Ländern, das sind 0,7 % der europäischen Waldfläche. Die Urwälder sind sehr ungleichmäßig über die europäischen Staaten, die biogeographischen Regionen und die Waldtypen verteilt, die meisten gibt es in unzugänglichen Bergregionen und in der nordischen Taiga (Abb. 22). Ein Großteil dieser Flächen (89 %) ist geschützt, aber nur 46 % sind streng geschützt. Bisher nicht kartierte Urwälder gibt es wohl vor allem in den unzugänglichsten und am dünnsten besiedelten Regionen, in denen der Waldanteil hoch ist und die Waldnutzung eine geringe Rolle spielt bzw. spielte.
Viele dieser Urwälder sind nach wie vor gefährdet, vor allem in Osteuropa gehen gerade in jüngster Zeit große Flächen verloren (Beispiel Rumänien, Polen). Dagegen sind weite Teile im westlichen Russland noch heute von unberührten Wäldern bedeckt und bilden inzwischen das einzige Rückzugsgebiet für jene Tierarten, denen über 30 andere europäische Länder keinen Lebensraum mehr bieten: Große Raubtiere (s. S. 43) wie Braunbär, Wolf und Luchs zählen dazu, aber auch kleinere Tiere wie Gleithörnchen (s. S. 44), Dreizehenspecht und Uhu bevorzugen unberührte Baumbestände, weil sie in Asthöhlen wohnen, im morschen Altholz nach Larven suchen oder wie der Uhu sehr empfindlich auf Störungen am Brut- oder Rastplatz reagieren.
Abb. 22: Borealer Nadelwald an einem See (Nationalpark Norra Kvill, Småland, Schweden).
THEMA
Das Auerhuhn
Das Auerhuhn ist der größte Hühnervogel Europas, der Hahn (Abb. 23) kann bis zu 1 m groß werden, die Henne bis zu 60 cm. Lebensraum des Auerhuhns sind lichte Wälder, in denen seine Hauptnahrungsquelle, die Heidelbeere, gut gedeiht. Wegen seiner Größe ist das Auerhuhn kein guter Flieger, auch deshalb sollten die Bäume nicht zu dicht stehen. Es hält sich hauptsächlich am Boden auf, nur zum Schlafen flattert es auf Äste. Auerhühner fressen nicht nur die Heidelbeeren, sondern fast die ganzen Sträucher, vor allem die Triebe, Blätter und Blüten – bis zu 2 kg täglich.
Abb. 23: Balzender Auerhahn.
Im Winter stellen sie ihre Nahrung um auf Kiefernnadeln, im Notfall weichen sie auch auf Tannen- und Fichtennadeln aus. In ihrem Muskelmagen befinden sich zahlreiche Steinchen, mit denen die karge Nahrung zerrieben wird. Da Kiefernnadeln nicht sehr nahrhaft sind, ist es wichtig, dass die Vögel im Winter nicht gestört werden. Müssen sie fliehen, verbrauchen sie zu viel Energie. Im Extremfall kann es tödlich sein, wenn sie nicht genügend Kalorien zu sich nehmen können.
Beeindruckend ist die Auerhahnbalz im März und April. Dazu versammeln sich einige Auerhähne an bestimmten Balzplätzen und versuchen, die Auerhennen mit ihrem Imponiergehabe zu beeindrucken. Ihr Balzgesang klingt für menschliche Ohren in etwa wie das Schleifen einer Sense und das Ploppgeräusch beim Entkorken einer Weinflasche. Nach dem Gesang vollführen sie einige Flattersprünge, und wenn dann noch nicht klar ist, wer der Hahn im Korb ist, kämpfen sie gegeneinander. Zu Verletzungen kommt es selten. Die Hennen suchen sich dann ihren Partner aus, mit dem sie eine Familie gründen möchten.
95 % des europäischen Bestands leben in Russland und Skandinavien, während die Bestände in Mitteleuropa außerhalb der Alpen stark rückläufig sind. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts gingen in Mitteleuropa die Bestände zurück, Randpopulationen z.B. in den Ardennen und in Niedersachsen erloschen. Seit Ende der 1940er-Jahre beschleunigte sich der Rückgang drastisch. Hauptgrund für die Abnahme der Auerhuhnvorkommen ist der Verlust von geeigneten Lebensräumen. Da das Auerhuhn hohe Ansprüche an sein Habitat stellt, sind Schutzmaßnahmen schwer zu realisieren. Für eine stabile Population werden etwa 50.000 ha zusammenhängende und ausreichend strukturierte Fläche benötigt. Die Populationen verhalten sich äußerst labil gegenüber Infrastrukturprojekten, die ihren Lebensraum einschränken und die Tiere bis hin zum Stresstod (im Winter) stören können. Des Weiteren spielt in Mitteleuropa die hohe Prädatorenzahl (Fuchs, Baummarder, Habicht, Wildschwein u.a.) eine – wenn auch umstrittene – Rolle.
Auch in Deutschland ist das Auerhuhn stark im Rückgang begriffen, neben der alpinen Population im Nationalpark Berchtesgaden besiedelt es hauptsächlich den Schwarzwald, den Bayerischen Wald und das Fichtelgebirge. Im Schwarzwald, wo bisher die meisten deutschen Auerhühner lebten, ist in den letzten Jahren nochmals ein beschleunigter Rückgang zu verzeichnen, sodass sich die Frage stellt, ob sein Aussterben im höchsten deutschen Mittelgebirge noch aufzuhalten ist (Hockenjos 2019) – trotz umfangreicher Schutzbemühungen wie dem „Aktionsplan Auerhuhn“.