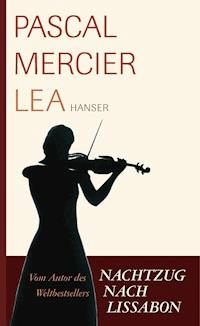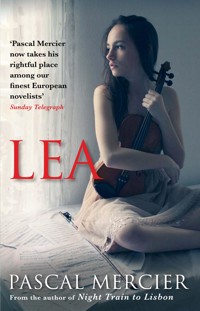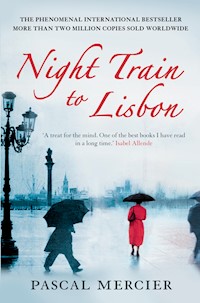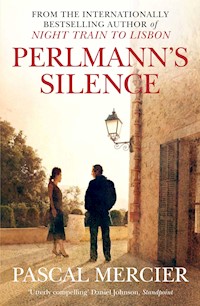Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Jetzt, da er wieder eine Zukunft hatte, wollte er verschwenderisch mit seiner Zeit umgehen.“ – Der neue Roman von Pascal Mercier, dem Autor des Bestsellers „Nachtzug nach Lissabon“
Seit seiner Kindheit ist Simon Leyland von Sprachen fasziniert. Gegen den Willen seiner Eltern wird er Übersetzer und verfolgt unbeirrt das Ziel, alle Sprachen zu lernen, die rund um das Mittelmeer gesprochen werden. Von London folgt er seiner Frau Livia nach Triest, wo sie einen Verlag geerbt hat. In der Stadt bedeutender Literaten glaubt er den idealen Ort für seine Arbeit gefunden zu haben – bis ihn ein ärztlicher Irrtum aus der Bahn wirft. Doch dann erweist sich die vermeintliche Katastrophe als Wendepunkt, an dem er sein Leben noch einmal völlig neu einrichten kann. Wieder ist Pascal Mercier ein philosophischer Roman gelungen, bewegend wie der "Nachtzug nach Lissabon."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 880
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
»Jetzt, da er wieder eine Zukunft hatte, wollte er verschwenderisch mit seiner Zeit umgehen.« — Der neue Roman von Pascal Mercier, dem Autor des Bestsellers »Nachtzug nach Lissabon«Seit seiner Kindheit ist Simon Leyland von Sprachen fasziniert. Gegen den Willen seiner Eltern wird er Übersetzer und verfolgt unbeirrt das Ziel, alle Sprachen zu lernen, die rund um das Mittelmeer gesprochen werden. Von London folgt er seiner Frau Livia nach Triest, wo sie einen Verlag geerbt hat. In der Stadt bedeutender Literaten glaubt er den idealen Ort für seine Arbeit gefunden zu haben — bis ihn ein ärztlicher Irrtum aus der Bahn wirft. Doch dann erweist sich die vermeintliche Katastrophe als Wendepunkt, an dem er sein Leben noch einmal völlig neu einrichten kann. Wieder ist Pascal Mercier ein philosophischer Roman gelungen, bewegend wie der »Nachtzug nach Lissabon.«
Pascal Mercier
Das Gewicht der Worte
Roman
Escrever não faz homens novos. Cria, porém, clareza e compreensão. Ou o seu semblante. E quando alguém é bem-sucedido com as palavras, é como um despertar para si próprio, e nasce, então, um novo tempo: o presente da poesia.
Pedro Vasco de Almeida Prado, O tempo da poesia Lisboa 1903
Schreiben macht keine neuen Menschen. Aber es schafft Klarheit und Verstehen. Oder doch den Anschein. Und wenn man mit seinen Worten Glück hat, ist es wie ein Aufwachen zu sich selbst, und es entsteht eine neue Zeit: die Gegenwart der Poesie.
Pedro Vasco de Almeida Prado, Die Zeit der Poesie Lissabon 1903
1
»Welcome home, Sir«, sagte der Beamte bei der Passkontrolle am Londoner Flughafen. Simon Leyland sah ihn an, wie man jemanden ansieht, der gerade etwas Wichtiges gesagt hat, etwas, was einen trifft. Er nahm seinen Pass entgegen. »Thank you«, sagte er, »thank you very much.« Langsam ging er den Gang entlang zur Rolltreppe, die hinunter zur Gepäckausgabe führte. Ab und zu trat er zur Seite, blieb stehen und betrachtete alles, als sähe er es zum ersten Mal. Auf der Treppe dann blätterte er im Pass und betrachtete sein Foto. Das letzte Mal hatte er es in seinem Arbeitszimmer in Triest betrachtet. Da war es das Foto von einem gewesen, der keine Zukunft mehr hatte. Jetzt zeigte das Bild einen Mann, für den sich die Zukunft wieder öffnete. So richtig glauben konnte er es immer noch nicht. Lange ließ er den Blick auf dem Bild ruhen und stolperte unten an der Treppe, als die gleitende Stufe, die ihn getragen hatte, unter dem festen Boden verschwand. Während er auf seinen Koffer wartete, dachte er daran, wie er den Pass in Triest in die Schublade zu den anderen Dokumenten gelegt hatte, die die Kinder finden würden. Ohne dass er es hätte erklären können, hatte er ihn mit der flachen Hand auf die Papiere gedrückt. Es war eine Bewegung der Endgültigkeit gewesen, ein Druck, der etwas besiegelte, und noch während die Bewegung andauerte, war er darüber erschrocken. Das war im September gewesen, ein glutheißer Tag voller Schirokko. Jetzt war November, und das Flugzeug war im Landeanflug durch feinen Nebel geglitten.
Leyland ging auf die Treppe zu, die hinunter zur U-Bahn führte, und blieb oben stehen. Er betrachtete das große, leuchtende Emblem der Bahn, den breiten roten Kreis, durchschnitten von einem blauen Balken mit den weißen Buchstaben UNDERGROUND. Vier oder fünf Jahre alt war er gewesen, als er es zum ersten Mal sah. Er war mit der Mutter im Zug von Oxford nach London gefahren, sie waren in Paddington Station ausgestiegen und hatten die U-Bahn genommen. Die Londoner nannten sie the tube, und sie waren stolz darauf, dass es die älteste U-Bahn der Welt war, hatte ihm die Mutter erklärt. Gebannt hatte er in die schwarze Mündung des Tunnels geblickt, an dessen Wänden Bündel von dicken, rußgeschwärzten Kabeln entlangliefen. Weit hinten im Dunkel erschienen Lichter von trübem Gelb, die immer größer und heller wurden, begleitet von einem geheimnisvollen, bedrohlichen Grollen, das immer mehr anschwoll. Als der Zug schließlich mit einer Bewegung aus dem Tunnel schoss, die wie ein Überfall war, und donnernd in die Station einfuhr, schob er ein Luftkissen vor sich her, das über den Bahnsteig fegte und das lose Papier auf dem Bahnsteig aufwirbelte. Die Luft roch nach Keller, nach Staub und Kohleofen, und doch auch ganz anders, es war ein Geruch, wie es ihn nur dort unten gab, es war der Geruch der großen, geheimnisvollen Stadt, und der Junge an der Hand der Mutter hatte die Luft tief eingeatmet.
Jetzt ging Leyland die Stufen hinunter zum Bahnsteig. Heathrow war das Ende der Piccadilly Line, und der Zug stand schon bereit. Er stieg ein und setzte sich so, dass er das Diagramm des U-Bahnnetzes sehen konnte. Er kannte das Netz auswendig, und es gab keine Station, bei der er nicht mindestens einmal ausgestiegen wäre. Der Gedanke, dass es unter dieser riesigen Stadt — so tief unten, dass man endlos lange auf den steilen Rolltreppen stand — überall Tunnel gab, in denen Hunderte von Zügen mit trüben Lichtern durch das rußige Dunkel fuhren, hatte nie aufgehört, ihn zu faszinieren, und in seinen Arbeitszimmern hatte er an der Wand stets einen Plan des Netzes aufgehängt. Sidney, sein Sohn, hatte lange vergeblich versucht, ihn zu einem mobilen Telefon zu überreden. Schließlich hatte er ihm eines zum Geburtstag geschenkt und darauf ein Programm installiert, das über Unregelmäßigkeiten in der Londoner U-Bahn informierte. Das Signal klang wie ein heller, träge fallender Wassertropfen, und dann war da etwa zu lesen: Central Line: two minutes delay at Bond Street. Leyland konnte nicht genug davon bekommen und trug das Telefon stets bei sich, obwohl er es hasste, überall erreichbar zu sein. Wenn das Signal in Gesellschaft ertönte, holte er das Telefon hervor und las mit ausdruckslosem Gesicht vor: Circle Line: three minutes delay at Victoria Station. Die Leute hielten es für eine Marotte, aber es war viel mehr als das. Manchmal setzte er sich auf die Molo Audace, die große Mole am Triestiner Hafen, ließ die Beine baumeln und wartete auf das Signal aus London. Er ging erst weg, wenn er es gehört und die Botschaft gelesen hatte. Diese Mole und die tube: wenn sie nur am selben Ort hätten sein können.
Leyland lauschte dem gedämpften Klopfen der Räder, als der Zug losfuhr. Immer, wenn er es nach längerer Zeit wieder hörte, spürte er, wie sehr er das sanfte, rhythmische Klopfen vermisst hatte. Es war ein Geräusch, das alles leichter machte. Im September, als er den Pass für immer weglegte, hatte er sich vorgestellt, hier in der Bahn zu sitzen und das Geräusch zu hören. Es würde nichts mehr helfen, hatte er gedacht. Nichts würde mehr helfen. Jetzt schloss er die Augen. Es war vorbei. Es war doch vorbei.
Leicester Square. Leyland ging den Gang entlang zur Northern Line. Auf dem Bahnsteig stand er vor dem Automaten mit Cadbury’s Schokolade. Bei jedem Besuch in London pflegte er Münzen einzuwerfen und eine Tafel mit dem dunkelblauen Papier und der goldenen Aufschrift herauszuziehen. Langsam ließ er die Schokolade jeweils im Mund zergehen, übersprang mehrere Züge und atmete tief ein, wenn das Luftkissen über ihn hinwegfegte. Dabei dachte er an das letzte Mal und an das vorletzte und rief sich in Erinnerung, was in der Zwischenzeit geschehen war. Was habe ich aus der Zeit meines Lebens gemacht?, fragte er sich dann regelmäßig. Manchmal schien ihm das eine einfache und klare Frage zu sein; dann wieder schien sie einen sonderbaren Klang zu haben, und er war nicht sicher zu wissen, wonach er fragte, und wie eine Antwort lauten könnte. Er war dann in Gedanken in Triest, er sah alles genau vor sich, jede Straße und jeden Raum, er konnte alle wichtigen Begebenheiten rekapitulieren, und trotzdem hatte er das beunruhigende Gefühl, dass das alles nicht ganz wirklich war. Dass es an ihm vorbeiglitt, ohne ihn mitzunehmen. Wie konnte das sein? Umgekehrt kam es ihm, wenn er durch Triest ging, manchmal vor, als verlöre sein früheres Leben in London immer mehr an Wirklichkeit. In solchen Momenten klang das helle Signal der Londoner U-Bahn auf seinem Telefon wie eine ferne, verblassende Erinnerung, oder wie ein Phantasma, eine Episode purer Phantasie. Nur wenn er an einer Übersetzung arbeitete und Stunde um Stunde nach den richtigen Worten suchte, war er sicher vor diesem Gefühl der zurückweichenden, schwindenden Wirklichkeit. Nur dann war alles in Ordnung und voller Gegenwart.
Dieses Mal zog er keine Schokolade aus dem Automaten. Dieses Mal sollte es anders sein. Die Frage nach der Zeit seines Lebens würde sich jetzt neu stellen. Er war hierhergekommen, um ihr auf neue Weise zu begegnen. Wie — das wusste er noch nicht. Warren Shawn, sein Onkel, hatte ihm sein Haus in Hampstead vererbt. In den letzten Tagen in Triest hatte er immer öfter daran gedacht, und immer mehr war es ihm als der richtige Ort erschienen, um über die nächste Wegstrecke nachzudenken. Sidney und Sophia hatten bemerkt, dass er den großen Koffer mitnahm. Beim Abschied am Flughafen hatte Sophia auf seinen Pass gezeigt. »Du hast nie einen italienischen beantragt«, hatte sie gesagt. Er war seiner Tochter, die bald Ärztin sein würde, übers Haar gefahren. »Keine Sorge, ich komme wieder«, hatte er gesagt. Als das Flugzeug abhob, hatte er hinuntergeblickt und gedacht: vierundzwanzig Jahre. Und jetzt?
Die Räder der Bahn klopften. Tottenham Court Road, Goodge Street, Warren Street, Euston. Noch vier Stationen bis Belsize Park. Der Zug fuhr ein. Das war die Station, die er von allen am besten kannte. Drei Jahre lang war er hier ein- und ausgestiegen, als er im Belsize Retreat Hotel in der Mansarde gewohnt und für einen Hungerlohn als Nachtportier gearbeitet hatte. Das war mehr als vierzig Jahre her. Er hatte jede Bank auf dem Bahnsteig gekannt, jede Reklame, beinahe jede Kachel an der Wand und jede Fuge. Auf der anderen Seite der Station hatte es zwei Automaten mit Cadbury’s Schokolade gegeben, auf dieser Seite nur einen. Als er bei seinem letzten Besuch hier ausgestiegen war, hatte er gesehen, dass der eine Automat beschädigt war und schräg an der Wand hing. Auf stille, unsichtbare Weise hatte er die Fassung verloren. Im Traum hatte er den Automaten wieder richtig befestigt. Wenn er dann wegging und zurückblickte, hing er wieder schief.
Als der Zug in Hampstead einfuhr, verscheuchte Leyland die Erinnerung. Er nahm den Aufzug und trat auf die neblige Straße hinaus. Das Licht der Laternen bildete einen diffusen, milchigen Hof. Er ging durch die stillen Straßen, die Räder seines Koffers ratterten auf dem Kopfsteinpflaster. Schräg gegenüber von Warren Shawns Haus gab es eine Teestube, der Onkel hatte dort pünktlich um vier seinen Nachmittagstee getrunken. Leyland setzte sich in einer Nische ans Fenster und blickte zum Haus hinüber. Von der Straße zurückgesetzt, stand es dunkel und still zwischen den kahlen Obstbäumen. Konnte es wirklich sein, dass dieses Haus jetzt ihm gehörte? Warren Shawn hatte es gekauft, als er mit vierzig seine Professur für orientalische Sprachen an der School of Oriental and African Studies bekam. Er hatte viele Jahre im Orient verbracht, in Beirut, Damaskus, Isfahan und Jerusalem, und war als einer der jüngsten Professoren berufen worden. Das war im Jahr, als Leyland aus der Schule in Oxford davongelaufen und im Belsize Retreat Hotel untergekommen war. Er hatte Warren Shawn besucht, es war Spätsommer, das Haus roch nach frischer Farbe, und die Bücherkisten mit den fremdländischen Aufklebern standen noch unausgepackt herum. Der Onkel hatte nicht gefragt, warum er aus Oxford davongelaufen war, und Leyland war ihm dafür dankbar gewesen. Insgeheim hatte er gehofft, bei ihm wohnen zu können. Doch schon bei diesem ersten Besuch hatte er gespürt: Das war ein Mann, der allein leben wollte. Als er nachher in der Mansarde des Hotels auf dem Bett lag, merkte er, dass ihm das gefiel. Und dass es ihm eigentlich auch gefiel, sich allein durchzuschlagen. Am Russell Square hatte er bei ihm Vorlesungen über Arabisch, Persisch und Hebräisch gehört, und er sah ihn noch heute vor sich, wie er nach Schluss der Vorlesung im Hörsaal eine seiner ovalen, ägyptischen Zigaretten anzündete. Die Vorlesungen waren vormittags, er kämpfte nach der durchwachten Nacht mit der Müdigkeit, aber er ging hin, und Warren Shawn nickte ihm kurz zu, wenn er ihn sah. Einmal im Monat besuchte er ihn im Haus, sie tranken Tee, und er erzählte vom Orient.
Eines Tages hing im Wohnzimmer eine große Karte des Mittelmeers. Er möchte die Sprachen aller Länder können, die ans Mittelmeer grenzten, hatte Leyland plötzlich gesagt. Es war ein spontaner Gedanke gewesen, der ihn selbst überraschte, ein Gedanke, wie ihm später schien, der alles zusammenfasste, was ihm wichtig war, ein Gedanke, in dem sein ganzer Lebenshunger, der ihn aus Oxford weggetrieben hatte, zum Ausdruck kam. Warren Shawn hatte gelacht, auf die Karte geblickt und ihn dann eine Weile angesehen. »Nicht unmöglich. Dir würde ich es zutrauen. Sofort beginnen. Maltesisch nicht vergessen!«
Jetzt öffnete Kenneth Burke im Nachbarhaus ein Fenster, blieb stehen und zündete eine Zigarette an; auch ihre glühende Spitze hatte, wie die Straßenlaternen, im Nebel einen feinen milchigen Hof. Er wohnte seit langem dort und hatte sich in den letzten Jahren um Warren Shawn gekümmert. »Er wird einmal alles regeln«, hatte der Onkel gesagt, als Leyland ihn das letzte Mal besucht hatte. Burke war es gewesen, der in Triest angerufen und ihn von Warrens Tod verständigt hatte. Das war im Juli gewesen, kurze Zeit, nachdem Doktor Leonardi ihm die Diagnose gestellt hatte. Sophia hatte ihn angetroffen, als er den Koffer packte. »Du fährst da nicht hin«, hatte sie gesagt, »nicht mit dieser Diagnose. Stell dir nur vor, du bekommst unterwegs einen Anfall.« Sanft hatte sie ihn auf die Bettkante gedrückt und ihn gehalten, als er zu zittern begann. Dann hatte sie den Koffer ausgepackt und etwas zu essen gemacht. Vor dem Studium war sie Krankenschwester gewesen, und die Patienten liebten sie wegen ihrer ruhigen, bestimmten Art, die alle Angst kleiner werden ließ. Sie hatte Burke angerufen und den Vater mit einer Notlüge entschuldigt. Zwei Wochen später war ein Brief von Warrens Anwalt gekommen, der ihn wissen ließ, dass er das Haus erbte. Während einer schlaflosen Nacht war in ihm der Wunsch übermächtig geworden, das Haus noch einmal zu sehen, durch die Räume zu gehen und vor der Karte des Mittelmeers zu stehen. Fast als sei es eine Episode in einem Traum, in dem die Wünsche jeden Widerstand der Wirklichkeit außer Kraft setzten, war er mit einer kleinen Reisetasche zum Flughafen gefahren. Kaum hatte er die Halle betreten, hatten ihn die Kopfschmerzen angefallen, und auf der Toilette hatte er sich übergeben müssen. Eine Stunde später war er wieder zu Hause. Sophia hatte nichts erfahren.
Und nun saß er hier und blickte zu dem dunklen Haus hinüber. Nicht nur das Haus war dunkel; auch die Lampen am Weg vom Gartentor zur Haustür brannten nicht, wie früher immer. Es war ein Dunkel nach dem Ende eines Lebens, ein Dunkel, in dem die Zeit nicht mehr floss. Er würde nachher überall Licht machen und sie von neuem zum Fließen bringen. Aber nicht gleich. Er bestellte noch einmal Tee und etwas zu essen. Jetzt, da er wieder eine Zukunft hatte, wollte er verschwenderisch mit seiner Zeit umgehen. Spüren, wie sie verstrich, ohne dass er etwas tat. Spüren, dass er nicht mehr atemlos einem Ende entgegentrieb. Spüren, dass er Dinge aufschieben konnte, ohne es später zu bereuen. Den ersten Tag seiner neuen Zeit hatte er auf der Fähre zwischen Triest und Muggia verbracht. Den ganzen Tag auf dieser Fähre, hin und her, hin und her. Beim dritten Mal wollte die Schaffnerin kein Geld mehr. »Va bene!« Auf der letzten Fahrt des Tages setzte sie sich zu ihm und steckte sich eine Zigarette an. »Die Strecke gefällt Ihnen«, sagte sie und atmete beim Sprechen den Rauch aus. »Es ist jedes Mal wie das erste Mal«, hatte er gesagt. Sie sah ihn verblüfft an. »Veramente?« Für einen Moment war er versucht gewesen, ihr seine Geschichte zu erzählen, ihr, einer wildfremden Frau, der der Fahrtwind das Haar ins Gesicht wehte. Sie waren zusammen ausgestiegen und ein paar Schritte nebeneinander auf der Mole gegangen. »Ciao«, hatte sie dann gesagt, sich nach einer Weile umgedreht und gewunken. Er hatte sich auf die Molo Audace gesetzt und die Beine baumeln lassen. Als ein Schiff ablegte, hatte er die Hosenbeine und Schuhe in das flutende Wasser gehalten und zugesehen, wie sich der Tang um die Knöchel schlang.
Leyland zahlte, ging langsam über die Straße zu Kenneth Burkes Haus und klingelte. Ein Hund schlug an. Wenn er Warren Shawn besuchte, hatte er Burke manchmal im Garten gesehen, und sie hatten sich mit knappen Worten gegrüßt. Ein wütender Mann, auch ein verletzter, hatte er gedacht. Es war, als schöbe er sein bleiches Gesicht den anderen herausfordernd entgegen, den anderen, die alle seine Gegner waren. Jetzt stand er unrasiert und mit kurzem, stoppligem Haar in der Tür und musterte Leyland aus zusammengekniffenen Augen. »Ach, Sie sind’s«, sagte er dann und ließ ihn eintreten. Der Hund, ein Boxer, erschien und knurrte. Burke hielt ihn fest. »Ruhig, Billy«, sagte er. Er war es gewesen, der Warren Shawn gefunden hatte. »Er war unsicher auf den Beinen, konnte nur noch mit der Lupe lesen und verließ das Haus kaum noch. Auch in die Teestube drüben ging er nicht mehr. Ich habe für ihn eingekauft und auch sonst nach ihm gesehen. Kochen konnte er noch. Er hat ja immer gern gekocht. Aber es wurde immer weniger. Ich würde sagen: Er hatte einfach genug, genug von allem. Dann ging das Licht abends nicht mehr an. Ich ging hinüber und fand ihn auf dem Sofa unter einer Decke, dort, wo er seinen Mittagsschlaf zu machen pflegte.« Burke blickte durchs Fenster hinüber auf das dunkle Haus. »Wie kann ein Haus so viel Abwesenheit ausstrahlen, so viel Leere. Er wollte nicht ins Familiengrab nach Oxford, er wollte kremiert werden, und die Asche sollte in seinem Garten verstreut werden. Ich habe dafür gesorgt, ich hatte eine Vollmacht.« Burke schwieg eine Weile. »Als wäre ich nie gewesen, sagte er, als wir darüber sprachen. Er hatte etwas Sanftes an sich und zugleich auch etwas Heftiges, Radikales. Aber das wissen Sie ja sicher.« Das Ticken einer Uhr war zu hören, und der Hund knurrte. »Ich habe in seinen Papieren nach der Adresse seines Anwalts gesucht, wegen des Testaments. Sonst habe ich alles gelassen, wie es ist, ich erfuhr ja dann, dass Sie das Haus erben.« Er zögerte, und für einen Moment meinte Leyland Enttäuschung zu spüren. »Mir hat er sein Barvermögen vermacht, ziemlich viel Geld, er verbrauchte ja nichts.«
Jetzt gab er Leyland die Schlüssel. »Als ich erfuhr, dass Sie kommen, habe ich die Heizung angemacht. Wenn Sie was brauchen: Ich bin da.« Er blieb mit dem Hund in der Tür stehen, als Leyland ging. Seine Haltung war nicht abweisend, nur distanziert. Es würde lange dauern, sollte sich jemand vornehmen, diese Distanz zu überwinden.
2
Leyland schloss auf und machte Licht. Den Koffer ließ er im Flur stehen und betrat als erstes das Wohnzimmer. Die Karte des Mittelmeers hing noch. Er setzte sich in den Sessel, von dem aus er damals auf die Karte geblickt und jenen Tagtraum geäußert hatte, der ihn selbst überraschte. Dir würde ich es zutrauen; Maltesisch nicht vergessen! hörte er Warren Shawn sagen. Nergghu naraw lil xulxin, hatte er zum Abschied gesagt: auf Wiedersehen. Noch am selben Abend hatte sich Leyland in den Lesesaal des Britischen Museums gesetzt und in der Encyclopedia Britannica die Artikel über Malta und seine Sprache gelesen. Aus dem maghrebinischen Arabisch entstanden, die einzige semitische Sprache Europas, und die einzige semitische Sprache, die das lateinische Alphabet benutzte. In der Bibliothek gab es eine alte Grammatik und ein großes Wörterbuch. Er las wie im Fieber, war der letzte, der ging, und kam zu spät zum Dienst im Hotel. Am Tag darauf suchte er die Stadt nach Antiquariaten ab, bis er die Grammatik und das Wörterbuch hatte. Es war sein letztes Geld für diesen Monat, und in den nächsten Tagen musste das Hotelfrühstück, das er am Ende seiner Schicht bekam, reichen. Nachts saß er hinter der Theke und blätterte Stunde um Stunde. John Taylor, der Besitzer des Hotels, erkundigte sich nach den Büchern. »Malta? Gehörte bis vor kurzem uns, dort sprechen alle Englisch. Wozu dann Maltesisch lernen?« Er wolle es einfach können, hatte Leyland gesagt; einfach können. »Einfach so?« Einfach so. »I see«, hatte Taylor gesagt und ihm einen sonderbaren Blick zugeworfen. Auch später hatte er ab und zu solche Fragen gehört. »Sardisch? Auf Sardinien verstehen sie doch alle Italienisch.« Er wolle hören, wie es klinge, hatte er gesagt, und nicht nur den Klang der Wörter wolle er hören, sondern den Klang der Leute, den Klang ihres Lebens.
Etwas stimmte mit der Karte nicht. Leyland machte alle Lampen im Raum an. Doch das war es nicht. Die Karte war so still. Das konnte man von einer Landkarte natürlich nicht sagen, und doch war es das treffende Wort. Der ganze Raum war still, das ganz Haus, es war die Stille, wie sie eintrat, wenn jemand, der den Raum mit seiner Gegenwart ausgefüllt hatte, hinausging. Eine Stille, die auch eine Leere war. Die Karte, an den Rändern längst vergilbt, wirkte wie ein Relikt aus ferner Zeit. War es nur, weil er nie mehr mit Warren Shawn davor stehen und die Sprachen zählen würde, die noch fehlten? Oder war die Karte auch deshalb so still und stumm, weil sie — irgendwie, es war schwer zu sagen — in der neuen, unerwarteten Zeit, die angebrochen war, keinen Ort mehr hatte?
Das Parkett knarrte, als Leyland durch die offene Schiebetür hinüber ins Arbeitszimmer ging. Er möchte das Knarren nicht missen, hatte Warren Shawn einmal gesagt, es erinnere ihn an eine Wohnung in Jerusalem, dort hätte er keinen Schritt tun können, ohne dass es knarrte. Auf dem Schreibtisch und dem Tischchen neben dem Lesesessel lagen große Lupen. Retinitis pigmentosa war der Name der Krankheit, die Warrens Netzhaut unaufhaltsam zerstört hatte. An den Bildschirm mit den vergrößerten Buchstaben hatte er sich nicht gewöhnen können, das Gerät lag unbenutzt unter einem Stapel Bücher. Er liebte teures Papier mit Wasserzeichen und schrieb mit einer Füllfeder. Entweder so oder gar nicht, pflegte er zu sagen. Leyland dachte an das, was Kenneth Burke über ihn gesagt hatte: Etwas Sanftes hätte er an sich gehabt und zugleich auch etwas Heftiges, Radikales. Wie gut hatte er seinen Onkel gekannt? Lange Jahre war er vor allem der Mann im Orient gewesen, immer unterwegs, zu Hause in all jenen fernen Sprachen, unerschrocken trotz politischer Unruhen, und von Zeit zu Zeit waren Ansichtskarten mit fremdländischen Marken und Stempeln nach Oxford gekommen. Der Vater, Sir Christopher Sheldon Leyland, ein hoher Beamter im Civil Service und strikter Gegner der indischen Unabhängigkeit, hatte sich mit dem Sohn wegen dieser Unabhängigkeit überworfen. Trotzdem war er auf verschwiegene Weise stolz auf ihn und seine Weltläufigkeit gewesen, und als Warren Shawn seine Professur erhielt, gab es ein Fest.
Zwei Frauen hatte Leyland in seinem Haus kennengelernt. Die erste war eine persische Studentin, mit der er Farsi sprach, die Erinnerung an sie war verwischt, Leyland sah sie vor allem vor sich als die Frau, die die Tür geöffnet und später Tee serviert hatte, eine Frau mit wallendem Haar und einem weißen, scharf geschnittenen Gesicht, die einen langen Rock aus bedruckter Seide trug und ein Parfum benutzte, das entfernt nach Weihrauch roch. Der Onkel folgte ihr mit seinen Blicken, auch mitten im Gespräch. Jahre später war sie verschwunden und mit ihr die Gegenstände, mit denen sie im Haus anwesend war. Jetzt lebe ich wieder allein, hatte Warren Shawn gesagt, als er das Erstaunen auf dem Gesicht des Neffen sah. Leyland war nicht sicher gewesen, ob es Trauer oder Erleichterung war, was aus seiner Stimme sprach. Klar war nur, dass er kein weiteres Wort darüber verlieren würde. Erst als Leyland bereits in Triest wohnte und zu Besuch in London war, öffnete bei Warren Shawn wieder eine Frau die Tür, eine Frau in den Vierzigern, streng und farblos gekleidet, eine britische Stimme mit herrischem Tonfall, und Warren Shawn, der mit seinen dicken Brillengläsern und dem ergrauten Haar inzwischen wie ein älterer Gelehrter aussah, schien froh zu sein, wenn sie aus dem Zimmer ging. Jetzt lebe ich wieder allein, sagte er beim nächsten Besuch zwei Jahre später. Natürlich, dachte Leyland, konnte er nicht sicher sein, dass es genau die gleichen Worte gewesen waren wie beim ersten Mal. Aber es gefiel ihm, das zu denken, er mochte die Bestimmtheit und den leisen Trotz in den Worten, und auf eine Art, die schwer zu erklären war, passte es zu Warren, dass man ihm Worte andichten konnte, die wie ein Refrain klangen.
Zögernd setzte sich Leyland an den Schreibtisch. Kenneth Burke hatte die Post hingelegt, die noch gekommen war, eine Reihe von Briefen und ein Paket mit Büchern. Leyland schob die Sachen zur Seite; das musste warten. Jetzt fiel sein Blick auf die flache, ockerfarbene Packung mit den ägyptischen Zigaretten. Es gab sie nur am Sloane Square, und Warren pflegte sie stapelweise zu kaufen. Die Zeichen der arabischen Aufschrift waren die ersten arabischen Zeichen, die Leyland gesehen hatte. Warren war zu Besuch in Oxford und holte die Schachtel hervor. Leyland ging noch nicht zur Schule, aber er konnte schon lange lesen. Gebannt blickte er auf die fremden Zeichen. »Kannst du das lesen?«, fragte er. Warren nickte. Sukun, las er vor und erklärte, dass es Ruhe bedeutete. Es war ein magischer Moment gewesen, in dem Leyland, ohne es ausdrücken oder auch nur denken zu können, gespürt hatte, dass etwas Neues begann, eine neue Melodie des Lebens. Warren musste es bemerkt haben, denn ein paar Tage später war in der Post eine Tabelle mit dem arabischen Alphabet und mit langen Kommentaren, wie die Laute auszusprechen waren. Leyland übte und übte, und es dauerte keine Woche, bis er die Schrift beherrschte. Zeichen und Wörter und immer mehr Zeichen und Wörter — darum ging es, und um nichts sonst.
Jetzt nahm er eine Zigarette aus der Packung, zündete sie an und sog den Rauch des vertrockneten Tabaks tief in die Lungen, bis ihm schwindlig wurde. Er schloss die Augen. Alles, was für ihn jemals gezählt hatte, waren Worte. Etwas existierte erst wirklich, wenn es benannt und besprochen wurde. Er hatte sich das nicht ausgesucht, es war ihm zugestoßen und war von Anfang an so gewesen. Oft hatte er sich gewünscht, ohne Worte bei den Sachen zu sein, bei den Sachen und den Menschen und den Gefühlen und den Träumen — und dann waren ihm doch wieder die Worte dazwischengekommen. Er erlebe die Dinge erst, wenn er sie in Worte gefasst habe, sagte er manchmal, und dann sahen ihn die Leute ungläubig an. Nur bei Livia, da hatte er nie Worte gebraucht.
Kenneth Burke hatte den Kühlschrank geleert und abgestellt. In den Schränken gab es Konserven und andere Lebensmittel. Am Geschirr und dem Besteck in den Schubladen klebten Essensreste, die Warren nicht mehr gesehen hatte. Die Handtücher im Bad mussten diejenigen sein, mit denen er sich zuletzt abgetrocknet hatte. Leyland trat ans Fenster. Der Nebel war dichter geworden, Burkes Haus war nur noch in den Umrissen zu erkennen. Was sollte er hier? Warum bloß hatte er geglaubt, in diesem Haus, das ja trotz aller Besuche ein fremdes Haus geblieben war, Klarheit über sein weiteres Leben gewinnen zu können? Welcome home, Sir, hörte er den Beamten am Flughafen sagen. Es hatte so richtig geklungen. Warum war alles Empfinden so flüchtig, warum hatte nichts Bestand.
Im oberen Stockwerk war er nie gewesen, das war eine Welt, die Warren Shawn ganz allein gehörte. Warum war es schwierig und mit dem Gefühl des Verbotenen verbunden, die Treppe hinaufzusteigen und in diese Welt einzudringen, wo es Warren doch nicht mehr gab? Die Stufen knarrten unter dem abgetretenen Läufer. Der Lack am Geländer war abgegriffen. Bei seinem letzten Besuch war Warren die Treppe heruntergekommen, die Hand auf dem Geländer, Leylands Blick war auf die vielen dunklen Altersflecke gefallen, und der Onkel hatte den Blick bemerkt. Als sie später beim Tee saßen, strich er sich von Zeit zu Zeit über die Handrücken mit den Flecken, unwillkürlich, wie es schien. Ein alter Freund aus Beirut sei vor kurzem gestorben, erzählte er. Er habe hinfliegen wollen und sei schon am Flughafen gewesen, da habe er erfahren, dass er die Bordkarte elektronisch ausdrucken müsse, und er habe nicht gewusst, wie. »Ich bin nach Hause gefahren«, hatte er gesagt, »und habe den Flugschein weggeworfen. Das ist vorbei, dachte ich, und nicht nur das Fliegen ist vorbei. Wo ich doch früher mit allem fertig geworden bin, mit allem.«
Die Tür zum ersten Zimmer stand offen, und Leyland machte Licht. Es war Warrens Schlafzimmer. Neben den Büchern auf dem Nachttisch lag eine Lupe. Wordsworth, Coleridge, T. S. Eliot. Als habe er sich, nach einem Leben im Universum orientalischer Sprachen, im Alter der eigenen Sprache versichern wollen, dachte Leyland. Aber es war nicht Dichtung, was er zuletzt gelesen hatte. Auf dem zweiten, unberührten Bett lag aufgeschlagen, mit den Seiten nach unten auf der Decke, ein anderes Buch: Tom Courtenay, Dear Tom, mit einem Untertitel: Letters from home. Aufgeregt griff Leyland danach. Ja, es war tatsächlich ein Buch von Tom Courtenay, dem Schauspieler, der hier die Briefe veröffentlichte, die ihm seine Mutter von Hull aus nach London geschickt hatte, wo er studierte und später die Schauspielschule besuchte. Und dazu erzählte er von seinem Leben und dem der Eltern. Tom Courtenay. Livia war ganz vernarrt in ihn gewesen. Kurz nachdem Leyland sie kennengelernt hatte, gab es in einem kleinen, muffigen Programmkino in Knightsbridge The loneliness of the long distance runner zu sehen, Courtenays ersten Film aus den frühen sechziger Jahren, in dem er einen rebellischen Jungen in einem Jugendgefängnis spielte, der sich wehrte, indem er allen davonlief. Als die Lichter angingen, war Livia einfach sitzen geblieben, und sie hatten sich den Film ein zweites Mal angesehen. »Hätte mir auch passieren können«, sagte er beim Hinausgehen, auf das Gefängnis im Film anspielend. »Ma che dici«, sagte sie, aber was redest du da. Sie fasste ihn um die Taille. Er spürte es, als er jetzt auf Warren Shawns Bett saß und in dem Buch blätterte.
Courtenays Sätze hatten einen lyrischen Klang, und ihre Poesie lag in der unaufdringlichen, gelassenen Genauigkeit, der alles Gewollte und Manierierte fernlag. Wie immer, wenn ihm Sätze gefielen, las er sie laut und lauschte ihrem Rhythmus, dem Rhythmus der Töne, dem Rhythmus der Bedeutungen und der Art, wie sich die beiden Rhythmen ineinanderschlangen. Nach einer Weile merkte er, dass er noch etwas anderes tat, als die Worte in ihrem Klang zu genießen: Er las die Sätze Livia vor, über einen Abstand von elf Jahren hinweg. Seine Frau, sie hatte diese Art gehabt, ihm zuzuhören, eine Art der Konzentration, die ihn verzaubern und entflammen konnte, auch nach zwanzig Jahren noch. Im Haus in Triest pflegten sie auf der obersten Treppenstufe zu sitzen und über Wörter zu sprechen, über ihre Bedeutung und darüber, wie sie zu übersetzen wären, ins Deutsche, Englische, Italienische, Französische, manchmal auch in den Triestiner Dialekt. Und als er jetzt, in Warren Shawns Schlafzimmer auf und ab gehend, Tom Courtenays Sätze in den Raum hinein sprach, schien Livia da zu sein wie damals auf der Treppe, die Frau, mit der er das Leben geteilt hatte, indem er seine Worte mit ihr geteilt hatte.
Bis unten das Telefon klingelte. Er versuchte, es nicht zu hören, versuchte, sich zu schützen und unerreichbar zu machen, indem er sich die Treppe des Triestiner Hauses vorstellte und den Duft von Livias Parfum in Erinnerung rief, den er besonders geliebt hatte, wenn er sich mit dem Rauch ihrer Zigarette vermischte. Doch das Klingeln des Telefons war mächtiger als die Kraft seines Erinnerns, und plötzlich verloren Tom Courtenays Worte ihren Zauber und klangen hohl und fremd in dem leeren Haus. Das Klingeln hörte auf. Er legte das Buch hin, wie er es gefunden hatte, ein bisschen so, als wolle er, ohne den Grund zu kennen, rückgängig machen, was eben geschehen war, oder als wolle er es als Geheimnis aufbewahren, als Geheimnis vor sich selbst. Dann löschte er das Licht.
Auch die beiden anderen Zimmer waren Schlafzimmer, und es gab Sessel und volle Bücherregale. Leyland legte sich im kleineren mit den schrägen Balken aufs Bett. Das Dunkel vor dem Fenster wirkte durch den dichten Nebel wie ausgestopft, das vertraute Geräusch eines Taxis klang, als sei der Motor in eine Decke gewickelt. Er atmete aus wie einer, der endlich angekommen ist. Nach einer Weile spürte er die Vorboten der Migräne. Migräne, es ist nur Migräne. Er ging hinunter in die Küche und nahm eine Tablette. Der bittere Geschmack, den er mit Wasser hinunterspülte, war wie ein Versprechen gegen den pochenden Schmerz. Das Telefon in seiner Tasche machte das helle, tropfende Geräusch, und er las: Circle Line: two minutes delay at Gloucester Road. Es war verrückt, aber er war enttäuscht, dass er das Signal hier in London hörte, wo es hingehörte, und nicht auf der Molo Audace in Triest, wo es wie ein Signal der Sehnsucht war. Verwirrt setzte er sich ins Wohnzimmer und wartete auf die Wirkung der Tablette. Nach achtzehn, neunzehn Minuten würde sich die Zeit auf die Gegenwart verengen, eine ruhige, klare Gegenwart, hinter sich ein sanftes Vergessen und vor sich eine angenehme Gleichgültigkeit, die man für Gelassenheit halten konnte. In den Gedanken würde es still, und alle Angst wäre gebannt. Es kam vor, dass er eine Tablette auch ohne Anlass nahm. Doktor Ivancich, sein Hausarzt, wusste das und sagte nichts.
Gloucester Road. Das war die Station für die Wohnung in Harrington Gardens, wo er mit Livia gewohnt und die kleinen Kinder durch die Räume getragen hatte, Sätze von Übersetzungen leise vor sich hin sprechend. Fünf Jahre lang waren sie dort ein- und ausgestiegen. Sie hatten sich ihre Zukunft auch weiterhin in London vorgestellt. Doch dann klingelte in der Nacht das Telefon, es klingelte lange und laut in den sparsam möblierten, hohen Räumen, und kurze Zeit danach wohnten sie in Triest. Es hatte lange gedauert, bis er das wirklich glauben konnte. Auch jetzt, in diesem Moment, kam ihm die neue Gegenwart, die damals begonnen hatte, unwirklich vor.
Die Tablette begann zu wirken. Er schaltete das Fernsehen ein. Als er nicht mehr reisen mochte, hatte Warren Shawn eine Antenne installieren lassen, mit der man Programme aus aller Welt empfangen konnte. Der letzte Kanal, den er eingestellt hatte, waren die Nachrichten der BBC. Leyland hörte zu. Nach einer Weile merkte er, dass er weniger auf die Nachrichten als auf die Worte achtete, in denen sie formuliert waren. War das wirklich seine Sprache, die Sprache, in die er meistens übersetzte? Die Worte waren wie Formeln, bloße Worthülsen, in Redaktionsstuben vorbesprochen und gefügig gemacht, sie fügten sich allen möglichen Regeln der politischen Korrektheit und wurden dadurch leblos und steril, ohne Sinnlichkeit, Witz und Farbe. Und es waren stets die gleichen Formulierungen, stets die gleichen. Leyland holte die Bücher von Warren Shawns Nachttisch, stellte beim Fernsehen den Ton ab und las. Was war das für ein Abstand!
Auf dem nächsten Kanal gab es eine Diskussionsrunde. Jetzt waren es nicht leere Formulierungen, die ihn störten, es war etwas anderes, es lag am Tonfall, und obgleich ihm das Unbehagen vertraut war, kam das treffende Wort erst nach einer Weile: Die Teilnehmer suhlten sich in den Worten, sie schienen sich in ihnen wohlig hin und her zu wälzen wie in einem Schlamm, die Briten in einem spitzlippigen, überspannten und überkandidelten Schlamm, you know, you know, der Amerikaner in einem lärmenden, blechernen Schlamm, der seinen Mund breiter und breiter machte, okay, okay, es war eine Wohltat, dass auch eine Inderin dabei war, eine Professorin, die das Englisch als gewählte Sprache benutzte, gewählt und wohlgesetzt, mit dem leisen Abstand des Fremden, ein bisschen wie Latein.
Er wechselte zu deutschen und französischen Kanälen. Das waren die Sprachen, mit denen seine Mutter aufgewachsen war. Sie wollte, dass der Sohn neben dem Englischen auch sie lernte, und so war es gekommen, dass er selbstverständlich und mühelos mit den Wörtern dreier Sprachen groß geworden war. Mit der Mutter waren es deutsche oder französische Wörter, mit dem Vater englische. So war es auch, wenn sie zu dritt waren. Mit traumgleicher Sicherheit kamen die richtigen Wörter, und dass es die richtigen waren, hieß, dass sie zu den Gefühlen passten, die man füreinander hegte. Mit dem Vater Deutsch oder gar Französisch zu sprechen, bedeutete Rebellion, und dann bekam man einen Schwall geschliffener britischer Worte zurück. Mit der Mutter — es war eine Frage der Temperatur, sozusagen, welche Sprache man wählte; nicht der Nähe, sondern der Art von Nähe. Es kam vor, dass sie falsch begannen und mitten im Satz die Sprache wechselten, wenn die Stimmung es verlangte. Wenn die Mutter sich mit ihren überkorrekten, ein bisschen steifen englischen Worten — in denen man, obwohl sie dagegen ankämpfte, einen deutschen Akzent hörte — an den Vater wandte, spürte man Nähe und Loyalität. Für das Kind waren es kostbare Momente. Kalt wurde es, wenn die Mutter dem überheblichen britischen Ton des Vaters mit französischen Worten begegnete, die wie Stiche mit einem blitzenden Florett waren. Dann schienen sie sich wie vollständig Fremde gegenüberzustehen: Ashton Chandler Leyland, der Jurist im Staatsdienst, und Lydia Sartorius, die am Magdalen College deutsche und französische Literatur unterrichtete. Und so lernte der Sohn von früh an zu verstehen, dass Worte den Gefühlen nicht äußerlich waren, auch nicht einfach Ausdruck von ihnen in einem plumpen Sinne, sondern dass die Gefühle in ihnen waren, direkt in ihnen, und sich in ihrem Klang offenbarten.
Als die Mutter verunglückte, verschwanden die deutschen und französischen Worte für eine Weile aus dem Haus in Oxford. Dann kam Ménanne Somerfeld, ein Au-pair-Mädchen aus den Vogesen, das den Haushalt machte und auch beide Sprachen konnte. Sie war gut zu dem Jungen, und der Vater behielt sie. Manchmal, wenn sie zusammen in der Küche saßen, sprachen sie Französisch, seltener Deutsch. Aber es war nicht mehr dasselbe wie mit der Mutter, bei weitem nicht. Sprachen, auch das lernte der Junge, waren irgendwie etwas Allgemeines; alle Welt sprach sie. Und doch waren sie jeweils auch etwas Besonderes, Unverwechselbares, je nachdem, mit wem man sie sprach.
Die nächste Sendung im Fernsehen kam aus Wien. Livias Mutter war dort aufgewachsen, bevor sie nach Triest heiratete, und sie hatte dafür gesorgt, dass die Tochter Deutsch so gut lernte wie Italienisch. Leyland stellte das Fernsehen stumm, schloss die Augen und rief sich Livias deutsche Stimme in Erinnerung, die Stimme, in der es eine feine Spur des österreichischen Singsangs gegeben hatte, viel weniger als bei den Stimmen eben im Fernsehen, wirklich nur eine Spur, und man hörte es nur, wenn man aufpasste. Er mochte ihre italienische Stimme lieber, vielleicht hatten sie auch deshalb meistens Italienisch miteinander gesprochen. Es hatte eine solche Energie in dieser Stimme gelegen, in all den Vokalen, die sie dehnte und sang, eine solch sprühende Lebendigkeit und überbordende Lebenslust, selbst wenn es nur um die Stromrechnung oder den kaputten Auspuff an ihrem Alfa Romeo ging. Es war jetzt elf Jahre her, dass die Stimme versiegt war, und die Erinnerung nahm ihm immer noch den Atem.
Er schaltete einen italienischen Sender ein. Es war die Nachrichtensprecherin mit der hellen, fast schon schrillen Stimme, die mit übereinandergeschlagenen Beinen hinter dem gläsernen Tisch saß und die Nachrichten vom Blatt las, als sei sie bei den Zuschauern zu Besuch und läse einen Brief vor. Es war dieselbe Sprecherin wie vor ein paar Tagen, und auf einmal, als sänke er in sich selbst eine Stufe tiefer, hinein in die Korridore der Erinnerung, saß Leyland in Triest neben seinem Sohn vor dem Fernseher. Bonbonfarbengrell, sagte Sidney. Was? Das Studio, ihr Kleid, ihre Stimme, die ganze Sendung. Sie lachten über das gelungene Wort, es war das erste Mal seit langem, dass er Sidney wieder lachen sah; seit er Referendar bei Gericht war, lag ein Schatten auf seinem Gesicht. Aber die Freude galt nicht nur der Wortschöpfung, sondern auch der Tatsache, dass der Vater zurück im Leben war, und plötzlich war Sidney aufgestanden, hatte sich zu ihm hinuntergebeugt und ihn umarmt. Leyland spürte seine Hände und seine rauhe, stopplige Wange, und als er wieder in die Gegenwart zurückkehrte, war die Nachrichtensendung vorbei.
Er setzte sich auf und beugte sich nach vorn, nahe an den Bildschirm. Die Kamera der Sendung, deren Anfang er verpasst hatte, führte durch eine mediterrane Stadt. Englische Schilder, und dann plötzlich maltesische Wörter: marsa, Hafen; knisja, Kirche; mbarrat, geschlossen; miftuħ, geöffnet. Valletta, Maltas Hauptstadt. Er erkannte Gassen, Gebäude, Plätze. Das war dreiundvierzig Jahre her. Mehr als ein Jahr hatte er etwas von dem Geld, das er im Belsize Retreat Hotel verdiente, gespart, um diese Reise machen zu können. Ein winziges Hotelzimmer, stickig und laut, Sandwich und Kaffee, zu mehr reichte es nicht. Einfachere Sätze konnte er inzwischen auf Maltesisch lesen. Doch wenn die Kellner miteinander redeten, verstand er kaum etwas. Und mit ihm sprachen sie Englisch. In seinem heißen Zimmer auf dem Bett liegend, fragte er sich, was er sich erwartet hatte. Er war bei einer Sprachschule vorbeigekommen und hatte sich erkundigt, was Unterricht in Maltesisch kosten würde. Nicht nur, dass er sich einen solchen Aufenthalt nicht leisten konnte. Im Café, vor einer maltesischen Zeitung sitzend, die jemand hatte liegenlassen, wusste er plötzlich nicht mehr, worum es ihm ging. Leyland betrachtete die Karte des Mittelmeers, die neben dem Fernseher an der Wand hing. An diese Karte, deren Ränder jetzt vergilbt und ein bisschen eingerollt waren, hatte er in jenem maltesischen Café gedacht, und plötzlich hatte er seinen Tagtraum, seinen Sprachtraum, nicht mehr verstanden. Drei Tage später saß er abends in der Londoner U-Bahn. Jetzt ergab der Traum wieder einen Sinn. Er verstand nicht, wie das sein konnte, aber es war so.
Warren Shawn hatte er nichts von seiner bizarren Reise erzählt. Obwohl er vielleicht der einzige war, der verstanden hätte. Als es damals darum gegangen war, ob er mit Livia und den Kindern nach Triest ziehen sollte, hatte er Warren von seinen Zweifeln erzählt. »Aber dort bist du doch mittendrin in deinem Traum!« hatte der Onkel ausgerufen. »No tube«, hatte Leyland gesagt. Es hatte wie ein Scherz geklungen, aber Warren sah ihn an und wusste, dass es keiner war; er verstand, dass es um viel mehr ging. »Ich verstehe«, sagte er nach einer Pause: »Du willst dort unten, in der Underground, in den Zügen sitzen und auf den Rolltreppen stehen, und dabei willst du von all den Sprachen träumen — und das ist alles, was du willst. Vielleicht noch nachts am Hotelempfang sitzen und übersetzen, aber sonst nichts. Und nun ist diese phantastische Frau gekommen, die du mir vorgestellt hast, und verschleppt dich nach Triest, wo die Sprachen wirklich gesprochen werden. And now you are upset. So ist es doch, oder?«
Auf dem nächsten Kanal gab es einen Film, der in Triest spielte. Der Hafen, die Piazza Unità d’Italia, der Kanal, auf den er von seiner Wohnung hinunterblickte. Leyland fror das Bild ein. »Am Kanal wohnen — das könnte ich mir auch vorstellen«, pflegte Livia zu sagen. Hatte er die Wohnung deshalb genommen? War er ohne sie mit ihr dort eingezogen? Er ließ die Bilder weiterlaufen, ohne auf die Handlung zu achten. Das Krankenhaus, in dem Sophia arbeitete. Die Kamera fuhr nahe heran. Wieder fror er das Bild ein. Die junge Frau, die heraustrat, war natürlich nicht seine Tochter; aber sie hätte es sein können mit dem offenen weißen Mantel, dem fliegenden Haar und dem energischen Schritt. Mit diesem Schritt war sie manchmal aufgestanden und hinausgegangen, wenn er beim Essen wieder einmal laut über ein Wort nachgedacht hatte. Dann konnte man auf ihrem Gesicht lesen, wie sie seine diktatorische Hingabe an die Wörter verfluchte. Ein Vater, der immer nur in den Wörtern war, immer nur in den Wörtern und sonst nie ganz da, nie ganz anwesend. Doch dann kam sie plötzlich mit einem brillanten Übersetzungsvorschlag, auf den er nicht gekommen wäre. Krankenschwester: War das ein Protest gewesen, ein Protest gegen all die Wörter und Bücher, gegen eine Welt, in der die handfesten Dinge, auch das handfeste Leiden, das Blut und die Wunden, nicht deutlich genug zur Sprache kamen? Wenn sie davonlief, war sie oft auf die hohe Zeder hinter dem Haus geklettert, hinauf und hinunter, wie um zu sagen, zu sich selbst zu sagen: Es gibt doch auch ein anderes Leben als dasjenige der Hingabe an die Wörter, ein sehr lebendiges, mächtiges Leben, ein Leben mit Muskeln, zupackenden Händen, dem Geruch von Harz, ein Leben mit Wind im Gesicht und zerschundenen Knien. Für diese verschwiegene Revolte, dachte Leyland, als er jetzt auf das stille Fernsehbild blickte, liebten die Patienten sie, sie konnten davon nichts wissen, aber vielleicht hatten sie doch eine Ahnung, eine dieser Ahnungen, die man haben kann, obwohl man nichts weiß, das könnte erklären, warum sie sich nachsichtig mit manchem Anfall von Strenge abfanden, der aus Sophia herausbrechen konnte, dann sah sie in ihrem weißen Mantel aus wie eine unerbittlich kommandierende Notfallschwester in einem Lazarett an der Front, man würde ihr sogar eine Waffe zutrauen. La Rossa hieß sie früher bei den Patienten, weil sie rote Kniestrümpfe trug. Alle wollten, dass sie möglichst lange in ihrem Zimmer blieb.
Leyland schaltete das Fernsehen aus. Das leise Rauschen der Heizung ließ die Stille hervortreten. Es war eine Stille ohne Triest. Natürlich ergab der Satz keinen Sinn: eine Stille konnte weder mit noch ohne eine Stadt sein. Und doch trafen es die Worte genau: eine Stille ohne Triest. Zögernd wählte er die Nummern von Sidney und Sophia und legte auf, bevor das Freizeichen kam. Die richtigen Worte würden jetzt nicht gelingen; am Telefon gelangen sie selten. Sein Blick fiel auf die Bücher von Warren Shawns Nachttisch. Für einen Moment war er versucht, sie wieder nach oben zu tragen — sein Eingreifen rückgängig zu machen und alles wiederherzustellen; wie mit Tom Courtenays Buch vorhin. Er ließ sie liegen. In der Küche trank er Wasser aus dem Glas von vorhin. Warum war beim Glas kein Zögern, wie bei den Büchern? Was war das für ein sonderbarer Unterschied zwischen einem Wasserglas und einem Buch?
Er trat ans Fenster. Im Nebel hatte sich eine Lücke aufgetan, und nun sah er, dass Kenneth Burke im einzig erleuchteten Zimmer Cello spielte. Eigentlich sah er nur den Notenständer, den unteren Teil des Cellos und die Hand, wie sie den Bogen führte, hin und her. Manchmal, wenn die Finger in hohe Lagen glitten, beugte er sich weit nach vorn, dann schob sich der eckige Kopf mit dem stoppligen grauen Haar ins Blickfeld. Leyland hätte gern gewusst, was er spielte — welche Musik zu diesem Mann passte, der so viel Distanz brauchte, so viel Abstand um sich herum.
Im Schlafzimmer mit den schrägen Balken war das Bett nicht bezogen. Leyland packte das Nötigste aus, wusch sich im Bad das Gesicht und schlüpfte unter die Decke. Das Mittel gegen die Migräne hatte nicht so gut gewirkt wie sonst. Nach einer Weile stand er auf und nahm im Bad eine zweite Tablette. Als der Schlaf nicht kam, ging er hinunter ins dunkle Wohnzimmer, machte die kleine Lampe an und lauschte dem Rauschen der Heizung. Eine Stille ohne Triest, die noch keine Stille in London war. Eine Stille zwischen allem, eine ortlose Stille. In Warren Shawns Arbeitszimmer stand sein Handkoffer. Er ging hinüber, nahm zwei dicke Mappen heraus und legte sie vor sich auf den Schreibtisch. Seine Briefe an Livia, mit denen er nach ihrem Tod begonnen hatte. Er machte die Lampe an, schlug die erste Mappe auf und las, was er im September, als Begleitbrief, an seine Kinder geschrieben hatte:
Meine liebe Tochter, mein lieber Sohn,
das sind meine Briefe an Livia, die ich ihr über die vielen Jahre seit ihrem Tod geschrieben habe. Es ist nicht so, wie es vielleicht scheinen könnte: dass ich ihren Tod insgeheim nicht anerkannt, dass ich ihn im verborgenen geleugnet hätte. Der Sinn der Briefe war nicht, sie über ihren Tod hinaus am Leben zu halten. Es war anders: An sie zu schreiben, war eine Art, an mich selbst zu schreiben. Seit der Nacht, in der wir sie damals fanden, hatte ich oft das Bedürfnis, mit mir selbst zu sprechen und mir in ausdrücklicher Form darüber klar zu werden, was ich dachte, fühlte und wollte. Einiges davon habe ich geäußert — Euch und anderen gegenüber. Doch das Äußern hat mir nicht wirklich geholfen: Was ich sagte, klang schon beim Sagen falsch oder, wenn nicht falsch, so doch viel zu einfach. Wenn man in Gegenwart anderer über sich spricht, sagt man nie genau das, was man eigentlich sagen möchte: Selbst wenn man sich dessen nicht bewusst ist, hemmt einen die Rücksicht, entweder die Rücksicht auf die Wirkung der Worte in den anderen, oder die Rücksicht auf die Art und Weise, wie man für die anderen durch diese Worte erscheinen würde. Und nachher hat man, statt mit sich selbst in der Klarheit einen Fortschritt gemacht zu haben, mit diesen Wirkungen bei den anderen zu kämpfen. Auf der anderen Seite stockte ich immer öfter, wenn ich im Inneren nur vor mich hinsprach, angefangene Gedanken fanden keine Fortsetzung, es gab keinen Fortschritt im Verstehen, alles blieb rhapsodisch und war voller Bruchstücke, die nicht zueinander passten. Da fing ich an, Livia zu erklären, wie es mir ging. Sie war ja auch im Leben meine Vertraute gewesen, diejenige, die mich am besten zu erraten vermochte. Doch es waren zu kurzatmige Dinge, solange ich sie nur in stillen und unsichtbaren Gedanken dachte, und immer öfter hatte ich das Gefühl, dass es darauf ankäme, weit auszuholen, so weit, dass ich insgesamt und ganz in der Tiefe verstehen könnte, wer ich bin.
Jedesmal, wenn ich einen Brief begann, nahm ich mir vor, mich nicht zu verstellen, weder vor ihr noch vor mir selbst, koste es, was es wolle. Es sollten ganz und gar aufrichtige Berichte sein, und manchmal, wenn ich vor dem leeren Blatt saß, kam es mir vor, als sei nichts anderes so schwer wie das: aufrichtig zu sein, furchtlos und aufrichtig. Es war befreiend zu spüren, dass ich mich öffnen konnte, wie ich es zuvor noch niemals getan hatte. Ich öffnete mich für sie und in derselben inneren Bewegung auch für mich selbst. Man würde erwarten, dass man sich ohne Umschweife und ohne Umweg für sich selbst öffnen könnte, denn man ist sich ja doch selbst am nächsten, denkt man. Und warum bedarf es überhaupt der Anstrengung, sich zu öffnen, wo es doch wegen der besonderen Nähe, in der man zu sich selbst steht, so sein müsste, dass man vor sich selbst und für sich selbst ganz unverschlossen ist?
Ich konnte mich Livia ungeschützt offenbaren, weil ich nicht befürchten musste, sie damit zu stören oder gar aus der Fassung zu bringen. Und doch war es ganz anders, als zu einer gefühllosen und stummen Wand zu sprechen, oder zu einer vollständig Fremden, deren Empfindungen mich nichts angingen. Es musste Livia sein, die zuhörte. Meine Worte mussten ihren Geist erreichen und dort ein Verstehen erwirken, und erst wenn dieses Verstehen groß genug wäre, hätte ich das Gefühl zu erkennen, wie es in mir aussah.
Ich habe mich mit dem Gedanken getragen, diese Briefe zu vernichten. Denn sie waren ein Leitfaden meines Lebens, der eigentlich nur mich etwas anging. Doch dann kam es mir grausam vor, ohne dass ich zu sagen vermöchte, in welchem Sinne. Und so gebe ich sie denn Euch beiden zum Lesen und Aufbewahren. Möge ihr Inhalt Euch helfen zu verstehen, warum ich so handelte, wie ich es tat, in all den vielen Jahren nach Livias Tod und auch am Ende meines Lebens.
Papà
Er klappte die Mappe zu und löschte das Licht. Die zweite Tablette wirkte, der pochende Schmerz ließ nach. Bei Kenneth Burke waren alle Fenster dunkel. Er ließ das kleine Licht im Wohnzimmer an und legte sich oben wieder unter die Decke. Die Kinder hatten seinen Brief nicht lesen müssen. Wie knapp es war, dachte er, bevor er einschlief, wie nahe dran ich war.
3
»How much time?« Leyland schreckte aus dem Schlaf auf, fuhr sich übers Gesicht und setzte sich auf die Bettkante. Er hörte sich die Worte, die er im Schlaf gesprochen hatte, noch einmal sagen. Es waren Worte eines angstvollen Traums gewesen und zugleich auch Worte der Erinnerung. Sie hatten einen rauhen und unbeholfenen Klang gehabt, wie bei einem, der lange nicht mehr gesprochen hatte. Es waren die einzigen Worte, die er in jenem schrecklichen Moment gefunden hatte, und er war froh gewesen, dass dort, am offenen Fenster von Doktor Leonardis Sprechzimmer, vor dem der Regen eines heftigen Morgengewitters rauschend durch die Blätter fiel, überhaupt Worte kamen.
Jetzt wusch er sich im Bad lange das Gesicht und ging dann hinunter in die Küche. Kenneth Burke hatte ein Glas Kaffee, Zucker und eine Dose Kekse hingestellt. Während das Wasser heiß wurde, öffnete Leyland im Wohnzimmer das Fenster und hielt das Gesicht in die nebelfeuchte Luft. Dieses Fenster und dieser Nebel — das war jetzt, das war Gegenwart, und diese Gegenwart war ein festes Bollwerk gegen jenes andere Fenster, gegen den Gewitterregen und den Schrecken der Erinnerung. Er fasste an den Fenstergriff. Dieses Mal musste er sich nicht, wie damals, daran festhalten, und die Worte, die er zur Probe in den Nebel hinaussprach, kamen wie immer, ohne Anlauf, ohne Angst vor Kompliziertem, mit jener fließenden Leichtigkeit und jener Freude an der Leichtigkeit, die das ganze Leben gegolten hatten und für ihn das Glück bedeuteten, mehr als alles andere. Kenneth Burke trat mit dem Hund aus dem Haus, bemerkte ihn und kam an den Zaun, um besser zu sehen. »Thank you for the coffee«, sagte Leyland. »That’s all right«, sagte Burke. Leyland mochte, wie er es sagte. Was er sagte, und wie er es sagte. Beides passte so gut zu seinem rauhen, bleichen Gesicht unter der Schiffermütze, die er heute morgen trug, und zu seiner knappen Bewegung des Grüßens.
Leyland goss den Kaffee ein und setzte sich mit der dampfenden Tasse neben das Tischchen mit Warren Shawns Büchern von oben. Eines nach dem anderen nahm er die Bücher in die Hand, ohne sie aufzuschlagen. Gestern abend war es darum gegangen, die Sprache der Dichter gegen das Geschwätz der BBC zu Hilfe zu rufen. Heute morgen ging es um etwas anderes: Die Bücher waren, wie der Fenstergriff und der Nebel, auch wie Burke vorhin, ein Beweis der Gegenwart, der Wirklichkeit, einer Wirklichkeit, mit der sich die Angst, wie sie im Traum aufgebrochen war, in Schach halten ließ. Er hatte das Fenster offen gelassen und atmete den herben Geruch des Nebels ein. Jetzt hörte er den feinen, leisen Regen. Er hatte es stets geliebt, das Gesicht in den Regen zu halten. Es konnte geschehen, dass er im strömenden Regen den Schirm zuklappte, die Augen schloss und es genoss, das Wasser auf sich zu spüren. Oder dass er beim Beginn eines Gewitterregens im Café plötzlich aufstand und hinausging, um die prasselnden Tropfen zu fühlen. Doch die sinnliche Freude, die pure Lust am Aufprall der kühlen Tropfen, war nur das eine. Es ging noch um etwas anderes, Tieferes: den Wunsch, alles, was am Leben schwer und bedrängend war, möchte hinter dem feuchten Gesicht ausbleichen und wegrieseln, mit jedem verlaufenden Tropfen mehr — so, wie sich einer, gequält von Sorgen, von der Woge des Schlafs erhoffen mag, dass der Kummer, von der Bewusstlosigkeit überspült, für immer verschwinden möge. Mit diesem Wunsch, diesem übermächtigen Wunsch, hatte er damals an Doktor Leonardis Fenster gestanden, seine schrecklichen Worte im Sinn, und sich gewünscht, in den rauschenden Regen hinausspringen und alles auslöschen zu können.
Eingehüllt in Warren Shawns Morgenmantel, die bloßen Füße in Pantoffeln, trat er jetzt hinaus in den Garten und ging, während ihm die feinen Regentropfen übers Gesicht liefen, um das ganze Haus herum. So eingehend wie jetzt hatte er den roten Backsteinbau noch nie betrachtet. Das Dach war schwarz vom Moos, der Lack an den Fensterrahmen verwittert, und an der einen Ecke war eine Dachrinne abgeknickt, so dass das Wasser herunterlief. Aber das Haus gefiel Leyland, mit jedem Blick und jeder Einzelheit mehr. Er blieb stehen und hielt das Gesicht in den Regen, minutenlang. Der Schrecken des Traums wich zurück. Als er die Augen öffnete, sah er, wie die Nachbarin auf der anderen Seite verwundert zu ihm hinüberblickte, zu dem älteren Mann, der wie ein entlaufener, verwirrter Patient in Morgenmantel und Pantoffeln reglos im Regen stand.
Als er nachher in trockenen Sachen im Wohnzimmer saß, gehörte ihm das Haus bereits ein bisschen, und nun verstand er auch den Gedanken wieder, der ihm gestern abend plötzlich so abstrus erschienen war: dass dieses Haus der richtige Ort sein könnte, um Klarheit über sein weiteres Leben zu gewinnen. Zu dieser Klarheit, so hatte er es sich vorgestellt, würde gehören, dass er all die Briefe an Livia wieder las, die drüben auf Warrens Schreibtisch in den Mappen lagen, Briefe aus elf Jahren, auch diejenigen, die mit Doktor Leonardis Worten begannen und später davon erzählten, wozu ihn diese schrecklichen Worte getrieben hatten. Er wollte wissen, wie ihn die eigenen Worte von damals berührten, jetzt, da alles vorbei war. In der Zeit zurückgleitend, würde er alles nachlesen, Satz für Satz und immer mit der Frage, wie er es damals erlebt und wie sich das Erleben seither, im Lichte des neuen, unerwarteten Wissens verändert hatte. Es würde sein, als kreiste in ihm ein Licht, das ihm zeigte, wie er gewesen war, wie er jetzt war und in welche Zukunft er hineingehen könnte.
Doch in der nächsten Stunde erwartete ihn Francis Page, Warren Shawns Anwalt. »Denken Sie daran, Ihren Pass mitzubringen«, hatte er vor ein paar Tagen am Telefon gesagt. Bevor er ihn einsteckte, betrachtete Leyland, wie er es auf der Rolltreppe in Heathrow getan hatte, das Foto. Als es gemacht wurde, war er Verleger gewesen. Eigentlich hatte er damit gerechnet, das ganze Leben als Übersetzer zu verbringen. Nach dem plötzlichen Tod seiner Frau dann hatte er ihren Verlag geerbt. Er hatte die Herausforderung angenommen, im Inneren oft zitternd, nach außen hin mit fester Hand und fester Stimme, und nach elf Jahren stand der Verlag gut da, es gab Leute, die sagten, er habe noch mehr Glanz als zu Livias Zeiten.
Leyland ging in die Küche und trank ein großes Glas Wasser. Zehn Tage. Wenn er die Wahrheit zehn Tage früher erfahren hätte, gehörte der Verlag jetzt immer noch ihm. Es wäre schwierig gewesen, alles rückgängig zu machen. Trotzdem. Zehn Tage, lächerliche zehn Tage. Im Mantel stand Leyland in der Küche, mit leerem Blick, das Glas in der Hand. Plötzlich brach das Glas, das er umklammert gehalten hatte. Er fuhr zusammen und konnte gerade noch verhindern, dass die Scherben zu Boden fielen. Am Daumen war ein Schnitt, und es blutete. Im Bad gab es Pflaster, und während er eines auf den Daumen klebte, erschrak er noch einmal, es war wie eine innere Schockwelle, die ihn mit Verzögerung erreichte. Sechs Wochen war es her, dass sich die Zukunft für ihn wieder geöffnet hatte. Das Begreifen war langsam vor sich gegangen, in den ersten Tagen hatte er wie in Zeitlupe gelebt. Der Gedanke, dass es eine Frage von nur zehn Tagen gewesen war, hatte ihn jeweils mitten in der Nacht überfallen. Jetzt erschrak er über die Heftigkeit seines stummen Grolls, der ihn, aus dem Dunkel heraus wirkend, ein Wasserglas hatte zerdrücken lassen. Es war, dachte er auf dem Weg zur Kanzlei des Anwalts, kein Groll, der einer bestimmten Person galt, eher war es ein Groll gegen das Leben und die Ungerechtigkeit in seinen Zufällen.
Francis Page las ihm das Testament vor. Danach hatte Warren Shawn ihm das Haus mit allem vererbt, was drin war — Möbel, die Bibliothek, alles. Leyland leistete die nötigen Unterschriften. Zum Schluss überreichte ihm der Anwalt einen verschlossenen Umschlag. For Simon Curtis Leyland, stand darauf, es war Warrens feine, schnörkellose Handschrift. »Er hat mir eingeschärft, Ihnen den Brief, wenn es soweit wäre, unbedingt zu geben«, sagte Page. »Es sei sein eigentliches Vermächtnis, sagte er.« Sie standen unter der Tür. »Zum Unterschreiben brachte er eine große Lupe mit. Abgesehen davon sah er nicht krank aus, nur müde. Wie einer, der genug hat.« So habe es auch Kenneth Burke empfunden, sagte Leyland. »Ein guter Grund zu gehen; der beste«, sagte Page. Leyland nickte. Er hatte den Anwalt nicht gemocht. Jetzt war es plötzlich anders.