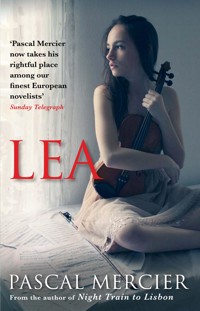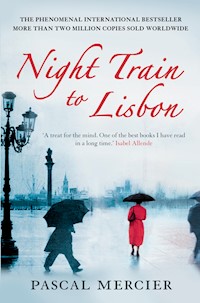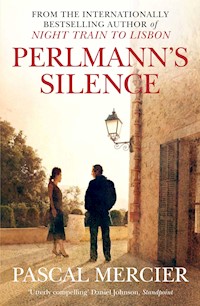Inhaltsverzeichnis
btb
Lob
Patrice – ERSTES HEFT
Patricia – ERSTES HEFT
Patrice – ZWEITES HEFT
Patricia – ZWEITES HEFT
Patrice – DRITTES HEFT
Patricia – DRITTES HEFT
Patrice – VIERTES HEFT
Patricia – VIERTES HEFT
Patrice – FÜNFTES HEFT
Patricia – FÜNFTES HEFT
Patrice – SECHSTES HEFT
Patricia – SECHSTES HEFT
Patrice – SIEBTES HEFT
Patricia – SIEBTES HEFT
Abschied
Copyright
btb
Buch
Ein berühmter italienischer Tenor wird während der Aufführung von Puccinis »Tosca« auf offener Bühne erschossen. Die Kinder des Täters, die Zwillinge Patrice und Patricia, reisen ins Elternhaus nach Berlin, um zu vestehen, wie es zu dieser pathetischen Tat kommen konnte. Schicht um Schicht legen sie die Beweggründe frei, die ihren Vater, einen legendären Klavierstimmer und erfolglosen Opernkomponisten, zur Waffe greifen ließen. Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive der Zwillinge. Jahre zuvor waren sie vor ihrer inzestuösen Liebe in verschiedene Hemisphären geflohen. Ihr Wiedersehen und die zunächst unbegreifliche Tat des Vaters führen dazu, daß sie ihre Sprachlosigkeit beenden und aufschreiben, wie sie die einstige Intimität erlebt haben. Durch den Prozeß des Erinnerns werden sie schließlich, für den anderen und für sich selbst, zu eigenständigen, voneinander unabhängigen Personen.
Autor
Pascal Mercier, 1944 in Bern geboren, ist heute Professor für Philosophie in Berlin. 1995 erschien sein vielbeachteter Roman »Perlmanns Schweigen«, und auch »Nachtzug nach Lissabon« wurde als Sensation gefeiert. Unter seinem bürgerlichen Namen Peter Bieri sind zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen erschienen.
Pascal Mercier bei btbPerlmanns Schweigen. Roman (72135) Nachtzug nach Lissabon. Roman (73436)
Nous cherchons notre bonheur hors de nousmêmes, et dans l’opinion des hommes, que nous connaissons flatteurs, peu sincères, sans équité, pleins d’envie, de caprices et de préventions: quelle bizarrerie!
Wir suchen unser Glück außerhalb von uns selbst, noch dazu im Urteil der Menschen, die wir doch als kriecherisch kennen und als wenig aufrichtig, als Menschen ohne Sinn für Gerechtigkeit, voller Mißgunst, Launen und Vorurteile: wie absurd!
LA BRUYÈRE
All dies aufzuschreiben – es hat mir dieGegenwart zurückgegeben, die ich vorlanger Zeit verloren hatte.
PATRICE
Läßt sich, was man einmal in Wortegefaßt hat, weiterleben wie bisher? Oderist die stille Beschäftigung mit Worten diewirkungsvollste Art, das Leben zu verändern – wirkungsvoller als dielauteste Explosion?
PATRICIA
Patrice
ERSTES HEFT
JETZT, DA ALLES VORBEI IST, wollen wir aufschreiben, wie wir es erlebt haben. Wir werden den Erinnerungen allein gegenübertreten, ohne Verführung durch die Gegenwart des anderen. Die Berichte sollen wahrhaftig sein, ganz gleich, wie groß der Schmerz sein mag beim Lesen. Das haben wir uns versprochen. Nur so, hast du gesagt, vermöchten wir den Kerker unserer Liebe zu zerschlagen, die mit der gemeinsamen Geburt begann und bis zum heutigen Tage gedauert hat. Nur so könnten wir frei werden voneinander.
Du hast es gesagt, als wir in der Küche standen und die letzten Schlucke Kaffee aus den Zwillingsbechern tranken, die Maman am Abend meiner Ankunft aus dem hintersten Winkel des Buffets hervorgekramt hatte. Ihre Hände zitterten, und es wäre unmöglich gewesen, sie in ihrem verlorenen Lächeln, hinter dem sie einen Sprung in die unversehrte Vergangenheit versuchte, zu enttäuschen. So haben wir einen unsicheren Blick getauscht und die beiden blaßgelben Becher in die Hand genommen, du den heilen, ich denjenigen mit dem Sprung; wie früher. Wenn wir uns, weil wir keinen Schlaf fanden, nachts in der Küche trafen, hielten wir die Becher wie damals, und es schien mir, als würden sich unsere Bewegungen mit jedem Mal wieder ähnlicher. Nur angestoßen haben wir mit unserem Kaffee nicht wie früher, obwohl wir beide vom anderen wußten, daß er daran dachte. (In diesen Tagen waren wir füreinander wie aus Glas: hart und zerbrechlich zugleich, und in den Gedanken vollkommen durchsichtig.)
Zweimal hast du heute morgen den leeren Becher an die Lippen geführt, bevor du ihn ausspültest. Als du nach einem Augenblick des Zögerns zum Küchentuch griffst, um ihn zu trocknen, hatte ich die Hoffnung, du würdest ihn in die Reisetasche stecken, die fertig gepackt im Entrée stand. Als einen Gegenstand, der uns über alle Abschiede hinaus verbände. Statt dessen tatest du den trockenen Becher in die Geschirrablage, als müßte er noch weitertrocknen. Es geschah langsam und mit großer Behutsamkeit. Dann gingst du voran. In dem Blick, mit dem du mich streiftest, lag erschöpfte Tapferkeit und der dunkle Schimmer der Resignation, denn wie immer fiel dir die grausame Rolle derjenigen zu, die den Abschied vollziehen mußte. Ich war froh, daß dies noch nicht der letzte Blick war. Gleichzeitig zitterte ich vor dem Moment, wo wir nachher unter der Haustür stehen würden, um den letzten Blick zu tauschen.
Deine Stiefel waren laut auf den Fliesen. Mit einer schnellen Bewegung schlüpftest du in den Mantel und holtest die Handschuhe aus der Tasche. Während du sie anzogst, standest du mit gesenktem Kopf vor mir. Nie wieder würde ich diese Hände auf mir spüren. Ich dachte an die weißen Handschuhe aus Spitze und öffnete die Tür, um das Bild zu verscheuchen. Dann begegneten sich unsere Blicke. Mit leise zitternden Lippen versuchtest du ein Lächeln, das deinen und meinen Schmerz, wenn nicht zu leugnen, so doch zu verharmlosen suchte: Machen wir es uns nicht schwerer, als es ist! Einen entsetzlichen Augenblick lang dachte ich, du würdest mir die Hand geben, etwas, was wir – außer wenn wir andere spielerisch nachahmten, so daß die Geste wie ein Zitat war – niemals getan haben. Schon hattest du dich gebückt, um die Reisetasche aufzunehmen, da richtetest du dich wieder auf, und nun verlor sich dein Blick in Tränen. Ich habe keine Ahnung, ob auch ich mich bewegte, ich weiß nur, daß du auf mich zutratest wie sonst nie in diesen Tagen und den Kopf an meine Schulter legtest.«Wir werden alles aufschreiben, nicht wahr?»hast du geflüstert. Ich nickte in dein Haar hinein, das anders roch als früher. Dann umarmtest du mich mit der wunderbaren, entsetzlichen Rückhaltlosigkeit eines letzten Males. In der Zeit gab es einen Sprung, du standest am Gartentor und hobst die Hand, es war die gleiche Bewegung wie bei zahllosen Gelegenheiten in ferner Vergangenheit. Auch ich hob die Hand, glaube ich. Und dann sah ich dich, wie damals, mit einer Reisetasche die Straße entlanggehen, zur Seite geneigt als Gegengewicht. Es war eine andere Tasche als damals, und jetzt, im November, konnte mein Blick dir länger durch die kahlen Bäume folgen als an jenem Sommermorgen unseres ersten Abschieds, als mir die Zeit verlorenging.
Nie werde ich vergessen, wie ich damals, vor sechs Jahren, von deiner Gegenwart auf dem Bettrand erwachte. Nicht die Bewegung des Hinsetzens war es, die mich weckte. Deine Nähe war es, dein Blick und der feine, kaum merkliche Geruch aus Seife und Parfum. Einen winzigen Moment lang glaubte ich, du wolltest zu mir kommen, und setzte an, die Arme nach dir auszustrecken. Doch dann sah ich im fahlen Licht der Morgendämmerung deine Reisekleidung. Nie zuvor bin ich so tief erschrocken wie damals, und jedes andere Erschrecken, das mir seither zugestoßen ist, war verglichen damit ein Nichts. Ich hoffe, nie wieder eine so große, so schmerzhafte Wachheit ertragen zu müssen wie in jenem Augenblick, als mir deine Absicht klar wurde. Du saßest sehr aufrecht, die Hände im Schoß. Es lag eine entsetzliche Bestimmtheit in dieser Haltung, und dein Blick besaß eine Entschlossenheit, die keinen Widerspruch duldete. «Adieu», sagtest du nur. Halb aufgerichtet wollte ich gerade fragen, wohin, da hast du nur stumm den Kopf geschüttelt. (Manchmal verfolgt mich dieses Kopfschütteln im Traum auch heute noch.) Wie nach einem Faustschlag sank ich ins Kissen zurück. Deine Entschlossenheit, so schien mir, geriet für einen Augenblick ins Wanken, als du meine Tränen sahst, und du schlossest die Augen, um in deinen Willen zurückzufinden. Immer noch mit geschlossenen Augen beugtest du dich plötzlich zu mir herunter und küßtest mich auf die Stirn. Dann warst du mit einer einzigen schnellen Bewegung bei der Tür, die du, ohne dich noch einmal umzudrehen, hinter dir zumachtest.
Ich hörte deine leisen Schritte auf der Treppe und im Entrée, und einmal das Schleifen von etwas, das deine Reisetasche sein mußte. Erst jetzt sprang ich auf und trat auf die Galerie. Du hattest den Schlüssel außen ins Schloß gesteckt, ich sah, wie sich die Tür lautlos schloß, und hörte, wie der Schnapper leise ins Schloß glitt. Ich stürzte ans Fenster. Seitlich geneigt gingst du mit unregelmäßigen, angestrengten Schritten die Straße entlang. Einmal setztest du die Tasche ab, um zu verschnaufen. Ich hoffte, du würdest dich umdrehen und zu meinem Fenster heraufblicken. Darüber vergaß ich zu atmen. Doch du standest nur da und massiertest die Hand. Dann nahmst du die Tasche in die andere Hand und gingst weiter, auf den Mexikoplatz zu und hinaus aus meinem Leben.
Damals breitete sich eine schreckliche Stille aus, die für lange Zeit auch den größten Lärm übertönen sollte: die Stille deiner Abwesenheit. Ich hörte das Geräusch einer jeden Bewegung, die ich machte. Vor allem meine Schritte hörte ich. Es kam mir vor, als sei ich nichts anderes als der Resonanzkörper für die Geräusche, die so schrecklich laut von deinem Verschwinden zeugten. Ich verließ das Haus in der Hoffnung, der Lärm der Straße würde die gespenstischen Laute der Stille aufsaugen. Doch weder das Aufheulen von Motoren noch das ohrenbetäubende Knattern von Preßlufthämmern vermochte der betäubenden Stille etwas anzuhaben. Ich hörte weiterhin jeden einzelnen meiner Schritte auf dem Pflaster, jedes Reiben des Ärmels an der Jacke, ja sogar jeden Atemzug, den ich tat. Im Haus spürte ich das Pochen meines Bluts und hörte – seit Jahren das erste Mal mit Bewußtsein – das Ticken der Pendule im Entrée. Von da an schien die Welt voll von tickenden Uhren zu sein, sogar das Ticken meiner Armbanduhr meinte ich zu hören. Nichts hätte die plötzliche Leere der Zeit, ihr dürftiges, lebloses und dennoch aufdringliches Verfließen besser zum Ausdruck bringen können als dieses Ticken.
Der heutige Abschied war noch nicht der letzte. Der endgültige steht uns noch bevor. Wir werden in Paris aus dem Bistro kommen, das du für diese Begegnung ausgesucht hast. Wie wird es aussehen? Werden wir unsere Aufzeichnungen gegeneinander über die Marmorplatte schieben wie bei einem Treffen von Spionen? Oder werden wir sie erst austauschen, wenn wir wieder draußen sind? Werden wir getrennt zahlen, oder werden wir versuchen, einander zu diesem letzten Kaffee einzuladen – du als die Gastgeberin, ich als der Besucher? Und was werden unsere letzten Worte sein? Worte eines solchen Abschieds haben wir nicht in unserem Repertoire. Es war nicht vorgesehen, daß wir sie eines Tages brauchen würden.
Wir werden auf der Straße stehen, jeder die Papiere des anderen in der Hand, um dann unserer Wege zu gehen, jeder einen anderen. Wie das sein wird – ich wage nicht daran zu denken.
Es ist Abend, und das Haus ist leergeräumt. Bis auf den Flügel, Vaters Schreibtisch, den Koffer mit den Partituren und das Sofa, auf dem ich schlafen werde. Vaters Arbeitszimmer, hatte ich den Möbelpackern gesagt, solle als letztes drankommen. Gegen Mittag kamen die Leute vom Klaviertransport und standen in blauer Arbeitskleidung um den glänzenden Steinway herum. Da geschah etwas mit mir, und ich schickte sie wieder weg. Dann gab ich Anweisung, was sonst noch dableiben sollte. Dem Möbelhändler sagte ich, er werde, wie vereinbart, auch die restlichen Sachen bekommen; nur jetzt noch nicht. Von Anfang an muß ich gespürt haben, daß ich hier noch nicht fertig bin. Daß ich Vater noch etwas schulde.
Eigentlich müßte ich jetzt im Flugzeug nach Santiago sitzen, und es stört mich, daß du mich über dem Ozean wähnst, während ich in Wirklichkeit hier an Vaters Schreibtisch sitze. Anrufen aber wäre gegen die Abmachung.
Als du heute morgen aus meinem Blickfeld verschwunden warst, konnte ich es kaum erwarten, den ersten Satz zu schreiben. Den Stift aufs Papier zu setzen, um zu dir zu sprechen, das würde verhindern, daß das unsichtbare Band zwischen uns zerrisse wie beim ersten, sprachlosen Abschied. Zumindest vorläufig würde es das verhindern. Jede Minute, die verstrich, ohne daß ich begonnen hatte, erschien mir bedrohlich. Doch dann fuhr der Möbelwagen vor, und ich hatte anderes zu tun.
Später ging ich in die Papeterie. Es sollten keine losen Blätter sein, auf denen ich unseren Pakt des Erzählens erfüllte, sondern Hefte. Das war im Flugzeug praktischer. Was ich mir nämlich vorstellte, war, während der sechzehn Stunden Flug ununterbrochen zu schreiben. Nur so wäre das Geräusch der Motoren erträglich, die mich unaufhaltsam von dir wegtrieben. Mit jedem Satz, den ich über uns schrieb, würde ich die Triebwerke und die äußerliche Distanz, die sie zwischen uns legten, verspotten. Nie wieder wollte ich eine Nacht erleben wie auf dem ersten Flug. Deshalb war es wichtig, daß mir auf keinen Fall das Papier ausginge. Ich nahm drei Hefte aus dem Regal, dann noch zwei. Schon draußen, kehrte ich um und kaufte weitere fünf dazu. Ich würde auf dem Flug nicht zehn Hefte füllen; das war es nicht. Was ich sicherstellen wollte, war, daß die Hefte bis zum Ende meines Berichts die gleichen blieben. Diese Gleichförmigkeit war – so kam es mir vor – ein Mittel, um mich gegen einen Abbruch unseres Gesprächs zu schützen. Auch wäre es gut, in Santiago einen Stoß von Heften zu haben, die aus der Papeterie stammten, in der wir beide über viele Jahre unsere Schreibwaren zu kaufen pflegten. Und so liegt jetzt ein Stoß von neun Reserveheften in der Schublade von Vaters Schreibtisch.
Noch während die Schritte der Möbelpacker im leer werdenden Haus hallten, begann ich zu schreiben. Die Männer, die vergeblich auf das Bier warteten, machten sich in halblauten, unwirschen Sprüchen lustig über mich, der ich dasaß, als ginge mich das Ganze nichts an. Auch Baranski, der Makler, der zur Schlüsselübergabe gekommen war, wußte nicht, was er von der Sache halten sollte. Kaum hatte ich ihn hereingelassen, setzte ich mich an den Schreibtisch und nahm den Stift zur Hand, ungeduldig auf den Moment wartend, wo ich würde weiterschreiben können. Er habe schon zwei Interessenten an der Hand, sagte er, die ein Haus zum 1. Dezember suchten, und vorher müsse ja noch renoviert werden. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Vorläufig keine Besichtigungen, sagte ich ungeduldig. Und unser Vertrag? Vorläufig keine Besichtigungen, wiederholte ich. Was das denn hieße:«vorläufig»? Das könne ich ihm vorläufig nicht sagen, war meine Antwort. Die Reifen quietschten, als er abfuhr. Kaum war der letzte Möbelpacker durch die Tür, schloß ich zweimal ab. Ich habe mich unmöglich benommen. Es wird noch Ärger geben.
Ich denke zurück an jenen Anruf von dir, der das zerbrechliche Gehäuse meines neuen Lebens zum Einsturz bringen sollte. Wie unwirklich es war, aus dem Schlaf gerissen zu werden und im Rauschen der transatlantischen Leitung deine Stimme zu hören! «Ici Patricia», sagtest du, als ich abnahm, und nicht wie früher «C’est moi». Als ob ich deine Stimme nicht in jedem Augenblick und unter allen Umständen erkennen würde.
Dein Bericht war von atemloser Sachlichkeit. Anders als früher hätte ich deine Worte nachher nicht wiederholen können. Sie versanken in der Betäubung, die mich schon nach den ersten Sätzen umfing. Nur die nackten Informationen behielt ich: Antonio di Malfitano während einer Aufführung von Tosca erschossen. Vater im Gefängnis. Maman sei dabeigewesen, sage aber nichts. Und dann der Schluß des Gesprächs, nachdem es eine Weile still gewesen war:«Patrice?»«Ja.»«Du wirst doch kommen?»«Ja», sagte ich,«ich komme.»«A bientôt.»«A bientôt.» Ich war froh, daß du bereit warst, unsere gewohnten Worte des Abschieds zu tauschen. In diesem Augenblick war es wie früher. Ich konnte es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Und ich habe noch nie vor etwas solche Angst gehabt.
Ich konnte es nicht glauben. Das würdest du niemals tun, Vater, dachte ich und wiederholte es mir in den nächsten Stunden hundertfach, laut und leise. Nicht Antonio di Malfitano, den Mann, dessen Stimme du vergöttert hast. Und gewiß nicht auf offener Bühne, die für dich wie ein Heiligtum war. Die Stimme zu vernichten, die du beim Schreiben deiner Partituren ständig im Ohr hattest: Das ist unvorstellbar.
Es kam mir damals ganz natürlich vor, Vater in Gedanken auf diese Weise anzusprechen. (Wobei es mir wichtig war, ihn Vater zu nennen und nicht Papá, wie du es – stets mit der französischen Betonung – zu tun pflegtest.) Erst im Laufe der folgenden Stunden wurde mir klar, daß ich es so noch nie getan hatte. Es war, das spürte ich allmählich, eine ganz neue Art, ihm zu begegnen. Es war eine Befreiung, darauf gekommen zu sein, und ich war verwundert, daß es der gespenstischen Nachricht von seiner undenkbaren Tat bedurft hatte, um mir diese Möglichkeit zu eröffnen. Jetzt, wo ich dir darüber berichte und die Worte, die ich damals an ihn richtete, nachträglich aufzeichne, habe ich das sonderbare Gefühl, Vater damit näher zu sein als früher, wenn ich bei ihm war. Richtig erklären kann ich es mir nicht. Vielleicht war es seine Aura der Einsamkeit, die mich vorher daran gehindert hatte, ihm so unmittelbar zu begegnen. Es ist, als müsse ich erst seine einsame Anwesenheit vergessen, um ihn mit meinen Gedanken ganz zu erreichen. (Wir alle haben – so kommt es mir nun vor – stets über ihn geredet statt zu ihm. Es klingt verrückt, aber ich möchte hinzufügen: Das war selbst dann so, wenn wir ihn, äußerlich gesehen, direkt angesprochen haben.)
Ich vermisse dich, Vater. Als ich damals verwirrt und ungläubig den Hörer auflegte, war es in Chile noch mitten in der Nacht, während für dich bereits der erste Tag hinter Gittern begonnen hatte. Du in Handschellen, dachte ich. Wie konnten sie das tun! Ich sah, wie die stählernen Ringe über deinen breiten Handgelenken zuschnappten, und hörte das Klicken. Wie ich dich kenne, sagte ich zu dir, wirst du kein Wort gesprochen haben, und auf deinem Gesicht wird jenes Lächeln erschienen sein, mit dem du der feindlichen Welt stets begegnet bist – jenes Lächeln, das Gygax, der Heimleiter, nicht ausstehen konnte. Das arroganteste Kinderlächeln, das ich kenne. Wie oft hast du diesen grausamen Ausspruch von ihm zitiert. Ich sehe, fuhr ich fort, das besondere Glitzern in deinen Augen, das wir geliebt und gefürchtet haben, Patty und ich. Diese Augen, sie wirken stets, als würdest du sie eine Spur zusammenkneifen, und zusammen mit den schmalen Lippen, die immer auf dem Sprung sind, sich zu einem spöttischen Lächeln zu büscheln, geben sie dem Gesicht den Ausdruck einer fortwährenden ironischen Distanz zu allem. Es ist, als würdest du das Gesicht stets ein bißchen nach vorne schieben, und dieses Schieben kommt nicht vom Hals, überhaupt kommt es nicht von etwas Körperlichem, es kommt aus deinem Inneren, aus derselben Quelle wie das Glitzern in den Augen. Allen, die dich nicht kennen, erscheinst du dadurch wie einer, der die Welt von einem inneren Hochsitz aus betrachtet.
Und doch könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Patty und ich, wir pflegten zueinander zu sagen: Er weiß es nicht, aber durch dieses Schieben des Gesichts und den oft überwachen Blick versucht er in jedem Augenblick, den Startnachteil auszugleichen, den er als Waisenkind hatte. Was an diesem Gesicht arrogant erscheinen mag, enthält in Wirklichkeit die Botschaft: Ich war im Hintertreffen, und damals, als Kind, konnte es scheinen, als würde ich es nie schaffen. Aber ich habe aufgeholt, und nun bin ich hier und weiß über Musik alles. Das soll mir einer nachmachen. Ihr, die ihr das bessere Los gezogen habt, wißt nichts von der Anstrengung und den Demütigungen, die hinter mir liegen.
Erst als dieses lautlose Gespräch mit Vater zu Ende war, machte ich damals Licht. Die Wohnung kam mir mit einemmal fremd vor, obwohl ich schon vier Jahre dort gelebt hatte. Dein Anruf, Patty, er hatte eine alte Empfindung von neuem aufbrechen lassen: daß die Dinge ihre Fremdheit für mich erst verlieren, wenn auch du sie gesehen hast. Wenn ich geglaubt hatte, mir diese Räume auch ohne dich zu eigen gemacht zu haben, so wurde ich in jenem Augenblick eines Besseren belehrt: Es hatte sich um bloße Gewöhnung gehandelt. Zu einem Teil von mir würden sie erst dadurch werden können, daß ich sie mit dir teilte. Insgeheim, da bin ich sicher, habe ich darauf gewartet, daß du sie eines Tages betreten und mir dadurch gewissermaßen übereignen würdest.
Bevor ich nach deinem Anruf in die Küche ging, um Kaffee zu machen, rief ich am Flughafen an, wohl wissend, daß es dafür noch zu früh war. Als ich dann den Tauchsieder in der Hand hielt, dachte ich an Vaters Tauchsieder. Mit diesem verbeulten Ding, Vater, pflegtest du dir dein Kaffeewasser zu machen, wenn du, lange vor uns anderen, aufgestanden warst, um noch ein, zwei Stunden Noten zu schreiben, bevor du ins Geschäft mußtest. Ich sehe dich in der Küche stehen, den schäbigen Topf in der Hand, umgeben von ausgesuchten italienischen Kacheln und einer endlosen Reihe von Pfannen und Töpfen aus blitzendem Kupfer.
Maman hat ihn gehaßt, deinen Tauchsieder mit dem wackligen Griff. Wenn sie dich dabei überraschte, daß du ihn herausholtest, statt eine der beiden Kaffeemaschinen einzuschalten, ging sie wortlos hinaus. Es war wie mit der alten Füllfeder, die ebenfalls aus deiner Junggesellenzeit stammte. Maman hat dir im Laufe der Jahre sicher ein Dutzend der edelsten Füller geschenkt. Deine Partituren aber hast du alle mit der alten Feder geschrieben, deren Griff vom vielen Gebrauch matt und gräulich geworden war. Oder der uralte Geldbeutel, den du heimlich zum Sattler brachtest, statt ihn gegen eines der eleganten Portemonnaies auszutauschen, welche Maman dir aufdrängte. Stumm hast du dich mit solchen Dingen in einer Familie behauptet, in der du immer ein Fremdling warst.
Weißt du, Vater, was mir als erstes durch den Sinn ging, kaum hatte ich in Santiago den Hörer aufgelegt? Deine heisere Stimme, wenn du über Erfolg sprachst. Es war dann, als streiftest du die alltägliche Stimme ab und schlüpftest in einen neuen, bedeutungsschweren Tonfall voller Geheimnisse. Etwa wenn du von Verdis, Puccinis oder Massenets Erfolgen sprachst und überhaupt vom Durchbruch, der jemandem gelungen war. Sie hatte viele Schattierungen, diese besondere Stimme. Ich weiß nicht warum, aber man wußte, auch wenn man eben erst dazugekommen war, sofort, ob du von einem Erfolg oder einem Mißerfolg sprachst. Der Klang verriet es, noch bevor man den Inhalt verstanden hatte. Es lag düsterer Triumph in deiner Heiserkeit, wenn die Rede von einem Großen war, dem der Erfolg bei einem später gefeierten Werk lange versagt geblieben war, wie Beethoven beim Fidelio. Wobei ich nie sicher war, ob der Triumph der späteren Anerkennung galt oder der Tatsache, daß auch Große manchmal lange auf sie warten müssen.
Nichts jedoch glich derjenigen Tonlage, die du anschlugst, wenn es um deinen Helden ging, dem der Erfolg ein Leben lang versagt geblieben war: Cesare Cattolica. Es gab diesen einen Satz über ihn, den ich bei zahllosen Gelegenheiten von dir gehört habe: Niemand wollte seine Musik hören. Und jedesmal war es, als sagtest du: Niemand will meine Musik hören – ein Satz, den du nie ausgesprochen hast, dazu warst du zu stolz. NIEMAND wollte seine Musik hören. So sagtest du, wenn du traurig und verzweifelt warst. KEINER wollte seine Musik hören. So drücktest du dich aus, wenn Wut und Verbitterung dich beherrschten. Es war, als wendetest du dich mit dem Wort KEINER an jeden einzelnen und klagtest ihn an – als schrittest du eine endlose Front von einzelnen ab, vor die du der Reihe nach hintratest, um ihnen deine heisere Anklage entgegenzuschleudern. Dein Blick bekam eine hilflose Heftigkeit, der Haß beigemischt war, ein anonymer Haß, der keiner bestimmten Person galt. Du sahst in solchen Momenten niemanden an, sondern blicktest an allen vorbei, und in dem Blick lag Anklage, nein, eigentlich nicht Anklage, sondern etwas, was darüber hinausging, nämlich das mit Verachtung gepaarte Wissen, daß niemand der Anwesenden, ja überhaupt niemand außer Cattolica und dir, Vater, ermessen konnte, was das bedeutete: daß niemand die Musik hören wollte, die man geschrieben hatte. Die anderen, zu denen du sprachst, waren nur Publikum, Staffage für die verzweifelte Botschaft, von der dich niemand erlösen konnte. Dein Blick war voll von brennender Einsamkeit, für die man sich keinen kraftvolleren Ausdruck hätte denken können als die Heiserkeit deiner Stimme.
Als ich damals, nach Pattys Anruf, mit dem dampfenden Kaffeebecher in meiner Küche in Santiago stand, war ich vollkommen sicher, Vater, daß wenn du es – was unmöglich schien – doch getan hattest, du gewissermaßen aus dieser Heiserkeit heraus geschossen hattest; daß es deine heisere Einsamkeit war, die sich in dem Schuß entladen hatte. Nach einer Weile dann spürte ich, daß hinter meinem Rücken etwas Überraschendes geschehen war: Mein Ekel vor deinen heiseren Erfolgspredigten war verschwunden, ein Ekel, der in den letzten Jahren zu Hause übermächtig geworden war und mich hierhergetrieben hatte. Ich hatte in die andere Hemisphäre reisen, einen Ozean von Wasser sowie einen ganzen Kontinent zwischen mich und diese Heiserkeit legen müssen, um ihrer erstickenden Eindringlichkeit zu entfliehen. Ans andere Ende der Welt war ich geflohen. Doch jetzt, wo ich dich mit deinem übertrieben geraden Rücken auf einer Gefängnispritsche sitzen sah, hatte deine Heiserkeit plötzlich alles Bedrängende verloren. Jetzt gehörte sie nur noch dir allein; sie war nichts mehr zwischen uns. Überhaupt hatte sie kein Ziel mehr, sondern war nur noch ein Aufschrei, vor dem ich wiederum fliehen wollte, doch nun nicht mehr, weil deine heisere Stimme mir die Zukunft zu rauben drohte, sondern weil ich spürte, wie schrecklich der Schmerz dahinter sein mußte.
Erfolg macht unantastbar. Ich hörte diesen Satz jeweils lange, bevor du ihn wirklich aussprachst, und ich versuchte mich dagegen zu schützen, indem ich mich innerlich taub stellte, damit er wie eine Lautfolge ohne Bedeutung an mir vorbeirauschen möge. Jetzt, wo eine Zellentür hinter dir ins Schloß gefallen war, mußte ich mich vor dem Satz erneut schützen. Doch nun war es anders als früher. Voller Scham dachte ich daran, wie ich deine Heiserkeit manchmal nachgeäfft hatte im hilflosen Versuch, mich dagegen zu wehren. Auf einmal konnte ich es kaum erwarten, deine heisere Stimme wieder zu hören.
Als ich dich vor dem Gefängnis wiedersah, war sie verschwunden, die früher so verhaßte Heiserkeit. Du warst so leer ohne sie, Vater, so matt und ohne Zukunft. Die Heiserkeit war doch auch die Stimmlage der Hoffnung und des Träumens gewesen. Ich hätte alles darum gegeben, sie noch einmal hören und dich noch einmal als Träumer erleben zu können. Ich vermisse dich, Vater. Und ich wünschte, ich hätte dich auf eine Weise berühren können, die den Griff der Polizisten, als sie dich abführten, ausgelöscht und dich in der Unantastbarkeit, nach der du dich stets gesehnt hast, wiederhergestellt hätte.
In Santiago begann es zu dämmern, langsam und zögernd wie an regnerischen Tagen immer. Ich trat auf meinen winzigen Balkon und lehnte mich auf das rostige Geländer. Die ersten Lastwagen donnerten vorbei. Ende Oktober, der Frühling hatte begonnen. Nicht nur meine Wohnung wirkte jetzt fremd. Die Fremdheit dehnte sich auf die ganze Stadt aus und auf die verschneiten Kordilleren, von denen sie umgeben ist. Nie, Patty, ist dein Blick über diese Szenerie geglitten, nie hast du leibhaftig neben mir gestanden und sie mit mir zusammen betrachtet, wenngleich ich mich in der ersten Zeit manchmal in diese Illusion vergrub und laut mit dir zu sprechen begann, bis ich einmal den verwunderten Blick meiner Nachbarin auffing, die sich erschrocken zurückzog, als hätte sie etwas Krankes gesehen. Weißt du noch, wie gut wir das schon als kleine Kinder konnten: etwas in so vollständigem Gleichklang betrachten, daß unsere Blicke ihre Getrenntheit verloren und miteinander verschmolzen? Und wie glücklich wir dabei waren?
Ich erschrak, als meine Gedanken eine abrupte Wendung nahmen und ich dachte: Gekonnt hätte er es. Vater, das wußten wir, war ein guter Schütze, der zweitbeste in der Kompanie. Hugentobler bekam den Preis, aber nur deshalb, weil er mogelte. Nie hat Vater vergessen, das hinzuzufügen. Erinnerst du dich an den verschlagenen Ausdruck, den sein Gesicht dabei annahm – als sei er wieder auf dem Schulhof und bereit, sich mit allen, auch den gemeinsten Tricks zu verteidigen? Ich kann mir vorstellen: Damit, mit seiner wortlosen Treffsicherheit, hat er sich bei den anderen, die den schweigsamen Außenseiter mieden, Respekt verschafft.
Ja, Vater, du hättest es gekonnt, dachte ich. Und Tosca war die perfekte Gelegenheit: Man könnte es kurz vor Ende tun, wenn Mario Cavaradossi, der Maler, auf der Engelsburg vom angetretenen Kommando erschossen wird, angeblich nur zum Schein, doch Scarpia hat sein Wort gebrochen, und die Schüsse sind echt. Man könnte gleichzeitig mit den Soldaten schießen, dann fiele der Knall nicht auf. Den genauen Zeitpunkt, den hättest du mühelos getroffen, Vater, du kennst jeden Takt dieser Oper, so wie du jeden Takt jeder Oper kennst.
Aber du hättest aufstehen und vor aller Augen die Waffe auf die Bühne richten müssen. Es ist viel zu melodramatisch, es paßt nicht zu dir. Oder doch?
Und dann hatte ich plötzlich das Gefühl zu verstehen: Sollte Vater es tatsächlich getan haben, dann hatte ihn das Theatralische seines Tuns nicht gestört. Im Gegenteil: Es war wie die Szene in einer Oper. So ergab es einen Sinn. Zugleich aber war es undenkbar. Auf einen anderen hätte er vielleicht zielen können, einen wie Gygax, den Heimleiter. Aber nicht auf Antonio di Malfitano.
Ich fror und ging hinein, um am Flughafen anzurufen.
Es war ein sonderbares Erwachen im leeren Haus. Ich hatte nicht daran gedacht, die Fensterläden zu schließen, und ohne die Gardinen ist es an einem frostklaren Morgen blendend hell in den Räumen. Das Sonnenlicht brach sich in den schwarzglänzenden Flächen des Flügels, die Vater so sehr liebte. Das gestrige Ausräumen hatte dort Staub hinterlassen, und als erstes nahm ich das Taschentuch und wischte ihn weg. So hätte es auch Vater gemacht. Ich wischte lange, viel länger als nötig, und nach dem Kaffee noch einmal. Dann stand ich lange am Fenster und überlegte, ob ich zum Grab gehen sollte. Doch das war es nicht, worum es ging. Was aber war es dann, was ich Vater schuldete?
Ich schloß den Metallkoffer auf und nahm seine Partituren heraus. Eine nach der anderen wog ich sie in der Hand. Vierzehn Opern, das Werk von dreißig Jahren. Natürlich habe ich gewußt, daß es viele waren. Trotzdem hat es mich erschüttert: Da war immer noch eine und noch eine und noch eine. Blütenweißes Papier, jede Note mit kalligraphischer Sorgfalt hingemalt. Wie wir uns doch diesen Noten, diesen Tönen gegenüber verschlossen haben, du und ich! Geradezu verbarrikadiert haben wir uns im Inneren, bis daraus schließlich eine selbstauferlegte Taubheit wurde. Lange saß ich und blätterte. Ich kam mir vor wie ein Analphabet vor einem Buch. Ich, der Sohn eines Komponisten.
Der erste Brief, den Vater mir nach Chile schickte, kam mir in den Sinn. Von den vielen Briefen, die aus Berlin kamen, war er der einzige, den ich öffnete. Ich kann ihn auswendig. Er verfolgte mich bis in die Träume hinein. Wochenlang suchte ich nach Worten, um ihm zu antworten, und fand sie nicht. Ohne Euch ist es leer hier, schrieb er. In den ersten Tagen konnte ich nicht komponieren. Jetzt geht es wieder. Warum bist Du weggegangen? Ich verstehe es nicht. Hattet Ihr es nicht gut hier? War ich ein so schlechter Vater? Es tut mir leid. Ich vermisse Dich (und auch Patricia). Es geht mir eine Melodie durch den Kopf. Sie ist für Dich. Chile, das ist so weit weg. Du willst sicher nicht, daß ich Dich besuche. Sonst wärst Du nicht geflohen. Ich hoffe, Du wirst dort Erfolg haben. Ich denke an Dich. Vater. P.S. Den Hausschlüssel bewahre ich für Dich auf.
Ich habe ihn nie beantwortet, diesen Brief. Die richtigen Worte, sie kamen erst heute. Zuerst sagte ich sie leise, dann sprach ich sie laut in den hallenden Raum hinein. Dabei stand ich auf und begann, auf und ab zu gehen. So war es leichter, mich zu verteidigen. Ja, Vater, sagte ich zu ihm, es war eine Flucht. So schrecklich das auch klingt. Eine Flucht vor vielem, nicht nur vor dir. Aber auch vor dir. Oder eigentlich nicht vor dir, sondern vor deinem übermächtigen, versklavenden Traum vom Erfolg, deiner aberwitzigen, dich verzehrenden Sehnsucht nach Anerkennung für deine Musik. Ich habe es nicht mehr ertragen, einfach nicht mehr ausgehalten, in dem Haus zu leben, wo du jede freie Minute mit deinen Partituren verbrachtest, den wirklichen und den erträumten, stets den Durchbruch vor Augen, den rauschenden Applaus nach der Aufführung deiner Werke.
Lange Zeit war es große Ehrfurcht, was Patty und ich empfanden, wenn wir dich beim Notenschreiben sahen. Der gewaltige Schreibtisch aus Mahagoni, der schöne aber unbequeme
Stuhl, du mit kerzengeradem Rücken auf der äußersten Kante, ein Anlehnen und Ausruhen kam nicht in Frage, viel zu ernst war deine Mission, wie ein Mönch in seiner Zelle saßest du da, das Gesicht nach vorne geschoben, den Blick unverwandt auf die Partitur gerichtet, verloren für alles außer der Musik: Für uns Kinder war dies das Sinnbild des Wichtigen – auch wenn wir keine Ahnung hatten, was wir darunter verstanden. Manchmal haben wir die Tür einen Spaltbreit geöffnet und dich in deiner Versunkenheit betrachtet, umgeben von einer Stille, die nur durch das kratzende Geräusch der Feder auf dem Notenpapier unterbrochen wurde. Der Gegensatz zwischen dieser Stille und der Musik, die, wie wir wußten, in dir erklang – er war ein Mysterium, wunderbar und ein bißchen auch beängstigend. Das, Vater, ist das Bild, durch das du all die Jahre in mir gegenwärtig warst.
Zu diesem Bild gehört auch das rhythmische Bewegen des Kopfes, ein langsames seitliches Schaukeln, manchmal unterbrochen durch ein sanftes Kreisen. Das Notenschreiben war die einzige Gelegenheit, bei der du in diese sonderbare Bewegung verfielst, die für mich unauflöslich mit dem Anblick deines Gesichts verbunden ist. Sie gab dir etwas von einem selbstvergessenen Kind und auch etwas von einem Schlafwandler, der abstürzte, würde man ihn aufwecken. Einmal, Patty und ich mochten acht oder neun sein, sahen wir dich so, als wir vom Spielen kamen und noch in ausgelassener Stimmung waren. Wir rannten weg, um ungehört in prustendes Lachen ausbrechen zu können, so komisch berührte uns dein Schaukeln. Doch dann geschah etwas Sonderbares: Kaum hatten wir uns Luft gemacht, erstarb uns das Lachen, und wir blickten uns voller Scham an: Wie du da am Schreibtisch saßest, schaukelnd und kreisend in deiner einsamen Welt, das war nichts, über das man sich lustig machen durfte. An jenem Abend waren wir beim Essen stiller als sonst und wetteiferten darin, dir das Salz, das Brot und andere Dinge zu reichen.
Was sich mir mit unauslöschlicher Beklemmung ins Gedächtnis eingegraben hat, sind die Berge von Notenpapier, mit denen sich der riesige Papierkorb füllte, lauter angefangene Blätter, die du wegwarfst, weil dir ein Fehler unterlaufen war und du es nicht ertragen konntest, auch nur eine einzige durchgestrichene oder ausradierte Note zu sehen, die das Gesamtbild eines makellosen Partiturenblatts gestört hätte. Oft genug geschah es, daß die alte Feder spritzte, und auch dann warfst du das Blatt weg. Ich weiß nicht, was von beidem ich schlimmer fand, wenn ich, noch ein Kind, bei abgeschlossener Tür den Papierkorb untersuchte wie eine geheime Akte: ein nahezu leeres Blatt, auf dem dir schon bei der ersten Note ein Mißgeschick passiert war, oder ein praktisch fertiges Blatt, bei dem in der untersten Ecke ein kleiner Spritzer zu sehen war.
Doch nicht dein stilles, sehnsüchtiges, mönchisches Arbeiten mit all seiner Komik war es, das unerträglich wurde. Es war der Mißerfolg und das, was er aus dir gemacht hat. Denn die eingesandten Partituren kamen zurück, eine nach der anderen, Jahr für Jahr. Sie kamen mit der gewöhnlichen Paketpost. Als seien es irgendwelche beliebigen Waren, hast du einmal gesagt; warum sie nicht als Wertpakete geschickt würden, das wäre doch das mindeste. Immerhin waren es Originale, die Seiten gefüllt mit handschriftlichen Noten, die Arbeit von vielen hundert Stunden.
Einmal, da fand ich einen Ausschreibungstext für einen der vielen Wettbewerbe, an denen du teilgenommen hast. Darin gab es einen fettgedruckten Absatz, in dem darum gebeten wurde, aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall das handschriftliche Original der Partituren einzusenden, sondern eine gute Fotokopie. Trotzdem hast du stets das Original eingesandt. Es war, als ob du die Welt zur Anerkennung deiner Leistung zwingen wolltest, indem du ihr das unmittelbare Werk deiner Hände vorzeigtest. Damit es den Mächtigen möglichst schwerfiele, es abzulehnen, schwerer, als wenn eine Kopie käme, die durch ihr neutrales Schwarz etwas Anonymes an sich hatte, hinter dem der Autor verschwand. Du wolltest der Jury in jeder Note aufs lebendigste gegenwärtig sein als einer, den es verletzen mußte, wenn man sein Werk zurückwies.
Dazu paßte die heilige, andächtige Sorgfalt, mit der du die Partitur jeweils einpacktest, mit Unmengen von Seidenpapier zum Polstern. Alle Schachteln, die bei uns leer wurden, hast du mit einem prüfenden Blick betrachtet: ob sie geeignet wären, darin eine Partitur zu verschicken. Manchmal hast du sie angefaßt, manchmal nur betrachtet, aufmerksamer als man sonst ein Stück Verpackungsmaterial betrachtet. Alle kannten wir diesen Blick von dir, Patty und ich sahen beklommen weg, und in Mamans Augen war Überdruß zu lesen.«Die ist zu groß», sagte sie einmal, kaum hattest du die Schachtel in Augenschein genommen. Du standest da wie geohrfeigt: daß man dich so erraten konnte.
Meistens kamen die Pakete mit den abgelehnten Partituren, während du im Geschäft warst. Maman nahm sie in Empfang und legte sie dir auf den Schreibtisch. Schon als Knirps spürte ich, daß es mit diesen Paketen etwas Besonderes auf sich hatte; daß es ungut, ja gefährlich war, wenn sie kamen. Es war, als ginge von ihnen eine Strahlung aus, welche die Atmosphäre vergiftete. Eine bedrückende Stille lag dann über allem, du erschienst nicht zum Abendessen, und wenn wir dich holen wollten, wurden wir zurückgepfiffen.
Später, als wir mehr verstanden, entwickelten wir einen sechsten Sinn: Kaum hatten wir, von der Schule kommend, die Genfer Wohnung und später dieses Haus hier betreten, wußten wir, daß es wieder einmal soweit war; wir brauchten dazu nicht einmal Mamans Gesicht zu sehen. Ich habe keine Ahnung, woran es lag, aber wir wußten es. Wenn wir dann einen Blick in dein Arbeitszimmer warfen, lag es regelmäßig da, das gefürchtete Paket. Und auch du schienst es schon im voraus zu ahnen: Dein Gang ins Arbeitszimmer war an solchen Tagen steifer und hektischer, dein Gesicht verschlossen, als müßtest du all deine Kraft versammeln, um der neuerlichen Enttäuschung zu trotzen, die dich hinter der Tür erwartete, vor der du einen Moment länger stehen bliebst als sonst, es war ein leises, winziges Stocken, das nur derjenige wahrzunehmen vermochte, der die Vorahnung mit dir teilte.
Manchmal kamen die Pakete während der Schulferien, wenn auch du dir freigenommen hattest. Du trugst sie stets unter dem linken Arm, nie anders, nie mit beiden Händen. Es hatte etwas so Bitteres und Gedemütigtes, dieses Tragen. Und wie du zu dem Postboten «Merci» sagtest: mit der unterwürfigen und doch auch trotzigen Biederkeit, die nur ein Deutschschweizer in dieses Wort hineinlegen kann. Damit muß ich allein fertig werden, sagte dein Ton, Sie persönlich können natürlich nichts dafür, andererseits gehören auch Sie zu der Welt draußen, in der man meine Musik nicht hören will … Es war entsetzlich, Vater. Und jedes weitere Mal noch ein bißchen entsetzlicher.
Mit verzweifelter, hohler Geschäftigkeit holtest du die große Schere aus dem Schreibtisch. Aus unerfindlichen Gründen spanntest du die Schnur zusätzlich an, so daß es einen dumpfen Knall gab, wenn sie zerschnitten wurde. Dann durchtrenntest du das Klebeband, faltetest das Papier und den Karton auseinander – alles so routiniert, als lägen schon Tausende von Absagen hinter dir. Aus der anhaltenden Geschäftigkeit und Energie hätte man beinahe schließen können, daß du, entgegen aller Erfahrung, trotz der Rücksendung mit einer positiven Antwort rechnetest. Die Verpackung stopftest du in den Papierkorb zu den zerknüllten Notenblättern. Mit scheuem, verhaltenem Stolz bliebst du vor der gebundenen Partitur stehen und legtest die Hand darauf ohne zu blättern. Erst jetzt setztest du dich hin und machtest den Begleitbrief auf.
Ich werde nie vergessen, wie versteinert dein Gesicht war, während der Blick über die Zeilen eines förmlichen Absagetexts glitt. Es mußte die Festigkeit von Fels haben, dieses Gesicht, um der Enttäuschung standhalten zu können, die so vertraut war und dir trotzdem so weh tat wie beim erstenmal. Langsam faltetest du den Brief wieder zusammen, tatest ihn zurück in den Umschlag und – ich zuckte zusammen – warfst das Ganze mit erbitterter Beiläufigkeit in den Papierkorb. Dann zündetest du dir eine Zigarette an, griffst zur Feder und schriebst an der Partitur weiter, die gerade in Arbeit war. All dies habe ich im Laufe der Jahre nur zwei- oder dreimal beobachtet. Aber ich weiß, daß alles immer auf die genau gleiche Weise geschehen ist. So warst du.
Es war unmöglich, dich zu trösten, Vater. Ich meine es in den Gliedern zu spüren, wie ich zu dir gehen und dich berühren wollte. Ich probierte es innerlich aus: wo und wie ich neben dir stehen würde; ob ich dir den Arm um die Schulter legen oder dir übers Haar fahren könnte; was für Worte sich sagen ließen. Am liebsten hätte ich gesagt: Nimm das Urteil der anderen nicht so wichtig; du schreibst deine Musik doch vor allem für dich selbst. Als Feststellung stimmte das natürlich nicht; ich hätte es als Empfehlung sagen wollen. Aber ich spürte: Das war etwas, was man dir nicht sagen konnte. Dir den Vorschlag zu machen, die Dinge so zu sehen – das hätte dir wie Hohn geklungen. Denn es war falsch, und wir beide wußten, daß es falsch war. Es wäre die billigste aller Tröstungen gewesen, die Tröstung durch Lüge. Eine Lüge, wie einer sie ausspricht, wenn er sich den Schmerz des anderen vom Hals schaffen will, statt ihn zu teilen. Du schriebst die Musik für die anderen: Sie sollten dich dafür lieben. Jede einzelne deiner Noten, die du kalligraphisch auf die Linien setztest, war getragen von dieser Sehnsucht nach Anerkennung.
Das Schlimmste war: Man konnte sie nicht verfluchen, deine Sehnsucht, wie man sonst Wunsch und Willen eines anderen verfluchen mag, weil sie ihn zerstören. Denn deine Sehnsucht war so gut, so mühelos zu verstehen. Du warst alles andere als erfolgsüchtig, obwohl dein Bedürfnis nach Erfolg wie eine Sucht war. Denn das eine warst du nicht: eitel und selbstverliebt. Sie sollten dich nicht großartig finden, damit auch du dir großartig vorkämest. Was du suchtest, war das Gefühl, angenommen zu sein, aufgehoben im Wohlwollen der anderen.
Das einzig Aufrichtige wäre gewesen, mit dir durch die Enttäuschung hindurchzugehen, sie mir zu eigen zu machen, auch wenn sie nicht meine war. Kann man das? Ich weiß es nicht, Vater, und ich denke, auch das hättest du nicht gewollt.
Du wolltest die Einsamkeit in deiner Enttäuschung. Auf sonderbare Weise wolltest du sie als Gegenstück zu der ersehnten, überbordenden Anerkennung, von der du träumtest. Es war, als wäre dir der Applaus fade und wertlos vorgekommen, wenn ihm in deinem Inneren nicht die kompromißlose Einsamkeit einer Ablehnung entsprochen hätte. Deshalb wohl kam es mir unmöglich vor, dich zu berühren oder auch nur neben dich zu treten, um dir meine Verbundenheit zu zeigen. Es wäre mir anmaßend erschienen.
Nein, es war nicht möglich, dich zu trösten. Auch deshalb bin ich geflohen.
So sprach ich zu Vater. Dann setzte ich mich an den Schreibtisch und stellte mir vor, ich sei es, der seinem Sohn jenen Brief nach Chile schriebe. Ich hatte das Gefühl zu ersticken, sobald ich mir die kurzen, hölzernen Sätze nicht nur zitierend vorsagte, sondern sie dachte, hier dachte, genau hier, wo Vater sie gedacht hatte. Plötzlich wußte ich, weshalb ich hiergeblieben war.
Durch ein Berlin, das mich nichts anging, fuhr ich zur Hochschule der Künste und machte am Schwarzen Brett einen Aushang: Ich würde jemanden suchen, der mir unbekannte Opernpartituren als Klavierauszug vorspielen könne.
Kaum war ich zurück, meldete sich am Telefon eine junge Französin, deren Vater in der Botschaft arbeitet. Juliette Arnaud heißt sie. Ihre erste Frage war, ob ich der Sohn von Monsieur Frédéric sei. Ich war verblüfft, doch inzwischen weiß ich: Vater war vielen Studenten der Hochschule ein Begriff. Er beriet sie im Steinway-Haus beim Kauf eines Klaviers, und er ging mit ihnen, wenn sie sich auf eine Annonce hin ein gebrauchtes ansehen wollten. Er genoß den Ruf eines unbestechlichen Experten, dem man bei Klavieren nichts vormachen konnte. Auch gestimmt hat er sie, wenn sie nachher in den Studentenbuden standen; mehrmals, wegen Temperatur und Feuchtigkeit, und unentgeltlich.
Still saß er anschließend in der Studentenküche beim Wein. Nur wenn sie ihn aufforderten, vom Klavierbau zu erzählen, konnte er reden. Und wenn er sich dann durch die Aufmerksamkeit der anderen angenommen fühlte, stellte er ab und zu auch eine Frage nach ihrem Leben, die durch eine sonderbare Einfachheit beeindruckte, die Art von Einfachheit, welche die ersten Fragen eines Laien an sich haben, wenn er sich einem fremden Gegenstand zuwendet. Wie das sei, in einer richtigen Familie aufzuwachsen, mit Vater, Mutter und Geschwistern, wollte er wissen. Was ihn vor allem interessierte: wie es bei den gemeinsamen Mahlzeiten sei, was man da rede, ob man immer rede oder manchmal auch schweige, und ob das dann unangenehm sei, peinlich. Und: was junge Menschen, wie sie es seien, dazu bewegen könne wegzugehen, wenn sie vorher in einer Familie aufgehoben waren.
Anfänglich grinsten die Studenten, die an Familienspaziergänge und ähnliches zurückdachten. Doch etwas an Vaters Art zu fragen ließ das Grinsen bald verschwinden. Die Einsamkeit, die aus seinen Fragen sprach, füllte die Küche, und plötzlich fingen diese Experten in Familienzynismus an, nach ernsthaften Antworten auf Vaters Fragen zu suchen. Wenn er dann aufbrach, fanden sie es schade und luden ihn ein wiederzukommen. Er kam nie wieder. Man stand, wenn Vater gegangen war, linkisch herum wie sonst nie, niemand sagte viel, es fanden sich plötzlich ungewohnt viele Freiwillige für den Abwasch, und nachher ging man leise in die Zimmer.
Wir haben dir die früher vermißte Familie nicht ersetzen können, Vater. Das habe ich gewußt. Niemand hätte das gekonnt. Daß wir es aber so wenig verstanden haben, dir die Einsamkeit zu nehmen, daß du Wildfremden solche Fragen stellen mußtest! Es scheint, wir haben das Ausmaß deiner Einsamkeit nicht einmal geahnt.
Noch auf eine andere Weise kannte man Vater: als den Mann, der im Foyer der Hochschule stand und die Ankündigungen studierte. Gelegentlich saß er in einer Vorlesung oder kam zu einem Konzert der Studenten. Daß er komponierte, hat er niemandem erzählt. Stets wirkte er wie einer, der nicht dazugehört, aber gern dazugehören würde.
Juliette Arnaud gehört auch zu denen, die Vater beim Kauf eines Klaviers beraten hat. Die Familie Arnaud muß, als er zum Stimmen kam, sonderbar berührt gewesen sein von Vaters Art. Viel sagte Juliette darüber nicht, aber ich kann es mir zusammenreimen: Scheu, langsam und ein bißchen komisch muß er ihnen vorgekommen sein. Er erinnere sie an Buster Keaton, habe Madame Arnaud bemerkt. Auch Juliette hatte keine Ahnung, daß Vater komponierte. Sie ist von dem Gedanken fasziniert, das geheime Leben dieses scheuen Mannes kennenzulernen. Leider kann sie erst am Freitag kommen. Ich kann es kaum erwarten.
Es ist noch keine zwei Wochen her, daß du mich in Santiago anriefst. Wir haben uns beeilt mit allem. Verpflichtungen, sagten wir, Verpflichtungen in Paris, Verpflichtungen in Santiago. Nach der Art dieser Verpflichtungen haben wir uns nicht gefragt. War es, daß wir uns nicht trauten? Oder war es, daß wir nicht fragten, um nachher nicht selbst gefragt zu werden?
Sie tat weh, diese Zurückhaltung, denn sie gab unserem Gespräch, wenn es um Termine ging, etwas Förmliches. Und sie läßt eine Frage entstehen, die ich nicht vorhersah, als wir unser Bündnis des Erzählens schlossen: Wird mein neues Leben in Santiago in meinem Bericht vorkommen? Darf es? Soll es? Oder war dein Vorschlag anders gemeint: daß wir nur aufschreiben, wie es uns in den ersten neunzehn Jahren unseres Lebens miteinander ergangen ist – bis zu jener Nacht, die alles zerstörte?
Wie wir diese Frage beantworten, wird für den anderen, den Lesenden, einen großen Unterschied machen. Was wird sein, wenn wir sie verschieden beantworten und also unterschiedlich viel preisgeben? Und uns das bei unserem Treffen sagen? Wie wird es dann im Bistro sein?
Nach deinem unwirklichen Anruf damals versuchte ich den ganzen Vormittag vergeblich, für denselben Tag eine Flugverbindung nach Frankfurt zu bekommen. Ich war bereit, die unmöglichsten Umwege zu fliegen, aber es war nichts zu machen. Schließlich buchten sie mich auf den Mittagsflug des nächsten Tages über Buenos Aires. Es wurden vierundzwanzig lange Stunden. Oft war ich versucht, die Berliner Nummer zu wählen, die ich immer noch auswendig wußte. Es drängte mich, mehr zu erfahren. Was du berichtet hattest, ergab einfach keinen Sinn; es kam mir vor wie das Allerunwahrscheinlichste, das im Universum passieren konnte. Es schien mir schlechterdings keine mögliche Geschichte zu geben, die das Geschehene verständlich machen konnte. Doch ich legte den Hörer immer wieder auf die Gabel zurück, bevor es bei euch klingelte. Ich fürchtete mich davor, Mamans Stimme zu hören, und auch vor dem Klang, den deine Stimme vorhin gehabt hatte, schreckte ich zurück.
Ich ging zur Bank und räumte mein Konto leer. Damals, vor sechs Jahren, hatte ich in der Bank am Mexikoplatz gestanden und mein Sparbuch aufgelöst. Es war nur wenige Stunden her, daß du Adieu gesagt hattest, und ich war noch gefühllos vor Entsetzen. Unschlüssig stand ich später am Flughafen und betrachtete die Kreditkarte, die ich kurz zuvor zum Abitur bekommen hatte. Es wäre die Gelegenheit gewesen, sie einzuweihen. Ich habe sie unbenutzt vernichtet, Maman. Du hättest die Abrechnung erhalten, und ich wollte nicht, daß du noch irgend etwas über mein weiteres Leben erführest. Nicht einmal das Land solltest du kennen, in das ich geflohen war.
Im Reisebüro hatte ich offengelassen, ob ich die Karte für den Rückflug auch gleich kaufen würde. Auf ein Datum wollte ich mich nicht festlegen, so daß es vom Geld her auf dasselbe hinauslief, ob ich sie hier oder in Berlin kaufte. Doch ums Geld ging es ohnehin nicht, das wußte ich nur zu gut. Worum es ging, war etwas ganz anderes, das mich bis zu der Stunde in Atem hielt, als das Reisebüro schloß: Würde ich überhaupt hierher zurückkommen?
Plötzlich nämlich brach die Erinnerung an die ersten Tage und Wochen in dieser Stadt über mich herein, und sie hatte eine solche Wucht, daß alles, was danach gekommen war, nicht mehr zählte. Das Spätere erschien an jenem Nachmittag wie eine Fron, die ich in der Fremde auf mich genommen hatte, weil ich nicht hatte zurückkehren dürfen. Zu dir. Doch jetzt war das Exil vorbei, in weniger als zwei Tagen war ich bei dir, und dann gab es nicht mehr den geringsten Grund, wieder herzukommen. Noch jetzt, hier an Vaters Schreibtisch, kann ich die Gewalt jener Gefühle nachempfinden, ich brauche nur die Augen zu schließen, und schon spüre ich den Sog.
Am ehesten wirst du es vielleicht verstehen, wenn ich dir sage: Den Reisewecker, den ich damals mitnahm, habe ich in den sechs Jahren nie umgestellt, er steht noch jetzt auf dem Nachttisch in Santiago und zeigt die Zeit von Berlin und Paris. In den ersten Wochen habe ich im Inneren ausschließlich nach einer Zeit gelebt, von der ich annahm, es sei deine. Ich stand auf und ging zu Bett nach chilenischer Zeit, gewiß. Doch kaum war ich wach, ging mein Blick zu der Uhr, die für dich tickte. Das war, als ich noch keine Arbeit hatte und mich noch nichts mit dem Alltag des neuen Landes verband. Ich weiß nicht mehr, was ich den Tag über machte. Doch oft schlüpfte ich, ohne daß es Absicht gewesen wäre, in deine Zeit, es wurde Abend auf deiner Uhr, und wenn ich dann hinaustrat, merkte ich mit ungläubigem Staunen, daß erst früher Nachmittag war. Später, als ich zu arbeiten begann, fing mich die chilenische Zeit schließlich ein. Aber der Blick auf deine Uhr, wenn ich aufwachte oder heimkam, blieb, nur sank alles tiefer nach innen, ohne deswegen an Macht zu verlieren. Einmal, während ich weg war, blieb die Uhr stehen, die Batterie war leer. Es war, als sei nun die letzte Verbindung zu dir gerissen. In Panik rannte ich zum Geschäft und kaufte einen riesigen Vorrat an Batterien. Nie wieder durfte so etwas geschehen.
ENDE DER LESEPROBE
Verlagsgruppe Random House
Einmalige Sonderausgabe September 2006 btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © 1998 by Albrecht Knaus Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München Umschlagfoto: Guido Pretzl Druck und Einband: Clausen & Bosse, Leck EM · Herstellung: LW
eISBN : 978-3-641-02551-9V002
www.btb-verlag.de
www.randomhouse.de