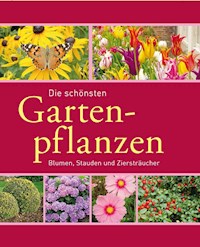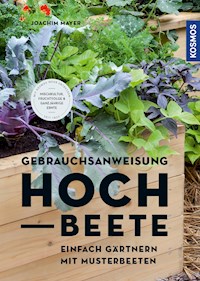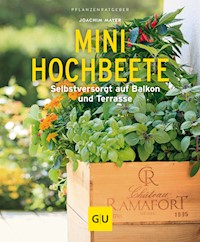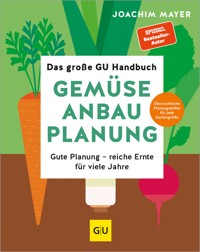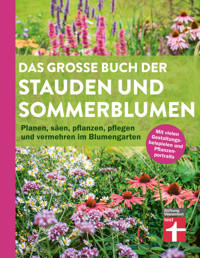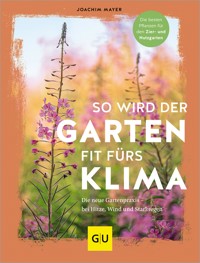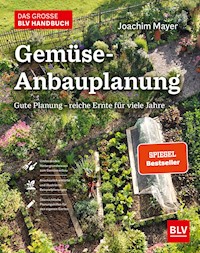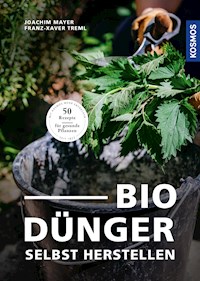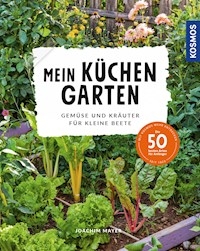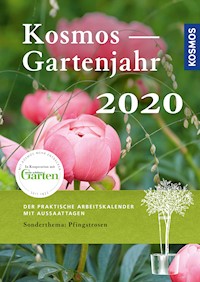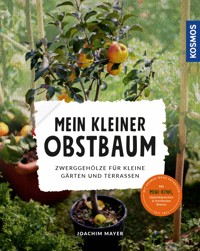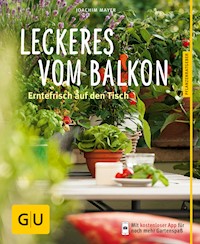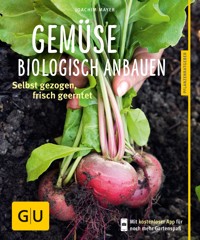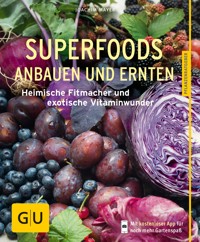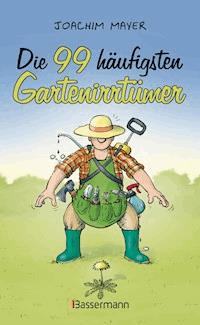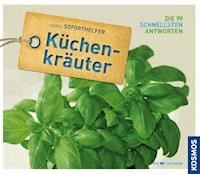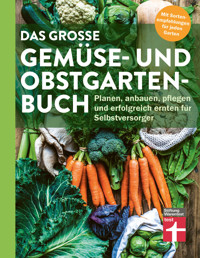
Das große Gemüse- und Obstgartenbuch - mit Tipps zu Pflanzen und Gartenarbeit für Anfänger und Profis E-Book
Joachim Mayer
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Stiftung Warentest
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ihr umfassender Ratgeber für den perfekten Obst- und Gemüsegarten! Möchten Sie Ihren Garten in eine Quelle frischer Lebensmittel verwandeln? Dieses Gartenbuch bietet Ihnen alles, was Sie für eine erfolgreiche Selbstversorgung wissen müssen. Von der Planung über die Pflege bis hin zur Ernte – das Handbuch begleitet Sie durch alle Phasen und liefert wertvolle Gartentipps für Einsteiger und erfahrene Hobbygärtner. Erfahren Sie, wie Sie Beete effizient anlegen, die richtigen Pflanzen auswählen und mit smarten Techniken die besten Ergebnisse erzielen. Ob Gemüse, Kräuter oder Obst – dieser Leitfaden hilft Ihnen, das Beste aus Ihrem Garten herauszuholen. Mit praktischen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, umfangreichen Pflanzenporträts und Expertenwissen wird Ihr Gartenprojekt garantiert zum Erfolg. Das bietet Ihnen dieses Buch: • Planung und Einrichtung: Pflanzpläne, Beetgestaltung, Bewässerung und Pflegemaßnahmen • Gemüse- und Kräuterpraxis: Alles zu Aussaat, Pflanzung und Düngung • Obstgarten anlegen: Pflanzenwahl, Bepflanzung, Schnitttechniken und Bodenpflege • Pflanzenschutz im Nutzgarten: Krankheiten erkennen und bekämpfen • Umfangreiche Pflanzenporträts: Eigenschaften und Pflege von Gemüse, Kräutern und Obstsorten Dank der langjährigen Erfahrung von Joachim Mayer, einem der renommiertesten Gartenexperten, erhalten Sie fundierte, praxistaugliche und leicht umsetzbare Tipps für jede Art von Garten. Highlights: - Detaillierte Anleitungen für die Selbstversorgung - Umfassende Porträts von Gemüse-, Kräuter- und Obstsorten - Praktische Tipps zur Schädlingsbekämpfung und Bodenpflege - Wertvolle Ratschläge für eine nachhaltige Gartenbewirtschaftung - Perfekt für Einsteiger und ambitionierte Hobbygärtner Ob knackige Möhren, saftige Beeren oder aromatisches Basilikum – mit diesem Ratgeber gestalten Sie Ihren Traumgarten und können schon bald die Früchte Ihrer Arbeit genießen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
DAS GROSSEGEMÜSE- UND OBSTGARTENBUCH
Planen, anbauen, pflegen und erfolgreich ernten für Selbstversorger
Joachim Mayer
INHALT
PLANUNG, EINRICHTUNG, ZUBEHÖR
WAS IST MÖGLICH, WAS IST NÖTIG?
Vielfältiges Erntevergnügen, Geeignete Gartenplätze, Sonnengenuss oder Hitzestress?, Trockenheit, Nässe, Kälte und Winde, Gesund bleiben, Platzbedarf und Pflegeaufwand
GESTALTEN: ATTRAKTIV UND PRAXISGERECHT
Nutzpflanzen im Ziergarten, Der separate Nutzgarten, Nutzgarten in Kübeln und Kästen, Pflanzgefäße und Erden
EINRICHTEN: ZWECKMÄSSIG UND PFLEGELEICHT
Beete und Wege planen, Essenziell: Gute Wasserversorgung, Regenwasser: von oben frei Haus, Spezielle Gießhilfen, Frühbeete: praktische Anbauhilfen, Gewächshaus: gut beschützt
GARTENGERÄTE, HILFSMITTEL UND ZUBEHÖR
Geräte für die Bodenbearbeitung, Wichtige Helfer im Gartenalltag, Scheren und andere Schnittwerkzeuge, Ernte- und Transporthilfen
VORBEREITEN UND ANLEGEN
DER BODEN
Unter der Oberfläche, Bodenarten – eine Frage der Körnchen, Humus: Das Salz in der Suppe, Bodenuntersuchung: Wichtige Bestandsaufnahme
DEN BODEN VERBESSERN UND BEARBEITEN
Neue Beete und Pflanzflächen, Gründliches Lockern, Böden nachhaltig verbessern
KOMPOST, MULCH UND GRÜNDÜNGUNG
Der eigene Kompost, Mulchen – stets gut bedeckt, Gründüngung – belebende Bodenkur
BEETE UND PFLANZFLÄCHEN ANLEGEN
Markieren und abstecken, Wege und Einfassungen, Hohes Niveau: Hügelbeet und Hochbeet, Eine Runde Sache: die Kräuterspirale
ANBAUPLANUNG IM GEMÜSE- UND KRÄUTERGARTEN
Zur rechten Zeit am rechten Ort, Fruchtwechsel, Fruchtfolge und Kulturfolge, Mischkultur: Auf gute Nachbarschaft, Sorten gezielt wählen, Samen- und Pflanzenkauf
ANBAUPLANUNG IM OBSTGARTEN
Obstart, Sorte, Platzwahl, Unterlagen und Baumformen, Wuchsformen der Beerensträucher, Verkaufsformen und Einkaufstipps
GEMÜSE- UND KRÄUTERPRAXIS
SÄEN UND PFLANZEN
Direkt ins Beet säen, Pflanzen selbst vorziehen, Richtig auspflanzen, Schützende Vliese, Folien und Netze
PFLEGEN UND HEGEN
Gießen und bewässern, Boden lockern, Wildkräuter eindämmen, Nährstoffe: Was Pflanzen brauchen, Düngerformen und Düngemittel, Wann, wie viel, was? Die Düngepraxis, Sonstige Pflegemaßnahmen
OBSTGARTENPRAXIS
SORGFÄLTIG PFLANZEN
Pflanzzeiten im Obstgarten, Obstbäume pflanzen, Beerenobst pflanzen, Pflanzschnitt beim Beerenobst
PFLEGEN UND HEGEN
Bodenpflege im Obstgarten, Düngung im Obstgarten, Gedeihliche Wasserversorgung, Früchte fördern, Ernte sichern, Sonstige Pflegemaßnahmen
OBSTGEHÖLZE SCHNEIDEN
Worum geht es?, Von Trieben und Knospen, Triebförderung und Schnittwirkung, Schnitttermine im Obstgarten, Schnitt- und Formierungstechniken, Baumschnitt nach Entwicklungsstadium, Obstbäume mit „klassischer“ Rundkrone, Das Fruchtholz im Blickpunkt, Spindelbusch und Säulenbaum, Hinweise zur Spaliererziehung
PFLANZENSCHUTZ IM NUTZGARTEN
SCHÄDEN ABWEHREN UND BEGRENZEN
Widerstandskräfte fördern, Risiken vermeiden, Selbst hergestellte Pflanzenauszüge, Standortwahl, Pflanzung und Pflege
NÜTZLINGE: WICHTIGE GEGENSPIELER
Nützlinge fördern und einsetzen, Abwehren, eindämmen, entfernen, Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Ursachenerkundung und knifflige Fälle, Kritischer Klimawandel, Knifflige Meldepflichten
HÄUFIGE KRANKHEITEN UND SCHÄDLINGE
Krankheitserreger und ihre Eigenheiten, Verbreitete Krankheiten und Symptome, Spezielle Krankheiten an Gemüse, Spezielle Krankheiten an Obst, Verbreitete saugende Schädlinge, Verbreitete Fraßschädlinge, Spezielle Schädlinge an Gemüse, Spezielle Schädlinge an Obst
GEMÜSE- UND KRÄUTERPORTRÄTS
SALATE UND BLATTGEMÜSE
Gesund und schmackhaft rund ums Jahr
STIEL- UND STÄNGELGEMÜSE
Geschichtsträchtige Gemüse
KOHLGEMÜSE
Für engagierte Gärtner
WURZEL- UND KNOLLENGEMÜSE
Üppige Knollen, kräftige Rüben
ZWIEBELGEMÜSE
„Pflanzliches Antibiotikum“
FRUCHTGEMÜSE
Von Liebesäpfeln und feurigen Früchtchen
HÜLSENFRÜCHTE
Eiweißlieferanten vom Feinsten
BEWÄHRTE KÜCHENKRÄUTER
Genussreich und unkompliziert
MEDITERRANE KRÄUTER
Genießen mit allen Sinnen
OBSTPORTRÄTS
KERNOBST
Von Kernen, Blüten und Bienen
STEINOBST
Erntereigen und Wermutstropfen
BEERENOBST
Beerenstarke Früchtchen
NUSSOBST
Kraftpakete mit harter Schale
REGISTER
PLANUNG, EINRICHTUNG, ZUBEHÖR
WAS IST MÖGLICH, WAS IST NÖTIG?Ein Garten ohne Gemüse, Obst und Kräuter? Das wäre in den traditionellen Bauerngärten genauso undenkbar gewesen wie in den städtischen Bürger- und Arbeitergärten früherer Zeiten.
VIELFÄLTIGES ERNTEVERGNÜGEN
Die eigenen Gärten waren die Hauptquelle für schmackhafte, gesunde Abwechslung in der Küche. Doch ab den 1960er-Jahren änderte sich das grundlegend. Das Angebot an käuflichen Lebensmitteln wurde größer und preiswerter, zugleich wurden die Gartengrundstücke zunehmend kleiner. So genoss man seinen Feierabend lieber entspannt mit Rasen und Rosen, statt sich noch mit Kohl und Kopfsalat abzumühen.
In den letzten Jahrzehnten allerdings entdeckten immer mehr Gartenbesitzer wieder, welch besondere Genüsse da winken. Biogartenfans und Gourmets, umweltbewusste Gärtnerinnen und Gärtner, verantwortungsbewusste Eltern und experimentierlustige Pflanzenfreunde: Sie alle haben dazu beigetragen, dass der Eigenanbau von Gemüse, Obst und Kräutern zu neuen Ehren kam. Dabei sind die Interessen unterschiedlicher und vielfältiger geworden, ebenso wie die Gartenformen und -zuschnitte.
Auch wer kein Eigenheim mit Garten besitzt, kann heute sein eigenes Obst und Gemüse anbauen, sei es in einem Schrebergarten oder einem städtischen Gemeinschaftsgarten, wo man sich schnell und gerne auch einmal gegenseitig mit Rat und Tat unterstützt.
Ein engagiert betriebener Nutzgarten kann durchaus die Haushaltskasse entlasten, zumal Lebensmittel durch die Inflation der letzten Jahre deutlich teurer geworden sind. Aber mindestens ebenso wichtig sind heute Erntespaß und gesunde Gaumenfreuden. Frisch, saftig, knackig, mit vollem Geschmack und Aroma, ohne Lagerungsverluste, künstlichen Kühlhaus-Pep oder gar chemische Rückstände: Mit so hochwertigen Eigenprodukten kann gekauftes Gemüse und Obst kaum mithalten.
Zudem bietet der Selbstanbau interessante Möglichkeiten, seltenere und besonders schmackhafte Arten und Sorten auszuprobieren. Einerseits werden fast vergessene Schätze wie Amaranth und Wildheidelbeeren, tolle alte Tomaten- und Kartoffelsorten wiederentdeckt. Andererseits ermöglicht die Klimaerwärmung nun vielerorts den Anbau von Süßkartoffeln, Wintersalaten, Melonen, Feigen oder sogar Oliven. Nicht zuletzt deshalb finden manche Hobbygärtner heute Gemüse, Kräuter und Obst einfach spannender als Blumen und Ziersträucher.
Sogar auf vielen Balkonen sieht man jetzt häufiger Tomaten, Paprika und Erdbeeren anstelle von Geranien, Petunien &. Co. Doch leider schlägt die anfängliche Begeisterung öfters in Enttäuschung um. Man muss sich schon ein wenig darauf einstellen, dass Nutzpflanzen, besonders Gemüse und kurzlebige Kräuter, nicht gerade zu den pflegeleichten Gewächsen gehören. Sie fordern meist etwas mehr Aufwand und Sorgfalt als Zierpflanzen und oft auch ein bisschen Geduld.
Zudem führt der Klimawandel teils auch schon spürbar zu unangenehmen Überraschungen: Anhaltende Trockenheit und Hitze können dem Gemüse und Obst ebenso zusetzen wie heftiger Starkregen oder gar Hagelschauer. Doch letztlich entschädigt jede gelungene Ernte für den gelegentlichen Verdruss. Und gerade der Nutzpflanzenanbau ist Erfahrungssache – das Lernen aus eventuellen Fehlschlägen inbegriffen, ebenso das gelassene Akzeptieren der Unwägbarkeiten von Wetter und Natur.
GEEIGNETE GARTENPLÄTZE
Für die meisten Gemüse und Obstgehölze sowie viele Kräuter sind folgende Standortverhältnisse ideal:
•vormittags und am späten Nachmittag besonnt, aber am besten nicht der prallen Mittagssonne ausgesetzt;
•warm und etwas geschützt vor starken Frösten und Winden; mit tiefgründigem, humosem, nährstoffreichem, gut bearbeitbarem Boden;
•möglichst nicht direkt an einer stark befahrenen Straße gelegen, um einer Abgasbelastung vorzubeugen.
Die Mehrzahl der Gärtnerinnen und Gärtner kann den Vorteil genießen, dass ihre grünen Freiflächen direkt beim Haus beziehungsweise bei der Wohnung liegen. In diesem Fall ist es optimal, wenn der Nutzgarten über bequeme und am besten kurze Wege gut erreichbar ist. Denn gerade im Gemüsegarten gibt es in der Wachstumszeit fast täglich etwas zu werkeln – und dann auch zu ernten.
Eine große Rolle spielt zudem die Garteneinrichtung (Seiten 25 ff.) Als sehr praktisch erweisen sich ein Geräteschuppen und ein ausreichend großer Kompostplatz in der Nähe des Nutzgartens. Noch wichtiger ist eine gute Ausstattung mit Wasserzapfstellen sowie mit Regentonnen oder unterirdischen Zisternen, sofern die Möglichkeit besteht, Regenwasser über Dachrinnen zu sammeln. Liegt der Garten stattdessen weitab vom Haus, zum Beispiel in einer Klein- oder Gemeinschaftsgartenanlage, sind eine gute Ausstattung mit Gartengeräten, Gießhilfen und Regensammelbehältern vor Ort besonders hilfreich.
Natürlich lässt sich das alles nicht überall so optimal einrichten, wie man es gern hätte. Die Grundstücksgröße und -lage sowie die Bebauung in der Umgebung geben den Rahmen vor. Die genannten „Idealbedingungen“ sollen vor allem als Orientierungshilfen dienen. Oft muss man davon einige Abstriche machen. Trotzdem kann man in den allermeisten Fällen immer noch mit Spaß und Erfolg Gemüse und Obst anbauen.
Wer künftig üppige Ernten möchte, muss sich auf häufigere Wetterextreme wie Hitze und Trockenheit einstellen.
Und der Klimawandel macht zwar manches kniffliger, erleichtert teils aber auch die Standortwahl. Denn für den Nutzgarten ist die volle Sonne, wie früher oft empfohlen, nicht mehr unbedingt ratsam: Selbst viele sonnenliebende Gewächse bevorzugen mittlerweile zeitweilige Beschattung, weil ihnen extreme Sommerhitze, Trockenheit und zunehmende Strahlungsintensität zu schaffen machen.
SONNENGENUSS ODER HITZESTRESS?
Nach wie vor gilt: Sonnenlicht und Wärme sind entscheidende Wachstumsfaktoren, fördern die Erntefreuden und das Aroma, besonders bei Obst und Fruchtgemüse. Doch durch die menschengemachte Verstärkung des Treibhauseffekts haben die Jahresmitteltemperaturen in den letzten 140 Jahren seit Beginn des industriellen Zeitalters deutlich zugenommen: nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes um rund 1,6 °C. Seit dem Jahr 2000 haben sich Hitzewellen mit Temperaturen über 30 °C gehäuft, schon öfter sogar rund 40 °C erreicht. Viele haben zum Glück längst gelernt, allzu pralle Sonne zu meiden und in heißen Sommerwochen auf anstrengende Tätigkeiten im Freien zu verzichten.
Der Trend zu Wetterextremen strapaziert aber nicht nur Gärtnerinnen und Gärtner, sondern auch zahlreiche Gartenpflanzen. Beeren und Äpfel leiden öfter unter Hitzeschäden und Sonnenbrand. Bei den Gemüsen kränkeln nicht nur Salate und Bohnen, sondern auch ausgesprochene Sonnenkinder wie Tomaten, zum Beispiel mit braunschwarzen Flecken an den Früchten. Steigen die Temperaturen längere Zeit über 30 °C, zeigen sich häufiger Schadbilder und Wachstumsprobleme.
Für die meisten Gemüse erscheint es mittlerweile vorteilhaft, wenn sie von der intensiven Sonnenstrahlung zwischen 11 Uhr und 15 Uhr verschont bleiben. Ihnen reichen in der Regel die Vormittagssonne und die späte Nachmittagssonne; im Zweifelsfall auch Halbschatten, also nur halbtags eine direkte Besonnung. Und manche Kohlarten sowie Blattgemüse, Salate, Radieschen, Erbsen und Beerenobst bringen sogar an der Nordseite eines Hauses gute Ernten, wenn sie nicht zusätzlich beschattet werden.
Zu den wichtigsten Ausnahmen gehören mediterrane Kräuter wie Oregano, Thymian und Bohnenkraut: Die stehen nach wie vor gern in der vollen Sonne, auch wenn diese etwas greller wird. Und wer gern Neues ausprobiert, kann es zum Beispiel mit Linsen und Kichererbsen versuchen, die als hitze- und trockenheitsverträglich gelten.
Zur genannten Beschattung um die Mittagszeit kann eine Vorpflanzung von Sträuchern, Hecken oder kleinen Bäumen in Süd- und Südwestrichtung verhelfen. Wenn Sie dafür robustes Wildobst wie Felsenbirne und Kornelkirsche wählen, bereichert das nebenbei auch das Fruchtangebot. Weniger Platz erfordert eine Beschattung durch Lamellen- oder Weidenflechtzäune, die etwas Licht und Luft durchlassen.
UNSERE TIPPS FÜR EINSTEIGER
Damit die Freude nicht in Frust umschlägt, ist es ratsam, sich am Anfang nicht zu viel vorzunehmen. Einige wenige, nicht übermäßig anspruchsvolle Gemüse-, Kräuter- und Obstarten, in überschaubarem Umfang: Das ist der beste Start.
•Wichtig ist vor allem die Regelmäßigkeit in der Pflege. Wenn Sie einigermaßen kontinuierlich dranbleiben können, verbessert das deutlich die Erfolgsaussichten. Aufzeichnungen, Pflanz- und To-do-Listen erleichtern die Planung und fördern ein gutes „Timing“.
•Nutzpflanzen sind häufig ausgesprochene Terminsache, vom richtigen Saat- oder Pflanzzeitpunkt bis hin zur passenden Erntespanne. Versuchen Sie, die Anbaumengen möglichst realistisch abzuschätzen, um übermäßigen Salat-, Radieschen- oder Zucchinischwemmen vorzubeugen. Dabei helfen skizzierte Beetpläne, ebenso beim Planen von Fruchtwechsel und Mischkulturen.
•Das Beachten des Witterungsverlaufs war schon immer wichtig für erfolgreiches Gärtnern. Mit der Zunahme von Wetterextremen und plötzlichen Umschwüngen ist noch mehr Aufmerksamkeit gefragt. Achten Sie auf Vorhersagen zum regionalen Gartenwetter und prüfen Sie verschiedene Online-Wetterdienste oder auch Wetter-Apps auf ihre Tauglichkeit.
Auch Obstarten machen die intensive Sonne und Hitze zu schaffen, so etwa den Äpfeln, Süßkirschen, Pflaumen und Zwetschgen. Für sie ist eine Sonnenpause während der heißesten Mittagsstunden ebenfalls günstig. Brombeeren, Himbeeren, Stachelbeeren und Johannisbeeren sind im Halbschatten besser aufgehoben als in der Vollsonne: In praller Hitze können ihre Früchte regelrecht „verkochen“. Das gilt auch für blaue und rote Weintrauben, obwohl die Reben an und für sich Wärme lieben.
Obstbäume können nicht nur durch Fruchtschäden sowie Brennflecken auf den Blättern beeinträchtigt werden, sondern auch durch Rindenrisse. Zu den Obstarten, die mit ganztägiger Sonne und recht trockenen Standorten besser zurechtkommen, gehören Birne, Sauerkirsche, Aprikose und Pfirsich; außerdem Spezialitäten wie Apfelbeere (Aronia), Gojibeere, Feigenbaum und Kakipflaume (Diospyros kaki), die mit ausreichendem Winterschutz auch in kühleren Regionen gedeihen.
TROCKENHEIT, NÄSSE, KÄLTE UND WINDE
Selbst die sehr sonnenliebenden, trockenheitsverträglichen Obstarten brauchen – wie alle Gehölze – in den ersten Jahren eine gute Wasserversorgung, bis sich ihr Wurzelwerk ausreichend entwickelt hat. Das gilt erst recht für die Gemüse, von denen die allermeisten regelmäßigen Wassernachschub benötigen. Dies ist ein weiterer „Knackpunkt“ des Klimawandels: häufiger auftretende, anhaltende Trockenphasen und regenarme Winter, in denen die Bodenvorräte nicht ausreichend aufgefüllt werden. Zugleich erhöhen sonnenreiche Frühjahrsund Sommerwochen den Bedarf an wachstumsförderndem Nass. In manchen Regionen gab es wegen Wasserknappheit schon sommerliche Beregnungsverbote, beispielsweise für Rasenflächen. Umso wichtiger werden das Nutzen von Regentonnen und Zisternen sowie das Mulchen freier Bodenflächen und eine gute Bodenpflege, um die Verdunstung herabzusetzen (siehe Seite 56).
Vorgezogene Tomaten können – wie viele andere Nutzpflanzen – immer früher ins Freiland.
Das andere Extrem, das in den letzten Jahren leider auch häufiger wurde, sind längere Phasen mit anhaltenden Regenfällen, Starkregen mit Überschwemmungen bis hin zu tragischen Hochwasserfluten. Durch die höheren Temperaturen verdunstet mehr Wasser, sodass der Wasserdampfgehalt in der Atmosphäre zunimmt und in manchen Regionen zu heftigen Niederschlägen führt. Hier sind natürlich die gärtnerischen Möglichkeiten stark begrenzt.
Zu den wichtigsten Vorbeugungsmaßnahmen gehört, möglichst wenig Flächen und Wege durch Pflaster zu versiegeln. Wo immer es möglich ist, sollte man eine wasserdurchlässige Bodenbedeckung bevorzugen: mit Bodendeckerpflanzen und Wiesengräsern, mit Mulch und mit wasserdurchlässigen Bodenbelägen, zum Beispiel mit Rasengittersteinen, Schotterrasen, Sickerpflaster oder Drainagebelägen (Steinteppichen). Wenn des Öfteren Nässeprobleme auftreten, können geschickt platzierte Drainagerohre und -gräben die Schäden in Grenzen halten; ebenso kleine Dämme und Erdwälle, die das Wasser beispielsweise in einen Teich, Bachlauf oder eine Zisterne leiten. Nicht zuletzt fördert auch das Verbessern stark tonhaltiger Böden das Versickern und Abfließen überschüssigen Regenwassers (siehe „Böden nachhaltig verbessern“, Seite 52).
Hitzewellen, Trockenphasen und Starkregen sind häufiger geworden, strenge Winter und starke Fröste dagegen seltener. Teils zeigen die Schneeglöckchen, die den Vorfrühling ankündigen, ihre hübschen Blüten schon im im Januar oder gar Ende Dezember. Früher wartete man mit dem Auspflanzen von Tomaten, Paprika, Gurken & Co. bis nach den „Eisheiligen“ gegen Mitte Mai, heute legen viele schon Ende April oder früher los. Auch außerhalb des Weinbauklimas gelingt nun öfter der Anbau von Tafeltrauben, Feigen, Auberginen, Chilis, Melonen und sogar von Ingwer, Granatapfel oder Maracuja im Freien.
Man sollte aber stets bedenken, dass wir bei aller Erwärmung noch längst kein mediterranes Klima haben. Frostige Winter, Kälteeinbrüche im Frühjahr und zur Zeit der Eisheiligen sowie nasskalte Sommer gehören nach wie vor zum Wetter-Repertoire, obwohl sie seltener auftreten. Das hängt auch sehr stark von der jeweiligen Region ab. Und wo Fröste ausbleiben, können stattdessen Starkregen oder Sturmwinde zum Beispiel frühe Obstbaumblüten und zarte Gemüsejungpflanzen empfindlich schädigen. Deshalb ist es nach wie vor günstig, wenn Nutzgartenbereiche etwas geschützt liegen.
Meist sind Hecken, deren Blattwerk etwas Luft durchlässt, die besten Sperren, wenn es zum Beispiel darum geht, einen exponierten Gartenteil vor kalten und austrocknenden Winden zu schützen. Sie brechen und verlangsamen die Wirkung des Windes. Die Heckengehölze müssen allerdings so gewählt und platziert werden, dass sie den Nutzgarten nicht übermäßig beschatten. Für solche Windschutzhecken eignen sich zum Beispiel Hasel, Hainbuche, Felsenbirne, Liguster und Wildrosen. Eine sehr dichte Hecke oder Mauer dagegen lenkt den Wind nach oben, sodass er die Hindernisse gewissermaßen übersteigt und schnell wieder an Geschwindigkeit zulegt.
Mauern und feste Wände bieten zwar den Vorteil der Wärmespeicherung, was für kälteempfindliche Obst- und Gemüsesorten günstig ist. Direkt vor hellen Mauern kann es jedoch zum Hitzestau und einem verstärkten Auftreten von Schädlingen wie Spinnmilben kommen. Etwas bewegte Luft beugt zudem Pilzkrankheiten vor, da sie für ein schnelleres Abtrocknen nasser Blätter sorgt, und ist zudem für windbestäubte Fruchtgemüse unerlässlich. Wo feste Barrieren gewünscht werden, eignen sich oft luftdurchlässige Weidenflecht- oder Lamellenzäune am besten, wie bereits für eine Beschattung um die Mittagszeit empfohlen.
Gerade während der Fruchtbildung brauchen die Pflanzen reichlich Wasser.
GESUND BLEIBEN
So wie die zarten Pflänzchen sich allmählich an die rauen Außenbedingungen anpassen können, so müssen auch wir uns langsam an neue Belastungen beim Gärtnern gewöhnen und entsprechende Vorsorge treffen. Gärtnern ist und bleibt gesund, sowohl körperlich als auch geistig, wie wissenschaftliche Studien immer wieder bestätigen. Man sollte auch die möglichen Gefahren, die bei allen Tätigkeiten im Freien auftreten können, keinesfalls übertreiben. Aber Unachtsamkeiten wie das Tragen zu schwerer Lasten oder schlecht gesicherte Leitern bei der Obsternte können das Vergnügen am Gärtnern doch beeinträchtigen.
Zunehmend rücken auch die Risiken ins Bewusstsein, die mit der Klimaerwärmung zusammenhängen. Steigen die Temperaturen über 30 °C und brennt die Sonne unbarmherzig, tut man gut daran, anstrengende Tätigkeiten zu verschieben und besser an einem schattigen, kühlen Plätzchen zu verweilen. Im Garten ist keine Arbeit so dringend, dass man Kreislaufprobleme oder gar einen Hitzschlag riskieren muss. Dazu können im Sommer die bodennahen Ozonwerte ansteigen, was die Atemwege belastet, die Schleimhäute reizt und zu Kopfschmerzen führen kann.
Der breitkrempige Strohhut schützt vor sengenden Sonnenstrahlen.
Sonnenbaden im Garten wird bei intensivem Sonnenschein mit hoher UV-Strahlung zum zweifelhaften Vergnügen. So droht nicht nur starker Sonnenbrand, sondern auf Dauer schlimmstenfalls Hautkrebs. Die Fallzahlen steigen leider seit Jahren bereits sichtbar. Nicht alle Betroffenen sind Gärtnerinnen und Gärtner, das Risiko besteht für alle Menschen, die sich ungeschützt längere Zeit intensiver Sonne aussetzen. Besser als Shorts und ärmellose Shirts sind eine leichte, luftige Bekleidung, die die Beine und Arme weitgehend bedeckt, sowie eine Kopfbedeckung – und eine gute Sonnencreme.
Körperbedeckende Kleidung hilft auch gegen manche Plagegeister, die durch die Wärme verstärkt und inzwischen teilweise fast ganzjährig auftreten. Zu den gefährlichsten gehören die Zecken. Sie können die Krankheiten Frühsommer-Hirnhautentzündung FSME und Borreliose übertragen. Gegen Ersteres gibt es vorbeugende Impfungen. Welche Gebiete zu den Risikozonen gehören, veröffentlicht jeweils aktuell das Robert Koch Institut auf www.rki.de.
Eine bakterielle Borreliose kann man nur – möglichst frühzeitig – durch eine Antibiotikabehandlung kurieren. Typisches Anzeichen einer Borreliose ist die sogenannte Wanderröte. Dabei handelt es sich um einen Fleck an der Einstichstelle, der sich Tage bis Wochen nach dem Biss ringförmig auf einen Durchmesser von mehr als fünf Zentimeter ausbreiten kann. Außerdem können bis zu sechs Wochen nach dem Stich grippeähnliche Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit auftreten. Das sollte sich dann umgehend ein Arzt anschauen.
Stiche von Wespen, Bienen und Hornissen sind für gesunde Menschen schmerzhaft, aber nicht weiter tragisch. Wirklich gefährlich werden sie, wenn allergische Reaktionen dagegen auftreten – dann sollte sofort ein Notarzt verständigt werden!
Deutlich zugenommen haben auch „Schnakenplagen“, also die Ausbreitung von Stechmücken. Was können Sie im eigenen Garten tun? Zu den besten Vorbeugungsmaßnahmen gehören Bakterienpräparate, die in Regentonnen, Tümpel und Teichen ausgebracht werden, um gezielt die Larven der sich entwickelnden Mücken abzutöten. Das hat allerdings negative Auswirkungen auf die Nahrungskette, reduziert das Nahrungsangebot für alle Tiere, die sich von Mücken ernähren. Besser ist in den meisten Fällen, wenn Sie sich während der Gartenarbeit mit den wirksamen Antimückenmitteln einsprühen oder -cremen.
Kleine Verletzungen, vor allem an Händen und Armen, sind nicht weiter tragisch. Extrem gefährlich werden sie aber, wenn bakterielle Erreger des Wundstarrkrampfs (Clostridium tetani) eindringen. Mögliche Infektionsquellen sind Staub, Blumen- und Gartenerde sowie Ausscheidungen von Pferden, Hunden, Meerschweinchen, Rindern und Schafen. Dagegen gibt es seit Langem die prophylaktische Tetanus-Impfung, die spätestens alle zehn Jahre wieder aufgefrischt werden muss. Es macht also schon Sinn, bei einer blutenden Verletzung an den Händen die verletzte Stelle mit einem wirksamen Desinfektionsmittel zu säubern.
Nicht zuletzt sollte man daran denken, dass manche Pflanzen Giftstoffe enthalten. Das gilt nicht nur für hochgiftige und hautreizende Wildkräuter wie Kreuzkraut (Greiskraut) und Riesen-Bärenklau. Auch durch unbedachten Verzehr mancher Gemüse sind schon Vergiftungen aufgetreten. Hohe Nitratgehalte, zum Beispiel in Roten Beten und Wintergemüse, hohe Oxalsäuregehalte, zum Beispiel in Rhabarber, unreife Tomaten und Auberginen, grüne und auskeimende Kartoffeln, rohe Bohnen, Kichererbsen und Linsen: Das alles kann die Gesundheit gefährden, bis hin zu starker Übelkeit, Durchfall und Krämpfen.
Giftig sind auch die Bitterstoffe, die manche Zucchini, Gurken und Kürbisse bei anhaltender Hitze und Trockenheit bilden. Das Essen bitterer Zucchini hat sogar schon zu Todesfällen geführt.
PLATZBEDARF UND PFLEGEAUFWAND
Ein paar sonnige Quadratmeter für einige Tomaten-, Erdbeerpflanzen und Kräuter finden sich in fast jedem Garten; zudem kann manches bei Platzmangel auch prima in Gefäßen oder kleinen Hochbeeten auf Balkon und Terrasse angebaut werden. Für einen „richtigen“, vielfältigeren Gemüse- und Kräutergarten braucht man allerdings wenigstens 15 bis 20 Quadratmeter, auf denen sich ungefähr vier bis acht Beete anlegen lassen.
Mindestens 20 Quadratmeter pro Person werden nötig, falls das meiste Gemüse aus dem eigenem Garten kommen soll. Strebt man zudem üppige Erdbeer- oder Spargelernten sowie Vorräte an Kartoffeln und Lagergemüse an, steigt der Flächenbedarf pro Haushaltsmitglied auf etwa 50 Quadratmeter; bei höheren Selbstversorgungs-Ambitionen sogar auf rund 80 Quadratmeter – Obstgehölze noch nicht mitgerechnet.
Denken Sie bei der Größenplanung auch an den nötigen Platzbedarf für Wege und Pfade zwischen und neben den Beeten. Dafür kann man rund 20 bis 25 Prozent der Gesamtfläche veranschlagen.
Zur Vollversorgung reicht es meist nicht, aber leckere Ernten sorgen für tolle Erfolgserlebnisse.
GRENZABSTÄNDE BEI OBSTGEHÖLZEN
Platzwahl und -bedarf für Obstgehölze haben auch einen wichtigen rechtlichen Aspekt: Für größere Gehölze und Hecken, ebenso für Baulichkeiten im Garten, gelten gesetzlich festgelegte Mindestabstände zur Grenze des Nachbargrundstücks. Diese können je nach Bundesland etwas variieren. Mit Obstbäumen müssen Sie je nach Wuchsstärke und Veredlung meist zwischen 2 und 4 Meter Abstand zum Nachbarn halten, mit Beerensträuchern mindestens 0,5 Meter, mit Walnussbäumen teils bis 8 Meter – jeweils gemessen von der Mitte des Stamms oder Strauchs.
Genaue Auskunft über die ortsüblichen Regelungen erhalten Sie bei der zuständigen Orts- beziehungsweise Kreisverwaltung oder Baubehörde.
Meiden Sie bei Obstgehölzen die Versuchung, durch zu enge Pflanzung Platz zu sparen – das lohnt sich im Endeffekt nicht. Bis auf wenige Ausnahmen (zum Beispiel Säulenobstbäume) müssen Sie selbst bei kleinen Obstbäumen und den meisten Beerensträuchern mindestens zweieinhalb bis fünf Quadratmeter Standraum veranschlagen (siehe auch Pflanzabstände Seite 66). Ein markanter Apfelhalbstamm kann allein schon über 20 Quadratmeter Fläche beanspruchen, ein Walnussbaum auf Dauer sogar über 70 Quadratmeter. Der gesamte Flächenbedarf ist hier – je nach bevorzugten Obstarten und Baumformen – noch wesentlich variabler als beim Gemüse.
Steht genug Platz für einen großen Nutzgarten zur Verfügung, stellt sich die Frage, was man tatsächlich ohne übermäßigen Stress bewältigen kann. Schließlich kann und soll das Pensum im eigenen Garten ganz nach Belieben erledigt werden – inklusive entspannender Päuschen, etwa auf einer Gartenbank im lauschigen Schatten oder Plaudern mit den Nachbarn.
Die folgenden Angaben sollen Ihnen nur ein wenig helfen, den Zeitaufwand grob, aber auch realistisch abzuschätzen.
Für 10 Quadratmeter Gemüsefläche kann man pro Woche mit rund 30 Minuten für die Pflege rechnen. Dazu kommen je nach Lage des Nutzgartens Wegzeiten, auch für das Holen und Wegräumen von Geräten. Wird in Trockenperioden tägliches Gießen nötig, kann der Zeitaufwand etwas höher liegen. In größeren Gärten reduziert sich das Ganze oft ein wenig, weil sich bei jedem Arbeitsgang mehr Fläche „auf einen Schlag“ erledigen lässt. Die meiste Arbeit fällt während der Hauptsaat- und -pflanzzeit im Frühjahr und Frühsommer an und dann wieder im Herbst, wenn es an das Räumen der Beete und die Bodenbearbeitung geht.
Im Obstgarten dagegen kosten die laufenden Pflegearbeiten kaum mehr Zeit als bei Rosen oder anderen anspruchsvolleren Ziersträuchern. Sehr wichtig sind allerdings eine regelmäßige Kontrolle auf Schädlinge oder Krankheiten und die frühzeitige Durchführung von Vorbeugungs- und Bekämpfungsmaßnahmen. Ansonsten sollte man pro Baum oder Strauch rund eine halbe Stunde für eine sorgfältige Pflanzung einplanen, ebenso dann später für den jährlichen Schnitt.
Denken Sie bei all dem schließlich auch an die Ernte. Je nachdem, was Sie anbauen, können ab Frühsommer öfter mal einige Stunden nötig werden, um Reifes abzuernten, einzufrieren oder auf andere Weise zu konservieren. Und das duldet in der Regel wenig Aufschub. Nicht zuletzt deshalb muss der Nutzpflanzenanbau auch auf die gewünschten Urlaubszeiten abgestimmt werden. Das Gießen bei einer längeren Abwesenheit lässt sich eventuell noch dank hilfsbereiter Freunde oder mit einer automatischen Bewässerung regeln. Vielleicht springen nette Gießvertreter auch als Erntehelfer ein und werden so für ihren Einsatz belohnt.
GESTALTEN: ATTRAKTIV UND PRAXISGERECHTDie klassische, altbewährte Lösung für den Nutzgarten ist ein eigener Gartenteil mit meist rechteckigen Beeten für Gemüse, Erdbeeren und Kräuter.
NUTZPFLANZEN IM ZIERGARTEN
Oft wird der Nutzgarten durch Einfassungen oder niedrige Hecken optisch etwas abgetrennt und durch Beerensträucher oder kleine Obstbäume am Rand ergänzt.
Als „Gegenmodell“ kann man die weitgehende Integration von Nutzpflanzen in den Ziergarten ansehen. Das kommt den heute oft recht kleinen Gartengrundstücken entgegen, ebenso dem Interesse an reizvollen, individuellen Gestaltungen, kann aber auch die gezielte Pflege erschweren und etwas aufwendiger machen.
Bei Obstgehölzen ist die recht freie Eingliederung in den Garten eine verbreitete Praxis, da sie meist in überschaubarer Anzahl gepflanzt werden, einzeln oder in kleinen Gruppen. Außerdem gedeihen und fruchten manche besser im Halbschatten, während andere die volle Sonne bevorzugen (siehe Seite 77 ff.). Mit ihren ansprechenden Wuchsformen und Blättern, hübschen Blüten und auffälligen Früchten entfalten Obstbäume in jeder Umgebung auch reichlich Zierwirkung. Man denke nur an die berühmte Kirschblüte im Frühjahr, die insbesondere in Japan traditionell besonders gefeiert wird.
Als Halb- oder Hochstämme können sie sogar die Funktion eines markanten Hausbaums übernehmen, der eine prägende Rolle in der Gesamtgestaltung übernimmt. Setzt die Krone erst ab etwa zwei Meter Höhe an, lässt sich darunter prima eine Bank platzieren, auf der man im Hochsommer den lauschigen Schatten des Laubdachs genießt. Aber auch in kleineren Buschbaumformen, als platzsparende Spalierbäume an einer wärmenden Hauswand oder als schmale Spindel- und Säulenbäume in heckenartiger Pflanzung bieten Obstbäume überall einen attraktiven Anblick.
Das gilt – von den unauffälligeren Blüten einmal abgesehen – auch für Beerensträucher. Besonders Hochstämmchen, etwa von Johannis- oder Stachelbeere, lassen sich als attraktive „Hingucker“ einsetzen, zum Beispiel auch inmitten einer Stauden- oder Kleinstrauchrabatte oder an der Terrasse. Für Obsthecken bieten sich eher die normalen Strauchformen an, wobei sich Haselnusssträucher sogar gut in gemischte Wildhecken integrieren lassen. Ausgesprochen zierend präsentieren sich Klettergehölze, nämlich Kiwi und Weinrebe, die sich zum Begrünen von Pergolen ebenso eignen wie zum Hochleiten an Fassaden.
Auch Kräuter fügen sich harmonisch in viele Gartenbereiche ein, sofern die Standortverhältnisse stimmen und sie durch höhere Nachbarpflanzen nicht zu stark beschattet werden. In Blumen-, Stauden- und Kleinstrauchbeeten oder – besonders im Fall der mediterranen Kräuter – auch im Steingarten entfalten sie ihre optische Wirkung als Blattschmuckpflanzen, teils auch als anmutige Blüher. Manche, darunter Thymian, Oregano und Ysop, bereichern den Garten zudem mit ihren aromatischen Düften und können zugleich benachbarte Zierpflanzen durch intensive Gerüche vor Schädlingen bewahren. Ihr Duft, aber auch der häufige Gebrauch in der Küche machen Kräuter so auch zu idealen Kandidaten für die Umpflanzung einer Terrasse oder zum Säumen von oft benutzten Wegen.
Kleiner Nutzgarten, als Halbkreis angelegt: (1) Dreieckige Beete; (2) Rabatte mit Kräutern, Erdbeeren, Blumen; (3) Hauptweg; (4) Kompost; (5) Beerensträucher; (6) kleine Obstbäume; (7) Himbeeren am Drahtgerüst; (8) Wasserzapfstelle
DER SEPARATE NUTZGARTEN
Besonders für den Anbau von Gemüse, Erdbeeren und größeren Mengen an Kräutern sind „eigenständige“ Flächen schon sehr vorteilhaft. Rechteckige oder quadratische Umrisse, sowohl für die einzelnen Beete als auch für den gesamten Nutzgarten, haben sich dabei als besonders praktisch erwiesen und passen ebenso gut in einen architektonischen Garten wie zu einer Gestaltung mit rustikalem Ambiente.
Aber auch eine unregelmäßige, fantasievoll gewählte Form des Nutzareals hat ihre Reize und kann beispielsweise in einem naturnahen Garten harmonischer wirken. Eine attraktive Variante sind außerdem kreis- oder halbkreisförmige Gemüse- und Kräutergärten.
Hier präsentieren sich die einzelnen Beete dann als spitz zulaufende Dreiecke. Unregelmäßige oder runde bzw. dreieckige Formen machen allerdings die meist übliche Saat und Pflanzung in parallelen Reihen schwieriger.
Ob man den Nutzgarten optisch als besonderen Gartenteil abgrenzen möchte, beispielsweise durch niedrige Hecken, Zäune oder Mäuerchen, oder mit eher fließenden Übergängen eingliedert, ist vor allem Geschmackssache. Allerdings wirkt es oft etwas „unproportioniert“, wenn eine eher bescheidene Nutzfläche durch auffällige, hohe Barrieren abgetrennt wird. Grenzt der Nutzbereich an eine Rasenfläche, vereinfachen schlichte Einfassungen mit ebenerdig verlegten Platten oder Randsteinen das Mähen der Rasenkante. Natürlich können auch hier dahinter gesetzte Hecken oder Zäune für eine augenfälligere Umrahmung sorgen.
Wählt man für die Einfassung und Wegbefestigung des Nutzgartens Materialien, die auch in anderen Gartenteilen präsent sind, ist schon einmal grundsätzlich für eine optische Anbindung gesorgt.
Auch Rabatten mit Sommerblumen, niedrigen Stauden oder Rosen, die den Nutzgarten säumen, können die gestalterische Integration fördern. Höhere Ziersträucher können schön als Kulisse an der sonnenabgewandten Seite der Nutzpflanzen platziert werden. Und natürlich lässt sich auch der Nutzgarten selbst durch charmante Blütenpracht aufpeppen. Da wir aber keine „Museumsgärten“ anlegen wollen, ist es ansonsten völlig in Ordnung, wenn man sich diejenigen Elemente heraussucht und beliebig kombiniert, die den eigenen Wünschen und Vorstellungen entsprechen.
Klassischer Nutzgarten: (1) Hauptweg; (2) Nebenwege zwischen Beeten; (3) Frühbeet; (4) Kräuterbeet mit Trittplatten; (5) Rhabarber; (6) Beerenhochstämmchen; (7) Wasserzapfstelle; (8) Blumen und Stauden; (9) Holzzaun; (10) Niedrige Hecke
In den früher traditionell größeren Nutzgärten und Bauerngärten wurde die meist rechteckig angelegte Fläche durch zwei sich überkreuzende Hauptwege in vier quadratische bis rechteckige Beetabteile untergliedert. Heute kann man das in den meist kleineren Hausgärten mit einer „halbierten“ Aufteilung umsetzen, wie die Illustration links zeigt. Bevorzugte Wegbeläge sind Klinker- oder Ziegelpflaster, Steinplatten oder Kies. Für schmalere Wege eignet sich auch Rindenmulch.
In der Sichtachse des Hauptwegs zieht ein Rundbeet (Rondell) oder ein dekorativer Brunnen die Blicke auf sich. Klassiker für das Rondell sind Edel-, Beet- oder niedrige Strauchrosen; passende Alternativen wären zum Beispiel Lilien oder andere hohe Stauden, Johannisbeerhochstämmchen oder ein Lorbeerbäumchen im Kübel.
Die Beete, inklusive Rondell, werden von niedrigen, regelmäßig geschnittenen Buchshecken umrahmt. Diese kommen auch für die Einfassung des kompletten Nutzgartens infrage, sofern man hier nicht eine deutlichere Abgrenzung durch Zäune oder hohe Holzpalisaden bevorzugt. Zum ländlichen Flair passt zum Beispiel der gute alte Scherengitter- oder Jägerzaun mit sich diagonal überkreuzenden Latten. Noch rustikaler und natürlicher wirken Staketenzäune mit senkrechten, nicht gehobelten Pfosten oder Latten sowie Flechtzäune aus Weiden- oder Haselnussruten. Bei solch einer markanten Einfriedung kann dann ein Rosenbogen, an dem eine Kletterrose oder Clematis hochwächst, als attraktive Eintrittspforte das Gesamtbild abrunden. Und natürlich darf im Bauerngarten auch eine Holzbank für Arbeitspausen und Mußestunden ihren Patz finden.
In den Beeten können Blumen und Stauden auf verschiedene Weisen eingebracht werden: etwa in getrennten Beetabschnitten, reihenartig zwischen Gemüsen und Kräutern oder auch als Beeteinfassung, wofür sich besonders Tagetes (Studentenblumen) und Ringelblumen eignen. Andere typische Sommerblumen für den Bauerngarten sind Bartnelke, Kapuzinerkresse, Schmuckkörbchen und Stockrose. Zu den charakteristischen mehrjährigen Stauden zählen zum Beispiel Lupine, Pfingstrose, Rittersporn, Schafgarbe und Türkischer Mohn.
Vielleicht haben ja schon die Bäuerinnen früherer Jahrhunderte festgestellt, dass dieses bunte Nebeneinander von Gemüse, Kräutern und Blumen einen praktischen Zusatzeffekt haben kann: Tatsächlich tragen die Vielfalt der Bepflanzung und die Abwehrwirkungen mancher Kräuter und Blumen dazu bei, bestimmte Schädlinge im Zaum zu halten.
NUTZGARTEN IN KÜBELN UND KÄSTEN
Immer häufiger sieht man auf Balkonen und Terrassen Pflanzgefäße mit Kräutern, Gemüse und Obst. Das Repertoire an Töpfen, Kästen und Pflanzschalen wird zunehmend ergänzt durch Mini-Hochbeete, die sich auf fast jedem Balkon unterbringen lassen. Der Fachhandel kommt solchen Wünschen gern entgegen und bietet dafür zum Beispiel auch Kartoffelpflanzsäcke, Pflanztaschen, rustikale Fässer und Kräutertürme an.
Auch Gärtnerinnen und Gärtner, die über genug Beetflächen verfügen, schätzen solche Möglichkeiten. So lassen sich Gemüse und Kräuter für den täglichen Gebrauch leicht in Hausnähe platzieren, beispielsweise im Hof. Drohen den Pflanzen Spätfröste, Starkregen oder allzu pralle Sonne, können sie vorübergehend an einen geschützten Platz gerückt werden. Wärmeliebende Gemüse- und Obstarten wie Pepino, Andenbeere (Physalis) und Granatapfel kommen als Kübelpflanzen einfach nach drinnen, falls Minustemperaturen die Ernte gefährden. So bietet der „mobile Anbau“ in Pflanzgefäßen gleich mehrere Vorteile.
Beflügelt wurde das alles in größerem Maßstab durch das „Urban Gardening“: den Anbau von Nutzpflanzen in städtischen Gemeinschafts- und Dachgärten. Deren Grundflächen sind oft befestigt, asphaltiert oder befinden sich auf unwirtlichen Brachflächen. Wenn ein Bauvorhaben ansteht, müssen die Pflanzen manchmal ganz schnell den Platz wechseln. Deshalb wurden die praktischen, leicht umzusetzenden Bäckerkisten zu den bevorzugten Pflanzgefäßen. In Deutschland gehört der Prinzessinnengarten in Berlin zu den Vorreitern solcher Anbaumethoden und Initiativen, die heute in zahlreichen Städten verbreitet sind.
Welche Nutzpflanzen in Gefäßen und Mini-Hochbeeten angebaut werden können, ist vor allem eine Platzfrage. Die meisten Kräuter, Salate, Blattgemüse sowie Radieschen gedeihen schon in Kästen am Balkongeländer und in nicht allzu großen Töpfen auf dem Balkon- und Terrassenboden, auf Tischen oder Regalen. Besonders gut eignen sich Gemüse mit kurzer Kulturdauer und geringem Platzbedarf sowie Arten, die über längere Zeit fortlaufend Erntegut liefern, zum Beispiel Mangold, Busch- und Feuerbohne oder Tomate.
Mit Busch- oder Balkontomaten, gefolgt von Hängetomaten für Ampeln, wurden die ersten Sorten speziell für die Gefäßkultur angeboten. Mittlerweile gibt es immer mehr „Minisorten“, die weniger Platz brauchen als Standardsorten und zudem früher erntereif werden. Das reicht von kleinen Snackgurken über Mini-Blumenkohle bis zu „Babymöhren“.
Frische Kräuter gibt es auch auf dem Balkon aus dem Topf.
Als Obst im Kübel kommen vor allem Zwerg- und Säulenbäume infrage. In Gefäßkultur gedeihen zudem fast alle Beerensträucher, inklusive aufrecht wachsenden Brombeeren (am besten die stachellose wie ‘Navaho’), Kiwi und Weinrebe. Erdbeeren, besonders mehrmals tragende und Monatserdbeeren, lassen sich ohnehin gut in großen Töpfen oder Balkonkästen kultivieren, und spezielle Hängesorten können sogar Ampeln schmücken.
PFLANZGEFÄSSE UND ERDEN
Zu den Vorteilen der Gefäßkultur gehören verschiedene Möglichkeiten der zeitsparenden und teils auch wassersparenden Versorgung mit Feuchtigkeit. Das ist auch öfter notwendig als im Beet, weil das Volumen der Erde als Wasserspeicher begrenzt ist und der Wurzelbereich auf allen Seiten einer intensiven Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Zur konstanteren Wasserversorgung verhelfen zum einen Kästen, Kübel und Tröge mit integriertem Wasserspeicher. Zum andern lassen sich hier Tröpfchenbewässerungen noch einfacher einsetzen als im Garten (siehe Seite 31).
Abgesehen von Wasserspeichergefäßen ist es andererseits sehr wichtig, dass überschüssiges Wasser über Löcher oder Spalten an den Unterseiten ablaufen kann; sonst drohen Staunässe und Fäulnis. Tonscherben über den Abzugslöchern beugen dem Verstopfen durch Erde vor. Vor allem für größere Gefäße empfiehlt sich unten eine 2–5 cm starke Drainageschicht aus Blähtonkügelchen, Splitt oder feinem Kies. Ein darüber gelegtes Vlies verhindert das Verdichten durch eingeschwemmte Erde.
Die Gefäßgröße sollte für einen guten Erdvorrat ausreichen, aber auch nicht überdimensioniert sein, da dies angepasstes Gießen erschwert. Für größere Gemüsepflanzen, etwa Mangold oder Paprika, sollten die Töpfe mindestens 8–10 Liter Erde fassen, für Obstgehölze wenigstens 25 Liter. Wenn nötig, können sie nach einigen Jahren in einen größeren Kübel umgesetzt werden.
Pflanzgefäße gibt es in vielen Materialien, bis hin zu Metall und Fiberglas. Die Hauptrolle spielen allerdings nach wie Kunststoffe (am besten aus Recycling-Material) sowie Ton. Ton- und Terrakottatöpfe stehen fest und sicher und ermöglichen mit ihren porösen Wänden Gasaustausch und Wasserregulierung. Größere Gefäße werden aber erheblich schwerer als Kunststofftöpfe, die dann auch oft bevorzugt werden. Kübel für Obst und andere draußen überwinterte Mehrjährige müssen unbedingt frostfest sein.
Für Gemüse, Kräuter und Erdbeeren sind die Bäckerkisten aus Kunststoff mit ihrer Grundfläche von 60 cm x 40 cm eine clevere Lösung. Obwohl recht geräumig, haben sie ein geringes Eigengewicht und lassen sich mit ihren Griffmulden einfach umsetzen. Werden die durchbrochenen Wände mit einem kräftigen Mulchvlies ausgekleidet, kann etwas überschüssiges Wasser trotzdem noch nach den Seiten hin ablaufen. Und stapelt man zwei erdgefüllte Kisten übereinander, fängt die untere den Wasserabfluss von der oberen auf.
Der langjährige Gebrauch von Unmengen an Torf für Pflanzenerden hat schon viele Moorlandschaften zerstört. Deshalb wollen nun mehrere EU-Staaten den Torfverbrauch stark reduzieren. In Deutschland sollen bis 2026 gar keine Torfprodukte mehr für den Hobbygarten angeboten werden. Mittlerweile findet man in Garten-, Bau- und sogar Supermärkten häufig torffreie Erden für Nutz- und Zierpflanzen, auch in guter Qualität. Darunter gibt es ausgewiesene Tomaten- und Gemüseerden sowie Kräutererden mit geringerem Nährstoffgehalt. Auch sogenannte Universal- und Blumenerden eignen sich für die meisten Gemüse. Obstgehölze im Topf haben als mehrjährige Pflanzen etwas höhere Ansprüche, vor allem an eine dauerhafte Strukturstabilität. Auch dafür bietet der Fachhandel torffreie Substrate an. Gute Kübelpflanzenerden taugen ebenfalls für Obst.
ÜBERWINTERUNG IN TÖPFEN
Für Obst und überwinternde Gemüse gilt im Allgemeinen: Was üblicherweise im Garten wächst, kann auch über Winter draußen bleiben – am besten an einem geschützten Platz nahe der Hauswand. Drohen stärkere Fröste, empfiehlt sich eine gute Topfisolierung (Styroporplatten oder Bretter als Unterlage, Luftpolsterfolie zum Einpacken), ebenso das Abdecken der Erdoberfläche mit Fichtenzweigen und Laub; wenn nötig, auch das Umhüllen oberirdischer Teile mit Vlies oder Jutegewebe. Kommen die Pflanzen vorsichtshalber nach drinnen, stehen sie am besten hell und recht kühl (bei 4–12 °C).
Platzsparend und mobil: Gemüseernte aus der Bäckerkiste
Torffreie Erden bestehen aus den Hauptrohstoffen Kompost, Holzfaser, Rindenhumus, Kokosfaser und Ton. Zusatzstoffe wie Blähschiefer, Lavagestein oder Pflanzenkohle lockern die Struktur auf, durchlüften den Boden und geben Nährstoffe ab. Torffreie Erden mit dem RAL-Gütesiegel stehen für sorgfältig geprüfte Qualität. Es gewährleistet zum Beispiel ein gutes Wasserspeichervermögen und dass die Erden frei von Schadstoffen sind.
EINRICHTEN: ZWECKMÄSSIG UND PFLEGELEICHTZwischen der Gestaltung, Einrichtung und Anlage von Nutzgartenbereichen gibt es fließende Übergänge. In diesem Kapitel soll es vor allem um praxisorientierte Planungen gehen, auch um nötige und nützliche Investitionen.
BEETE UND WEGE PLANEN
Informationen zur konkreten Umsetzung von der Bodenvorbereitung bis zur Beetanlage und Wegbefestigung finden Sie im Kapitel „Vorbereiten und anlegen“ (ab Seite 42). Hier geben wir Empfehlungen und Tipps für den klassischen, separaten Nutzgarten, sie lassen sich aber leicht für andere Lösungen anpassen.
Die bewährte Standard-Beetform für Gemüse ist rechteckig, 1,2 Meter breit und meist zwischen 1,5 und 2,5 Meter lang. So kann man von beiden (Längs-)Seiten her noch gut die Mitte erreichen, und die Beete bieten Platz für genügend lange, parallele Reihen. Wer es noch etwas bequemer haben möchte, kann die Beetbreite auch auf rund einen Meter reduzieren. Häufig wird empfohlen, die Beete in Nord-Süd-Richtung anzulegen, damit alle Pflanzen morgens vom Osten bis abends vom Westen möglichst viel Sonne abbekommen. Doch angesichts der nun häufiger auftretenden Hitzewellen hat es Vorteile, wenn die Beete um die Mittagszeit leicht beschattet und nicht voll der intensiven Südwestsonne ausgesetzt sind. Sofern die Beete nicht direkt an einem Hauptweg liegen, verlaufen zwischen ihnen 30–40 Zentimeter breite Pflegepfade.
Für Kräuter, die oft gruppenweise statt in Reihen gepflanzt werden, wählt man gern quadratische oder rundliche Beetformen. Kräuter lassen sich auch schön in Rabatten unterbringen, also in schmalen, lang gezogenen Beeten, etwa an einer Hauswand, als Saum an der Terrasse oder entlang eines Weges. Sind solche Rabatten nur von einer Seite her zugänglich, sollten sie nicht viel breiter beziehungsweise tiefer als 60 Zentimeter angelegt werden, damit sich auch die Kräuter im hinteren Bereich leicht pflegen und ernten lassen. Andernfalls empfehlen sich einige gut verteilte Trittplatten oder schmale Pflegepfade innerhalb der Rabattenflächen. Rabatten eignen sich ebenso für Erdbeeren und Beerensträucher sowie Zwerg- und Säulenobstbäume, wobei sich die Rabattentiefe für Gehölze natürlich an deren Durchmesser orientieren muss.
Spezielle Beetformen mit „Ausdehnung“ nach oben sind Hoch- und Hügelbeet, die vorrangig für Gemüse genutzt werden (siehe Seite 62 f.) und die auch gestalterisch sehr reizvolle Kräuterspirale (Seite 63 ff.). Ein Hochbeet macht zudem ein bequemes Arbeiten ohne Bücken möglich.
Wie viel Fläche man für Wege reserviert, ist nicht zuletzt eine Platzfrage. Dabei werden öfter Kompromisse und Abstriche nötig. Soweit möglich, empfiehlt sich aber gerade im Nutzgarten der eine oder andere Hauptweg mit 90–120 Zentimeter Breite, vor allem inmitten eines größeren Nutzgartens sowie als Verbindung zum Haus oder Garteneingang. Solche Wege bieten genug Bewegungsfreiheit für die Schub- oder Sackkarre und Platz zum Abstellen zum Beispiel von Erntekörben oder Düngersäcken. Wege mit wenigstens 60 Zentimeter Breite sind auch sehr praktisch für den Zugang zum Kompostplatz, Geräteschuppen oder zu einem Gewächshaus.
ESSENZIELL: GUTE WASSERVERSORGUNG
Gemüse und viele Kräuter müssen in Trockenphasen unbedingt regelmäßig gegossen werden; ebenso junge Obstgehölze, bis sie gut eingewachsen sind. Wie hoch der Gießwasserverbrauch ist, kann stark variieren. Das hängt zunächst vor allem ab von den örtlichen Niederschlagsmengen und ihrer Verteilung im Jahreslauf. Großen Einfluss haben außerdem die Bepflanzung, die Wasserhaltekraft des Bodens, die Bodenpflege und nicht zuletzt die Gieß- und Bewässerungsmethoden. Grob über den Daumen gepeilt, können für 20 Quadratmeter Gemüsefläche 8 000 bis 12 000 Liter Gießwasser im Jahr nötig werden, also bis zu 12 Kubikmeter.
Das belastet deutlich die Wasserrechnung, wenn man ganz auf Leitungswasser angewiesen ist. Zudem ist das Trinkwasser, das überwiegend aus dem Grundwasser gewonnen wird, ein wertvolles Gut, das in manch trockenen Jahren schon recht knapp wurde. Im Hinblick auf die Wasserqualität und Schadstoffarmut hat das Trinkwasser aus der Leitung natürlich die Nase weit vorn. Ein Problem ist aber vielerorts die hohe Wasserhärte, vor allem die Carbonathärte, die dann auch mit einem hohen Kalkgehalt und pH-Wert (siehe Seite 46) einhergeht. Bei kalkempfindlichen Arten wie Heidel- und Preiselbeeren kann hartes Wasser auf Dauer Wuchs und Fruchtbildung beeinträchtigen, aber auch für die meisten anderen Pflanzen ist es nicht gerade „bekömmlich“. Über die Härte Ihres Trinkwassers kann Ihnen Ihr Wasserversorgungsunternehmen oder die Gemeindeverwaltung Auskunft geben. Meist betreiben die Wasserversorger auch Websites im Internet und nennen dort die regionalen Härtebereiche. Die Gesamthärte wird heute in Millimol Calciumcarbonat pro Liter (mmol/l) angegeben. Häufig findet man aber auch noch die ältere, vertraute Unterteilung nach deutschen Härtegraden (°dH).
Liegt die Gesamthärte im Härtebereich 3 beziehungsweise „hart“ (mehr als 14 Grad deutsche Härte), kann der Einbau einer Wasserenthärtungsanlage sinnvoll sein. Das beugt in erster Linie Verkalkungen in Rohren und Haushaltsgeräten vor und verbessert den Wassergeschmack, kommt nebenbei aber auch den Pflanzen zugute. Zudem beugt es Kalkverstopfungen in Tropfern vor, falls Bewässerungssyteme verwendet werden. Im Allgemeinen empfehlen sich Enthärtungsanlagen auf Ionenaustausch-Basis, am besten mit einem DVGW- oder DIN-Zertifikat, das für geprüfte Wirksamkeit und Qualität steht.
Ein Brunnen, der aus dem Grundwasser gespeist wird, kann Wasserkosten sparen und zum Beispiel mit einer schönen Natursteinumrandung auch optisch etwas hermachen.
REGENTONNEN GUT BEDECKT HALTEN
Regentonnen sollten mit einem Deckel ausgestattet sein. Er beugt der Verschmutzung, etwa durch Falllaub, vor, bewahrt Kleintiere vor dem Ertrinken und dämmt auch ein wenig die Stechmücken ein, die leider gern in solchen Tonnen brüten. Zur aktiven Bekämpfung von Stechmückenlarven bietet der Fachhandel biologische Präparate (mit dem Bacillus thuringiensis israelensis) an, die einfach in die Regentonne gegeben werden. In typischen „Schnakengebieten“, etwa am Rhein, gibt es solche Präparate teils auch bei den Gemeindeverwaltungen.
Zuerst sollte man aber bei der Unteren Wasserbehörde (bei der zuständigen Kreis- oder Stadtverwaltung) nachfragen, ob für die Brunnenbohrung eine Genehmigung oder nur eine Anzeigepflicht erforderlich ist. Es ist sehr ratsam, für solch ein Projekt eine Fachfirma mit entsprechender Erfahrung heranzuziehen. Die kann zunächst einmal feststellen, ob überhaupt genug Grundwasser im Untergrund zur Verfügung steht und, wenn ja, ob es leicht zu nutzen ist oder aufwendigere Technik und höhere Kosten nötig werden. Steht das Grundwasser erst ab sechs Meter Tiefe an, lohnt sich der Brunnenbau meist nicht.
Zudem empfiehlt sich im Vorfeld eine Wasseruntersuchung auf Nitrat, Chlorid, Pestizidreste, Schwermetalle und andere Schadstoffgehalte sowie eventuelle Krankheitserreger (coliforme Keime, Bakterien). Erkundungsbohrung und gründliche Wasseranalyse können sich schon auf einige Hundert Euro summieren. Zur Untersuchung mancher chemischer Kennwerte wie Wasserhärte, pH-Wert, Nitrat- und Eisengehalt bietet der Fachhandel Testsets an. Ebenso wie das Leitungswasser ist auch das über Brunnen geförderte Grundwasser oft recht hart; in dem Fall kann zum Beispiel ein geeignetes Wasseraufbereitungsmittel helfen. Braune oder rote Verfärbungen zeigen meist hohe Eisen- und Mangangehalte an, die auf Dauer Rohre und Schläuche stark verunreinigen können, sofern kein entsprechender Filter eingesetzt wird. Beachten Sie unbedingt, dass sich Brunnenwasser ohne gründliche Wasseruntersuchung, -reinigung und -aufbereitung nicht zum Trinken eignet.
REGENWASSER: VON OBEN FREI HAUS
Kostenlos, schon mit wenigen Investitionen nutzbar, für die Pflanzen angenehm weich und meist recht gut temperiert: Wer Regenwasser im Garten speichern und nutzen kann, verfügt über eine der besten Lösungen. Zunächst braucht es dafür natürlich eine Auffangmöglichkeit, in Form von Dachrinnen, die das Nass über Fallrohre in Sammelbehälter leiten. Ein großes Hausdach ist ideal, aber Rinnen lassen sich bei Bedarf auch an Gartenhäusern, Geräteschuppen und Gewächshäusern anbringen. Abzuraten ist allerdings vom Sammeln von Kupfer- und Zinkdächern, ebenso von Teerpappe mit Bitumenabdichtung. In diesen Fällen können Schadstoffe ins Gießwasser gelangen.
Eine Regenwassertonne mit Deckel und direktem Zulauf von der Regenrinne (Fallrohrklappe)
Aber auch auf anderen Dächern sammeln sich zumindest Schmutzstoffe an, wie Staub, Ruß, Ziegelabrieb und organische Stoffe. Deshalb sollte man den ersten Regenguss nach längerer Trockenheit besser nicht nutzen und in die Kanalisation ablaufen lassen. Wo sich häufig zum Beispiel Laubreste oder auch Vogelkot ablagern, ist regelmäßiges Reinigen der Rinnen ratsam. Regensammler mit guten Filtern können zwar manch Fragwürdiges beseitigen – aber auch danach eignet sich das gesammelte Nass keinesfalls zum Trinken! Wegen besserer Abgasreinigung und schwefelarmer Kraftstoffe droht in unseren Breiten kaum noch der sehr saure Regen, der früher viel Schaden anrichtete. Unabhängig davon sind die Niederschläge von Natur aus leicht sauer – und deshalb weich und kalkarm, was den Pflanzen gut bekommt. Allerdings muss deshalb der Boden gelegentlich etwas aufgekalkt werden, damit er nicht versauert, also sein pH-Wert allzu stark abnimmt (siehe Seite 46).
Einfache Wassertonne, in der eine Gießkanne durch ein beherztes Eintauchen schnell befüllt werden kann
Das Angebot an Sammelbehältern ist gewaltig. Grundsätzlich unterscheidet man oberirdisch aufgestellte oder angebrachte Behältnisse, meist mit Zapfhähnen, und unterirdische Tanks oder Zisternen, aus denen das Nass zum Beispiel über pumpenbetriebene Wassersäulen entnommen wird. Meist bestehen sie aus kräftigem Kunststoff, Zisternen können auch betoniert werden. Oberirdische Tonnen, Amphoren oder schmale Säulen fassen oft nur 200 Liter Wasser, lassen sich aber häufig über Verbindungssets miteinander koppeln.
Ab 500 Liter Fassungsvermögen werden die Gefäße als Tanks bezeichnet. Zunehmend häufiger sieht man quaderförmige IBC-Tanks aus weißem Kunststoff mit Stahlgitterrahmen, angebracht auf Paletten. Es handelt sich meist um recht preiswerte, gebrauchte, gereinigte Industrietanks, die sehr robust sind und sich gut übereinander stapeln lassen.
Je nach Material sollten oberirdische Tanks vorm Winter teilweise oder ganz entleert werden, wenn anhaltende starke Fröste drohen, oder zumindest mit geeigneten Schutzhüllen überzogen. Andernfalls kann gefrierendes Wasser zu Rissen in den Kunststoffwänden führen. Nach einer vollständigen Leerung bietet es sich an, die Behältnisse gründlich zu säubern und Schlammreste zu entfernen.
Bei unterirdisch eingebauten Zisternen, die 5 000 Liter und mehr speichern können ist die Reinigung aufwendiger, fällt aber nur alle fünf bis zehn Jahre an. Hier besteht keine Gefahr, dass das gespeichertes Wasser über Winter gefriert. Es schadet aber nichts, die Tanks gelegentlich überlaufen zu lassen, damit Schmutzteilchen an der Wasseroberfläche abgeschwemmt werden. Andernfalls können sich verstärkt Algenbeläge bilden und unangenehme Gerüche entstehen. Deshalb sollten die Behältnisse auch nicht übermäßig groß bemessen werden. Viele Gartenbesitzer schätzen mittlerweile Flachtanks, die es auch mit mäßigem Fassungsvermögen gibt (zum Beispiel 1 500 Liter). Sie sind einfacher einzubauen als runde oder zylindrische Tanks, und dies selbst bei felsigem Untergrund.
SCHADSTOFFE IN SCHLÄUCHEN?
Die meisten Gartenschläuche bestehen aus Polyvinylchlorid (PVC) und sind innen durch ein synthetisches Gewebe verstärkt. Leider wird das PVC erst durch größere Mengen an Weichmachern (Phthalaten) biegsam und elastisch, außerdem enthält es teils schwermetallhaltige Stabilisatoren. Manche Hersteller erproben alternative Weichmacher, die aber auch nicht völlig unbedenklich sind. Ähnliches gilt für Schläuche aus synthetischem Kautschuk (EPDM), die früher als schadstofffrei eingestuft wurden. Von all diesen Materialien droht keine direkte „Giftwirkung“, aber es besteht zum Beispiel die Gefahr, dass sie hormonelle Veränderungen hervorrufen. Teils wird deshalb sogar empfohlen, beim Gemüse auf teure Trinkwasserschläuche umzusteigen. Jedenfalls sollte man Wasser, das bei hohen Temperaturen mehrere Tage im Schlauch gestanden hat, besser nicht für Nutzpflanzen verwenden.
Schlauchwagen (1), Schlauchtrommel (2) und Führungsrollen (3) erleichtern die Arbeit mit langen Schläuchen.
Das Wasser aus größeren Regensammelbehältern und aus Brunnen kann mithilfe eines sogenannten Hauswasserautomaten ebenso bequem genutzt werden wie das Nass aus der Trinkwasserleitung. Hauswasserautomaten bestehen aus einer Pumpe und einem Steuerungssystem. So lässt sich mit ihnen das Wasser gut über Rohre und auch über verschiedene Stränge verteilen. Für einen reibungslosen Betrieb empfiehlt sich der Einsatz geeigneter Schmutzfilter.
Die gute alte Gießkanne ist nach wie vor ein unverzichtbares Hilfsmittel, besonders dort, wo eine sehr gezielte Wasserversorgung gefragt ist. Mehrere Kannen in verschiedenen Größen (hauptsächlich mit 5–15 Liter Fassungsvermögen) gehören zur Standardausstattung im Garten. Kunststoffkannen sind vergleichsweise leicht und können auch recht lange halten, wenn man beim Kauf ein wenig auf Qualität achtet und sie pfleglich behandelt. Kannen aus Edelstahl, Zink oder verzinktem Blech haben eine längere Lebensdauer und sehen zudem oft hübsch aus.
Vieles lässt sich mit dem Schlauch erleichtern, besonders auf größeren Flächen und wenn sich keine Wasseranschlüsse in nächster Umgebung finden. Mit passenden Brausenaufsätzen, bei denen sich Wasserdruck und Art des Strahls einstellen lassen, oder entsprechenden Gießstäben kann man auch per Schlauch bedarfs- und zielgerecht bewässern. Gartenschläuche werden meist in Längen zwischen 10 und 50 Metern angeboten. Wählen Sie im Zweifelsfall lieber einen etwas längeren Schlauch – etwas Reserve für die in der Praxis oft nötigen Umwege bei der Schlauchführung kann nicht schaden.
Billigschläuche, die häufig umknicken, verknoten und bald spröde werden, lohnen sich unterm Strich nicht. Qualitäts-Gartenschläuche sind UV- und witterungsstabil, abrieb- und knickfest, frei von Schwermetallen wie Blei und Kadmium, halten einen Berstdruck von mindestens 20 bar aus und werden mit einer Herstellergarantie von wenigstens acht Jahren angeboten. Mittlerweile findet man in der Werbung auch öfter das Prädikat „hitzebeständig“. Trotzdem ist es ratsam, Schläuche und Schlauchwagen besser im Schatten aufzubewahren – und besonders bei starker Hitze die Schläuche vollständig zu entleeren.
Tropf- oder Perlschlauch zur wassersparenden Bewässerung im Gemüsebeet
Meist sind die Schlauchanschlüsse auf Wasserhähne mit einem Außengewinde von ½ oder ¾ Zoll ausgelegt; bei „Anpassungsschwierigkeiten“ gibt es verschiedene Adapter. Neben diversen Gieß- und Brauseaufsätzen sind Schlauchwagen, -trommeln und -führungsrollen nützliche Anschaffungen für den bequemen Umgang mit langen Schläuchen.
SPEZIELLE GIESSHILFEN
Altbekannte Gießhilfen sind Regner oder Sprenger, vor allem für den Rasen. Sie können zwar auch für Beete eingesetzt werden, allerdings ist der Wasserverbrauch wegen der hohen Verdunstungsrate beträchtlich. Bei warmem Wetter „verdampft“ weitaus mehr in die Luft, als bei den Wurzeln der Gemüse ankommt. Außerdem können das ständige Benässen der gesamten Pflanzen und die Erhöhung der Luftfeuchtigkeit die Ausbreitung von Pilzkrankheiten fördern. Fazit: Im Nutzgarten höchstens als gelegentliche Ergänzung oder „Notfalllösung“ empfehlenswert, in erster Linie für Flachwurzler wie Salate, Spinat und Radieschen.
Ein besseres Prinzip bieten Bewässerungsringe, auch für Tiefwurzler wie Tomaten. Solche halb in den Boden eingesenkte, kräftige Kunststoffringe mit 20 bis 30 Zentimeter Durchmesser sorgen dafür, dass das eingegossene Wasser direkt an die Wurzeln geleitet wird. Sie sollen sich auch sehr gut für Gurken, Zucchini, Bohnen und andere Gemüse eignen. Ähnliche Bewässerungsringe mit größerem Durchmesser werden für junge Bäume angeboten, auch für Obstbäume.
Für diese gibt es außerdem Bewässerungssäcke. Die werden um den Stamm gelegt, mit einem Reißverschluss fixiert und mit Wasser befüllt. Sie haben an den Unterseiten kleine Ablauflöcher, über die sie das Nass über mehrere Stunden tröpfchenweise abgeben. Das scheint sich aber eher für junge Stadtbäume mit beengtem Wurzelraum zu eignen. Obstbäume und andere Gartengehölze entwickeln bei dieser Methode hauptsächlich oberflächennahe Wurzeln. Sie sollten aber auf Dauer besser ein möglichst tief und weit reichendes Wurzelsystem entwickeln.
Bei einer Tröpfchenwässerung wird das Nass in Tropfenform direkt auf den Boden neben den Pflanzen verteilt, entweder durch Einzeltropfer (oft mit Feuchtigkeitsfühlern) an dünnen Verteilerschläuchen oder durch sogenannte Tropf- oder Perlschläuche mit kleinen Perforierungen oder Düsen, die man entlang der Reihen auslegt. Diese Methode spart sehr effektiv Wasser und beugt zudem dem Auswaschen von Nährstoffen vor.
Für Pflanzen mit hohem Wasserbedarf und tief reichenden Wurzeln ist allerdings eine kräftige Durchfeuchtung des Bodens mittels Kanne oder Schlauch günstiger. Zudem müssen manche Tropfer öfters gereinigt werden. Während sich Tropfschläuche auch für größere Flächen eignen, lassen sich Systeme mit Einzeltropfern besser für kleine Beete, im Gewächshaus oder für Pflanzen in Topfkultur einsetzen.
Tröpfchenbewässerung oder auch Regner können gut als automatische Bewässerung betrieben werden: im einfachsten Fall mithilfe einer Zeitschaltuhr, in der raffinierten Variante mit einem Bewässerungscomputer, der das Ganze in Verbindung mit Feuchtesensoren (Tensiometern) im Boden steuert. Des Weiteren gibt es Bewässerungssysteme, bei denen die Tropfer zugleich auch Feuchtefühler sind; hier regulieren entweder druckempfindliche Membranen in Tonkegeln oder Quellhölzer in den Tropfern die Wasserabgabe. Solche Systeme brauchen weder Steuerungselektronik noch Strom. So oder so sollte man sich vor einer Anschaffung und Installation gründlich über die verschiedenen Systeme und ihre Erfordernisse (zum Beispiel Wasserdruck, nötige Ventile) informieren.
Während einer längeren Urlaubsabwesenheit ist es ideal, wenn freundliche Bekannte oder Nachbarn regelmäßig nachsehen – schließlich muss ständig die Wasserzuleitung aufgedreht bleiben. Eine Alternative bietet der Anschluss an einen genügend großen Vorratsbehälter, der dann wiederum entsprechend mit Pumpen und Filtern ausgestattet werden muss.
Komplizierte Steuermechanismen sind für Ollas nicht nötig: Dabei handelt es sich um in den Boden eingegrabene Tongefäße. Diese geben über ihre porösen Wände nach und nach Wasser an die umgebende Erde ab und damit an die Wurzeln. Ob diese Bewässerungshilfen ursprünglich aus Asien, Afrika, Amerika oder dem Mittelmeerraum stammen, ist unklar. Ihr Name kommt jedenfalls aus dem Spanischen und heißt übersetzt einfach „Topf“. Seit Jahrhunderten bewährt in trockenen Regionen, haben die Ollas mittlerweile auch hierzulande viele Fans. Man gräbt die bauchigen, unglasierten Tontöpfe so tief in Erdbeete oder Hochbeete ein, dass oben nur der Einfüllstutzen herausschaut. Eine Olla mit etwa fünf Liter Inhalt kann einen Quadratmeter Beetfläche bis zu vier Tage lang versorgen – wassersparend und je nach Höhe 15 bis 30 Zentimeter tief. Das lässt sich leicht auch mit zwei unglasierten Tontöpfen nachahmen, die man mit ihren Öffnungen aufeinander stellt und mit Silikon oder Wachs zusammenklebt. Das Abflussloch des unteren Topfs wird verschlossen, das obere wird zum Einfüllloch für das Wasser.
Höchste Zeit, dass die Keimlinge ins Beet kommen
FRÜHBEETE: PRAKTISCHE ANBAUHILFEN
Frühbeete eignen sich vor allem für den zeitigen Frühjahrsanbau sowie den Herbstanbau von nicht allzu hoch wachsenden Gemüsen; außerdem für die frühe Anzucht aller Arten, die keine besonders hohen Temperaturen brauchen. Über den Sommer kann man sie zum Beispiel – ohne Fensterabdeckung – für die platzsparende Anzucht von Herbst- und Wintergemüse nutzen, über den Winter, gut isoliert, auch zur Lagerung von Gemüse. Saaten und Jungpflanzen in Frühbeeten müssen häufig gegossen und öfter belüftet werden. Deshalb sollte der Standort vom Haus möglichst gut erreichbar sein. Sehr vorteilhaft ist ein etwas geschützter Platz, der vor allem zwischen Herbst und Frühjahr viel Licht abbekommt.
Käufliche Frühbeetkästen sind als recht einfach zu montierende Bausätze erhältlich: meist mit Gestellen aus Aluminium, seltener aus Holz oder Kunststoff, und üblicherweise mit UV-geschützten Stegdoppelplatten als Abdeckung. Auch die Seitenwände bestehen in der Regel aus solchen gut isolierenden Kunstglasplatten, sodass rundum eine gute Belichtung gewährleistet ist. Im Fachhandel findet man zahlreiche Größen- und Modellvarianten, die sich teils durch Verlängerungen erweitern lassen. Zumindest die kleineren Kästen können meist leicht umgesetzt und so als „Wanderkästen“ verwendet werden. Kästen mit 100 Zentimeter Länge erlauben schon eine sinnvolle Nutzung, doch wenn der Platz reicht, erweisen sich wenigstens 150 Zentimeter oft als vorteilhaft. Günstige Breiten beziehungsweise Tiefen für Einfachkästen sind 80–90 Zentimeter. Die Vorderwand beziehungsweise die Längsseiten der Kästen sollten wenigstens 30 Zentimeter hoch sein.
Beim üblichen Einfachkasten ist die Rückwand etwa 10 Zentimeter höher als die Vorderwand, sodass die Abdeckscheibe wie bei einem Pultdach aufliegt.
Bei Doppelkästen überragt eine Mittelachse die gleich hohen Vorder- und Rückwände; wie bei einem Satteldach liegen hier zwei Scheiben auf, die getrennt geöffnet werden können und so einen Zugang von beiden Seiten möglich machen. Einfachkästen stellt man mit den Längsseiten am besten in Ost-West-Richtung auf, Doppelkästen in Nord-Süd-Richtung.
Sofern automatische Fensteröffner nicht schon zur Grundausstattung gehören, kann man diese nachkaufen. Als weiteres Zubehör gibt es bei Bedarf Heizmatten oder -kabel sowie Solarwärmespeicher für Frühbeete; nicht zu vergessen die Noppen- oder Luftpolsterfolie für eine zeitweilige Zusatzisolierung an kalten Wintertagen.
Frühbeete der Marke Eigenbau ermöglichen besonders individuelle Lösungen. Ein Einfachkasten mit einem Gestell aus vier druckimprägnierten Holzbrettern ist schnell gebaut, und geeignete Verbindungswinkel und Scharniere gibt es in jedem Baumarkt. Etwas schwieriger wird es allerdings mit der Abdeckung, sofern Sie nicht gerade über geeignete ausrangierte Fenster verfügen, einen Schreiner beauftragen wollen oder sich selbst das Rahmen der Scheiben zutrauen. „Fertige“ Frühbeetfenster mit Glasscheiben werden meist nur vom spezialisierten Fachhandel für Erwerbsgärtner angeboten.
STEGDOPPELPLATTEN: BELIEBTER GLASERSATZ
„Richtige“ Glasscheiben für Frühbeet und Gewächshaus haben immer noch ihre Liebhaber, aber auch Nachteile: die Bruchgefahr und vor allem die geringe Wärmedämmung. Effektives Isolierglas wiederum ist schwer und zudem recht teuer. Deshalb sind schon länger die Stegdoppel- oder Hohlkammerplatten aus Polycarbonat oder Acrylglas auf dem Vormarsch. Bereits ab vier bis fünf Millimeter Stärke haben sie aufgrund der in ihnen eingeschlossenen Luft einen Isoliereffekt; 16 Millimeter dicke Platten bieten dann schon eine sehr effektive Wärmedämmung. Gute Stegdoppelplatten für draußen sind UV-Licht-beständig, wetter- und hagelfest und meist mit einer Garantie von zehn Jahren versehen. Teils werben die Hersteller auch mit besonderen Beschichtungen, die die Kondenswasserbildung oder das Anlaufen der Scheiben verhindern.
An warmen Tagen müssen Frühbeete belüftet werden.
Eine Alternative sind UV-geschützte Stegdoppelplatten aus transparentem Kunststoff, die sich recht leicht zusägen und mit passenden Aluprofilen einfassen lassen.
GEWÄCHSHAUS: GUT BESCHÜTZT
Ein Gewächshaus bietet noch weit mehr Möglichkeiten als ein Frühbeet und erlaubt einen Gemüse- und Kräuteranbau rund ums Jahr. Das beginnt mit der zeitigen Anzucht von Jungpflanzen und ersten Ernten schon im Vorfrühling und erstreckt sich bis zur Ernte vielfältiger Wintersalate und -gemüse. Kälteempfindliche Arten wie Auberginen, Melonen, Chilis und Okras gedeihen hier viel sicherer als draußen. Wird das Haus von Herbst bis Frühjahr frostfrei gehalten und mäßig beheizt (auf etwa 5–12 Grad Celsius), lassen sich zudem kälteempfindliche Nutzpflanzen im Kübel überwintern. So können auch Granatäpfel, Zitrusfrüchte, Maracujas und Chinesische Datteln (Jujuben) heranreifen, mit etwas Geduld und Glück sogar kleine Bananen und Mangos.
Vor dem Kauf empfiehlt es sich, gut zu überlegen, wie das Gewächshaus genutzt werden soll, wie viel Platz dafür zu Verfügung steht und wo es am besten hinpasst. Der Standort sollte sonnig, etwas windgeschützt und vom Haus möglichst gut erreichbar sein, am besten über einen befestigten Weg. Beachten Sie, dass bei Gewächshäusern die ortsüblichen Mindestabstände zum Nachbargrundstück einzuhalten sind. Bei sehr großen Bauten kann zudem eine Bauanzeige oder -genehmigung nötig werden. Empfehlenswert ist von vornherein das Einplanen von Wasseranschlüssen am oder im Gewächshaus, teils auch von Strominstallationen (die man unbedingt Fachleuten überlassen sollte) sowie eine Verbindung mit der Zentralheizung des Wohnhauses, falls eine intensive Nutzung über Winter vorgesehen ist.
Soll das Gewächshaus vor allem der Anzucht dienen, können vier bis fünf Quadratmeter Grundfläche reichen; ist zudem ein geschützter Anbau in Beeten vorgesehen, sollten es wenigstens acht bis zwölf Quadratmeter sein, für eine sehr vielfältige Nutzung darf es gern doppelt so groß werden. Als Firsthöhe empfehlen sich mindestens 2,20 Meter.
Im Garten frei stehende Häuser bieten den Vorteil, dass sie von allen Seiten gut belichtet sind. Dafür profitieren Anlehnhäuser, die an der Hauswand montiert werden, von der Wärmeabstrahlung der Fassade und lassen sich auch wie ein Wintergarten nutzen. Anlehnhäuser werden meist mit einem nach vorn abfallenden Pultdach und drei senkrechten Wänden konstruiert. Bei frei stehenden Häusern dominieren Modelle mit Satteldach, also mit zwei geneigten Dachflächen. Daneben gibt es tunnelartige Rund- und Spitzbogenhäuser sowie Sonderformen wie Gewächshaus-Pavillons.
Das vielfältige Angebot reicht von recht preiswerten Foliengewächshäusern bis zu aufwendigen „Nobel-Gewächshäusern“ mit Holzrahmen und kräftiger Isolierverglasung. Doch die meisten Gartenbesitzer bevorzugen die verbreitete Bauweise mit einer Rahmenkonstruktion aus witterungsbeständigem Aluminium sowie Stegdoppelplatten (Hohlkammerplatten) für Bedachung und Seitenwände. Die Platten sollten wenigstens 6 Millimeter dick sein; bei 16 Millimeter Stärke genügen sie höchsten Ansprüchen.
Sehr wichtig sind ausreichende Belüftungsmöglichkeiten: Mindestens 10 Prozent der Glasfläche beziehungsweise 20 Prozent der Gewächshausgrundfläche sollten sich zum Lüften öffnen lassen – dies am besten über automatische Fensteröffner.
Als Fundament der Konstruktion dient meist ein Aluminium- oder Stahlrahmen, der im einfachsten Fall mit kräftigen Erdankern am Boden befestigt wird. Bessere Standfestigkeit gewährleisten jedoch das Aufschrauben auf Platten oder betonierte Punktfundamente. Für größere, beheizte Gewächshäuser ist ein durchlaufendes Streifenfundament aus Beton die beste Lösung.
Foliengewächshäuser sind mit UV-stabilisierter, kräftiger Folie bespannt und ähneln so großen Folientunneln. Höherwertige Modelle mit solider Stahlrohrkonstruktion und meist mit Polyethylenfolie als Abdeckung zeigen dagegen schon „richtigen“ Gewächshauscharakter, teils sogar mit Lüftungsfenstern. Ansonsten erfolgt hier das Lüften über die Türen, die entsprechend groß sein sollten, oder aufklappbare Vorder- und Rückseiten. Die tragenden Rohre lassen sich im Boden verankern oder auch mit Punktfundamenten einbetonieren.
Zum hilfreichen und praktischen Gewächshauszubehör gehören Stelltische und Regale, die bereits erwähnten automatischen Fensteröffner, Minimum-Maximum-Thermometer und Hygrometer sowie spezielle Pflanzen- und Vermehrungsleuchten. Besonders wichtig sind Schattiermatten und -netze für prallsonnige Frühlings- und Sommertage. Gewächshaus-Ventilatoren können helfen, übermäßigen Hitzestau zu vermeiden. Die Luftbewegung beugt zudem dem Ausbreiten von Pilzkrankheiten und Schimmel vor.
Überwintern Salate, Spinat, Wirsing, Lauch und ähnlich robuste Gemüse im Gewächshaus, reichen oft schon eine gute Isolierung und, wenn nötig, eine innen angebrachte Luftpolsterfolie, um sie gut über kalte Tage zu bringen. Noch sicherer hilft ein sogenannter Frostwächter, der einschaltet, sobald die Temperaturen unter fünf Grad Celsius fallen. Je nach Wärmebedarf der „Überwinterer“ können außerdem gewächshaustaugliche Elektro- oder Propangasheizungen eingesetzt werden, die gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser geschützt sind. Auch Heizkörper, die an die Zentralheizung angeschlossen werden, müssen für diesen Zweck feuchtraumgeeignet sein.
GARTENGERÄTE, HILFSMITTEL UND ZUBEHÖRGute Gartengeräte können die Arbeit spürbar erleichtern – und im Angebot der Gartencenter, Baumärkte, Gartenbedarf- und Werkzeugversender herrscht wahrlich kein Mangel. Was brauchen Sie wirklich?
Selbst große Supermärkte und Discounter warten teils mit brauchbaren Geräten auf. Die Angebotsvielfalt nutzt man am besten, indem man nicht das erstbeste Gerät kauft, sondern sich ein wenig Zeit nimmt, um ein paar verschiedene Werkzeuge und Ausführungen zu vergleichen.
Ob die Geräte stabil und gut verarbeitet sind, ob sich bequem mit ihnen arbeiten lässt – das kann man natürlich beim Direktkauf besser überprüfen als bei Versandprodukten. Zumindest für eine erste Orientierung ist deshalb der Besuch entsprechender Geschäfte ratsam.