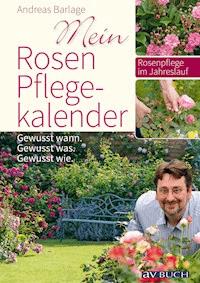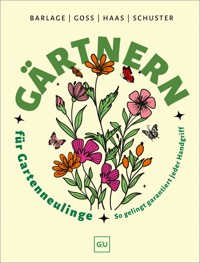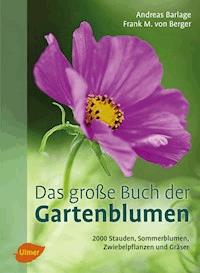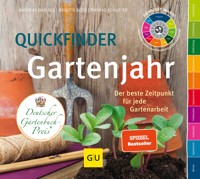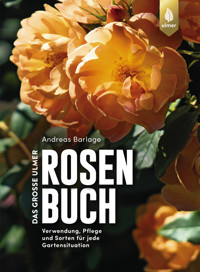
31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Eugen Ulmer
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Träumen Sie von einem blühenden Rosenparadies in Ihrem Garten? Mit diesem Buch steht Ihrem Glück nichts mehr im Weg! Rosenexperte Andreas Barlage nimmt Sie mit auf eine spannende Reise durch die faszinierende Welt der Rosensorten und hilft Ihnen, sich in dem immensen Angebot zurechtzufinden. Egal, ob Sie einen majestätischen Rambler oder eine entzückende Zwergrose suchen – hier finden Sie die perfekte Sorte für Bogen, Wand, Beet, Hecke oder Kübel! Mit wertvollen Tipps aus seinem reichen Erfahrungsschatz begleitet Sie der Autor bei Kauf, Pflege, Vermehrung, Schnitt und Behandlung Ihrer Rosen. So wird Ihr Garten zum langlebigen, blühenden und insektenfreundlichen Rosenparadies.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jedem Anfang ist ein Zauber inne – so auch der aufblühenden Rugosa-Rose ‘Blanc Double de Coubert’ von Cochet-Cochet aus dem Jahre 1892.
Inhalt
ROSEN IM GARTEN PFLEGEN
Was braucht eine Rose?
Am Anfang stand die Essig-Rose
Der Charme der Wilden
Mannigfaltige Blütenformen
Feine Früchtchen und spitze Stacheln
Rosen fallen nicht vom Himmel
Hauptsache gesund!
Wie werden Rosen vermehrt?
Augen auf beim Rosenkauf
So geht’s nach dem Pflanzen weiter
Wenn etwas schief geht
Vorsorge vor kalten Monaten
MIT ROSEN GÄRTEN GESTALTEN
Es gibt immer die richtige Rose
Rosenfarben richtig kombinieren
Wandelbare Kletterrosen
Die Klassenbesten:
Einmal blühende Rambler
Kletterrosen mit großen Edelblüten
Kletterrosen für die Hauswand
Kleinblumige Bogenkletterer
Mehrfach Blühendes von Austin
In guter Begleitung:Auf in die dritte Dimension
Lebende Legenden
Die Klassenbesten:
Gallica-Rosen
Alba- und Damaszener-Rosen
Zentifolien und Moos-Rosen
Öfter blühende Alte Rosen
Das Ätherische der Rose
Die Krönung: Stammrosen
Die Klassenbesten:
Rosen für Kaskadenstämme
Duftendes für Hochstämme
Edel- und Beetrosen für Hochstämme
Kompakte Rosen für Halbstämme
In guter Begleitung:Blütenteppiche unter Stammrosen
Rosen als Heckenpflanzen
In guter Begleitung:Stauden als Lückenfüller
Die feinsten Strauchrosen
Die Klassenbesten:
Elegante Moschata-Hybriden
Rugosa-Rosen
In guter Begleitung:Begleiter für rustikal wirkende Rosenhecken
Hagebutten, ganz schön gesund!
Die Klassenbesten:
Halbhohe, öfterblühende Strauchrosen für Hecken
Stauden für den nostalgischen Hecken-Look
Beetprägende Strauchrosen
Die Klassenbesten:
Strauchrosen als prägende Beetpflanzen
In guter Begleitung:Prachtstauden zu Strauchrosen
Die Klassenbesten:
Rosen, die zwischen April und Ende Mai blühen
In guter Begleitung:Frühlingsrosen inszenieren
Edelrosen – aufrechte Blüteneleganz
Die Klassenbesten:
Edelrosen mit hoher Blütenform
Edelrosen mit „nostalgischer“ Blütenform
Rosen für die Vase
Elegante Rosen für Formationen
In guter Begleitung:Flankierende niedrige Heckengehölze
Reich blühende Beetrosen für Flächen
Beetrosen für Flächen
Die Klassenbesten:
Beetrosen für Farbflächen
Beetrosen in ihrer ganzen Variationsbreite
In guter Begleitung:Niedrige Stauden zu Beetrosen
Revolution durch „Bodendeckerrosen“
Die Klassenbesten:
Kleinblumige „Bodendeckerrosen“
Hoch wachsende Rosen für Bienen und Co.
Niedrige bienenfreundliche Rosen
In guter Begleitung:Begleitpflanzen, die Insekten nähren
Innovativ und zeitgemäß: Persica-Hybride
Die Klassenbesten:
Persica-Hybriden für alle Fälle
Von Nahem betrachtet: Rosen in Pflanzgefäßen
Die Klassenbesten:
Patio- und Zwergrosen
In guter Begleitung:Hier summt, brummt und flattert es den ganzen Sommer
Ausblick: Wie geht es weiter in der Rosenwelt?
… noch eine Doppelseite mit Rosensortenbeschreibungen
SERVICE
Was soll das heißen?
Bezugsquellen
Literaturverzeichnis
Ohne Euch hätte ich es nicht geschafft!
Bildnachweis
Impressum
Bei den Beschreibungen von Rosensorten und Begleitpflanzen finden Sie folgende Zeichnungen, die auf deren ökologischen Wert hinweisen:
Blüten dieser Rose sind besonders pollenreich und daher sehr bienenfreundlich
Blüten dieser Pflanze liefern Nektar und versorgt Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten
Warum ausgerechnet Rosen?
Ich will gar nicht der Versuchung erliegen, an dieser Stelle ein schwelgerisches Loblied über die Schönheit der Rosen anzustimmen, denn das können Sie selber. Rosen verzaubern seit jeher in ihrer Vielfalt jeden Menschen, der sich nur ein klitzekleines bisschen für Ästhetik allgemein und Pflanzen im Besonderen begeistern lässt.
Lassen Sie mich lieber mal ein paar handfeste Argumente formulieren, die Rosen zu den wertvollsten aller Gartenpflanze machen:
Rosen sind klimafest
Wir alle erleben: Die Zeiten mit einigermaßen berechenbaren, jahreszeitlich eingetakteten Verläufen von Hitze und Regen, Frost und Wärme sind offensichtlich vorbei. Zwar ist es nach wie vor im Winter bei uns kühler als im Sommer, doch in dem Jahr, als dieses Manuskript entstand, habe ich beispielsweise für den 17. Februar Temperaturen um 24 °C und für den 21. April Nachttemperaturen um den Gefrierpunkt in mein Gartentagebuch eingetragen. Die Kamelie draußen verblühte in Rekordzeit, aber zwei Monate später musste ich alle meine fröhlich austreibenden Fuchsien wieder ins schützende Haus stellen, während die Apfelblüte an den Nachbarbäumen erfror. Wir hatten einen regenreichen Frühsommer und Hochsommerwochen, in denen sich treibhausschwüle Tropenhitze mit heftigsten Gewittern abwechselte.
Und die Rosen? Egal ob in Pflanzgefäßen oder im Vorgarten – sie nehmen das alles gelassen. Rosen in Beeten überstehen durch ihre tief reichenden Wurzeln lange Trockenphasen ebenso wie Dauerregen und die besten Sorten haben hitze- wie auch regenfeste Blütenblätter.
Rosen sind ökologisch wertvoll
Wenn Rosen nicht gerade superdicht gefüllt blühen, bieten sie Bienen und vielen anderen bestäubenden Insekten reichlich Blütenpollen als Kraftfutter. Die vielen öfter blühenden Rosensorten decken den Pollentisch von Mai bis Oktober; welche andere Pflanze kann da mithalten?
Belässt man Blüten am Strauch, entwickeln die meisten Sorten Hagebutten, die im Herbst von Vögeln als wertvolle Vitaminquelle verspeist werden. Aber das ist nicht alles: Rosen wachsen jahrzehntelang an Ort und Stelle. Abgesehen von einer einmaligen Bodenaufbereitung vor dem Pflanzen muss man nicht viel am Boden herumwirtschaften – und das begünstigt das so wichtige Bodenleben. Da sich mit den aktuellen Rosensorten chemischer Pflanzenschutz völlig erübrigt, ist es mit ihnen leicht, vor der eigenen Tür ein intaktes Ökosystem zu etablieren.
Rosen sind pflegeleicht
Vielleicht stutzen Sie bei dieser Aussage, denn jedem ist klar, dass Rosen im Laufe des Jahres gärtnerische Zuwendung brauchen. Doch der Begriff „pflegeleicht“ wird schnell mit „pflegefrei“ verwechselt. Aber welche Pflanze, welches Gartenbeet kann wirklich jahrein, jahraus sich selbst überlassen werden? Rosen in ihrer Langlebigkeit sind mindestens genauso unkompliziert wie etwa Stauden. Pflegeleicht bedeutet eher, dass die Pflegeschritte plausibel und einfach durchführbar sind. Wenn man nicht gerade Parks voller Rosen in Schuss halten muss, ist ein Rosenbeet relativ leicht zu handhaben.
Eine Rose passt immer
Das ist das wirklich Einzigartige bei Rosen: Es gibt sie in nahezu allen Wuchshöhen und -formen, in sehr zahlreichen Variationen und Größen der natürlichen Blütenform und in einer Farbenskala bei der nur Blautöne fehlen. Ob Sie ein ganzes Gebäude überwachsen lassen wollen oder eine handliche Kübelpflanze neben ihre Haustür stellen möchten – es gibt für alle Ideen die perfekten Sorten. Die einzige Voraussetzung ist, dass der Pflanzplatz etwa sechs Stunden lang im Sommer von der Sonne beschienen wird.
Das mit den Rosen haben wir ja nun geklärt, doch …
Wozu braucht man ein (neues) Rosenbuch
In Zeiten von YouTube-Tutorials und zahlreichen weiteren Anleitungen, die jederzeit im Internet abrufbar sind, scheint ein dickes, gebundenes Buch veraltet zu sein.
Doch viele Zeitgenossen bevorzugen es, Infos nicht nur häppchenweise bei Bedarf abzugreifen, sondern sich Zusammenhänge zu erschließen. Es ist auf lange Sicht leichter, bei einer ruhigen Lektüre zu begreifen, wie Rosen „funktionieren“, als jedes Mal das Vorexerzierte nachzumachen.
Unsere Team-Aufgabe als „Buchmacher“ ist es, Ihre Lust am Lesen zu erhalten. Wenn wir Ihnen schon zumuten, lange Texte zu lesen, sollen diese praxisnah, verständlich und lebendig sein – und im Buchverlauf laden hier und da großformatige Bilder zum Innehalten und Träumen ein.
Weil das Thema „Rosen im Garten“ alles andere als in Stein gemeißelt ist und sich in Teilen stets weiter entwickelt, wurde „Das große Ulmer Rosenbuch“ nicht einfach mit einem neuen Einband nachgedruckt und die über 160 neuen Fotos sorgen nicht nur für einen neuen Look. Wir haben jede einzelne Seite geprüft und schon im ersten Drittel des Buches, wo es um Historie und Pflege der Rosen geht, einiges aktualisiert oder anders gewichtet – das Rad der Rosenpflege musste selbstverständlich dabei nicht völlig neu erfunden werden. Ganz anders sieht das bei der konkreten Sortenwahl aus. In den letzten sieben Jahren hat sich das Sortiment sehr stark weiterentwickelt – so stark, dass es einige noch vor wenigen Jahren vorgestellte Rosen jetzt praktisch nicht mehr zu kaufen gibt. Das führte dazu, dass rund 200 Seiten, also der Löwenanteil des Buches, sehr umfassend erneuert wurde. Über 117 neue Rosensorten sind nun mit Bild und kurzen oder langen Beschreibungen zu finden. Kapitel wie „Moschata-Hybriden“ und „Rugosa-Rosen“ wurden erweitert und als eigene, neue Themen finden Sie „bienenfreundliche Rosen“ sowie „Persica-Hybriden“.
Ist es nicht faszinierend, wie sich in nur wenigen Jahren allgemeine Schwerpunkte des Interesses an Rosen verschieben können?
Hoffentlich kann ich Ihre Begeisterung für Rosen weiter wach halten und dazu beitragen, dass Ihre Rosenträume Wirklichkeit werden.
In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen und Schwelgen
Die kleine Grundausstattung für Rosengärtner: Neben der Rose selbst (hier ‘Knirps’ von Kordes, 1997) sind Spaten, Rosenstärkungsmittel, Unkrautstecher, Pflanzkelle, Unkrautgrubber, ummantelter Bindedraht, Rosengabel, Dünger und ein Sammelbottich für Abgeschnittenes und Unkraut nützliche Helfer.
ROSEN IM GARTEN PFLEGEN
Zunächst seien Vorüberlegungen, ein kleiner Ausflug in die Botanik und Geschichte zum besseren Verständnis der Ansprüche der Rosen im Garten und Beschreibungen, wie unterschiedlich Rosen aussehen können, gestattet. Viele handfeste, allgemeine Praxistipps runden dieses Kapitel ab. Vertiefende Pflege-Hinweise, die sich auf spezielle Rosengruppen beziehen, folgen an den entsprechenden Stellen im zweiten wesentlich größeren Kapitel „Rosen im Garten verwenden“.
WAS BRAUCHT EINE ROSE?
Unsere Kulturrosen stammen von Wildarten ab, die sich im Laufe ihrer Evolution an bestimmte Standorte angepasst haben. Ihr Naturstandort ist ein Waldrand, ein Gehölzrain oder freies Gelände. Der Boden ist tiefgründig und weder zu sauer noch nährstoffarm. Das lässt Rückschlüsse auf den Gartenplatz aller Rosen zu.
Man kann den idealen Standort einer Rose mit den Worten des Rosenfreundes Konrad Adenauer (1876–1967) zusammenfassen: „Die Rose liebt es warm, aber nicht heiß. Die Rose liebt es feucht, aber nicht nass. Die Rose liebt es luftig, aber nicht zugig.“
Auf den ersten Blick erscheinen diese Vorlieben wie Ansprüche einer Diva. Aber das ist absolut nicht der Fall, denn viele Gartenplätze bieten genau diese Voraussetzungen. Schaut man sich einmal um, wo in den Gärten Rosen am besten gedeihen, erkennt man auf den ersten Blick, dass dort mindestens einen halben Sommertag lang die Sonne scheint. Die üppigsten Rosenstöcke fußen auf fruchtbarem Boden – dort, wo auch Gemüse bestens gedeihen würde. Das Erdreich trocknet also nie völlig aus und liefert ausreichend Nährstoffe.
Reicht das aus? Nicht ganz! Rosen stehen gerne frei. Sie möchten nicht im Wurzelbereich um Wasser und Nahrung konkurrieren. Die direkte Nachbarschaft von Stauden, die Ausläufer bilden, ist beispielsweise ungünstig. Auch über der Erdoberfläche brauchen Rosen eine „freie Bahn“. Grundsätzlich dürfen benachbarte Stauden oder Kletterpflanzen nicht in die Rosenstöcke hineinwachsen. Luft muss durch die Blätter der Rosen hindurchziehen. Nur so trocknet das Laub, sollte es einmal benetzt sein, zügig ab und das ist ein wichtiger Schutz vor Pilzbefall. Den gleichen Effekt hat der freie Himmel über den Rosenpflanzen. Unter der Traufe eines Daches oder der ausladenden Krone großer Bäume fühlen sich Rosen nicht wohl, einmal wegen der Beschattung, zum anderen weil sich Feuchte auf den Rosenblättern nur zögerlich auflöst.
Die bekannteste heimische Rosenart ist Rosa canina, die Hunds-Rose. Hier ist eine Selektion namens ‘PiRo 3’ abgebildet, deren zahlreiche herbstliche Hagebutten einen besonders hohen Vitamin-C-Gehalt haben. Hunds-Rosen gedeihen wild an offenen Standorten. Säen sie sich an schattigen Stellen aus, fangen sie sich fast immer Mehltau ein und wachsen sehr viel sparriger, ehe sie von anderen, für diesen Platz geeigneten Pflanzen verdrängt werden.
Diese hohe Beetrose – oder niedrige Strauchrose, je nach Schnitt – brachte das Züchterhaus Tantau 2013 als ‘Sirius’ auf dem Markt. Sie ist ein Ausbund an Gesundheit und Vitalität. Wenn sie dazu noch sonnig steht und nicht umgeben von Stein oder Beton, die Hitze stark abstrahlen, was die Pflanzen stressen würde und Schädlinge anzieht, wird sie so üppig blühen, wie hier als formale Gruppe in einer Rasenfläche.
Außerdem verlängert Tropfwasser das Risiko einer Infektion mit Blattkrankheiten.
Wer eine Rose in seinen Garten pflanzen möchte, hat vielleicht auch noch die Vorstellung einer wild wachsenden, frei stehenden Hunds-Rose (Rosa canina) auf einem Feld im Sinn und versucht, einen einigermaßen ähnlichen Platz im Garten zu finden.
Besonders Gärten rund um neu gebaute Häuser erweisen sich als sehr rosenfreundlich, da hier vorher noch keine Rosen gestanden haben. Wäre das der Fall, wäre der Boden „rosenmüde“ und die neu gepflanzten Rosen würden weder leben noch sterben. Woran das genau liegt, ist noch nicht einmal von Experten vollends geklärt. Und den Beobachtungen nach ist dieses Phänomen auch nicht auf allen Böden gleichstark ausgeprägt. Gegen Bodenmüdigkeit sollen Mittel helfen, die sie neutralisieren, etwa sogenannte „EM“, das sind Effektive Mikroorganismen, oder Mycorrhiza-Bodenpilze. Beides hat zwar unbestritten einen bodenverbessernden Effekt, doch es ist noch nicht gelungen, genau die Pilzstämme zu extrahieren, die dieses Phänomen bei Rosengewächsen ausgleichen können.
Um sicher zu gehen, dass dort, wo Rosen vorher gestanden haben, eine Rosenpflanzung gelingt, muss der Boden mindestens 80 Zentimeter tief ausgetauscht werden. Bei einem großen Beet sollte man das am besten als eine fröhliche Garten-Aktion ausrufen, ein, zwei starke Kerle aus der Verwandtschaft oder Nachbarschaft einladen und anschließend eine deftige Erbsensuppe austeilen.
Sonnig, absonnig, halbschattig?
Die Lichtverhältnisse in einem Garten werden von Fachleuten mit klar definierten Begriffen bezeichnet.
Vollsonnig: Hier bescheint die Sonne den ganzen Tag das Terrain. Ideal für fast alle Rosen.Halbschattig: Der Platz wird zeitweise von der Sonne beschienen. Für einige Rosensorten reichen sechs Stunden Sonne aus, wenn sie auch besser vollsonnig stehen. Sorten mit dunklen Blüten profitieren sehr davon, wenn die Mittagssonne nicht auf sie glüht, da ihre Blütenblätter verbrennen können. Gleiches gilt für Rosen mit sehr dünnen Blütenblättern, etwa Rugosa-Rosen.Absonnig: Der Gartenbereich ist sehr hell, wird aber indirekt von der Sonne beschienen, etwa durch eine angestrahlte helle Mauer. Für Rosen reicht dieses Licht nicht aus.Lichter Schatten: Hier scheint die Sonne etwa durch das lockere Laubdach eines großen Gehölzes. Das ist kein Standplatz für Rosen.Schatten bzw. Vollschatten: Hier kommt kein Licht hin; es ist eine Pflanzsituation wie in einem geschlossenen Wald und etwas für Waldpflanzen, aber nicht für Rosen.AUSNAHMEN BESTÄTIGEN DIE REGELN
Bitte nehmen Sie diese Überschrift wörtlich. Die nun genannten Ausnahmerosen sind wirklich so zäh, dass sie auch Bedingungen hinnehmen, die sich nicht optimal für Rosen eignen. Und da die Kämpfernaturen wirklich ausgesprochen reizvoll sind, ist das eine sehr gute Nachricht für Rosenfreunde, die ihren Garten voll für Rosen ausnutzen möchten.
Die Gattung Rosa hatte rund 60 Millionen Jahre Zeit, Arten auszubilden, die auch knifflige Standorte bevölkern. Zum Vergleich: Unsere eigenen ältesten Vorfahren gingen allerfrühestens vor 7 Millionen Jahren aufrecht und der moderne Mensch, Homo sapiens, dem wir selbst taxonomisch zugeordnet sind, benutzt sein unschlagbares, 1,2 Liter großes Gehirn seit knapp 200.000 Jahren. Rosen waren also viel eher da als wir. Sie passten sich an zahlreiche Lebensräume der Nordhalbkugel unserer Erde an. Ausgehend vom Orient und dem Kaukasus eroberten sie selbst Gebirge und Küsten.
Küstennähe bedeutet meist, dass der Boden karg ist und immer Wind weht. Hier sind die Rosen daher genügsam und haben so zähe Triebe, dass sie kaum brechen. Zu solchen Überlebenskünstlern zählen etwa die Bibernell-Rose (Rosa spinosissima) und die unverwüstliche Rosa rugosa.
Einige Rosenarten machten sich im Laufe ihres Werdens hohe Gehölze zu Diensten, um an ihnen zum Licht zu klimmen. Das führte zur Entwicklung des enormen Höhenwachstums, und die natürlichen Kletterrosen waren in der Welt. Nicht nur in ihrer Jugendzeit tolerieren sie einen halbschattigen Standort. So wundert es nicht, dass viele Rambler sich für den Halbschatten eignen. Auch Alba-Rosen kommen hier an kleineren Gehölzen voran, sofern der Boden nicht allzu arm ist. In halbschattig gelegenen Beeten lassen sich außerdem auch Moschata-Rosen, Damaszener-Rosen und Gallica-Rosen mit gewissem Erfolg pflegen.
Es ist erstaunlich, wie frohwüchsig die Sorten von Rosa rugosa auch auf sandigen Böden wachsen. Hinzu kommt, dass sie auch steifen Brisen widerstehen. Kein Wunder, dass Rugosa-Rosen nun sogar Nordsee-Inseln besiedeln und gelegentlich sogar „Sylter Rosen“ genannt werden. Sogar eine gewisse Wurzelkonkurrenz, im Bild etwa von der Weidensorte Salix integra ‘Hakuro Nishiki’ nehmen sie gelassen.
Die gut sechs Meter hoch wachsende Rosa helenae mit ihrer verschwenderischen Vielzahl süß duftender Blüten stammt aus China und verträgt halbschattige Standorte recht gut. Diese Eigenschaft hat sie an zahlreiche Sorten weitergegeben, deren Ahnin sie ist. Eine Vielzahl von Ramblern gehört dazu. ‘Lykkefund’ oder ‘Christine Hélène’ sind sehr pflanzwürdige Beispiele dafür.
Die Beispiele zeigen, dass sich die Toleranzschwelle der Rosen-Arten hinsichtlich ihrer Ansprüche von ihrem natürlichen Standort ableiten lassen. Dazu müsste man aber jeweils die Ahnenreihe der Sorte kennen, und das ist angesichts des äußerst komplexen Züchtungsgeschehens, vor allem bei modernen Sorten, kaum noch zu machen. Darum verblüfft die eine oder andere Sorte zuweilen mit Eigenschaften, die man ihr nicht ohne Weiteres zugetraut hätte.
Wie erkennt man die Bodenstruktur?
Um einen groben Überblick zu bekommen, mit welchem Boden man es zu tun hat, nimmt man ihn erstmal in eine Handfläche und reibt dann mit der anderen darüber. Der leichte Sandboden bleibt lose und schmutzt nicht. Das genaue Gegenteil ist Tonboden, denn mit ihm lassen sich kleine Würste formen. Dazwischen steht Schluff-Boden. Schmutzige Hände ohne Tonkunstwerk-Rohlinge sind also ein gutes Zeichen für Rosengärtner: Ihr Boden hält das Wasser, ohne zu vernässen, und stellt ausreichend Nährstoffe bereit.
AM ANFANG STAND DIE ESSIG-ROSE
Seit Anbeginn der (Garten-)Kultur faszinieren Rosen die Menschen. Besonders schöne, reich blühende oder duftende Findlinge in der Natur oder den frühen Gärten wurden durch Stecklinge vermehrt und bildeten bis zur Einfuhr der ersten ostasiatischen Rosenarten den Grundstock der Rosenkultur.
EUROPÄISCHE ROSEN BIS ZUR NEUZEIT
Über die Entstehung der Rosen überhaupt haben sich die Menschen der Antike unterschiedliche Mythen erzählt, die fast immer mit Liebe, Liebesleid, außergewöhnlicher Schönheit oder Rauschzuständen zu tun haben. Sehr bekannt ist die Vorstellung, dass Rosen aus dem gleichen Meeresschaum entstanden sein sollen, der die griechische Liebesgöttin Aphrodite hervorgebracht hat. Eos, die Göttin der Morgenröte hat den Beinamen „rhododaktylos“ – die „Rosenfingrige“. Und der Gott Dionysos, der dankenswerterweise auch den Weinbau erfand, soll sich Rosen als Anti-Rauschmittel gern als Kranz auf den Kopf gesetzt haben.
Abseits aller Sagen lässt sich festhalten, dass Rosen seit knapp 4000 Jahren die Menschen begleiten. Das „Fresko mit dem blauen Vogel“ im Palast von Knossos auf Kreta zeigt unter anderem auch Rosen. Es wurde vor etwa 3500 Jahren angefertigt. Vor etwas mehr als 2500 Jahren bekam die Rose durch die Dichterin Sappho auch den Titel verliehen, den sie seither unangefochten führt: „Königin der Blumen“.
Im östlichen Mittelmeerraum wurden schon in diesen Tagen Rosen zur Gewinnung von Öl, aber auch frischen Blüten kultiviert. Durch den Kulturaustausch im Römischen Reich weitete sich die Rosenkultur nach Nordeuropa aus. Rosen behielten ihren hohen Stellenwert in allen sowohl religiös geförderten als auch weltlich sich emanzipierenden Künsten.
Nach Stand der Forschung ist insbesondere Rosa gallica, die Essig-Rose, die wichtigste Ahnin europäischer Kulturrosen. Von ihr stammen beispielsweise als Naturhybridgruppe die Damaszener-Rosen ab, die wiederum die Alba-Rosen hervorgebracht haben. Und schon bei den drei bereits in der Antike bekannten Rosenklassen zeigt sich, dass sich Rosen sehr gut miteinander kreuzen lassen.
Es gilt als sicher, dass die übermannshoch wachsende, süß duftende ‘Alba Maxima’ bereits vor dem Jahr 1500 in den Gärten gepflanzt wurde. Bis zum heutigen Tag hat sie nichts von ihrer Vitalität verloren und bedeckt bereitwillig sogar Wände im Halbschatten. Über die Jahrhunderte hinweg war sie die Zeugin von Maifeiern und Landhochzeiten.
1586 ist das Jahr, auf das ‘Tuscany’, die auch als „Samt-Rose“ bekannte Gallica-Rose, datiert werden kann (wenn auch nicht als Züchtungsjahr, das wohl deutlich eher anzusetzen ist. Aber zumindest ist sie nachweisbar seitdem in Kultur). Die Blüten auf den knapp mannshohen Sträuchern zählten zu den dunkelsten, die jahrhundertelang bekannt waren, und duften süß. Die farblich sehr ähnliche, jüngere ‘Tuscany Superb’ ist etwas stärker gefüllt.
Später kamen noch Zentifolien und als deren Ableitung Moos-Rosen hinzu. Sie traten etwa im 16. Jahrhundert auf. In dieser Phase selektierten europäische Gärtner vermehrt Sorten aus, die vegetativ durch Stecklinge vermehrt wurden und mit ihren Eigenschaften identifiziert werden können. Besonders flämische Maler des Barock haben sie in ihren schönsten Gemälden verewigt.
Als Lieferantin von Rosenöl hat die seit 1612 bekannte, rein und schwer duftende Damaszener-Rose ‘Trigintipetala’ Geschichte geschrieben. In Bulgarien wird sie unter dem Namen ‘Kazanlik’ noch heute angebaut und liefert einen der kostbarsten Ausgangsstoffe der Parfümindustrie. Die Sträucher erreichen eine Höhe von über zwei Metern.
Bis eineinhalb Meter Höhe erreichen die Sträucher der Zentifolie ‘Petite de Hollande’, die mindestens seit 1791 in nordeuropäischen Gärten wächst. Der belebende Duft ist stark und die Pflanzen blühen reich. Wem der Platz für die hohen Zentifolien fehlt, dürfte diese kompaktere, auch als ‘Pompon des Dames’ bekannte Sorte glücklich machen.
FOLGENREICHER BESUCH AUS FERNOST
Die Handelsbeziehungen vor allem von England und Frankreich mit Ostasien nahmen ab Mitte des 17. Jahrhunderts Fahrt auf. In den kommenden 150 Jahren wurden nicht nur Konsumgüter, sondern auch zahlreiche neu entdeckte Pflanzen nach Europa gebracht. Natürlich fanden auch hier völlig unbekannte Rosen den Weg.
Die Wissenschaften waren auf dem Vormarsch und etwa zwischen 1750 und 1900 fanden bahnbrechende Expeditionen europäischer Forscher statt. Sie bescherten den Heimatländern eine enorme Vielzahl neuer Pflanzen, mit denen eifrig experimentiert wurde. Das ließ auch die Rosenwelt nicht unberührt. Auch wenn die Regeln von Mendels entdeckter Vererbungslehre sich erst nach 1900 wirklich durchsetzten, begannen die Rosengärtner bereits gezielt zu züchten. Sie verließen sich nicht nur darauf, zufällig auf neue Sorten zu stoßen, die Mutter Natur ihnen bot. Muttersorten, die Hagebutten ausbildeten, und Vatersorten, die den Pollen für die Bestäubung lieferten, wurden zusammengebracht. Die Ergebnisse waren vielfach Zufallstreffer. Einige von ihnen gehören zu den schönsten Rosensorten aller Zeiten.
1792 brachte John Parsens diesen Rosenschatz namens ‘Old Blush’ von China nach Europa. Die bis zu drei Meter hohe Sorte führt daher auch den Namen ‘Parson’s Pink China’ als Synonym. Für die europäische Rosenzüchtung ist sie eine höchst bedeutende Sorte. Sehr wahrscheinlich hat sie bereits Generationen vor ihrer „Entdeckung“ in Chinas Gärten geblüht. Sie ist keine reine Wildart, sondern schon ein Ergebnis höchster fernöstlicher Gartenkultur.
Die Züchtungsbestrebungen mussten zunächst gefördert werden. Betriebe, die von der Entwicklung neuer Sorten leben konnten, waren anfangs nicht existenzfähig. Da auch das Beschaffen und Pflegen der bestehenden und neu gekreuzten Rosen kostenintensiv war, fanden viele solche Tätigkeiten in den Schlossgärten von Fürsten und ähnlichen Mäzenen statt, die Gefallen an den Pflanzen gefunden hatten.
Nicht wegzudenken aus dem Züchtungsgeschehen Europas ist der Garten von Joséphine Beauharnais, der ersten Gattin Napoleon Bonapartes. Sie erwarb das Anwesen Malmaison 1799 und legte fünf Jahre später den berühmtesten Rosengarten ihrer Zeit dort an. Alles, was sie an an exotischen Pflanzen, wie auch an Rosen, in die Hände bekommen konnte, pflanzte sie dort an. Aufgrund ihrer hohen Stellung verfügte sie über beste Beziehungen und enorme Mittel. Am Ende stand eine Rosensammlung, die so ziemlich alles in ihrer Zeit Verfügbare aus Europa und Übersee zusammenführte. Ihr Protegée, der Maler Pierre-Joseph Redouté, verewigte die Sammlung der Kaiserin in seinem unsterblichen Werk „Les roses“.
Der größte Wurf des Züchters Pradel war gewiss ‘Maréchal Niel’, die seit 1864 jeden Betrachter in Verzückung versetzt. Farbe, Form, Duftnote – alles war zu ihrem Erscheinen neu und aufregend. Und das so nachhaltig, dass sie bis ins 20. Jahrhundert hinein Inbegriff mondäner Roseneleganz war und noch heute Liebhaber begeistert.
Rudolf Geschwind stellte 1897 seine robuste, duftende ‘Gruß an Teplitz’ vor. Sie erreicht eine Höhe von gut zwei Metern und ist sehr winterhart. Oft wird sie den Bourbon-Rosen oder den China-Rosen zugeordnet, wahrscheinlich aber handelt es sich um eine frühe Tee-Hybride. Das zeigt, wie kompliziert die Klassifizierung einer Rose nur aufgrund ihrer Herkunft mit fortschreitender Züchtung geworden ist.
Mit einer Einführung im Jahr 1976 ist die von Joseph Holmes gezüchtete ‘Sally Holmes’ vergleichsweise jung. Sie knüpft mit ihrer Herkunft und ihrem Aussehen an die Entwicklung der Moschata-Rosen an. Die Blüten sind ziemlich groß, duften leicht und der gut mannshohe Strauch hat sehr gesundes Laub.
Die große Rosenehe
Die größte Revolution der Rosenzüchtung war sicherlich das Kreuzen der einmal blühenden europäischen Rosen mit öfter blühenden neuen Wildarten bzw. Kultursorten aus Fernost. Die sehr unterschiedlichen Kombinationen führten zu einer Vielzahl neuer Rosentypen. Bevorzugt wurde dann mit den entstandenen Rosen weitergezüchtet, die mehrmals im Jahr und zuweilen dauerhaft blühten. Außerdem konnten fast alle Farben entwickelt werden. Die Duftnoten erweiterten sich um honigsüße, würzige und herbe Nuancen. Durch das Hinzukommen hoch gebauter Blütenformen wurde auch der Formenreichtum der Blüten vergrößert.
Neben den Tugenden vererbten die asiatischen Arten aber auch einige Schwächen. So sind sie in Nordeuropa nicht überall zuverlässig winterhart und viele von ihnen duften kaum oder gar nicht. Hinzu kommt, dass das Laub oft anfällig gegenüber Pilzbefall, allen voran Sternrußtau, ist. Von Anfang an versuchten Züchter hier gegenzusteuern – mit gutem Ergebnis. Nie zuvor hat es so viele sehr widerstandsfähige Rosenzüchtungen gegeben.
ES GEHT AUCH FÜR ROSEN IN DIE MODERNE
Mit Kreuzungen von europäischen und mit asiatischen Rosen wurde unendlich viel möglich: Kletternde oder zwergige Spielarten genauso wie solche mit riesigen oder winzigen Blüten. Die Vielzahl der Sorten brauchte dringend ein Ordnungssystem: Sie wurden nach Herkunft, später nach Wuchsform, in Klassen (siehe Glossar) aufgeteilt. Man wurde sich einig, alle Klassen, die vor der Einführung der erste Tee-Hybride existierten, als „Alte Rosen“ zu bezeichnen. Tee-Hybriden und alle nach ihnen entstandenen Rosenklassen zählen somit zu den „Modernen Rosen“.
Das Erscheinen von ‘La France’ von Jean-Baptiste Guillot im Jahr 1867 markiert den Beginn des Zeitalters der Modernen Rosen. Sie gilt als erste Tee-Hybride. Form, Farbe und Duft schienen kaum übertreffbar. Die Eigenschaften der etwas mehr als meterhohen Pflanzen sind aber durch spätere Sorten längst überholt. So ist sie ein Kleinod für hingebungsvolle Liebhaber.
Vielblumige, etwa tischhoch und kompakt wachsende Rosen, die mehrmals im Jahr blühen, wie die bezaubernde, leicht duftende ‘Katharina Zeimet’ von Peter Lambert aus dem Jahr 1901, konnten in Europa erst seit der Einführung asiatischer Arten entwickelt werden. Man nannte diese neue Rosenklasse „Polyantha-Rosen“.
Die aus Japan und Korea stammende Rosa lucieae, besser bekannt unter ihrem nicht mehr gültigen Namen Rosa wichuraiana, führte zu neuartigen Kletterrosenzüchtungen. Eine der ersten öfterblühenden davon ist die weltweit berühmte ‘New Dawn’ (Somerset Nurseries, 1930), die als erste Rosensorte mit einem patentierten Warenzeichen angemeldet wurde. Sie hat nichts von ihrem Zauber eingebüßt.
Bei der Zuordnung einer Rosensorte zu „Alten Rosen“ oder „Neuen Rosen“ einer Rosenklasse gilt nicht der Zeitpunkt der Züchtung einer Sorte, sondern die Zugehörigkeit zur entsprechenden Klasse. ‘Scharlachglut’ von Kordes aus dem Jahr 1952 etwa stammt von einer Tee-Hybride und einer Gallica-Rose ab und wird den Gallica-Rosen zugeordnet, obwohl ihr strahlend warm-roter Farbton die Einflüsse Moderner Rosen verrät. Ganz seltsam wird das Geschehen, wenn man sich den Moschata-Rosen zuwendet. In ihrer Feinheit wirken sie herrlich nostalgisch und doch gehören sie zu den Modernen Rosen.
Während die Klasseneinteilung Alter Rosen beibehalten wurde, straffte man die Einteilung fast aller Modernen Rosen Ende des 20. Jahrhunderts zumindest in Deutschland in fünf Klassen.
‘Circle of Life’ ist eine leicht duftende, recht neue Strauchrose von Tantau. Diese 2020 veröffentlichte Schönheit vereinigt das Beste der modernen, aus asiatischen Arten hervorgegangen Sorten – Blattgesundheit, Dauerblüte, Wetterfestigkeit, einen besonders attraktiven Honiggelb-Ton – mit dem Blütenlook europäischer Rosenklassen, die man auch „Alte Rosen“ nennt.
Die fünf Hauptgruppen öfterblühender Moderner Rosen in Deutschland lauten darum offiziell:
Moderne Kletterrosen (wachsen über 2 Meter hoch und müssen grundsätzlich aufgebunden werden),
Moderne Strauchrosen (erreichen Wuchshöhen zwischen 120 und 180 cm),
Edelrosen (bilden straffe Triebe mit großen Einzelblüten aus und werden zwischen 50 und 150 cm hoch),
Beetrosen (bilden straffe Triebe mit Büscheln aus einigen bis vielen Blüten und erreichen eine Höhe zwischen 50 und 100 cm),
Kleinstrauch- oder „Bodendeckerrosen“ (haben eher kleine Blüten in großen Blütenständen und schwanken in der Höhe zwischen 60 und 120 cm).
Das alles sind nur grobe Einteilungen und kann allenthalben zur allerersten Orientierung dienen. Die Vielfalt innerhalb jeder Rosenklasse ist ebenfalls dermaßen groß, dass man immer die jeweilige Sorte genau anschauen muss, um beurteilen zu können, ob sie sich für die vorgesehenen Zwecke auch wirklich eignet.
ROSENMODEN ÄNDERN SICH
In der Antike waren Rosen Lieferanten von Duftöl, Kopfkränzen und Dekorationen. Zur Verfügung standen etwa Rosa gallica, Alba- und Damaszener-Rosen. Sehr begehrt waren Auslesen mit vielen Blütenblättern. Die wurden auch gebraucht, wenn es darum ging, Rosenblütenblätter bei römischen Gelagen von der Decke regnen zu lassen.
Weit strenger hielten es die Rosenfreunde im christlich geprägten Mittelalter des Abendlandes. In (Kloster-) Gärten musste die Rose ihren Nutzen erweisen. Man entdeckte auch ihre außergewöhnliche Schönheit wieder. Rosen wurden zum göttlichen Symbol und Maria, Jesu Mutter, zugeeignet. Rosenkränze waren anfangs aus Rosenblüten oder Kugeln aus Blütenblättern gefertigt.
Im Zeitalter des Barock wurde ein gepflegter Schlossgarten zum Statussymbol herrschender Fürsten. Das wertete auch die Pflanzen auf, die darin kultiviert wurden, und es begann ein Wettlauf nach dem Besseren, Ungewöhnlicheren und Exotischeren. Rosen konnten gar nicht groß genug sein und eine üppige Füllung war gefragt. Zentifolien kamen auf und die daraus abgeleiteten Moos-Rosen brachten das gewünschte Quantum Skurrilität mit.
‘Gloria Dei’ ist in vielerlei Hinsicht eine Historische Rose, wenn auch keine Alte. Sie hat nicht nur das Züchtungsgeschehen stark beeinflusst, sondern hat auch eine bewegte Geschichte. Entstanden ist sie kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in Frankreich; als Einführungsjahr hat der Züchter Meilland 1945 angegeben. Diese Sorte gilt als die am meisten verkaufte Gartenrose aller Zeiten. Wer sie pflanzen will, sollte sich darüber im Klaren sein, dass sie viel von ihrer legendären Gesundheit eingebüßt hat und sich zuweilen sehr schwer etabliert. Sie ist etwas für echte Liebhaber.
Alt oder Historisch?
Oft werden diese Begriffe synonym verwendet. Doch das ist genau genommen falsch. Alte Rosen gehören zu den Rosenklassen, die es bereits vor den Tee-Hybriden 1867 gab.
Historische Rosen sind aber diejenigen, die in irgendeiner Weise in der Geschichte in Erscheinung getreten sind. Sei es, weil sie sehr früh erwähnt wurden, etwa die Gallica-Rose ‘Officinalis’, oder weil sie in der Kunst eine erkennbare Rolle gespielt haben. So regnen beispielsweise bei Botticellis Gemälde „Geburt der Venus“ die Alba-Rosen ‘Semiplena’ auf die makellos schöne Göttin.
Daneben haben aber auch einige Rosen bei der Entwicklung des Sortimentes einen enormen Einfluss genommen, sodass sie in der Rosenwelt als historisch gelten. Historisch ist etwa die legendäre gelbe ‘Gloria Dei’ von Meilland, die der Züchtung der Edelrosen einen neuen Schub gegeben hat, oder die dunkel-zinnoberrote ‘Baccara’ desselben Züchterhauses, die Maßstäbe für Treibhausrosen setzte.
Die Gründerzeit ab Mitte des 19. Jahrhunderts war die hohe Zeit der Remontant-Rosen. Sie stellten besonders durch ihre wiederholte Blüte alles andere in den Schatten. Wer es sich leisten konnte und ein Gewächshaus besaß, versuchte mit Tee- und Noisette-Rosen sein Glück.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts waren Polyantha- und Moschata-Rosen in Bosketts oder öffentlichen Gärten sehr beliebt. Tee-Hybriden wurden zur wichtigen Rosenklasse, denn Hobby-Gärtner entdeckten sie für ihren privaten Bereich.
Das änderte sich, als David Austin im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts seine Sorten einführte und damit genau den Zeitgeschmack traf. Tee-Hybriden etwa waren für viele Gartenfreunde zur kalten Pracht geworden, Austin stillte die Sehnsucht nach der „guten alten Zeit“.
Im ausgehenden 20. Jahrhundert hielten „Bodendeckerrosen“ mit dem wachsenden ökologischen Bewusstsein in den Gärten Einzug. Man war nicht mehr bereit, gegen Pilzbefall zu spritzen. Bei den „Bodendeckern“, die auch als „Kleinstrauchrosen“ bekannt wurden, gab es krankheitsfeste Sorten. Mit ‘Heidetraum’ lässt sich diese Entwicklung markieren; sie begründete den Ruhm der Gütersloher Rosenschule Noack. Das beginnende dritte Jahrtausend beschert uns schon die Weiterentwicklung öfterblühender Rambler und neuartige Rosenblüten: Die Persica-Hybriden mit ihrem exotischen Basalring.
Eine Züchtungslinie, die erst seit dem 21. Jahrhundert Aufsehen erregt, besteht aus Züchtungen aus Rosa persica: den „Persica-Hybriden“. Sie sind leicht erkennbar an dem dunklen Ring an der Blütenbasis als markantes Erbe der Wildart. Die halbmeterhohe ‘Bravo Babylon Eyes’ (Interplant, 2019) ist ein vorzügliches Beispiel der vielen gesunden Sorten.
Englische Rosen und ihr Boom
Der Brite David Austin löste Ende des vergangenen Jahrhunderts durch seine markanten Züchtungen eine Bewegung in der Rosenwelt aus, die bis heute anhält. Seine Sorten sind als „Englische Rosen“ populär geworden. Das ist jedoch zu eng gedacht, denn aus England stammen auch viele wertvolle Sorten anderer Züchter, die völlig anders aussehen. Genauer wäre die Bezeichnung „Austin-Rosen“. Austin verband den Duft und die kugeligen Blütenformen Alter Rosen mit der Dauerblüte und dem Farbenreichtum Moderner Rosen. Hinzu kam sein Ehrgeiz, besonders ästhetische Strauchformen zu erzielen. So inspirierte er weltweit viele Züchterhäuser, ähnliche Rosen zu entwickeln. Diese Sortenlinien bekamen eigene Namen. Bei Kordes heißen sie „Märchenrosen“, bei Meilland „Romantica“ und bei Tantau „Nostalgie-Rosen“. Das alles sind keine offiziellen Rosenklassen – genauso wenig wie die „Englischen Rosen“. Es handelt sich grundsätzlich um moderne Sorten, deren Blüten einen „alten Look“ haben.
DER CHARME DER WILDEN
Neben der furiosen Entwicklung von Gartenrosen haben Wildarten nichts von ihrer Ausstrahlung verloren. Besonders in naturnahen Gärten werden sie zu Juwelen. Die meisten Wildrosen wachsen übermannshoch und eröffnen mit ihren einfachen Blüten das alljährliche Kalendertor zum Sommer.
Doch das ist längst nicht alles, womit wilde Rosenarten auch im Garten punkten. Die meisten von ihnen wachsen kraftvoll und völlig problemlos. Krankheitsbefall tritt grundsätzlich nur auf, wenn die Bedingungen nicht rosengeeignet sind. Mit dem robusten Wachstum geht auch ein gewisser Ausbreitungsgang einher. Viele Arten schicken Wurzelausläufer durch den Boden und sorgen so für identischen Nachwuchs.
Die Blüten ziehen bestäubende Insekten an. Der Bestäubungserfolg zeigt sich in zahlreichen Hagebutten, die gern von Vögeln gefressen werden. Diese scheiden den Samen der Früchte wieder aus, der an einigermaßen geeigneten Stellen keimen wird. Das ist die natürliche Art der Vermehrung und Verbreitung der Rosen. Ohne den Umweg durch einen Vogelkörper werden Wildrosen – auch die für Gärten – grundsätzlich ausgesät.
Wildrosen eignen sich kaum für kleine Vorgärten oder Prachtrabatten. Eine gewisse Vorsicht ist bei den meisten Arten zudem angesagt, denn sehr oft haben die Wildarten zahlreiche spitze Stacheln. Darum fallen auch Standorte, an denen ein Weg vorbei führt, grundsätzlich aus.
Den großen Auftritt haben die wilden Verwandten und Ahnen unserer Gartenrosen in kleineren und mittelgroßen Gärten als Heckenpflanzen. Sie werden mit den Jahren so dicht, dass nicht einmal eine Katze dort hindurch schleichen kann. In größeren Gärten können Wildrosen zusätzlich als Einzelpflanzen oder kleine Gruppen inmitten einer extensiven, mittelhohen Pflanzung brillieren.
Die völlig winterharte chinesische Goldrose, Rosa hugonis, kam Anfang des 19. Jahrhunderts in Europas Gärten und war eine der damals sehr seltenen gelb blühenden Rosen. Die exquisiten Blüten erscheinen oft schon im April über sehr fein gefiedertem Laub auf etwas sparrigem, stark bestachelten Triebwerk – was für ein Kontrast! Diese außergewöhnlichen Wildrose bildet im Herbst kleine, fast schwarze Hagebutten aus.
Eine der wichtigsten Stammformen europäischer Gartenrosen ist die Essig-Rose (Rosa gallica). Ihre hohe Selektion ‘Complicata’ hat sich sehr viel vom Charakter der Ausgangsart bewahrt. Die großen, aufrecht gehaltenen Blüten sind definitiv nicht nur als unsterbliche Rosen-Antiquität gartenwürdig, sondern erfüllen auch handfeste gärtnerische Anforderungen, etwa in einer Heckenpflanzung.
Wildrose ist freilich nicht gleich Wildrose. Für Gärten nördlich der Alpen liegt es nahe, neben heimischen Arten weitere Rosen auszuwählen, die eine ausreichende Winterhärte mitbringen. Unkomplizierte Rosenarten aus Asien sind beispielsweise die Kartoffel- oder Apfel-Rose (Rosa rugosa), die Vielblumige Rose (Rosa multiflora), die Moschus-Rose (Rosa moschata) sowie die Mandarin-Rose (Rosa moyesii) und die Chinesische Gold-Rose (Rosa hugonis). Aus dem nordamerikanischen Kontinent stammen die etwa 150 Zentimeter hohe Sand-Rose (Rosa carolina) und die nicht einmal meterhohe Glanz-Rose (Rosa nitida). Beide eignen sich bestens auch für kleine Gärten. Sehr reizvoll ist die ebenfalls wildhaft anmutende, meterhohe Kreuzung von Rosa nitida mit Rosa rugosa, die als Glanz-Apfel-Rose Rosa × rugotida im Handel ist.
Reine Stilsache
Wilde Rosen müssen genauso sorgfältig in den Garten eingegliedert werden wie jede andere Rosensorte auch. Inmitten von Prachtstauden wirken sie „underdressed“ und können ihre Reize schwerlich ausspielen. Es kommen aber nicht allein heimische Wildpflanzen als Begleiter in Frage. Die Nachbarschaft zu einem Kräuterbeet kommt da wie gerufen. Die meisten Kräuter entwickeln ebenfalls feine Blüten, die nicht mit den Wildrosen konkurrieren. Wildrosen im Obstgarten sind ebenfalls eine stimmige Idee – vielleicht sogar um Hagebutten zu ernten. Und mit den asiatischen Arten, etwa der Mandarin-Rose, können sogar fernöstliche Gartenbilder mit Fächerahorn, Bambus und Zierkirschen als Leitpflanzen auf rosige Weise komplettiert werden.
Ein fast vergessener ungemein feiner Gartenschatz ist die Strauchrose ‘Golden Wings’ (Shepherd, 1956). Die Knospen blühen auf den gesunden Sträucher den ganzen Sommer hindurch leuchtend gelb auf und die Blüten verblassen stets am ersten Mittag in der Sonne zu einem nicht weniger reizvollem zarten Gelbton, der die rötlichen Staubgefäße umso schöner hervorhebt.
MANNIGFALTIGE BLÜTENFORMEN
Schon allein die Anzahl der Blütenblätter der Rosen variiert stark. Einfache Blüten haben fünf davon. Die Zahl kann bei Züchtungen aber durchaus dreistellig werden. Hinzu kommt die Haltung der Blütenblätter. So ergeben sich sehr viele Formen der Blüte, die grob in Kategorien eingeteilt werden können.
Der Blütenbau der Rose leitet sich von den Wildrosen ab – bei ihnen lässt er sich sehr klar erkennen; das vorangegangene Bild der ‘Golden Wings’ zeigt das ganz gut. Im Zentrum befinden sich die Fruchtblätter mit den Griffeln. Sie sind der weibliche Teil der Blüte und stehen in einer Gruppe von 10 bis etwa 50 Stück, selten mehr, zusammen. Um sie herum ordnen sich kreisförmig die männlichen, pollenreichen Staubblätter an. Ihre Zahl schwankt meist zwischen 40 und 200. Griffel und Staubgefäße sind von den großen, leuchtend gefärbten Kronblättern (= Petalen) umgeben. Fast alle Wildrosen haben fünf Petalen; sie schließen sich mehr oder weniger lückenlos zu einer Schale zusammen.
Der geschlossene Blütenbecher der Rosenblüte befindet sich unter diesen drei Blütenorganen. Hier fußen die Griffel und es reifen nach der Befruchtung im Verborgenen die Samen. Der Blütenbecher wächst sich bei zunehmender Reife zur Hagebuttenfrucht aus. Aus dem Blütenbecher entspringen auch die Hüllblätter der Rosen. Meist sind es ebenfalls fünf Stück, die eine rosentypische, etwas dreieckige Form haben. Während des Knospenwachstums schützen sie die zarten Petalen, Staubblätter und Fruchtblätter. Von Hüllblättern umschlossene Rosenknospen sind rund bis eiförmig mit einem spitzen Zipfel. Wird die Rosenknospe in Sortenporträts beschrieben, meint man das Stadium, in dem sich die Hüllblätter abgespreizt oder völlig umgebogen haben, die Kronblätter sich bereits in ihrer Farbe zeigen und die äußersten von ihnen sich schon lösen.
Die Blütenform einer Rosensorte wird anhand ihrer offenen Blüte bestimmt. Sehr reizvoll sind dabei Übergänge zwischen den Blütenstadien. Ich staune beispielsweise immer wieder, wie hoch die Knospe von ‘Graciosa’ gebaut ist, und wie vollgefüllt schalen- bis ballförmig sich die Blüte zeigt. Die Kategorisierung ist, wie alle Versuche, etwas Natürliches einzugruppieren, ein grobes Raster. Die Grenzen sind fließend. In nahezu allen Rosenklassen finden sich nahezu alle Blütenformen.
Der Bau der einfachen Rosenblüten wurde im vorigen Kapitel bereits durch Fotos veranschaulicht. Eine Rose gilt als einfach blühend, wenn sie einen Kranz von Kronblättern ausbildet. Ein wenig Spielraum in der Anzahl der Blütenblätter wird hier gelassen. Meist sind es tatsächlich wie bei der Urform der Rosenblüte fünf Stück; aber es dürfen bis zu zehn werden, um noch eine einfach blühende Rose zu definieren.
Illustre Verwandte
Der Bau der Blüte ist für die Botaniker das Kriterium, die Verwandtschaft von Pflanzen zu bestimmen. Die Gliederung in das namensgebende Pflanzensystem fußt genau darauf. Pflanzenfamilien, Pflanzengattungen und einzelne Arten sind drei unterschiedliche Stufen in dieser Nomenklatur. Rosen sind Namensgeber einer ganzen botanischen Familie: die Rosengewächse. Zu ihr gehören nicht nur alle Gewächse, die der Gattung Rosa zugeordnet werden. Weitere Gattungen der Familie der Rosengewächse sind so wichtige Nutzpflanzen wie Him- und Brombeeren (Rubus), Apfel (Malus), Birne (Pyrus), Mandel und Kirsche (Prunus) oder die Erdbeere (Fragaria). Auch staudig wachsende Zierpflanzen finden sich, denn Frauenmantel (Alchemilla), Fingerkräuter (Potentilla), Nelkenwurz (Geum) und Geißbart (Aruncus) zählen ebenfalls zur Verwandtschaft. Allen gemeinsam ist das Prinzip des Blütenbaus, wobei sich hinsichtlich der konkreten Ausformung der Blütenorgane und ihrer Größe erhebliche Abweichung erkennen lassen.
Halb gefüllte Blüte: Die 10 bis 20 Blütenblätter ordnen sich zu einer zwei- bis dreireihigen Schalenform an und präsentieren reichlich Staubgefäße, die Insekten mit Pollen nähren. Die allermeisten Rosen mit dieser Blütenform bilden viele Hagebutten. Die Blütenblätter können leicht gewellt oder herzförmig eingekerbt sein, die Petalen unterschiedliche Farbzonen oder farblich kontrastierende Staubgefäße haben. Locker gefüllte Blüten haben zwischen 20 und 30 Blütenblätter. Schöne Beispiele sind: ‘Semiplena’ (Alba-Rose), ‘Versicolor’ (Gallica-Rose), ‘Rambling Rector’ (einmal blühender Rambler), ‘The Lark Ascending’ (öfter blühende Strauchrose), ‘Maigold’ („Frühlingsrose“), ‘Darling’ (Beetrose).
Edelrosenförmige Blüte: Die Knospen sind eher schmal und die Blütenblätter ordnen sich zu einem hoch gebauten Zentrum an. Gelegentlich schlagen sie sich um, sodass einzelne Blütenblätter eine Spitze formen und eine sternförmige Blüte bilden. Blüten mit außen und innen unterschiedlich gefärbten Petalen behalten diesen Farbeffekt lange bei. Schöne Beispiele sind: ‘Better Times’ (Edelrose), ‘Vedette’ (Edelrose), ‘Perle d’Or’ (China-Rose), ‘Super Trouper’ (Beetrose), ‘Maréchal Niel’ (Noisette-Rose) ‘Climbing Lady Hillingdon’ (Climbing Sport), ‘Alaska’ (öfter blühende Kletterrose).
Schalenförmige Blüte: Die Blütenform ist rund und die Größe der Blütenblätter nimmt von außen nach innen nach und nach ab. Die Anzahl der Blütenblätter variiert. Schon halb gefüllte Blüten bilden oftmals Schalen. Komplett geöffnete Blüten tragen entweder in ihrer Mitte oder zwischen den kleinsten Blütenblättern Staubgefäße. Sanfte Farbverläufe auf den Blütenblättern wirken hier besonders stimmig, oft verdichtet sich ein Farbton von außen nach innen. Schöne Beispiele sind: ‘Desdemona’ (Strauchrose), ‘Voyage’ (Edelrose), ‘Novalis’ (Strauchrose), ‘The Ancient Mariner’ (Strauchrose), ‘Ferdinand Pichard’ (Remontant-Rose).
Ballförmige Blüte: Das ist eine Steigerung der schalenförmigen Blüte. Hier wölben sich die Blütenblätter wie eine Kuppel über das Zentrum, sodass sich das Blüteninnere sehr spät offenbart. Äußere konkav ausgerichtete Blütenblätter umschließen die Blüte lange. Fast immer sind ballförmige Blüten stark gefüllt. Schöne Beispiele sind: ‘Belkanto’ (Kletterrose), ‘Artemis’ (Strauchrose), ‘Madame Plantier’ (einmal blühende Kletterrose), ‘Nautica’ (Beetrose), ‘Roald Dahl’ (Strauchrose).
Rosettenförmige Blüte: Sehr stark gefüllte Blüten bilden oft am Rand etwas größere Blütenblätter. Die Blüten öffnen sich zuerst schalen- oder ballförmig, doch dann breiten sich die äußeren Petalen waagerecht aus oder neigen sich nach hinten und die dichte Rosette aus kleineren Petalen offenbart sich. Durch die relativ flache Blütenform kann Regenwasser schnell abfließen. Gelegentlich bilden die innersten, kurzen Blütenblätter ein Knopfauge in der Mitte oder ordnen sich zu vier kleinen, bohnenförmigen Zentren an, die sich als Viertelung mittig treffen. Schöne Beispiele sind: ‘Jacques Cartier’ (Portland-Rose), ‘Tranquility’ (Strauchrose), ‘Domaine de Chantilly’ (Strauchrose), ‘Dame Judi Dench’ (Strauchrose).
Pompon-Blüte: Die mehr oder weniger dicht gefüllten Blüten lassen durch die waagerechte Haltung der Petalen Wasser ebenfalls gut ablaufen. Alle Blütenblätter liegen ziegelartig regelmäßig übereinander. Die äußeren von ihnen sind kleiner als bei rosettenförmigen Blüten – alle Blütenblätter wirken mehr oder weniger „gleichberechtigt“. So entsteht ein Blütengebilde, das auf den ersten Blick konstruiert wirkt. Schöne Beispiele sind: ‘Rose de Resht’ (Damaszener-Rose), ‘Charles de Mills’ (Gallica-Rose), ‘Crimson Siluetta’ (Rambler), ‘The Fairy’ (Polyantha-Rose).
WIE ZEIGEN SICH DIE BLÜTEN?
Nicht allein die Form einer Rosenblüte bestimmt neben der Wuchsform die Wirkung der Pflanze. Es ist ein gravierender Unterschied, ob die Sträucher einzelne große Blüten hervorbringen ober ob viele kleine Blüten in Büscheln zusammenstehen. Mit dieser Vielfalt lassen sich Rosengärten sehr abwechslungsreich gestalten.
Wer in einem Blumenladen Rosen aussucht, wird in erster Linie einzelne große Blüten auf festen langen Stielen vorfinden. Hier handelt es sich um Edelrosen und das Bild einer Rose ist bei vielen Menschen so geprägt: Ein Stiel, eine Blüte. Für den Anbau von Schnittrosen ergibt das Sinn. Diese Form der Rose lässt sich nicht nur floristisch gut verarbeiten, sondern auch vergleichsweise leicht ernten, für den Handel bündeln, lagern, transportieren, nach der Lieferung anschneiden und im Verkaufsraum präsentieren. Hin und wieder finden sich aber auch Sorten, die mehrere Blüten pro Stiel tragen. Für den kommerziellen Blumenhandel kommen da nur wenige Sorten in Frage. Das Problem ist nämlich, dass sich meist zuerst die mittlere Blüte eines Blütenstandes öffnet und die noch geschlossenen Knospen etwa eine Woche brauchen, bis sie aufblühen. Nur Sorten mit ungewöhnlich langer Haltbarkeit, bei denen mehrere Blüten gleichzeitig pro Büschel blühen, bringen den gewünschten Effekt. Im Garten ist die Situation völlig anders. Hier sollen Rosen nicht nur durch die einzelne Blüte begeistern, sondern auch für Farbe sorgen. Selbst Edelrosen dürfen dann gerne Stiele mit mehreren Blüten entwickeln. Bei allen anderen Rosenklassen sind auch deutlich mehr Blüten pro Trieb willkommen. Hier können zuweilen weit über 20 Blüten zusammenstehen. Fast immer blüht dabei ebenfalls eine erste Knospe auf, die von den jüngeren Knospen umgeben ist.
Die stark duftende Züchtung ‘Gertrud Fehrle’ von Schultheis aus dem Jahr 2011 bildet vorwiegend einzeln stehende, sehr große Blüten aus, die sich edelrosenartig öffnen. Mit ihrer Höhe von über 1,5 Metern gilt sie als Strauchrose, doch sie hat definitiv auch das Flair einer besonders üppig wachsenden Edelrose. Manchmal sind die schwer zu kategorisierenden Rosen auch die interessantesten.
Das Züchterhaus Tantau stellte 2019 die Beetrose ‘Theodor Fontane Rose’ der Öffentlichkeit vor. Sie ist ein wunderbares Beispiel, das in der einstigen „Problemfarbe Orange“ für die Züchtung nun ausgezeichnet gesunde, farbkonstante Sorten entwickelt wurden. Die Blüten stehen in kleinen und großen Büscheln zusammen und sind einzeln ungewöhnlich schön und gemeinsam ein fantastischer Farbeffekt.
Bei dieser Aufnahme schwankten wir schon beim Fotografieren, ob wir die auf dem Schild ausgewiesene ‘Mademoiselle Cécile Brunner’ als ausgesprochen gut gepflegte Buschform oder ihre kletternde Mutation vor uns haben. Die Buschform ist eine China- oder Polyantha-Rose, die vom französischen Züchter Ducher 1881 eingeführt wurde. Die Zahl der Knospen pro Trieb geht in die Hunderte und die Blütezeit eines Triebes allein zieht sich über Wochen hin.
Die Kombination von großblumigen, eher einzeln oder zu wenigen zusammenstehenden Rosenblüten mit kleinen, büschelblumigen Rosen, verleiht einem Garten einen besonderen Reiz. Gerade die unterschiedlichen Charaktere verschiedener Rosen ergänzen und steigern sich in ihrer Wirkung. Will man Rosen zu anderen Pflanzen kombinieren, geht man ähnlich vor. Zu großblumigen Sorten stehen sehr gut feinteilige Staudenpartner wie Schleierkraut (Gypsophila), Purpurglöckchen (Heuchera) oder Prachtkerzen (Gaura). Je mehr Blüten beisammenstehen, desto stärker wird ihre Farbwirkung. Solche Rosen nehmen es auch mit Prachtstauden wie Rittersporn (Delphinium), Indianernesseln (Monarda) oder Lupinen (Lupinus) auf.
Die stark und typisch rosig duftende Strauchrose ‘Soul’, die Tantau 2014 veröffentlichte, gehört zu den besten Neuheiten der letzten 20 Jahre. Ihre rote Farbe spielt zwar ins Purpur, ist aber weder zu blass noch zu bläulich, um als Zwischenton abgetan zu werden. Derart duftstarke und gleichzeitig gesund belaubte, rot blühende Rosen sind noch immer nicht alltäglich. Bei guten Bedingungen eignet sich ‘Soul’ sogar als moderat hohe Kletterrose.
Auf einem Stamm veredelt zeigt sich die Wuchsform einer Rosensorte sehr deutlich. ‘Bienenweide mango’ von Tantau aus dem Jahr 2021 bringt ihre kugeligen, zweifarbigen Blüten auf geschlossen und gleichmäßig wachsenden, eher breiten als hohen Büschen hervor.
„WER NUR DIE BLÜTE SIEHT …
…verpasst die halbe Schönheit“. Ich zitiere sehr gerne dieses Credo begabter Floristen, denn es lässt sich voll und ganz auch auf Gartenpflanzen wie Rosen beziehen. Das erste, was wir im Garten von einer Rose wahrnehmen, ist ihre Wuchsform und Größe. Die erheblichen Unterschiede lassen es zu, dass Rosen nahezu überall gestalterisch eine Rolle spielen können.
In den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts bin ich als Jugendlicher mit Gartenrosen aufgewachsen. Die Gärten meines westfälischen Heimatstädchens Harsewinkel waren voll von ihnen – genauer gesagt mit Beetrosen und Edelrosen. Gelegentlich fanden sich auch Strauchrosen und großblumige Kletterrosen. Abgesehen von Kletterrosen, die fast immer an einer Hauswand standen, wuchsen fast alle Sorten buschigaufrecht und wurden zwischen 70 und 170 Zentimeter hoch. Ich hielt das für rosentypisch.
Doch die Vielfalt der Wuchsformen von Rosen ist weit größer, als es eine Kleinstadt der Provinz damals spiegeln konnte. Nach und nach lernte ich mehr davon kennen. Es war ja die Zeit, in der Alte Rosen langsam wieder stärker ins Bewusstsein traten. Viele von ihnen wachsen raumgreifend ausladend mit zuweilen malerisch bogig überhängenden Zweigen, an denen sich Blüten wie an einer Perlenschnur aufreihen. Das erste Mal, als ich einen knapp zehn Meter hohen Rambler in Vollblüte mit einem Baum als Stütze gesehen hatte, war eine Offenbarung für mich. In Mode kamen zudem die sogenannten Englischen Rosen, die einen besonders runden, gefälligen Wuchs hatten. Außerdem setzte sich die Gruppe der „Bodendecker-“ oder „Kleinstrauchrosen“ durch, die um 70 Zentimeter hoch wachsen, aber ebenfalls ausschwingende Triebe ausbilden. Das Züchterhaus Noack, das wesentlich diese Sortengruppe prägte, lag nicht einmal 20 km von uns entfernt – in Gütersloh.
Schaut man erst einmal aufmerksam auf die grundsätzlichen Unterschiede der Wuchsformen der Rose, schärft sich der Blick für Feinheiten, die viele Sorten unverwechselbar machen. So stehen die großen Blütenbüschel von ‘Little White Pet’ oder ‘Mademoiselle Cécile Brunner’ auf aufrecht wachsenden Trieben, setzen aber weit unten schon nach drei oder vier Blättern an. Die Verzweigungen der Blütenbüschel machen so den eher steifen Wuchs gefälliger. Ähnlich verhält es sich bei kletternden Rosen. Während Rambler oder Abkömmlinge von Rosa lucieae eher geschmeidige Triebe ausbilden, wachsen Kletterrosen mit einer Herkunft von Strauch- oder Edelrosen straffer und müssen mit Fingerspitzengefühl ausgerichtet werden. Das mag alles kompliziert klingen, soll aber nichts anderes sein als eine Einladung, sich jede Sorte genau anzuschauen und ihre Eigenart kennenzulernen. Nicht nur die Blüte, sondern ihr Zusammenspiel mit der Wuchsform und Höhe der Sträucher macht den Charakter einer Sorte aus und lässt sie zu einer echten Pflanzenpersönlichkeit werden – unterscheidbar und gerade darum besonders liebenswert.
Wuchsform 1: niederliegend Die Pflanze besteht aus langen, laxen Trieben, die sich mehr oder weniger waagerecht ausrichten. Je waagerechter sie werden, desto mehr Seitentriebe können sich im folgenden Flor bilden. Die untersten von ihnen liegen fast am Boden auf; obere schwingen mehr oder weniger frei darüber.Typisch für … „Bodendecker-“ bzw. „Kleinstrauchrosen“. Auch Rambler und Kletterrosen wachsen so, falls sie keine Stützen finden. Die langen, biegsamen Triebe können leicht geleitet werden. Auf Stamm veredelt werden Rosen mit dieser Wuchsform zu fontänenartig schwingenden Kaskaden. Auf Mauerkronen oder in Gefäßen überspielen die hängenden Triebe die Kanten von Steinen und Töpfen.
Wuchsform 2: straff aufrecht Das Triebwerk strebt klar nach oben. Blüten finden sich nur in ihren oberen Zonen. Je höher die Blütenzone ansetzt, desto strenger und formaler wirken die Sträucher. Blüten werden aufrecht stehend präsentiert und stehen in den meisten Fällen frei über dem Laub.Typisch für … die meisten Edelrosen und viele Beetrosen. Auch einige Strauchrosen wachsen in dieser Weise. Es wäre viel zu kurz gedacht, sie ausschließlich als Lieferanten von Schnittrosen oder als Farbeffekte einzusetzen. Gruppenweise gepflanzt wirken sie in formalen Gartenplätzen, als Begleiter von Wegen oder flankiert von niedrigeren Hecken oder Einfassungspflanzen gerade durch ihre gewisse Distanziertheit unschlagbar elegant.
Wuchsform 3: buschig Alle Triebe ordnen sich korbartig an und streben sowohl nach oben wie aus dem Strauch heraus zum Licht. Die Blüten erscheinen auch stets an den Enden der Triebe, setzen aber unterschiedlich hoch an, sodass sich auch seitlich Farbe zeigt.Typisch für … einige Edelrosen, viele Beet- und Strauchrosen. Jede Sorte solcher Wuchsform kann bereits als einzelne Pflanze bestens wirken, wenn ihre Dimension zur Beetgröße passt. Gegen eine Gruppenpflanzung ist ebenfalls nichts einzuwenden. Außerdem zeigen sie den harmonischen Wuchs ausgezeichnet, wenn sie auf Stamm veredelt sind.
Wuchsform 4: hoch wachsend, überhängend Zunächst wachsen die Triebe klar aufrecht. Dann neigen sie sich ab etwa der oberen Hälfte oder dem oberen Drittel, dort wo sich die Blüten bilden, mehr oder weniger stark über. Je ausgeprägter diese Zone ist, desto opulenter und ausladender werden die Sträucher.Typisch für … viele Strauchrosen und Kletterrosen. Ob die Pflanzen frei stehen können, hängt von der Höhe und der Stabilität der Triebe der einzelnen Sorte ab. Sollte die Statik nicht reichen, können sie bis etwa zur Hälfte gestützt werden. Moderne Kletterrosen bilden dermaßen lange Triebe aus, dass sie sich bestens zur Fixierung an Wandgerüsten und Bögen eignen.
FEINE FRÜCHTCHEN UND SPITZE STACHELN
Wer das Lied „ein Männlein steht im Walde“ kennt, weiß, dass sich das gesungene Rätsel als Hagebutte auflöst. Leider bringt uns der populäre Reim auf die falsche Fährte, denn Hagebutten wachsen nicht im Wald, sondern am Waldrand als Ergebnis anmutiger Rosenblüten und der kooperativen Arbeit bestäubender Insekten.
Das sind die Hagebutten aus dem Kinderlied! Sie werden von der Hunds-Rose Rosa canina hervorgebracht und halten etwa bis zum Frost.
Kleine, etwa erbsengroße, runde Hagebutten finden sich in Massen etwa bei der vielblumigen Rosa multiflora und der abgebildeten Rosa helenae.
Bei der Hecht-Rose Rosa glauca heben sich die leuchtenden Hagebutten von dem blaugrünen Laub besonders gut ab.
Und dieses Ergebnis, das man auch unter dem Namen „Hägen“ oder „Hiften“ kennt, kann sich in jeder Hinsicht wahrlich sehen lassen! Die heimische, weit verbreitete Hunds-Rose (Rosa canina) gibt den Prototyp einer Hagebutte vor: signalrot, oval bis birnenförmig, mit einer schwarzen Kappe und etwa drei Zentimeter lang. Sie reifen etwa im Spätsommer und bei heimischen Wildarten schrumpeln die Früchte, noch ehe die ersten Fröste den Winter ankündigen. Abweichend von dieser bekannten Hagebuttenform überraschen weitere Arten mit anderen Farben, Formen und Größen ihrer Früchte.